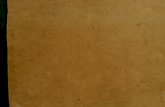Die Industrie der Riechstoffe im 19. Jahrhundert - Gesellschaft ...
‚Die Entwicklung erster Hochkulturen im Alten Orient’ bis ‚Die Sasaniden – Roms Konkurrenz...
-
Upload
mkg-hamburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ‚Die Entwicklung erster Hochkulturen im Alten Orient’ bis ‚Die Sasaniden – Roms Konkurrenz...
OB
JEK
TE
ERZ
ÄH
LEN
G
ESC
HIC
HT
ED
IE S
AM
MLU
NG
DES
MU
SEU
MS
FÜR
KU
NST
U
ND
GEW
ERB
E H
AM
BU
RG
Herausgegeben von
Sabine Schulze Silke Oldenburg Manuela van Rossem
Ermöglicht durch die Justus Brinckmann Gesellschaft. Freunde des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg
INH
ALT
4 000 JAHRE KREATIVITÄT – EIN PROLOG 12
DIE WIEGE DER ZIVILISATION 16Vom Acker zur Schrift – Die Entwicklung
erster Hochkulturen im Alten Orient · 18
DER WEG ZUR HOCHKULTUR 24Wie der Nil die Weltordnung der Ägypter prägt · 26
Religion gibt Regeln für das Miteinander vor · 3o
Helden und Heroen schreiben Geschichte · 34
Bürger bestimmen Politik · 36
Das Eigene und das Fremde – Identität verlangt Abgrenzung · 4o
Sport – Training für den Ernstfall · 44
Seefahrer und Händler verbreiten Waren und Wissen · 48
Das rechte Maß – Schönheit als Tugend · 52
Das Gewand als Botschaft · 56
Was nach dem Leben kommt · 6o
DIE GROSSEN IMPERIEN 66Alexander der Große und das erste Weltreich · 68
Charakter im Porträt · 72
Die Sasaniden – Roms Konkurrenz im Osten · 76
Die Seidenstraße – Netzwerk der Kulturen · 8o
ZURÜCK ZUR NATUR 190 Die Entdeckung der Psyche · 192
Fernöstliche Inspiration · 198
Die Frau, das Plakat und die Schönheit · 2o4
Das Handwerk wertschätzen · 2o8
Fotografie wird Kunst · 214
Vorbilder aus Flora und Fauna · 218
DIE WELT IM KRIEG 224Manipulation der Massen · 226
Plakate für die Revolution · 23o
Euphorie und Trauma · 234
FRAGILE GEGENWART 240 Die Erfindung des Standards · 242
Ware mit Charakter – Die Einführung der Marke · 248
Mode – Viel mehr als Kleidung · 252
Vom Zeitzeugen zum Bildautor · 262
Plakate schockieren – und klären auf · 266
Immer kleiner, immer mobiler · 27o
Gleiche Chancen für alle – Ein Epilog · 274
DIE GEBURTSSTUNDE DER WELTRELIGIONEN 84Buddha – Der Weg zur Erkenntnis · 86
Der Islam und die Schlüsselrolle der Schrift · 92
Das Judentum – Erinnern stiftet Identität · 96
Christianisierung – Europas Identität im Glauben · 1oo
DER BEGINN DER NEUZEIT 108Der vermessene Mensch · 11o
Die Entdeckung der Welt · 114
Die Welt zwischen zwei Buchdeckeln · 12o
Die Erkundung des Kosmos · 122
DER GLANZ DER HÖFE 126Die Residenz – Zentrum der Macht · 128
Wettstreit um das weiße Gold · 132
Istanbul und Isfahan – Kulturelle Rivalen · 14o
Die japanischen Samurai und die Kunst der Krieger · 146
Musik als Vergnügen · 152
Von der Werkstatt zur Fabrik · 16o
DIE WELT IM RAUSCH 164 Weltausstellung – Leistungsschau der Nationen · 166
Vom Salonbild zum Automatenfoto · 172
Erst am Hof, dann im Kaffeehaus · 176
Neues Medium wirbt für neue Technik · 18o
Musik erobert das Wohnzimmer · 184
VOM ACKER ZUR SCHRIFT – DIE ENTWICKLUNG ERSTER HOCHKULTUREN IM ALTEN ORIENT
Zu den bedeutendsten Kulturlandschaften der Menschheitsgeschichte zählt der Alte Orient. Geografisch umfasst er Mesopotamien – das Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris –, die Levante, Syrien, Anatolien, das irani-sche Hochland und die arabische Halbinsel. Die sich bogenförmig entlang der Vorgebirge des Libanon, des Taurus und des Zagros erstreckenden Regionen werden als »Fruchtbarer Halbmond« bezeichnet. Hier wird im 9. Jahrtausend v. Chr. erstmals regelmäßig Getrei-de angebaut. Wenig später folgt die Domestizierung von Schaf, Ziege und Rind. Es vollzieht sich der Übergang von Jägern und Sammlern zu sess-haften Ackerbauern – die Neolithische Revolution. Mit der Herstellung von Keramikgefäßen ab dem 7. Jahrtausend v. Chr. verändern sich Vorrats- und Speisegewohnheiten; so werden nun Getreidebreie und Fleisch gekocht. Ab dem 6. Jahrtausend v. Chr. werden die Schwemmlandebenen besiedelt und Bewässerungsfeldbau betrieben; dieser erfordert die Zusammenarbeit einer Gemeinschaft beim Bau und Unterhalt der Kanalsysteme sowie recht-liche Regelungen – die Grundlage für Staatswesen ist gelegt. Es folgt eine Phase der Urbanisierung, in der sich die ersten Städte und Staaten herausbilden. Auseinandersetzungen um Wasser und Rohstoffe be stimmen das Handeln. Ende des 4. Jahrtausends v. Chr. entsteht die älteste bekannte Schrift in Südmesopotamien. Anfänglich zur Aufzeich-nung von Verträgen, Rechtstexten und Listen genutzt, entwickelt sich Schrift schnell zu einem universalen Medium. Bald werden auch Mythen, Hymnen, Chroniken und wissenschaftliche Texte aufgeschrieben. In der Folge entstehen mehrere Hochkulturen, darunter die Sumerer, Baby lonier, Assyrer, Hethiter und Perser. Städte wie Ur, Babylon, Ninive, Hattuša oder Persepolis sind politische, geistige und ökonomische Zentren. Der Orient wird zur Drehscheibe des Handels mit Asien. Die natürlichen Ressourcen der Landschaft und das Know-how ihrer Bewohner sind über Jahrtausende Anziehungspunkt für einwandernde Völkerschaften, unter anderem die Akkader und Nomaden aus den Steppen Eurasiens. In der Kontaktzone entstehen immer wieder neue Ideen und Ausdrucksweisen.
Seit der Steinzeit verkörpern solche Idole Muttergöttinnen und stehen für Ursprung, Schöpfung und Fruchtbarkeit.
Vermutlich Nordpersien, Südufer des Kaspischen Meeres, frühes 1. Jt. v. Chr.TonH. 21,3 cm, B. 1o,2 cm, T. 7,6 cmInv. 1963.3o
WEIBLICHES IDOL DER AMLASCH-KULTUR
18 DIE WIEGE DER ZIVILISATION 19VOM ACKER ZUR SCHRIFT – DIE ENTWICKLUNG ERSTER HOCHKULTUREN IM ALTEN ORIENT
Die Herstellung von Keramik ist Aus-druck der veränderten Lebensweise in der Neoli thischen Revolution. Bei diesem Gefäß handelt es sich um das älteste Objekt des Museums.
Hacılar-Kultur (Anatolien), 6. Jt. v. Chr.TonH. 13,4 cm, ø 13,5 cmInv. 1977.193
Das Siegel wird zur Beglaubigung von Urkun-den entwickelt. Anfangs sind dies nur kleine Stempel mit Ritzverzierungen, später werden dann Skulpturen und die zylinderförmigen Roll siegel entwickelt.
Vorderer Orient, um 3 3oo–3 ooo v. Chr., (Uruk-Zeit/Dschemdet Nasr-Zeit) Serpentin L. 3,8 cm, B. 2,5 cm, T. 1,7 cmInv. 1929.335
BECHERSTEMPELSIEGEL IN GESTALT EINES LIEGENDEN STIERES
Die Platte ist Teil eines langen Frieses. Dargestellt sind Beamte des Hofes, die an einer Prozession zu Ehren des Königs teilnehmen. Neben Beamten werden auch verschiedene Völkerschaften und Gefangene dargestellt, die so die Größe des Reiches, die Macht und die Sieghaftigkeit des Herrschers belegen.
Nimrud (Assyrien), 3. Viertel 8. Jh. v. Chr.KalksteinH. 77 cm, B. 57 cm, T. 5 cmInv. 1966.13o / St. 246Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
WANDRELIEF AUS DEM PALAST DES TIGLAT-PILESER III.
20 DIE WIEGE DER ZIVILISATION 21VOM ACKER ZUR SCHRIFT – DIE ENTWICKLUNG ERSTER HOCHKULTUREN IM ALTEN ORIENT
Spätestens seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. sind Tierkampfmotive im Orient bekannt. Tiere und Fabelwesen symbolisieren die Kräfte der Natur. Die Luristanbronzen zeigen Einflüsse des Orients und der Steppennomaden.
Luristan (Iran), 8.–7. Jh. v. Chr.BronzeH. 17,9 cm, B. 6,5 cm, T. 1,9 cmInv. 1931.64
KULTSTÄNDERAUFSATZ »DÄMONENBEZWINGER«
Über drei Jahrtausende ist die Keil-schrift in Gebrauch. Ähnlich unserem heutigen Alphabet wird sie für ver- schiedene Sprachen verwendet, unter anderem Babylonisch, Hethitisch und Persisch.
Vorderer Orient, mittelassyrisch, Zeit des Tiglat-Pileser I. (1114–1o76 v. Chr.)TonH. 7,2 cm, B. 4,2 cmInv. 1983.286Geschenk der Joachim Jungius- Gesellschaft der Wissenschaften e. V., Hamburg
BEIN MIT KEILSCHRIFTTEXT
Zum Schmuck von Betten, Thronen und Truhen aus edlen Hölzern dienen nicht selten neben Gold aufwendige Elfenbein schnitzereien. Diese Arbeit stammt aus einem königlichen Palast. Dargestellt ist die Himmelsgöttin Ischtar-Astarte.
Aus Arslan Tasch (Hadatu, Syrien),phönizisch, 8. /7. Jh. v. Chr.ElfenbeinH. 5,9 cm, B. 4,2 cmInv. 1966.26 / St. 224Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
MÖBELBESCHLAG»FRAU IM FENSTER«
2322 DIE WIEGE DER ZIVILISATION VOM ACKER ZUR SCHRIFT – DIE ENTWICKLUNG ERSTER HOCHKULTUREN IM ALTEN ORIENT
Die ägyptische Hochkultur ent -wickelt sich entlang des Nil. Aus der Abhängigkeit von der Natur ent steht ein komplexes Staats -wesen mit dem Pharao an der Spitze. Den Griechen geben Mythen und Helden sagen aus ihrer Früh zeit Orientierung. Sie bilden das ethi - sche und moral ische Rüst zeug der Ge meinschaft. Diese Wert vor-stellungen spiegeln sich in einem Schönheits ideal, das – in der euro -päischen Renaissance wieder - entdeckt – bis heute wirkt. In der Ab grenzung nach außen wächst die eigene Identi tät. Um sich diese zu be wahren, scheuen die Griechen keinen Kampf.
DER
WEG
ZU
R H
OCH
KULT
UR
25
WIE DER NIL DIE WELTORDNUNG DER ÄGYPTER PRÄGTDie Entwicklung des Menschen, der Völker und Kulturen ist untrennbar mit den Naturräumen und deren Voraussetzungen verbunden. Nirgends wird dies so deutlich wie im Alten Ägypten. »Geschenk des Nil«, so nennt der Grieche Herodot das Land. Der Fluss und sein fruchtbares Schwemmland sind die Lebensader Ägyptens. Im Kon -trast dazu stehen die unwirtlichen Wüsten und die schroffen, das Niltal be grenzenden Felswände. Der Nil versorgt die Menschen mit Nahrung, Kleidung und Baumaterial; er ist Kommunikations - und Handelsweg. Um 3 ooo v. Chr. entsteht ein komplexes Staatswesen, verwaltet von Beamten und Priestern: Sie zeichnen mit Schrift und Kalendern die Nilflut auf, die Überschwemmungen werden reguliert, Wasser mithilfe von Kanälen zugeteilt. Die jährlich wiederkehrende Nilschwemme und der tägliche Sonnenzyklus prägen das Weltbild der Ägypter. Durch die Abhängigkeit von der Natur entwickelt sich seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. eine eigene, komplexe religi-öse Vorstellungswelt. Ihr Grundpfeiler ist ma’at, die gerechte Weltordnung, die vom Pharao als Sohn und Abbild des Schöpfer - und Sonnengottes Re ver körpert wird. Daneben existieren Hunderte von Gottheiten mit lokalen Kulten und Tradi-tionen. In ihre Zuständigkeit fallen der Himmel, die Erde und das Leben im Diesseits und Jenseits. Ihre Eigenschaften und ihr Wesen werden von Tieren symbolisiert, die ihnen zugeordnet sind. In der Kunst führt dies zur Darstellung in menschlicher oder tierischer Gestalt oder als Mischwesen mit Menschenkörper und Tierkopf. Die Sonne und das Schauspiel der Überschwemmung – die Dörfer ragen auf kleinen Hügeln aus der Wasserlandschaft empor, eine Verbindung ist nur noch mit Schiffen möglich – spiegeln sich im Schöpfungsmythos wider: An der Spitze der Götterwelt steht der Sonnengott Re. Er entsteigt dem Urhügel und erschafft die Menschheit. Am Tag fährt Re in Begleitung seiner Toch-ter Maat in der Sonnenbarke über den Himmel, nachts mit der Nachtbarke durch das Totenreich, um am nächsten Morgen wiedergeboren zu werden. Dabei interagiert er mit anderen Göttern und Göttinnen in unterschied-lichster Weise. In der Unterwelt muss er mithilfe von Seth die Angriffe der Schlangengottheit Apophis abwehren, die die Welt ins Chaos stürzen will.
Auf den Schnurösengefäßen finden sich im-mer wieder Szenen mit vielrudrigen Schiffen. Das hier gezeigte Schiff besitzt Kabinen, am Bug einen Zweig, dahinter Standarten. Am Gefäßfuß sind drei Bäume dargestellt. Es handelt sich um ein frühes Nilpanorama.
Ägypten, um 3 3oo–3 1oo v. Chr., prädynastisch, Negade II -ZeitTonH. 18 cm, ø 15,2 cmInv. 1919.2
SCHNURÖSENGEFÄSS MIT SCHIFFSDARSTELLUNG
26 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 27WIE DER NIL DIE WELTORDNUNG DER ÄGYPTER PRÄGT
Osiris ist der Gott der Toten und der Wiedergeburt, zugleich aber auch des Nil und damit der Vegetation und Fruchtbarkeit. Im Jenseits richtet er die Toten. Von seinem Bruder Seth getötet, wird er durch die Liebe seiner Schwester und Gemahlin Isis und mit-hilfe des Gottes Anubis wieder zum Leben erweckt.
Vermutlich Theben, Spätzeit, vermutlich 26. Dynastie, um 664–525 v. Chr. BronzeH. 75 cmInv. 1956.129 / St. 12Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
STATUETTE DES GOTTES OSIRIS
28 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 29WIE DER NIL DIE WELTORDNUNG DER ÄGYPTER PRÄGT
RELIGION GIBT REGELN FÜR DAS MITEINANDER VOR Religion ist in vielen Kulturen ein allgegenwärtiger Bestandteil des Alltags. Sie schöpft ihre Kraft aus Aspekten und Phänomenen des Lebens und aus übernatürlichen Vorstellungen. Religion beeinflusst maßgeblich mensch -liches Verhalten, Denken, Fühlen, und prägt die Wertevorstellungen einer Gesellschaft. Zugleich unterliegt sie aber auch Veränderungen und Anpassungen. Sehr langlebig sind die religiösen Vorstellungen, Kulte und Rituale im Alten Ägypten. Umso bemerkenswerter sind gerade hier die Phasen der Ver änderung: Zu einem radikalen Wandel kommt es nach Streitigkeiten um Macht und Privilegien. Auf Befehl Pharao Amenophis IV. (Regentschaft um 1351–1334 v. Chr.) werden die alten Götter verfolgt, ihre Bilder zerstört, ihre Namen entfernt, nahezu alle Tempel geschlossen, Kulte und Feste eingestellt. Ab jetzt gibt es nur noch den Sonnengott Aton. Geradezu revo lu tionär ist seine Sonderstellung als einzige, allumfassende Gottheit. Der Pharao ändert seinen Namen in Echnaton, »Wohlgefällig dem Aton«. Sein Sohn Tutanchamun (Regentschaft um 1332–1323 v. Chr.) kehrt zum Polytheismus zurück, doch Ideen und Impulse der sogenannten Amarna - Zeit überdauern. Eintausend Jahre später, im Jahr 332 v. Chr., nimmt Alexander der Große (Regentschaft 336–323 v. Chr.) Ägypten kampflos ein und wird als göttlich-es Wesen und Erlöser begrüßt. Mit ihm gelangen griechische Kultur, Sprache, Kunst und religiöse Vorstellungen in das Land. Er gründet die Stadt Alexandria und lässt zerstörte altägyptische Tempel wieder aufbauen. Alexander und seine Nachfolger setzen auf das Nebeneinander altägypti-schen und griechisch-hellenistischen Gedankenguts. Ptolemaios I., Freund und Gefährte Alexanders, beauftragt die Priester, einen neuen Kult für seine Dynastie und das Land zu entwerfen: Der altägyptische Osiris -Apis wird zur Schutzgottheit Sarapis, dem Gott des Orakels, Herr der Zeit und Ewigkeit. Als Allgott ist er für Alltägliches wie auch staatspolitische Ereignisse zuständig. In Alexandria vermischen sich langsam die religiösen Ideen der dort lebenden Ägypter, Orientalen, Griechen, Juden und Römer. Sichtbarer Ausdruck dieses Synkretismus sind die sogenannten Fayum-Terrakotten.
Mit langem Haar und Bart erinnert die Erscheinung des Sarapis an den Göttervater Zeus. Der Korb auf dem Kopf steht für Fruchtbarkeit, die Kugel unter der Büste weist ihn als Pantokrator, Allherrscher, aus. In der römischen Kaiserzeit zählt er zu den meistver ehrten Gottheiten im Imperium.
Vermutlich Ägypten, um 3oo v. Chr., Kopie 2. Hälfte 2. Jh. n. Chr.Römische Kopie nach einem Original aus Alexandria MarmorH. 48,5 cmInv. 1974.81Erworben mit Besucherspenden
BÜSTE DES GOTTES SARAPIS
30 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 31RELIGION GIBT REGELN FÜR DAS MITEINANDER VOR
Die Gestaltung des Horusknaben entspricht griechischen Formen, das Kopftuch ist der ägyptischen Tradition entlehnt. Bei den sogenannten Fayum -Terrakotten handelt es sich um Kinderspielzeug, Kultsymbole, Grabbeigaben, Wallfahrtsbilder, Weihgab en und magische Objekte zur Bannung böser Mächte.
Ägypten, 1.–2. Jh. n. Chr.TonH. 17,3 cmInv. 1989.349Geschenk von Friedrich Gütte, Hamburg
HARPOKRATES MIT NEMES-KOPFTUCH
Fayencefigürchen wie diese dienen als Amulette. Bei der Mumifizierung werden sie zwischen die einzelnen Leinenlagen gelegt, um den Verstorbenen zu beschützen.
Ägypten, um 664–34o v. Chr. (Spätzeit)FayenceH. 6,8–7,9 cmInv. 1956.43, 1956.42, 1956.44, 1956.41, 1955.39Teilweise erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
DIE GÖTTER CHNUM, HORUS, THOËRIS, ANUBIS, PTAH UND SACHMET
32 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 33RELIGION GIBT REGELN FÜR DAS MITEINANDER VOR
Dargestellt ist die Bestrafung des Jägers Aktaion. Nachdem er die Göttin Artemis beim Baden beobachtet hat, verwandelt diese ihn in einen Hirsch, der von seinen eigenen Jagdhunden angefallen wird.
Töpfer der Berliner Amphora und Eucharides -MalerAthen, attisch-rotfigurig, 1. Viertel 5. Jh. v. Chr.TonH. 64 cm, ø 4o cmInv. 1966.34Gestiftet von den b.a.t. Cigaretten- Fabriken GmbH, Hamburg
HALSAMPHORA
HELDEN UND HEROEN SCHREIBEN GESCHICHTEDie Griechen des 1. Jahrtausends v. Chr. haben an verschiedenen Orten, unter anderen in Mykene oder auf der Akropolis von Athen, Hinterlassen-schaften einer großen Vergangenheit vor Augen. Für sie stammt dieses Erbe aus einer mythischen Epoche, das in den Heldengedichten Homers, den Werken des Dichters Hesiod oder lokalen Erzählungen weiterlebt. Der Mythos ist für die Griechen fester Bestandteil ihrer Geschichte. Mythen erzählen in poetischer, bild- und symbolhafter Sprache von einer Zeit, in der Heroen wie Herakles, Theseus oder Achilleus noch persönlich mit den Göttern verkehrten. Diese Welt bevölkerten Götter, Menschen, Halb-götter, Ungeheuer, Mischwesen, Riesen und wilde Tiere, die häufig ver wandtschaftlich miteinander verbunden waren. Mythen schaffen in literarischer Form oder in Bildern religiöse, ethische und moralische Traditionen und eine kulturelle Identität. Sie setzen Maßstäbe, geben Orientierung und warnen vor Lastern wie hýbris, Hochmut, Neid und Missgunst. Doch schon im späten 6. Jahrhundert v. Chr. setzt die Mythenkritik ein. Im 5. Jahrhundert v. Chr. stellen die Sophisten dem Mythos den Begriff des lógos gegenüber: Die Wahrheit einer Behauptung begründet sich nicht durch Erzählungen, sondern nur durch Beweise, die der Verstand erfassen kann. Trotzdem dienen Mythen bis in die Spätantike als Orientierungshilfen. Die enge Verknüpfung mit der alltäglichen Lebens -welt wird auch darin deutlich, dass eine Unterscheidung zwischen Mythos und All tag nicht immer möglich ist: So weisen Vasenbilder Kampfszenen mit Kriegern und Gefallenen zunächst durch die Beischriften von Heroen - namen auf einen Mythos hin. Später zeigen die gleichen Szenen ohne Namen ein nun nicht mehr näher bestimmbares Ereignis.
34 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 35HELDEN UND HEROEN SCHREIBEN GESCHICHTE
BÜRGER BESTIMMEN POLITIKpoliteúein, Bürger sein – mit diesem Begriff bezeichnen die Griechen zum einen das Leben in und die Teilhabe an einer Gemeinschaft. Zum anderen definieren sie damit auch die Art dieser Gemeinschaft: Die pólis, der Stadtstaat, ist ein Raum politischer Autonomie, religiöser und kultureller Identität. Durch organisierte Selbstverwaltung bewältigen die Bürger gemeinsame Aufgaben, treffen Entscheidungen, entwickeln und sprechen Recht. Die griechische Kultur entsteht im Wesentlichen in diesen póleis. Die Jahre nach dem Untergang der mykenischen Kultur im 11. Jahr - hundert v. Chr. werden oft als die »Dunklen Jahrhunderte« bezeichnet. Es existieren dörfliche Siedlungen mit lokalen Oberhäuptern und einem starken Adel. Erst im 8. Jahrhundert v. Chr. bilden sich die ersten póleis. Die pólis besteht in der Regel aus einem ásty, einem städtischen Zentrum, und der chóra, dem Umland. Den traditionellen Kern der Gemeinschaft bildet der oíkos, die Haus - und Wirtschaftsgemeinschaft – daher auch der Begriff der Ökonomie. Der oíkos umfasst neben der Familie, den Bediens-teten und Sklaven auch Land, Gebäude und das Inventar. Mit der sogenannten großen Kolonisation um 75o–55o v. Chr. verbreiten Griechen die pólis im gesamten Mittelmeerraum. Diplomatische Kontakte zwischen den póleis sind wesentlicher Bestandteil der Politik. Im inner- städtischen Raum findet die Politik auf Versammlungsplätzen, im Theater sowie im privaten Bereich statt. Auch beim sympósion, einem ritualisierten Trinkgelage, wird politisiert. Aus dem Orient übernommen gilt das Symposion seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. als ein Vergnügen der Aristokratie, bei dem auch wichtige politische Entscheidungen getroffen oder philosophische Gespräche geführt werden. Soziale Grundlage ist das Beisammensein mehrerer gleichrangiger oder be freundeter Männer. Vasenbilder zeigen nicht einen bestimmten Moment des Symposions, sondern charakterisieren es vielmehr als Lebensideal und vermitteln die damit verbundenen, sinnlichen Wert vorstellungen. Von der politischen Komponente erfahren wir lediglich aus schriftlichen Quellen.
Das Symposion beginnt mit der An rufung der Götter und einem Trank opfer, gefolgt von Getränken, Speisen und Gesprächen. Dabei liegt man auf Klinen, bettähnlichen Gestellen.
Athen, attisch-schwarzfigurig, Mitte 6. Jh. v. Chr.TonH. 12,6 cm, ø 33,5 cm (mit Henkeln)Inv. 1984.488Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
SIANA-SCHALE
36 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 37BÜRGER BESTIMMEN POLITIK
In antiken Theaterstücken werden die unter-schiedlichen Akteure durch ihr Äußeres, insbesondere die Masken, gekennzeichnet. Zunächst aus dem Kult für den Weingott Dionysos hervorgegangen, kommt den Tra-gödien, Komödien und Satyrspielen neben der Unterhaltung auch eine gesellschaft -liche Bedeutung zu.
Römisch, 1. Jh. n. Chr.MosaikglassteinH. 3,4–3,5 cm, B. 1,3–1,4 cmInv. 1969.115 a–b
ZWEI THEATERMASKENEinzigartig ist der obere Abschluss des Heroldstabs in Form zweier Schwanenköpfe. In der Regel finden sich Schlangen- und Widderköpfe, die mit dem Gott Hermes zu verbinden sind. Die Schwanenköpfe könnten auf Aphrodite oder Apollon hinweisen.
Metapont (Süditalien), 4. Jh. v. Chr.BronzeH. 18,4 cm, B. 6,3 cmInv. 2ooo.13oErworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
Heroldstäbe stehen symbolisch für den Kontakt zwischen den Gemeinschaften. Sie sind Erkennungszeichen des Keryx, des Ausrufers und Überbringers von Botschaften im privaten und staatlichen Bereich. Sie dienen auch seinem Schutz: Der Keryx nimmt an politischen, mili-tä rischen, gerichtlichen und religiösen Aktivitäten teil.
Syrakus (Sizilien), um 48o–47o v. Chr.BronzeH. 51,1 cm, B. 8,8 cmInv. 1978.61 / St. 337Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
HEROLDSTAB MIT INSCHRIFT (KERYKEION)
HEROLDSTAB MIT INSCHRIFT (KERYKEION)
3938 DER WEG ZUR HOCHKULTUR BÜRGER BESTIMMEN POLITIK
DAS EIGENE UND DAS FREMDE – IDENTITÄT VERLANGT ABGRENZUNG
Die Auseinandersetzung mit dem Eigenen und dem Fremden ist Bestandteil jeder Gemeinschaft. Sie definiert sich zum Teil einzig durch die Abgrenzung von Anderen. Im griechischen Bewusstsein ist zunächst derjenige fremd, der die griechische Sprache nicht beherrscht, also nur unverständ liche Laute – bar - bar – von sich gibt. Er wird als bárbaros bezeichnet. Die im 5. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Historien Herodots, dem Vater der Geschichtsschreibung, lassen kein sonderliches Interesse erkennen, fremde Kulturen zu verstehen. Verschiedene Stereotype von Barbaren defi-nieren die griechische Identität. Das Verhältnis von Eigenem und Fremden bewegt sich in einer Spannbreite von Konflikt und Gegensatz bis zu Inter-aktion, Austausch und gegenseitiger Abhängigkeit. Bis ungefähr 7oo v. Chr. liegt die griechische Welt an der Peripherie der Hoch kulturen des Alten Orients und Ägyptens. Sie erfährt Anregungen durch den Kontakt mit den älteren, weiter entwickelten Kulturen. Nach der Übernahme des phönizischen Alphabets können Ideen aufgeschrieben und weitergedacht werden. Die nun einsetzende, orientalisierende Phase übernimmt Techniken, Produkte, Motive und ikonografische Elemente und passt sie an die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen an. Das ändert sich radikal zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr.: Die militäri-sche Konfrontation und der Sieg über die Perser führen in der Klassik des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. zu einer strikten Abgrenzung der Griechen von den Barbaren. Bei den Griechen folgt aus dem Abwehrkampf das Bewusst-sein einer gemeinsamen kulturellen und ethnischen Identität. Hier verfestigt sich das Bild des Barbaren als bedrohlichem Fremden. Alle Nicht-Griechen sind Barbaren. Ihnen werden Laster wie überbordender Luxus, Verweichli-chung, Mangel an Selbstkontrolle und despotisches Verhalten angedichtet. Die Eroberungen Alexanders des Großen in der Zeit zwischen 336 und 323 v. Chr. führen zu einem erneuten Wandel: Griechen migrieren in das östliche Mittelmeer und den Orient. Die griechische Kultur und Identität werden von Ägypten bis nach Afghanistan übernommen und in unter- schiedlicher Weise angepasst.
Während umfangreicher Entdeckungs- und Handelsreisen entwickeln die Griechen, insbesondere aber die Athener, eine Vorliebe für das Exotische. Sie schlägt sich auch in der Produktion von Bildern, Skulpturen und Gebrauchs gegenständen nieder.
Athen, attisch, Mitte 4. Jh. v. Chr.TonH. 15,1 cm, B. 5,5 cmInv. 1962.126
SOGENANNTE AFRIKANERKOPF-KANNE
40 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 41DAS EIGENE UND DAS FREMDE – IDENTITÄT VERLANGT ABGRENZUNG
SOGENANNTE PERSERKANNE (OINOCHOE)Die Szene ist auf ein historisches Ereignis bezogen: An dem kleinasiatischen Fluss Eurymedon siegt 465 v. Chr. die athenische Flotte unter dem Strategen Kimon über die Perser. Der nackte Grieche steht für die Sieger. Er beabsichtigt, den nach vorne gebeugten Perser sexuell zu missbrauchen. Dieser Übergriff stellt den Sieg brutal und erniedrigend dar.
Umkreis des Triptolemos-MalersAthen, attisch-rotfigurig, um 46o v. Chr.TonH. 23,8 cm, ø 13,3 cmInv. 1981.173Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
42 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 43DAS EIGENE UND DAS FREMDE – IDENTITÄT VERLANGT ABGRENZUNG
SPORT – TRAINING FÜR DEN ERNSTFALLDer beständige Wettkampf und das Sichhervortun sind Wesenszüge der griechischen Kultur. Nahezu unablässig kommt es zwischen den griechi-schen Stadtstaaten zu Konflikten, die immer wieder auch bewaffnet aus-getragen werden. Davon zeugen die zahlreichen Waffen in Gräbern und Heiligtümern, aber auch die Präsenz des Themas in der Bildkunst. Kampf und Krieg prägen das Selbst verständnis der Gemeinschaft nach innen und außen, ihre Ideologie und – wie in Sparta – bisweilen auch die gesellschaft lichen Strukturen. Auch in der Literatur spielt der Kampf eine tragende Rolle: Das erste Epos der europäischen Geschichte, Homers ilias, hat den mythischen, zehn-jährigen Krieg um Troia zum Thema. Die Schlachten bestehen aus einer Vielzahl von Einzelkämpfen, in denen die Sieger Ehre erringen und ihre soziale Stellung verbessern. aristeúein, der Beste sein, ist das Ziel; die Besten, die Aristokraten, wiederum sollen die Gesellschaft führen. Im 7. Jahrhundert v. Chr. entwickelt sich die phálanx, eine im Gleichschritt auftretende, gleichartig bewaffnete Schlachtreihe. Sie ist mehr als nur eine militärische Formation, steht sie doch für die Gleichheit der Bürgerpflicht. Im kollektiven Gedächtnis der Griechen nehmen die Perserkriege und der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta im 5. Jahrhundert v. Chr. eine außergewöhnliche Stellung ein. Tiefgreifende politische Veränderungen sind die Folge: Das Stadtstaatensystem wandelt sich zu größeren Interessens-bündnissen. Der Umgang mit Waffen und Rüstung erfordert regelmäßiges Training. Sport weist einen engen Bezug zum Kampf auf. Bereits im Jahr 776 v. Chr. sollen im berühmten Zeus -Heiligtum von Olympia erstmals sportliche Wett-kämpfe stattgefunden haben. Die Teilnehmer messen sich in verschiedenen Laufdisziplinen, im Wagenrennen, im Faustkampf, Ringkampf und Speer-werfen. 52o v. Chr. wird der hoplitodromos, der Wettlauf in voller Rüstung, eingeführt. Ähnliche Spiele finden in Delphi, Korinth und Nemea statt. Während der Spiele unterbleiben Feindseligkeiten zwischen den Städten, da der sport liche Wettkampf, der agón, an die Stelle des kriegerischen Kräftemessens tritt. Auch hier gilt, stets der Beste zu sein.
Herakles und sein Gefährte Iolaos kämpfen gegen Kyknos, den Sohn des Kriegsgottes Ares.
Leagros -GruppeAthen, attisch-schwarzfigurig, Ende 6. Jh. v. Chr.TonH. 4o,5 cm, ø 18,6 cmInv. 1917.471
HALSAMPHORA
44 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 45SPORT – TRAINING FÜR DEN ERNSTFALL
Palästra - Szene: Je zwei Ringkämpfer stehen sich unter der Anleitung eines Trainers in unterschiedlichen Positionen gegenüber.
Briseis-MalerAthen, attisch-rotfigurig, um 47o v. Chr.TonH. 9 cm, ø 23,3 cm (mit Henkeln)Inv. 19oo.518
SCHALE
Kampf zwischen einem Orientalen in voller Bekleidung und einem Griechen, der mit Speer, Schild und Helm gerüstet ist.
Umkreis des Stier-MalersAthen, attisch-rotfigurig, um 41o–4oo v. Chr.TonH. 26,2 cmInv. 1983.28oGeschenk von Herbert Joost, Hamburg
Darstellung des Wettlaufs bewaffneter Fußsoldaten: Ursprünglich voll gerüstet verzichtet man später auf Beinschienen und Speer.
Phiale-MalerAthen, attisch-rotfigurig, Mitte 5. Jh. v. Chr.TonH. 34 cmInv. 1897.222
OINOCHOE NOLANISCHE AMPHORA
4746 DER WEG ZUR HOCHKULTUR SPORT – TRAINING FÜR DEN ERNSTFALL
SEEFAHRER UND HÄNDLER VERBREITEN WAREN UND WISSENDie Welt besteht schon in der Antike aus einem Netzwerk, in dem neben Waren auch Menschen, Ideen, Technologien, Kultur und Kunst reisen. Die Menschen wandern als Händler, Seeleute, Handwerker, Söldner, Künstler, Priester, Ärzte, Kurtisanen, Pilger, Exilanten oder Migranten von einer Gemeinschaft zur nächsten. Während zunächst reisende Seefahrer und Händler das Mittelmeer durch-queren und das Wissen um ferne Länder und Völker verbreiten, beginnt Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. das Zeitalter der sogenannten Großen Ko-lo nisation. Zweihundert Jahre lang gründen Siedler des griechischen Fest-landes und von den Ägäischen Inseln zahlreiche Städte am Schwarzen Meer, in Süditalien, auf Sizilien und bis nach Spanien. Dadurch verbreiten sich die griechische Sprache, Kultur und politische Ordnung. Gründe für die Auswanderungen sind Konflikte innerhalb der Mutterstädte, Bevölkerungs-wachstum und ökonomische Interessen. Im Westen locken die Bodenschätze Etruriens. Die neuen Städte entstehen entlang der Seeverbindungen und Handelsrouten. Die reichen Erzvorkommen in Etrurien lassen das Metallhandwerk zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. aufblühen. Die Etrusker prägen von etwa 1 ooo bis 1oo v. Chr. die Geschichte und Kultur Italiens. Ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. treiben sie Handel mit Griechen und Phöniziern. Etruskische Exporte finden sich in Griechenland, Nordafrika und bei den Kelten. Offenbar führen die Phönizier die Töpferscheibe in Mittelitalien ein. Motive wie Blüten oder Fabel wesen sind sichtbarer Beleg der Übernahme von Ideen aus dem Orient. Ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. treten vermehrt griechische Einflüsse auf. In etruskischen Gräbern finden sich zahlreiche Gefäße aus Korinth und Athen, die als Handelsware nach Etrurien gelangt sind. Nach 55o v. Chr. entwickelt sich der etruskisch-schwarzfigurige Vasenstil. Athen produziert teils speziell für den etruskischen Markt, griechische Handwerker siedeln sich in Etrurien an und es entstehen eigene etruskische Imitationen. Umgekehrt nehmen die Athener etruskische Formen und Dekorationen auf, etwa die Tyrrhenischen Amphoren oder den Kyathos, eine spezielle Schöpftasse. Bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. dehnen die Etrusker ihr Gebiet weiter aus. In der Seeschlacht von Cumae gewinnen Griechen und Karthager 474 v. Chr. die Kontrolle über die Seerouten. Folge ist der politische und wirtschaf t - liche Niedergang Etruriens. Erst im Hellenismus kommt es zu einem letzten Auf blühen der etruskischen Kultur.
Die Figur nimmt die Gestalt der griechischen Koren auf. Das Etrus kische an ihr sind die Schnabelschuhe.
Italien, etruskisch, 2. Hälfte 6. Jh. v. Chr.Bronze H. 11,5 cm, B. 4,3cm, T. 4,o cmInv. 1969.134Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
STEHENDES MÄDCHEN ODER GÖTTIN
48 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 49SEEFAHRER UND HÄNDLER VERBREITEN WAREN UND WISSEN
Etrusko-korinthisch, um 58o–56o v. Chr.TonH. 4o,5 cm, ø 2o cmInv. 1998.3o8Geschenk von Dr. Heinz Eder, Hamburg
OLPE
Neben Importen kopieren die Etrusker Vasen aus Korinth und Athen. Form, Material und Motive sind beinahe identisch, einzig die Ausführung der Malerei fällt in Etrurien gröber aus.
Maler der Kanne Vatikan 73Korinthisch, um 63o v. Chr.TonH. 28,7 cm, ø 16,1 cmInv. 1962.41Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
OLPE
Die Szene zeigt die Personifikation des winterlichen Nordwindes, Boreas, der die Nymphe Oreithyia entführt. Auf beiden Seiten ist in groben Buchstaben die etruskische Inschrift »suthina«, zum Grab ge-hörig, eingeritzt. Sie dokumentiert, dass es sich um einen etruskischen Import aus Athen handelt.
Maler der AthenageburtAttisch-rotfigurig, um 46o v. Chr.TonH. 47,5 cm, ø 35 cmInv. 198o.174Geschenk von Herbert Joost, Hamburg
PELIKE
Mit der Einführung der Töpferscheibe und einer verbesserten Brenntechnik entwickelt sich die sogenannte Bucchero-Keramik. Sie ist grundsätzlich schwarz gefärbt und orientiert sich an Vorbildern aus Metall.
Bucchero a cilindrettoItalien, 1. Hälfte 6. Jh. v. Chr.TonH. 26,7 cm, ø 15,5 cmInv. 1998.345Geschenk von Dr. Reimar Odefey, Hamburg
BANDHENKELAMPHORA MIT ROLLSTEMPELVERZIERUNG
50 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 51SEEFAHRER UND HÄNDLER VERBREITEN WAREN UND WISSEN
DAS RECHTE MASS – SCHÖNHEIT ALS TUGENDIm 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. versuchen die Künstler, das Schöne zu schaffen, zu beschreiben und seine Gesetzmäßigkeiten zu ergründen. Es ist die Blütezeit der aísthesis, der Ästhetik. Um 45o v. Chr. kreiert Polyklet, einer der bedeutendsten Bildhauer der grie-chischen Klassik, eine unbekleidete, männliche Idealfigur und verfasst eine kunsttheoretische Schrift. Dabei setzt er sich mit Proportionen, dem Bewe-gungsmotiv und der Gewichtsverteilung des menschlichen Körpers auseinan-der. Künstler bezeichnen die Statue als Kanon, aus dem sie »die Grundregeln der Kunst wie aus einer Art Gesetz ableiten« (Plinius, naturalis historia, 34,55 f.). Das künstlerische Bestreben liegt jetzt darin, Gewicht, Bewegung und deren Auswirkung auf Körper und Gewand realistisch dar zustellen. Grundlagen für die Auseinandersetzung mit der Ästhetik sind Entwicklun-gen in der Mathematik, die Proportionslehre und die Philosophie. Feder-führend sind die Naturphilosophen um Pythagoras und Thales von Milet. Die Griechen verknüpfen die Ästhetik mit ethischen Wertvorstellungen: Seit homerischer Zeit identifizieren sich Aristokraten mit den Begriffen kalós – schön – und agathós – gut. kalokagathía, die Vortrefflichkeit, wird zum Leitmotiv der griechischen Philosophie. Sie bezeichnet die Ver bindung des ästhetisch Schönen mit dem sittlich Besten. Die Künstler der archaischen und klassischen Zeit versuchen, dieses Ideal umzusetzen. Die Darstellung von Nacktheit ist immer ambivalent: Bilder unbekleideter, muskulöser Kämpfender sind einerseits Ausdruck sittlicher Überlegenheit. Andererseits kann Nacktheit auch ein Zeichen der Schutzlosigkeit sein. So werden die Schwachen der Gemeinschaft häufig nackt dargestellt. Im Gegensatz zu unbekleideten Männern und Knaben tragen Frauen lange Gewänder. Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. nehmen Kleider die Körper - kon turen auf und scheinen nahezu transparent. Erst der Bildhauer Praxiteles wagt um 34o v. Chr., einen Frauenkörper nackt darzustellen. Seine aphrodite von knidos wird zu einem seiner berühmtesten Werke und Vorbild für unzählige Kopien. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. steht dem Schönen auch das Hässliche gegen-über. Im Hellenismus finden sich Darstellungen von Zwergen, Missgestalte-ten und Verkrüppelten. Sie rufen Heiterkeit hervor, wenn sie bei Gastmählern oder Festspielen auftreten. Hässlichkeit steht auch für einen schlechten Charakter, man sieht in ihr die Verkörperung des Übels. Mit dem Anblick des Übels will man das Üble bannen.
Statuen wie diese prägen unser Bild der griechischen Klassik und letzten Endes auch unser Schönheits ideal bis heute. Junge Männer, Athleten und Krieger werden mit den Heroen der mythischen Zeit assoziiert, man bezeichnet dies als heroische Nacktheit.
5. Jh. v. Chr., Kopie um 15o n. Chr.Römische Kopie nach einem griechischen OriginalMarmorH. 59,5 cm, B. 38,4 cmInv. 1917.181
JÜNGLINGSTORSO
52 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 53DAS RECHTE MASS – SCHÖNHEIT ALS TUGEND
Der berühmteste Bildhauer der Spätklassik, Praxiteles, hat eine Reihe von Statuen der Göttin Aphrodite geschaffen. Charakteristisch für seine Werke sind der s-förmige Körper-schwung und die Betonung von Stand - und Spielbein.
Nach dem Vorbild des PraxitelesVermutlich Syrien, 1. Jh. v. Chr.BronzeH. 28,4 cmInv. 2o11.312 / St. 491Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
APHRODITE PSELIOUMENE (DIE SCHMUCKANLEGENDE)
Ungeachtet aller körperlichen Miss -bildungen gilt die Statuette als Talisman. Buckel und Phallos sollen Übel abwehren und Glück bringen.
Vermutlich Alexandria (Ägypten), 3. Jh. v. Chr.Bronze und SilberH. 6,6 cm, B. 4,o cm, T. 5,2 cmInv. 1949.4o
BUCKLIGER BETTLER
5554 DER WEG ZUR HOCHKULTUR DAS RECHTE MASS – SCHÖNHEIT ALS TUGEND
DAS GEWAND ALS BOTSCHAFTKleidung ist lebensnotwendig, schützt den Körper vor Witterung und Verletzung. Sie ist auch ein Kommunikationsmedium. Gestaltung, Material, Verzierung, Drapierung und Trageweise der Textilien sind meist unmittel-bares Zeichen des gesellschaftlichen Status ihres Trägers. Zugleich steuert er, wie er von seiner Umgebung wahrgenommen werden will. Wenn sich römische Kaiser etwa in soldatischer Tracht mit Brustpanzer kleiden, treten sie als sieg reiche, fähige Feldherren auf. Saubere und standesgemäße Kleidung gehört bei den Griechen, Etruskern und Römern zum guten Ton. Auffällig – fremd – erscheinen Völker oder Personen in anderer Kleidung. Orientalen erscheinen grundsätzlich in Hosen und langärmeligen Gewändern und werden deswegen als schlicht-weg anders wahrgenommen. Antike Kleidung besteht aus Wolle, Leinen, Flachs, Leder und Fellen. Seltener und erst ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. sind Importe kostbarer Seidenstoffe aus China und indischer Baumwolle nachgewiesen. Eingewebte Goldfäden oder die Färbung mit Purpur steigern den Wert. Farbreste an antiken Skulp turen und die sogenannten koptischen Stoffe aus Ägypten zeugen von farben froher Kleidung. Neben der Bekleidung prägt auch der Schmuck das Erscheinungsbild. In prä historischer Zeit hat er vor allem magische und mystische Kräfte, die im Zusammenhang mit der damaligen Lebenswirklichkeit stehen: Jagd, Frucht barkeit und Rangabzeichen. Viele dieser uralten Bezüge blei- ben er halten. In der Antike symbolisiert Schmuck gleichzeitig auch Reich-tum, gesell schaft liche Stellung und wichtige persönliche Eigenschaften. Der Gebrauch ist häufig re glementiert, so sind goldene Fingerringe den römischen Patriziern vorbehalten.
Die Göttin Athena trägt einen péplos. Es handelt sich hierbei um ein rechteckiges Tuch, das um den Körper gelegt wird. An den Schul-tern ist es mit zwei Fibeln befestigt, während sich unter der Brust eine sichtbare Gürtung befindet, eine weitere ist auf Hüfthöhe durch den Gewandüberfall verdeckt.
MyronUm 44o v. Chr., Kopie 1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.Römische Kopie nach einem griechischen BronzeoriginalMarmor aus CarraraH. 142 cm, B. 52 cm, T. 41 cmInv. 1961.288 / St. 168Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
ATHENA
56 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 57GEWAND ALS BOTSCHAFT
Besonders qualitätsvoll ist jener Schmuck, den die Etrusker meisterhaft mit der Technik der Granulation, der Auflage feinster Goldkügelchen, herstellen. Die Fibel funktioniert wie eine Sicherheitsnadel.
Kampanisch-etruskisch, 2. Hälfte 4. Jh. v. Chr.GoldH. 3,5 cm, L. 7,9 cmInv. 1927.148
PRUNKFIBEL MIT GRANULATIONKunstvoll drapiert sind der bis auf die Füße reichende dünne chíton, das Unterkleid, und ein himátion, der Mantel. Die unterschiedliche Ausprägung und Anzahl der Falten zeigen die Verschiedenartigkeit der verwendeten Stoffe.
Tanagra (Griechenland), 3. Jh. v. Chr.TonH. 35,5 cm, B. 17 cm, T. 9,8 cmInv. 1897.48
MÄDCHEN, AN EINEN PFEILER GELEHNT
Das heiße und trockene Klima Ägyptens hat die Stoffe konserviert. Die sogenannten koptischen Textilien sind ein Fenster in die Vergangenheit der Textilkunst.
Koptisch, 4.–5. Jh. n. Chr.Leinen, Wolle (Buntwirkerei)H. 11 cm (mit Zierleiste), L. 127 cmInv. 1887.2
ZIERSTREIFEN MIT KREISEN AUS AKANTHUSRANKEN UM KÖPFE UND TIERE
58 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 59GEWAND ALS BOTSCHAFT
Neben Tierfriesen, Krieger- und Schiff-fahrtsbildern finden sich vor allem Szenen des Grabkultes und der Toten-klage. Auf dem Hals ist die próthesis dargestellt: Trauernde umringen einen Toten, der auf einem Bett liegt.
Werkstatt von Athen 894Attisch-spätgeometrisch, letztes Drittel 8. Jh. v. Chr.TonH. 72 cm, ø 36,4 cmInv. 1966.89Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
HALSAMPHORA
WAS NACH DEM LEBEN KOMMTErstmals definieren die Griechen die psyché, die Seele: Sie ist ein Ebenbild des Menschen, das im Augenblick des Sterbens den Körper verlässt. Nur in der Unterwelt, dem Hades, kann sie Ruhe finden. Er gilt als düsterer, freud -loser Ort und erfüllt die Lebenden mit Grauen. Die Vorstellungen werden im Laufe der Zeit konkreter: Der Hades ist von dem Fluss Styx umgeben, den man nur mithilfe des Totenfährmanns Charon überqueren kann. Um diesen zu entlohnen und nicht in einer Zwischenwelt gefangen zu sein, legt man den Verstorbenen eine Münze, die sogenannte Obole, auf die Zunge. Den Eingang zur Unterwelt bewacht der dreiköpfige Höllenhund Kerberos. Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. kommt eine neue Auffassung hinzu. Mysterien -kulte versprechen ein glückseliges Leben nach dem Tod. Die Orphiker verkün-den, dass nur Rechtschaffende zur Insel der Seligen, dem Elysion, gelangen. Im Alltag werden diese Vorstellungen in Ritualen zur Bestattung, Ehrung und Erinnerung der Toten umgesetzt. Die Bestattung eines Verstorbenen gehört zur höchsten Pflicht der Angehörigen. Im Totenkult bewahren die Lebenden die Erinnerung an den Verstorbenen mit Opfern und Festlichkeiten. Im 8. Jahrhundert v. Chr. schmücken großformatige Vasen die Gräber; sie zeigen unter anderem die próthesis, die Aufbahrung, und die ekphorá, die Fahrt zum Grab. An ihre Stelle treten später marmorne Statuen und Grabpfeiler. Reliefs, Stelen und Gefäße sind häufig Bestandteile monumentaler Grab-bezirke und dienen dem Gedenken der Toten. Zugleich zeugen sie vom Wohl stand und Repräsentationsbedürfnis ihrer Auftraggeber, einem stär ker werdenden Individualismus und hoher handwerklicher Kunst. In Unteritalien begleiten im 4. Jahrhundert v. Chr. prunkvolle Keramik - ge fäße die Verstorbenen ins Grab. Sie zeigen Grabmäler und Bilder aus der Unterwelt. Daneben zählen auch Geschichten um Dionysos und sein Gefolge sowie Aphrodite und Eros zu diesem Bereich. Sie sollen ein seliges Weiter leben im Jenseits gewährleisten.
6160 DER WEG ZUR HOCHKULTUR WAS NACH DEM LEBEN KOMMT
Eine Abschiedsszene zwischen zwei verstorbenen Familienmitgliedern: Links der Vater Neokles, rechts sein Sohn Aristoteles. Beide stammen aus der attischen Gemeinde Kikynna.
Attisch, um 375 v. Chr.Pentelischer MarmorH. 142 cm, B. 38,5 cmInv. 1977.52Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
SOGENANNTE BILDFELDSTELE
Der Totenfährmann Charon holt eine Frau ab, die am Ufer steht, um sie in die Unterwelt überzusetzen.
Attisch-weißgrundig, um 435 v. Chr.TonH. 2o,7 cm, ø 6,7 cmInv. 1984.442Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
Herakles muss im Rahmen seiner berühmten zwölf Taten den Wach-hund des Hades, Kerberos, aus der Unterwelt holen.
Werkstatt des Athena-MalersAttisch -schwarzfigurig, um 5oo v. Chr.TonH. 18,9 cm, ø 11 cmInv. 1899.98
LEKYTHOS OINOCHOE
62 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 63WAS NACH DEM LEBEN KOMMT
Grabtempelchen, naïskos, mit drei Frauen: in der Mitte die Verstorbene, hervorgehoben durch die helle Farbgebung. Der Schleier charakterisiert sie als Braut der Götter der Unterwelt im dionysischen Erlösungsglau-ben; die Hochzeit mit den Unsterblichen garantiert auch die Überwindung des Todes.
»Inspiriert vom Varrese-Maler«Apulisch-rotfigurig, um 34o–33o v. Chr.Ton H. 74,2 cm, ø 48,1 cmInv. 1984.447 bErworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
HYDRIA
Geflügelter Liebesgott mit Schmuck-kästchen und Muschel. Für den täglichen Gebrauch ungeeignet dient die mehrfarbige Vase als Weih- oder Grabbeigabe.
Aus Methana (auf der Peloponnes), attisch, um 39o/38o v. Chr. H. 26 cm, B. 18 cm, T. ca. 1o cmTonInv. 1899.95
STATUETTENLEKYTHOS IN FORM EINES EROS
64 DER WEG ZUR HOCHKULTUR 65WAS NACH DEM LEBEN KOMMT
ALEXANDER DER GROSSE UND DAS ERSTE WELTREICHPersien ist das erste Weltreich der Antike. Der Vielvölkerstaat entwickelt sich unter der Dynastie der Achämeniden ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. zu einem weitläufigen Reich von Ägypten und Nordgriechenland bis nach Indien und Zentralasien. In nur vier Jahren, von 334 bis 33o v. Chr., erobert Alexander der Große dieses Reich – ein epochaler Umbruch! Mit seinem frühen Tod im Alter von nur 32 Jahren wird er zu einer überragenden Gestalt in der abendländischen und orientalischen Geschichte. Der Philosoph Aristoteles ist sein Lehrer. Die Helden Achill und Herakles faszinieren ihn. Ihren Taten und ihrem unsterb-lichen Ruhm eifert er nach. Der anfängliche Eroberungszug verwandelt sich schnell in eine Expedition, die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Umbrüche nach sich zieht. Folge ist die Erweiterung der Welt in einem nie dagewesenen Ausmaß. Mit Alexander breiten sich die griechische Sprache und Kultur aus und bestimmen die Länder weit über die Küsten des Mittelmeeres hinaus. In Wirtschafts - und Verwaltungsbelangen übernimmt er das System der Perser und stilisiert sich so zum Nachfolger der Achämeniden. Vergeblich sind die Versuche, das gewaltige Reich nach dem Tod Alexanders 323 v. Chr. zu erhalten. Nach erbitterten Kämpfen gründen die makedo nischen Feldherren und Nachfolger, die Diadochen, eigene Dynastien und Reiche. Politisch vollzieht sich endgültig der Wandel vom Stadtstaatensystem zur helle nis tischen Weltkultur. Um sich gegenseitig zu übertrumpfen, fördern die neuen Herrscher auch Künste und Wissenschaften: In Dichtung, Philo-sophie, Kunst, Philologie, Mathematik, Astronomie, Geografie und Medizin leisten die Menschen Gewaltiges. So entstehen berühmte Biblio theken wie die legendären von Alexandria und Pergamon. Archimedes erfindet zahl-reiche Maschinen, unter anderem Planetarien und die nach ihm benannte archimedische Schraube zur Wasserförderung. Auch im Osten kommt es zu nachhaltigen Wechselwirkungen: Im Grenz-gebiet zwischen Pakistan und Afghanistan zeugt der sogenannte Gandhara- Stil von persischen, griechischen und schließlich indischen Einflüssen. In der Region um die heutige Stadt Peschawar verbinden sich griechische Philosophie und der Mahayana-Buddhismus, der sich ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. in Korea, China und Japan verbreitet.
Die gelockten, zu den Seiten fallenden Haare dieses Kopfes greifen griechisch -römische Haarmode auf.
Gandhara, Kuschan Reich, 4. Jh. n. Chr.StuckH. 23,2 cm, B. 18,5 cmInv. 199o.72
KOPF EINES SCHÜLERS ODER EINER GOTTHEIT
68 DIE GROSSEN IMPERIEN 69ALEXANDER DER GROSSE UND DAS ERSTE WELTREICH
Luxus am persischen Hof: Typische Motive wie die Tropfen finden sich auf Glas- und Silberarbeiten.
Persisch-achämenidisch, 5. Jh. v. Chr.SilberH. 4,o cm, ø 22,3 cmInv. 1988.195
OMPHALOSSCHALE
Persisch-achämenidisch, spätes 5. – frühes 4. Jh. v. Chr.Glas, geschliffenH. 6,o cm, ø 19,2 cmInv. 1973.1o7
SCHALE
Die Statue geht wahrscheinlich auf ein Kultbild des vergöttlichten Alexanders zurück, das ihn als Gründer der Stadt Alexandria zeigt.
Typus des Zeus AigiochosAlexandria (Ägypten), um 31o v. Chr.Römische Kopie nach einem griechischen OriginalMarmorH. 136 cm, B. 45,5 cm, T. 24 cmInv. 1963.74Erworben mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung
STATUE ALEXANDERS DES GROSSEN
70 DIE GROSSEN IMPERIEN 7170 DIE GROSSEN IMPERIEN ALEXANDER DER GROSSE UND DAS ERSTE WELTREICH
CHARAKTER IM PORTRÄTFiguren in Menschengestalt zählen zu den ältesten Motiven der Kunst. Dabei spielt die Darstellung des Kopfes seit der Frühzeit eine entscheidende Rolle. Bildnisse dienen dazu, das Gedächtnis der Verstorbenen über den Tod hi naus zu bewahren, an bedeutende Leistungen zu erinnern, Wohlstand und gesell schaftliche Stellung auszudrücken. Bildnisse von Herrschern und bedeutenden Persönlichkeiten, die öffentlich verbreitet werden, dienen der Selbst darstellung. Im 4. Jahrhundert v. Chr. setzt in Griechenland eine rege Produktion von Porträts ein – als posthume Ehrung für Staatsmänner, Philosophen und Dichter. Mit Alexander dem Großen entwickelt sich das Regentenbildnis zu Lebzeiten, das sich im hellenistischen Herrscherkult etabliert. Das frühe römische Porträt basiert einerseits auf den griechischen Entwick-lungen, andererseits folgt es der etruskischen Tradition. Dort werden Bildnis-se und Totenmasken der Ahnen bei der Zeremonie mitgetragen (portare). Lebensgroße Porträts sind in Rom erst im 1. Jahrhundert v. Chr. nachweisbar, in der Kaiserzeit weit verbreitet. Bildnisse wie diese zeigen den Kaiser und seine Familie, Angehörige der Reichs aristokratie, der Ritterschaft und städtischer Oberschichten sowie freigelassene Sklaven, die zu Geld gekommen sind. Statuen zieren öffentliche Plätze, Bauwerke und aufwendige Grabbauten. Büsten, Hermen und gemalte Bildnisse sind auch im privaten Bereich aufge-stellt. Einzig die Inschriften informieren über Name, besondere Leistungen, Anlass der Aufstellung, Auftraggeber oder auch Finanzierung. Bekleidung und Attribute zeigen den sozialen Rang des Porträtierten. Im Gegensatz dazu sind nackte Körper als Götter- und Heroenstatuen gedacht und der älteren griechischen Kunst entlehnt. Häufig werden Köpfe und Körper in Werkstätten separat hergestellt. Die Bild hauer legen einen Vorrat an Statuen an, für die sie nur noch Einsatz-köpfe fertigen müssen. Details am Kopf, Schmuck und Gewänder mit bun-ten Mustern und Borten sind bei Marmorstatuen häufig aufgemalt.
Bildnisse der späten Republik besitzen ausgesprochen realistische Züge. Die strenge Physiognomie, gerun-zelte Augenbrauen und Stirnfalten setzen Werte der Aristokratie ins Bild: cura – Sorge und Verant-wortung – für die res publica – die öffentlichen Angelegenheiten –, gravitas – Würde –, severitas – Ernsthaftigkeit –, constantia – Beständigkeit – und auctoritas. fides – Treue – zeigt eine Narbe auf der Stirn, die von einer im Kampf erlittenen Verletzung zeugt.
Römisch, um 5o–25 v. Chr.MarmorH. 34 cmInv. 1967.214 / St. 254Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen unter Mitwirkung der Campe’schen Historischen Kunststiftung
PORTRÄT EINES MANNES
72 DIE GROSSEN IMPERIEN 7373CHARAKTER IM PORTRÄT
Den realistischen Bildnissen der späten Republik setzt Augustus idealisierte Gesichtszüge entgegen, die sich maßgeblich an Idealstatuen der griechischen Klassik orientieren. Charakteristisch für die julisch-claudische Zeit ist die Haargestal-tung mit dicken, gebogenen Strähnen.
(63 v. Chr.–14 n. Chr., Regentschaft ab 27 v. Chr.)Angeblich aus der Nähe von Epidauros (Griechenland), römisch, frühes 1. Jh. n. Chr.MarmorH. 37,4 cm, B. 21,4 cmInv. 196o.57
RELIEFKOPF DES KAISERS AUGUSTUS
Frauenbildnisse folgen denselben Prinzipien wie Männerporträts. Mo-den dokumentieren sich vor allem in den Frisuren, die sich stets an der Haartracht der Kaiserin orientieren. Die Gattung der Mumienporträts vermischt römische und ägyptische Vorstellungen, wonach der Verstor-bene weiterhin am täglichen Leben der Familie teilnimmt.
Er-Rubayat (Fayum, Ägypten), spätes 2. Jh. n. Chr.Holz, bemalt in EnkaustikH. 36 cmInv. 1928.42
MUMIENPORTRÄT EINER FRAU
Durch sein Bildnis ist der Kaiser im öffent-lichen Leben immer präsent: Bei Gerichtsver-handlungen, öffentlichen Bekanntmachungen und im Rahmen kultischer Handlungen vertritt das Bildnis den Kaiser. Panzer und Feldherrenmantel, paludamentum, sind Sinn bild der kaiserlichen Macht, Würde und Sieghaftigkeit.
(161–192 n. Chr., Regentschaft ab 18o n. Chr.)Sechster BildnistypusStadtrömisch, um 19o n. Chr.H. 74,2 cm, B. 58 cmMarmorInv. 198o.14 / St. 341Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
PANZERBÜSTE DES KAISERS COMMODUS
74 DIE GROSSEN IMPERIEN 75CHARAKTER IM PORTRÄT
DIE SASANIDEN – ROMS KONKURRENZ IM OSTENSeit der Herrschaft der Perser folgt im Orient ein Großreich auf das andere. 260 n. Chr. gelingt den Sasaniden unter König Schapur I. zum ersten Mal, einen römischen Kaiser gefangen zu nehmen. Sie werden zum neuen mäch-tigen Gegner des Imperium Romanum. Das Sasanidenreich umfasst die Gebiete der heutigen Länder Iran, Irak und Afghanistan. Unter der Herrschaft des Großkönigs Chosrau I. Anuschirvan (531–579) erlebt das Reich seine Blüte. Der hochgebildete König fördert Künste und Wissenschaften. Während seiner Regentschaft entstehen pracht- volle Bauten. Auch heute noch lebt er in den Erzählungen aus tausendundeiner nacht fort. Die Sasaniden erfinden die Windmühlen und raffinieren den Zucker, sie bringen das Schachspiel in den Westen und machen Hose und Turban populär. Ihre Formensprache wirkt bis nach Indien, China und ins römi-sche Reich. Typisch sind Glas sowie Gold- und Silberarbeiten. Die hoch-wertigen Gefäße finden Verwendung bei den Banketten der Herrscher. Sie zeigen Jagdszenen, kultische Handlungen und mythologische Darstellun-gen, die ihren Ursprung in griechischen und römischen Vorlagen haben. Häufig berichten römische Autoren von Reichtum und höfischer Pracht. Als im Jahr 651 Heere muslimischer Araber in das Sasanidenreich einfallen, ist dessen Ende besiegelt. Jedoch beeinflussen seine Traditionen die Erobe-rer. Die höfische Kultur der Sasaniden wird zum Vorbild des rit-terlich-höfischen Lebens am Abbasidenhof in Bagdad.
Neben Gold- und Silberarbeiten zählt Glas zu den begehrten Luxus-gütern. Die Bearbeitung des extrem fragilen Materials erfordert meist mehrere Arbeitsschritte und die Kenntnis unterschiedlicher Techni-ken: hier zunächst das Gießen über einem Holzkern, dann das Schleifen der einzelnen Facetten.
IrakSasanidisch, 6. / 7. Jh.GlasH. 8,5 cm; ø 10 cmInv. 1963.39 / St. 184Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
SCHALE MIT FACETTENSCHLIFF
76 DIE GROSSEN IMPERIEN 77DIE SASANIDEN – ROMS KONKURRENZ IM OSTEN
Dargestellt sind vier unbekleidete Tänzerinnen mit Musikinstru-menten, Rebhühnern und einem Pfau. Ausdruck und Haltung der Tänzerinnen gehen auf eine Aphrodite des griechischen Bildhauers Praxiteles zurück.
IranSasanidisch, 6. / 7. Jh.Silber, vergoldetH. 16,3 cm; ø 10 cmInv. 1990.62 / St. 379Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
WEINKARAFFEDas Innenbild zeigt einen Adler, der ein Huftier geschlagen hat. Neben dem Thema der Jagd wird durch den Adler die Über-legenheit des obersten Gottes und damit des unter seinem Schutz befindlichen Herrschers symbolisiert.
IranSasanidisch, frühes 4. Jh.H. 4,1 cm, ø 20,7 cmInv. 1963.107 / St 193Eigentum der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlungen
SCHALE
78 DIE GROSSEN IMPERIEN 79DIE SASANIDEN – ROMS KONKURRENZ IM OSTEN