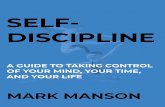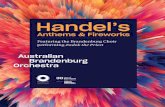Slawen in Brandenburg: eine archäologische Momentaufnahme. In : J. Müller/K. Neitmann/F. Schopper...
-
Upload
bldam-brandenburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Slawen in Brandenburg: eine archäologische Momentaufnahme. In : J. Müller/K. Neitmann/F. Schopper...
1 Charakterisierung und historische Situation
Unter dem Begriff „Slawenzeit“ soll die Zeit-spanne vom 6./7. bis ins 12./13. Jh. verstanden werden, in welcher die Nordwestslawen mit archäologischen Mitteln, also anhand typi-schen Sachgutes und entsprechender Befunde, im östlichen Mitteleuropa fassbar sind. Die Slawenzeit hat in unserem Gebiet mit dem Zeitpunkt der Einwanderung einen Anfang, nicht aber ein Ende – jedenfalls da, wo slawi-sche Bevölkerung bis auf den heutigen Tag vor-handen ist. Zwischen Elbe und Oder beginnt sie Ende des 7. Jhs. mit der Landnahme einer neuen Bevölkerung aus Südosten in einem im Zuge der Völkerwanderungszeit praktisch ent-völkerten Gebiet. Sie bringt völlig neue For-men des Sachgutes, der Siedlung und Bestat-tung mit sich, der Herkunftsraum lässt sich anhand von Grab-, Haus- und Keramikfor-men gut fassen (Brather 2001, 57; Dulinicz 2006). Ob die neue Bevölkerung vielleicht auf Reste der abgewanderten Germanen traf, wird aufgrund der Überlieferung vorslawi-scher Flussnamen vermutet (Abb.1). In der sla-wischen Periode entwickelt sich eine zuerst nur archäologisch fassbare, wenig differenzier-te rein urgeschichtliche Kulturgruppe aus be-
15
Slawen in Brandenburg: eine archäologische Momentaufnahme
Thomas Kersting, Wünsdorf
Ende des 7. Jhs. n. Chr. kommt die neue sla-wische Bevölkerung ins heutige Brandenburg und bringt dabei Sachgut, Siedlungs- und Bestattungsformen eigener Prägung mit sich. Die wenig differenzierte, rein urgeschichtliche Kulturgruppe entwickelt sich in den nächsten Jahrhunderten zu einer komplexen Gesell-schaft mit Fernbeziehungen und beginnen-dem Landesausbau. Schriftquellen berichten über den nordwestslawischen Raum. Eine eigene zentrale Herrschaftsbildung in unse-rem Raum gelingt allerdings nicht. Er war eher Grenzraum, aber mit europaweiten Beziehungen. Mitte des 12. Jhs. beginnt mit Einwanderung westlicher Siedler ein Akkul-turationsprozess, der die Slawen bald archäo-logisch „unsichtbar“ macht, obwohl bis heute eine Bevölkerungskontinuität herrscht.
Since the end of the 7th century A.D. the new Slavic population comes into today‘s Branden-burg, with material culture, settlement and fu-neral forms of its own. Within the next centu-ries the little differentiated, purely prehistoric cultural group develops to a complex society with distant relations and beginning agricul-tural landscape development. Written sources report about the northwestern Slavic area. Efforts to develop an own central rule in our area did not succeed. It was rather a border-line area, but with European-wide relations. In the middle of the 12th century immigrati-on of western colonists led to an acculturation process, that soon takes the Slavs archaeologi-cally out of sight, although population conti-nuity lasts till this day.
Abb. 1: Flussnamen, die aus vorslawischer Zeit überliefert sind, widersprechen anscheinend einer völligen Siedlungsleere beim Eintreffen der ersten Slawengruppen
16 Kersting, Slawen in Brandenburg
scheidensten Anfängen zu einer wirtschaft-lich und sozial differenzierten Gesellschaft mit Stammesherrschaften, weitreichenden Be-ziehungen und beginnendem Landesausbau. Ihren frühgeschichtlichen Charakter definie-ren Schriftquellen von außen (beim Fehlen ei-gener schriftlicher Zeugnisse), in denen Nach-barn und Handelspartner ein zunehmend detailreiches Bild der inneren Verhältnisse des westslawischen Raumes zeichnen. Der Schritt zur Bildung einer eigenen Großherrschaft – über einen losen Stammesverband hinaus – wird im Raum der späteren Mark Branden-burg nicht unternommen (zur Geschichte immer noch Herrmann 1985, 326ff.; Lübke 2004, 179ff.; Brather 2001, 51ff.). Der hiesige Bereich dürfte auch aus „slawischer Sicht“ immer eher ein Grenzraum gewesen sein, das Fundmaterial spiegelt gleichwohl seine Ein-bindung in europaweite Beziehungen wider. Am Ende des „Slawischen Mittelalters“ seit Mitte des 12. Jhs. wandert wiederum eine frem-de Bevölkerung ein, diesmal aus dem Westen. Es kommt – bei Verbleiben der ansässigen Be-völkerung – zu einem Zusammenleben, bei dem das slawische Sachgut schnell durch das der neuen, christlichen Siedler ersetzt wird. Mit der Übernahme der beigabenlosen christlichen Bestattungssitte ist das slawische Ethnikum dann archäologisch nicht mehr fassbar – ein Phänomen der Assimilation und Koexistenz (Brather 2001, 84ff.; 2004, 301ff.). Seine Weiter-existenz belegen gleichwohl Schriftquellen und slawische Namen noch über Jahrhunderte. Das zweisprachige Sorbengebiet in Südost-Bran-denburg und Sachsen zeugt bis heute von einer echten Bevölkerungskontinuität.Nach frühen Erwähnungen – der byzantini-sche Chronist Theophylaktos Simokattes schildert im Jahre 592 den Besuch dreier Sla-wen vom „äußersten Ende des westlichen Ozeans“ bei Kaiser Maurikios, die Chronik des Franken Fredegar erwähnt zum Jahr 631 erstmals Sorben ex genere Sclavinorum öst-lich des fränkischen Machtbereichs – schweigen die Quellen für längere Zeit. Erst im späten 8. Jh. treten die Slawen vor dem Hintergrund fränkisch-sächsischer Auseinandersetzungen wieder ins Blickfeld, nach der Unterwerfung der Sachsen wurden sie nämlich um 800 di-rekte Nachbarn des Frankenreiches. Das Gebiet der Nordwestslawen, zu dem das heutige Land Brandenburg gehört, ist schon bald der Einflussnahme aus den in der Nachbarschaft entstehenden, konkurrieren-den Mächten ausgesetzt. Das fränkische, ot-
tonische, dann deutsche Reich im Westen, das polnische Piastenreich im Osten, die Pom-mern im Norden, die Wettiner und das Mag-deburger Erzbistum im Süden und Südwesten entwickeln ein hohes Maß an Expansions-drang und bringen die Slawenstämme unter ihre wechselnde Herrschaft. Im Jahre 928/29 werden der Hevellerhauptort „Brennaburg“ und gleichzeitig im Nordwes-ten an der Elbe die Burg der Linonen, Lenzen, unter Heinrich I. erobert. Sein Sohn Otto I. plant die Eingliederung der slawischen Gebie-te zwischen Elbe und Oder durch Missionie-rung und Eroberung – „mit Kreuz und Schwert“ – und richtet dazu ein System von Burgwarden und die Bistümer in Havelberg und Brandenburg ein, die 968 dem Erzbistum Magdeburg untergeordnet werden (das genaue Datum der Bistumsgründung ist strittig, s. Partenheimer 2007). Zu diesem System gehört auch die Einrichtung von „Grenzmarken“ – Anspruchs- oder Einflussgebieten mit dafür eigens ernannten Markgrafen, die sie sich al-lerdings erst selber unterwerfen müssen. Der Slawenaufstand des Lutizenbundes von 983 setzt dieser Entwicklung zunächst ein Ende; für rund 150 Jahre bleiben die slawischen Stämme im Nordwesten politisch relativ un-abhängig. Erst 1130 überlässt der letzte, bereits christliche Hevellerfürst Prisbislaw-Heinrich – offenbar die Zeichen der Zeit erkennend – die Zauche (tota zucha) als Patengeschenk dem unmündigen Sohn des askanischen Markgra-fen. Im Jahr 1150 schließlich fällt die Branden-burg selbst mit dem ganzen Herrschaftsbe-reich in einer geheimen Erbfolgeregelung an den Markgrafen Albrecht. Der Gedanke, dass diese „Wende“ eigentlich friedlich über die Bühne gehen sollte, ist reizvoll: immerhin gibt es eine gemeinsame propagandistische Mün-zedition beider Herrscher. So aber ist die am 11. Juni 1157 erfolgte kriegerische „Rück-eroberung“ seiner Burg durch Albrecht den Bären aus der Hand des Konkurrenten Jaxa von Köpenick der Anlass der Feierlichkeiten im Jahr 2007 (vgl. Partenheimer 2007, 27ff.; 2009).
2 Räume und Stämme
Beim „Baierischen Geographen“, einem Chro nisten der zweiten Hälfte des 9. Jhs., und in der „Völkertafel“ des ethnografisch interes-sierten englischen Königs Alfred (871–899) werden zahlreiche slawische Stammes namen mit Angaben zur Lokalisierung überliefert
16
17Kersting, Slawen in Brandenburg
(Kluger/Lehnert 1994). Die schwer punkt-mäßige Verbreitung der heute bekannten sla-wischen Fundplätze mit offenbar (und nicht nur scheinbar) fundleeren Zwischenräumen scheint durch Waldgebiete abgegrenzte Sied-lungsareale anzudeuten, die gerne mit den in zeitgenössischen Quellen aufgezählten „Stäm-men“ in Verbindung gebracht werden (seit Herrmann 1985, T. 1 ein feststehendes Karten-bild, hier nach Gringmuth-Dallmer 2000, 97). Wenn auch in manchem Einzelfalle strittig, dürfte eine solche Karte (Abb.2) im Großen und Ganzen den wahren Verhältnissen Rech-nung tragen, wobei von der Frage nach der eige-nen Selbstwahrnehmung der „Stämme“ und ihrem Zugehörigkeits- oder Abgrenzungsge-fühl hier abgesehen werden muss. Häufig han-delt es sich ja um Fremdbenennungen, also den Versuch, den unübersichtlichen Verhältnissen von „außen“ eine Ordnung überzustülpen. Im-merhin kann eine solche Karte aber auch der Identifizierung der heutigen Brandenburger Bevölkerung mit ihren slawischen Vorfahren dienen. Im Raum Brandenburg a. d. H. sind hier natürlich die Heveller zu nennen (die sich selbst aber Stodoranen nannten), an der Spree die Sprewanen, im Land Lebus die Leubuzzi und in der Lausitz die Lusizi, in der Uckermark die Ukranen – um nur einge „prominente“ Stämme anzuführen.
3 Forscher und Geschichte
Die Burgen als auffälligste Bodendenkmale nicht nur der Slawenzeit regten schon früh die Phantasie der Bevölkerung und der For-scher an – hier seien stellvertretend die Namen Virchow, Götze, Schuchardt und Unverzagt für die frühe Phase der Forschung im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jhs. genannt (Brather 2001, 18ff.). Zu dieser Zeit wurden die „Burg-wall-Keramik“ und ihre drei Stilarten als sla-wisch erkannt, eine systematische Burgwall-kartei begründet und erste Grabungen in den Havel- und Oderburgen sowie an der Rö-merschanze bei Potsdam-Sacrow und auf dem Reitweiner Sporn unternommen. Errungenschaften der Forscher der nächsten Generation sind u. a. heute noch unverzicht-bare Publikationen wie die Burgen von „Groß-berlin“ (Herrmann 1960), das sog. „Slawen-handbuch“ (Herrmann 1985), das Corpuswerk zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der DDR (Herrmann/Donat 1979) sowie zahlreiche Gra-bungen im Lausitzer Tagebaugebiet und in Brandenburg a. d. H., Köpenick und Spandau.
Unverzichtbar und an dieser Stelle zu nennen sind bis heute auch die zahlreichen siedlungs-genetisch-auswertenden Beiträge E. Gring-muth-Dallmers (Würdigung und Schriften-verzeichnis bei Jeute et al. 2007, 21–32). In der jüngeren Zeit, im Wesentlichen nach der poli-tischen Wende Anfang der 1990er Jahre – aber auch schon kurz vorher einsetzend – kam der planmäßige und flächendeckende Einsatz der Dendrochronologie hinzu (Hen-ning/Heußner 1992). Dieser naturwissen-schaftlichen Forschungsmethode verdanken wir u. a. im Glücksfall des Schmerzker Brun-nens ein Datum für frühslawische Keramik sowie die Umdatierung der zahlreichen Burgwälle in der Niederlausitz ins 10. Jh. (Biermann et al. 1999). Die Forschungsgeschichte setzt sich auch und gerade unter den gewandelten politisch-gesell-schaftlichen Vorzeichen seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts fort, u. a. in Form eines neuen „Handbuches“ zur Archäologie
17
Abb. 2: Überlieferte Stammesnamen und ihre Lokalisierung in (rekonstruierten) waldfreien Siedlungsgebieten
18 Kersting, Slawen in Brandenburg
der Siedlungen im Laufe der Zeit, offenbar auch entlang von Wegen, ist zu rechnen. Bis zum Einsetzen eines planmäßigen Landesau-baues unter deutscher und polnischer Herr-schaft nutzte man dafür Gebiete innerhalb der alten Siedlungskammern (vgl. z. B. Frey 2001; zu Siedlungsstrukturen, basierend auf Gringmuth-Dallmer: Kersting 2009 b). Oft sind mehrere ländliche Siedlungen auf „zentra-le“ Burgwälle bezogen, die Knotenpunkte des Austauschs im überregionalen Wegenetz sind. Solche Siedlungkammern dürfen als politisch-wirtschaftliche Einheiten betrachtet werden, die Schriftquellen sprechen hier von civitates.
5 Befunde und Wirtschaft
Die innere Struktur der ländlichen Siedlun-gen ist durch eine äußerst dichte Nutzung ge-kennzeichnet, wobei oft nur tief reichende Bodeneingriffe (z. B. Gruben oder Brunnen) erhalten sind. Spuren der Gebäude selbst sind archäologisch kaum fassbar, hölzerne Block-bauten werden nur wenig in die Erde einge-tieft und manchmal mit Pfosten an den Wän-den und Firstseiten verstärkt. Spuren der nicht unterkellerten Gebäude sind daher ar-chäologisch meist kaum zu erkennen und können sich je nach Untergrund im Sand oder Lehm lediglich als unregelmäßige oder rechteckige, flache Grubenverfärbungen ab-zeichnen. Manchmal sind Kuppelöfen aus Feldsteinen in einer Hausecke erkennbar, erst im Falle von Holzerhaltung werden Kons-truktionsdetails der Wände sichtbar (vgl. Brather 2000). Die häufigsten Siedlungsbefun-de sind tiefe Grubenverfärbungen. Mit Flechtwerk ausgekleidete Speichergruben dienen zur Aufnahme von Getreidevorräten. Später werden sie zu Abfallgruben, hier finden sich oft Fischschuppenschichten und ver-kohlte Reste der Vorräte. Wahrscheinlich als Getreidespeicher werden gerade in der Früh-zeit fest eingebaute „Lehmwannen“ benutzt. Neben Backöfen (Abb. 5) benutzt man auch Dörröfen zur Haltbarmachung von Vorräten wie Getreide oder Obst (Kersting et al. 2007). Innerhalb der Siedlungen zeichnen sich ge-trennte Wohn- und Wirtschaftsbereiche ab; bei den Siedlungen können Kalk- und Teer- bzw. Pechöfen auftreten (Abb. 4), die teilwei-se – in Gruppen angeordnet – eine hohe In-tensität der Produktion belegen (Kennecke 2008, 36; Abb.13). Wiesenkalk und Holz zur Teergewinnung gibt es in der natürlichen Umwelt genug – beide Materialien finden in
der Westslawen (Brather 2001, das auch für die-sen Beitrag intensiv genutzt wurde). Getragen von der DFG, der in der Vergangenheit mehre-re Projektförderungen im Lande zu verdanken sind (u. a. das Projekt zur Dendrochronologie der Lausitzer Burgen, vgl. Henning 2002 b) sind derzeit besonders wichtig einerseits die Förde-rung der Aufarbeitung der Grabungen auf der Dominsel in Brandenburg a. d. H. (vgl. Kirsch 2009) sowie die Untersuchungen im Rahmen des „Linonen-Projektes“ an der Elbe (vgl. Bier-mann et al. 2009b). Mittlerweile greifen erfreulicherweise auch die Berliner Universitäten mit Feldforschun-gen und Abschlussarbeiten ins Brandenbur-ger Umland aus.
4 Strukturen und Landschaft
Die Siedlungsplätze der Slawenzeit sind immer entlang der Wasserläufe oder Seen aufgereiht (Abb.3); damals konnten auch Niederungsla-gen besetzt werden, die heute feucht und unzu-gänglich sind.Die anfangs im 8. und 9. Jh. noch schüttere Verbreitung der Besiedlung erfährt in mittel- und spätslawischer Zeit im 10.–12. Jh. eine Verdichtung; zunehmend werden im Zuge eines deutlichen Bevölkerungszuwachses auch bisher unbesiedelte Bereiche in Besitz genom-men. Mit einer „schrittweisen“ Verlagerung
Abb. 3: Siedlungskammern an der Havel im Bereich um die Brandenburg
19Kersting, Slawen in Brandenburg
lungsbereiche (Abb. 6), auch über größere Wasserflächen hinweg (Bleile 1999). Zu einer Siedlung dürfte ungefähr ein Qua-dratkilometer Ackerland, Wald und Nutz-fläche als Wirtschaftsareal gehört haben. Als Feldfrüchte sind neben Weizen vor allem Roggen und Hirse von Bedeutung. Der Ha-kenpflug wird durch hölzerne Stielscharen und eiserne Pflugscharen ergänzt, der Boden wird aber nur kreuzweise geritzt und noch nicht gewendet. Zur Ernte benutzt man
Haushalt und Hausbau, Handwerk, Land-wirtschaft und Bootsbau vielfach Verwen-dung. Auch Ofenanlagen für die Verarbei-tung von Raseneisenerz sind durch Funde von Schlacke und Tondüsen von Blasebälgen belegt (Knaack 1996); das Material konnte ebenfalls fast überall in feuchten Niederun-gen gewonnen werden. Aus dem so gewonne-nen Eisen wird Gerät für den Alltagsbedarf gefertigt, wobei von der früh- zur spätslawi-schen Zeit eine beträchtliche Zunahme in Qantität und Qualität zu verzeichnen ist.Eigentliche Keramikbrennöfen fehlen im Be-fundspektrum, Gefäße konnten offenbar in Gruben im offenen Feuer gebrannt werden – wie moderne Versuche zeigen, führt dieses Verfahren zu guten Ergebnissen (frdl. Mitt. St. Dalitz über Experimente der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Branden-burg a. d. H.). Hölzerne Kastenbrunnen (wie bei Schmerzke) dienen der Versorgung mit Frischwasser (Bier-mann 2001). Hölzerne Bohlenwege oder Brü-cken verbinden die unterschiedlichen Sied-
Abb. 5: Backofenunterteil von der Dominsel in Brandenburg a. d. H.; rechts unten Arbeitsöffnung, rundherum Löcher der aufgehenden Kuppelkonstruktion, die mit Staken verstärkt war
Abb. 4: Die dicht genutzte spätslawische Siedlung von Dyrotz, Lkr. Havelland, mit peripherer Nutzungszone: technische Ofenanlagen
Verteilung der:
Kalkbrennöfen
Teersiedegruben
Teersiedekeramik
20 Kersting, Slawen in Brandenburg
weitgehenden Kahlschlag im Umfeld größerer Burganlagen auszugehen: Holz wird für Wälle, Brücken, Bohlenwege und ständige Reparaturen benötigt. Das zunehmende Be-völkerungswachstum bewirkt eine Auswei-tung der Anbauflächen und eine Siedlungs-verdichtung – dies ist ein gesamteuropäisches Phänomen, das im planmäßigen Landesaus-bau des Hochmittelalters mündet.
6 Burgen und Gesellschaft
Frühe Befestigungen wurden in geringer Zahl erst einige Zeit nach der Landnahme errichtet und nutzen bei meist großem Umfang natürli-che Geländebedingungen oder gar urge-schichtliche Befestigungen (wie im Falle von Sacrow und Reitwein). Sie dürften als Flucht-punkte für Volk und Vieh einer Siedlungs-kammer gedient haben. Später werden Rundwälle von bis zu 80m Durchmesser typisch für das gesamte west-slawische Gebiet: sie werden in mittelslawi-scher Zeit, ab dem 10. Jh. innerhalb eines kurzen Zeitraumes errichtet, wohl als Reak-tion auf empfundene und tatsächliche äußere Bedrohung. Sie liegen, meist von Niederun-gen umgeben, auf Geländespornen oder fla-chen Erhebungen. Diese Burganlagen lassen auch eine neue Siedlungs- und Gesellschafts-struktur erschließen, nicht zuletzt aufgrund der immensen Organisationsleistung inklusi-ve Abholzung ganzer Wälder bei ihrer Er-richtung. Neben ihrer Aufgabe von Reprä-sentation und Verteidigung dienen sie den regionalen und lokalen Eliten auch als Wohn- und Speicherraum. Herrschaftliche Auftraggeber, Aussicht auf Schutz und überregionale Verbindungen ziehen Hand-werker und Kaufleute an, die sich im Schutz der Burgen niederlassen. Manche dieser Burgen werden nach zeitweiser Eroberung im 10. Jh. kurzzeitig durch die deutsche Herrschaft weiter genutzt. In Havelland und Fläming ist die Einrichtung von Burgwar-den für mehrere bekannte slawische Burg-wälle durch historische Quellen belegt, aber archäologische Anhaltspunkte – etwa in Form steinerner Fundamente – sind die Ausnahme (Kersting 2004).Seltener sind Anlagen aus einer Kernburg und einer befestigten Vorburg (Abb. 8). Neuere Forschungen in Burgwallanlagen der Prignitz (Lenzen-Neuehaus, vgl. Biermann et al. 2009b) und den angrenzenden Gebieten lassen mitt-lerweile erkennen, dass die am Ende mehr-
große Sicheln. Der Getreideanbau ist noch in etwa gleichrangig mit der Viehhaltung; Winter- und Sommerkulturen mit Weide-nutzung wechseln sich ab. Ab dem 10. Jh. ist Obstanbau nachgewiesen (zu den Aspekten der Fauna Jahns 2009). Der Bevölkerungszu-wachs erfordert mehr Fleisch, die ökono-misch günstigere Schweinehaltung über-wiegt nun gegenüber der Rinderzucht (vgl. Hanik 2009). Die Pferdezucht spielt nach Schriftquellen und Knochenfunden eine große Rolle, offenbar auch aus kultischen Grün-den. Im Spree-Havel-Gebiet ist mit 5% Haushuhn und -gans der höchste Geflügelan-teil an der frühmittelalterlichen Nahrung in Mitteleuropa im Knochenmaterial nachge-wiesen. Hier ist auch noch der Elch heimisch, sowie Rothirsch, Reh, Wildschwein und Wassergeflügel. Ein Landschaftsbild mit Bä-chen, Teichen, Seen, aber auch offenem Ge-
lände mit Talwiesen und Sumpf, Erlenbrü-chen und Auwald ist aufgrund der Fauna rekonstruierbar. Fischfang spielt eine große Rolle, Jagd ist deutlich im Knochenmaterial von Burgen repräsentiert; mit Trittfallen (Abb.7) fängt man Pelztiere und Hochwild. Der Wald dient zur Schweinemast und zur Ge-winnung von Teer und Holzkohle, Honig und Bienenwachs. Allerdings ist von einem
Abb. 6: Lebensbild eines frühslawischen Dorfes nach dem Befund von LübbenSteinkirchen, Lkr. DahmeSpreewald, auf flacher Spornlage in feuchter Niederung
Abb. 7: Eine der sechs hölzernen Trittfallen vom Ufer einer verlandeten Wasserstelle bei Rägelin, Lkr. OstprignitzRuppin, die man den Wildtieren in den Weg gelegt hatte
21Kersting, Slawen in Brandenburg
Grabungen auf der Dominsel (vgl. Kirsch 2009). Auf dem benachbarten Marienberg wird das Heiligtum des Gottes Triglav er-wähnt, als an derselben Stelle im 12. Jh. die Marienkirche errichtet wird. An der Stelle dieser Zentralburgen entwickeln sich „Früh-städte“, die durch ihre Funktionen Gewerbe, Handel, Herrschaft und Kult definiert sind: genauso wie in der späteren mittelalterlichen Stadt auch, bei welcher dann allerdings auch noch der rechtliche Aspekt der städtisch-bür-gerlichen „Freiheit“ hinzutritt.
7 Materielle Hinterlassenschaft
In der frühslawischen Zeit wurden ausge-sprochen schlichte Erzeugnisse in einer schma len Material- und Formenpalette neben der Landwirtschaft für den eigenen Bedarf hergestellt. Man beherrschte die Verhüttung
gliedrigen Anlagen oft einem Entstehungs-prozess unterlagen, in dessen Verlauf in eine große Burganlage eine kleinere, konzentrier-te Befestigung „eingebaut“ wurde; ob unter Auflassung der größeren, ist noch nicht klar. Am Ende der Entwicklung kann wie in Len-zen-Neuehaus eine noch kleinere, stark be-festigte „deutsche“ Turmhügelburg stehen, sodass im archäologischen Befund ein dreifa-cher Befestigungsring abzulesen ist.Zur Brandenburg auf der Dominsel sei auf die Beiträge von K. Kirsch (2009) und St. Da-litz (2009), zur Burg Lenzen auf denjenigen von Biermann et al. (2009b) verwiesen.Die Konstruktion dieser Anlagen aus Holz und Erde beschreibt schon im 10. Jh. als Au-genzeuge der arabisch-jüdische Handlungsrei-sende Ibrahim Ibn Jacub aus Spanien (Lübke 2004, 179f.). Dafür stehen illustrierend das-Wall- und Grabenprofil aus Raddusch und eine Rekonstruktion nach den Befunden in Saßleben (Abb.9; 10): Im Kern bestanden die Wälle aus dicht gepackten Holzrost- oder Kastenkonstruktionen, die mit Erde gefüllt wurden. In spätslawischer Zeit, ab dem 11. Jh., kommt es zur Aufgabe der meisten dieser kleineren Burgen zugunsten großer, zentra-ler Anlagen wie der Brandenburg, aber auch z. B. in Lebus, bei Spandau und Köpenick. An diesen Zentralburgen finden sich regelhaft Zeugnisse gehobener Lebensart und Belege von Handwerk und Gewerbe, von Handel und Austausch, sowie heidnischer und später dann christlicher Kultstätten. Für die Brandenburg z. B. belegen dies zahlreiche Funde aus den
Abb. 8: Freesdorfer Borchelt (Burgstall) bei Luckau, Lkr. DahmeSpreewald, lässt im Luftbild seine zweiteilige Anlage aus Burg und Vorburg erkennen
Abb. 10: Die Konstruktion des Walles der Burg Saßleben, Lkr. OberspreewaldLausitz, verschlang eine Menge Holz
Abb. 9: Raddusch, Lkr. OberspreewaldLausitz: während man im Vordergrund noch das Grabenprofil dokumentiert, wird die hölzerne Fassade der rekonstruierten Slawenburg fertiggestellt
22 Kersting, Slawen in Brandenburg
Schnallen sind nur vereinzelt zu finden. Beide trugen allerdings Messer am Gürtel, manch-mal mit blechbeschlagener Scheide, die Be-schläge zuweilen in Tierform. Eiserne Aus-rüstungsgegenstände und Waffen wie Äxte, Schwerter, Lanzen und Reitzubehör wie Tren-sen, Sporen und Steigbügel gehören zur krie-gerischen Lebenswelt, wobei die Erzeugnisse fränkischer Schwertschmieden von der Karo-lingerzeit bis ins Hochmittelalter bevorzugt wurden – nicht ohne Grund hatte schon Karl der Große im Diedenhofer Kapitular den Handel damit untersagt (Brather 2001, 296).Zum bäuerlichen Alltag gehören Eisenwerk-zeuge wie Sicheln, Bohrer, Meißel und Pflug-schare, aber auch Wetz- und Mahlsteine, tö-nerne Spinnwirtel und Webgewichte sowie eine große Vielfalt von Gegenständen aus Holz, Knochen und Geweih. Gedrechselte Holzgefäße gehobener Qualität sind von der Brandenburger Dominsel erhalten. In slawischem Zusammenhang sind oft ex-zellente Erhaltungsbedingungen für Funde aus Holz und Knochen gegeben (Abb.12). Verantwortlich ist dafür die Veränderung des Grundwasserspiegels im Laufe der Zeit, der anfangs eine Besiedlung trockenerer Niede-rungslagen erlaubte, welche später mit dem Anstieg des Wasserstandes (u. a. im Zuge des mittelalterlichen Mühlenstaues) zur Erhaltung organischer Funde in feuchtem Milieu führte, wie in Burggräben und Brunnen (grundsätz-lich hierzu Bleile 2008). Die hier anzutreffen-den hölzernen Gegenstände sind ein wichtiges „Alleinstellungsmerkmal“ für die Archäolo-gie der Slawenzeit. Sie dürfen wohl auch als repräsentativ für die vorangegangenen ur- und frühgeschichtlichen Perioden gelten: Auch wenn sie „erst“ ca. 1000 Jahre alt sind, zeigen sie dennoch, was aus früheren Epochen in der Regel spurlos verloren ist. Darüber hin-aus bieten organische Reste die Möglichkeit zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, wel-che die Umweltgeschichte betreffen, also die Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft (vgl. Jahns 2009). Hinzu kommt der Einblick in technische Details, wie sie an Resten von Pflug und Stielscharen (neu bis abgenutzt) zu beobachten sind, an Tierfallen oder an verzier-ten Türblättern wie aus der Lenzener Burg oder aber ausgeklügelten Zimmermannstechniken an Bauhölzern aus Wall- oder Brückenkon-struktionen wie Ösen- oder Hakenbalken.Die Hölzer – insbesondere Bauhölzer mit um-fangreichen Jahrringabschnitten – können schließlich auch zu Zwecken der Dendrochro-
von Raseneisenstein zur Herstellung von Ei-sengerät, die Knochen- und Holzschnitzerei sowie die Keramikherstellung. Sie war zu-nächst von bescheidener Qualität, anfangs ohne Drehscheibe hergestellt und fast gänz-lich unverziert.Im Laufe der Zeit nehmen Anzahl, Qualität und Variationsbreite der Gegenstände zu, vor allem bei den Eisenerzeugnissen und der Ke-ramik, ohne aber die Vielfalt der materiellen Hinterlassenschaft mancher vorangegangenen ur- und frühgeschichtlichen Periode zu errei-chen (Abb.11).Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ge-rät sind grundsätzlich in den Gräbern nur spärlich überliefert, die Funde stammen meist aus Siedlungen und Burgen und unterliegen nur wenigen Änderungen im Laufe der Zeit. Nur die Frauen trugen Schmuck wie Ketten aus Glasperlen, selten aus Karneol, Bernstein und Bergkristall sowie Ohr- und Schläfen-ringe, massiv oder blechförmig aus Bronze, selten Silber. Die Kleidung von Mann und Frau kam weitgehend ohne Metallteile aus,
Abb. 11: Das Fundspektrum aus Eisen umfasst in erster Linie Messer, Werkzeug und Reitzubehör
23Kersting, Slawen in Brandenburg
Dendrodatiert im Schmerzker Brunnen auf 736 (Biermann et al. 1999), wird sie je nach Ausprägung als „Prager“ oder „Sukower Typ“ bezeichnet. Qualitativ höherwertige, verzier-te und drehscheiben-gefertigte Gefäße haben wohl Vorbilder im Süden oder im Karolinger-reich und gehören zum wenig später auftreten-den Feldberger Typ (Brather 2001, 188). Gefäße mit Kammstrich-, Stich- und Stempel-zier, die auf drehbaren Untersätzen gefertigt sein können und im oberen Teil nachgedreht wurden, repräsentieren als „Menkendorfer Typ“ die mittelslawische Keramik. Im 10./11. Jh. sind auf der Brandenburger Dominsel auch Importgefäße aus dem Harzgebiet feststellbar (Grebe 1991, 30; Kirsch 2009).In spätslawischer Zeit dominiert dann völlig die auf der schnell rotierenden Drehscheibe hergestellte und daher fast nur noch mit sog. Gurtfurchen verzierte Keramik. Individuell gestaltete Zeichen unter dem Boden auf der Standfläche sind wohl als Abdrücke der Drehscheibe im Sinne von Töpfermarken zu in-terpretieren. Anhand ihrer Verbreitung, z. B. im Umkreis rund um die Brandenburg, erlau-ben sie in spätslawischer Zeit Einblick in kleinräumige Handelsbeziehungen (Grebe 1991, 35). Selten sind Mischformen, die in Qualität und
Randformen „schon“ Ähnlichkeit mit deut-scher Ware haben, aber noch in slawischer Tradition verziert sein können – gerade sie sind aber nicht immer mit ausreichender Si-cherheit von südostdeutscher Standbodenke-ramik abzusetzen (Frey 2003).
nologie genutzt werden und so eine jahrge-naue Altersbestimmung anhand der Einord-nung in eine regionale Jahrringvergleichskurve ermöglichen. Diese spielt für die Slawenzeit eine wichtige Rolle, denn die so gewonnenen Datierungen erlauben gegebenenfalls eine Ver-bindung archäologischer Befunde mit histo-risch überlieferten Daten. Im Falle der Burgan-lage von Lenzen wird dies besonders deutlich:
sie wurde am Vorabend des Slawenaufstandes 983 noch einmal verstärkt ausgebaut, was kaum ein Zufall sein wird (Werner 2004). Die Masse des Fundmaterials stellt die Kera-mik (Abb.13). Für die frühslawische Zeit, das späte 7. und 8. Jh., ist unverzierte, einfache, ohne Töpferscheibe gefertigte Keramik ty-pisch: Sie konnte hierzulande bisher nicht vor dem Beginn des 8. Jhs. nachgewiesen werden.
Abb. 12,1–3: Aus Knochen wurden häufig Pfrieme, seltener Flöten gefertigt; aus Holz u. a. Haushaltsbedarf wie Gefäße und Schöpfer
24 Kersting, Slawen in Brandenburg
kleine Gruppen von Urnen- und flachen Hü-gelgräbern, die Scherben und Leichenbrand in der Schüttung aufweisen (Wetzel 1979). Ursprünglich wohl auf der Geländeoberflä-che oder flachen Hügeln angelegte Brand-schüttungsgräber sowie Gruben mit wenig Leichenbrand, die leicht mit Siedlungsgruben zu verwechseln sind, treten ebenfalls selten auf (Schmidt 1991, 275; 280). Zudem sind wegen meist fehlender Beigaben kaum Ein-blicke in die Ausstattung der Menschen mög-lich. Die Bestattungen enthalten – wenn überhaupt – nur ein wenig Ringschmuck und Perlen bei den Frauen, sowie Messer und ein-zeln beigegebene Gefäße bei Männern und Frauen. Waffen und Gerät fehlen in der Regel.Das Gleiche gilt grundsätzlich auch für die Körpergräber, die unter christlichem Ein-fluss ab dem (fortgeschrittenen) 10. Jh. ange-legt werden (Grebe 1999; Pollex 2007). Hier muss nicht unbedingt eine Christianisierung des Einzelnen vorliegen – trotz christlicher Ost-West-Orientierung und gefalteten Hän-den der Toten. Neben anderen (seltenen) Bei-gaben werden mitunter „Charonspfennige“ beigegeben. Diese eigentlich heidnische Sitte hat sich – wohl mit der Ausbreitung des Christentums – seit der Antike vom Mittel-meerraum einerseits über Byzanz und Groß-mähren und über den fränkischen Westen und den Ostseeraum andererseits bis zu den Westslawen hin verbreitet. Ob man sich dabei der antiken Vorstellung der Entlohnung des Fährmannes, der den Toten über den Styx, den Grenzfluss der Unterwelt brachte, be-wusst war, bleibt zweifelhaft.Gesellschaftliche Gruppen, die in histori-schen Quellen Erwähnung finden – wie „rex / dux; reguli / primores; meliores / praestanti-ores; vulgus / populus“ (Herrmann 1985, 254; Brather 2001, 310), die eigentlich aber nichts anderes als von außen übergestülpte Katego-risierungen sind, können archäologisch in der Ausstattung der Toten nur im Ausnahmefall nachvollzogen werden.Seitdem die christliche Kirche für die Bestat-tung auch der slawischen Bevölkerung auf dem Dorffriedhof sorgt, ist das slawische Ethnikum archäologisch nicht mehr fassbar. Dass den Gräbern dennoch besonderer Quel-len- und Erkenntniswert zukommt, nämlich bezüglich der überlieferten Reste der Men-schen selber, zeigen die Ergebnisse der anthro-pologischen Forschung (vgl. Jungklaus 2009).Abgesehen von den Bestattungen sind ar-chäologische Zeugnisse zu Weltbild und Jen-
8 Bestattungen und Kult
Gräber spielen in der Slawenzeit als archäolo-gische Quelle im Vergleich zu anderen Perio-den eine eher untergeordnete Rolle. Vor allem die Brandschüttungsgräber der Frühzeit sind kaum auffindbar, das Gleiche gilt auch für
Abb. 13,1–3: Die Gefäßkeramik ist formal recht einheitlich, die Gestaltung reicht von unverziert über kammstrichverzierte Oberteile bis zu Gurtfurchenverzierung auf dem ganzen Gefäß
25Kersting, Slawen in Brandenburg
ter kompletter spätslawischer Gefäße in einer Grube mit Pferdeschädel in der Siedlung von Dyrotz (Kennecke 2008, 56ff.).Auch die auffallend häufig als Gewässer-funde (Anders/Gringmuth-Dallmer 2007) begegnenden Waffen und Ausrüstungsteile, meist Schwerter und Lanzen, aber auch Reit-zubehör, lassen an bewusste Niederlegungen denken. Sie wurden vielleicht an bestimmten Fluss- oder Seeübergangsstellen als Opfer, Bitte oder Dank für heile Überfahrt depo-niert (Abb.16; 17). Glasierte Tonklappern und Toneier, biswei-len in Gräbern zu finden, sind weit aus dem Osten – aus Polen und der Kiewer Rus – hier-her nach Brandenburg gelangt. Mit ihnen
verband sich in ihrem Herkunftsgebiet ein bestimmter kultischer Brauch, wohl ein Fruchtbarkeitsritus. Ob dies aber auch hier-zulande in gleicher Weise verstanden wurde, wissen wir nicht. Eindeutig christliche Zeugnisse dagegen sind absolute Ausnahmen und kommen erst in der spätslawischen Zeit vor. Hierher gehören aus Blech gefertigte Hohlköper, die als eine Art Reliquienbehälter gedient haben können, wie eine sog. Kaptorge aus dem Schatzfund von Niederlandin (Seyer 1999, 37) und ein Blech-kreuz (Abb. 18) aus der Siedlung von Schmer-gow (Gustavs 1984, 214ff.).
seitsvorstellungen hierzulande eine Selten-heit. Schriftquellen überliefern zwar Namen und Aussehen von Götterfiguren, wie dem des Triglav auf dem Brandenburger Marien-berg, oder Beschreibungen von Kulthandlun-gen, wie denen beim Tempel von Arkona auf Rügen. Fundgegenstände aber, die sicher kul-tisch interpretiert werden könnten – egal ob heidnisch oder christlich – sind kaum vor-handen. Eine Zuordnung der wenigen be-kannten figürlichen Darstellungen – entweder in Keramik oder Knochen eingeritzt oder in Form von Kleinplastiken wie dem bekannten Brandenburger Pferdchen (Abb. 14) oder das Männchen aus Schwedt – zu dieser Lebens-sphäre ist nicht mit Sicherheit möglich, wenn-
gleich in letzterem Falle doch sehr wahr-scheinlich als eine Art „Taschengott“ deutbar. Größere plastische Darstellungen aus Holz, wie der sog. „Götze von Raddusch“ (Abb. 15)z. B., werden erst im Vergleich mit dem be-kannten, naturalistischen Kultbild von der Fi-scherinsel bei Neubrandenburg verständlich, eine noch stilisiertere Form als die aus Rad-dusch ist kaum denkbar (Ullrich 2003, 62). Dennoch lassen sich gut dokumentierte Be-funde wie die absichtliche Deponierung gan-zer und halbierter Gefäße (eines Geschirrsat-zes?) im Brunnen von Schmerzke kaum anders als in kultischem Zusammenhang deuten. Ähnliches ist aus der Baugrube des Brunnens von Raddusch bekannt: Hier ist (übrigens neben den angebrannten „Götzen“) in Form eines eisenbeschlagenen Holzeimers und eines Bronzebeckens sozusagen eine „Lu-xus-Ausführung“ eines Geschirrdepots nie-dergelegt worden (Ullrich 2003, 48ff.). Das-selbe gilt vielleicht auch für den „Vierer-Satz“ ganz gleichartiger, auf die Mündung gestell-
Abb. 14: Die Pferdchenfigur aus einer Siedlungsschicht auf der Dominsel von Brandenburg a. d. H. darf als Amulett gedeutet werden und stammt aus dem 11./12. Jh.
Abb. 15: Eine menschenähnlich gestaltete Holzbohle wurde angebrannt in der Baugrube des Burgbrunnens von Raddusch, Lkr. OberspreewaldLausitz, deponiert
26 Kersting, Slawen in Brandenburg
9 Fernbeziehungen und Schatzfunde
Aus Schriftquellen und Funden lässt sich eine hohe Mobilität von Waren und Personen insbe-sondere in der späteren Zeit ab dem 10. Jh. er-schließen. Slawische Krieger wurden 982 Zeu-gen der Niederlage Kaiser Ottos II. gegen die Araber in Süditalien – was offenbar den will-kommenen Anlass für den wohl schon geplan-ten Slawenaufstand von 983 lieferte. Die euro-paweiten Beziehungen der Nordwestslawen spiegeln sich im Fundgut wider, das den Aus-tausch mit entfernten Räumen belegt: Partner im Norden sind das Baltikum und Skandinavi-en, im Osten Polen, Böhmen und die Kiewer Rus‘ und im Westen das Frankenreich bzw. später das salisch-ottonische „deutsche“ Reich. Verbindungen führen aber auch durch das Frankenreich hindurch bis ins arabische Spani-en, im Südosten bis nach Byzanz und wieder-um bis nach Arabien. Die Slawen konnten dabei vor allem Naturprodukte wie Honig, Wachs und Felle anbieten, ihr Interesse lag wiederum bei Luxusgütern und Waffen, vor allem bei frän-kischen Schwertern. Bergkristall und Bern stein, Karneolperlen und „Owrutscher“-Schiefer-Spinnwirtel werden im Norden und Osten ein-getauscht. Ein regelrechter Silberstrom ergießt sich in Form arabischer und später deutscher Münzen ins Land – er ist u. a. als der Ertrag aus einem schwunghaften Sklavenhandel anzuse-hen, denn auch Menschen sind als mobile Han-delsware unterwegs. Quer durch das christliche Reich der Franken und Ottonen – über einen großen Umschlagplatz bei Verdun – gelangen sie ins arabische Andalusien (McCormick 2002, 173), denn Heere und Harems der Araber brauchten ständig Nachschub. Das Wort „Skla-ven“ geht bezeichnenderweise auf die arabische Bezeichung für die Slawen „al saqaliba“ zurück, die griechische Bezeichnung lautete „sklabenoi“. Die Schatzfunde lassen den Anteil auch der ländlichen Bevölkerung am Wohlstand erken-nen, oft stammen sie gerade aus deren Siedlun-gen und nicht nur von Burgen. Die Schätze die-nen aber sicher auch dem Prestige und werden vielleicht in erster Linie als „totes Kapital“ ver-borgen, denn in den wirtschaftlich entwickel-teren Regionen des Reiches bleibt das Geld im Umlauf anstatt im Boden gehortet zu werden. Mangels „Kleingeld“ verwendete man im 9./10 Jh. überwiegend „Hacksilber“ – zerklei-nerten Schmuck und Münzen – während später zunehmend Münzhorte überwiegen. Schwer-punkte der Schatzfundbildung liegen im Ha-velland und an der Oder sowie im Ostseeraum
Abb. 16: Das Schwert aus dem Dreetzer See, Lkr. OstprignitzRuppin, stammt aus fränkischer Produktion des 10. Jhs.
Abb. 17: Auch der Steigbügel des 11. Jhs. aus dem Balti kum ist ein Gewässerfund von einem Havelüber gang beim Burgwall Pritzerbe, Lkr. PotsdamMittelmark
Abb. 18: Ein hohles Blechkreuz aus einer Siedlung spätsalwischen bei Schmergow im Havelland dürfte als Reliqiuar verwendt worden sein
27Kersting, Slawen in Brandenburg
10 Übergang und Wandel
Die letzten archäologisch erschließbaren Äu-ßerungen des slawischen Bevölkerungsanteils unter neuer Herrschaft nach dem deutschen Ausgreifen in die Mark Brandenburg sind schwer zu fassen. Einen Einblick in diese „Wen-dezeit“ Mitte des 12. Jhs. liefern Grabfunde als Zeugnisse des Übergangs unseres Raumes ins christliche Hochmittelalter.
und zeigen damit einen regen Austausch über die dadurch rekonstruierbare Fernverbindun-gen an (Abb. 19), die in West-Ost Richtung in Form von Straßen und in Nord-Süd-Richtung auf den Flüssen funktionierten (Herrmann 2003, 57).Eine erste eigene slawische Münzprägung im 12. Jh. durch Jaxa von Köpenick und Pribislaw-Heinrich von Brandenburg dürfte zunächst nur Ausdruck des eigenen Herrschaftsanspruchs ge-wesen sein, der unmittelbar vor dem endgültigen deutschen Ausgreifen über die Elbe sowohl von außen als auch durch „innere“ Konkurrenten als bedroht empfunden wurde.Als geradezu programmatisch ist eine Münze der 1140er Jahre zu verstehen (Abb. 20): Auf ihren beiden Seiten sind Pribislaw-Heinrich und Albrecht der Bär jeweils als thronender Herr-scher dargestellt. Die Münze wurde offenbar von beiden gemeinsam in Eintracht herausgege-ben, um die gemeinsame Herrschaft bzw. die friedliche Übergabe derselben propagandistisch im antiken Sinne einer concordia zu feiern (Bahrfeldt 1889, 61ff., Typ 4, Taf. 1,4; vgl. Wus-terhausen: Bauer et al. 2009).Schlaglichtartig deutlich wird die Einbindung in ein europaweites Beziehungsnetz am Münz-fund von Plänitz im Ruppiner Land mit 601 Randpfennigen der Mitte des 11. Jhs. Als einzigen „nichtmonetären“ Bestandteil enthielt er nämlich auch ein exotisches Medaillon (Abb. 21). Auf einer Seite erkennt man ein ge-läufiges byzantinisches Münzmotiv des 10. und 11. Jhs., ergänzt mit Figürchen in einem ver-meintlich „typisch slawischen“ Habitus. Die andere Seite zeigt einen Reiter mit Fahnenlan-ze, angelehnt an zeitgenössische Siegeldarstel-lungen, wie z. B. von Heinrich dem Löwen aus der Mitte des 12. Jhs. (Kersting 2009a). Münz-bilder der gleichen Zeit zeigen ebenfalls dieses Motiv, u. a. Pribislaw-Heinrich von Branden-burg als Reiter. Das Stück ist im Überschnei-dungsbereich unterschiedlicher kul tureller Einflüsse zu verorten: aus dem byzantinischen Reich, dem westlichen Russland, dem skandi-navischen Raum sowie dem Deutschen Reich. Im Brennpunkt dieses Überschneidungsberei-ches liegt die Kiewer Rus’, eine Reichsbildung zwischen Ostseeraum und Schwarzem Meer, durch Staatsverträge mit Byzanz verbunden. Dem Verfertiger waren Vorbilder aus den ver-schiedenen kulturellen Zusammenhängen ge-läufig, zugänglich und wohl auch verständlich; er schuf daraus einen „interkulturellen“ Ge-genstand, einen Träger symbolischer Bildin-halte als Zeugnis einer echten Kultursynthese.
Abb. 19: Die Verteilung von Schatzfunden ist anscheinend an das Fernstraßen und Wasserwege netz gebunden
Abb. 20: Gemeinsam herausgegebene Münze, welche PribislawHeinrich und Albrecht den Bären zeigt
Abb. 21: Das Medaillon aus dem Münzschatzfund des 11. Jhs. von Plänitz, Lkr. OstprignitzRuppin, zeigt Motive verschiedener kultureller Milieus
28 Kersting, Slawen in Brandenburg
Raum schon etwa ein Jahrhundert vor dem Ausgreifen der Deutschen Reiches in die Nord-mark jenseits der Elbe 1147 im Zuge des Wen-denkreuzzuges eine Art „Reichtumszentrum“ an, das „sich durch reiche Grab- und Hortfun-de sowie Importgüter“ heraushebt (vgl. Brather 2004, 479, dort aber bezogen auf das kasier- und völkerwanderungszeitliche Dänemark). Die Funde sind seit September 2008 im Ar-chäologischen Landesmuseum im Paulikloster in Brandenburg a. d. H. zu sehen.
11 Probleme und Chancen der Archäologie der Slawenzeit
Gravierende – z. T. allgemeine, aber auch „sla-wenzeitspezifische“ – archäologische Probleme schränken den Blick in unterschiedlicher Weise ein, im ungünstigsten Falle in Kombination miteinander. Auf der anderen Seite sind aber in der Archäologie der Slawenzeit ebenso spezifi-sche Chancen vorhanden, die diese Effekte teil-weise ausgleichen.Die Probleme sind materialbedingt, wenn an-hand des oft nur relativ ungenau datierbaren Fundmaterials die zeitliche Entwicklung beob-achteter Strukturen unklar bleibt. Befundbe-dingte immanente Einschränkungseffekte er-geben sich durch geringe Erhaltungstiefe flachgründiger Hausbefunde und die archäolo-gisch oft kaum erkennbaren Grab-Befunde. Weitere Einschränkungen wie mangelnde Komplettuntersuchungen von Objekten wie Siedlung, Burgwall oder Gräberfeld sind „all-gemein-archäologische“ Probleme.Die Datierungsunschärfe der Keramik kon-trastiert umso stärker im Vergleich mit den in dieser Periode zunehmenden jahrgenauen Daten historischer Ereignisse. Die spezielle Er-haltungsqualität organischer Materialien mit dem Effekt einer jahrgenauen Datierbarkeit von Holzfunden durch die Dendrochronologie (Biermann 1999) erlaubt häufig die Korrelie-rung archäologischer Befunde mit diesen histo-risch überlieferten Ereignissen, wie es in keiner vorangegangenen Epoche der Ur- und Frühge-schichte möglich ist.
In Wusterhausen, wo es bemerkenswerte Kontinuitäten zwischen einem spätslawi-schem Wirtschafts- und Herrschaftszentrum und frühdeutscher Burg und Stadt gibt, waren 2006 spektakuläre Gräber entdeckt worden. Angehörige einer Elite waren in zwei Kammergräbern mit wertvollen Schwertern in prunkvoller Kleidung beigesetzt worden (Abb. 22). Ein Daubeneimer und ein Holzgefäß dienten als Trink- oder Handwaschservice. Im reicheren Grab war der Tote (bis auf einen Arm) entfernt worden. Da das Schwert samt Goldgewebe im Grab verblieb, ist wohl weni-ger eine gezielte Beraubung als die absichtliche Entnahme des Leichnams als Grund für die Öffnung des Grabes zu unterstellen – viel-leicht für eine nachträgliche Bestattung in ge-weihter Erde. Beide Schwerter sind in die Zeit vom späten 11. bis zum 12. Jh. einzuordnen. Herausragende, repräsentative Gräber sind Zeichen von Umbruchs- und Krisenzeiten, wie sie im Falle der Wusterhausener Gräber gut nachvollziehbar sind. Diese Prunkgräber einer Elite, „zwischen den Welten“ (heidnisch/christlich, sächsisch-deutsch/slawisch) werfen ein Schlaglicht auf die religiösen und politi-schen Umbrüche, die der nördliche elbslawi-sche Raum vom späten 11. bis zum frühen 13. Jh. erlebte – vom Kontakt mit den sächsischen Nachbarn über den Wendenkreuzzug von 1147 bis zur Herausbildung lokaler Kleinherrschaf-ten in der Prignitz in seiner Folge (Bauer et al. 2009).Im Zusammenhang mit dem nur knapp 5 km entfernt gefundenen Plänitzer Schatz und sei-nen Fernbeziehungen deutet sich in diesem
Abb. 22: Mit Prunkschwert und in goldbrokatverzierter Kleidung wurde ein Angehöriger der Elite in Wusterhausen, Lkr. OstprignitzRuppin, beigesetzt
29Kersting, Slawen in Brandenburgl
Dulinicz 2006M. Dulinicz, Frühe Slawen im Gebiet zwischen unterer Weichsel und Elbe. Eine archäologische Studie. Stud. Siedlungsgesch. u. Arch. Ostseegebiete 7 (Neumünster 2006).
Frey 2001K. Frey, Die Keramik und die Kleinfunde des Pennigsbergs. In: F. Biermann (Hrsg.), Pennigsberg – Untersuchungen zu der slawi-schen Burg bei Mittenwalde und zum Siedlungswesen des 7./8. bis 12. Jahrhunderts am Teltow und im Berliner Raum (Langenweiß-bach 2001) 113–227.
Frey 2003K. Frey, Spätslawische und spätmittelalterliche Standbodenkera-mik in Südostdeutschland – Traditionen und Neuanfänge. Jahrb.Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 50, 2002 (2003) 265–280.
Grebe 1991K. Grebe, Die Brandenburg vor 1000 Jahren (Potsdam 1991).
Grebe 1999K. Grebe, Der Übergang von der Brand- zur Körperbestattung im Hevellergebiet. In: E. Cziesla/Th. Kersting/St. Pratsch (Hrsg.), Den Bogen spannen… Festschrift für B. Gramsch. Beitr. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropa 20 (Weißbach 1999) 461–470.
Gringmuth-Dallmer 2000E. Gringmuth-Dallmer, Siedlungslandschaften, Siedlung und Wirt-schaft der Westslawen zwischen Elbe und Oder. In: A. Wieczorek/H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschich-te, Kunst und Archäologie 1 (Stuttgart 2000) 97–103.
Gustavs 1984S. Gustavs, Spätslawische Siedlungsfunde von Schmergow, Kr. Potsdam-Land. Veröff. Mus. Ur- u. Frühgesch. Potsdam 18, 1984, 175–224.
Hanik 2009S. Hanik, Tiernutzung bei den Slawen. In: Müller et al. 2009, 31–35.
Henning 1991J. Henning, Slawen und Deutsche im östlichen Brandenburg. Arch. Deutschld. 2, 1991, 22–25.
Henning 2002aJ. Henning (Hrsg.), Europa im 10. Jahrhundert, Archäologie einer Aufbruchszeit (Mainz 2002).
Henning 2002b J. Henning, Der slawische Siedlungsraum und die ottonische Ex-pansion östlich der Elbe: Ereignisgeschichte – Archäologie – Dend-rochronologie. In: Henning 2002a, 131–146.
Henning/Heußner 1992J. Henning/K.-U. Heußner, Zur Burgengeschichte im 10. Jahrhun-dert. Neue archäologische und dendrochronologische Daten zur Anlage vom Typ Tornow. Ausgr. u. Funde 37, 1991, 314–324.
Herrmann 1960J. Herrmann, Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle Gross-Berlins und des Bezirkes Potsdam. Schr. der Sektion Vor- u. Früh-gesch. 9 (Berlin 1960).
Herrmann 1985J. Herrmann (Hrsg.), Die Slawen in Deutschland, Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Veröff. Zentralinst. Alte Gesch. u. Arch. Akad. Wiss. DDR 14 (Berlin 1985).
Herrmann 2003J. Herrmann, Typen von Kommunikationswegen im frühen Mit-telalter im nordwestslawischen Gebiet. Mitt. deutsch. Ges. Arch. Mittelalter u. Neuzeit 14, 2003, 55–64.
Herrmann/Donat 1979J. Herrmann/P. Donat (Hrsg.), Corpus archäologischer Quel-len zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen De-mokratischen Republik (7. bis 12. Jh.), 3. Lfg. (Berlin 1979). Jahns 2009Landschaftsbild im Wandel – Die Mark Brandenburg zwischen dem 11. und dem 15. Jh. In: Müller et al. 2009, 152–157.
Literatur
Anders/Gringmuth-Dallmer 2007J. Anders/E. Gringmuth-Dallmer, Slawenzeitliche Flussfunde als Quellen der Kommunikationsgeschichte. In: Siedlung, Kommuni-kation 2007, 13–18.
Bahrfeldt 1889E. Bahrfeldt, Das Münzwesen der Mark Brandenburg. Von den ältesten Zeiten bis zum Anfange der Regierung der Hohenzollern (Berlin 1889–1913; Neudr. d. Orig.-Ausg. 1975).
Bauer et al. 2009U. Bauer/F. Biermann/O. Brauer/Th. Kersting/H. Lettow, Spätsla-wische Gräber mit Schwertbeigabe von Wusterhausen an der Dosse – ein Vorbericht. In: Biermann et al. 2009a, 327–337.
Biermann 1999F. Biermann, Dendrochronologie und Keramik des 8. bis 12. Jahr-hunderts im Raum zwischen Elbe und Oder/Neiße. In: L. Polácek (Hrsg.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March (Brno 1999) 97–123.
Biermann 2001F. Biermann, Der Brunnenbau des 7./8. bis 11./12. Jahrhunderts bei den nördlichen Westslawen (Polen und Ostdeutschland). Ethnograph.-Arch. Zeitschr. 42, 2001, 211–264.
Biermann et al. 1999F. Biermann/St. Dalitz/K.-U. Heußner, Der Brunnen von Schmerzke, Stadt Bbg. a.d. Havel, und die absolute Chronologie der frühslawischen Besiedlung im nordostdeutschen Raum. Prä-hist. Zeitschr. 74, 1999, 219–243.
Biermann et al. 2009aF. Biermann/Th. Kersting/A. Klammt (Hrsg.), Siedlungsstruktu-ren der Slawenzeit. Vorträge der Slawensektion auf der Tagung des MOVA in Halle/Saale, März 2007. Beitr. Ur- u. Frühgesch. Mittel-europa 52 (Langenweißbach 2009).
Biermann et al. 2009bF. Biermann/N. Goßler/H. Kennecke, Archäologische Forschun-gen zu den slawenzeitlichen Burgen und Siedlungen in der nord-westlichen Prignitz. In: Müller et al. 2009, 36–47.
Bleile 1999R. Bleile, Slawische Brücken in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrb.Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 46, 1998 (1999) 127–169.
Bleile 2008R. Bleile, Quetzin – eine spätslawische Burg auf der Kohlinsel im Plauer See: Befunde und Funde zur Problematik slawischer Insel-nutzungen Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin 2008).
Brather 2000M.-J. Brather, Ein frühslawisches Grubenhaus aus Dorf Zechlin, Lkr. Ostprignitz-Ruppin. Veröff. Brandenburg. Landesmus. Ur- u. Frühgesch. 33, 1999 (2000) 107–126.
Brather 2001S. Brather, Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirt-schaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ost-mitteleuropa (Berlin, New York 2001).
Brather 2004 S. Brather, Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie: Geschichte, Grundlagen und Alternativen. Realle-xikon der germanischen Altertumskunde Ergbd. 42, (Berlin, New York 2004).
Dalitz 2009St. Dalitz, Die Brandenburg in der Havel – Arbeitsstand zu Topo-grafie und Entwicklung der Insel und Burg. In: Müller et al. 2009, 54–78.
Donat 2001P. Donat, Aktuelle Fragen der archäologischen Forschungen zur Geschichte der Slawen im nördlichen Deutschland. Jahrb. Boden-denkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 48, 2000 (2001) 215–257. Donat/Govedarica 1998P. Donat/B. Govedarica, Die jungslawische Siedlung Falkenwalde, Fpl. 10, Lkr. Uckermark. Veröff. Brandenburg. Landesmus. Ur- u. Frühgesch. 32, 1998, 141–187.
30 Kersting, Slawen in Brandenburg
Seyer 1999H. Seyer, Slawische Silberschatzfunde des Mittelalters aus der Prä-historischen Sammlung des Stadtmuseums Berlin (Berlin 1997).
Siedlung, Kommunikation 2007F. Biermann/Th. Kersting (Hrsg.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur sla-wischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4. bis 7. April 2005. Beitr. Ur- u. Früh-gesch. Mitteleuropa 46 (Langenweißbach 2007).
Ullrich 2003M. Ullrich, Slawenburg Raddusch. Eine Rettungsgrabung im Nie-derlausitzer Braunkohlenabbaugebiet. Veröff. Brandenburg. Lan-desarch. 34, 2000 (2003) 121–194.
Werner 2004 H. Werner, Von Erdnägeln und Kastenelementen: Neues zur Kon-struktion der slawischen Burg von Lenzen, Lkr. Prignitz. Arch. Berlin u. Brandenburg 2003 (2004) 111–115.
Wetzel 1979G. Wetzel, Slawische Hügelgräber bei Gahro, Kr. Finsterwalde. Veröff. Mus. Ur- u. Frühgesch. Potsdam 12, 1979, 129–158.
Wieczorek/Hinz 2000A. Wieczorek/H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000. Bd. 1 (Stuttgart 2000).
Abbildungsnachweise
1: Donat 2001, 222. – 2: Wieczorek/Hinz 2000, 97. – 3: M. Härtel, BLDAM. – 4: Kennecke 2008, 36 Abb. 13. – 5: Grebe 1991, 56. – 6: Hen-ning 1991, 25. – 7: Wieczorek/Hinz 2000, 68. – 8: Wetzel, BLDAM. – 9: Bönisch BLDAM. – 10: Henning 1991, 25. – 11: Donat/Govedarica 1998. – 12; 13; 14; 16; 18; 22: Sommer, BLDAM. – 15: Ullrich 2003, 63. – 17: Herrmann/Donat 1979, 79/58. – 19: Herrmann 2003, 57. – 20: I. Borak, BLDAM. – 21: Th. Kersting, BLDAM. – Bearbeitungen G. Mat-thes BLDAM .
Anschrift
Dr. Thomas Kersting, Brandenburgisches Landesamt für Denkmal-pflege und Archäologisches Landesmuseum. OT Wünsdorf, Wünsdor-fer Platz 4–5, D-15806 Zossenthomas.kersting@bldambrandenburg.de
Jeute et al. 2007G. H. Jeute/J. Schneeweiß/C. Theune (Hrsg.), aedificatio terrae. Bei-träge zur Umwelt- und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. Fest-schrift für Eike Gringmuth-Dallmer zum 65. Geburtstag. Internat. Arch. – Stud. honoraria 26 (Rahden/Westf. 2007).
Jungklaus 2009B. Jungklaus, Zur Brandenburgischen Bevölkerung im Mittelalter und ihren Lebensumständen aus anthropologischer Sicht. In: Mül-ler et al. 2009, 249–281.
Kennecke 2008H. Kennecke, Die slawische Siedlung von Dyrotz, Lkr. Havelland. Mat. Arch. Brandenburg 1 (Rahden/Westf. 2008).
Kersting 2004 Th. Kersting, Slawenzeitliche Burgwälle in Brandenburg. Arch. Berlin u. Brandenburg 2003 (2004) 36–44.
Kersting 2009aTh. Kersting, Interkulturell. Das Medaillon aus Plänitz. Arch. Ber-lin u. Brandenburg 2007 (2009) 106–109.
Kersting 2009bTh. Kersting, Slawenzeitliche Siedlungsstrukturen – Einführung. In: Biermann et. al 2009a, 9–16.
Kersting et al. 2007Th. Kersting/S. Hanik/S. Jahns, Päwesin „Fischerstraße“: eine sla-wische Siedlung im Havelland. In: Jeute et al. 2007, 201–210.
Kirsch 2009K. Kirsch, Die slawische Burg auf der Brandenburger Dominsel – ein herausragender Burgort im Fundspektrum. In: Müller et al. 2009, 48–53.
Kluger/Lehnert 1994 Die westsächsische Geographie Germaniens von König Alfred dem Großen. Veröff. Brandenburg. Landesmus. Ur- u. Frühgesch. 28, 1995, 181–190.
Knaack 1996 A. Knaack, Germanische und slawische Eisenverhüttung in Rep-ten, Niederlausitz. Ethnograph.-Arch. Zeitschr. 37.3, 1996, 375–381.
Lübke 2004Ch. Lübke, Die Deutschen und das europäische Mittelalter – Das östliche Europa (Berlin 2004).
McCormick 2002M. McCormick, Verkehrswege, Handel und Sklaven zwischen Eu-ropa und dem Nahen Osten um 900. Von der Geschichtsschreibung zur Archäologie? In: Henning 2002a, 171–180.
Müller et al. 2009J. Müller/K. Neitmann/F. Schopper, Wie die Mark entstand. 850 Jahre Mark Brandenburg. Forsch. Arch. Land Brandenburg 11 (Wünsdorf 2009).
Partenheimer 2007L. Partenheimer: Die Entstehung der Mark Brandenburg (Weimar 2007).
Partenheimer 2009L. Partenheimer, Vom Hevellerfürstentum zur Mark Brandenburg. In: Müller et al. 2009, 298–323.
Plate 2000Ch. Plate, Baggerfunde aus dem Dreetzer See. In: Potsdam, Bran-denburg und das Havelland. Führer zu archäologischen Denkmä-lern in Deutschland 37 (2000) 276–279.
Pollex 2007A. Pollex, Der Übergang zur Körperbestattung bei den Nordwest-slawen 2 – Überlegungen zum Verlauf der Christianisierung bei den pomoranischen, lutizischen und ranischen Stämmen. In: Sied-lung, Kommunikation 2007, 363–392.
Schmidt 1991V. Schmidt, Das Bestattungswesen der Lutizen. In: F. Horst/H. Kei-ling (Hrsg.), Bestattungswesen und Totenkult (Berlin 1991) 275–284.
Schneeweiß 2007J. Schneeweiß, Die Rolle des Gewässersystems bei der slawischen Einwanderung am Beispiel des Werders bei Neubrandenburg – ein Beitrag zur Kontinuitätsdiskussion. In: Siedlung, Kommunikation 2007, 19–28.