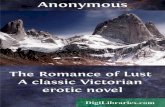Algi, Ye shoveh, The Elymaian Rock-Carving, Bazoft Char Mahal & Baxtiyari,IRAN, by Mehr Kian
Lust auf mehr machen - eurotransport
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Lust auf mehr machen - eurotransport
Lust auf mehr machenDie Wirtschaftsmacher stellen ihre Kampagnenmotive vor –
14 Logistikhelden stehen in den Startlöchern
D I E Z E I T U N G F Ü R T R A N S P O R T, L O G I S T I K U N D M A N A G E M E N T
www.eurotransp or t .d e 6035 Euro 2,90Nr. 9 · 18. April 2019
Sei d enstraße: Wer ist schneller? Lkw und Züge wetteifern um die kürzeste Laufzeit von China nach Europa. Seite 8
TRANS AKTUELL-SYMPOSIUM ZUR AUTOMOBILLOGISTIK – BLICK HINTER DIE KULISSEN BEI CONSTELLIUM
Die Kampagne, die von den Wirtschaftsmachern initiiert wur-de, soll keine Recruiting-Kampag-ne sein, wie Wirtschaftsmacher-Sprecherin Frauke Heistermann in Berlin betonte. Zunächst stehe im Vordergrund, das Image der Branche zu verbessern: „Wir wol-len für die Logistik eine bessere Sichtbarkeit und Wertschätzung erreichen. Und natürlich auch Be-werber für Jobs finden – und zwar nicht aus der dritten Reihe“, sagte Heistermann.
Bandbreite der Logistik
Die verschiedenen Motive der Logistikhelden sollen in den So-cial-Media-Kanälen für die Band-breite der Logistikbranche wer-ben. Angesprochen werden sollen Nachwuchskräfte wie Studierende aus verschiedenen Bereichen — BWL, VWL, Mathematik, IT und Wirtschaftsingenieure — und Auszubildende aus den verschie-denen Berufen. Aber auch Unge-lernte, außerdem berufserfahrene und wechselwillige Arbeitnehmer. Das mediale Roll-out der Kampa-gne Logistikhelden soll am 5. Juni
Die Initiative „Die Wirt-schaftsmacher“ hat die drei allgemeinen Kampagnen-motive vorgestellt, die für
die Logistikbranche werben sol-len. Zukunft, Frische und Frei-heit sind die Anzeigenthemen: Die Message ist die Vielfalt der Logistik. Zeitgleich war Start-schuss für die 14 Logistikhelden – ausgewählte Mitarbeiter deut-scher Unternehmen, die künftig als Testimonials für die Attrakti-vität der Branche werben.
Während sich rund 35 von 80 engagierten Wirtschaftsmachern in Berlin zum Tag der Logistik trafen, waren zur selben Zeit die Logistikhelden in Köln bei der Arbeit: In einem Film- und Fo-tostudio wurden die Freiwilligen für die Kampagne mediengerecht fotografiert und gefilmt. Darun-ter eine angehende Lokführerin der Deutschen Bahn, ein Zu-steller von UPS, der sowohl mit dem Lkw als auch mit dem Las-tenrad unterwegs ist, eine junge Lagermitarbeiterin von Seifert Logistics, die an Gabelstapler-Wettbewerben teilnimmt, oder ein Standortleiter von Loxxess, der das Thema Künstliche Intel-ligenz im Lager eingeführt hat.
im Rahmen der Messe Transport Logistic stattfinden.
Hinter den Wirtschaftsma-chern stecken Engagierte aus der ganzen Branche, „Macher, die nichts dem Zufall überlassen“, wie Heistermann sagte – und sich deshalb auch über das ei-gene Unternehmen hinaus aktiv dafür einsetzen, dass die Logis-tik besser wahrgenommen wird. „Die Initiative braucht dafür die Aktivität aller Mitwirkenden und kann auch nur entsprechend des Budgets Wirkung entfalten“, sagte Heistermann.
Harald Seifert, Geschäftsführer von Seifert Logistics und Mitglied des Lenkungskreises der Wirt-schaftsmacher, appellierte daher an alle Beteiligten entlang der ganzen Lieferkette, auch finanzi-ell zu der Kampagne beizutragen – bei dem Kampf um die Talente müsse die ganze Branche ran. Aber mit Geld allein sei es nicht getan: Im Unternehmen Seifert seien die Mitarbeiter schon jetzt stolz auf den Beitrag ihres Hauses für mehr Wertschätzung. „Jeder Wirtschaftsmacher ist Botschaf-ter und Multiplikator“, sagte Sei-fert: „Vervielfältigen Sie vorhanden Content der Wirtschaftsmacher,
laden Sie zum Tag der Logistik, machen Sie interne Logistikhel-den-Wettbewerbe, befüllen Sie ei-nen youtube-Kanal, sprechen Sie fachnahe Verbände wie ihre IHK an“ appellierte Seifert, „geben wir gemeinsam Gas!“
An der Initiative Wirtschafts-macher nehmen neben Logis-tikdienstleistern und Schienen-verkehrsunternehmen auch Industriekonzerne, Handelsun-ternehmen und Softwareanbieter teil, ebenso wie die Branchen-verbände. Auch der ETM Verlag beteiligt sich mit seinen Marken eurotransport.de, trans aktuell, FERNFAHRER und lastauto om-nibus an der Initiative.
Text: Ilona Jüngst | Illustrationen: Die Wirtschaftsmacher, Victor Koldunov/stock.adobe.com, Montage: Marcus Zimmer
IT: Wie Sie sich vor Cyber-Crime schützen.
Leitfaden gegen CyberkriminalitätSpediteursverband Fiata gibt Tipps – immer einen Plan B in der Schublade haben
www.t el e-traf f ic .d e 6035 Euro 2,90Nr. 1 · 18. April 2019
Spediteure ausgesetzt sind. „Diemeisten dieser Unternehmen sindD
as Beratungsgremiumfür Rechtsangelegenheiten
D I E Z E I T U N G F Ü R I T- L Ö S U N G E N R U N D U M S N U T Z F A H R Z E U G
Te leTraf f ic
nicht eingehaltenen rechtlichenVerpflichtungen führen mit den
Herausforderung, die weltweit 76 Hafenterminals am Laufen zu hal
Siehe Beilage
KV: Wie Speditionen auf die Schiene verlagern, sagte Paneuropa-Chef Carsten Hemme (li.) beim trans aktuell-Symposium.
Seiten 6–7
Haus 61: Im Frankfurter Bahnhofsviertel entsteht ein Labor für Start-ups.
Seite 10
Praxis: Die Spedition Craiss baut ihre Geschäftsfelder aus.
Seite 12
Sicherheit: Dekra hat die ersten Abbiegesysteme technisch abgenommen.
Seite 14
Test: Der neue Iveco Daily wartet mit vielen Assistenzsystemen und Einsparpotenzialen auf.
Seite 15
Verkehrsforum holt Klinkner
Das Präsidium des
Deutschen Verkehrs-
forums hat auf der 35.
Mitgliederversammlung
Prof. Raimund Klinkner
als neuen
Vorsit-
zenden
gewählt.
Kinkner,
von 2007
bis Ende
2017 Vorstandsvorsit-
zender der Bundesver-
einigung Logistik, folgt
auf Dr. Jörg Mosolf,
Vorstandsvorsitzender
der Mosolf Gruppe, der
das Amt für ein Jahr als
Interimsvorsitzender
übernommen hatte.
Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel: Neue Mobilitätsformen und -konzepte, der Um-stieg auf alternative Antriebe und das automati-sierte Fahren stellen Zulieferer und Hersteller vor Herausforderungen. Veränderte Materialeinsät-ze und -flüsse sowie Produktionsabläufe haben erhebliche Auswirkungen auf die Logistik. Was das für Speditionen bedeutet, zeigt ein trans ak-tuell-Symposium am 9. Mai beim Logistikdienst-leister Transco in Singen.Transco-Geschäftsführer Christian Bücheler er-läutert, wie sich Transco am Standort Gottma-
dingen zum Logistikpartner der Automotivebran-che entwickelt hat. In der Gemeinde ist Transco für den Automobilzulieferer Constellium tätig. Constellium-Logistikleiter Daniel Johe gewährt den Teilnehmern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Weitere Referenten: Prof. Stephan Freichel (TH Köln), Thomas Lammer (Vorstand Schnellecke), Rainer Schmitt und Benjamin Som-mer (Schmitt Logistik), Stefan Brötz (AVSL) und Reinhard Bohrer (Schunck). Am besten gleich Plätze sichern. Mehr Informationen und Anmel-dung unter eurotransport.de/tasymposien. rat
Praxis hautnahAM 9. MAI BEI TRANSCO IN SINGEN
DIREKT UND ALLESAUS EINER HAND
Der Ersatzteil-Servicevon KRONEBestell-Hotline:+49 5951-209 302
www.krone-trailer.com
02
om
trans aktuell 9 18. April 2019 M E I N U N G U N D H I N T E R G R U N D2
BVL zeichnet Lkw Walter aus
Die Bundesvereinigun-
gen Logistik Österreich
und Deutschland ver-
geben den Nachhaltig-
keitspreis Logistik 2019
an Lkw Walter. Die Aus-
zeichnung im Rahmen
des 35. Logistik Dialogs
in Wien gab's unter
anderem für 300.000
Tonnen weniger CO2 pro
Jahr durch Kombinierte
Verkehre.
Das Güterverkehrskonzept Baden-Württemberg (GVK BW) nimmt Formen an. Ziel des im Mai 2017 vorge-
stellten Konzeptes ist es, Schiene und Binnenschifffahrt zu fördern sowie den Straßengüterverkehr nachhaltiger zu gestalten. Nach ei-ner europaweiten Ausschreibung wurde die Hochschule Heilbronn im Rahmen einer Bietergemein-schaft beauftragt, spezifische Aufgabenpakete zu den Verkehrs-trägern Straße, Schiene und der Binnenschifffahrt zu erarbeiten.
digt Prof. Tobias Bernecker an. Mit seinem Team an der Hochschule Heilbronn koordiniert er die Ar-beiten am GVK BW und arbeitet selbst aktiv an den Inhalten mit. Drei weitere Foren folgen im Frühsommer in Reutlingen, Lud-wigsburg und Ulm. Dort gehe es um Güterverkehre in der Stadt. Ein weiteres Forum folgt zu Groß-raum- und Schwertransporten. Danach werde der Schlussbericht erstellt, der im ersten Quartal 2020 vorliegen soll, sagt Bernecker.
Der Praxisbezug des Konzepts, konkret die Diskussion mit Exper-ten, findet in der Branche großen Anklang. „Ich habe die Foren als sehr positiv und gewinnbringend empfunden“, sagt Dr. Timo Didier, Geschäftsführendes Vorstandsmit-glied des Verbands des Württem-bergischen Verkehrsgewerbes (VV Württemberg). Jedes Forum hatte einen anderen Schwerpunkt, der sich aufgrund der geografischen und wirtschaftlichen Struktur der jeweiligen Stadt anbot: in Ehingen der Kombinierte Verkehr (KV), in Heilbronn das Thema Innovatio-nen, in Weil am Rhein die Themen Personal und Infrastruktur sowie in Mannheim die Hafenlogistik.
Der KV sei seinem Verband wichtig, unterstreicht Didier mit Blick auf die Diskussion in Ehin-gen. Der Austausch mit anderen Experten habe auch gezeigt, wie schwierig es sei, KV-Standorte und Relationen zu definieren. „Das A und O sind hohe Mengen, die wir dauerhaft für einen Zug benötigen.“
Alternative Antriebs- und Zu-stellkonzepte für Ballungsräu-me liegen dem VV Württemberg ebenfalls am Herzen, wie Didiers Stellvertreter Holger Tenfelde be-tont. Daher begrüßt er es, dass die urbane Logistik Thema eines wei-teren Forums sein wird. In Stutt-gart gebe es bereits einige gute An-sätze, etwa durch den Einsatz von Elektro-Lkw und Lastenrädern.
Bei Großraum- und Schwertransporten sei der Hand-lungsbedarf ebenfalls groß. Trotz eines 2017 aufgesetzten Brand-briefs aufgrund der langen Ge-nehmigungsverfahren stünden konkrete Maßnahmen noch aus. „Seit mehr als zehn Jahren schrei-ben wir schon Briefe, jetzt muss sich endlich was tun“, fordert Dr. Didier. Er ist froh, dass das GVK BW Formen annimmt und den Stellenwert von Güterverkehr und
Logistik im Land unterstreicht. Wünschen würde er sich ferner eine Bedarfsanalyse für die Infra-struktur sowie eine Betrachtung der Güterströme vor allem mit Blick auf die Straße, um auch dar-aus Erkenntnisse zu ziehen.
Andererseits habe man in der Diskussion mit den Praktikern bereits zahlreiche Hemmnisse für einen nachhaltigen Güterverkehr identifiziert, sagt Prof. Bernecker, und könne diese Punkte im wei-teren Prozess aufgreifen – seien es fehlende Lkw-Parkplätze, Eng-pässe bei den Schleusen oder beim Einsatz von 740 Meter langen Gü-terzügen. „Der vom Verkehrsminis-terium initiierte Beteiligungs- und Workshop-Prozess, der für sehr viel Realitätsnähe sorgt, ist die beson-dere Stärke des Konzepts“, sagt er. „Der Konkretisierungsgrad der vie-len großen und kleinen Maßnah-men für einen nachhaltigen Gü-terverkehr in Baden-Württemberg, die im Rahmen der Fachforen ent-wickelt wurden, ist beeindruckend und für unsere weiteren Arbeiten sehr wertvoll“, so sein Resümee.
Text: Matthias Rathmann | Fotos: Thomas Küppers, HHN, VVW
KOMMENTAR
von Matthias Rathmann
Wer ist der Laufzeit-König von Eurasien?
Lok oder Lkw – wer ist der Laufzeit-König von Eurasien? Rekord!, meldet die Rail Cargo Group und wirbt mit einer Laufzeit von nur zehn Tagen für ihren Containerzug von Xi‘an nach Budapest. Zuvor gab der Logistikdienstleister Ceva bekannt, die Relation Südchina–Spanien in nur 16 Tagen bewältigt zu haben – per Lkw. Doch es geht offenbar noch schneller: Die IRU kann sich Lkw-Verkehre von Asien nach Europa in nur acht Tagen vorstellen.Das Wetteifern um die kürzeste Laufzeit auf der Seidenstraße ist in sportli-cher Hinsicht faszinierend. Ökonomisch und ökologisch hinterfragt man das Ganze aber besser nicht. Wer sich sonst mit sechs Wochen per Seefracht arrangiert, muss nicht plötzlich in einer Woche ans Ziel kommen. Die Langstrecke ist zudem die Spezialität der Schiene – warum also ohne Not No-madentum mit Lkw-Fahrern aus China Vorschub leisten?
Bericht zur SeidenstraßeSeite 4
Damit's rund läuft im LändleGüterverkehrskonzept für Baden-Württemberg auf Zielgeraden – Workshops zu den Hauptthemen
Foto
: Lkw
Wal
ter
IMPRESSUMtrans aktuellDie Zeitung für Transport, Logistik und Management
Chefredaktion trans aktuell/eurotransport.de: Matthias Rathmann (rat)
Geschäftsführender Redakteur: Carsten Nallinger (cn)
Redaktion: Andrea Ertl (ane), Ilona Jüngst (ilo), Ralf Lanzinger (rla),
Weitere Mitarbeiter: Markus Bauer (mb), Carina Belluomo (cbe), Ralf Becker (rb),
Grafik/Produktion: Frank Haug (Ltg.), Florence Frieser, Monika Haug, Oswin Zebrowski, Marcus Zimmer
Sekretariat: Uta Sickel, Sumita Brumbach
Korrespondenten Berlin/Brüssel: Hans-Peter Colditz (co), Regina Weinrich (rw)
Verlag: EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH, Das Gemeinschaftsunternehmen von Dekra, Motor Presse Stuttgart und VF Verlagsgesellschaft
Geschäftsführer: Oliver Trost
Anschrift von Verlag und Redaktion: Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Tel.: 07 11/7 84 98-31, Fax: 07 11/7 84 98-59
E-Mail: [email protected]
Internet: www.transaktuell.de
Anzeigenleitung: Werner Faas, Tel.: 07 11/7 84 98-96
Anzeigenmarkt: Norbert Blucke, Tel. 07 11/7 84 98-94
Vertrieb: Bernd Steinfeldt (Ltg.), Gerlinde Braun, Sylvia Fischer, Tel. 07 11/7 84 98-14/-18, Fax 07 11/7 84 98-46, E-Mail: [email protected]
Anzeigenverwaltung: Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Nicole Polta, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart, Tel.: 07 11/1 82-13 87
Herstellung: Thomas Eisele
Druck: Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel.
trans aktuell erscheint 24x jährlich, freitags. Höhere Gewalt entbindet den Verlag von der Lieferungspflicht, Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. Alle Rechte vorbehalten, © by ETM Verlags- und Veranstaltungs-GmbH. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos oder Zeichnungen übernimmt der Verlag keine Haftung. Die Mitglieder von Dekra erhalten trans aktuell im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Einzelpreis in Deutschland 2,90 Euro. Bezugspreise jährlich direkt ab Verlag (Lieferung frei Haus): Deutschland 69,60 Euro, Schweiz 134,40 sfr, Österreich 79,20 Euro, übriges Ausland auf Anfrage.
Studenten erhalten gegen Vorlage einer Immatrikulationsbe-scheinigung einen Nachlass von 40% gegenüber dem Kauf am Kiosk. ISSN-Nummer 0947-7268
Abonnenten-/Leserservice: trans aktuell Vertrieb, Postfach 81 02 07, 70519 Stuttgart, Tel.: 07 11/7 84 98-14/-18, Fax: 07 11/7 84 98-46, E-Mail: [email protected], Web: www.transaktuell.de/shop
Anzeigenpreisliste: Nr. 28, 2019, Gerichtsstand Stuttgart
Unterstützer von
Pannen-Notrufnummer:
0 800 524 80 00
Kaum passiert, schon repariert.
ADAC TruckService
SCHWERPUNKTE DES KONZEPTS
1) Betrachtung und Beurteilung von Maßnahmen nach ihren Systemwirkungen mit dem Fokus auf der „Synchro-Moda-lität“, das heißt dem optimalen Zusammenspiel zwischen den Verkehrsträgern
2) Nachhaltigkeit, das heißt insbesondere Beurteilung von Maßnahmen auf ihre Eignung für langfristige Strukturver-änderungen und dauerhafte Effekte (anstelle kurzfristiger isolierter Maßnahmen)
3) Gestaltbarkeit, insbesondere Fokussierung auf die Hand-lungsspielräume des Landes Baden-Württemberg für eigene Ansätze, aber auch klare Hinweise auf Felder, auf denen Maßnahmen den Dialog mit Kommunen, Bund oder EU erfordern. Quelle: HHN
Nachdem die federführenden Institute einem breiten Experten-kreis im Januar erste Zwischener-gebnisse vorgestellt hatten, folgte in den vergangenen Monaten in vier regionalen Foren eine inten-sive Diskussion darüber. Fachleu-te aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden unterwarfen die erarbeiteten Inhalte in Ehingen, Heilbronn, Mannheim und Weil am Rhein einem Praxischeck und brachten weitere Ideen ein.
„Diese Impulse werden nun aufbereitet und konsolidiert“, kün-
VV Württemberg-Chef Dr. Didier (oben) begrüßt die
Einbindung von Praktikern. Prof. Bernecker koordiniert mit seinem Team der Hoch-
schule Heilbronn die Arbeiten an dem Konzept. Eine wichtige Rolle darin spielt der KV, unten
das Terminal Kornwestheim.
trans aktuell 9 D I E S E I T E D R E I 18. April 2019 3
Mehr als nur das Contai-nerschiff, das Waren aus Asien in den Hafen bringt, mehr als nur der Lkw, der
von der Fabrik zum Handelslager und dann zur Discounterfiliale fährt: „Logistik ist mehr“ war das Motto des Tags der Logistik 2019, der der interessierten Öffentlich-keit sowie Schülern und Studen-ten einen Einblick in die Vielfalt der Logistikbranche gewährte.
Schade für die teilnehmenden Unternehmen und Organisatio-nen, vor allem aber für die Bun-desvereinigung Logistik (BVL), auf deren Initiative der Akti-onstag zurückgeht: Dieses Jahr wurden 270 Veranstaltungen ge-meldet, an denen nach Zählung der BVL rund 23.000 Personen teilnahmen – im vergangenen Jahr waren es 350 Veranstaltun-
gen mit rund 35.000 Besuchern. Ein Rückgang, der sicherlich der Tatsache geschuldet war, dass der Tag in Niedersachsen und Schleswig-Holstein mitten in die Osterferien fiel und somit viele Schüler nicht teilnahmen.
Dabei dient der Tag der Bran-che in Zeiten des Fachkräfteman-gels auch dazu, neue Arbeitskräf-te und vor allem Nachwuchs zu werben: „Wir sind die Architekten der Logistik von morgen“ hieß es etwa bei Andreas Schmid Logistik in Gersthofen, die bei der Veran-staltung gezielt Studenten und Fachpublikum auf das innovati-ve Arbeitsumfeld hinwies. Elsen Logistik lud in sein Multi-User-Logistikzentrum in Koblenz ein, um die Prozesse im Lager und vor allem die verschiedenen Berufs-bilder vorzustellen – vom Kom-
missionierer zum Junior Lean Ma-nager. Und an der TU Berlin gab es ein Logistikpraxisseminar zum Thema Künstliche Intelligenz in der Logistik (siehe Artikel unten).
Aber auch für Logistiker sel-ber ist der Tag immer wieder eine gute Möglichkeit, um sich zu in-formieren– sei es, um bei anderen Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie bei der Firma Pabst in Gochsheim, die ei-nen Rundgang durch ihr neues Logistik-Center anbot (siehe Ar-tikel unten). Oder sei es, um sich selbst über aktuelle Trends fortzu-bilden – wie bei der Veranstaltung von Ubimax in Bremen, bei der die Anwendung von Datenbrillen live getestet werden konnte.
Und vor allem richtet sich die Veranstaltung an die Öffentlich-keit, die die Logistik meist nur in
Form von Lkw, Güterbahn oder Seeschiff wahrnimmt. Dass ohne Logistik tatsächlich alles, wo-mit wir arbeiten, und vor allem die Dinge des täglichen Bedarfs fehlen würden, zeigten etwa der Handelskonzern Rewe beim Blick hinter die Kulissen seines Logis-tikzentrums in Neudietendorf bei Erfurt oder Amazon Deutschland, das gleich an zwölf Standorten seine Türen öffnete (siehe Artikel unten). Von der Krankenhauslo-gistik über die Ersatzteillogistik, Offshore-Windanlagen, Phar-magroßhandel und der Logistik für die Luftfahrtindustrie bis zur Organisation der kompletten Sup-ply Chain – Logistik kann einfach mehr.
Text: Ilona Jüngst | Foto: Johannes Vogt/BVL
Große Vielfalt erlebenTag der Logistik 2019 – Bundesvereinigung Logistik (BVL) zählt 23.000 Besucher bei 270 Veranstaltungen
MEHR IM NETZ
EINE BILDERGALERIE FINDEN SIE HIER
eurotransport.de/tdl19
Pforzheim – AmazonSogar ein Fernseh-Team des SWR ist am Tag der Logistik zu Amazon nach Pforzheim gekommen, um darüber zu berichten, was hier hinter sonst verschlossenen Türen vor sich geht. Armin Cossmann, Regionaldirektor Amazon Operations Deutschland, sagt: „Wir zeigen, was passiert, nachdem man auf „Jetzt kau-fen“ klickt.“ Am Tag der Logistik weiht Amazon in Pforzheim gleichzeitig mit Gästen aus Lokalpolitik und Geschäftspartnern sein neues Schmalgang-Hochregallager ein. „Zehn Millionen Invest bedeu-tet dieser Umbau“, informiert Standortleiter Alexander Brugg-ner. Anfang des Jahres ist das Projekt gestartet, weit mehr als 300 Staplerfahrer mit Schwerpunkt Hochregallager hat das Un-ternehmen seither ausgebildet – mehr als 200 Flurförderfahrzeu-ge sind hier unterwegs. Mit dem neuen Hochregal lassen sich rund zwei Millionen Artikel mehr lagern, 115 Hochregalstapler der Firma Jungheinrich wurden dafür ebenfalls neu angeschafft. Eine Batteriewechselstation mit 144 Ladeplätzen ermöglicht, dass Fahrer ihren Stapler mit leeren Akkus hier einfach abstel-len und sofort auf einen frisch aufgeladenen umsteigen – ein Akku hält 1,7 Schichten.Seit 2012 besteht das Logistikzentrum in Pforzheim und umfasst 110.000 Quadratmeter. Mehr als 1.300 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, sieben Auszubildende im Bereich Lagerlogistik und zwei Studierende der Dualen Hochschule gibt es. In jeder Schicht sind 500 bis 600 Mitarbeiter beschäftigt, täglich liefern 40 bis 50 Lkw Waren an: die Hälfte ist Amazon-Ware, die andere Hälfte Ware, bei der der Online-Händler als Plattform fungiert. Von Pforzheim aus beliefert Amazon seine Kunden in München, Nürnberg, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Augsburg noch am selben Tag. „Wir sind hier vorbereitet auf Zustellungen innerhalb von zwei oder vier Stunden“, informiert Standortleiter Alexander Bruggner die 50 Besucher und sagt: „In zehn Jahren werden vielleicht Lieferungen in einer Stunde möglich sein – wir sind darauf vorbereitet.“ Das Pforzheimer Logistikzentrum ist heute Referenzwerk im Amazon Non-Sort-Netzwerk – also „für Artikel, die größer sind als ein Schuhkarton“, wie Markus Simeit, Learning & Deve-lopment Manager bei Amazon Pforzheim, der Besuchergruppe erklärt. „Das ist Amazon: Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Ge-schwindigkeit“, sagt Simeit, weiter, „wir wollen immer schneller, immer besser werden.“ Text und Foto: Andrea Ertll
Berlin – Technische UniversitätVolle Ränge im Hörsaal H1012 der TU Berlin in der Straße des 17. Juni: Neben Studenten haben sich auch deutlich ältere Fachbesucher zu diesem Logistikpraxisseminar eingefunden. Zu der Veranstaltung im Rahmen einer öffentlichen Vortragsreihe der Technischen Universität hat das Fachgebiet Logistik – Insti-tut für Technologie und Management eingeladen. Die Veranstal-tung am Tag der Logistik verlangt von den Zuhörern einiges ab: „Künstliche Intelligenz in der Logistik – Mehr als nur ein Hype“. Prof. Frank Straube, Leiter des Fachgebiets Logistik, berichtet über das Forschungsprojekt SMECS (Smart Event Forecast for Seaports), das mittels Künstlicher Intelligenz ein Modell zur
Ankunftszeitenprognose (ETA) bei multimodalen und internatio-nalen Containertransporten entwickeln will.Ziel des Vorhabens ist es, Verspätungen und Terminalüberlas-tungen besser prognostizieren zu können. Um das Thema ETA geht es auch im folgenden Beitrag von Hannah Richta, Manage-rin Performance Analytics und Leiterin eines ETA-Projekts bei DB Cargo, bei dem KI für die Prognosen für Ankunftszeiten im Schienengüterverkehr genutzt wird. Weitere Referenten kom-men von MLG Logistic, den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Microsoft Deutschland, Arvato Bertelsmann sowie den Start-ups Tracks und Blik. Text und Foto: Ilona Jüngst
Gochsheim – Pabst TransportPabst Transport aus Gochsheim baut seinen Geschäftsbereich Value Added Services weiter aus. Die Betriebsfläche vergrößert sich auf über 100.000 Quadratmeter. Dies gab Geschäftsfüh-rer Hans Pabst beim Tag der Logistik am Unternehmenssitz in Gochsheim bekannt. Unter Value Added Services versteht Pabst Dienstleistungen rund um das Outsourcing von Teilprozessen bei Kunden aus der Region, zum Beispiel: Um- oder Neuver-packung, Belabelung, Bestellverwaltung und Fakturierung, Behälterreinigung, Kommissionierung und Konfektionierung, Containerentladungen oder Ladungssicherungen. „In den vergangenen Jahren konnten wir uns auf diesem Gebiet einen Namen machen“, erklärt Pabst.Der Ausbau dieser Geschäftsaktivitäten erfordert weitere Logistikflächen. Dafür hat Pabst Transport mit dem ersten Bauabschnitt 15.000 Quadratmeter neue Logistikfläche fertigge-stellt und damit seine Lagerkapazität von 25.000 Quadratmeter auf aktuell 40.000 Quadratmeter erweitert. Langfristig soll die Logistikfläche auf insgesamt 75.000 Quadratmeter wachsen. In dem Zuge vergrößert sich die Betriebsfläche in Gochsheim auf über 100.000 Quadratmeter. Das neue Logistik-Center entstand in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Betriebsareal in Verlän-gerung der Firmenzentrale in der Julius-Hofmann-Straße.Der Neubau entstand nach neuesten Baunormen. Bei der Um-setzung des Projekts lag der Fokus auf Nachhaltigkeit – gemäß der Unternehmensphilosophie von Pabst. LED-Beleuchtung sowie eine Photovoltaikanlage sind daher Standard. Das neue Logistik-Center ist durchgängig mit Regalen ausgestattet. Insgesamt 23.000 Paletten-Stellplätze und eine Lagernutzhöhe von 10,60 Meter sowie Bereiche für die Kommissionierung und Konfektionierung sollen eine hohe Flexibilität auf einem hohen Qualitätsniveau gewährleisten. Durch die flexible IT-Struktur im Haus können Kundenanbindungen individuell gestaltet werden. Auch sind die Prozesse sowohl manuell als auch teilautomati-siert flexibel abbildbar. Hier kommen neben modernen Android-Lager-Scannern auch effiziente Flurfördergeräte zum Einsatz. Das Unternehmen beschäftigt zurzeit gut 400 Kraftfahrer und gut 220 Mitarbeiter in anderen kaufmännischen und gewerblichen Berufen. Darin sind 73 Auszubildende in allen Bereichen enthal-ten. Insgesamt sind für das Unternehmen rund 300 Fahrzeuge unterwegs, die alle zentral von der Firmenzentrale in Gochsheim koordiniert werden. Text: Ralf Lanzinger | Foto: Pabst Transport
Die TU Berlin lud zum Logistikpraxisseminar (links unten), Pabst Transport und Amazon (rechts) in ihre neuen Logistikläger.
trans aktuell 9 18. April 2019 P O L I T I K U N D W I R T S C H A F T4
Nachdem das Europäische Parlament (EP) mehrheit-lich für das Mobilitätspa-ket gestimmt hat, könnte
noch in dieser Legislaturperiode ein Kompromiss mit den EU-Ver-kehrsministern und der Europä-ischen Kommission ausgehandelt werden. Zuvor hatten Abgeordne-te aus Osteuropa noch versucht, die Regeln für die Abstimmung infrage zu stellen, um so eine mögliche Gesetzesänderung in letzter Minute zu verhindern.
Rund 3,6 Millionen Lkw-Fahrer könnten künftig vom Prinzip „glei-cher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ profitieren, denn das Entsenderecht soll bereits am ers-ten Arbeitstag im Ausland gelten – ausgenommen, die Fahrt be-ginnt und endet im Heimatland. Außerdem wird Briefkastenfir-men und dem Nomadentum der Kampf angesagt. Kabotage soll nur an jeweils drei Tagen möglich sein, dann muss das Fahrzeug für mindestens 60 Stunden an den Firmenstandort zurückkehren.
Die Abgeordneten stimmten zudem dafür, dass Fahrer zumin-
dest alle vier Wochen nach Hau-se zurückkehren müssen und die regelmäßige wöchentliche Ruhe-zeit nicht in der Fahrerkabine ver-bringen dürfen. Darauf hatten sich auch schon die Verkehrsminister Ende vergangenen Jahres geeinigt.
Monatelang verhandelt
Dem EP-Votum zu Lenk- und Ruhezeiten, Entsendung sowie Markt- und Berufszugang waren monatelange Verhandlungen vo-rausgegangen, doch die Spaltung zwischen Ost und West ließ sich nicht auflösen. In Rumänien und Bulgarien wird befürchtet, dass mit höheren Fahrerlöhnen auch die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Transportbran-che schwindet, die einen nicht unerheblichen Anteil am Brutto-inlandsprodukt hat. Zwei von drei Berichterstattern des EP war es aber gelungen, auch konservative Kräfte hinter sich zu bringen.
Insbesondere der deutsche So-zialdemokrat Ismail Ertug hatte
sich intensiv um einen Kompro-miss bemüht. Dem konnten dann auch mehr als 1.000 Änderungs-anträge nichts mehr anhaben, mit denen vorwiegend osteuro-päische Parlamentarier in der vor-herigen Plenumssitzung versucht hatten, das Gesetzespaket zu kippen. Nicht zuletzt der gravie-
rende Fahrermangel und die zwi-schenzeitlich auch in der Öffent-lichkeit diskutierten unhaltbaren Zustände auf den Parkplätzen haben zum Abstimmungsergebnis beigetragen.
Text: Regina Weinrich | Foto: Jan Bergrath
Schluss mit NomadentumDurchbruch beim EU-Mobilitätspaket – Vorgehen gegen Briefkastenfirmen – neue Kabotageregeln
Der Bundesverband Güter-kraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) begrüßt den Durchbruch beim EU-
Mobilitätspaket und bewertet die vorgesehene Heimkehrpflicht für Lkw-Fahrer zu ihren Familien sowie die Rückkehrpflicht für in-ternational eingesetzte Lkw in ihr Zulassungsland nach spätestens vier Wochen als besonders positiv.
Als Erfolg wertet es der BGL auch, dass der von ihm vorge-schlagene Lenkzeitzuschlag Zu-stimmung gefunden habe. Damit hätten Fahrer maximal zwei Stun-den mehr, wenn sie auf dem Weg nach Hause ins Wochenende sei-en. Diese Zeit müsste zwar in der Folgewoche ausgeglichen werden, ermögliche den Fahrern aber bei Verzögerungen, trotzdem bei ihren Familien anzukommen.
Der BGL hofft jetzt ebenso wie der Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) auf eine schnelle Einigung bei den
anstehenden Verhandlungen in Brüssel. Würde das Mobilitätspa-ket erst nach den Europawahlen im Mai weiterverhandelt, wäre das eine vertane Chance für den Ver-kehrsmarkt in Europa, sagt BWVL-Hauptgeschäftsführer Christian Labrot. Besonders positiv sei die Einigung zur Fahrerentsendung zu sehen. „Mit dieser Einigung kön-nen derzeit vorherrschende büro-kratische Hürden abgebaut wer-den“, betont er. Zudem seien auch die zügige Einführung des smarten Tachographen und damit verbun-dene bessere Kontrollmöglichkei-ten ein weiterer Sicherheitsgewinn.
Kontrollen erforderlich
Die Position des Parlaments sei ein „insgesamt tragfähiges Gerüst für eine Angleichung der Wettbe-werbs- und Sozialbedingungen“, erklärt der Bundesverband Spedi-
tion und Logistik (DSLV). Es blei-be aber nur stabil, wenn zukünftig regelmäßiger und dichter als heute kontrolliert werde, sagt Hauptge-schäftsführer Frank Huster. Die Erwartungen an den neuen Tacho-graphen seien deshalb sehr hoch. Eine regelmäßige Rückkehr der Fahrzeuge an die Unternehmens-standorte könne zu einem uner-wünschten Anstieg von Leerkilo-metern und Emissionen führen, gibt Huster zu bedenken. Ob die Neuregelungen beim Entsende-recht praxistauglich seien, werde sich zeigen. „Der Flickenteppich nationaler Einzelbestimmungen wird dadurch erst einmal nicht aufgelöst“, betont Huster.
Der Dienstleistungsgewerk-schaft Verdi und dem DGB ge-hen die von den Parlamentariern beschlossenen Verbesserungen nicht weit genug. „Die Möglich-keiten des Sozialdumpings wer-den durch die Entscheidung ein-gedämmt, jedoch nicht gänzlich
beendet“, sagt die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. So gebe es künftig Ausnahmen bei der Anwendung der Entsende-richtlinie. Dass es keinen Mindest-lohn bei bilateralen Transporten gibt, kritisiert auch DGB-Vor-standsmitglied Annelie Bunten-bach. Zudem sei die Übernach-tung in der Fahrerkabine zwar untersagt, könne aber durch eine Verzichtserklärung des Fahrers umgangen werden. Außerdem könnten Raststätten sich selbst zertifizieren, damit die Nacht im Fahrerhaus möglich werde.
Text: Regina Weinrich | Foto: Thomas Küppers
„Sozial-dumping
wird einge-dämmt, je-doch nicht gänzlich beendet“
ANDREA KOCSIS, STELLVERTRETENDE VERDI-VORSITZENDE
DIE WESENTLICHEN PUNKTE
Intermodal boomt
Glänzende Aussichten
für den Kombinierten
Verkehr: Er ist die
Verkehrsart, der die
neue Güterverkehrs-
prognose des Bundes
bis 2022 die höchsten
Zuwächse voraus-
sagt – um jährlich 4,5
Prozent beim Verkehrs-
aufkommen und um
4,6 Prozent bei der
Verkehrsleistung.
Bei der Straße sind
es 1,8 und 2,6 Pro-
zent, bei der Schiene
1,6 und 2,5 Prozent.
Ein ausführ licher
Bericht folgt.
Vorstoß für den eCMR
Der BGL beteiligt
sich an einem Aeolix-
Pilotversuch zu den
Verwendungsmöglich-
keiten elektronischer
Frachtdokumente im
Straßengüterverkehr.
Für die Erfordernisse
in der Logistik soll
der CMR-Frachtbrief
auch in digitaler Form
zulässig werden, um
so eine Automatisie-
rung von Prozessen zu
ermöglichen. Das EU-
Programm Aeolix soll
dabei helfen, Ladungs-
ströme zu optimieren,
das Supply-Chain-
Management zu
erleichtern, den
Verwaltungsaufwand
zu reduzieren und
Ressourcen besser
zu nutzen.
Parkplätze erforderlich
Die Bundesregierung
muss ihre Anstren-
gungen beim Bau von
Parkplätzen an Auto-
bahnen erhöhen. Das
war eine der Forde-
rungen der Landesver-
kehrsminister bei ihrer
Konferenz in Saarbrü-
cken. Ferner sprachen
sich die Minister für
den Einbau von Lkw-
Abbiegesystemen
und ein Aufstocken
der Fördermittel von
zurzeit jährlich fünf
Millionen Euro aus.
Erleichterung überwiegtReaktionen der deutschen Verbände zum EU-Mobilitätspaket
● Mit dem Mobilitätspaket soll für rund 3,6 Millionen Lkw-Fahrer das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ umgesetzt werden.
● Das Entsenderecht soll vom ersten Tag eines Auslandseinsatzes an gelten, aus-genommen, die Fahrt beginnt und endet im Heimatland.
● Fahrer müssen zumindest alle vier Wochen nach Hause zurückkehren und dürfen die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nicht in der Fahrerkabine verbringen.
● Kabotagefahrten sollen nur an jeweils drei Tagen möglich sein, dann muss das Fahrzeug für mindestens 60 Stunden an den Firmenstandort zurück.
● Die Einführung und Nachrüstung des digitalen Tachographen werden deutlich vorgezogen.
● Kleintransporter mit über 2,5 Tonnen wer-den den gleichen Bestimmungen unterwor-fen wie große Lkw.
Mit dem neuen Volvo FH mit I-Save reduzieren Sie Ihre Kraftstoffkosten um bis zu 7 %*,
ohne einen Kompromiss bei Produktivität und Fahrkomfort einzugehen. Jedes Detail des Volvo FH
mit I-Save ist perfekt auf den Fernverkehr abgestimmt – eine Investition, die sich auszahlt, insbesondere
bei Fahrstrecken von über 120 000 Kilometern im Jahr. Sie profitieren vom neuen 13-Liter-Motor
mit Turbo-Compound-Technologie, unserem effizientesten Langstreckenmotor aller Zeiten,
sowie von verbesserten, kraftstoffsparenden Funktionen wie dem kartenbasierten I-See.
Je weiter Sie fahren, desto mehr sparen Sie mit I-Save für ein nachhaltigeres und profitableres Geschäft.
Weitere Informationen finden Sie unter volvotrucks.de/i-save
* D13TC Euro 6 Stufe D inkl. Kraftstoffpaket für den Fernverkehr (I-Save) gegenüber D13 eSCR Euro 6 Stufe D.
Die tatsächliche Kraftstoffersparnis hängt von vielen Faktoren wie beispielsweise der Verwendung
des Geschwindigkeitsreglers, der tatsächlichen Topografie, dem Fahrstil und den Wetterbedingungen ab.
Kraftstoff sparen hat sich nie so gut angefühlt
VOLVO FH MIT I-SAVE
trans aktuell 9 18. April 2019 6 S C H W E R P U N K T K O M
Wenn schon Kombinierter Verkehr, dann richtig, meint Carsten Hemme, Geschäftsführer von
Paneuropa. „Man kann nicht Fisch und Fleisch gleichzeitig machen.“ Aus diesem Grund hat das Unternehmen aus Bakum nur noch kranbares Equipment. 400 Tautliner, 90 Kühlauflieger, 150 BDF-Wechselbrücken, 180 Jumbo-wechselbrücken und 195 Sattel- und Hängerzüge sind im Einsatz. Im Kombinierten Verkehr (KV) bedient Paneuropa bevorzugt die Relationen nach Italien; allein acht Company-Trains fahren pro Woche zwischen Bremen und Verona. Dabei setzt Firmenchef Carsten Hemme auch auf seinen Partner Terratrans aus Bremen. „Im Kombinierten Verkehr den-ken wir immer in Joint Ventures, etwa in Bezug auf die Auslastung der Züge und die Paarigkeit.“
Trotz aller Baustellen auf der Schiene brach Hemme beim trans aktuell-Symposium mit dem Titel „Erfolgreich im Kombinierten Ver-kehr“ in seiner neu bezogenen Fir-menzentrale in Bakum eine Lanze für den Intermodaltransport. Bei der Frage der Motivation muss der Unternehmer nicht weit ausholen: Für den Vor- und Nachlauf im KV findet er problemlos Fahrer. Weite-re Vorteile sind das Mehrgewicht von vier Tonnen, die geringeren CO2-Emissionen und der Menge-nausgleich bei Peak-Situationen.
Über die Fahrpläne sei der KV auch planbarer – allerdings nur auf gewissen Relationen. Und das ist auch das derzeitige Manko: die Qualität im Bahnverkehr und die mangelhafte Infrastruktur, die Verspätungen herbeiführen. Auch das Fehlen europaweit einheitli-cher Rahmenbedingungen ist für Hemme eine Hürde, ebenso un-paarige Warenströme, die einen Equipment-Tausch erschwerten, und die stetigen Preissteigerungen.
Aber Hemme ist Überzeu-gungstäter und sieht für das System KV trotz aller Probleme auch Zukunftschancen. Auto-nom fahrende Züge könnten etwa den Lokführerwechsel be-schleunigen, die Integration von Start-up-Technologien könnte bei der Sendungsverfolgung und der Bündelung helfen. Wenn zu-dem im Rahmen der Digitalisie-rung Telematiksysteme besser verknüpft werden, so Hemmes Überzeugung, ermöglicht dies einen Blick auf die gesamte Lie-ferkette. Die Datendrehscheibe, die allen Beteiligten in Echtzeit Informationen liefern soll, ist Ziel
des Projekts KV 4.0, für das sich Paneuropa mit anderen Unter-nehmen engagiert.
Wie Paneuropa setzt auch die Spedition Bode aus Reinfeld aus Überzeugung auf die Schiene. Wie Paneuropa hat auch sie ihre Renn-strecken, auf denen sie firmenei-gene Company-Trains bewegt – in dem Fall nach Schweden. In 95 Pro-zent der Fälle erfolgt die Reise nach Schweden mit der Bahn. 10.000 Hauptläufe mit dem Lkw pro Jahr und rund 25 Tonnen Kohlendioxid-emissionen pro Fahrtstrecke spart der „Alter Schwede“ genannte Zug ein. Damit helfe Bode als Dienst-leister seinen Kunden, deren CO
2-Bilanz zu verbessern, wie der
Intermodalverantwortliche Stev Etzrodt erläuterte.
Dass Verlagerungsziele sich nicht von allein umsetzen, weiß auch die Politik. Entsprechen-de Impulse sollen deshalb auch die Maßnahmen im Masterplan Schienengüterverkehr liefern. Der wurde schon in der vergangenen Legislaturperiode vorgestellt, „aber er wird dauerhaft umgesetzt, auch in der neuen Koalition“, erklärte Steffen Müller, Referatsleiter Mas-terplan Schienengüterverkehr, Gleisanschlussförderung beim
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).
Ein Ziel aus dem Paket der fünf Sofortmaßnahmen wurde 2018 bereits erreicht: die Reduzierung der Trassenpreise, die allein im vergangenen Jahr 175 Millionen Euro gekostet habe. Unterneh-men sollten das Geld aber nicht nur einstecken, sondern auch für Innovationen und Preissenkun-gen verwenden, sagte Müller.
740-Meter-Netz kommt
Auch mit den anderen Maßnah-men geht es voran. Das 740-Meter-Netz ist laut Müller in der Realisie-rung, ein digitales Testfeld unter anderem für die Automatisierung der Zugbildung in München-Nord in der Planung. Auch die unterneh-merischen Beiträge des Sektors seien erkennbar, um etwa Innova-tionen bei der Telematik oder dem effizienteren Einsatz von Material voranzutreiben. Im Herbst habe der Runde Tisch Schienengüter-verkehr mit Vertretern aus der Branche zudem das Bundespro-gramm „Zukunft Schienengüter-verkehr“ beschlossen und die drei Förderbereiche Digitalisierung, Automatisierung und innovative Fahrzeugtechnik festgelegt.
Quasi deckungsgleich mit den Zielen des Masterplans Schienen-güterverkehr ist die Motivation vieler Unternehmen und Organi-sationen aus der Branche. Auch sie treibt der Ehrgeiz an, Speditionen einen einfacheren Zugang zum Schienensystem zu ermöglichen – sei es durch Standardisierung des eingesetzten Equipments, durch Angebote für den noch nicht kranbaren Trailerbestand oder bessere Prozesse aufgrund digitaler Weichenstellungen.
Was die Standardisierung angeht, weist Karl Fischer, Ge-schäftsführer des Logistik-Kom-petenz-Zentrums (LKZ) Prien am Chiemsee, auf den Siegeszug des Containers hin. 1956 erfunden und zehn Jahre später erstmals in Deutschland umgeschlagen, ist die Blechbox aufgrund ihrer genorm-ten Abmessungen im internationa-len Warenverkehr heute das Maß aller Dinge. Die Erfolgsgeschichte des Standardcontainers – 2016 waren 38 Millionen davon welt-weit unterwegs – will LKZ-Chef Fischer auf das eingesetzte Schie-nen-Equipment, Container in dem Fall ausgenommen, übertragen.
In entsprechenden Teilprojekten möchte Fischer diese Idee weiter vorantreiben.
Abgeschlossen ist der erste Baustein, das Projekt „Future Trailer for Road and Rail“, das die Standards für den Sattelauf-lieger geschärft hat, um einen reibungslosen Wechsel zwischen den Verkehrsträgern zu ermögli-chen. Partner des Projekts waren TX Logistik, die Spedition Zitzls-perger sowie die Trailerhersteller Schmitz Cargobull, Krone und Schwarzmüller. Die Unterneh-men machten beim Trailer an 15 Punkten Optimierungsbedarf aus und setzten ihre Erkenntnisse im Bau eines Future-Trailers um. Zum Beispiel muss ein Auflieger auf der Schiene – anders als auf der Straße – Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h standhalten, weswegen es sich empfiehlt, die Plane stärker zu sichern. Ratsam seien auch ein einheitlicher Achs-abstand, ein starrer statt eines klappbaren Unterfahrschutzes oder eine Anpassung der Posi-tions- und Begrenzungsleuchten, da sie beim häufigen Umschlag oft Schaden nähmen, so Fischer.
Noch nicht am Ziel ist der KV-Profi bei seinen Bestrebungen, Viermetertrailer durchgehend in Europa zu befördern. „Auf 64 Prozent des Transeuropäischen Netzes haben wir ein P385-Profil“, sagte der LKZ-Prien-Chef. Für den Megatrailer sind diese Strecken bisher tabu. Um 15 Zentimeter geht es also, die Fischer einsparen möchte, um auch Viermetertrailer auf den Transeuropäischen Netzen (TEN) zu transportieren. „Für neun Zentimeter haben wir schon Ideen, jetzt geht es um die verbleibenden sechs Zentimeter“, machte Fischer deutlich. Er will diese Ideen auch in das nächste Teilprojekt, den Future Intermodal Wagon, einbringen, denn auch der Waggon ist laut Fischer gefordert und biete Raum für Verbesserungen.
Der Future-Trailer sei zwar kei-ne Revolution, aber insofern schon ein Riesenfortschritt, als sich die am KV beteiligten Akteure über-haupt einmal über eine Standar-disierung ausgetauscht hätten, so die Bewertung von Norbert Rekers, Regional Director im Intermodal-bereich beim KV-Operateur TX Logistik aus Troisdorf, der auch an den Projekten mitgewirkt hat. Wie Fischer macht sich auch Rekers dafür stark, das Segment der nicht kranbaren Trailer zu erschließen. Seinen Schätzungen zufolge sind
Plädoyer für die Schienetrans aktuell-Symposium zum Kombinierten Verkehr bei Paneuropa – Praktiker lieferten Impulse fürs Ve
Verfechter des Intermodalverkehrs (von oben links): Uwe Salvey (Warsteiner-Gruppe), Karl Fischer (Logistik-Kompetenz-Zentrum Prien), Norbert Rekers (TX Logistik), Peter Hirsch (Duss), Stev Etzrodt (Spedition Bode) und Steffen Müller (BMVI).
neun von zehn Sattelaufliegern in Europa nicht kranbar.
Um sie auf die Schiene zu bringen, stellt TX Logistik Spedi-tionen Nikrasa-Plattformen zur Verfügung, auf die der Auflieger gefahren wird. Die Spreader des Portalkrans oder Reach Stackers schnappen sich diese Plattform, um den Trailer auf den Waggon zu heben. Auch Nikrasa – TX Logis-tik wird das Produkt auf der Messe Transport Logistic als Offroader bewerben – ist in den Augen von Rekers keine Revolution, sondern vielmehr eine Brückentechnologie beziehungsweise „Einstiegsdroge“, bis Speditionen auf kranbare Trai-ler umgestellt haben.
Die zwei Tonnen schwere Platte könne in jedem Terminal nach ei-ner Vorbereitungsphase von etwa vier Wochen eingesetzt werden, sagte Rekers und nannte bereits zahlreiche Verbindungen, auf de-nen TX schon Angebote für nicht kranbare Trailer mache – etwa auf den Relationen nach Verona, sei es ab Köln, Leipzig oder Lübeck.
Gemeinsame Standards
Hürden für den Einstieg oder ein Engagement im Intermodalver-kehr lassen sich aber auch durch digitale Prozesse abbauen, wie Ralf-Charley Schultze erläuterte, Präsident der International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR). „Dabei geht es nicht nur darum, alle Prozesse auf papierlos umzustellen“, verdeutlichte Schult-ze. „Es geht viel weiter.“ Im Vorder-grund steht für ihn die Datenver-fügbarkeit, idealerweise nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern für alle an einem Prozess beteiligten Akteure.
Dazu brauche es gemeinsame Standards oder eine gemeinsame Plattform, skizzierte der UIRR-Präsident. Als Beispiel für einen gemeinsamen Standard nannte er den ILU-Code, mit dem Auflieger markiert und identifiziert werden können. Vor zehn Jahren hatte die UIRR ihn auf den Weg gebracht. „Bis letztes Jahr hatten sich bereits 1.000 Unternehmen dazu entschie-den, ihre Ladeeinheiten entspre-chend zu markieren“, so Schultze.
Ein weiteres aktuelles Projekt ist der Aufbau eines europawei-ten Portals, das Auskunft über alle Serviceeinrichtungen rund um den KV gibt. Dazu zählen nicht nur Gü-terbahnhöfe, sondern auch Tank-
DIE PARTNER
Premium-Partner
Mit freundlicher Unterstützung von
trans aktuell 9 18. April 2019 7B I N I E R T E R V E R K E H R
eerlagern von Verkehren
Mehr Achtung, mehr GeldBahnverkehre europaweit harmonisieren und Terminals ertüchtigen
Logistik auch mal als Triathlon betreiben.
Wir bringen Dinge ins Rollen. DB Cargo.
DB Cargo AG @DB_Cargo www.dbcargo.com
Sprechen wir über Ihre Logistik:[email protected]
Telefon: +49 2039851-9000
Schienen führen auch über Ländergrenzen – und doch ist gerade im Kombinierten Verkehr die jeweilige natio-
nale Auslegung von Richtlinien ein Problem, wie bei der Podi-umsdiskussion im Rahmen des trans aktuell-Symposiums klar wurde. „Zum Thema Multimo-dalität gibt es in der EU ein ganz falsches Verständnis“, sagte auch Ralf-Charley Schultze, Präsident des Verbands UIRR, der das Vor-gehen der EU-Politik im Rahmen des neuen Mobilitätspakets kriti-sierte – „weniger Harmonisierung geht gar nicht“. Matthias Gastel, Sprecher für Bahnpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, kritisierte die Arbeit der EU-Kommission ebenfalls. Der Bahnsektor brauche nicht immer wieder einen weiteren Erkenntnisgewinn, sondern die Umsetzung der Erkenntnisse.
Auch Gastgeber Carsten Hemme, Geschäftsführer von Pan-europa, hat leidvolle Erfahrungen zum Thema Europa gesammelt. In Italien setzt das Unternehmen nur noch italienische Fahrzeuge ein, „weil fremde Fahrzeuge an die Kette gelegt werden“ – etwa weil die italienischen Behörden unterschiedliche Auffassungen zum Thema Nachlauf und dem nächsten Terminal hätten. „Wir brauchen dringend eine europä-ische Harmonisierung“, forderte daher auch der Unternehmer.
Ob international oder national: Kein Thema beschäftigt die KV-Branche so stark wie die Qualität der Schiene. Dirk Steffes, Senior Vice President – Sales Intermodal bei DB Cargo, weiß, was Einschrän-kungen hier für die KV-Speditionen bedeuten. Der wichtigste Fokus muss seiner Meinung nach auf den Terminals und deren Kapazi-täten liegen. So seien im Terminal
München-Riem zwar Zeitfenster frei, aber eben in der nicht ge-rade beliebten Zeit von 23 bis 3 Uhr. Weitere Terminalfläche zu erschließen, sei aufgrund der lang-wierigen Planfeststellungsverfah-ren ein Problem. UIRR-Präsident Schultze bestätigte: „Die ganze Produktivität, die auf der Strecke erarbeitet wird, hat sich im Termi-nal erübrigt.“ Zwar würden auf den TEN-Netzwerken ab 2030 auch 740-Meter-Züge fahren, „man hat nur die Terminals vergessen“.
Benchmark ist der Lkw
Paneuropa-Chef Hemme sieht dringenden Platzbedarf vor allem in Ballungsräumen und erklärte das Problem der vollen Termi-nals auch mit den Rampenzeiten des Handels. Viele Unternehmen führen ein Slow-Rail-Konzept und schafften sich mit einer Terminal-abstellung Zeitpuffer. Robert Breuhahn, Geschäftsführer des KV-Operateurs Kombiverkehr, führte an, dass es vor allem im maritimen Verkehr eine Gepflogenheit sei, Container in den Hinterlandtermi-nals abzustellen, „weil es dort billi-ger ist“. Im Vergleich dazu habe der Kontinentalverkehr als Benchmark immer den Lkw. Vielleicht, so Breu-hahn, sei es angesichts der unter-schiedlichen Bedürfnisse notwen-dig, in Zukunft auch an getrennte Umschlagsanlagen zu denken.
Breuhahn kritisierte zudem das verschenkte Potenzial auf der Schiene, die heute hauptsächlich für Massengüter sowie Komplett- und Teilladungen genutzt werde. Wenn die Qualität stimme und entsprechende Korridore ausge-baut würden, wäre auch wieder Stückgut denkbar. Dafür brauche es aber die Unterstützung der Po-
litik. Dies sei etwa die Staatspolitik Österreichs, was auch die Preise der ÖBB erkläre.
Grünen-Bahnpolitiker Gastel bestätigte, dass Infrastruktur-investitionen die wichtigste Hand-habe seien. Der Güterverkehr auf der Schiene leide aber darunter, dass der Personenverkehr das System lahmlege und der KV da-durch auch aus dem Fokus der Politik rücke. Sie spüre aus dem Personenverkehr mehr Druck. Die Wählerschaft honoriere nicht die wichtige Rolle des Güterverkehrs für den Klimaschutz. Laut Gastel müssen alle daran arbeiten, einen höheren Stellenwert der Bahn zu erreichen, mit einer entsprechen-den Finanzierung der Infrastruk-tur als Folge.
Dirk Steffes von DB Cargo ist indes auch der Meinung, dass in der Diskussion um das Thema Schiene mehr Ehrlichkeit notwen-dig sei und die Frage lauten sollte, was auf der Schiene überhaupt al-les möglich sei. Denn zum einen sei der KV zwar eine Alternative zum Lkw, könne aber auch nicht alle Probleme im Güterverkehr lösen. Zum anderen sei auch nicht jede Bahn in der Lage, aus-reichend Geld zu verdienen. „Fast alle größeren Frachteisenbahnen in der EU sind heute wieder ver-staatlicht“, sagte Steffes. Und auch Verlader müssten das System so annehmen, wie es sei, und etwa auch mal andere Zeitfenster als gewohnt anbieten oder es akzep-tieren, dass nicht alle Ware schnell komme. „Dann sind auch die Ope-rateure und Eisenbahnunterneh-men in der Lage, Trassen und Ter-minals effizienter zu bedienen.“
Text: Ilona Jüngst | Foto: Thomas Küppers
stellen und Werkstätten. Und wie die Kunden im Straßentransport wollen auch Bahnverlader wissen, wann die Sendungen ihr Ziel errei-chen, im Fachjargon auch Estima-ted Time of Arrival (ETA) genannt. Die UIRR hat sich auch hier auf den Weg gemacht. Sie entwickelt zurzeit einen Kalkulator, der auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert und Auskunft über zwölf Relatio-nen von fünf Operateuren gibt. Ge-plant ist laut Schultze, das Projekt im September abzuschließen und dann zu entscheiden, inwiefern es auf das gesamte KV-Netz ausge-weitet werden kann.
Hohe IT-Kompetenz wird auch bei einem weiteren Projekt nötig sein, das der Branche Impulse geben soll: dem im Bau befindli-chen Megahub Lehrte. Ein erster Teilbereich, der Umschlag Schie-ne–Straße, soll noch dieses Jahr eröffnet werden. Dies bietet den Unternehmen im KV, aber auch den Regionen im Umland, neue Möglichkeiten im Bündeln und Abwickeln von Schienengüterver-kehren.
Die Idee dahinter sei es, nach dem Vorbild des Rangierbahnhofs Maschen bei Hamburg eine Um-schlaganlage für Container bezie-hungsweise Auflieger zu bauen, erläuterte Peter Hirsch, Vertriebs-leiter des Betreibers Deutsche Um-schlaggesellschaft Schiene–Straße (Duss) aus Bodenheim, die die Megaanlage betreiben wird. Die Pläne sind ehrgeizig: Bis zu sechs Züge auf einmal sollen dort ab-gefertigt werden und deren Lade-einheiten innerhalb von zwei bis drei Stunden auf neue Relationen umsteigen können – wohlgemerkt, wenn das Terminal voll funktions-fähig ist. Herzstück ist eine auto-matische Sortieranlage, die einzig-artig in Europa sein dürfte und laut Hirsch zeitaufwendige Stafetten-kranungen auf der 720 Meter lan-gen Kranbahn überflüssig macht.
Das enorme Umschlagstempo bringt attraktive Laufzeiten mit sich. Duss-Prokurist Hirsch hält es für möglich, dass ein Zug abends um 18.10 Uhr Lübeck verlässt und morgens um 7 Uhr in München eintrifft; inbegriffen wäre der nur zweistündige Umschlag in Lehrte. Das würde der Schiene – darin sind sich Branchenkenner einig – einen Schub verleihen und sie attraktiv für weitere Kunden machen.
Vielleicht eröffnet der Megahub ja auch der Brauerei Warsteiner neue Möglichkeiten. Sie hat 2004 ihr erstes Gleis gelegt und 2005
ihren ersten Zug auf die Reise ge-schickt. Der Brauerei ging es vor allem darum, ihren Standort und die Region ein Stück weit vom zunehmenden Lkw-Verkehr zu befreien – üblicherweise von der A 44 kommend und in Soest auf Bundesstraßen abfahrend. Nicht nur die Logistiker bei Warsteiner, sondern auch die Kunden muss-ten hier ziemlich umdenken. „Es ist schon ein Unterschied, wenn man nur noch ein- oder zweimal die Woche Ware bekommt“, erläu-terte Logistikleiter Uwe Salvey.
Es komme darauf an, dass man paarige Verkehre aufbauen könne, was mit Leergut auf dem Rückweg schon mal gegeben ist. Und das An-gebot auf der Schiene müsse auch preislich konkurrenzfähig sein. Der Malztransport zum Beispiel findet zurzeit auf der Straße statt, weil Warsteiner auf der Schiene drei Euro mehr pro Tonne zahlen müsste, diese Kosten aber nicht weiterreichen kann.
Seit 2009 befördert Warsteiner Bier auch per Bahn nach Berlin, seit 2016 mit zwei Zügen wöchent-lich nach Hamburg, und aktuell ist das Unternehmen daran, in Zusammenarbeit mit dem Logis-tikdienstleister Fr. Meyer’s Sohn und der Westfälischen Landes- Eisenbahn (WLE) eine Verbindung nach Bremerhaven aufzubauen. Trotz aller Stolpersteine hat War-steiner Geschmack an der Schiene gefunden. Die Fixkostenbelastung sei enorm, die Preisgestaltung mit-unter intransparent, und es habe ein paar Jahre gedauert, um das nötige Know-how aufzubauen, räumte Logistikleiter Salvey ein. Doch er sieht auch die Erfolge. So soll der unbeschwerte Biergenuss nicht mehr durch überlastete Stra-ßen getrübt werden.
Text: Matthias Rathmann, Ilona Jüngst | Fotos: Thomas Küppers
MEHR IM NETZ
BILDERGALERIE UNTER:
www.eurotransport.de/tas_paneuropa
Teilnehmer der Podiums-diskussion (von links): Robert Breuhahn (Kombiverkehr), Carsten Hemme (Paneuropa), Ralf-Charley Schultze (UIRR), Moderator Matthias Rath-mann (trans aktuell), Matthias Gastel (Bündnis 90/Die Grü-nen), Dirk Steffes (DB Cargo).
DIE TERMINE
Die Termine, Themen und Gastgeber der nächsten trans aktuell-Symposien 2019 auf einen Blick:
● 9. Mai 2019: „Anforderungen in der Automobillogistik“ bei Transco in Singen
● 18. September 2019: „Trends im Volumen-transport“ bei L. I. T. in Brake
● 6. November 2019: „Wir lieben Lebens-mittel und Sicherheit“ bei Edeka Südbayern in Landsberg (Lech)
trans aktuell 9 18. April 2019 S C H W E R P U N K T K O M B I N I E R T E R V E R K E H R8
In acht Tagen könnte es ein Lkw von China nach Europa schaffen, betont die Straßentransportlob-by, ein Güterzug war kürzlich
gerade mal zehn Tage von Xi’an nach Budapest unterwegs. Der Lkw fordert die Bahn zum Wett-lauf auf der neuen Seidenstraße heraus, dabei ist die mehrere tausend Kilometer lange Strecke eigentlich für kombinierte Ver-kehre prädestiniert. Und sie ist gleichzeitig immer noch eine fast zu vernachlässigende Größe bei den Transporten aus China: Nur ein Prozent wird über Land ge-schickt, rund 90 Prozent kommen per Schiff, der Rest ist Luftfracht.
Dennoch ist der Schienen-güterverkehr über Zentralasien nach Osten stark gewachsen und legt weiter zu. In den vergangenen Jahren verging fast keine Woche, in der nicht ein neuer Zug nach China medienwirksam auf den Weg gebracht wurde, aber jetzt will auch die Straße ihren Anteil sehen. Im November hat der ers-te Lkw seinen TIR-Transport auf einer mehr als 7.400 Kilometer langen Strecke in 13 Tagen zu-rückgelegt. Im Januar dauerte es in der Gegenrichtung zwölf Tage.
Mit zwei Fahrern lasse sich die Zeit von Tür zu Tür künftig prob-lemlos auf acht Tage senken, sagt Arduin Geenen von der Internati-onal Road Transport Union (IRU) in Genf. Die bisherigen Fahrten hätten unter normalen Arbeits-
bedingungen mit nur einem Fahrer stattgefunden, hebt der IRU-Mann hervor. Der Verband will den Handel zwischen Europa und China erleichtern und des-halb nicht nur alle Barrieren aus dem Weg räumen: „Jetzt wollen wir Lieferanten und Transporteu-
re zusammenbringen“, kündigt er an. Es gebe bereits Kontakte zu mehreren großen Unterneh-men – Unternehmen wie Ceva Logistics, das den ersten beiden Testfahrten Anfang April noch einen dritten Transport hinzuge-fügt hat. In 16 Tagen ging es mehr
als 13.600 Kilometer von Südchina über Kasachstan, Russland, Weiß-russland, Polen, Deutschland und Frankreich bis nach Spanien.
Zusammen mit dem nieder-ländischen Partner Alblas Inter-national Logistics soll jetzt ein regulärer Service von Europa nach China aufgebaut werden: Zweimal pro Woche hin und zu-rück. Kelvin Tang, Direktor Road & Rail bei Ceva Logistics North Asia, geht davon aus, dass man so mindestens 40 Prozent billiger ist als das Flugzeug und mindestens zehn Tage schneller als die Bahn.
Das mit der Geschwindigkeit könnte eng werden, nachdem die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) einen Güterzug in zehn Tagen von Xi’an nach Budapest geführt hat. Aber Ceva nimmt für sich in Anspruch, von Tür zu Tür zu liefern, während beim Bahntransport in der Regel noch jeweils fünf Tage für den Vor- und Nachlauf hinzukämen. Das laufe dann insgesamt auf etwa 25 Tage hinaus. Eine mögliche Zeit-ersparnis mit dem Lkw ist offen-bar für einige Kunden interessant, obwohl der Transport vier Mal so teuer sei wie mit dem Zug, sagt ein Ceva-Sprecher trans aktuell.
Der schnelle Laster bringt bei DB Cargo jedenfalls niemanden aus der Ruhe. „Für uns ist der Lkw
Wettlauf auf der SeidenstraßeIn nur acht Tagen mit dem Lkw nach China – Neue Zugangebote ebenfalls mit kurzen Laufzeiten
Wer ist schneller? 16 Tage hat der Ceva-Lkw von Südchina nach Spanien gebraucht, zehn Tage der Zug der Rail Cargo Group von Xi’an nach Budapest.
keine Konkurrenz“, sagt ein Spre-cher auf Anfrage. Zum einen brau-che man nur 14 bis 16 Tage von Zentralchina bis nach Deutschland und ohnehin seien die Vorteile der Bahn einfach zu groß, was Kapa-zität, Preisniveau und die Umwelt-bilanz angehe. „Es ist doch schön, dass der Lkw einmal zeigt, was al-les möglich ist“, sagt der Sprecher. Es gehe aber kein Weg daran vor-bei, dass ein Lkw pro Fahrt mit ma-ximal zwei Containern unterwegs sei, während die Bahn gleichzeitig 41 Einheiten befördere.
DB Cargo will jedenfalls von dem „sehr interessanten Markt“ Seidenstraße profitieren und hat Ende 2018 eigens die Vertriebsein-heit „DB Cargo Eurasia“ gegrün-det. Sie soll als Operateur für die Chinaverkehre alle Aktivitäten im Konzern bündeln, unterstützt von einem neuen Büro in Shanghai. Mehr Angebote und eine verbes-serte Produktivität sind das Ziel, und so kam auf Kundenwunsch auch eine Seeverbindung von Kaliningrad nach Rostock dazu. 2018 wurden auf der Strecke mit über 3.600 Zügen 85.000 Contai-ner transportiert, bis 2020 soll die 100.000er Marke geknackt werden.
Text: Regina Weinrich | Fotos: Ceva, Rail Cargo Group
TIRE FLEET DAYKÖLN, 28.05.2019
DAS NETWORKING-EVENT FÜR HERSTELLER,
HÄNDLER UND FLOTTENMANAGER
JETZT
ANMELDEN
www.eurotransport.de/
tirefl eetday
RFID-Technologie
24-Stunden Breakdownservice
Telematiksysteme
RDKS
Fleetchecksysteme
Winterreifen
Das neue Kombi-Terminal Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein nimmt mit dem Start eines Güterzugs
von und nach Verona am 6. Mai seinen Betrieb auf. Darauf weist der KV-Operateur Kombiverkehr hin. Er betreibt das Terminal ge-meinsam mit der Kreisbahn Sie-gen-Wittgenstein. An den neuen Mehrgruppenzug bindet Kombi-verkehr nach eigenen Angaben in Kooperation mit Mercitalia auch das Terminal Kornwestheim an.
Die Züge verkehren dreimal die Woche. Die Laufzeit beträgt rund 38 Stunden. Mit dem neuen An-gebot zwischen Deutschland und Italien steigert Kombiverkehr die Zahl seiner wöchentlichen Zugab-fahrten über den Brenner auf 148.
Kombiverkehr-Geschäftsfüh-rer Robert Breuhahn weist darauf hin, dass es aufgrund der hohen Auslastung des Terminals Vero-na als auch aufgrund der hohen Trassenbelegung in Italien nicht einfach gewesen sei, das neue Angebot zu realisieren.
Das Terminal in Kreuztal wurde erst im September eröffnet, bietet also noch erhebliches Potenzial für weitere Zugabfertigungen. Ein weiteres Argument: „Es ist der ein-zige Standort am südlichen Ende des Rhein-Ruhr-Gebiets, der ohne Nutzung der Rheinstrecke mit dem Ladeeinheiten-Profil P400 angefahren werden kann“, sagt Breuhahns Geschäftsführerkollege Armin Riedl. Ferner sei dort ein Be-trieb rund um die Uhr möglich. rat
Achse über den Brenner
Kombiverkehr startet Kreuztal–Verona
1Prozent
DER WARE KOMMT BISLANG AUF DEM
LANDWEG VON CHINA NACH EUROPA. DER LÖWENANTEIL ENT-
FÄLLT AUFS SEESCHIFF
DIE SEIDENSTRASSE
● Chinas Projekt einer neuen Seidenstraße, auch Belt and Road Initiative genannt, umfasst weit mehr als nur die Land-verbindung auf dem eurasischen Kontinent. Insgesamt sind mehr als 80 Länder eingebunden. Kritiker unterstellen, dass es bei weitem nicht nur darum geht, neue Handelsrouten zu erschließen, sondern sehen die Aktivitäten als Expansion, mit dem das Land nicht nur exportieren und seine Ressour-cen sichern, sondern auch seine geopolitische Position ausbauen und festigen will.
● Schätzungen zufolge werden die mehr als 1.000 Projekte der neuen Seidenstraße in Zentral- und Süd- und Südostasien, dem Mittleren Osten, der Türkei und Osteuropa sowie in der Karibik und in Afrika mehr als eine Billion US-Dollar kosten. Bereits Anfang 2018 hatten 27 EU-Botschafter in Peking einem Handelsblatt-Bericht zufolge vor dem Mammutunter-fangen gewarnt. Es begünstige subventionierte chinesische Baukonzerne und laufe der Liberalisierung des Handels entgegen, schrieben sie.
● China hat schon viele Kredite vergeben, Experten gehen von einem Umfang von mehr als 200 Milliarden Dollar aus. Staaten wie Pakistan mit Infrastrukturinvestitionen in zweistelliger Milliardenhöhe geraten in eine große Abhängigkeit. Das Thema Seidenstraße erregt auch in Europa Besorgnis, weil das geliehene Geld in eine Schuldenfalle und zu Abhängigkei-ten führen könne, so ein EU-Sprecher. China könnte sich zum Spaltpilz in der EU entwickeln, es pickt sich die Mitgliedstaa-ten gern abseits der Institutionen zu Verhandlungen heraus.
● Die EU-Kommission überprüft unterdessen die Beziehungen zu China, auch angesichts „des zunehmenden politischen Ein-flusses“, und will die Union geschlossener aufgestellt sehen. „Die EU und China sind strategische Wirtschaftspartner und auch Konkurrenten“, sagte der für Wachstum und Investitio-nen zuständige Kommissar Jyrki Katainen und pochte auf ei-nen fairen Wettbewerb. Es geht um Subventionen, erzwunge-nen Technologietransfer, um Arbeits- oder Umweltstandards und um die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen.
trans aktuell 9 S C H W E R P U N K T K O M B I N I E R T E R V E R K E H R 18. April 2019 9
Wie lassen sich mehr Gü-ter von der Straße auf die Schiene verlagern? Das Unternehmen BSH
Hausgeräte beantwortet diese Frage seit November 2018 mit ei-nem Güterzug, der bislang einmal wöchentlich von Giengen nach Triest und wieder zurückfährt. Die Fracht: Hausgeräte. BSH sucht nun noch weitere Verlader,
die den Zug mitnutzen, damit die Fahrten langfristig rentabel sind und der Güterzug ausgelas-tet ist. Ebenso möchte BSH mit den externen Verladern saisonale Schwankungen ausgleichen.
Das Interesse an dem Güter-zug ist groß. Etwa 100 Unterneh-mer kamen kürzlich zu BSH nach Giengen (Kreis Heidenheim), wo das Unternehmen seine Pläne mit dem Güterzug vorstellte. Bei den Transporten arbeitet BSH mit der Firma MSC (Mediterranean Ship-ping Company) zusammen, einem Anbieter globaler Containerver-schiffung sowie von Schienengü-tertransporten. „Wir wollen mit dem Zug zwei Rundläufe in der Woche erreichen“, erklärte Gerd Ocker, Leiter der BSH-Logistik in Giengen, gegenüber trans aktuell.
Für die Strecke von Giengen nach Triest benötigt der Güterzug 20 Stunden. Er fährt als Ganzzug los und kommt als solcher am Ziel an. Nur zum Fahrerwechsel findet ein Halt statt. Immerhin fährt der Zug durch drei Länder, und die Fahrer müssen die Landessprache beherrschen.
Warum wählte BSH den Hafen Triest als Ziel? „Es ist der einzige Hafen am Mittelmeer mit Tief-seeterminal. Dies betrachten wir als eine gute Voraussetzung für die Verladung in Großcontainer-schiffe“, führt Ocker aus. Zudem gibt es von Triest aus Schiffsver-bindungen zu einigen Zielmärk-ten von BSH, zum Beispiel nach Israel, Griechenland, Nordafrika,
in die Türkei und nach Fernost. Interessant ist der Hafen für BSH und andere Verlader auch gewor-den, nachdem dort in den ver-gangenen Jahren erheblich in die Infrastruktur investiert wurde.
Der Hafen Triest lässt sich auch für Warenströme des Un-ternehmens nach Deutschland nutzen, zum Beispiel aus der Tür-kei. Dort befindet sich eine große Produktionsstätte von BSH, die Haushaltsgeräte für den deut-schen Markt produziert.
Bis November 2018 fuhren die Güterzüge von Triest aus jedoch
nur bis zum Güterbahnhof Mün-chen-Ost, wo dieser Zug endete. Anschließend wurden die Haus-haltsgeräte mit dem Lkw über die A 8 nach Giengen gefahren. Dort befindet sich nicht nur ein BSH-Werk für Kühlschränke und Gefriertruhen, sondern auch das größte deutsche Logistiklager.
Mit dem neuen Güterzug spart sich BSH seit vergangenem November den Lkw-Nachlauf für jeden Container von München-Ost nach Giengen. Damit ent-fallen auch die zeitraubenden Verkehrsstaus auf der A 8. Ein Ganzzug ersetzt laut BSH zudem wöchentlich 160 Lkw-Fahrten von Giengen nach München – mit entsprechend positiven Folgen für die CO2-Bilanz des Unterneh-mens. Außerdem entlastet der Zug das Containerterminal Ulm, das schon seit Längerem an der Kapazitätsgrenze arbeitet.
Die Kapazität des Zugs beträgt 80 TEU, also 80 Standardcontainer. Als Einzugsgebiet für die externen Verlader betrachten BSH und MSC einen Umkreis von bis zu 150 Kilo-metern rund um Giengen.
Mit seinen Haushaltsgeräten transportiert BSH eher leichtere Waren. Daher können die ex-ternen Verlader durchaus auch schwerere Güter auf dem Zug transportieren. Laut BSH ist der Zug für Verlader aus sämtlichen Branchen offen.
Da es sich um ein privates Terminal handelt, versprechen
die Partner BSH und MSC kurze Abwicklungszeiten beim Be- und Entladen ohne langes Warten. „Die Logistikkette lässt sich sehr stabil planen“, erklärt Ulf Büsch-king, Head of Intermodal & Logis-tics bei MSC.
Der Zug nach Triest ist nicht der einzige, der das Terminal von BSH verlässt. Wöchentlich fah-ren von Giengen aus drei bis fünf Nordzüge nach Hamburg, Bre-merhaven und Wilhelmshaven sowie zwei Züge in die Türkei.
Vor einigen Jahren lag das Verhältnis Schiene/Lkw im Ex-port bei BSH noch bei 50 : 50. In-zwischen hat sich das Verhältnis auf 60 : 40 zugunsten der Schiene verändert. Diesen Weg möchte BSH weitergehen. Auch deshalb, weil das Güteraufkommen im Terminal seit Inbetriebnahme im Jahr 2008 ständig steigt. So wur-den im Jahr 2008 noch 5.800 TEU abgewickelt, 2012 schon 30.200 Container und 2017 dann 41.500 Einheiten.
Gibt es auch bei Inland-stransporten noch Möglichkei-ten, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern? „Eher nicht. Die Zeitres triktionen sind zu eng“, erklärt An dreas Tonke, Director Transport Management bei BSH. „Dennoch sind erste Tests bereits im Gange.“
Text: Ralf Lanzinger | Foto: IHK Ostwürttemberg | Grafik: Florence Frieser
EIN GÜTERZUG SPART PRO WOCHE 160 LKW-FAHRTEN EIN
Zwei Rundläufe als ZielBSH Hausgeräte mit neuer Güterzugverbindung von Giengen nach Triest – noch Kapazitäten frei
MEHR QUALITÄT UND EFFIZIENZ VON UND NACH POLEN Nutzen Sie ab sofort drei Mal pro Woche die Verbindungen zwischen Duisburg und Poznan bzw. Warszawa und erreichen Sie im Gateway verkehr zahlreiche europäische Länder. Und das Ganze aufgrund eines neuen Produktionskonzeptes mit dezidierten Ressourcen qualitätsgesichert und effizient.
Mehr Informationen und Preisauskünfte unter Telefon +49 69/7 95 05-2 67 oder [email protected]
DAS UNTERNEHMEN
BSH Hausgeräte in Giengen
● In Giengen an der Brenz befindet sich eine Fabrik für Kühlschränke und Gefriertruhen sowie das größte deut-sche Logistikzentrum von BSH Hausgeräte. Hier werden Haus geräte auf einer Fläche von 144.000 Quadratmetern gelagert.
● Täglich verlassen 21.000 Großgeräte und 200.000 Klein-geräte das Logistikzentrum, ein Großteil davon über das betriebseigene BSH-Containerterminal mit Gleisanschluss. Jährlich werden von Giengen aus 20.000 Container mit Zügen transportiert, beispielsweise zu den deutschen See-häfen. Seit November 2018 auch zum Adria-Tiefseehafen nach Triest.
Porsche auf der Schiene
Porsche exportiert
ab sofort elf Prozent
seiner fabrikneuen
Fahrzeuge nach China
mit der Bahnverbin-
dung von Hellmann
Worldwide Logistics.
Sie führt entlang der
Neuen Seidenstraße
in die Metropole
Chongqing. Damit sind
die Sportwagen bis zu
drei Wochen schneller
als mit dem Schiff am
Ziel. Die Bahnstrecke
misst rund 11.000
Kilometer und führt
von Deutschland aus
ostwärts über Polen,
Weißrussland, Russ-
land und Kasachstan
ins Reich der Mitte.
TFG mit 2018 zufrieden
Der Seehafen-
hinterland-Anbieter
TFG Transfracht
hat 2018 eine neue
Bestmarke beim
Aufkommen erzielt.
Das Sendungs-
volumen legte gegen-
über dem Vorjahr
um 6,4 Prozent auf
950.000 20-Fuß-
Container zu. Einen
wichtigen Beitrag dazu
haben den Angaben
nach die verbesserte
Performance in der
Schienentraktion so-
wie Schritte zur Digi-
talisierung der Liefer-
ketten geleistet.
GiengenGiengen
TriestTriest
trans aktuell 9 18. April 2019 S P E D I T I O N U N D L O G I S T I K10
trans aktuell: Herr Touzani, Herr Haltmayer, wie kamen Sie auf die Idee, ein Lab für Logis-tik-Start-ups zu gründen?
Touzani: Bei unserer Zu-sammenarbeit mit Quick Cargo, Fraport und anderen Partnern des Haus 61 hatten wir immer das Gefühl, besser kommunizie-ren zu müssen. Wenn man sich im normalen Geschäft mal zwei Wochen nicht sieht, geht vieles einfach unter und viel wertvolle Zeit verloren. Da wir selbst ein Büro mit 160 Quadratmetern ha-ben, dachten wir uns: Wie wäre es, wenn wir selbst ein Lab auf-machen und Start-ups reinholen, die zu den Partnern passen? Wir versuchen das zu machen, was die Leute schon seit Jahrzehnten sa-gen: Die Menschen in der Logistik zusammenbringen.
Haltmayer: Wenn man sich die fünf größten Logistikunter-nehmen ansieht, sind vier davon aus Deutschland. Wir Spezialisten aus der Logistik sehen jedoch we-nig Initiative in Richtung Digitali-sierung und Start-ups.
Touzani: Aber genau in der Digitalisierung liegt der richtige Schritt. Und langsam aber sicher wacht die Branche auf. Als wir vor zwei oder drei Jahren angefangen haben, wollte uns keiner zuhören. Heute ist das genau andersrum.
Gibt es solche Labs nicht schon längst?
Haltmayer: Ich denke, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass es sowas im deutschen Logis-tiksektor noch nicht gab.
Touzani: Wir sind mit Car-gosteps mittlerweile seit dreiein-halb Jahren in der Start-up-Szene unterwegs. Da haben wir schon einiges gesehen. Es gibt viele An-gebote für Start-ups, die schön verpackt sind. Aber wenn man sich das durchrechnet, bekommt das Start-up oft nicht den Benefit, den es sich verspricht. Außerdem müssen die Start-ups in vielen Fäl-len Anteile abgeben. Das müssen sie bei uns im Haus 61 nicht.
Wie funktioniert das Haus 61?Touzani: Sechs Start-ups er-
halten für ein Jahr nach einer erfolgreichen Bewerbung einen kostenlosen Platz in unserem Lab für je zwei Personen. Dort sind sie mit allem versorgt, was sie zum Arbeiten benötigen und werden von unseren Partnern als Mentor unterstützt. Außerdem wird es Veranstaltungen zum Netzwerken und verschiedene Workshops ge-ben. Eröffnet wurde das Lab am 12. April.
Was ist das Ziel?Touzani: Ziel ist es, sich mit
anderen Leuten aus anderen Un-ternehmen auszutauschen, die ebenfalls aus dem Bereich Logis-tik kommen und den Partnern die richtigen Start-ups zu vermitteln.
Aus dieser Zusammenarbeit sol-len Projekte wirklich vorangetrie-ben und realisiert werden.
Haltmayer: Es geht darum, Profis aus jedem Transportseg-ment mit ins Boot zu holen. Das werden sicher nicht alles Start-ups sein, die dasselbe machen. Und das ist das Schöne für uns als Partner: Wir kommen da mit ei-ner Idee oder einem Problem zum Thema Digitalisierung rein, stellen es vor und können dann mit dem passenden Start-up kooperieren und eine Lösung erarbeiten.
Wie groß ist das Interesse der Unternehmen am Haus 61?
Touzani: Mittlerweile gibt es viele Anfragen von Unternehmen, die einsteigen wollen. Man sieht, dass die mittelständischen Unter-nehmen großes Interesse am The-ma Start-up haben. Ihnen fehlt es aber an Zeit und Manpower, um so etwas überhaupt auf die Beine zu stellen und im Thema zu sein. Zu wissen, wo wichtige Veranstal-tungen sind, welche Start-ups und Kooperationsmöglichkeiten es gibt. Dafür müssten die meisten eine eigene Firma oder zumindest einmal eine eigene Abteilung in ihrem Unternehmen gründen.
Und da kommt das Haus 61 ins Spiel?
Touzani: Genau. Diese Arbeit nehmen wir den Unternehmen ein Stück weit ab. Wir wissen
nach mehreren Gesprächen, was sie machen und was sie brauchen. Und wir vermitteln mit diesem Wissen das richtige Start-up an die Partner im Haus 61.
Welche Vorteile springen dabei für beide Seiten heraus?
Touzani: Im Endeffekt ist es eine Win-win-Situation. Natür-lich ist die Sache ein Investment für die Unternehmen – und damit ein Risiko. Der feine Unterschied ist, dass wir an die Unternehmen herantreten und ihnen sagen, was für sie interessant ist. Und genau diese Vernetzung macht das Gan-ze für Start-ups interessant.
Ist eine Erweiterung schon an-gedacht?
Touzani: Als wir mit dem Haus 61 angefangen haben, war uns nicht bewusst, dass so viele Anfragen kommen würden. Wir haben auf jeden Fall noch 80 Qua-dratmeter Platz, der bald frei wird. Also Tendenz klar zum Erweitern.
Text: Carina Belluomo | Fotos: oneinchpunch/stock.adobe.com, Ina Martella, Cargosteps
Kräfte bündelnIm Frankfurter Bahnhofsviertel entsteht ein Lab für Start-ups aus der Logistik – Raum für Ideen schaffen
Näher dran.TV
Seit 7. März 2019 unter eurotransport.de/tv
Neu im WebTVMit eurotransport TV sind Sie näher
dran an aktuellen Entwicklungen,
den Zukunftstechnologien und
allem, was Logistik und Speditionen
bewegt.
Mit freundlicherUnterstützung von:
Moderation: Alexandra von Lingen
DAS HAUS 61
● Das Haus 61 ist ein Lab für Start-ups aus der Logistik, das sich im Frankfurter Bahnhofsviertel befindet
● Im Rahmen eines zwölfmonatigen Programms bekommen sechs Start-ups nach erfolgreicher Bewerbung kostenlos je zwei Plätze mit kompletter Büroinfrastruktur
● Partner aus der Logistk, wie beispielsweise Fraport, Sove-reign oder Quick Cargo Service unterstützen das Haus 61 finanziell und fungieren als Mentoren für die Start-ups
● Außerdem bietet das Haus 61 regelmäßige Events zum Netzwerken sowie Workshops an
● Ziel ist es, große Logistikunternehmen und Start-ups aus den unterschiedlichsten Branchen an einen Tisch zu bringen
ZUR PERSON
● Rachid Touzani ist Grün-der und CEO von Cargo-steps, einer Track-and-Trace-Softwarelösung für Logistik- und Fracht-unternehmen
● Das Logistik-Start-up gewann 2017 den Frank-furter Gründerpreis
ZUR PERSON
● Nico Haltmayer ist Leiter der Quick Cargo Service Niederlassung Frankfurt und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Logistik
● Quick Cargo Service ist einer der Partner des Start-up Lab Haus 61
trans aktuell 9 S P E D I T I O N U N D L O G I S T I K 18. April 2019 11
Ein guter Standort ist alles. Die Mitarbeiter der Stocké Spedition & Transport ver-fügen zwar noch nicht über
einen fertig eingerichteten Kon-ferenzraum und müssen die nächste Zeit zumindest teilwei-se mit Renovierungsarbeiten le-ben, aber der neue Firmensitz in Kelsterbach hat genügend Platz: 600 Quadratmeter Büroflächen stehen zur Verfügung.
Die will Firmenchef Manuel Stocké nicht allein nutzen. „Wir können damit Flächen an Kun-den und Partner untervermieten. Sechs Unternehmen nutzen das Angebot bereits, beispielsweise Frachtführer und Spediteure, mit denen wir zusammenarbeiten“, sagt Stocké. Darunter ist auch ein Unternehmen, das für die Stocké Spedition & Transport und deren Kunden wichtige Aufgaben im Be-reich der Sicherheit übernimmt. Es kümmert sich bei Frachtfüh-rern um die notwendigen Schu-lungen und Nachweise für den zugelassenen Transporteur, schult Mitarbeiter im Umgang mit ADR-Gut und macht die Luftfracht-sicherheitspläne. „Das kommt unserem Bestreben nach, so viele Dienstleistungen wie möglich inhouse zu machen“, so Stocké.
Denn die Spezialität von Stocké Spedition & Transport und deren Kunden sind Luftfrachttranspor-te. Das Unternehmen, 1974 von Stockés Vater gegründet, hat heute rund 50 Mitarbeiter und 20 Fahrzeuge, vom Sprinter bis zum 40-Tonner. 25 Fahrer bewegen die Fahrzeuge, vier bis fünf feste Un-ternehmen übernehmen darüber hinaus einen weiteren Teil der Verkehre. „Wir fahren dabei mit deutschen Transporteuren. Da läuft alles richtig, und wir haben alles im Blick“, betont Stocké.
Denn die sichere Lieferkette, das ultimative Ziel in der Luft-fracht, ist laut dem Firmenchef durch die Datenschutzgrund-verordnung erschwert worden. „Rechtlich darf ich nur noch die Personalausweise der Fahrer prü-
fen, nicht aber die Zuverlässigkeit des Fahrers selbst oder die Zuge-hörigkeit des Fahrers zu dem ge-nannten Unternehmen, was für eine sichere Lieferkette eigentlich wichtig wäre“, bedauert Stocké.
Seine eigenen Transportkapa-zitäten hat Stocké in den ver-gangenen Jahren durch einige Übernahmen ausgebaut, kleinere, befreundete Firmen, deren Chefs keine Nachfolge gefunden hat-ten – darunter 2016 die BG Trans aus Maintal (Kurier-Express), das Unternehmen Dieter Lemp aus Friedberg (Stückgut national) und 2018 das Unternehmen Franz Kohl, das Luftfrachtimporte auf die Straße bringt.
Zusammen mit einem weiteren Partnerunternehmen hatte Stocké 2018 auch das Lager in Kelsterbach übernommen und für das eigene Unternehmen in eine 200.000 Euro teure Röntgenanlage für Luftfracht investiert. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit klappte jedoch nicht, das Partnerunternehmen zog im August vergangenen Jah-res aus. Für Stocké eine glück-liche Fügung, denn neben den Import- waren jetzt auch mehr Exportsendungen zu bearbeiten. „Der Import ist Ende 2018, Anfang
2019 um fast 70 Prozent eingebro-chen“, sagt Stocké. Inzwischen be-arbeitet das Unternehmen 800 bis 1.000 Tonnen Exportsendungen monatlich und macht als regle-mentierter Beauftragter durch sei-ne Röntgenanlage unsichere Sen-dungen für die Luftfracht sicher.
Großes Geld verdiene man aber allein durch die Röntgen-anlage nicht, sagt der Firmenchef. Vorn rein, hinten raus: So einfach sei es nicht. „Das Problem sind die vielen Schwarzalarme“, sagt er. Wenn das Material zu dicht gepackt sei, drängen die Röntgen-strahlen nicht überall durch. „In diesem Fall müssen wir die Sen-dung abpacken oder das Pack-stück aufmachen und eventuell mit einem Sniffer einen Spreng-stoffabstrich machen.“
Das kostet Zeit und Personal-kapazität. Wenn die Mitarbeiter wegen eines Schwarzalarms drei Tonnen Quarzsand abpacken und nach dem Röntgen wieder als Pa-letten zusammensetzen müssen, vergeht viel Zeit. Aber die Akribie ist wichtig. Laut dem Unternehmer sind Mitarbeiter des Luftfahrt-Bun-desamts seit einigen Monaten viel stärker am Flughafen unterwegs, vor allem im Charterbereich, um
die Luftsicherheitskontroll kräfte, die die Röntgenanlagen bedie-nen, zu kontrollieren. Für ihn eine positive Sache, „denn dann wird es endlich zu den notwendigen Preisanpassungen kommen“. Denn für einen erhöhten Sicherheitsauf-wand sollen Kunden auch zahlen.
Text: Ilona Jüngst | Fotos: Jüngst, Stocké, Thomas Küppers
Was sicher sein mussStocké Spedition & Transport aus Kelsterbach ist auf Luftfracht und explosive Stoffe spezialisiert
Geschäftsführer Manuel Stocké schafft sichere Luftfracht.
Geschulte Mitarbeiter bedienen die Röntgenanlage.
Wie man es auch dreht und wendet: Wir machen immer das beste Angebot. Mercedes-Benz CharterWay. Mieten ohne böse Überraschungen: keine versteckten Kosten oder komplizierte Klauseln. Bei uns erwartet Sie Transpa renz, Qualität und reibungsloser Service. Mehr Informationen unter www.charterway.de
ERFOLGREICH IN DER NISCHE
● In einer Nische ist das Unternehmen Stocké besonders erfolgreich: in der Logistik für Feuerwerk. In seinem Lager in Dietzenbach übernimmt der Logistiker für den Marktfüh-rer Weco die Lagerlogistik. Auf den 4.250 Quadratmetern lagern neben Pyrotechnik aber auch Airbags für einen Hersteller aus Aschaffenburg.
● 2019 sollen weitere 5.000 Quadratmeter Lagerfläche in Darmstadt dazukommen, die 2020 auf 10.000 Quadratmeter aufgestockt werden sollen.
● „Der Bereich Explosiv ist ein Wachstumsfeld“, sagt Stocké. Wenn andere von einer Peak-Saison reden, kann Stocké den Hochlauf auf wenige Tage eingrenzen. „Am 27. und 28. Dezember verladen wir für den Postleitzahlenbereich 6 und angrenzende Gebiete pro Tag zwischen 20 und 40 Lkw“, sagt Stocké. Dafür sind die eigenen Fahrzeuge und die der Partnerunternehmen bereits ab Juni geblockt. Die Partner schulen dafür ihre Fahrer im Umgang mit Gefahrgut.
● „Nach dem Jahreswechsel holen wir die unverkaufte Ware aus den Läden zurück. In unserem Lager wird sie, wenn nötig, neu verpackt und wieder verkaufsfähig gemacht. Ab April starten dann die Rundtransporte zwischen den Lager-standorten des Herstellers, die wir auch durchführen.“
200.000Euro
INVESTIERTE DIE FIRMA STOCKÉ IN DIE RÖNT-
GENANLAGE, MIT DER DAS UNTERNEHMEN LUFTFRACHT SICHER
MACHT
trans aktuell 9 18. April 2019 S P E D I T I O N U N D L O G I S T I K12
Das Unternehmen Craiss aus Mühlacker ist bekannt für seine Jumbotransporte. Was macht man aber als Mittel-
ständler, wenn man auch seine an-deren Stärken in den Vordergrund stellen will? Craiss hat sich des-wegen einen ganz eigenen Claim ausgedacht: Generation Logistik.
Denn das Unternehmen will zeigen, dass es noch mehr kann als nur Jumbotransporte. Luft-fracht und Seefracht etwa: Aktu-ell haben daher Craiss und der Luft- und Seefrachtspediteur ITK Internationales Transport-Kontor aus Karlsruhe ein Joint Venture namens LSA Logistics gegründet. „Durch die Vereinigung unserer ge-
meinsamen See- und Luftfrachtka-pazitäten haben wir eine gewisse Größe erreicht und werden so von den Reedern und Carriern besser wahrgenommen“, sagt Geschäfts-führer Michael Craiss. Durch das Joint Venture erhofft sich der Ge-schäftsführer einen deutlichen Umsatzsprung von bis zu vier Millionen Euro. Craiss-Kunden profitieren zudem durch den di-rekteren Zugang, etwa durch Büros in Hamburg und an den Flughäfen Stuttgart und Frankfurt.
„Die Marke Jumbo führen wir weiter fort – sie macht auch noch rund ein Viertel unseres Umsat-zes aus“, sagt Michael Craiss im Gespräch mit trans aktuell. Der
Claim Generation Logistik soll aber ausdrücken, dass nicht nur eine neue Unternehmensgenerati-on am Start ist, sondern dass auch die Logistik in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle spielt.
Etwa die Kontraktlogistik. Nicht zuletzt im Ausland will Craiss hier noch wachsen, ins-besondere in Tschechien und Rumänien, wo es bereits einen stabilen Bestandskundenstamm gibt. Erst vor einem Jahr hat Craiss im rumänischen Sibiu einen neu-en Kontraktlogistikstandort mit 10.000 Quadratmeter Fläche in Betrieb genommen.
„Das Lager ist ein Multi-User-Standort und ausgerichtet für Kunden aus den Bereichen Elek-tronik, Konsumgüter, keramische Industrie beziehungsweise Bau-stoffe und Automotive“, sagt Jörg Schneider, der Geschäftsführer für die Sparte Kontraktlogistik ist. Vor allem von den Automobilzuliefe-rern werde der Bereich gepusht: „Wir übernehmen für einen Her-steller die Inbound-Transporte, den Wareneingang, die Lagerung
und das Umverpacken sowie die Sequenzierung und das Ausliefern bis an die Maschinen in der Pro-duktion.“ Auch für Elektronikkun-den ist Craiss laut Schneider in die Produktionsversorgung involviert und übernimmt etwa Rüstprozesse an den Maschinen und die Mate-rialversorgung mit Routenzügen, Staplern und Kanban-Systemen.
In Bezug auf die Kontraktlo-gistik arbeitet das Unternehmen laut Schneider mit zwei Wachs-tumsszenarien: Erstens einem Multi-User-Ansatz – zuletzt habe das Unternehmen dafür etwa ei-nen Lagerstandort in Karlsruhe mit 18.000 Quadratmetern über-nommen. Zweitens ein „dedica-ted warehouse“, ein Konzept, das vor allem in Deutschland verfolgt werde. Vor allem bei letzterem sei aber die Vorlaufzeit deutlich länger als in anderen Bereichen – anderthalb bis zwei Jahre braucht es laut Schneider, bis für Kontrakt-logistikkunden die Immobilienbe-schaffung oder der Bau, die Integ-ration der Systeme und der Anlauf der Prozesse beginne.
Der Transportbereich bleibt aber ein weiteres wichtiges Ge-schäftsfeld. 360 schwere Lkw und 140 Kleinfahrzeuge sowie Verteilerfahrzeuge sind laut Mi-chael Craiss für das Unterneh-
Generation Logistik stärkenCraiss aus Mühlacker baut Geschäftsfelder aus – Joint Venture in der Luft- und Seefracht, neue Kontraktlogistiklager
Setzt auf kurze Reaktionszeiten: Geschäftsführer Klöpper.
men aus der Nähe von Pforzheim unterwegs, darunter 200 eigene Fahrzeuge. 360 Fahrer – einige der Lkw werden in Mehrfachbeset-zung gefahren – arbeiten für den Mittelständler. Einen Ausbau des Fuhrparks plant Craiss nach eige-nen Angaben nicht, 2019 werden nur 70 bis 80 Fahrzeuge ersetzt, allerhöchstens ein moderates Auf-stocken sei möglich – der Fach-kräftemangel macht eventuellen Ausbauplänen einen Strich durch die Rechnung. „80 Prozent unserer Fahrer haben daher einen Migrati-onshintergrund oder sind auf Fahr-zeugen mit nicht-deutschen Kenn-zeichen unterwegs“, sagt Craiss.
Aufgrund des Fachkräfteman-gels sei das Thema Personal in-zwischen „ganz klar Aufgabe jeder Führungskraft bei Craiss“, sagt Mi-chael Craiss, und eines der zentra-len Themen, beispielsweise auch bei den alle zwei Monate statt-findenden Treffen der Standort-leiter, bei denen erfolgreiche Ak-tionen multipliziert werden, um die Mitarbeiter zu halten: „Denn schließlich erwarten wir von un-seren Mitarbeitern hinsichtlich Belastung und Flexibilität auch nicht wenig“, sagt Craiss.
Text: Ilona Jüngst | Fotos: Jüngst, Craiss
Wir bieten Ihnen mit CarLo® die richtige Software für all Ihre Prozesse:Speditionelle Frachtabwicklung, Disposition, Fuhrparkverwaltung und vieles mehr!Kontaktieren Sie die Soloplan GmbH – DAS Softwarehaus der Logistikbrancheunter +49 831 57407- 300, [email protected] oder im LIVE-Chat auf soloplan.de!
Manchmal ist der Bedarf unmittelbar: Wer akut Lagerf lächen benötigt, möchte die Suche und
die Geschäftsanbahnung mög-lichst schnell gestalten und auch bei konkreten Nachfragen nicht lange auf Antwort warten. Aus diesem Grund hat die Online-Lagerplattform Sharehouse, auf der Interessenten an Lagerflä-chen und Lager-Anbieter zusam-mentreffen, eine neue Chat- und
Lager auf AnrufPlattform Sharehouse erweitert Funktionen zur schnelleren Kontaktaufnahme
Angebotsfunktion eingerichtet, über die Lager-Suchende und -Anbieter direkt miteinander kommunizieren können.
„Die neue Funktion ermög-licht es, dass der Logistikdienst-leister ein ganz individuelles Angebot machen kann, weil die konkreten Anforderungen schon im Vorfeld der Buchung im Chat angesprochen werden können“, sagt Sharehouse-Geschäftsführer Jörg Klöpper. Dies können etwa Anforderungen sein, die sich aus der Natur der Ware ergeben, Fra-gen zu Spezifikationen des Lagers oder auch die Frage nach Zusatz-dienstleistungen.
Laut Klöpper sind Zeit und Fle-xibilität für viele Kunden wichtige Kriterien: „In der Regel antworten die Logistikdienstleister, die bei Sharehouse anbieten, im unte-ren Stundenbereich oder greifen gleich zum Telefon.“ Um die Kom-munikation noch mehr zu ver-einfachen, ist laut Klöpper auch eine App geplant. Zudem wurde kürzlich das Empfehlungspro-gramm gestartet, im Zuge dessen es möglich ist, Sharehouse an be-kannte Logistiker zu empfehlen. „Wir merken, dass es viele Leute
gibt, die den einen oder anderen Logistiker kennen. Warum also nicht die Möglichkeit geben, die-sem Sharehouse zu empfehlen und bei Erfolg dafür belohnt zu werden“, so Klöpper.
Das Berliner Start-up, das zum Duisburger Logistikdienstleister Imperial Logistics gehört, hat nach Angaben des Geschäftsfüh-rers derzeit bereits Direktzugriff auf mehr als 280 Lagerstandorte.
Im Hintergrund der Plattform stehen zudem 2.500 Lager in ei-ner Datenbank mit CRM-System. Denn zum Serviceangebot von Sharehouse gehört nicht nur die direkte Vermittlung zwischen dem suchenden Verlader und dem Dienstleister mit freien La-gerflächen, sondern auch ein „klassischer Concierge-Service“: Der Verlader teilt mit, was er braucht, und Sharehouse sucht entsprechende Lagerstandorte. „Unser Ziel ist es, den Kunden, die suchen, im Umkreis von 50 Kilometern fünf Lagerstandorte anbieten zu können“, sagt Klöp-per. Ziel sei es, auch langfristige Geschäfte zu vermitteln. Dabei hat der Geschäftsführer auch vie-le Onlinehändler oder Hersteller
im Blick, die über Grenzen hinweg Lagerflächen suchen und damit etwa bei größeren Logistikdienst-leistern fündig werden.
Abhängig ist die Suche vom Lagertypus, von geforderten Zer-tifizierungen und besonderen Konfigurationen wie Rampe oder angebotene Zusatzdienstleistun-gen. Das Start-up bietet laut Klöp-per alle gängigen Lagerklassen an, vom überdachten Außenlager
über Regal- und Fachbodenlager bis hin zum Gefahrgut- oder Tief-kühllager. Klöpper legt allerdings Wert darauf, dass die Suche und die Bedienung der Plattform so einfach wie möglich sein sollen. Aktuell sind Deutsch und Englisch als Standardsprachen gesetzt. Die Aufschaltung weiterer Sprachen ist geplant.
Text: Ilona Jüngst | Foto: Dierk Kruse
DAS UNTERNEHMEN
● Craiss wurde 1931 im schwäbischen Mühlacker gegründet. Heute verfügt die Firma über 15 Stand-orte in sechs Ländern – neben Deutschland auch in Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien und Mazedonien. Die verfügbaren Lagerkapa-zitäten belaufen sich auf 160.000 Quadratmeter
● 800 Mitarbeiter arbeiten für Craiss, darunter rund 360 Fahrer. Die Flotte umfasst zusammen 500 Fahrzeugeinheiten
Geschäftsführer Michael Craiss (rechts) und Jörg Schneider, verantwort-lich für Kontraktlogistik.
trans aktuell 9 M A N A G E M E N T 18. April 2019 13
Wie können Logistiker qualifizierte Lkw-Fah-rer finden und binden? Darüber sprachen Ex-
perten und Praktiker bei der IHK Region Stuttgart.
Michael Schäfer, wissenschaft-licher Mitarbeiter an der Univer-sität Stuttgart in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Logistik- und Beschaffungsmanagement, stellte Forschungsergebnisse vor, die unter Mitwirkung der Koope-ration Elvis zustande gekommen sind.
Die Studie untersuchte die Personalarbeit von 67 Speditio-nen und bewertete den Erfolg verschiedener Instrumente, zum Beispiel die firmeneigene Home-page, eigene Mitarbeiternetzwer-ke, Social-Media-Plattformen, Zeitarbeitsagenturen, Headhun-ter sowie Jobmessen.
Höhere Abschlussquote
Letztere lohnen sich der Studie zufolge. „Die 40 Prozent der Spedi-tionen, die auf Jobmessen gehen, sind deutlich erfolgreicher bei der Rekrutierung von Azubis zum Be-rufskraftfahrer als die anderen 60 Prozent, die nicht auf Jobmessen gehen“, betonte Schäfer. Zudem ergaben die Forschungen, dass die Jobmesse-Speditionen insgesamt
mehr Azubis zu erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen führen können als Betriebe, die keine Jobmessen besuchen. Weiteres Er-gebnis: Nur rund acht Prozent der befragten Unternehmen setzen Headhunter bei der Fahrersuche ein. Dieser niedrige Prozentsatz sei durchaus berechtigt, erklärte Schäfer, denn: „Unternehmen, die Headhunter einsetzen, können ihre Mitarbeiter weitaus schlech-ter binden als Unternehmen, die das nicht tun.“ Ein Grund dafür könne sein, dass Headhunter die betreffenden Mitarbeiter einfach zeitnah weitervermittelten, da sie dafür Provision erhielten, ver-mutete Schäfer. Bei den anderen bereits erwähnten Instrumenten kommt die Studie zu dem Ergeb-nis, dass sie weitgehend wirkungs-los seien. Apropos Bindung von Personal: Sie ist laut der Studie ge-nauso wichtig wie die Gewinnung von Personal. Schäfer verglich die Mitarbeiterbindung mit einer Ba-dewanne: „Der Stöpsel muss rein, damit das einfließende Wasser nicht abfließt.“
Die Forschungen brachten ebenso zutage, dass folgende Faktoren die Mitarbeiter signi-fikant an das Unternehmen bin-den: Vermittlung von Wohnraum, Sprachschulungen für Fahrer oder die Verbesserung der Be- und Ent-ladebedingungen. Eine noch stär-kere Mitarbeiterbindung entstehe
bei der persönlichen Vermittlung von Wertschätzung, so ein Ergeb-nis der Forschungen der Universi-tät Stuttgart. Die Wertschätzung könne sich hierbei in vielfältiger Weise ausdrücken. Zum Beispiel, indem der Spediteur dem Fahrer eine Lohnerhöhung nicht nur kommentarlos auszahlt, sondern ihm sagt: „Du hast dir die Lohn-erhöhung verdient, weil du so gut bist.“ Eine weitere Möglichkeit: die Fahrer großflächig auf den Trailern abbilden. „Einige Spedi-tionen sind so bereits unterwegs“, berichtete Schäfer.
Verlässliche Absprachen
Auch Nikolja Grabowski, Lei-ter politische Kommunikation bei Elvis, hält Wertschätzung für sehr wichtig. Er empfiehlt beispielsweise Fahrerbetreuer, Geburtstagsanrufe und Aus-zeichnungen, etwa für unfallfrei-es Fahren. Notwendig sei auch Verlässlichkeit, insbesondere bei Absprachen. „Der Urlaub sollte niemals verschoben werden.“
Als weiteren Schritt empfiehlt Grabowski nicht nur transparente Lohnmodelle, sondern auch mo-netäre Anreize wie doppelte Spe-sensätze, Urlaubsgeld oder alter-nativ dazu die unter Umständen steuerfreie Erholungsbeihilfe.
Der Gleichbehandlungsgrund-satz solle für alle Fahrer gelten, so Grabowski. Und: „Leistungsan-reize müssen erreichbar sein.“ Als sinnvolle Ergänzung zum Gehalt und den Leistungsanreizen erach-tet er materielle Maßnahmen wie Arbeitskleidung, private Handy-nutzung, Tankkarten, Mitarbei-terdarlehen, Weiterbildungen sowie die Erlaubnis, den Lkw am Wochenende mit nach Hause zu nehmen. „Wichtig sind klare Re-geln und die Benennung eines An-sprechpartners“, sagte Grabowski.
Jochen Dumler von der Prü-fungsaufgaben- und Lehrmittel-Entwicklungsstelle (PAL) der IHK Region Stuttgart mahnte eine Erneuerung der Ausbildungsord-nung für Berufskraftfahrer an. Die aktuelle stammt noch aus dem Jahr 2001. Berufskraftfahrer werde in der Öffentlichkeit kaum als anerkannter Ausbildungsbe-ruf wahrgenommen, bemängelte Dumler. Hier könne eine Abgren-zung durch geschützte und attrak-tive Berufsbezeichnungen, etwa Kraftfahrtechnologe Güterlogis-tik, helfen. Sinnvoll sei zudem, die fahrzeugtechnischen Aus-bildungs- und Prüfungs inhalte zugunsten von fahrzeuginforma-tions- und assistenztechnischen Inhalten zu reduzieren.
Text: Ralf Lanzinger | Fotos: Matthias Rathmann, Universität Stuttgart
Jobmessen gegen FahrermangelForschungsergebnisse der Uni Stuttgart vorgestellt – persönliche Wertschätzung bindet Mitarbeiter am stärksten
Rekrutierung des eigenen Fahrernachwuchses: Michael Pfister, Ausbilder bei der Barth Logistik gruppe, mit den Azubis Markus Vadas (links) und Boris Sauter (rechts).
„Headhun-ter vermit-teln zeitnah
weiter“MICHAEL SCHÄFER,
WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER AN DER
UNIVERSITÄT STUTTGART
Finden und gefunden werden
Die meisten Jobs in der
Branche gibt es bei:
eurotransport.de/jobs
trans aktuell 9 18. April 2019 S I C H E R A U F A C H S E14
Die „Aktion Abbiegeassistent“ gibt es bereits seit Juli 2018. Nun können die ersten Lkw mit förderfähigen Abbiege-
assistenten auf die Straße rollen. Dafür hat das Kraftfahrt-Bun-desamt (KBA) kürzlich erstmals
die Allgemeine Betriebserlaub-nis (ABE) an Abbiegeassistenz-systeme erteilt, und zwar an die Firmen Wüllhorst Fahrzeugbau und Luis Technology. Für Luis Technology hat die Erteilung der ABE eine große Bedeutung. „Viele
Kunden haben zwar unsere Ab-biegeassistenten reserviert, doch erst jetzt nach Erteilung der ABE bestellen sie. Die ABE ist schon so etwas wie ein Qualitätssiegel“, erklärte Geschäftsführer Martin Groschke gegenüber trans aktuell. Auch Heinrich Wüllhorst, der Ge-schäftsführer der gleichnamigen Firma für Fahrzeugbau, ist stolz auf die ABE. Sein Ziel ist es au-ßerdem, den Abbiegeassistenten so preisgünstig anzubieten, dass jeder Lkw-Besitzer sich ihn leis-ten kann. Zwei Unternehmen, nämlich die Transportgesellschaft Doll (Luis) und Edeka Südbayern (Wüllhorst), haben ihre Fahrzeuge bereits mit den Abbiegeassistenz-systemen nachrüsten lassen.
Nach dem Einbau der Abbiege-systeme in die Lkw ist noch eine Änderungsabnahme nach § 20 und § 22 der StVZO verpflich-tend. Diese technische Abnahme erfolgt durch Prüfingenieure von Überwachungsorganisationen wie Dekra. „Die Änderungsab-nahme dauert etwa 30 Minuten
und kostet um die 74 Euro“, sagt Dekra-Prüfingenieur Gerald Suft.
Bundesverkehrsminister An-dreas Scheuer war bei der Ände-rungsabnahme zu Gast bei Dekra in Regensburg. Scheuer: „Damit haben wir jetzt sichere Systeme für den nachträglichen Einbau auf dem Markt. Fünf weitere Her-steller stehen im engen Austausch mit dem Kraftfahrt-Bundesamt, um die ABE zu erlangen. Das sind gute Nachrichten.“
Damit kann nach Ansicht Scheuers das „Förderprogramm Abbiegeassistenzsysteme“ wei-ter Fahrt aufnehmen. Förderfä-hig ist ein System dann, wenn durch einen amtlich anerkann-ten Sachverständigen oder einen benannten Technischen Dienst eine Einzelabnahme erfolgt oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegt. Bundesminister Scheuer hatte das Förderprogramm des Bundesministeriums für Ver-kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen der „Aktion Abbiegeassistent“ gestartet. Da-
Sicher und gefördert abbiegenMinister Scheuer nimmt bei Dekra erste Abbiege-Assis mit ABE in Betrieb – Aussicht auf weitere Haushaltsmittel
Toter Winkel adeBewegung bei den Nachrüstsystemen
Verkehrsminister Andreas Scheuer und Dekra-Prüfinge-nieur Gerald Suft unterzeich-neten symbolisch das Doku-ment zur Änderungsabnahme.
für stellte das BMVI im Haushalt 2019 insgesamt fünf Millionen Euro bereit, um die freiwillige Aus-rüstung von Lkw zu unterstützen. Innerhalb von nur vier Tagen wur-den diese Mittel im Januar 2019 abgerufen. 587 Anträge für 3.905 Einzelmaßnahmen sind im Mi-nisterium eingegangen. „Ich setze mich dafür ein, dass dieses För-derprogramm in den jetzt anste-henden Haushaltsberatungen für 2020 ausgeweitet wird“, erklärte Scheuer gegenüber trans aktuell. „Und zwar in der Größenordnung eines einstelligen Millionenbe-trags“, so der Verkehrsminister.
Wie Andreas Scheuer gegen-über trans aktuell weiter ausführ-te, haben sich die EU-Gesetzgeber vorläufig auf neue Regeln für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ge-einigt. Dazu gehören verpflich-tende Abbiegeassistenzsysteme für Lkw bei neuen Fahrzeugtypen ab 2022 sowie für alle neuen Lkw ab 2024.
Text und Fotos: Ralf Lanzinger
Vor Betriebsunterbrechungen wegen Feuer und Explosionen fürchten sich Unternehmen neben Cyberattacken mittlerweile am meisten. Kommt es zu einem Großbrand, besteht höchste Gefahr für Mensch und Gesundheit – von den meist enormen Kosten ganz zu schweigen.
Arbeitssicherheit in Betrieben betrifft nicht nur Großunternehmen und Konzerne. Das verdeutlichen die Regelwerke der Deut-schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 1 und DGUV Information 205-003 sowie die ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände), die den betrieblichen Brandschutz beschreiben. Die Vorschriften verpfl ichten auch kleine und mittlere Unternehmen dazu, Brandschutzhelfer zu bestellen und ausbilden zu lassen.
Was heißt das für Transport- und Logistik-unternehmen? „Auch kleinere Unternehmen der Branche müssen bei normaler Brand-gefährdung fünf Prozent ihrer Beschäftigten zum Brandschutzhelfer ausbilden lassen.
Das gilt unter Berücksichtigung des Schichtbetriebs und nicht nur für die Lagerhalle, sondern auch für die Büros in der Verwaltung“, erklärt Rainer Lill vom CompetenceCenter Handwerk/Industrie der DEKRA Akademie. „Liegt eine generell erhöhte Brandgefährdung vor, werden noch mehr Helfer erforderlich.“
Als Experte in Sachen Sicherheit hat die DEKRA Akademie auf diese Vorgaben mit einem maßgeschneiderten eintägigen Un-terweisungsangebot für künftige Brand-schutzhelfer/-innen reagiert. Mit dieser praxisorientierten Ausbildung schützen Unternehmer Ihren Betrieb dauerhaft, sorgen für Rechtssicherheit und erfüllen die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.
Weitere Informationen:DEKRA Akademie GmbHCompetenceCenter Handwerk/IndustrieRainer LillTel.: +49.2251.70 222-22E-Mail: [email protected]
Ausbildung von Brandschutz-helfern. Denn im Ernstfall zählt jede Sekunde!
Seit Anfang des Jahres das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-struktur (BMVI) sein För-
derprogramm für Abbiegeassis-tenzsysteme ins Leben gerufen hat, ist einiges in Bewegung ge-kommen. Und nach der beende-ten Verkehrsministerkonferenz (VMK) fordert auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) an-gesichts der gestiegenen Zahl von Verkehrstoten erneut, die För-dermittel zu erhöhen. Ziel müsse sein, so viele Nutzfahrzeuge wie möglich mit Abbiegeassistenten auszustatten, wofür unabding-bar sei, dass mehr Hersteller eine Betriebserlaubnis für ihre Systeme erhielten. Diese Allge-meine Betriebserlaubnis (ABE) bekommen diejenigen Systeme, die nachgewiesenermaßen die im Verkehrsblatt veröffentlichten technischen Kriterien erfüllen.
Nicht zu verwechseln sind förderfähige Abbiegeassistenz-systeme mit Kamera-Monitor-Systemen, die nicht förderfähig sind. Unterscheidungsmerkmal: Kamera-Monitor-Systemen fehlt das „abstrakte“ Signal zur War-nung des Fahrers – etwa per Warnton oder Warnleuchte.
Außer dem Abbiegeassistenten von Luis Technology, der radar-basiert arbeitet, und dem System von Wüllhorst Fahrzeugbau, das mit Ultraschall funktioniert, hat
noch kein Hersteller eine ABE für seinen Abbiegeassistenten erhalten.
Zuversichtlich , eine ABE im Laufe des Mai zu bekom-men, zeigt sich das Unternehmen Con-tinental, das auf Ra-dartechnologie setzt. Das Prüfverfahren bei Dekra laufe, alle Ergebnisse seien viel-versprechend.
Aktuell beschäf-tigt sich auch der Hersteller Dometic Waeco International aus Emsdetten mit diesen Fragen, konn-te aber bis Redak-tionsschluss noch keine genauen Anga-ben machen.
Dass das System der britischen Firma Brigade Electronic Schwierigkeiten habe, eine ABE zu erhalten, berichtet Geschäftsführer John Osmant. Die technischen Prüfungen seien erfolgt, aber wegen des Brexits sei eine neue ISO-Zertifizierung für Brigade Electronic nötig. Bis Ende dieses Jahres sei jedoch mit der Erteilung der ABE zu rechnen.
Text: Andrea Ertl | Foto: Thomas Küppers
trans aktuell 9 F A H R Z E U G U N D T E C H N I K 18. April 2019 15
Gut 40 Jahre hat der Iveco Daily mittlerweile auf dem Buckel. Mit der neuesten Generation ziehen aktuelle
Assistenzsysteme in den kleinsten Iveco ein. Bei der neuen elektro-mechanischen Lenkung wirkt ein Elektromotor direkt auf die Zahn-stange. Im City Mode, aktivierbar am Lenkrad, verstärkt sich die Lenkunterstützung. Beim Parken und Rangieren muss der Fahrer so laut Iveco bis zu 70 Prozent we-niger Kraft aufwenden als zuvor. Gleichzeitig kann der Elektromo-tor auch selbstständig das Lenkrad drehen. Das ist die Grundlage für intelligente aktive Eingriffe in die Längsführung des Transporters.
Der Pro Active Lane Keeping Assist hilft dabei, den Daily in der Spur zu halten. Um die richtige Spur überhaupt zu erkennen, be-hält ein Kamerasystem die Spur und die Begrenzungslinien im Blick. Dabei wartet das System nicht, bis der Transporter an der Linie kratzt. Die Prämisse lautet, den Daily möglichst stabil in der Spur zu halten. Das klappt auch bestens. Der Daily scheint beina-he mit Autopilot unterwegs. Wer die Hände vom Lenkrad nimmt, wird aber einige Sekunden später ermahnt, bevor der Assistent den Dienst quittiert. Auch ein Seiten-windassistent ist an Bord. Der nutzt aber statt der Lenkung die ESP-Sensorik, um das Fahrzeug zu stabilisieren.
Zusammen mit dem Ab-standstempomaten kommt also nicht nur ein Hauch von auto-nomem Fahren auf. Denn die so-genannte ACC (Adaptive Cruise Control) hat Iveco vorbildlich ab-gestimmt. Das Radar erfasst den Vordermann schon lange, bevor die eingestellte Abstandsschwel-le erreicht ist. All die angenehmen Assistenzsysteme kann der Fahrer über entsprechende Knöpfe am neuen Multifunktionslenkrad be-dienen. Die Logik der Bedienele-mente ist leicht zu erfassen und praktisch selbsterklärend.
Für die Fahrt auf der Autobahn ist der Fahrer also bestens gerüs-tet. Doch wie sieht es in engen In-nenstädten aus? Schließlich bleibt ein mindestens 3,5 und bis zu 7,2 Tonnen schwerer Transporter mit entsprechenden Ausmaßen. Einen elektronischen Flanken-schutz sucht man beim Daily vergebens. Zumindest teilweise kompensiert das aber die City Bra-ke Pro. Dieser Notbremsassistent wirkt im Geschwindigkeitsraum bis fünf Kilometer pro Stunde, also beim Parken und Rangieren. Bei mehr Tempo schlägt die Stunde des Notbremssystems AEBS. Ive-
co verkündet vollmundig, die Not-bremse verhindere alle Kollisio-nen bis 50 km/h. Darüber mildert es die Unfallfolgen zumindest ab.
Dazu soll der sogenannte Queue Assist Fahrer im Stop-and-Go-Verkehr entlasten. Im Verbund mit dem Achtgang-Automatikge-triebe Hi-Matic fährt der große Italiener fast von selbst wieder an. Das System überwacht das vo-rausfahrende Fahrzeug und passt die Geschwindigkeit an. Kommt die Autoschlange zum Stehen, bremst der Assistent den Daily bis zum Stillstand ab. Geht es weiter, genügt ein kurzer Tapp aufs Gas-pedal und er hängt sich erneut selbständig an den Vordermann.
Neue LED-Scheinwerfer
Ein weiteres Highlight auf der Hardware-Seite sind die neuen Scheinwerfer des Daily. Die neu-en LED-Scheinwerfer (950 Euro Aufpreis), verbessern die Sicht um 15 Prozent. Gut zu wissen: Sie sollen ein komplettes Daily-Leben halten. Das hilft im Kapitel Total Cost of Ownership. Kosten sparen soll auch die Stoßstange. Statt ei-nes großen Formteils, hat Iveco den Stoßfänger in drei Segmente unterteilt. Wer sich also die rech-te Ecke verbeult, muss auch nur die austauschen. Laut Iveco ent-schärft dieses Detail in 90 Prozent der (Un-)Fälle die Situation.
Zu Beginn der Testfahrt zeigt sich der Daily gleich von seiner besten Seite. Eine Handbremse gibt es nämlich nicht. So passen tatsächlich problemlos drei Men-schen auf Fahrersitz und Doppel-sitzbank. Eine elektrische Park-bremse arbeitet vollautomatisch. Iveco rechnet dazu vor, dass ein Paketfahrer pro Monat fünf Stun-den mit der mechanischen Hand-bremse vergeudet. Gleichzeitig verhindert die elektrisch-automa-tische Bremse Armbeschwerden durch die wiederholte Bewegung.
Beim Antrieb setzt Iveco wei-ter auf zwei Grundaggregate. Der 2,3-Liter-Diesel, bei Automatikge-triebe inklusive Start-Stopp-Sys-tem, leistet 116, 136 oder 156 PS bei 320, 350 oder 380 Newtonme-ter Drehmoment. Im Test erweist er sich in der stärksten Ausfüh-rung trotz des eigentlich üppigen Drehmoments nicht gerade als der spritzigste Geselle. Vor allem aus dem Drehzahlkeller heraus fehlt es an Mumm. Dazu kommt, dass Iveco beim Schaltgetriebe nach-bessern sollte. Während es sich in der Gasse zwischen dem dritten und vierten Ganz butterweich
schaltet, fehlt jegliche Finesse beim Wechsel in die nächstrechte oder -linke Gasse. Dabei geht es nicht einmal darum, dass das Getriebe etwas mehr Kraft erfordert. Gefühlt bewegt sich der Schalthebel kaum aus der Mittellage. Doch irgendwo dort verbergen sich schließlich die Gänge – ziemlich hakelig.
Der 3,0-Liter-Motor leistet 160, 180 oder 210 PS bei 380, 430 oder 470 Newtonmeter Drehmoment. Dazu kommt eine 3,0-Liter-Erd-gasvariante mit 136 PS und 350 Newtonmeter. Auch der Stromer bleibt Teil des Programms. Allen Motoren gemein ist die Einstufung nach Euro 6D Temp. Insgesamt ist der neue Daily laut Iveco bis zu zehn Prozent sparsamer als sein Vorgänger. Dabei helfen auch Su-per Eco-Reifen mit besonders nied-rigem Rollwiderstand und Reifen-druck-Überwachungssystem. Die Wartungskosten sollen ebenfalls sinken. Bis zu zehn Prozent sind drin. Verantwortlich ist zum Bei-spiel eine neue größere Ölwanne. So muss der Daily nur noch alle 60.000 Kilometer zum Ölservice.
Neben der Technik unter dem Blech will Iveco beim Daily auch einen Fokus auf den Arbeitsplatz hinterm Lenkrad legen. Fahrer können dank des neuen Hi-Con-
nect Infotainmentsystems mit Sieben-Zoll-Display und Sprach-steuerung ihr Handy per Android Auto oder Apple Car Play direkt verbinden und haben so einfachen Zugriff auf die Musikbibliothek.
Im Display sind auch die Bilder der Rückfahrkamera und selbst-redend die Handynavigation zu sehen. Optional verbaut Iveco ein Tom Tom-Navi, das speziell auf Nutzfahrzeugbedürfnisse zuge-schnitten ist. Hinter dem Volant zeigt ein hochauflösendes Farb-display allerhand Informationen zu Fahrzeug und Co. an.
Update bei Vernetzung
Neben all den Neuerungen im Fahrzeug selbst, mit denen Iveco den Daily fit für 2020 macht und technologisch zu Crafter und Co. aufschließt, haben die Italiener auch in die Vernetzung investiert. Dazu hat sich Iveco unter anderem mit der Microsoft Plattform Azure zusammengetan. Damit und mit der eingebauten Konnektivitäts-einheit steht der Daily in direktem Kontakt mit Ivecos Control Room. Das Fahrzeug liefert in Echtzeit Daten an die Zentrale. Im Um-
Bis zu zehn Prozent sparenIveco hat sein Transporter-Urgestein Daily überarbeitet – mit moderner Konnektivität und neuen Assistenten im Test
kehrschluss kann der Transporter so kontinuierlich überwacht wer-den. Dazu gehört laut Iveco auch, proaktiv Diagnosen zu stellen und die Wartungsmaßnahmen vorbeu-gend zu planen. So will Iveco die Anzahl der Werkstattaufenthalte möglichst auf ein Minimum her-unterschrauben und Reparaturen und Wartung zeitlich zusammen-führen. Der Remote Assistance Service ermöglicht zudem, die Software im Daily aus der Ferne fit zu halten. Updates passieren also künftig „durch die Luft“ statt per Kabel in der Werkstatt.
Die Daten sind aber nicht nur für Iveco zugänglich, sondern auch für die Nutzer. Im MyDaily Portal beziehungsweise in der MyDaily App können die Halter ihren Daily überwachen. Über die Anwendung lassen sich Leistung, Kraftstoffverbrauch und Fahr-stil analysieren. Dazu sendet der Transporter selbständig regelmä-ßige Smart Reports und gibt darin Empfehlungen, wie der Fahrer sei-nen Fahrstil verbessern kann, um Sprit zu sparen.
Flottenmanager sollen von der Lösung Verizon Connect profitie-ren, die für den neuen Daily erhält-lich ist. Sie bietet eine verbesserte Navigation und stellt unter ande-
Alles für Ihren Fuhrpark - Miete, Fahrer, Tank- und
Mautlösungen, Sicher Parken.
worldofheroes.com
EIN STARKES TEAM FÜR NEUE MOBILITÄT.
Volkan Kececi, Disponent
• Trucker-Thron
• Rennbahn
• Barista
transport & logistic, München04. - 07.06.Halle A6, Stand 325/422
Erleben Sie uns auf der transport logistic und
verpassen Sie nicht die folgenden Highlights:
MEHR IM NETZ
MEHR BILDER UNTER eurotransport.de/daily
rem die Standorte der Flottenfahr-zeuge dar. Wer schon ein eigenes Flottenmanagementsystem be-treibt, kann seine neuen Dailys per Web API-Schnittstelle integrieren.
Unter dem Strich ist die Missi-on New Daily also gelungen. Zwar kann der Neue die Konkurrenz nicht überholen. Doch das liegt weniger an der Entwicklungsabtei-lung von Iveco als vielmehr daran, dass die aus dem Pkw bekannten Assistenzsysteme mittlerweile für alle neu vorgestellten Trans-porterbaureihen adaptiert sind. Eine Elektroversion hatte Iveco ohnehin schon im Programm, die Brennstoffzelle hat sich auch bei den Marktbegleitern noch nicht durchgesetzt. Der nächste Sprung für die Branche steht also noch aus.
Text: Markus Bauer | Foto: Iveco
trans aktuell 9 18. April 2019 16 F A H R Z E U G U
Mittlerweile 17 Jahre ist es her, dass Iveco den Euro-star durch den Stralis ab-gelöst hat. Anfangs noch
mit nahezu identischer Roh-karosserie, im Jahr 2007 dann mit einem überfälligen Schritt: Das große Active Space und später Hi-Way genannte Fernverkehrs-fahrerhaus legte in Länge und Höhe um jeweils zehn Zentimeter zu. Das Gardemaß von zwei Meter Stehhöhe, gemessen vom Stralis-typischen, podestartig angehobe-nen Motortunnel bis zur Decke, war somit endlich erreicht.
Dabei ist es vorerst geblieben, was sich auch am aktuellen Test-wagen ablesen lässt: einem Stralis 480 Hi-Way mit Traxon-Getriebe von ZF, leichter Einblattfeder an der Vorderachse, Vierbalg-luftfederung hinten, 3,80 Meter Radstand und Achsübersetzung 2,47 zu 1. Vorn prangt eine äu-ßere Sonnenblende, auf die Iveco generell nicht verzichtet. Auch das Hochdach ist mehr oder min-der Standard. Zwar gibt es vom 2,50 Meter breiten Haus auch eine Version mit Flachdach, aber die sieht man allenfalls mal mit
Kippsattel oder in der Tankstellen-versorgung.
Mit Einführung von Euro 6 löste Iveco den 10,3-Liter-Motor Cursor 10 durch den 11,1 Liter großen Cursor 11 ab, der mit bis zu 480 PS heute längst zum Standardmo-tor avanciert ist. Klar, es gibt auch weiterhin den Cursor 13, aber der legt mit 510 und 570 PS in den Fernverkehrsmodellen, neuerdings Stralis XP genannt, erst jenseits der 500-PS-Marke los. Vorerst noch in einer eigenen (Tankstellen-)Liga spielt die 460 PS starke Methan-variante Cursor 13 NP.
Sparsamer Ecoroll-Freilauf
Doch zurück zum 480 PS star-ken Cursor-11-Diesel im Testwa-gen, bei dem sich in Verbindung mit dem vorausschauenden Tem-pomaten Hi-Cruise das Grund-muster früherer Stralis-Tests wiederholt: ein eher sparsamer Einsatz des Ecoroll-Freilaufs so-wie eine auf Tempo ausgelegte Schaltstrategie mit wenig Scheu vor hohen Drehzahlen am Berg.
Wobei man dazu sagen muss, dass Iveco in den Testwagen meist auf die lastabhängige Antriebssteue-rung Eco-Switch verzichtet (die Schaltzentrale für die permanen-te, vom Fahrer nicht umschaltbare Aktivierung ist ein kleines Schloss im Beifahrerfußraum). Mit 40 Ton-nen und 85 km/h Sollgeschwin-digkeit sollte sich zwar ohnehin kein messbarer Effekt einstellen, ansonsten aber wird mit Eco-Switch grundsätzlich bei 85 km/h abgeregelt, der Kick-down deakti-viert, das Drehmoment bei Teil-beladung reduziert sowie in Stei-gungen später runter- und früher wieder hochgeschaltet.
Auch bei den Dauerbrem-sen bleibt Iveco der üblichen Testkonfiguration treu. Das in sechs Stufen regelbare Duo aus Dekompressions-Motorbremse und Retarder sorgt für entspann-tes Talfahren (die Auspuffklappe dient beim Stralis im Grunde nur zur schnelleren Aufwärmung bei kaltem Motor). Ein regelrechtes Angasen vor Steigungen hat Iveco der Getriebesteuerung zwar nicht eingeimpft, aber dafür wird nach jeder Rollphase wieder zügig auf
Tempo 85 beschleunigt und kein weiteres Tempo verschenkt. Zu-dem wirkt die Schaltstrategie im Auslauf einer Steigung souve-räner. Die Gänge werden nicht mehr so unnötig weit ausgedreht, wie das bei einem 460-PS-Stralis zu beobachten war.
Hier scheinen die 150 Newton-meter mehr, die der 480er aufbietet (2.300 statt 2.150 Newtonmeter), das entscheidende Plus. Besagter 460er absolvierte den Test mit identischer Konfiguration, demsel-ben beladenen Auflieger und den beim XP serienmäßigen 385/55er-Michelin-X-Line-Energy an der Vorderachse. Im Vergleich kommt der 480er auf ein um 0,7 km/h hö-heres Tempo bei 1,5 Prozent höhe-rem Dieselkonsum.
Beim Blick ins Detail relativiert sich der Mehrverbrauch aber et-was. Der Löwenanteil entfällt auf die leichten Streckenabschnitte, wenn es jedoch fast nur hoch- und runtergeht, herrscht beinahe Gleichstand. Überzeugen kann der Iveco auch beim Thema Handling; Lenkung und Federung wirken ab-solut ausgereift. Kurz: Mit üblicher Tempomateinstellung auf 85 km/h sowie plus/minus 5 km/h als Über- und Unterschwinger stellt sich das Gefühl eines angenehmen, zügigen Vorankommens ein.
Dabei liegen auch die Innen-geräusche zwar nicht auf nied-rigstem, aber gutem Niveau. Ins-besondere ist es einen Tick leiser als im 460er, wobei der größte Unterschied in der Abgastechnik zu finden ist. Denn im Gegensatz zu den übrigen, auf SCR-only ge-trimmten Leistungsstufen kommt beim stärksten Cursor 11 (und beim Cursor 13) eine geringe Ab-gasrückführungsrate von maxi-mal acht Prozent hinzu. Die Smart EGR getaufte Technik greift aber lediglich in Teillastbereichen ein
Mit 17 Jahren gehört er nStralis 480 XP tritt mit kraftvollem Cursor-11-Diesel in Verbindung mit vorausscha
und ist laut Iveco gerade so spar-sam ausgelegt, dass kein höherer Wartungsaufwand und vor allem keine aktive Filterregeneration erforderlich werden. Das Mehr-gewicht beziffert Iveco auf rund zehn Kilogramm. Verbunden mit der neuen Technik sind ein leich-ter Kraftzuwachs (2.300 statt 2.250 Nm beim SCR-only-480er) sowie
Über 3.000 Stellen für Berufskraftfahrer*
Foto
: ©sy
lv1r
ob1
- sto
ck.a
dobe
.com
Traumjob gesucht. Gefunden!Zehntausende Stellenangebote aus Logistik, Transport und Werkstatt
warten auf dich – jetzt zum ersten Mal gesammelt auf einer Seite.
Finde den Job, der zu dir passt – oder lass dich informieren, wenn
dein Traumjob auftaucht. Kostenlos. Jetzt auf eurotransport.de/jobs
* Stand: 25.02.2019
trans aktuell: Herr Eschey, die 9. Änderungsverordnung bringt weitere Erleichterungen beim Einsatz des verlängerten Sattelaufliegers. Beispielswei-se hat das Fahrzeug nun auch flächendeckend freie Fahrt in Baden-Württemberg. Wirkt sich das schon positiv auf den Absatz aus?
Eschey: Mit jeder weiteren Änderungsverordnung spüren wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Jetzt natürlich auch in
Baden-Württemberg. Beispiels-weise warten die Spedition Hans Ihro mit Hauptsitz in Neuenstein sowie deren Kunden schon unge-duldig auf die 9. Änderungsver-ordnung. Allein für Ihro stehen aktuell insgesamt 20 verlängerte Kögel Euro-Trailer Mega Rail be-reit zur Abholung. Die Spediteu-re, deren Kunden und wir können aufgrund der Verzögerung der Änderungsverordnung nur sehr schwer planen. Damit bleiben leider auch die Umsetzung der umweltpolitischen Ziele und auch die Verbesserung der internatio-nalen Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland weiter auf den Be-hördenschreibtischen liegen.
Wagen Sie eine Prognose, wie sich die weitere Nachfrage nach diesem Fahrzeug entwickeln wird?
„VerlängeKögel-Geschäftsführer Thomas Esch
ZUR PERSON
● Thomas Eschey hat eine Ausbildung als Maschi-nenbaumechaniker und -techniker absolviert. Seit 1995 war er Konstrukteur, später technischer Leiter bei Humbaur.
● Heute leitet Eschey als Geschäftsführer die Bereiche Produktion, Technik, Industriali-sierung und Qualitäts-management bei Kögel Trailer in Burtenbach.
7,5Tonnen
LEERGEWICHT BRINGT DAS TESTFAHRZEUG AUF DIE WAAGE – EIN IM VERGLEICH SEHR MODERATER WERT
trans aktuell 9 18. April 2019 17N D T E C H N I K
och nicht zum alten Eisenauendem Tempomaten zum Test an – Iveco ist mit der Zugmaschine auf Tempo aus
safholland.commade by
SAF INTRA CD TRAK- integrierter Zusatzantrieb auf Knopfdruck
- besonders lange Laufzeiten
- unterstützt auf schwierigem Gelände
Über kurz oder lang wird der verlängerte Auflieger das Standard-fahrzeug nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sein, denn mit keinem anderen Konzept las-sen sich so schnell und einfach die Klimaschutzziele von morgen um-setzen. Bis es so weit ist, wird die Nachfrage stetig steigen.
Die Befürworter dieses Kon-zepts gehen davon aus, dass es 60 Prozent der Standardtrai-ler ersetzen könnte. Trotzdem fehlt für deutschlandweite Ver-kehre noch die Zustimmung aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist Ihre Erwartungshaltung für diese Bundesländer?
Der um 1,3 Meter verlängerte Auflieger, also der Lang-Lkw Typ 1, darf ja heute in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
bereits das Lang-L kw-Po sit iv n etz nutzen. Nur Berlin sträubt sich noch komplett. Wir rech-nen jedoch damit, dass sich hier dann hoffentlich mit der 10. Änderungsver-ordnung etwas tut. Wir können also aktuell von einer Einsatzfähigkeit in 15 Bundesländern sprechen.
Ebenfalls neu ist der Verzicht auf
die Bahntauglichkeit. Ist das in Ihrem Sinne? Immerhin hat-ten Sie mit Ihrem Euro-Trailer und der Megavariante ent-sprechende Probeverladungen durchgeführt.
Kögel richtet sich grundsätz-lich nach den Anforderungen in der Änderungsverordnung. Auch künftig gehen wir zudem auf die entsprechenden Anforderungen unserer Kunden ein und bieten die verfügbaren Kögel-Euro-Trailer-Varianten optional bahnverladbar an. Allgemein sehen wir den Ent-fall der Bahnverladbarkeit jedoch nicht nur positiv. Natürlich wird das Fahrzeug dadurch leichter, aber er erschwert die Zulassung für den europaweiten Einsatz aus unserer Sicht enorm. Und wie der Name des verlängerten Aufliegers Euro-Trailer doch schon andeu-tet, sollte Europa das Ziel sein und nicht nur der innerdeutsche Verkehr.
Inwiefern bringen acht Zenti-meter zusätzliche Länge der Branche wirklichen Mehrwert?
Größeres Ladevolumen ist ein grundsätzlicher Mehrwert, genau-so wie eine höhere Nutzlast. Bei-de Faktoren bestimmen zu einem wesentlichen Teil den Zweck von Nutzfahrzeugen – sowohl in wirt-schaftlicher als auch umweltscho-nender Hinsicht. Wobei sich der Mehrwert der acht Zentimeter nur auf den Umschlag von zwei Wechselbrücken C745 bezieht. Für den reinen Palettentransport
rter Auflieger wird der Standardtrailer“hey über die weiteren Potenziale des „kurzen Lang-Lkw“ – Spedition Ihro bestellt 20 Euro-Trailer in Bahnausführung
Einsparungen beim Adblue: Auf den Diesel bezogen liegt der Be-darf mit 7,2 Prozent einen guten Prozentpunkt niedriger als zuvor.
Standard sind in allen XP zu-dem abschaltbare Luftpresser, be-darfsgesteuerte Lichtmaschinen mit Batteriesensor, Lenkungspum-pen mit variablem Durchsatz und eine automatische Motorabschal-
tung nach einiger Zeit im Leerlauf. Zu den jüngsten Überarbeitun-gen im Hi-Way – die Nachfolger dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen – zählt ein Display mit mehr Kontrast vor schwarzem Hintergrund. Die Vorhänge enden nicht mehr an den A-Säulen, son-dern schließen rundum, die hakeli-gen seitlichen Rollos wurden durch
leichter handhabbare Teile ersetzt. Nicht so komfortabel gelöst ist wei-terhin das Auslösen der Lenkrad-verstellung mit einem Knopf am Boden, und die auf dem Podest hoch montierten Sitze geben nur wenig Verstellweg nach unten.
Wenig Handlungsbedarf gibt es beim Gewicht. Ziemlich genau 7,5 Tonnen bringt die Testzug-
maschine auf die Waage, mit Fah-rer, vollen Tanks (400 Liter Diesel, 80 Liter Adblue) und Retarder in dieser Fahrzeugklasse ein güns-tiger Wert. Ein Gutteil geht aufs Konto des kleinen Cursor 11 und der Einblattfedern vorn. Um knapp einen Zentner hat laut Iveco aber auch die Hinterachsfederung der XP-Serie abgespeckt. Zugleich er-hielt die seit Mitte 2016 gebaute Generation die neue Hinterachse mit Standardübersetzung 2,47 zu 1 (zuvor 2,64), die bei 85 km/h nur noch 1.130 Umdrehungen diktiert. Im Gegenzug das Tempo schlei-fen zu lassen, kommt Iveco aber wie geschildert nicht in den Sinn: 83,5 km/h stehen am Ende für den Testwagen zu Buche, in der 480-PS-Klasse ein Spitzenwert.
Text: Ralf Becker | Fotos: Karl-Heinz Augustin
TECHNISCHE DATEN
Motor Wassergekühlter Reihensechszylinder (Cursor 11 F3G) mit variablem Turbolader (elektronisch gesteuerte Geometrie) und Ladeluftkühlung, eine oben liegende Nockenwelle, vier Ventile pro Zylinder, einteiliger Zylinderkopf; Euro 6 mit Smart EGR, SCR und DPF
Hubraum 11.100 cm3
Nennleistung 353 kW (480 PS) bei 1.465 bis 1.900/min
Drehmoment 2.300 Nm bei 970 bis 1.465/min
Getriebe ZF Traxon 12 TX 2210 TD, Zweigang-Grund-getriebe mit Range- und Dreifach-Splitgruppe, 12 Gänge, Direktgangausführung, automatische Schaltung; Intarder
Verbrauch Diesel 34,8 l/100 km
Verbrauch Adblue 2,52 l/100 km (7,24 % vom Diesel)
Leergewicht 7.460 kg
Nutzlast 10.540 kg
Kaufpreis 106.500 Euro
Feste Kosten pro km 31,83 Cent
Variable Kosten pro km 51,92 Cent
Kleine Abkehr von der Devise SCR-only: In der 480-PS-Ver-sion arbeitet der Cursor 11 nun mit einer geringen Abgas-rückführungsrate von bis zu acht Prozent.
haben diese acht Zentimeter so-mit keine Relevanz.
Das heißt, Sie produzieren fort-an das Containerchassis Kögel Long Plex ausziehbar auf eine Länge von 15 Metern? Sind hier die 14,92 Meter also hinfällig?
Wie auch schon in der Ver-gangenheit wird Kögel die Än-derungsverordnung eins zu eins umsetzen. Falls die Änderung so kommt, wie der Entwurf ver-spricht, muss für die technische Umsetzung das Fahrzeug kom-plett neu aufgesetzt werden. Die-ser Aufwand ist nicht von heute auf morgen zu meistern.
Text: Matthias Rathmann | Fotos: Kögel
Leitfaden gegen CyberkriminalitätSpediteursverband Fiata gibt Tipps – immer einen Plan B in der Schublade haben
www.t el e-traf f ic .d e 6035 Euro 2,90Nr. 1 · 18. April 2019
Spediteure ausgesetzt sind. „Die meisten dieser Unternehmen sind keine direkten Ziele dieser Angrif-fe, aber zufällige Opfer“, heißt es in dem Report. So oder so müssen die betroffenen Firmen viel Zeit und Geld aufwenden, um den Angriff zu stoppen, Kunden zu informieren und gegebenenfalls die Supply-Chain zu ordnen.
Teure Verpflichtungen
Da sich das laufende Geschäft im Wesentlichen auf IT-Systeme stützt, können Betriebsstörungen oder Unterbrechungen sowohl zu monetären Verlusten als auch zu
Das Beratungsgremium für Rechtsangelegenheiten (ABLM) der Internationa-len Föderation der Spedi-
teursorganisationen (Fiata) hat einen Leitfaden zum Verhindern von Cyberkriminalität herausge-geben. Er orientiert sich an Fällen aus der Praxis und soll den Logis-tikern Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, um nicht selbst Ziel eines Angriffs zu werden.
Gerade in den letzten fünf Jah-ren seien „zahlreiche Vorfälle im Zusammenhang mit Cyberangrif-fen gemeldet“ worden, heißt es seitens der Fiata. Vom Phishing über Malware und Mandatsbe-trug bis zu Ransomware reicht die Palette an Cyberattacken, denen
Digitalisierung: Beim
Logcoop-Forum gab
es für die Mitglieder
Beispiele aus der Praxis.
Seite 4
Telematik: Der Fuhrpark
von Badenhop ist mit
gleich drei Systemen aus-
gerüstet – unter anderem
mit einem für die Trailer.
Seite 6
D I E Z E I T U N G F Ü R I T- L Ö S U N G E N R U N D U M S N U T Z F A H R Z E U G
Te leTraf f ic
5G- Au sb au : Wie Deutschland in Sachen Netzausbau im internationalen Vergleich dasteht. Seite 3
DIE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ● Beurteilen der Gefährdung anhand von Risiken: Ermitteln von Berei-chen, in denen potenzielle Attacken durch Cyberangriffe und betrieb-liche Schwachstellen auftreten können, sowohl in IT-Systemen als auch in der sogenannten Operatio-nal Technology (OT), die eigentlich auf physische Geräte abzielt.
● Übernehmen von technischen Stan-dards wie den Normen der ISO/IEC-27000-Serie oder nationalen Stan-dards zur Informationssicherheit für die Logistikbranche.
● Implementierung von Verteidigungs-ebenen wie physischer Sicherheit von Hardware, Verwaltungsver-fahren, Firewalls und Architektur, Computerrichtlinien, Kontenverwal-tung, Sicherheitsaktualisierungen und Antivirenlösungen.
● Den Zugriff auf Informationen inner-halb eines Unternehmens auf eine Basis an Personen beschränken, die jene unbedingt kennen müssen.
● Richtlinie zum Einsatz von Wechsel-datenträgern wie USB-Sticks oder externen Festplatten erstellen.
● Erarbeiten von Business-Continuity-Plänen für den Fall, dass auf einen Angriff reagiert werden muss.
● Festlegen von Maßnahmen, um Cyberattacken schnellstmöglich zu entdecken.
● Die Mitarbeiter mittels regelmäßi-ger Schulungen informiert halten, sodass jedem alle regulatorischen Maßnahmen bekannt sind.
● Geeignete Versicherungen abschlie-ßen, die zumindest einen gewissen Schutz vor den Folgen bieten.
nicht eingehaltenen rechtlichen Verpflichtungen führen – mit den entsprechenden Folgekosten und einem schwer zu beziffernden Imageschaden.
Eine solche Erfahrung muss-te im Juni 2017 beispielsweise die dänische Containerreederei Maersk machen. Sie wurde Opfer eines nicht gezielten globalen Malware-Angriffs, der als „Not Petya“ bekannt wurde. Die Aus-wirkungen auf die Geschäftsak-tivitäten zogen weite Kreise und reichten bis zu den Onlinefracht-buchungen. Aber auch die all-gemeine E-Mail-Korrespondenz und die Fähigkeit der Kommuni-kation mit Kunden waren betrof-fen. Ganz zu schweigen von der
Herausforderung, die weltweit 76 Hafenterminals am Laufen zu hal-ten. Während sich Maersk schnell von dem Angriff erholen konnte, wurde abschließend berichtet, der Vorfall habe das Unterneh-men mehrere Hundert Millio nen US-Dollar gekostet. Teuer dürfte es zudem für die KEP-Dienst-leister DHL und TNT sowie den Logistiker Raben geworden sein, denn auch sie hatte der Trojaner erwischt. Basierend auf den ge-meldeten Fällen aus der Praxis kommt die Fiata zu einer Reihe von Handlungsempfehlungen.
Text: Carsten Nallinger | Foto: edelweiss/Fotolia | Montage: Götz Mannchen
2 TeleTraffic 1 18. April 2019 M E I N U N G U N D H I N T E R G R U N D
Die Transportlogistik hat nicht unbedingt das Image, eine Hightech-Branche zu sein. Man denkt da eher an
verrostete Eisenbahnwaggons oder überladene Sattel züge mit abgefahrenen Reifen und über-müdetem Fahrer. Kein sehr po-sitives Bild also. Es gibt diese Fälle zweifellos, aber stimmt das wirklich als Bild einer gan-zen Branche?
Wenn heute von Automatisie-rung und Digitalisierung geredet wird, denkt man unwillkürlich an Heerscharen von Robotern, die in
klinisch reinen Fabriken unter-schiedlichste Produkte montie-ren und sich untereinander über ihren Systemzustand austau-schen, damit der Fertigungstakt möglichst kontinuierlich laufen kann. Das ist ein typischer Fall von Mechanisierung vormals menschlicher Arbeit und von Au-tomatisierung, da der komplette Prozessablauf von elektronischen Systemen gesteuert wird. In der modernen Intralogistik sind diese Technologien bereits angekom-men, dort wieseln fahrerlose Transportsysteme mit automati-sierten Hochregallagern um die Wette. Das ist ja aber auch hin-sichtlich der Herausforderungen durch äußere Einflüsse relativ harmlos, denn man befindet sich in einer gut strukturierten und geschützten Umgebung. Auf der
Straße sieht das anders aus. Die Umgebung ist dynamisch, da sich durch Baustellen, Staus und Wet-terbedingungen eine Fahrt heute ganz anders darstellen kann als noch gestern. Und dann sind da noch diese Pkw-Fahrer, Radfahrer und Fußgänger, die im Sinne der Regelungstechnik als Störgrößen zu bezeichnen sind. Kein Wun-der, dass die Transportlogistiker den Intralogistikern in der Auto-matisierung des Transports hin-terherhinken. Doch das wird sich ändern. Erste Ansätze, beispiels-weise mobile Beladeroboter, gibt
es bereits. Und getrieben durch die Aktivitäten im Pkw-Bereich wird das autonome Fahren dann auch im Nutzfahrzeug Einzug halten. Die Versuche zum Pla-tooning waren ja erste Anzeichen dafür.
Digitalisierung im Wandel
So viel zur Automatisierung. Wie sieht es aber in der Digi-talisierung aus? Ursprünglich war damit nur die Umwandlung analoger Größen, etwa der Fahr-geschwindigkeit, in eine Abfolge von Nullen und Einsen gemeint, die dann ein Computer weiter-verarbeiten kann. Inzwischen interpretiert man diesen Begriff viel weiter und versteht darunter
auch die rechnergestützte Ab-bildung und Steuerung von Ge-schäftsprozessen, um Betriebs-abläufe effizienter abwickeln zu können. Und da muss sich die Transportlogistik nun wirklich nicht verstecken. Mit den ersten GPS-basierten Ortungssystemen der 1990er-Jahre ging es schon los. Erinnert sich noch jemand daran? Die Ortungsinformatio-nen kamen per SMS zum Dis-ponenten-PC und wurden auf ersten digitalen Straßenkarten dargestellt. Die Stecknadeln mit den vermuteten Fahrzeugpositio-
nen auf der Papierkarte an der Wand waren obsolet, und der Disponent konnte seine Fahrzeu-ge plötzlich viel effizienter ein-setzen. Bereits damals hatte die Branche eine Vorreiterrolle beim mobilen Asset- Management ge-spielt. Hinzu kamen die Trans-portmanagement- und Touren-planungssysteme, die digitalen Tachographen, die Fahrstilana-lysen, die Frachtenbörsen und so weiter. Da kann man die Trans-portlogistik durchaus als Parade-beispiel für den digitalen Wandel bezeichnen.
Und es geht in der Trans-portlogistik weiter: in Form der künstlichen Intelligenz (KI). Erste Systeme bieten Adress-überprüfungen von Sendungen mittels KI-Algorithmen, die ihre Wissensbasis durch Selbstlernen
laufend verbessern. Auch die Sys-temansätze zur Predictive Main-tenance von Fahrzeugen basieren auf KI-Methoden und werden bereits in ersten Pilotversuchen eingesetzt. Die Branche ist also schon erstaunlich weit.
Text: Heinz-Leo Dudek | Foto: THATREE/stock.adobe.com
Digitalisierung im BlickBestandsaufnahme in der Logistik – wie weit die Branche in Sachen Automatisierung ist
STEUERUNG DER BETRIEBLICHEN PROZESSE MITTELS IT SCHREITET VORAN
IMPRESSUMTeleTraffic 1/2019
Die Zeitung für IT-Lösungen rund ums Nutzfahrzeug
Chefredakteur: Matthias Rathmann (rat)
Geschäftsführender Redakteur: Carsten Nallinger (cn)
Weitere Mitarbeiter: Ralf Johanning (jh)
Grafik/Produktion: Frank Haug (Ltg.), Monika Haug
Redaktionsassistenz/Sekretariat: Uta Sickel
Verlag: EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH. Das Gemeinschaftsunternehmen von Dekra, Motor Presse Stuttgart und VF Verlagsgesellschaft
Geschäftsführer: Oliver Trost
Anschrift von Verlag und Redaktion: Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Tel.: 07 11/7 84 98-31, Fax: 07 11/7 84 98-59
E-Mail: [email protected]
Internet: www.eurotransport.de, www.tele-traffic.de
Anzeigenleitung: Werner Faas, Tel.: 07 11/7 84 98-96, Fax: 07 11/7 84 98-29
Anzeigenverwaltung: Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Postfach, 70162 Stuttgart; Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart Nicole Polta, Tel.: 07 11/1 82-13 87, Fax: 07 11/1 82-15 48
Herstellung: Thomas Eisele
Vertrieb: Bernd Steinfeldt (Ltg.), Gerlinde Braun, Sylvia Fischer, Tel.: 07 11/7 84 98-14/-18, Fax: 07 11/ 7 84 98-46, E-Mail: [email protected]
Druck: Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel
TeleTraffic erscheint dreimal im Jahr. Höhere Gewalt entbindet den Verlag von der Lieferungspflicht, Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. Alle Rechte vorbehalten, © by ETM Verlags- und Veranstaltungs-GmbH. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos oder Zeichnungen übernimmt der Verlag keine Haftung.
Anzeigenpreisliste: Nr. 10, 2019, Gerichtsstand Stuttgart
KOMMENTAR
von Carsten Nallinger
„Die Transport-
logistik muss sich nicht ver-stecken“
PROF. DR. HEINZ-LEO DUDEK,
DUALE HOCHSCHULE RAVENSBURG
Cyberkriminelle stoppen
Die voranschreitende Digitalisierung hat leider auch ihre Schattenseiten. Im Zeitalter von Big Data, Algorithmen und autono-men Systemen agieren Kriminelle aus der Anony-mität des Internets heraus. Die Zahl der Cyberdelikte nimmt beständig zu. Längst sind dabei auch kleine und mittlere Unternehmen ins Fadenkreuz der organisier-ten Banden geraten.Nicht ohne Grund hat sich das Bundeskriminalamt (BKA) neu aufgestellt. Bis-lang waren Cyber experten des BKA dem Bereich „Schwere und Organisierte Kriminalität“ zugeordnet. Nun bekommen sie eine eigene Abteilung. Dort wiederum entwickeln sie Werkzeuge und Methoden, „um auf der Höhe der Zeit zu bleiben“, wie es BKA-Chef Holger Münch Ende 2018 formuliert hatte. Schließlich gilt es, die sogenannten kritischen Infrastrukturen, zu denen auch Teile der Lo-gistik gehören, zu schützen.Das entbindet die Unterneh-men natürlich nicht davon, sich selbst gegen mögliche Cyberattacken zu schützen. Was es dabei zu beachten gibt, das hat der europä-ische Spediteursverband Fiata zusammengetragen. Es ist nun an den Verantwortli-chen, ihre Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen. Mehr zur Cyberkriminalität: Seite 1
3TeleTraffic 1 V E R N E T Z U N G 18. April 2019
Die Bundesnetzagentur ver-steigert aktuell 41 Fre-quenzblöcke für den neuen Mobilfunkstandard 5G in
Deutschland. Zwar folgt nach Ab-schluss der Auktion, an der sich neben den drei Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica auch der Provider 1 & 1 Drillisch beteiligt, ein straffes Ausbauprogramm. Im Vergleich zu den USA oder zu Südkorea ist Deutschland damit aber dennoch ein Spätzünder.
Ganz aktuell hat beispielswei-se der größte US-amerikanische Mobilfunkbetreiber Verizon Wire-less bekannt gegeben, in Teilen der beiden Städte Chicago und Minneapolis das 5G-Netz scharf geschaltet zu haben. Mehr als 30 weitere Städte sollen noch in die-sem Jahr folgen.
Hardwareseitig ist bereits das Motorola Moto Z3 im Angebot. Das Samsung Galaxy S10, das ebenfalls 5G unterstützt, soll zu-dem in Kürze erhältlich sein. So oder so wirbt Verizon Wireless abseits der Consumer-Geräte be-reits mit den niedrigen Latenz-zeiten für Machine-to-Machine-Anwendungen (M2M), wobei der Mobilfunkanbieter natürlich ebenfalls noch weit vom Ende des Netzausbaus entfernt ist. „Hinter einem starken drahtlosen Netz-werk steckt viel Glasfaserkabel. Deshalb installieren wir 37,2 Mil-lionen Kilometer, um unser beste-hendes Netzwerk zu stärken und eine solide Basis für 5G zu schaf-fen“, heißt es dazu seitens Verizon.
Quasi im Gleichschritt verläuft die Entwicklung von 5G in Süd-korea. Dort gab es bereits vorab das neue, 5G-taugliche Flaggschiff des Marktführers Samsung zu kaufen, wobei der eigentliche Verkaufs-start für die breite Masse dennoch erst am Freitag, 5. April, war.
Vorab hatten allerdings bereits im Dezember 2018 die drei Tele-kommunikationsunternehmen SK Telecom, KT sowie LG Uplus ein 5G-Netz für den kommerzi-ellen Dienst für WLAN-Router
von Firmenkunden in Betrieb genommen.
Damit nicht genug: Eben diese drei hatten am Mittwochabend, 3. April, um 23 Uhr das 5G-Netz in Betrieb genommen – und das flä-chendeckend. Allerdings zunächst nur für ein paar Prominente. Doch der Massenstart folgte nach dieser Bewährungsprobe postwendend. Seit Freitag, 5. April, kann wiede-rum jeder Südkoreaner in den Ge-nuss des neuen Datenfunks kom-men, der bis zu 20-mal schneller als LTE (4G) ist. Immer voraus-gesetzt, man konnte eines der
Samsung Galaxy S10 ergattern, die es seitdem im Handel gibt.
Wann es in Deutschland eine nahezu flächendeckende 5G-Ver-sorgung geben wird, steht hinge-gen noch in den Sternen. Wenn alles nach dem Plan der Bundes-netzagentur geht, wäre das im Jahr 2022 zumindest annähernd der Fall.
Nicht wirklich besser sieht es übrigens im benachbarten Öster-reich aus. Dort ging Anfang März 2019 – still und heimlich – die 5G-Auktion über die Bühne. Zwar ging es bei dieser ersten Runde ledig-lich um die Versorgung der Lan-deshauptstädte, mit 188 Millio-nen Euro kommen die Bieter aber dennoch verhältnismäßig günstig weg, selbst wenn der österreichi-sche Telekomregulator RTR nach eigenen Angaben sogar mit weit weniger – nämlich rund 50 Millio-nen Euro – gerechnet hatte.
Dabei ersteigerte Telekom Aus-tria ein Spektrum für 64 Millionen Euro, T-Mobile Austria gab 57 Mil-lionen Euro aus, und Drei (Hutchi-son) investierte 52 Millionen Euro. Die drei großen Netzbetreiber be-kommen dafür jeweils mindestens 100 MHz im Bereich zwischen 3,4 und 3,8 GHz. Den Rest teilen vier kleinere Regio nalanbieter unter sich auf: Mass Response (1,8 Mil-lionen Euro), Liwest (5,3 Millionen Euro), der Energieversorger Salz-burg (4,4 Millionen Euro) und die Holding Graz (3 Millionen Euro). Laut RTR sollen sie für einen Inno-vationswettbewerb sorgen.
Bis in der Alpenrepublik 5G flächendeckend zur Verfügung
steht, wird es aber ebenfalls noch eine ganze Weile dauern. Das liegt auch daran, dass die Frequenzen für eine landesweite Abdeckung Österreichs erst 2020 vergeben werden. Dementsprechend gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Ausbau für den neuen Mobilfunkstandard nicht vor 2025 abgeschlossen sein wird.
Mit Auflagen verbunden
Wie in Deutschland auch ist die Ersteigerung von 5G-Lizenzen mit entsprechenden Auflagen verbun-den. Die Telekommunikations-unternehmen müssen beispiels-weise gewährleisten, dass Ende 2020 rund 1.000 Sendeanlagen stehen. Bis zum Jahr 2022 sollen es dann mehr als 3.000 sein, wo-bei die Anbieter dafür wohl meist die bestehenden Sendemasten umrüsten.
Ähnlich wie in Deutschland solle dabei „nicht auf Erlösmaxi-mierung für das Staatsbudget“ ab-gezielt werden, erklärt die öster-reichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Vielmehr solle das Geld in einen schnellen Netzausbau fließen.
Inwieweit sich dieses Ziel in Deutschland tatsächlich noch realisieren lässt, bleibt abzuwar-ten, denn mittlerweile geht die Auktion in die 140. Runde (Stand bei Redaktionsschluss). Sah es kurz zuvor danach aus, als sei die Versteigerung bereits auf der Zielgeraden, hat der vierte im
DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH HINKEN WEIT HINTERHER
Zukunft hat bereits begonnenBundesnetzagentur versteigert 5G-Lizenzen – in den USA und in Südkorea gibt es erste Erfolgsmeldungen
Flächendeckend ausgerollt: In Südkorea hat SK Telekom den ultraschnellen Mobilfunk scharf geschaltet.
Bunde, Neueinsteiger 1 & 1 Dril-lisch, mit einem neuen Gebot die Karten neu gemischt. Eigentlich sollte es nur noch um Details in den letzten zu vergebenden Fre-quenzblöcken gehen – da bot die United-Internet-Tochter plötzlich auf bereits als abgehakt geltende. Damit liegen die vorliegenden Angebote aktuell bei zusammen 3,679 Milliarden Euro – und ein Ende der Auktion ist nicht abzu-sehen. Folglich befindet sich die 5G-Auktion noch im Rahmen des anvisierten Zielkorridors von drei bis fünf Milliarden Euro, aber der Poker um die Lizenzen wird nun auf jeden Fall teurer als von den Unternehmen erhofft.
Seitens der Bundesregierung wurde die neueste Dynamik der Auktion prinzipiell zwar begrüßt, allerdings wies Regierungsspre-cher Steffen Seibert im gleichen Atemzug darauf hin, dass es nicht das Ziel sei, „möglichst viel Geld einzunehmen“. Schließlich müs-sen die künftigen 5G-Netzbetrei-ber noch eine Reihe an Auflagen erfüllen (siehe Kasten), die eben-falls ins Geld gehen.
Text: Carsten Nallinger | Fotos: SK Telecom, Verizon Wireless
9370
Sicherheit – ab sofort serienmäßig Mit Daten in Echtzeit und validen Nachweisen. Die Telematik TrailerConnect® ist jetzt serienmäßig im Sattelkoffer S.KO COOL SMART an Bord. Mehr Infos: smart.cargobull.com
Unser Anspruch ist es, die Sicherheit und Nachverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Das erreichen wir durch die
Echtzeitübertragung der Temperatur- und Positionsdaten sowie durch die strikte Einhaltung der Gesetze und Leitlinien der EU-GDP-Richtlinie (Good Distribution Practice) und der
Qualitätszertifizierung nach IFS Logistics Version 2.01.“
Katja Seifert, Fuhrpark und Versicherung Spedition Kaiser & Schmoll
DIE AUFLAGEN
● Mindestens 98 Prozent der Haushalte sollen bis 2022 mobiles Internet mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) bekommen
● An den Autobahnen soll es einen 5G-Empfang mit Minimum 100 Mbit/s geben. Die Verzögerung beim Zugriff (Latenz) darf dabei höchstens zehn Millisekun-den betragen
● Gleiches gilt für alle Bahngleise mit mehr als 2.000 Fahrgästen am Tag
● Des Weiteren soll es bis dahin mindestens 1.000 Basis-stationen für 5G geben
● Für bislang schlecht versorgte Gebiete sollen nochmals 500 Basisstationen entstehen, wobei allerdings eine Versorgung mit 4G ausreicht
Punktuell gestartet: In den US-Städten Chicago und
Minneapolis hat Verizon das 5G-Netz in Betrieb genommen.
4 TeleTraffic 1 18. April 2019 D I G I TA L I S I E R U N G
Das historische Ambiente der Gebläsehalle in Duisburg war Kulisse für den Innova-tionstag der mittelständisch
geprägten Speditionskooperation Logcoop zur „Digitalisierung zum Anfassen“. Rund 250 Teilnehmer waren in den Landschaftspark Nord gekommen, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche zu informieren.
Und die haben es in sich, wie Logcoop-Geschäftsführer Marc Possekel versicherte: „Logistik 4.0 zum Anfassen mit vornehmlich praxisrelevanten Themen.“ Ein Motto, bei dem Tobias Rademann, Geschäftsführer des IT-Bera-tungsunternehmens Rit, aus dem Nähkästchen plaudern konnte. Schließlich begleiten er und sei-ne Kollegen beständig kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) bei ihrem Transformationsprozess. „Digitalisierung im Mittelstand – oder wie der Patient wieder auf die Beine kommt“ war Rade-manns Vortrag überschrieben. Aus seiner Erfahrung heraus wird die Digitalisierung oft zu tech-nisch angegangen. Das liegt zwar nahe, ist aber erst der dritte und letzte Schritt. Vielmehr müssen zunächst die Strategie und Orga-nisation geklärt sein.
„Viele sind der Meinung, dass das Thema Digitalisierung eher in die IT-Abteilung als in die Vor-standsetage gehört“, berichtete Rademann. Das sei ein Fehler. Die Logistik 4.0 ist laut seiner Überzeugung Chefsache, „denn die Digitalisierung muss in die eigene Geschäftsstrategie einge-bettet werden“, auch wenn der Transformationsprozess von der Technologie getrieben sei. „Was wiederum zu einer exponentiell wachsenden Geschwindigkeit führt“, konstatierte der IT-Berater.
Daher sieht er die KMUs ei-gentlich sogar im Vorteil gegen-über den Konzernen: Auf der einen Seite sind wenige Schnell-boote, auf der anderen träge Tanker. Warum gerade der Mit-telstand dennoch als Patient in Sachen Digitalisierung gilt? „Viele
Rennboote liegen sauber vertäut und mit Planen überzogen an Land“, sagte Rademann. Um sich der digitalen Revolution stellen zu können, müssten sich die Unter-nehmer aus ihrer sicheren Kom-fortzone herausbewegen. „Das ist eine Riesenchance für KMUs.“
Um dem Wandel gerecht zu werden, müssten aber auf jeden Fall die Mitarbeiter mitgenom-
men und motiviert werden. „Las-sen Sie Ihre Mitarbeiter ihre ver-bindlichen Ziele selbst festlegen. Sie werden positiv überrascht sein“, sagte Rademann, denn ge-rade bei KMUs fänden sich viele motivierte Mitarbeiter. „Wer in der Masse untertauchen will, der geht zu einem Konzern.“
Im Anschluss stellte Jan Ditt-berner, der beim Deutschen In-stitut für Normung (DIN) unter anderem als Geschäftsführer der DIN-Koordinierungsstelle Logis-tik tätig ist, die Frage: „Braucht Digitalisierung Standards?“ Hier gehe es um Normungen, die aus der Wirtschaft heraus entwickelt würden. Prominente Beispiele hatte er gleich zur Hand: das DIN- A4-Format, das als ISO-Norm mittlerweile in fast der ganzen Welt genutzt wird. Oder die ISO-Container oder eben auch die DIN EN ISO/IEC 27000 für IT-Sicher-heitsmanagementsysteme.
Sicherheit durch Normen
„Von Normen profitieren wir alle. Sie sorgen für mehr Effizienz und Sicherheit“, erklärte Dittber-ner. So könnten auch Logistiker mit neuen Produkten auf einer Norm aufsetzen – mit der Gewiss-heit, dass sie auch im Zusammen-spiel mit anderen Lösungen funk-tionieren. Gleiches gelte natürlich auch für die Sprache von Geräten, die in der Cloud, Stichwort Inter-net of Things (IoT), fehlerfrei mit-einander kommunizieren sollten. Zudem wies Dittberner auf die Koordinierungsstelle Logistik mit ihrer offenen Web-Plattform
hin, auf der jeder seine Ideen für Normierungen in der Branche ein-bringen kann.
Direkt in die Praxis ging es dann mit Andreas Schmid, Sales Manager Forwarding bei Seifert Logistics, und seinem Kollegen Christoph Krieg, Leiter Digitalisie-rung und Verbesserungsprozesse. 2017 hatte bei dem Mittelständ-ler alles mit einem zweitägigen Workshop angefangen. Daraus entwickelte sich die Seifert Digi-tal Roadmap, in die auch die CEO-Ebene eingebunden ist. „Ist zwar nicht immer einfach, einen ROI zu benennen und so eine Freigabe für ein Projekt zu erhalten“, dennoch sei man als Unternehmen agil un-terwegs, berichtete Krieg.
So ist Seifert gerade dabei, den 3-D-Druck für Ersatzteile zu testen, schließlich ist der Logis-tiker sehr stark im Automotive-bereich unterwegs. „Wir sehen hier die Gefahr, dass uns Geschäft wegbrechen könnte, und wollen daher frühzeitig gegensteuern“, erläuterte Krieg. Aber auch sonst sei in Sachen Digitalisierung der Geschäftsprozesse einiges gebo-ten. Mit der sogenannten SLG-Training-App geht es um eine durchgängige Qualifikation der Mitarbeiter an allen Standorten europaweit.
Im Lager kommen Kommissio-nierroboter von Magazino zum Einsatz, die die dortigen Mitarbei-ter unterstützen. Die wiederum haben den Kommissionierhand-schuh von Proglove buchstäblich zur Hand, damit das Scannen leichterfällt. Für die Inventur kom-men Drohnen zum Einsatz – „eine Technik, die zugegebenermaßen aber noch in den Kinderschuhen steckt“, berichtete Krieg. Ganz ak-tuell werde darüber hinaus eine tägliche Leergutinventur mithil-fe von fest installierten Kameras getestet.
Einen nach eigenem Bekun-den Glücksgriff hat Seifert Lo-gistics mit der Umstellung des Transport-Management-Systems (TMS) auf die Brabender Logistic Suite getan. „Demnächst stellen wir auch unsere Telematik auf das System von Brabender um“, sagte Schmid. „Das ist insbesondere für mich als Vertriebschef ein wich-tiges Thema.“ Denn nur wer seine Daten im Griff hat, kann auch bei der Digitalisierung respektive Automatisierung erfolgreich sein.
Dr. Daniel Steinke, CEO und Gründer von Jit Pay Financial, be-schäftigt sich mit der Abrechnung in der Logistik. Im Auge hat sein Start-up dabei die Digitalisierung vom Auftrag bis zur Zentralab-
rechnung. In ebendiesem Zusam-menhang hat er ein Projekt mit der Spedition Wandt umgesetzt. Einer der Großkunden habe „alle Rückmeldungen in digitaler Form“ gewollt, berichtete Steinke. Zwar sei bei der Spedition Wandt be-reits eine Telematik im Einsatz ge-wesen – „die war aber bei den Sub-unternehmern nicht nutzbar“. Ein anderes System musste her. Mitt-lerweile laufen alle Informationen über das Portal von Jit Pay. Das wiederum meldet alle Daten ans Transport-Management-System von Wandt und stößt dort auch gleich die Leistungsrechnung an. Doch nicht nur das: Jit Pay ver-fügt über eine eigene Banklizenz. „Geld ist höchst motivationsför-dernd“, erklärte Steinke. Deshalb übernehme sein Unternehmen auch den gesamten Geldfluss. „Wir wollen das Paypal der Lo-gistik werden.“ Fürs notwendige Finanzpolster sorgt eine genos-senschaftliche Bank, die bei Jit Pay eingestiegen ist.
Wie unterschiedlich die Ein-schätzungen hinsichtlich der Ge-schwindigkeit der Digitalisierung sind, zeigte sich wiederum in ei-ner Podiumsdiskussion. Einigkeit bestand zumindest darin, dass die Mitarbeiter bei Umstruktu-rierungen mitgenommen werden müssen. Eine Digitalisierung von oben sei hingegen zum Scheitern verurteilt. So geht etwa Prof. Dr.
BEI SEIFERT LOGISTICS ERLEDIGT DIE DROHNE DIE INVENTUR
Logistiker fliegen auf die ZukunftInnovationstag zur Digitalisierung bei der Kooperation Logcoop – Praxislösungen vorgestellt
Volles Haus: 250 Teilnehmer, so viele wie noch nie, waren zu dem Innovationstag von Logcoop gekommen.
Franz Vallée, Gesellschafter und wissenschaftlicher Leiter des Be-ratungsunternehmens VuP aus Münster, von einem „dramatisch exponentiell verlaufenden Wan-del“ aus. Für Prof. Dr. Bernd Noche von der Fakultät für Ingenieur-wissenschaften, Transportsyste-me und Logistik der Universität Duisburg-Essen geht es hingegen um einen „generationsübergrei-fenden Wandel, der klein anfängt“.
Uneins über Entwicklung
Dem widersprach Eric Wirsing, Vice President Global Innovation bei DB Schenker bei: „Wer glaubt, dass es sich um einen Hype han-delt, der vorüberzieht, der irrt sich gewaltig.“ Es gehe vielmehr schon heute darum, die Silos Landver-kehr, Luftfracht und Seefracht aufzureißen, mit – zunehmend rasanter Geschwindigkeit.
An welchen Stellschrauben ge-dreht werden kann, das erfuhren die Teilnehmer auf der begleiten-den Hausmesse. An rund 30 Stän-den präsentierten sich Logcoop-Rahmenvertragspartner mit ihren Lösungen, von denen viele die Digitalisierung vorantreiben. Di-gitalisierung zum Anfassen eben.
Text: Carsten Nallinger | Fotos: Doks Innovation/Patrick Tiedtke, Logcoop
„Logistik 4.0 zum Anfassen
mit praxis-relevanten Themen“
LOGCOOP-GESCHÄFTS-FÜHRER MARC POSSEKEL ÜBER DEN INNOVATIONS-TAG DER KOOPERATION
DIE KOOPERATION
● Logcoop ist eine Kooperation für mittelständische Unternehmen der Transport- und Logistikbranche
● Gegründet im Mai 2013, hat Logcoop mittlerweile mehr als 120 Mitglieder
● Im Fokus des Verbunds stehen Einkaufsvorteile sowie Wissensaustausch
● 2016 gründete Logcoop ein Lagernetzwerk, in dem inzwischen mehr als 70 Mitglieder aus Deutschland, Belgien, Österreich, der Schweiz und Ungarn zusam-menarbeiten und 3,1 Millionen Quadratmeter Lager-fläche bündeln
5TeleTraffic 1 A U S D E R P R A X I S 18. April 2019
Seit bei der mittelständi-schen Spedition Cargotrans die Telematiklösung von Trimble Einzug gehalten
hat, ist in die Disposition deutlich mehr Ruhe eingekehrt. „Wenn wir früher Informationen zu einem bestimmten Lkw haben wollten, mussten wir erst einmal auf vier oder fünf Portalen nachsehen, wo sich dieser gerade befindet. Das konnte dann bei einem Dispo-nenten schon einmal 20 Minuten in Anspruch nehmen“, berichtet Frank Pieper, Speditionsleiter bei Cargotrans. Das Unterneh-men aus Dortmund, das sich auf Komplett- und Teilladungen spe-zialisiert hat, ist vor allem für die Getränke- und Papierindustrie sowie für Baumärkte und Sport-artikelhersteller tätig.
Zwar waren in dem damals mehr als 80 Lkw großen Fuhr-park bereits Telematiklösungen im Einsatz, aber eben immer das System des jeweiligen Fahrzeug-herstellers. Folglich musste je nach Fahrzeug ein anderes Programm im Back office genutzt werden. „Das war viel zu umständlich und ineffizient“, berichtet Pieper.
Tipp von Kollegen
Durch den Austausch mit Kollegen anderer Speditionen sei er dann auf die Lösung von Trimble aufmerksam geworden. Um nicht die Katze im Sack zu kaufen, ließ er im Jahr 2017 von Trimble zunächst in zwei Lkw die Bordeinheit Carcube verbauen. Die wiederum besteht aus dem eigentlichen Rechner, der soge-
nannten Blackbox, sowie einem berührungsempfindlichen Bild-schirm als Benutzeroberfläche für den Fahrer.
Im gleichen Atemzug gab’s auch einen Testzugang für die Backoffice-Anwendung Fleet-cockpit, um sowohl das Fahrzeug als auch die logistischen Prozesse im Blick zu behalten. Des Weite-ren sendet das System aber auch Informationen zum Fahrverhalten an die Fuhrparkverwaltung.
Erfolgreicher Testlauf
„Wir haben gleich gemerkt: Das ist die richtige Lösung für uns“, erklärt Pieper. Der augen-scheinlichste Vorteil lag für ihn sofort auf der Hand: Alle rele-vanten Informationen – etwa zur aktuellen Position der Fahrzeuge, zum Kraftstoffverbrauch oder den Lenk- und Ruhezeiten – seien in einem System sofort übersichtlich verfügbar. Statt sich die Informa-tionen in gleich mehreren Porta-len zusammenzusuchen, mussten die Disponenten plötzlich nur noch einen Blick ins Fleetcockpit von Trimble werfen.
Entlastung habe es auch auf der Fahrerseite gegeben: Die müssen sich nämlich nicht mehr separat im Lkw anmelden. Das Stecken der Fahrerkarte reicht, der Rest erfolgt automatisch. Zu guter Letzt, so be-richtet Pieper, habe sich auch die Kommunikation zwischen Fahrer und Disposition gewandelt. Lange Telefonate gehören der Vergangen-heit an. Die Kommunikation rund um die Transportaufträge läuft beispielsweise komplett in Form
von Textnachrichten über den Bordrechner.
Die eigentliche Umstellung auf die Telematiklösung von Trimble habe dann gerade einmal zwei Mo-nate gebraucht, berichtet Pieper. Im Mai 2018 sei der letzte Lkw mit einem Bordrechner ausgestattet
worden. „Egal, ob Disponent oder Fahrer: Jeder, mit dem ich gespro-chen habe, ist mit der Umstellung sehr zufrieden“, sagt Pieper.
Für den Fuhrparkleiter stand schon zuvor fest, dass es angesichts des scharfen Wettbewerbs in der Logistikbranche nicht mehr ohne
Alles in einem PortalWeniger Aufwand in der Disposition – Cargotrans hat alle Lkw mit Carcube und Fleetcockpit im Blick
Telematiklösung geht. Es stelle sich eigentlich nur noch die Frage, welche Lösung zu welchem Fuhr-park passe, um ihn bestmöglich zu lenken. Für sein Unternehmen, davon ist Pieper überzeugt, habe er mit Trimble die passende Lösung gefunden. Eine Einschätzung, die
Alles möglich machen, damit Ihr Logistik-Alltag perfekt läuft: das ist die Handschrift von Krone. Darum haben wir ein unvergleichlich starkes und innovatives Komplett-Paket für Sie zusammengeschraubt, dass Ihnen einmalige Service-Sicherheit bietet: Krone Fair Care. Das geht ohne Umweg, direkt mit Krone. Denn so sind höchste Kompetenz und schnellste Rundum-Wartung garantiert. Für Ihren Profi Liner, Mega Liner oder Cool Liner. Sie wünschen Garantieverlängerung? Auch kein Problem, wir geben Ihnen drei Jahre dazu. Wir sind schließlich Krone.
www.krone-trailer.com
Sebastian Dust, Leiter Full Service
DIE UNTERNEHMEN
Cargotrans
● Die mittelständische Spedition Cargotrans hat ihren Hauptsitz in Dortmund sowie eine Niederlassung in Hamburg
● Mit dem rund 100 Lkw umfassenden Fuhrpark ist das Unternehmen vornehmlich im Bereich Teil- und Kom-plettladungen unterwegs
● Als Überseespedition ist Cargotrans darüber hinaus in den Bereichen Luft- und Seefracht unterwegs
● Hinzu kommen noch die Zollabfertigung, Lagerlösungen sowie Value-added-Services
Trimble Transport & Logistics
● Trimble Transport & Logistics ist eine Tochtergesell-schaft des Trimble-Konzerns mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien (USA)
● Die Telematiksparte ist dabei ein Nachfolgeunter-nehmen von Punch Telematix, das 2010 übernommen wurde
● Zu den Referenzkunden von Trimble bei der Telematik zählen unter anderen Alfred Talke, Schnellecke, Grei-wing und Sievert Handel Transporte
auch die Disponenten von Cargo-trans teilen, bei denen seither kein Telefon mehr heiß läuft. Und das, obwohl der Fuhrpark mittlerweile auf 100 Lkw erweitert wurde.
Text: Carsten Nallinger | Fotos: Trimble/www.argus-photo.be
6 TeleTraffic 1 18. April 2019 A U S D E R P R A X I S
Wie die täglichen Trans-porte ohne Telema-tik gelaufen sind, da-ran kann sich Lüder
Meyer, Prokurist bei Badenhop Fleischwerke, kaum noch erin-nern. „Wir sind einer der ersten Kunden bei Schmitz Cargobull gewesen, die die Trailertelema-tik getestet haben, und seitdem dabei geblieben, denn ohne geht es gar nicht mehr“, resümiert der Logistikverantwortliche. Im Zentrum der Telematikfunk-tionen stehen dabei heute noch die Ortung der Fahrzeuge und die Einhaltung der Kühlkette. Beim Auftrags- und Fahrerma-nagement haben sich Badenhop Fleisch werke für das Telematik-system von Daimler entschieden. Fleetboard versorgt die Fahrer mit Aufträgen und spielt die Da-ten auch sofort zurück an die Dis-position. Zudem übernimmt das System das Fahrermanagement und sorgt dafür, dass die Fahr-zeuge rechtzeitig in die Werkstatt kommen, bevor es zu größeren Schäden kommen kann.
Als Verwerter von hochwer-tigen Schlachtnebenprodukten beliefern Badenhop Fleischwerke alle großen europäischen Tier-nahrungshersteller und stellen auf Kundenwunsch individu-elle Mischungen zusammen. Entsprechend aufgebaut ist der spezialisierte Fuhrpark des nach IFS-Food-Stan dard zertifizierten Unternehmens. Etwa die Hälfte der 150 Auflieger besteht aus Silofahrzeugen. Die anderen 50 Prozent teilen sich Tank- und
Kühlauflieger. Nur selten stehen die gezogenen Einheiten auf dem eigenen Hof. „Es kommt häufig vor, dass unsere Kunden die Auf-lieger als Ladungsträger nutzen, sodass gleich mehrere Einheiten bei ihnen stehen. Um hier den Überblick zu behalten, ist für uns die Trailertelematik unver-zichtbar“, so Meyer. Und die ist auch nötig, denn die Kunden sind über den westlichen Teil Europas verstreut: von Dänemark über Deutschland, Benelux und Frank-reich bis nach Großbritannien.
Flotte auslasten
Um die Flotte möglichst aus-zulasten, hat sich Badenhop für Stafettenverkehre entschieden. „Viele Touren starten auf dem Hof, führen zum Schlachthof und von dort wieder zurück zum Werk oder direkt zum Kunden“, erklärt Jan-Oliver Bargfrede, Disponent bei Badenhop Fleischwerke. Bargfrede und seine vier Kollegen kümmern sich im Zweischicht-betrieb an sechs Tagen in der Woche um einen optimalen Ein-satz der Fahrzeuge. Grundlage für die Planung sind die Zugmaschi-nen und Fahrer. Sie werden vom Team nach Möglichkeit wöchent-lich eingeteilt. „Doch Ausnahmen bestätigen wie so oft die Regel. Mal müssen Fahrzeuge repariert werden, mal bestellt der Kunde kurzfristig mehr, oder er benötigt doch kein Fahrzeug“, sagt Barg-frede. Prokurist Meyer ergänzt:
„Flexibilität hat bei uns als Dienst-leister Priorität. Der Fuhrpark und die Telematiksysteme sind dabei Mittel zum Zweck und müssen funktionieren.“
Dabei haben sich der Proku-rist und sein Team die Wahl des Telematiksystems nicht leicht gemacht. „Wir haben viel re-cherchiert und eine aufwendige Marktanalyse betrieben“, betont Meyer. Für das Unternehmen war es wichtig, wie lange sich die Tele-matikanbieter schon am Markt befinden, wie deren Struktur auf-gebaut ist und welche Chancen sie in Zukunft am Markt haben. Die Entscheidung fiel dann auf Lösungen der Fahrzeughersteller. Dabei sind die Systeme nicht nur in den Lkw der eigenen Marken verbaut. Badenhop hat die Fleet-board-Geräte auch in den MAN-Zugmaschinen, und die Schmitz-Cargobull-Telematik sitzt an den Silo- und Tankfahrzeugen.
Die beiden Telematiksysteme sind im Alltag unersetzlich, wenn es um das Managen der Transpor-te und der Produktion geht. Denn Badenhop Fleischwerke haben die Systeme so weit über Schnittstel-len zum Transport-Management-System (TMS) integriert, dass im Zuge der Digitalisierung auch die Produktion den Überblick über die auf dem Hof stehenden und die sich im Zulauf befindenden Auflieger hat. Die Positionen fin-den die Mitarbeiter direkt auf dem Wareneingangsmonitor. So haben sie immer einen Überblick über die Fahrzeuge, die als Nächstes eintreffen. Gleichzeitig weiß auch
der Warenausgang, welche leeren Auflieger sich auf dem Hof befin-den und als Nächstes genutzt wer-den können. Dabei helfen auch die Türsensoren. „In der Regel ist es so, dass Fahrzeuge mit offenen Türen auch leer sind und einge-setzt werden können“, erklärt Dis-ponent Bargfrede. Darüber hinaus seien die Daten der Türsensoren sehr nützlich, wenn es mal zu Re-klamationen seitens der Kunden komme. Badenhop kann dann im-mer genau nachweisen, wann bei-spielsweise die Türen offen waren.
Nützliche Funktionen
Zu den nützlichen Funktionen gehört zudem der elektronische Temperaturverlauf. Badenhop erhält über das Telematiksystem die Temperaturdaten der Kühlma-schinen des Herstellers. Gleichzei-tig kann der Disponent über die Zweiwegekommunikation auf die
Ohne Telematik geht’s nichtBadenhop Fleischwerke nutzen für ihre Flotte gleich drei Systeme – Lkw, Trailer und Reifen im Blick
Kühlaggregate zugreifen, wenn ein Sollwert über- beziehungs-weise unterschritten wird.
Während die Trailer- und Lkw-Telematik Alarm schlägt, wenn eines der Verschleißteile an den Fahrzeugen ausgetauscht werden muss, hat sich Badenhop beim Reifenmanagement für eine Lösung von Goodyear-Dunlop entschieden. Die Reifensensoren sitzen auf der Felge und senden die Daten dann direkt an die Werkstatt, ohne dass der Fahrer dabei einbezogen wird. „Sobald es auffällige Werte gibt, können die Mechaniker sofort eingreifen und das betreffende Fahrzeug in die Werkstatt holen oder den Fahrer informieren“, sagt Meyer. Dadurch reduzieren sich immer wieder Ausfallzeiten und Reifenplatzer und damit hat auch das dritte Te-lematiksystem seinen festen Platz bei Badenhop.
Text: Ralf Johanning | Fotos: Badenhop Fleischwerke, Goodyear
„Telematik- systeme
sind Mittel zum Zweck und müs-sen funk-tionieren“
LÜDER MEYER, PROKURIST UND
LOGISTIKCHEF BEI BADENHOP
DAS UNTERNEHMEN
● Johann Hinrich Badenhop gründete das Unternehmen 1871 als Viehhandelsgeschäft
● Seit 2016 leitet Christian Badenhop das Familien-unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Verden
● Die Firma, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt, ist nach eigenen Angaben der größte Lieferant für die Tierfutterindustrie
● Badenhop verarbeitet dazu Kategorie-3-Schlacht-nebenprodukte von EU-zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieben
● Das Rohmaterial wird kundenspezifisch in ununterbro-chener Kühlkette verarbeitet und dann tiefgefroren
● Eigene Lager ermöglichen eine flexible Disposition und sichern die Just-in-sequence-Lieferungen durch eigene Spezialfahrzeuge
● Badenhop Fleischwerke verfügen über eine Lager-kapazität von 24.000 Tonnen, darunter 500 Tonnen an Gefriervolumen, und wickeln täglich rund 500 Tonnen an Frischlieferungen ab
7TeleTraffic 1 A U S D E R P R A X I S 18. April 2019
Live Planner – die optimale Tourenplanung im TachoWeb | telematics.dako.de/tourensteuerung
Bei Georgi Transporte steht die Sicherheit der Ladun-gen ganz weit oben auf der Prio ritätenliste. Auf dem
gleichen Level befindet sich auch die Pünktlichkeit. Der Grund dafür ist einfach: Das Unterneh-men aus Burbach ist europaweit einer der führenden Anbieter für Luftfracht-Ersatzverkehre. Hinzu
kommen Schwergut-, Gefahrgut-, Kühl- und High-Value-Trans-porte. „Pünktlichkeit, Zuver-lässigkeit und eine permanente Überwachung sind bei unserem Portfolio einfach ein Muss“, sagt Ricardo Heidel, Projektmanager
Truckfleet bei Georgi Transpor-te. Insbesondere das permanente Tracking sei für Kunden heutzu-tage Standard. Bei einer Flotte von mehr als 400 Lkw kann sich Heidel das Arbeiten ohne Telema-tiksystem nicht mehr vorstellen.
Daher setzt das Unterneh-men auf ein Telematiksystem von Astrata in Kombination mit einer
Trailertelematik von Orbcomm. „Für die bestmögliche Sicherheit haben wir gleich zwei Telematik-systeme in unsere Lkw-Kombi-nationen eingebaut. Sollte bei ei-nem das GPS-Tracking ausfallen, können wir immer noch auf das zweite System zugreifen“, erklärt Heidel. Doch das ist nur sehr sel-ten der Fall. Dafür bietet Georgi Transporte den Kunden nicht nur eine permanente Ortung der Fahrzeuge, auch die voraussicht-liche Ankunftszeit (ETA) wird vom System berechnet. Sollte es zu Verzögerungen kommen, alar-miert das Telematiksystem alle an der Tour Beteiligten.
Zeit im Auge behalten
Um die Zeiten möglichst ge-nau im Auge zu behalten, hatte der Manager bereits vor einigen Jahren wichtige Punkte eines Tourenverlaufs, sogenannte
Points of Interest (POI), program-miert. Diese Bezugspunkte einer Tour bilden gemeinsam mit den dazu gehörenden Geozonen einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor. Sobald ein Lkw beispielsweise in den Flughafen Frankfurt ein-fährt, wird eine Push-Nachricht versendet, und der Kunde erhält die Information, dass seine La-dung da ist. „Andere Anbieter konnten uns die Möglichkeit zur Einrichtung von POI in der von uns benötigten Form nicht so lie-fern“, bekräftigt Heidel die Wahl des Astrata-Telematiksystems Driver Linc+. Zudem sei das Anlegen der POI und Geo zonen denkbar einfach.
War das Telematiksystem zu Beginn hauptsächlich für die Tou-renverfolgung gedacht, so haben sich im Verlauf der vergangenen Dekade auch die Funktionen ver-mehrt. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung profitiert Georgi Transporte jetzt auch von neuen Funktionen, um Auftrags-, Fahr-zeug- und Fahrermanagement zu unterstützen. Ein nützliches Tool ist der App-Store, in den Georgi Transporte auch Apps von ande-ren Anwendern legen kann.
Der Fahrer fotografiert damit nach der Auslieferung alle Doku-mente und sendet sie an das Por-tal Fleet Visor. Von dort werden sie automatisch an das Buchhal-tungsprogramm weiter geleitet. Somit kann Georgi Transporte die Frachtbriefe und andere wichtige Papiere sofort an den Kunden übermitteln. Ein weite-res wichtiges Dokument, das im App-Store hinterlegt ist, ist ein Abnahmeprotokoll für die Fahrer, das sie vor und nach Fahrtantritt ausfüllen müssen. „Wir kennen so immer den aktuellen Zustand unserer Fahrzeuge und können damit auch Werkstattaufenthalte für Reparaturen und Wartungen
besser organisieren“, sagt Heidel. Das Unternehmen könnte sich auch gut vorstellen, elektroni-sche Frachtbriefe (E-CMR) auf diese Weise zu hinterlegen und digital zu bearbeiten, doch hier fehlt noch immer die Unterschrift Deutschlands zum Zusatzproto-koll, das von 17 Ländern bereits ratifiziert wurde.
Massendaten auslesen
Ein nützliches Tool ist dabei das Auslesen der Fahrer- und Mas-sendatenspeicher des digitalen Tachographen geworden. Waren früher gleich mehrere Mitarbeiter regelmäßig damit beschäftigt, mit einem Download-Stick die Daten aus den Fahrzeugen zu lesen, übernimmt das jetzt eine Mitar-beiterin, die lediglich die Abfolge des Auslesens festlegt. Alles an-dere läuft automatisch. Zugleich
Sicherheit für HochwertigesMithilfe der Telematik von Astrata lenkt Georgi Transporte Kundenaufträge – permanente Ortung eingerichtet
lässt sich mit der Funktion auch die Lenk- und Ruhezeit der Fahrer bei neuen Aufträgen integrieren. Die Disponenten können damit die Kapazitäten besser auslasten, indem sie die Touren entspre-chend den Restlenkzeiten der Fahrer verteilen.
Gleichzeitig liefert das Tele-matiksystem wesentliche Kenn-ziffern zum Kraftstoffverbrauch. So wertet Heidel regelmäßig die Berichte aus. Daran kann er er-kennen, welches Fahrzeug seiner Flotte am meisten Diesel ver-braucht. „Der Dieselverbrauch ist eine der Schrauben, an denen wir noch drehen können. Deswegen wollen wir diesen Bereich auch in Zukunft weiter intensivieren“, sagt der Flottenmanager. Denn gleichzeitig gelingt es so, die Um-welt weniger zu belasten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Text: Ralf Johanning | Fotos: Georgi Transporte
DIE UNTERNEHMEN
Georgi Transporte
● Siegfried Georgi gründete 1953 das Unternehmen Georgi Transporte in Burbach
● 1978 startete das Unternehmen Luftfracht-Ersatz-verkehre mit einem Spezialfahrzeug im Subunter-nehmerverbund
● 1985 begannen die eigenen Transporte im Auftrag von Fluggesellschaften
● Ab 1995 richtete sich das Unternehmen auf jegliche Spezial- und Sondertransporte aus
● Im Jahr 2000 schaffte sich Georgi Transporte moderne EDV- und Telematiksysteme an
● Heute hat das Unternehmen mehr als 400 Fahrzeuge und 700 Mitarbeiter
Astrata Europe
● Stellt seit mehr als 25 Jahren Telematiksysteme her
● 100-prozentiges Tochterunternehmen der Astrata Group mit Sitz in Singapur
● Früher arbeitete das Unternehmen unter dem Namen Qualcomm
● Hat in Europa mehr als 1.500 Kunden
● Zu den Kernprodukten gehören die Plattform Fleet Visor und die Telematiksysteme der Driver-, Van- und Trailer-Linc-Serien
Wer wird denn gleich in die Luft gehen: Georgi Transporte ist viel in Sachen Luftfracht-Ersatzverkehre unterwegs.
BEI EINER FLOTTE VON 400 LKW GEHT ES NICHT OHNE TELEMATIK
8 TeleTraffic 1 18. April 2019 A U S D E R P R A X I S
Wenn es um die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer geht, kann es schnell teuer werden, wenn die
gesetzlich vorgeschriebenen Zei-ten überschritten werden. Dessen ist sich auch die Greif-Gruppe bewusst und hat sich auch aus diesem Grund eine Telematik-lösung zugelegt. „Wenn wir mit dem System nur eine Ordnungs-widrigkeit – also eine Über-schreitung der Lenkzeiten etwa – verhindern können, dann hat es sich für uns schon gelohnt“, sagt Martin Leszynsky, Fuhrparklei-ter in Eggenfelden und zugleich Telematikverantwortlicher der Greif-Gruppe.
Daher entschieden sich vor zwei Jahren die Fuhrparkleiter des in der vierten Generation fami liengeführten Unternehmens, zwei Telematiksysteme zu testen. Nach einem Jahr Probebetrieb schlossen sie die gesamte Flotte an das auf einer Tachofresh- Anwendung basierende System von Precisa Telematics an. „Mit
dem Telematiksystem bekommt man einen guten Überblick, ob es Ausreißer gibt, weil die Da-ten sofort auswertbar sind“, sagt Precisa- Geschäftsführer Thomas Bauer und teilt die Ansicht seines Kunden. „Viele Fuhrunternehmen wissen gar nicht, dass sie vor al-lem im Bereich der Arbeitszeit ihrer Fahrer angreifbar sind.“
Auf die Minute genau
Schließlich könne die Über-schreitung der gesetzlichen Ar-beitszeit oder die Nichteinhaltung von Ruhezeiten um auch nur eine Minute schon teuer werden. „Das kostet gleich einen fünfstelligen Betrag“, warnt Bauer. Und Les-zynsky fügt hinzu: „Stellt das BAG fest, dass beispielsweise ein Fahrer regelmäßig seine Zeit überschrei-tet – etwa, weil er nur noch wenige Kilometer von der Betriebsstätte entfernt ist –, kann es auch bei uns schnell zu einer Betriebsprüfung
kommen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden.“ Denn mit einer Flotte von 155 Fahrzeugen kann es schnell teuer werden. Zumal die Fahrer des Unternehmens mit acht Standorten in Deutschland viel unterwegs sind. Sie beliefern Hotels in Deutschland und Ös-terreich mit Mietwäsche von acht Standorten in Deutschland mit 12- bis 14-Tonnern von Mercedes, MAN und Iveco.
Ein weiterer Vorteil der Tele-matiklösung ist der Zeitgewinn. Das rechtssichere Herunterla-den der Fahrerdaten mit einem USB-Stick kostete die Fuhrpark-leiter der Greif-Gruppe zuvor zu viel Zeit. „Wenn wir für unsere Fahrzeuge alle sieben Tage die Fahrerdaten händisch über einen USB-Stick herunterladen müss-ten, wäre das kaum machbar“, erläutert Martin Leszynsky und rechnet vor, dass jeder Fuhrpark-leiter pro Auslesevorgang 20 bis 40 Minuten benötigt. „Vorausgesetzt, die Fahrzeuge sind in dem Mo-ment auf dem Parkplatz“, ergänzt der Fuhrparkleiter. „Der Remote Download, also die Fernübertra-gung der Massenspeicherdaten des digitalen Tachographen und der Fahrerkarte, ist ein rechts-sicheres und modernes Mittel der Fuhrparkverwaltung.“
Darüber hinaus schätzen die Greif-Mitarbeiter das einfach zu bedienende System, mit dem je-der Fuhrparkleiter intuitiv um-
Ruhezeiten im GriffTelematik von Precisa unterstützt die Greif-Gruppe bei der Kontrolle der Lenkzeiten – Tourenplanung verbessert
gehen kann, und den Vor-Ort-Support. „Wir wollten nicht an jedem unserer Standorte einen IT-Fachmann sitzen haben, der das System versteht und bedient.“ Mit dem gewählten Telematik-system kann die Greif-Gruppe automatisch Flotte und Touren digital abbilden und verwalten. Die Fahrer müssen es nicht im Cockpit einschalten und sehen auch nicht in Echtzeit ihr Fahrver-halten. Erst am Ende der Schicht können sie am Betriebshandy ihre Tour nachvollziehen.
Kaum IT-Aufwand
IT-Aufwand haben die Fuhr-parkleiter bei der Greif-Gruppe mit dem neuen System dabei kaum. „Die Daten liegen bei uns auf dem Server, das System ist also cloudbasiert“, erläutert Bauer. „Der Disponent oder Fuhrpark-leiter ist sozusagen Beifahrer. Er sieht in Echtzeit, was der Fahrer macht.“ Der betriebsseitige Zugriff auf die Daten ist kein Problem. „Das System läuft stabil“, berich-tet Leszynsky. „Wir hatten zwei kleinere Probleme, die aber sofort per Fernwartung vom Techniker behoben wurden.“ Zweimal im Jahr treffen sich Leszynsky und seine Fuhrparkleiterkollegen mit dem Systembetreiber, um ge-gebenenfalls Funktionen anzu-
DIE UNTERNEHMEN
Greif-Gruppe
● Die Greif-Gruppe ist ein familiengeführtes Textil-serviceunternehmen mit Hauptsitz in Augsburg
● Weitere Niederlassungen gibt es in Berlin, Cadolzburg, Eggenfelden, Erfurt, Gundremmingen, Hamburg, Lan-genfeld und Wolfratshausen
● Geschäftsführer der Greif Holding sind Walter, Markus und Martin Greif
● Im Fokus stehen Services für die Bereiche Hotelle-rie und Gastronomie, Industrie und Handwerk sowie Pflege und Klinik
● Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund 83 Millionen Euro
Precisa Telematics
● Der Telematikspezialist Precisa hat seinen Sitz in Memmingen
● Geschäftsführer ist Sebastian Baumann
● Der wiederum verantwortet auch die Geschicke des Mercedes-Benz-Händlers Wilhelm Baumann, der im Pkw- und Lkw-Bereich unterwegs ist
● Im Blick hat der Anbieter alles von der Tachoarchi-vierung über die Ortung und das Fahrtenbuch bis zu Predictive Maintenance
passen. „Kürzlich haben wir das Reporting nachbessern lassen“, erzählt Leszynsky. Es fehlte ein anwählbares Kontrollkästchen, mit dem bestätigt wird, dass der Fahrer in Deutschland losgefahren ist. Laut EU-Vorgabe ist diese An-gabe notwendig.
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Telematiklö-sung war neben dem Anzeigen des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen die Tourenpla-nung. „Das Schlimmste für uns ist, keine Daten zu haben und Touren planen zu müssen. Jetzt haben wir die Lenkzeiten aktuell vorliegen und können die Fah-rer entsprechend ihrer Arbeits-zeit einsetzen.“ Deswegen sieht Leszynsky die Anschaffung des Telematiksystems auch als deut-liche Arbeitserleichterung für die Fahrer an. Die Touren könnten so anhand der vorliegenden Daten effektiver geplant werden.
Sparend fahren lohnt sich
Das neue System bringt noch weitere Vorteile für die Fahrer. Die Greif-Gruppe hat mit den Mitarbeitern Betriebsvereinba-rungen geschlossen, wonach sie bei wirtschaftlichem Fahren mo-natliche Belohnungen erhalten können. „Wer wirtschaftlich fährt und bei wem es in diesem Monat
Martin Leszynsky, Fuhrparkleiter der Greif-Gruppe, hatte zunächst zwei Systeme getestet.
etwas schwieriger war, sehen wir jetzt viel früher“, sagt Leszynsky. Bei unerwünschten Ergebnissen schauen sich die Fuhrparkleiter aber zuerst das Fahrzeug an. Schließlich könne ein erhöhter Spritverbrauch auch an einer zu geringen Motorleistung oder an einem Defekt liegen. Die Daten nutzt die Unternehmensgruppe auch für ihre Greif-Challenge. Dabei wird die Höhe der Kraft-stoffeinsparungen pro Standort verglichen. Das Fahrerteam mit dem besten Wert darf als Beloh-nung an seinem Standort eine Feier ausrichten. „So ist Team-building gleich ein toller Neben-effekt des Telematiksystems“, sagt Martin Leszynsky.
Text: Ralf Johanning | Fotos: Greif-Gruppe
Siri, Alexa und MBUX im Test
Sprachsteuerung
Lieferzeiten von Elektroautos
Warum Fuhrparks bis zu
einem Jahr warten müssen
Kaufberatung Kia Ceed
Was der kompakte Golf-
Gegner als Firmenwagen kann
Restwerte von Elektroautos
Wie sich gebrauchte
Stromer verkaufen lassen
8 0 3 1 8 | € 4 , 0 0
w w w. f i r m e n a u t o. d e
5 19
firmenautoMobilität & Management
Leasing Gewinner und Verlierer – der Markt im Überblick
ararararararrarrarararrrarararraaaaaa teteteteteteteteteteteteteteteetettetettetttttt onononononooonononooonoonooooonoooo .vv.v.v.v.v.vvvvvvv.vvololololollooolooooooollksksksksksksksskssskssssssswawawawawaww gegegegegegeggeggeg n.n.n.n.n.n.nnnnnnn dededededeeddededd
Der Arteon. Überzeugt schon beim ersten Eindruck. Der Arteon fasziniert sowohl mit
seinem Design als auch mit modernster Technologie. Dank innovativer
Gestensteuerung¹, dem Active-Info-Display¹ und dem weiterentwickelten Feature
„Emergency Assist“¹ sind Sie der Konkurrenz so immer einen Schritt voraus.
¹ Optionale Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Wettbewerbsvorteilebeginnen aufdem Parkplatz.
Mai 2019 firmenauto 3
Nach einem stressigen Arbeitstag steige ich gerne ins Auto und schalte ab. Das Auto als abgeschotteter Ort der Ruhe und
Geborgenheit. Nichts stört, kein quasselnder Radiosprecher, kein nörgelnder Kollege.
Ruhe? Von wegen. Moderne Autos pfeifen, summen, piepen oder klackern, was das Zeug hält. Warum etwa bimmeln sie hektisch, sobald man einsteigt? Ich schnalle mich in der Regel erst an, bevor ich den Motor starte. Und dass Mitfahrer mit wildem Geklingel auf meine Fahr-fehler aufmerksam gemacht werden, nervt ebenso wie die synthetische Begrüßungs-sinfonie im Kia Ceed. Im Ford Focus piept’s, während die Heckklappe automatisch schließt. Wahrscheinlich als Warnung, falls jemand im Kofferraum liegt und die Hand rausstreckt. Manche Blinker gehen mir mit ihrem metalli-schen Klackern auf die Nerven. Beschäftigen die Autohersteller eigentlich keine Sounddesi-gner? Ach was, lasst mir doch einfach meine Ruhe!
Hanno Boblenz Chefredakteur [email protected]
Lasst mir doch meine Ruhe!
Foto
s: H
ann
o B
ob
len
z (1
), K
arl-
Hei
nz
Au
gu
stin
(1)
EDITORIAL
Lesen Sie firmenauto bereits einen
Tag vor der Printausgabe als
E-Paper und legen Sie sich
gleich Ihr persönliches Archiv an.
www.firmenauto.de/epaper
Aus der Redaktion
In einer Beziehung gilt das siebte als das verflixte Jahr. Oft kratzt dann einer die Kurve. Wenn uns Kollege Martin Schou nach sieben Jahren bei firmenauto verlässt, so können wir zumindest für die Redaktion sagen: Hier war nichts im Argen. Im Gegenteil, wir waren über all die Jahre ein super Team und Martin ein verlässlicher Mitspieler. Jetzt wechselt er auf die andere Seite des Schreibtisches in eine Pressestel-le. Schade für uns, aber wir wünschen dir viel Glück, Martin!
So kann man auch zeigen, was man drauf hat. Unsere
Testroute mit dem neuen Range Rover Evoque führte
auf einer Eisenbahnbrücke über den Kanal von Korinth.
Nicht nur aufs Klein gedruckte achten, sondern bei der Abrechnung von Leasingver-trägen ganz genau hinschauen, so die Tipps von Anwalt Peter Rindsfus. Sonst kann’s für den Fuhrpark teuer werden.
42
34
rot = Themen auf dem Titel
LEASINGab 26
54
14
TITELTHEMA Leasing
26 Der Markt in Zahlen Was die Leasinggesellschaften bieten und
wie viele Kunden sie unter Vertrag haben
34 Fahrzeugrückgabe Am Ende der Leasinglaufzeit droht häufig
eine unangenehme Überraschung. Mit ein
paar Tricks kann man Nachzahlungen aber
vermeiden
MANAGEMENT
03 Editorial
06 Branchen-News
08 Kolumne Axel Schäfer vom Fuhrparkverband findet,
Unternehmen sollten Diensträder fördern
10 Brauchen wir ein Tempolimit? Volvo prescht vor und riegelt künftig bei
180 km/h ab. Doch macht langsameres
Fahren die Autobahnen wirklich sicherer?
14 Lieferzeiten Elektroautos
Bis zu einem Jahr müssen Fuhrparks auf
E-Autos warten. Woran liegt’s?
22 Gebrauchte Elektroautos
Leasinggesellschaften und Fuhrpark-
betreiber verkaufen immer mehr
gebrauchte E-Autos. Das hat auch Einfluss
auf die Preise von Neuwagen
37 Zertifizierter Flottenmanager
Wie bildet Dekra Flottenprofis aus?
Teil 2: Rechtsgrundlagen
und Versicherungsmanagement
38 Unfallabwicklung Neuer Trick der Versicherer: Sie kürzen die
Wertminderung um die Umsatzsteuer
40 Abschleppen Ein zugeparkter Firmenparkplatz ist ärger-
lich. Doch Falschparker dürfen nicht ohne
Weiteres abgeschleppt werden
UNTERNEHMEN
Adesion Leasing 26
ALD 26
Alphabet 26
Amazon 62
Apple 62
ARI 20
Arval 20
Athlon 26
Bähr & Fess 22
BCA 22
BF Analytics 22
Consors Finanz 26
Dekra 34
Dekra Akademie 37
Deutsche Bahn Connect 26
Deutsche Leasing 26
Free2move 26
Google 62
Kazenmaier 26
Kanzlei Voigt 40
Land Rover 20
Mazda Finance 26
Mobility Concept 26
Raiffeisen-Impuls 26
Santander 26
Sixt Leasing 26
VMF 34
Volvo Car Financial Services 26
Volkswagen Financial Serv. 26
X-Leasing 26
INHALT 5 2019
Kaufberatung Kia Ceed.
4 firmenauto Mai 2019
Das lange Warten auf Elektroautos.
Foto
s: A
dobe
Sto
ck (2
)
44
62 AUTO
Neuheiten
42 VW T-Cross Der kleine SUV ist mehr als nur
ein hochgebockter Polo
44 Mercedes CLA
Zweite Generation des Sportcoupés:
cooleres Design, mehr Platz
46 Range Rover Evoque Der kompakte SUV bleibt stylish.
Aber er wurde ein bisschen öko
48 Skoda Scala
Mit neuem Namen soll der Nachfolger
des Rapid in der Golf-Klasse punkten
50 Jaguar XE Ein Facelift bringt neues Infotainment
und eine überarbeitete Optik
Fahrberichte
52 Honda Civic 1.6 i-DTEC
Extrovertierte Firmenwagenalternative in
der Kompaktklasse: Was kann der Diesel?
54 Kaufberatung Kia Ceed Alle Daten und Preise des kompak-
ten Koreaners und wie er sich als
Geschäftswagen schlägt
Service
60 Kostencheck Mittelklasse Die meistverkauften Firmenwagen und ihre
Kosten sowie die sparsamsten Modelle
62 Sprachassistenten Nach Apple und Google drängt nun Amazon
Alexa ins Auto. Wir haben die Dienste mit MBUX
von Mercedes verglichen
66 Rückblick / Impressum
Worüber firmenauto vor 20 Jahren berichtete
AUTOS IM HEFT
Audi e-Tron 20/24 A5 Sportback 60 Q7 55 TDI quattro 24
BMW i3/225 xe/530e/745e 20 320d Touring 60 320d Gran Turismo 60
e.Go Life 20
Ford Focus 1.5 Eco Blue 59 Mondeo 60/61
Honda Civic 1.6 i-DTEC 52
Hyundai Kona/Kona Elektro 24
Jaguar XE 50 I-Pace 20
Kia e-Niro/Niro PIH/e-Soul 20 Ceed 54 Optima Plug-in Hybride 20/61
Land Rover Range Rover P400 PIH 20 Range Rover Evoque 46
Lexus IS 300h 61
Mercedes A-Klasse 62 CLA 44 C-Klasse 20/60/61 E-Klasse 20 EQC 20
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybride 20
Nissan Leaf/e-NV200 20
Opel Corsa-e/Ampera-e 20 Astra 1.6 Diesel 59 Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel 60
Peugeot 308 Blue HDi 130 59 508 Blue HDi 130 61
Porsche Panamera 4 E-Hybrid/Cayenne E-Hybrid/Taycan 20
Renault Zoe/Kangoo Z.E. 20/22
Skoda Scala 48 Superb 60/61
Smart EQ Fortwo/EQ Forfour 20
Tesla Model 3/Model S/Model X 20
Toyota Prius Plug-in Hybride/Mirai 20
Volvo V60/V90/XC60/XC90 20 V60 D4 60 Volvo S60 T8 Twin Engine 61
VW e-Up/e-Golf/Golf GTE 20 T-Cross 42 Passat 60/61 Arteon 2.0 TDI 61
Mai 2019 firmenauto 5
Neuer Mercedes CLA: coole Optik, viel Platz.
Versteht Sie Ihr Sprachsystem? Ein Test.
6 firmenauto Mai 2019
BRANCHENNEWSFo
tos:
Fo
tolia
/Ism
agilo
v (1
)
VW testet autonome Autos in HamburgIn Hamburg testet VW ab sofort mit fünf elektrischen Golf autonomes Fahren. Ganz allein geht
es aber noch nicht, ein Fahrer muss im Notfall eingreifen.
Auf Hamburgs Straßen testet VW automatisiertes Fahren bis Level 4. Ab sofort sind fünf elek-
trische Golf im öffentlichen Straßenver-kehr auf einem drei Kilometer langen Teil abschnitt einer neuen Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fah-ren unterwegs.
Die Autos sind mit je elf Laserscan-nern, vierzehn Kameras, Ultraschall-sensoren und sieben Radarsystemen ausgestattet. Bei den Testfahrten im
regulären Alltagsbetrieb werden Datenmengen von bis zu fünf Gigabyte je Minute verarbeitet.
So soll es möglich sein, andere Ver-kehrsteilnehmer, den Straßenverlauf, Verkehrsschilder und Fahrstreifen-wechsel im fließenden Verkehr in Millisekunden zu erfassen. Damit die Fülle an Informationen richtig inter-pretiert und umgesetzt wird, lernt die Software aus den erfahrenen Situatio-nen. Da autonomes Fahren im Straßen-
verkehr noch nicht erlaubt ist, sitzt hinter dem Volant ein Testfahrer, der bei Bedarf jederzeit eingreifen kann.
Zurzeit entsteht in Hamburg eine neun Kilometer lange Teststrecke, die 2020 fertiggestellt sein soll. Sie verfügt unter anderem über Ampelanlagen, die die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur, zum Beispiel Verkehrsleitsystemen, sicher-stellen soll, um den Verkehrsfluss durch Digitalisierung zu optimieren.
Bundesverband Fuhrparkmanagement
Rundum-Check für Flotten Für Flotten mit bis zu 200 Fahrzeugen bietet der Bundesverband Fuhrparkmanagement einen Rundum-Check an. Er enthält feste Prüf-punkte und soll innerhalb eines festen Zeitrahmens Optimierungs-möglichkeiten im Fuhrpark aufzeigen. Durch sein Expertennetzwerks kann der Verband bundesweit Beratungen im Bereich Fuhrpark und Mobilität anbieten. Ziel sei es, Kosteneinsparungen zu schaffen, die den günstigen Paketpreis überträfen. Für Verbandsmitglieder ist jähr-lich ein halber Beratungstag kostenlos.
Mai 2019 firmenauto 7
Smart und Geely
Nächster Smart kommt aus ChinaDaimler und Geely gründen ein Joint Venture in China, um Smart als Hersteller von E-Autos weiterzuentwickeln. Die nächste Generation soll in China produziert und ab 2022 global vertrieben werden. Parallel dazu übernimmt das bisherige Werk in Hambach die Produktion des elektrischen Mercedes-Kompaktwagens EQA. Schon Anfang 2018 war die Volvo-Mutter Geely mit 9,7 Prozent bei Daimler eingestie-gen. Außerdem wollen beide Seiten bei Chauffeurdiensten im Luxus-segment in China zusammenarbeiten.
Vispiron Carsync kauft Mobility First
Mehr MittelstandCarsync hat eine 51-Prozent-Beteiligung an Mobility First erworben. Das Unternehmen ist auf Schaden- und Fuhrpark-management für kleinere Flot-ten spezialisiert und betreut der-zeit rund 70.000 Fahrzeuge. Prozessoptimierung im Fuhr-park und Kosteneinsparungen in der Schadenabwicklung sind das Kerngeschäft der neuen Beteiligung. Erst vergangenes Jahr hatte Vispiron Carsync die Mehrheit bei Expert Automotive übernommen. Künftig sind die drei Unternehmen durch eine mehrheitliche Beteiligung miteinander verbunden, bleiben recht-lich aber unabhängig. Durch den neuen Verbund entsteht so ein Konzern, der nach Unternehmensangaben einer der größten digitalen Fuhrparkma-nagementanbietern auf dem deutschen Markt sein wird.
Toyota
Hybrid-Patente
frei zugänglichToyota hat die Freigabe von fast 24.000 Patenten aus über 20 Jah-ren Hybrid-Entwicklung ange-kündigt. Damit wollen die Japa-ner die Elektrifizierung von Autos vorantreiben. Außerdem bietet Toyota anderen Herstellern gegen Gebühr technische Unter-stützung bei der Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge an. Toyota sieht die Zeit für Zusam-menarbeit gekommen, um den Klimawandel zu verlangsamen.
Pkw-Markt
Januar/Februar 2019 (Anteil an Neuzulassungen)
Der Dieselanteil an den Neuzulas-sungen stabilisiert sich langsam. Vor allem in den Flotten laufen nach wie vor überwiegend Dieselfahr-zeuge. Auffällig ist der gegenüber dem Privatkundenmarkt höhere elektrifizierte Anteil. Bei den Hybriden berücksichtigt Dataforce nur Voll- und Plug-in Hybriden, keine Mild-Hybriden.
Benzin
35,7 %
Hybrid
2,7 % Elektro
2,2 %
Diesel
59,0 %
CNG/LPG
0,3 %
Relevanter Flotten- markt
Benzin
71,2 %
Hybrid
2,4 % Elektro
2,0 %
Diesel
23,6 %
CNG/LPG
0,9 %
Privat
Quelle: Dataforce
8 firmenauto Mai 2019
Fahrräder liegen im Trend, speziell E-Bikes: Alleine 850.000 Stück wurden 2018 in Deutschland verkauft, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch immer mehr
Arbeitnehmer wünschen sich ein Rad vom Arbeitgeber. Nicht nur die Google-Suche nach dem Thema »Dienstfahr-rad« hat nach einer Analyse zwischen 2014 und 2018 um fast 300 Prozent zugenommen und liegt damit auf Platz zwei hinter der allgemeinen Suche nach »Mitarbeiter-Bene-fits«. Unter den Top-Suchanfragen von Arbeitnehmern belegte das Dienstrad 2018 Platz vier, vor Arbeits-Laptop und Arbeits-Handy. Keine Spur von Dienstwagen oder anderen Mobilitätsthemen für Mitarbeiter.
Arbeitgeber haben das erkannt und bieten immer häu-figer flexible Möglichkeiten, etwa im Rahmen eines indi-viduellen Mobilitätsbudgets. Statt eines Dienstwagens erhalten die Angestellten einen monatlichen Betrag. Damit können sie ihren Mobilitätsmix dem persönlichen Pendel- und Reiseverhalten entsprechend individuell zusammenstellen. Das Budget können sie für einen Dienstwagen oder den ÖPNV nutzen, aber auch für ein Dienstrad oder E-Bike, mit dem sie privat radeln dürfen.
Die Politik sieht das ebenfalls positiv: Mitar-beiter müssen privates Radeln bis zum Jahr 2021 nicht mehr versteuern. Aber nur, wenn die Räder vom Arbeitgeber zusätz-l ich zum ohneh in geschuldeten Arbeits-
lohn finanziert und den Arbeitnehmern auch zur pri-vaten Nutzung überlassen werden.
Das dienstlich genutzte Fahrrad ist also schwer im Kommen. Und das ist auch gut so, selbst wenn man die je nach Standort möglicherweise erhöhten Unfall-risiken im Blick behalten muss. Und ganz ohne Auf-wand für das Mobilitätsmanagement geht’s auch nicht. Denn für ein dienstlich genutztes Fahrzeug gelten natürlich genauso die Unfallverhütungsvorschriften mit jährlicher Sachkundigenprüfung, regelmäßigem Check der Verkehrssicherheit des Rads, richtiger Klei-dung, Helm und vielem mehr.
Auf der anderen Seite fällt der CO2-Ausstoß des Mitarbeiters auf dem Rad wesentlich geringer aus als beim Auto. Ergo: Das Rad ist gut für die Umwelt, gut für Gesundheit und Fitness der Mitarbeiter – und gut für neue Ideen und Innovationen im Unternehmen.
Wie ich darauf komme? Studien haben herausge-funden, dass weniger als zehn Prozent der Mitarbei-terinnen und Mitarbeiter die besten Ideen nicht im Büro bekommen, sondern wenn sie auf der Toilette sitzen, duschen, joggen – oder Rad fahren. Die Bewe-gungsabläufe sind automatisiert und blockieren das Gehirn nicht, dazu kommt die frische Luft. Gleich-zeitig baut die Bewegung Stress ab und fördert die Sauerstoffaufnahme – und Geistesblitze. Keine Frage, die kann jedes Unternehmen gebrauchen. Selbst Albert Einstein hat über seine Relativitätstheorie berichtet: »Mir ist es eingefallen, während ich Fahr-rad fuhr.« Wenn das kein weiterer Ansporn ist. Fo
to: A
do
be
Sto
ck/S
mo
kovs
ki
Mehr Tatendrang Diensträder als Incentive spornen Mitarbeiter an. Der Verwaltungsaufwand für
die Unternehmen hält sich in Grenzen, der Gewinn dagegen ist riesig.
Axel Schäfer, Geschäftsführer und Vertreter des Bundesverbands Fuhrparkmanagement e. V. im Board der EUFMA – European Fleet and Mobility Management Association.
von Axel Schäfer
KOLUMNE
MAN KANN ES NICHT
ALLEN RECHT MACHEN.
doch
214,– €*z. B. ŠKODA KAROQ
mtl. ab
Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA KAROQ 1,0 l TSI (85 kW) in l/100 km, innerorts: 6,3; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,3.
CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in
NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.
Ob Combi oder SUV: Unsere Firmenwagen bleiben auch mit Vollausstattung im Budget.Jetzt Probefahrt vereinbaren oder ein persönliches Angebot anfordern: Unsere Business-Hotline erreichen Sie unter (08 00) 2 58 58 55. Für weitere Details zu unseren Angeboten besuchen Sie unsere Webseite: skoda-geschäftskunden.de
Berechnung des Ratenbeispiels: ŠKODA KAROQ AMBITION 1,0 l TSI (85 kW), inkl. Sonderlackierung und Businesspaket Amundsen, unverbindliche Preisempfehlung
22.361,34 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungskosten. Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung
der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Nur gültig für gewerbliche Kunden und bei Bestellung bis zum 30.04.2019 bei teilnehmenden
Händlern. Bonität vorausgesetzt. Abbildung enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Preisstand 11/2018, Modellpreis-Änderungen vorbehalten.
*
10 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Tempolimit
Volvo hat eine Vision: Ab 2020 soll kein Mensch mehr in einem neuen Auto der Schweden getö-tet oder schwer verletzt werden. Weil zu schnel-
les Fahren einen besonders negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit habe, begrenzt Volvo ab 2020 die Höchstgeschwindigkeit in Pkw auf 180 km/h. Die Überwachung des Fahrers soll die Sicherheit weiter erhöhen. »Wir werden das Auto eingreifen lassen, wenn der Fahrer schlecht fährt«, sagte Håkan Samu-elsson, Präsident und CEO bei Volvo.
Kameras und Sensoren beobachten den Fahrer. Falls der die Augen schließt oder Schlangenlinien fährt, reduziert das System die Geschwindigkeit, bremst das Auto im letzten Schritt bis zum Stillstand ab und parkt automatisch ein. Anfang der 2020er-Jahre will Volvo das Überwachungssystem einführen.
Ab dem Modelljahr 2021 können Besitzer von Vol-vos mittels einer anderen Technologie die Höchstge-schwindigkeit ihres Fahrzeugs individuell beschrän-ken. »Wir wollen mit unseren Maßnahmen eine Diskussion darüber starten, ob Automobilhersteller das Recht oder vielleicht sogar die Pflicht haben, Tech-nik in ihren Autos zu installieren, die das Verhalten der Fahrer verändert oder Fehlverhalten wie zu schnel-les Fahren verhindert«, begründet Samuelsson die Aktionen. Aber sind die überhaupt notwendig?
Ab gewissen Geschwindigkeiten sind auch die besten Sicherheitstechniken in Fahrzeugen macht-los und können Unfälle mit Schwerverletzten und Todesfällen nicht mehr vermeiden. Das ist mit ein Grund dafür, dass es in den meisten Staaten Tem-polimits gibt, mit nur wenigen Ausnahmen. Deutsch-
Ist langsamer auch sicherer?
Ab 2020 begrenzt Volvo die Höchstgeschwindigkeit seiner
Autos auf 180 km/h. Die Schweden fühlen sich der Sicherheit
beim Fahren verpflichtet. Was wirklich dahintersteckt.
von Peter Ilg
Mai 2019 firmenauto 11
land ist die einzige Industrienation der Welt ohne durchgängiges Tempolimit auf Autobahnen. Keine grundsätzlichen Tempoobergrenzen bestehen außer-dem in Haiti und auf der britischen Isle of Man. In Schweden ist die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt. Aber Autos werden für globale Märkte gebaut, deshalb bringen es auch manche Volvo-Modelle auf 250 km/h. Damit soll nun Schluss sein, weil Volvo Sicherheit vorgeht. Ein PR-Gag ist die Selbstbeschränkung der Schweden keinesfalls
– sondern eine konsequente Fortsetzung der Unter-nehmensphilosophie, die Autofahren möglichst sicher macht. Ein Ingenieur der Schweden hat 1959 den ersten Sicherheitsgurt entwickelt, darauf ein Patent angemeldet, und noch im selben Jahr wur-den erstmals Sicherheitsgurte serienmäßig in Volvos
verbaut. Ganz uneigennützig gab Volvo das Patent für andere Hersteller frei.
Auch mit der Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit kann man Volvo nicht vorwerfen, damit einen Reibach machen zu wol-len. »Kurzfristig sehe ich durch die Maßnahme bei Volvo keinen Kostenvorteil durch Einsparungen in der Produktion der Autos,
Care Key
Volvo-Besitzer können künftig die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs über den jeweiligen Schlüssel begrenzen. Leihen sich Kollegen den Wagen aus, können sich diese nicht über das Tempolimit hinwegsetzen. Der neue Schlüssel kommt ab dem Modelljahr 2021 in allen neuen Volvo-Modellen serienmäßig zum Einsatz. Nutzer eines Care Key sollen auch finanziell profitieren. Volvo ist bereits mit ersten Versicherungen im Gespräch.
12 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Tempolimit
etwa im Fahrwerk«, sagt Thomas Schirle, Professor an der Hoch-schule Esslingen in der Fakultät für Fahrzeugtechnik. Etwas klei-nere Bremsscheiben und Bremssättel, leicht günstigere Reifen: Maximal 200 Euro pro Fahrzeug, vermutet Schirle, macht die Geschwindigkeitsreduktion Autos günstiger in der Herstellung.
Seiner Ansicht nach nehmen die Schweden mit ihrer Initia-tive mittel- bis langfristig wahrscheinlich nur das zwingend Notwendige vorweg: »Selbst 180 km/h sind für elektrisch ange-triebene Autos und fürs autonome Fahren schon eine sehr hohe Messlatte.« Sollte sich die Elektromobilität durchsetzen, wer-den Autos schon aus rein technischer Sicht langsamer, weil hohe Geschwindigkeiten kurze Reichweiten zur Folge haben. Und
wer will schon für den kurzen Hochgeschwindigkeitsrausch stundenlang an der Stromzapfsäule bitter büßen?
Unabhängig von der Art des Antriebs wirkt sich die maximal mögliche Geschwindigkeit sowohl positiv als auch negativ auf ein Fahrzeug aus. Werden zwei Autos – das eine aus 180 km/h, das andere aus 250 km/h – bis zum Stillstand abgebremst, dann fährt das schnellere Auto zu dem Zeitpunkt, wenn das langsa-mere schon steht, immer noch 180 km/h. Der Bremsweg beträgt im langsameren Fall 150 Meter, im schnelleren 280 Meter. »Die verheerenden Folgen bei Unfällen durch zu schnelles Fahren können mit niedrigeren Geschwindigkeiten deutlich reduziert werden«, ist der Professor überzeugt. Die heute starken Moto-ren seien eher dem Wunsch nach hoher Beschleunigung geschul-det, um mit den inzwischen schweren Autos flott zum Überho-len anzusetzen, als nach Top-Speed. Die negative Konsequenz aus dem ordentlichen Antritt ist: Um auf 250 km/h zu kommen, braucht man 2,5-mal so viel Motorleistung wie bei der Beschleu-
nigung auf 180 km/h. »Rein rechnerisch ist für die doppelte Geschwindigkeit die vierfache Energie not-wendig«, sagt Schirle. Und somit bläst man auch die vierfache Schadstoffmenge in die Luft.
Zurück zum steigenden Gewicht der Autos. Ein schwerer SUV mit voller Beladung erzeugt beim Aufprall auf ein Hindernis mit 250 km/h eine Wucht, die etwa zwei Drittel der Durchschlagskraft eines 40-Tonnen-Lastzugs entspricht. Aus 250 km/h kann ein SUV-Geschoss eine doppelt so starke Mauer durchbrechen wie aus 180 km/h. Die doppelte Masse eines Autos führt zur doppelten Durchschlagskraft.
Deshalb sind Auffahrunfälle am Stauende so gefährlich. Alle gängigen Crash-Vor-kehrungen sichern nur bis etwa 60 km/h ab. Was darüber hinausgeht, bleibt dem Schutzengel überlassen.
Sinkende Höchstgeschwindigkeit macht nach Meinung von Schirle das Fahren sicherer, senkt die Emissionen und kann Autos alltagstauglicher machen. »Wenn
Aggregate wie Motor, Bremsen, Achsen kleiner wer-den, hat man im Innenraum mehr Platz für die Pas-sagiere und Gepäck.« Denn ein Auto wachse mit grö-ßeren Aggregaten nach innen und nicht nach außen.
So viel zu den Fakten des schnellen Fahrens aus Ingenieurssicht. Seit Jahrzehnten wird in Deutsch-land regelmäßig über ein Tempolimit auf Autobah-nen diskutiert. Meist emotional und ohne wirkliches Wissen darüber, ob es einen möglichen Zusammen-hang zwischen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und Verkehrssicherheit gibt, weil keine umfassenden Studien vorliegen. Deshalb vertritt selbst der Deutsche Verkehrssicherheitsrat in diesem Fall keine eindeutige Position. Mangels Zahlenma-terial helfen Aussagen wie die des Professors, sich selbst eine Meinung zu bilden, kombiniert mit gesun-dem Menschenverstand.
Geringere Geschwindigkeit – weniger Unfälle
Eine umfassende Studie existiert nicht, aber es gibt Untersuchungen auf Autobahnabschnitten, auf denen nach einer Geschwindigkeitsreduzierung die Unfallzahlen deutlich zurückgingen. Zwischen den beiden Autobahndreiecken der A 24 Wittstock/Dosse und Havelland hat sich die Zahl der Unfälle in einem Dreijahreszeitraum von 654 auf 337 in etwa halbiert. Auf einem Abschnitt der A 4 zwischen Merzenich und Elsdorf wurde die Höchstgeschwindigkeit im Jahr 2017 ebenfalls auf 130 km/h begrenzt. In den drei Jahren zuvor gab es Unfälle mit neun Toten. Seit der Einführung des Tempolimits bislang keine mehr.
Rein rechnerisch ist für die doppelte Geschwindigkeit
die vierfache Energie notwendig.
Professor Thomas Schirle
Hochschule Esslingen
Jetzt neu in Deutschland: das Open-End Leasingmodell von ARI –
einem der weltweit führenden Flottenmanagement-Dienstleister.
Transparent, flexibel, wirtschaftlich. Mehr dazu in unserem Whitepaper.
www.OpenLeaseOpenMind.de
Mehr erwarten, alles bekommen. Mit ARI FlexLease.
ARI FlexLease ist ein Angebot der ARI Fleet Leasing Germany GmbH, Liebknechtstrasse 33, 70565 Stuttgart.
MANAGEMENT Lieferzeiten E-Autos
14 firmenauto Mai 2019
Ganz gleich, ob Sportwagen, Geländewagen oder Business-Limousine: Viele der im Frühjahr auf dem Genfer Autosalon gezeigten neuen Modelle
hatten einen Elektroantrieb unter der Haube. Exper-ten wie Professor Ferdinand Dudenhöffer attestieren deshalb auch den deutschen Herstellern den Willen, es nicht nur bei Ankündigungen zu belassen, sondern tat-sächlich die Energiewende einzuläuten.
Fakt ist: Die Hersteller könnten weltweit weit mehr Fahrzeuge mit Elektroantrieb verkaufen, wenn sie
denn welche hätten oder bauen könnten. Hyundai beispielsweise vertröstet Käufer eines elektrischen Kona gleich um ein ganzes Jahr. »Gerade der neue Kona Elektro wird mehr nachgefragt, als wir kurz-fristig liefern können«, bestätigt Sascha Behmer, Abteilungsleiter Gewerbekunden.
Hinter vorgehaltener Hand ist jedoch bei etlichen Herstellern zu hören, dass man bereits ausverkauft sei. Wenige Marken kommunizieren das so offen wie Volkswagen. Deren Händler nehmen wegen der Fo
tos:
Ad
ob
e St
ock
/Pat
hd
oc
(1),
Step
han
Klo
nk
(1)
Das lange WartenElektroautos sind als Firmenwagen begehrt, und viele Unternehmen wollen umsteigen.
Wer aber jetzt bestellt, muss bis zu einem Jahr warten. Woran liegt’s?
von Annett Boblenz
Mai 2019 firmenauto 15
großen Nachfrage nach dem e-Up schon gar keine Bestellungen mehr an.
Für die Fuhrparkeinkäufer ist das allerdings mehr als ärgerlich. »Wer heute versucht, E-Autos anzu-schaffen, muss feststellen, dass in vielen Fällen jen-seits von medialen Ankündigungen die Lieferfähig-keit extrem eingeschränkt bis nicht vorhanden ist«, klagt Marc-Oliver Prinzing vom Bundesverband Fuhrparkmanagement. Im Kleinwagensegment seien vor allem deutsche Hersteller 2019 ein Totalausfall.
Dabei sind gerade die kleinen Modelle prädesti-niert für die Elektromobilität. Zumindest, solange die Preise für große Akkus nicht drastisch sinken. Außer-dem passen kleine E-Autos zu vielen urbanen Ein-satzprofilen von Flottenbetreibern. Beispiel Pflege-dienste: Sie brauchen kleine und bezahlbare Autos, mit denen ihre Mitarbeiter im Stadtverkehr schnell und sauber unterwegs sind. Am Ende der Schicht geht’s an Ladestation oder Wallbox, damit der Akku am nächsten Tag wieder gefüllt ist.
Die Situation sei schon kurios, findet Prinzing. »Jah-relang wurde den Unternehmen vorgeworfen, zu wenig in Richtung E-Mobilität zu machen«, erklärt er. Er weiß, dass Betriebe und Flottenmanager die
Entwicklung interessiert beobachten. Und sie würden gern mehr elektrifizierte Autos bestellen. »Dank größerer Reichweiten wer-den die Autos ja immer alltagstauglicher«, so der Fuhrparkprofi. Allerdings werde oft vergessen, dass gerade im Volumenseg-ment der Kompakt- und Mittelklasse ein Elektroauto nicht nur dem betrieblichen, sondern auch dem privaten Fahrprofil gerecht werden muss. »Es fehlen einfach familientaugliche E-Fahrzeuge im Mittelklassesegment«, bedauert Prinzing.
Automobilexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg sieht die Probleme vor allem darin, dass speziell die deutschen Hersteller zu spät auf den Zug aufge-sprungen sind. »Die Technik ist noch in den Kinderschuhen, und da gibt es immer wieder Nachbesserungen, die Zeit kos-ten. Außerdem sind die Deutschen zu lange im Diesel gesessen und haben das Thema nicht ernst genommen.«
Dessen ungeachtet kündigte Volkswagen-Konzernchef Her-bert Diess an, in den nächsten zehn Jahren nicht wie geplant 50, sondern fast 70 neue E-Modelle auf den Markt zu bringen. 22 Millionen E-Autos will der VW-Konzern bis 2030 verkaufen
Wo bleiben die kleinen, bezahlbaren E-Autos
für den innerstädtischen Verkehr?
Umweltprämie
Noch bis Juni bezuschusst das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) den Kauf eines neuen Elektroautos (2.000 Euro netto) beziehungsweise Plug-in Hybriden (1.500 Euro). Maximaler Kaufpreis: 60.000 Euro netto. Den gleichen Betrag muss der Hersteller dazuschie-ßen, sodass der Käufer also 4.000 beziehungs-weise 3.000 Euro bekommt. Gefördert werden allerdings nur Plug-in Hybriden, die nach WLTP nicht mehr als 50 Gramm CO
2 pro Kilometer aus-
stoßen. Der gesamte Antragsprozess läuft on-line. Nach Eingang des Zuwendungsbescheids muss der Antragsteller das Auto innerhalb von neun Monaten zulassen. Eine Verlängerung der Frist ist laut Bafa nur in begründeten Ausnahme-fällen für maximal drei Monate möglich.
16 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Lieferzeiten E-Autos
Nissan Leaf In drei Monaten lieferbar
und den E-Anteil in der Flotte bis 2030 auf mindestens 40 Prozent steigern. Bis zum Jahr 2025 soll das den CO
2-Aus-
stoß der Flotte über den gesamten Lebenszyklus hinweg um 30 Prozent gegenüber 2015 reduzieren.
Ein ehrgeiziges Ziel. Andererseits meldeten sich bereits 20.000 Kunden als Interessenten für den ab Herbst bestell-baren Porsche Taycan, obwohl sie ihn noch nirgends fah-ren konnten. Ebenso viele reservierten einen Audi E-tron. Auch hier sind lange Wartezeiten programmiert. Noch spricht Audi von fünf Monaten. Laut einem Bericht des Baye-rischen Rundfunks laufen in Brüssel aber täglich nur 150 statt der geplanten 300 Modelle vom Band. Der Sender ver-mutet, dass LG Chem zu wenige Akkus liefern kann.
Die Engpässe bei Batterien sieht auch Marktexperte Dudenhöffer: »Die Zellen werden noch zwei bis drei Jahre knapp bleiben.« Um unabhängiger zu agieren, will der VW-Konzern eine eigene Batteriezellenfabrik bauen. Und bean-tragt gleich Fördergelder des Bundes. Außerdem fordert VW-Chef Diess mehr Förderung für E-Autos bis mindestens 2025, besonders für Geringverdiener und Kleingewerbe.
Denn dass Elektroautos für viele Unternehmen noch immer zu teuer sind, ist kein Geheimnis. Billiger werden sie erst, wenn wirklich große Stückzahlen von den Bändern rollen. Oder wenn die Hersteller unter Druck geraten ange-sichts der ambitionierten CO
2-Vorgaben der EU-Kommis-
sion. Wer die künftig nicht einhalten kann, muss ab 2021 hohe Strafen zahlen. Dudenhöffer hat berechnet, dass jedes verkaufte Elektroauto bis zu 10.000 Euro Strafzahlungen vermeiden könnte. Man könnte also Taktik dahinter ver-muten, dass sich die Hersteller derzeit noch so zurückhal-ten und Auslieferungen möglichst bis 2020 hinausschieben. Warum sonst kann man die meisten der angekündigten neuen Modelle frühestens ab Herbst 2019 bestellen?
Das große Interesse an
unseren E-Autos freut uns
einerseits, es stellt uns aber
auch vor Herausforderungen.
Sascha Behmer
Leiter Gewerbekunden Hyundai
und den
BMW 225xe Zwei Monate Wartezeit
Tesla Model 3 Zwei Monate Lieferzeit
PEUGEOT GEWERBEWOCHEN
01.03. – 30.04.2019
SORGLOS KANN SO EINFACH SEIN
229 € NETTO/MONAT SORGLOS-LEASING INKL. BUSINESS PAKET1
PEUGEOT 308 SW
PEUGEOT 3008255 € NETTO/MONAT SORGLOS-LEASING INKL. BUSINESS PAKET1
Abb. enthält Sonderausstattungen.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 4,6–3,7; CO2-Emission (kombiniert) in g/km 120–97; Energieeffizienzklasse: A–A+.
Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben.
Die Steuern berechnen sich von diesen Werten abweichend seit dem 01. 09. 2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informiert Sie Ihr PEUGEOT Partner.1Unverbindliches Free2Move Lease Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem
Fuhrpark < 50 für den PEUGEOT 3008 Active BlueHDi 130 – 255 € netto/Monat und für den PEUGEOT 308 SW Active BlueHDi 130 – 229 € netto/Monat; zzgl. 19 % MwSt., zzgl.
Überführungs- und Zulassungskosten, ohne Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, 10.000 km/Jahr Laufleistung. Inkl. Garantieverlängerung, Wartung und Verschleiß gemäß den
Bedingungen des PEUGEOT optiway ServicePlus-Business-Vertrages. Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss ab sofort bis auf Widerruf, längstens bis 30.04.2019. Änderungen
und Irrtümer vorbehalten.
Nur für Gewerbetreibende
2Gemäß ADAC Ecotest,
Ausgabe April 2018
Mehr Infos unter:
free2move-lease.de
DIESEL MIT BESTWERTEN UNTER REALEN BEDINGUNGEN2
18 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Lieferzeiten E-Autos
VW e-Up Ausverkauft, VW nimmt keine Bestellungen entgegen
Kia e-Niro Ein Jahr Lieferzeit
Smart Forfour EQ Sieben Monate Lieferzeit
»Spätestens im Januar 2022 werden die Preise einbre-chen«, prognostiziert Dudenhöffer. »Dann muss die Auto-industrie die von der EU geforderten 95 Gramm CO
2 lie-
fern, oder hohe Strafen fallen an. Die Autobauer müssen dann quer subventionieren. Ich gehe davon aus, dass dies bis zu 5.000 Euro beim Elektroauto ausmachen kann. Das wäre immer noch billiger als die Strafzahlungen.«
Unbeeindruckt von den aktuellen Lieferschwierigkei-ten pusht die Bundesregierung die E-Mobilität in gewohn-ter Manier. Nachdem die Umweltprämie mehr als schlep-pend anlief, sind mittlerweile über 100.000 Anträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eingegangen. Offiziell läuft die Förderung im Juni aus. Doch laut der Pressesprecherin Christiane Fuckerer ist eine Verlängerung des Förderprogramms in Planung. Auch hier könnten lange Lieferfristen Probleme bereiten, denn sobald das Bafa den Umweltbonus zugesagt hat, muss der Käufer das Auto innerhalb von sechs Monaten zulas-sen. Wird es nicht rechtzeitig geliefert, verfällt der Bonus.
Und dann zündete die Bundesregierung zum Jahres-beginn mit der um 50 Prozent ermäßigten Dienstwagen-steuer für E-Autos und Plug-in Hybriden eine weitere Subventionsstufe. Sie sorgte bei etlichen Marken für den gewollt stärkeren Run auf die elektrifizierten Modelle, wie Volvo-Sprecher Michael Schweitzer bestätigt. »Sie hat auch bei uns noch einmal zu einem deutlichen Anstieg der Bestellungen von Plug-in Hybriden geführt.«
Aus Sicht der Fahrer ist das natürlich nachvollziehbar. Aus unternehmerischer Sicht aber bedeutet der teurere
Fahrzeugbestand in Deutschland
Am 1. Januar 2019 waren in Deutschland 47,1 Millionen Pkw zugelassen, davon verschwindend wenige elektri-fizierte Autos. Im Vergleich zu 2017 wuchs der Anteil an E-Autos aber prozentual am stärksten.
Benzin 65,8 %31,03 Mio Stk.
+ 1,9 %
Diesel 32,1 %15,16 Mio Stk.
– 0,5 %
Erdgas 0,2 %80.776 Stk.
+ 7,0 %
Flüssiggas 0,8 %395.592 Stk.
+ 6,1 %
Plug-in Hybride 0,2 %66.997 Stk.
+ 50,8 %
Elektro 0,2 %83.175 Stk.
+ 54,4 %
Hybrid 0,7 %341.411 Stk.
+ 44,2 %
B D
CNG
LPG
Kia Ein JaEin Ja
SETZT SICHERHEIT GANZ OBEN AUF DIE AGENDA.
DER VOLVO V60 SERIENMÄSSIG MITLENKUNTERSTÜTZUNG BEI AUSWEICHMANÖVERN.
BUSINESS AUF SCHWEDISCH.
VOLVOCARS.DE/FLEET
INNOVATION MADE BY SWEDEN.
20 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Lieferzeiten E-Autos
Plug-in-Firmenwagen in erster Linie nur höhere Kosten. Vor allem bei ladefaulen Fahrern. »In vie-len Fuhrparks sorgt die subventionierte Versteue-rung von E-Autos eher für Unruhe als für einen positiven Anreiz«, sagt Prinzing. Vielfahrer sind in der Regel mit einem Diesel besser bedient, den sie jedoch voll versteuern müssen. Und Mitarbei-ter, die lange Anfahrtswege von zu Hause zum Arbeitsplatz zurücklegen müssen, profitieren besonders. »Aber genau dafür sind Plug-in Hybriden nicht die richtige Antriebsart, weder aus wirtschaftlicher noch aus ökologischer Sicht. Das führt in vielen Unternehmen zu unschönen Diskussionen«, bedauert Prinzing.
Lange Lieferzeiten sind ein großes Ärgernis für jedes Unternehmen. Der Fuhrparkverband for-dert deshalb, dass Hersteller und Importeure Markteinführungstermine und Verfügbarkeiten offener kommunizieren, denn Fuhrparkverant-wortliche brauchen eine stichhaltige Planungs-grundlage. Ansonsten steigt der Frust. Wie bei dem Berliner Fuhrparkmanager, der sich kürz-lich bei firmenauto meldete, aber nicht genannt werden wollte. Kurz vor der geplanten Ausliefe-rung seines sechs Monate zuvor bestellten e-Golf erfuhr er, dass er noch einmal sechs Monate war-ten solle. Die Batterieproduktion mache Probleme.
LieferzeitenMarke Modell Lieferzeit
e-Tron 4 Monate
i3
2–3 Monate225xe iPerformance
530e iPerformance
745e iPerformance
Life 10 Monate
Kona Elektro 12 Monate
Ionic Plug-in Hybride Ionic Elektro
Mj. 2019 im Handel vorrätig; für Mj. 2020 keine Angaben
I-Pace 3–4 Monate
e-Niro 12 Monate
Niro Plug-in Hybride 5 Monate
e-Soul ab April bestellbar
Optima Plug-in Hybride 6 Monate
Range Rover P400 PIH 3–4 Monate
C 300 de
7 MonateE 300 e
E 300 de
S 560 e 3 Monate
EQC ab Herbst bestellbar
Outlander Plug-in Hybride 6 Wochen
Leaf 3 Monate
e-NV200 6 Monate
Ampera-e 2–3 Monate
Corsa-e ab Mai bestellbar
Panamera 4 E-Hybrid keine Aussage
Cayenne E-Hybrid keine Aussage
Taycan ab Herbst bestellbar
Zoe 2 Monate
Kangoo Z.E. 3 Monate
Kangoo Z.E. (lang) 4 Monate
EQ Fortwo7 Monate
EQ Forfour
Model 3 2 Monate
Model S 2 Monate
Model X 1 Monat
Prius Plug-in Hybride 4 Monate
Mirai 6 Monate
V60 T8
Mj. 2019 ausverkauft; Mj. 2020 Auslieferung ab Mai
V90 T8
XC60 T8
XC90 T8
e-Up nicht lieferbar
e-Golf 6 Monate
Golf GTE ab Juli wieder bestellbar
Passat (Variant) GTE ab Juli wieder bestellbar
Elektrifizierung bei Vattenfall
Der Energieversorger Vattenfall verpflichtete sich 2017, den kompletten Fuhrpark mit 4.500 Pkw und leich-ten Nutzfahrzeugen auf Elektroantrieb umzustellen. Mittlerweile sind unternehmensweit 34 Prozent aller ungebrandeten sowie 21 Prozent aller gebrandeten Ge-schäftsfahrzeuge elektrifiziert. Aber auch das Vattenfall-Flottenmanagement hat Schwierigkeiten, Fahrzeuge zu bestellen, beziehungsweise hadert mit langen Warte-zeiten. So werden laufende Leasingverträge verlängert oder Bestandsfahrzeuge als Übergangslösung genutzt.
2022 werden die Preise für
E-Autos einbrechen, denn dann
müssen die Hersteller die 95
Gramm CO2-Flottenausstoß liefern.
Dazu brauchen sie Stückzahlen.
Automobilexperte
Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer
Anzeige
Aus Frust orderte er einen BMW i3. Der soll schon nach 2,5 Monaten auf dem Parkplatz stehen.
Auch die Autorin wartet schon seit geraumer Zeit auf die Zusage eines verbindlichen Auslie-ferungstermins ihres Smart EQ. Was umso erstaunlicher ist, als der Wagen Teil einer von EnBW bereits Ende 2018 bestellten Marge von 100 Stück ist. Dass der Händler dem Kunden eine vage Auslieferung »zwischen März und Juli« in Aussicht stellt, lässt die Vorfreude auf das Auto deutlich schrumpfen.
Für Profis wie Prinzing ist klar: »Geht eine Bestellung mehrmals schief, wenden sich die Ent-scheider von der E-Mobilität ab und legen sich auf Jahre auf andere Antriebe fest.« Das gelte besonders für Unternehmen, die Fahrzeuge lea-sen und sich drei und mehr Jahre binden. Ver-brannte Erde kann also nicht im Interesse der Hersteller sein. Schließlich müssen sie am Ende die strengen EU-Vorgaben einhalten.
Die ehrliche Wartungspauschale nach Herstellervorgaben
A.T.U bietet den Flottenkunden Transparenz, Effi zienz und Preiswürdigkeit durch die Wartungspauschale. Durch defi nierte Laufzeiten und Laufl eistungen verbessert sich die Kalku-
lierbarkeit der Fuhrparkkosten. Neben diesen transparenten monatlichen Fixkosten profi tieren Fuhrparkleiter auch durch ein sofort realisierbares, erhebliches Einsparpotential.
Jetzt informieren unter +49 (0) 961 6318 6666
Inspektion und Wartung
nach Herstellervorgaben
Prüfung nach den
Unfallverhütungsvorschriften (UVV)Verschleißbedingte Reparaturen WARTUNGSPAUSCHALE pro Monat1
z.B. Audi A4 2.0 TDI € 16.50
(1) Vertragslaufzeit: 36 Monate/Gesamtlaufl eistung 60.000 km. Gilt für Fahrzeuge nicht älter als 6 Monate ab Erstzulassung. Preis zzgl. MwSt. Mtl. Rate enthält folgende Leistungen: Inspektion nach Herstellervorgaben, alle verschleißbedingten Wartungsarbeiten inkl. Material/Öl, welches A.T.U im Sortiment führt, HU/AU (Gilt nur für PKW bis 3,5 t, gilt nicht für vertiefte Prüfung gem. § 29 Abs. 1 StVZO i.V.m. Anlage VIIIa Nr. 2.2. Durchführung der Hauptuntersuchung durch eine amtlich anerkannte Prüf-Organisation. Durchführung der Abgasuntersuchung durch A.T.U), DGUV Vorschrift 70 Prüfung und europaweite Mobilitätsgarantie. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei A.T.U. Alle Angebote erfolgen für die A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Dr.-Kilian-Str. 11, 92637 Weiden und gelten für alle deutschen A.T.U-Filialen. Angebot gilt für Gewerbekunden von A.T.U Flottenmanagement.
www.atu.de/fl otte
22 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Restwerte E-Autos
Erst die Henne, dann das Ei. 2018 erreichten reine Elektroautos erstmals einen Anteil von einem Pro-zent bei den Neuzulassungen. Der Bestand klet-
terte über die 80.000er-Marke, und mit dem Auf-schwung wächst folgerichtig auch der Gebrauchtmarkt. Beobachten lässt sich das sehr gut an Deutschlands meistgekauftem Elektroauto, dem Renault Zoe. Für Sta-tistiker bietet er den großen Vorteil, auf beiden Ver-kaufsflächen eines Händlers zu stehen: nicht nur bei den Neuwagen, sondern auch bei den Gebrauchten. So führte das Renault-Gebrauchtwagenportal Ende März mehr als 370 Renault Zoe auf. Der Stromer befüllt auch die Listen der bekanntesten Internetportale. Bei Heycar standen zum genannten Zeitpunkt gut 400 gebrauchte Renault Zoe zum Verkauf, bei Mobile etwa 890 und bei Autoscout mehr als 680.
Auch im B2B-Geschäft, dem Handel zwischen Gewerbetreibenden, wächst das Zweitmarktvolumen der Stromer. Elektroautos sind mittlerweile in den Flotten angekommen, werden von Unternehmen geleast und gelangen nach Vertragsablauf in die Wie-dervermarktung. Den größten Marktplatz für den gewerblichen Handel mit gebrauchten Autos betreibt das ursprünglich britische Unternehmen BCA. Der
Anbieter von B2B-Auktionen war hierzulande 1997 gestartet und ist heute Marktführer. Als solcher, so eine alte Kaufmannsregel, setzt man Trends. Die Branche registrierte daher interessiert, dass BCA Anfang des Jahres erstmals eine Auktion mit einigen Renault Zoe aus dem Jahr 2015 startete. Die Autos waren durchweg ausgestattet mit einer Kaufbatterie.
Für BCA-Marketingleiter Maximilian Ebert ist genau das ein wichtiges Kriterium. »Autos mit Kauf-batterie werden im B2B-Bereich derzeit deutlich stär-ker nachgefragt. Um das Interesse und die langsam steigende Nachfrage zu bedienen, haben wir begon-nen, dieses Fahrzeugsegment verstärkt anzubieten.« Für Ebert sind Elektroautos und deren Zweitmarkt ein wichtiges Thema in der künftigen Vermarktungs-strategie. Nach der ersten nationalen Auktion will BCA künftig auch über seine internationale Plattform Elektroautoauktionen anbieten. Und zwar monatlich, denn laut Unternehmensangaben lief der Erstversuch erfolgreich ab.
Einlieferer der März-Auktion war das Münchner Leasing- und Fuhrparkmanagementunternehmen Alphabet. Der Dienstleister bietet Elektromobilitäts-lösungen an, die über die reine Fahrzeugwahl hinaus- Fo
tos:
Kar
l-H
ein
z A
ug
ust
in (1
)
Mai 2019 firmenauto 23
Von wegen Elektroschrott
Der Gebrauchtmarkt für Elektroautos nimmt Fahrt auf. Auf Leasingangebote
und Restwerte hat das ebenso Einfluss wie auf die Preise von Neuwagen.
gehen. Umsetzung und Nutzung geeigneter Lade-infrastrukturen gehören ebenso ins Portfolio wie das Ermöglichen der Inanspruchnahme unterschied licher Förderprogramme. Vertriebs- und Marketingleiterin Susan Käppeler geht davon aus, dass ihr Unterneh-men im laufenden Jahr etwa 2.500 Elektroautos und Plug-in Hybriden weitervermarkten wird. »Tendenz steigend, weil wir ein immer höheres Interesse an der Elektromobilität feststellen«, so Käppeler. Kom-men die Autos in die Zweitvermarktung, zeigt sich zuweilen ein anderer Status quo als bei konventio-nellen Fahrzeugen. »Die Leasingverträge von Elek-troautos und Plug-in Hybriden weisen bei den meis-ten unserer Kunden aktuell geringere Laufzeiten und Fahrleistungen auf als vergleichbare Verbrenner-modelle«, weiß Käppeler.
Solche Erfahrungen sind für Fuhrparkanalysten wichtige Datenbasis, denn beim Thema Leasing-rücknahme und Zweitvermarktung steht meistens eine Zahl im Vordergrund des Interesses: der Rest-wert. Für Maarten Baljet, Geschäftsführer von BF Analytics bei dem Prognosedienstleister Bähr & Fess, ist der Restwert ohnehin »der größte Bestandteil der Total Costs of Ownership«. Die sich abzeichnende
von Alex Mannschatz
Steuervorteil auch für gebrauchte Stromer
Die private Nutzung von Firmenelektroautos wurde in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) neu geregelt. Er betrifft E-Autos oder Plug-in Hybride, die nach dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2022 angeschafft wurden oder werden. Zur Versteuerung des geldwerten Vorteils der privaten Nutzung wird der Listenpreis dieser Autos seit diesem Jahr zur Hälfte angesetzt. Die Steuerlast ist gegenüber der herkömmlichen Ein-Prozent-Methode für Verbrennerfahrzeuge damit halbiert. Da das Gesetz ausdrücklich von der »Anschaffung«, nicht aber von der »Neuzulassung« spricht, gilt diese Vorteilsregel auch für gebrauchte Elektroautos. In Deutschland wechselten im vergangenen Jahr 8,6 Millionen Kfz den Besitzer, etwa ein Prozent weniger als im Vorjahr. Der Dieselanteil lag bei 31,6 Prozent, Benziner machten fast zwei Drittel des Marktvolumens aus. Der Anteil an alternativen Antrieben (Gas, Hybrid, Elektro) lag bei 1,8 Prozent, wobei die größte Steigerungsrate bei den gebraucht gehandelten E-Autos zu verzeichnen war (plus 28 Prozent). Insgesamt fanden laut Kraftfahrtbundesamt im vergangenen Jahr knapp 7.500 Elektroautos einen neuen Besitzer. 2017 waren es nur 5.850 gewesen. Die ersten Zahlen für 2019 lassen einen weiteren deutlichen Anstieg von E-Auto-Besitzumschreibungen erwarten. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden bereits 1.513 gebrauchte Stromer umgeschrieben. Auch der Bestand wächst stetig weiter. Im Januar waren in Deutschland 83.175 Elektro-Pkw zugelassen, 54,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
24 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Restwerte E-Autos
Dynamik auf dem Elektroautomarkt werde zwangsläufig Auswirkungen auf die Rest-werte haben. Noch hinke allerdings manchmal der Vergleich. »Die Stromer müssen sich eben in der Summe ihrer Eigenschaften gegen Verbrennungsmoto-ren behaupten«, sagt Baljet. Nur sauber reicht nicht. Sie müssen auch praktikabel sein und vor allem wirtschaftlich. Das wer-den E-Autos in zunehmendem Maße. Ein Grund dafür sind die günstigeren Repara-tur- und Unterhaltskosten: weniger war-tungsintensive Technik, geringere Steu-ern. »Elektroautos haben daher sogar das Potenzial, wertstabiler zu werden als Ben-
zin- und Dieselfahrzeuge, sofern sich die Rahmen-bedingungen weiter in die eingeschlagene Richtung bewegen«, konstatiert Baljet.
Restriktionen für Benziner und Diesel, Kraftstoff-verteuerung, Reichweitenverbesserung oder ein besseres und wirtschaftlicheres Batterierecycling: All dies seien zunehmend Argumente pro Elektro, die sich auch in den Restwerten niederschlügen. Baljet sieht noch einen Aspekt, der bisherige Markt-schemata verschieben könnte: das Image. »Mög-licherweise werden sich am Markt eingefahrene Ima-gestrukturen verändern. Manche Hersteller werden durch ihre Elektrostrategie und die entsprechenden Autos ihr Image verändern.« Auch dies sei ein Fak-tor für die Restwertbestimmung.
Betriebskosten von Elektroautos im Vergleich zu Dieselmodellen
Antrieb 2 × Elektromotor, Akku: 95 kWh, Allradantrieb
Leistung 408 PS; 664 Nm; 0–100 km/h: 6,6 s; Vmax: 200 km/hWLTP-Verbrauch/CO
2 22,6 kWh/0 g
Grundpreis 67.143 EuroRestwert (3 Jahre/60.000 km) 39 %
Festkosten in Euro/Jahr
Festkosten in ct/km 113,6
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 6,3Reifen 3,3Wartung und Reparatur 7,1Summe variable Kosten 16,6Gesamtkosten2) 130,2 ct/km
Antrieb 2.967 cm3; 6 Zylinder; AllradantriebLeistung 286 PS; 600 Nm; 0–100 km/h: 6,3 s; Vmax: 241 km/hWLTP-Verbrauch/CO
2 8,2 l D; 216 g
Grundpreis 56.555 EuroRestwert (3 Jahre/60.000 km) 48,2 %
Festkosten in Euro/Jahr
Festkosten in ct/km 90,7
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 8,5Reifen 3,3Wartung und Reparatur 7,1Summe variable Kosten 21,5Gesamtkosten2) 112,2 ct/km
Antrieb Elektromotor, Akku: 39,2 kWh, FrontantriebLeistung 136 PS; 395 Nm; 0–100 km/h: 9,7 s; Vmax: 155 km/hWLTP-Verbrauch/CO
2 15,0 kWh/0 g
Grundpreis1) 28.017 EuroRestwert (3 Jahre/60.000 km) 34,5 %
Festkosten in Euro/Jahr
Festkosten in ct/km 53,6
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 4,2Reifen 3,1Wartung und Reparatur 5,2Summe variable Kosten 12,5Gesamtkosten2) 66,1 ct/km
Antrieb 1.598 cm3; 4 Zylinder; FrontantriebLeistung 136 PS; 320 Nm; 0–100 km/h: 10,2 s; Vmax: 191 km/hWLTP-Verbrauch/CO
2 5,3 l D; 141 g CO2
Grundpreis 22.294 EuroRestwert (3 Jahre/60.000 km) 45,1 %
Festkosten in Euro/Jahr
Festkosten in ct/km 42,6
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 5,5Reifen 3,1Wartung und Reparatur 6,9Summe variable Kosten 15,5Gesamtkosten2) 58,1 ct/km
Audi e-Tron55 Quattro
Audi Q750 TDI Quattro
Hyundai KonaElektro Style
Hyundai Kona1.6 CRDi DCT StyleD D
Die Betriebskosten von E-Autos sind bisher vor allem wegen hoher Fixkosten noch nicht konkurrenzfähig zu vergleichbaren Modellen mit Dieselmotor. Das liegt zum einen an den hohen Anschaffungskosten, zum anderen auch am hohen Wertver-lust. Die Restwerte von E-Autos sind wegen der unvorhersehbaren Akkuweiterentwicklung niedriger als bei Dieselmodellen.
Herstellerangaben, Motoren erfüllen Euro 6d-Temp; ¹)4.000 Euro Elektrobonus abgezogen 2) Bei 20.000 km/36 Monaten Laufzeit. Berechnet von
Restwerte berechnet von
Mai 2019 firmenauto 25
Anzeige
RESTWERT-FAKTOREN BEI ELEKTROAUTOS
• Preiseentwicklung von Elektroautos im Vergleich zu Modellen mit Verbrennungsmotor
• Entwicklung des Strompreises im Vergleich zum Spritpreis• Garantie und Haltbarkeit der Akkus• Gesetzliche Rahmenbedingungen • Reichweite• Infrastrukturentwicklung• Herstellerimage• Batterierecycling Quelle: BF Forecasts
Bleibt die Sache mit den Preisen. Auch sie haben großen Einfluss auf die Restwertprognosen. Im Han-del justiert sich derzeit das Gefüge zwischen Angebot und Nachfrage neu. Noch sind Elektroautos ein eher seltenes Gut. Rabattschlachten wie bei den Verbren-nern sind daher bisher noch unbekannt. Das ändert sich, wenn nun junge Gebrauchte das Angebot nen-nenswert erweitern. »Denn der Wettbewerber des Gebrauchten ist immer der Neuwagen mit Rabatt«, erklärt Baljet. Und umgekehrt: Junge Gebrauchte stehen im Preiskampf mit Leasing- und Finanzierungs-angeboten. Erst- und Zweitmarkt beeinflussen sich gegenseitig, beim Stromer wird das nicht anders sein als beim Verbrenner. Zumindest das verleiht der Elektromobilität ein Stück Normalität.
Was macht die TOTAL Card zur perfekten Assistentin für Ihre berufliche Mobilität?Gern beraten wir Sie zu Produkten und Services.Telefon: 030 2027- 8722 · www.totalcards.de
TOTAL Tankkarten für den kleinen und großen Fuhrpark
26 firmenauto Mai 2019
TITELTHEMA Leasing
Die Leasingbranche konnte 2018 das hohe Vorjahres-niveau beibehalten. Laut dem Bundesverband deut-scher Leasing-Unternehmen (BDL) waren 39,7 Pro-
zent der 2017 neu zugelassenen Autos geleast. Damit blieb die Quote gegenüber dem Vorjahr quasi unverändert.
In die Zukunft schaut der BDL hingegen skeptisch. Viele konkurrierende Antriebskonzepte und Unsicherheiten bei den Dieselrestwerten sorgen weiterhin für die wenig rosige Prognose. Viele Leasinggesellschaften nutzen diese Un sicherheit im Markt für neue Angebote. Die Deutsche Bahn Connect etwa bietet unter dem Namen Fuhrpark-management plus Kauffuhrparks eine Restwertgarantie und die Wiedervermarktung der Fuhrparkautos an. Mit Leasing allein ist es also nicht mehr getan, viele Anbieter
stehen gerade vor dem Schritt hin zum Mobilitäts-dienstleister. Immer mehr Unternehmen haben die gesamten Mobilitätskosten im Blick, der Fokus rein auf die Pkw verliert sich etwas.
Arval entwickelt gerade solche Budgetlösungen, andere Leasinggesellschaften sind noch nicht ganz so weit. Viele Unternehmen beschränken sich auf Corporate Carsharing, so seit letztem Jahr auch ALD. »Mit der neuen Lösung können Unternehmen ihren Mitarbeitern Poolfahrzeuge sowohl zur gewerblichen als auch privaten Nutzung anbieten und somit ihre Fahrzeuge effizienter auslasten sowie die Mobilitäts-kosten senken«, fasst ALD-Geschäftsführer Karsten Rösel die Vorteile zusammen.
Sixt geht noch einen Schritt weiter und bündelt alle Mobilitätsdienste in einer einzigen App. Über eine Schnittstelle können so die Reisedienste integriert werden. Nutzer der App können neben Mietwagen und Sharing-Autos auch Fahrdienste buchen. Der öffentliche Nahverkehr soll bald folgen. Beinahe selbst-verständlich ist für die Münchner da der digitale Bestellprozess, der komplett online funktioniert. Andere entwickeln diesen Service gerade für Unter- Fo
to: A
do
be
Sto
ck/B
ug
hd
arya
n
Lässig leasenDie Leasingbranche ist im ständigen Umbruch.
Mobilitätsbudgets, flexible Laufzeiten und neue
Antriebe machen die Angebote vielseitig wie nie.
von Immanuel Schneeberger
Mai 2019 firmenauto 27
nehmenskunden neu. »Bestellung, Bonitätsprüfung und Onlinelegitimation erfolgen noch 2019 komplett digital – die Zulassung und Auslieferung an die Wunschadresse des Kunden übernehmen wir«, so Karsten Rösel von ALD.
Viele Leasinggesellschaften wollen die Prozesse nicht nur vereinfachen und digitalisieren, sondern auch flexibilisieren. Der neue Bilanzierungsstandard IFRS 16 betrifft zwar laut der Leasinganalyse 2018 von Dataforce nur wenige Fuhrparks, doch gleichzeitig
weiß fast die Hälfte der befragten Fuhrparkleiter nicht, nach welchem Standard ihr Unternehmen bilanziert.
Dem Trend zu Langzeitmiete und flexibleren Fahrzeugwech-seln trägt beispielsweise Ari Fleet Rechnung. Mit Flexlease ver-spricht das Unternehmen flexible Laufzeit ohne Mehrkilometer-abrechnung, ohne Minderwerte bei Vertragsende und mit vollen Vermarktungserlösen. Möglich macht’s eine Abrechnung der modular buchbaren Services auf Ist-Kostenbasis. Nach eigenen Angaben verdient Ari nur an der festen Dienstleistungsgebühr.
Doch nicht nur mehr Flexibilität fordert die Anbieter, sondern auch der zu erwartende Umschwung hin zu mehr Elektromobili-tät. Mit den ab Ende 2019 erhältlichen neuen E-Autos werden die Stückzahlen schnell steigen. Lease Plan nimmt derzeit viele Tesla Model 3 in die Flotte auf, doch auch kleinere Anbieter reagieren auf die neue Verfügbarkeit. Kazenmaier aus Karlsruhe etwa bie-tet Fördermöglichkeiten für die Einführung von E-Fahrzeugen. Im Programm »Saubere Luft« ergänzen diese Angebote die Option, den Umweltbonus über die Leasingfirma abzurechnen. Vor allem für die Klimabilanz eines Unternehmens ist der Fuhrpark ein wichtiger Hebel. X-Leasing etwa kompensiert für alle Neuver-träge 2019 den CO2-Ausstoß, Kunden können das gegen Geld schon seit 2007 tun. Dank hohem E-Auto-Anteil tut sich das Unter-nehmen damit aber auch leichter als mancher Mitbewerber.
Das Who is Who der Leasinggesellschaften
Nur wer alle Zahlen offenlegt, schafft es in unsere jährliche Leasingmarktübersicht. Dem wollten einige Gesellschaften nicht nachkommen. Wer alle wichtigen Player des Markts sucht, sollte einen Blick in unser »Who is Who Pkw 2019« werfen. Dort sind alle Gesellschaften gelistet – teils auch mit umfangreichen Porträts. Online finden Sie das Who is Who unter firmenauto.de/wiw
Das Nachschlagewerk für Flottenmanager
Adressen und Firmenporträts von Pkw- und Reifenherstellern, Dienstleistern und Software-Anbietern
PKW 2019
www.firmenauto.de
Unterstützt von
Top 10 der firmenauto-ÜbersichtLeasinggesellschaft Vertragsbestand
2017Vertragsbestand
2018Änderungen
Volkswagen Leasing 1.386.000 1.487.000 +7,3 %Alphabet 160.909 181.918 +13,1 %ALD Auto Leasing 154.785 167.964 +8,5 %Santander Cons. Leasing 135.818 159.314 +17,3 %
Deutsche Leasing 143.362 145.412 +1,5 %
Sixt Leasing 122.600 120.100 −2,0 %Athlon k. A. 95.000 k. A.Arval 75.412 78.429 +4,0 %Free2move 69.981 74.900 +7,0 %Ari Fleet Leasing 41.984 59.324 +41,3 %Basierend auf den Gesellschaften, die Zahlen für die Umfrage nannten. Quelle: Unternehmensangaben
Insgesamt wuchs die Leasingbranche auch 2018 wieder. Einziger Ausreißer in der Top 10 ist Sixt Leasing. Die Münchner mussten nach einem rasanten Wachstum 2017 nun einen leichten Dämpfer einstecken. Bei Athlon sind nun die Deutschlandzahlen von Daimler Fleet mit dabei, deswegen ist kein Vergleich zum Vorjahr möglich.
28 firmenauto Mai 2019
TITELTHEMA Leasing
Non CaptivesAdesion Leasing ALD Auto Leasing
DeutschlandARI Fleet Leasing
GermanyArval Deutschland
Mutterkonzern Autobank Société-Générale-Gruppe Holman Enterprise BNP Paribas
GeschäftsgebietDeutschland • • • •
Europa – • • •
Kundenstruktur DeutschlandFirmenkunden 2.000 5.000 74 1.200Flotten >10 Autos 50 k. A. 67 k. A.
Mindestflottengröße 1 1 50 1
Stärkste Marken im BestandVW/Audi 20 %,
BMW 15 %, Porsche 10 %
k. A.VW 27 %,
Mercedes 22 %, Ford 18 %
VW 24 %, Mercedes 15 %,
BMW 13 %Vertragsneugeschäft 2018 in DeutschlandNeuverträge 2.000 30.865 17.548 22.123
LeasingFull-Service-Leasing 200 k. A. 0 k. A.Finanzleasing 1.800 k. A. 500 k. A.
Reines Fuhrparkmanagement 0 k. A. 17.048 k. A.
Vertragsgesamtbestand 2018 4.200 167.964 59.824 78.429Veränderung zum Vorjahr +5,0 % +8,5 % +42,5 % +4,0 %
davon
Full-Service-Leasing 2018 400 k. A. 0 k. A.Veränderung zum Vorjahr 0 % k. A. – k. A.Finanzleasing 2018 3.800 k. A. 500 k. A.Veränderung zum Vorjahr +5,6 % k. A. k. A. k. A.Fuhrparkmanagement 0 74.968 59.324 k. A.Veränderung zum Vorjahr – +12,5 % +41,3 % k. A.
Angebote allgemeinKonfigurator auf DW-Regelung abgestimmt • • • •
Full-Service-Leasing • • • •
Fuhrparkmanagement – • • •
Fuhrparkanalyse • • • •
Rechnungsprüfung • • • •
Führerscheinkontrolle – • • •
Tankkarte • • • •
Spesenabrechnung • • – –
SchadenmanagementWerkstattbindung – •, frei wählbar • •
Rechnungskontrolle • • • •
Fahrzeugrücknahme zertifiziert – • • •
Partner Gutachter, Händler Dekra, PS-Team verschiedene verschiedeneMehr-/Minder-km gleicher Satz – • – –ElektromobilitätE-Autos/Plug-in Hybriden/Brennstoffzellenfahrzeuge •/•/– •/•/• •/•/• •/•/•
Hilfe Aufbau Ladeinfrastrukturim Unternehmen – • • •
beim Mitarbeiter – • • •
Reporting Stromverbrauch – – • •
Ladekarteregional – – • •
bundesweit – – • •
MobilitätsdienstleistungenCorporate Carsharing – • • •
Langzeitmieteim Angebot – • • •
Laufzeit min./max. – 1 Tag/unbegrenzt 1 Monat/>12 Monate 1 Monat/24 MonateMobilitätsbudget – ALD Carsharing – Arval Mobility Link
Kostenloser Ersatzwagen Unfall oder Reparatur •• bei Reparatur/
– bei Unfall• •
• ja; – nein; k. A. = keine Angaben; ¹)Oberösterreich; Pflichtangaben: Neugeschäft 2018 insgesamt, Gesamtbestand, Anzahl Firmenkunden, Mindestflottengröße.
Mai 2019 firmenauto 29
Consors Finanz (BNP Paribas S. A. Deutschland)
Deutsche Bahn Connect
Deutsche Leasing Fleet
Kazenmaier Fleetservice
Mobility Concept Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
– Deutsche Bahn Deutsche Leasing – Mobility Holding Raiffeisenlandesbank¹)• k. A. • • • •
– k. A. • – – –0 120 3.425 356 627 1.0560 k. A. k. A. 32 110 1020 30 5 1 1 1
Renault 11,3 %, McLaren 10,4 %,
Ford 9,0 %
VW, Mercedes,
Opel
VW 19 %, Mercedes 18 %,
Ford/Opel jeweils 14 %
Audi 28 %, VW 19 %,
Mercedes 13,5 %
VW 20 %, Mercedes 17 %,
Ford 17 %
Ford 28 %, VW 19 %, Opel 11 %
115 1.800 44.183 725 7.556 3.1100 k. A. k. A. 625 k. A. 2.502
115 k. A. k. A. 100 k. A. 5330 k. A. k. A. 0 k. A 75
115 23.000 142.412 2.844 27.312 8.610k. A. +9,0 % +1,5 % +2,6 % +6,7 % +5,0 %
0 20.600 k. A. 2.512 k. A. k. A.– +3,0 % k. A. +2,1 % k. A. k. A.
115 0 k. A. 332 k. A. k. A.k. A. – k. A. +6,4 % k. A. k. A.
0 2.400 k. A. 40 k. A. k. A.– +118,2 % k. A. 0 % k. A. k. A.
– • • • • •
– • • • • •
– • • • – •
– • • • • •
– • • • • •
– • • • • •
– • • • • •
– • – – – –– k. A. • • • –• • • • • •
• • • – • –Dekra Dekra Schlosser Cartrans, PS-Team Dekra Dekra –
• • • • • •
•/•/– •/•/– •/•/• •/•/• •/•/• •/•/k. A.– • • • • –– • • • • –– • • • • –– • • • • –– • • • • –
– • – – – •
– • • – • •
– 1 Monat/24 Monate 1 Monat/6 Monate – 1 Monat/12 Monate 1 Monat/24 Monate– Call a Bike – – – –
• • • – individuell •
Quelle: Angaben der Unternehmen, teilweise gekürzt (Stand: 03/2019)
30 firmenauto Mai 2019
TITELTHEMA Leasing
Non CaptivesSantander Consumer
LeasingSixt Leasing X-Leasing
Mutterkonzern – Sixt SE –
GeschäftsgebietDeutschland • • •
Europa – • –
Kundenstruktur DeutschlandFirmenkunden 500 250 2.548Flotten >10 Autos k. A. k. A. 13
Mindestflottengröße 1 20 1
Stärkste Marken im BestandVolvo 38,8 %,
Mazda 24,4 %, Kia 5,9 %
k. A.Tesla 44 %,
Porsche 10 %, Mercedes 8 %
Vertragsneugeschäft 2018 in DeutschlandNeuverträge 63.783 20.000 760
LeasingFull-Service-Leasing 17.544 k. A. 0Finanzleasing 46.239 k. A. 760
Reines Fuhrparkmanagement 0 k. A. 0
Vertragsgesamtbestand 2018 159.314 120.100 2.548Veränderung zum Vorjahr +17,3 % −2,0 % +1,6 %
davon
Full-Service-Leasing 2018 36.260 k. A. 0Veränderung zum Vorjahr k. A. k. A. –Finanzleasing 2018 123.054 k. A. 2.548Veränderung zum Vorjahr k. A. k. A. +1,6 %Fuhrparkmanagement 0 38.900 0Veränderung zum Vorjahr – +9,0 % –
Angebote allgemeinKonfigurator auf DW-Regelung abgestimmt – • –Full-Service-Leasing • • –Fuhrparkmanagement – • –Fuhrparkanalyse • • –Rechnungsprüfung – • –Führerscheinkontrolle – • –Tankkarte • • –Spesenabrechnung – • –
SchadenmanagementWerkstattbindung – – –Rechnungskontrolle • • •
Fahrzeugrücknahme zertifiziert – • –Partner verschiedene Dekra, TÜV, Hüsges etc. –
Mehr-/Minder-km gleicher Satz – • •
ElektromobilitätE-Autos/Plug-in Hybriden/Brennstoffzellenfahrzeuge •/•/• •/•/• •/•/•
Hilfe Aufbau Ladeinfrastrukturim Unternehmen – • •
beim Mitarbeiter – • –Reporting Stromverbrauch • • –
Ladekarteregional • • –bundesweit • • –
MobilitätsdienstleistungenCorporate Carsharing • – –
Langzeitmieteim Angebot • • –Laufzeit min./max. 12 Monate/24 Monate 1 Tag/12 Monate –
Mobilitätsbudget – Sixt Mobility Consulting –Kostenloser Ersatzwagen Unfall oder Reparatur – • •
• ja; – nein; k. A. = keine Angaben; Pflichtangaben: Neugeschäft 2018 insgesamt, Gesamtbestand, Anzahl Firmenkunden, Mindestflottengröße. Quelle: Angaben der Unternehmen, teilweise gekürzt (Stand: 03/2019)
32 firmenauto Mai 2019
TITELTHEMA Leasing
CaptivesAlphabet Fuhrpark-
managementAthlon Germany Free2move Lease Mazda Finance2)
Mutterkonzern BMW Group Daimler Groupe PSA –
GeschäftsgebietDeutschland k. A. • • •
Europa k. A. • • –
Kundenstruktur DeutschlandFirmenkunden 4.700 6.5001) 43.560 150Flotten >10 Autos k. A. k. A. 312 k. A.
Mindestflottengröße 20 1 1 1
Stärkste Marken im BestandBMW 45,7 %, Ford 11,2 %, VW 10,2 %
Mercedes, VW, Opel
Citroën 22 %/DS 3 %, Opel 50 %,
Peugeot 25 %Mazda 100 %
Konzernfremde Marken erhältlich • • – –Vertragsneugeschäft 2018 in DeutschlandNeuverträge 65.366 32.0001) 26.126 15.586
LeasingFull-Service-Leasing 36.179 k. A. k. A. k. A.Finanzleasing 22.232 k. A. k. A. k. A.
Reines Fuhrparkmanagement 6.955 k. A. 0 k. A.
Vertragsgesamtbestand 2018 181.918 95.0001) 74.900 30.926Veränderung zum Vorjahr +5,6 % 0 % +31,6 % +60,1 %
davon
Full-Service-Leasing 2018 124.354 k. A. k. A. k. A.Veränderung zum Vorjahr +3,1 % k. A. k. A. k. A.Finanzleasing 2018 45.232 k. A. k. A. k. A.Veränderung zum Vorjahr +12,2 % k. A. k. A. k. A.Fuhrparkmanagement 12.332 k. A. 0 k. A.Veränderung zum Vorjahr +8,4 % k. A. – k. A.
Angebote allgemeinKonfigurator auf DW-Regelung abgestimmt • • – –Full-Service-Leasing • • • •
Fuhrparkmanagement • • – –Fuhrparkanalyse • • • –Rechnungsprüfung • • • •
Führerscheinkontrolle • • – –Tankkarte • • • •
Spesenabrechnung – – – –
SchadenmanagementWerkstattbindung – – – –Rechnungskontrolle • • • •
Fahrzeugrücknahme zertifiziert • • – –Partner Dekra k. A. Dekra verschiedene
Mehr-/Minder-km gleicher Satz – • – –ElektromobilitätE-Autos/Plug-in Hybriden/Brennstoffzellenfahrzeuge •/•/• •/•/– •/•/– –/•/•
Hilfe Aufbau Ladeinfrastrukturim Unternehmen • • – –beim Mitarbeiter • • – –
Reporting Stromverbrauch • • – •
Ladekarteregional • • • •
bundesweit • • • •
MobilitätsdienstleistungenCorporate Carsharing • • • –
Langzeitmieteim Angebot • • – –Laufzeit min./max. k. A. ab 1 Monat – –
Mobilitätsbudget k. A. MyBenefitKit App Free2move –Kostenloser Ersatzwagen Unfall oder Reparatur • • • –• ja; – nein; k. A. = keine Angaben; Pflichtangaben: Neugeschäft 2018 insgesamt, Gesamtbestand, Anzahl Firmenkunden, Mindestflottengröße; 1) Athlon und Daimler Fleet Management gesamt; 2) Servicecenter der Santander Consumer Leasing; 3) Bestellmenge pro Jahr Einzelabnehmer/Großkunden.
Mai 2019 firmenauto 33
Ihre Profi-Newsletter – immer aktuell informiertJede Woche Ihr persönlicher Informationsvorsprungmit News und aktuellen Infos aus dem Flottenmarkt.
Früher wissen, was läuft. Kostenlos!
Die Top-Meldungen aus der Firmenwagen-Welt im Überblick.
Informationen über Aktionen und Gewinnspiele.
Ausführliche Vorschauen auf die neuesten Ausgaben von firmenauto.
Spannende firmenauto-Artikel exklusiv vor Erscheinen der Hefte.
Abonnieren Sie jetzt Ihren Newsletter unter: www.firmenauto.de/newsletter
Jetzt anmelden!
✔
✔
✔
✔
Volkswagen Leasing
Volvo Car Financial Services2)
Volkswagen Financial Services –
• •
• –350.000 400
k. A. k. A.1/53) 1
VW-Pkw, Audi,
VW-NfzVolvo 100 %
• –
618.000 24.487456.000 k. A.162.000 k. A.369.000 k. A.
1.487.000 48.026+7,3 % +27,2 %
1.305.000 k. A.+14,3 % k. A.182.000 k. A.−25,4 % k. A.873.000 k. A.+12,1 % k. A.
• –• •
• –• –• •
• –• •
– –• –• •
• –Händlerpartner, Dekra verschiedene
• –
•/•/– •/•/•
– –– –• •
• •
• •
– –• –
1 Monat/12 Monate –– –• –
Quelle: Angaben der Unternehmen, teilweise gekürzt (Stand: 03/2019)
34 firmenauto Mai 2019
Am Ende eines jeden Leasingvertrags steht die Rückgabe des geleasten Autos. Jeder Fuhrpark-leiter kennt die Tücken, die damit einhergehen:
Während manch ein Leasinggeber kaum Schäden nach-berechnet, kommen andere mit teils unverständlichen Nachforderungen um die Ecke. Und ist das Auto erst einmal weg aus dem Fuhrpark, kann die Abrechnung kaum noch korrigiert werden.
Der erste Schritt zur Kostenkontrolle ist also ein Übergabeprotokoll. Dabei geht der Fuhrparkmitarbei-
ter mit dem Verantwortlichen der Leasinggesellschaft um das Auto und dokumentiert alle Schäden schrift-lich. Das stellt sicher, dass die Leasinggesellschaft nur tatsächlich vorhandene Schäden nachberechnet.
Zum Hintergrund: Bei einem Leasingvertrag über-lässt die Leasinggesellschaft das Fahrzeug gegen Gebühr zur Nutzung, kalkuliert aber im Gegenzug mit dem Restwert des Wagens bei der Fahrzeugrück-gabe, meist gekoppelt an eine vorgegebene Laufleis-tung. Entstehen am Auto Schäden, so sinkt der tat- Fo
to: K
arl-
Hei
nz
Au
gu
stin
Rückgabe ohne Schrecken
Nach Ablauf des Leasingvertrag können hohe Nachzahlungen anfallen.
Mit ein paar einfachen Tricks vermeiden Sie Ärger bei Rückgabe des Leasingautos.
von Immanuel Schneeberger
TITELTHEMA Leasing
Mai 2019 firmenauto 35
Anzeige
sächliche Restwert. Der Darlehensbetrag hingegen bleibt in Höhe des kalkulatorischen Restwerts. Diese Differenz zwi-schen den beiden Werten muss nun der Fuhrpark bezahlen.
Doch wann ist denn wirklich ein Schaden entstanden? Laut Vertragsbedingungen muss sich das Fahrzeug bei der Rückgabe in einem der Laufleistung angemessenen Zustand befinden. »Das ist ein sehr schwammiger Begriff«, sagt Fuhr-parkspezialist und Rechtsanwalt Peter Rindsfus. Bei Alu-felgen werde beispielsweise der Unterschied da gemacht, wo eine Felge nicht mehr nur zerkratzt, sondern in ihrer Substanz beeinträchtigt sei. »Wo aber hört der Kratzer auf und wo fängt die Substanzbeeinträchtigung an?«
Solche Streitfragen lassen sich häufig nur mithilfe eines Sachverständigen klären. In anderen Fällen helfen die Scha-denkataloge der großen Leasinggesellschaften. Sie listen auf, was bei einer normalen Nutzung alles passieren kann und darf.
Wichtig dabei: Die Summe der Schäden entspricht nicht dem Betrag, der bei einer Nachzahlung zu leisten ist. Ein Bei-spiel: Ein ansonsten gut erhaltener geleaster Audi A4 hatte einen größeren Einparkschaden. Kostenvoranschlag der
Faire Fahrzeugrückgabe
Der Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften (VMF) bietet ein Qualitätssiegel für eine faire Fahrzeugrücknahme an. Nach der Terminvereinbarung holt der Leasing-geber innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Leasingende das Fahrzeug ab. Dabei sucht er gemeinsam mit dem Kun-den nach Schäden, und diese werden in einem Rücknahmeprotokoll festgehalten. Die Prüfung durch einen Sachverstän-digen erfolgt dann innerhalb von drei Arbeitstagen. Prüfgesellschaften wie die Dekra haben Schadenkataloge im Angebot, die bebildert aufführen, was noch als Abnutzung gilt und wo ein Schaden zu Minderwerten führt. Auch viele Leasing-gesellschaften schnüren Pakete, die in Zusammenarbeit mit Prüfgesellschaften faire Rückgaben ermöglichen.
Strom laden ohne Ende!E-Mobilität mit dem DKV.dkv-euroservice.com/e-mobilitaet
36 firmenauto Mai 2019
Reparatur: 2.000 Euro. Steht dieser beschädigte A4 beim Gebrauchtwagenhändler neben einem identischen A4 ohne Parkschaden, so wird kein Käufer für den beschädigten Audi volle 2.000 Euro weniger bezahlen. In der Praxis bringt er vielleicht 1.500 Euro weniger als der top erhal-tene A4. Der Restwert sinkt also nicht um den Betrag der Reparatur, sondern weniger. Da der Leasingnehmer nur den Minderwert ersetzen muss, dürfen bei der Abrechnung nicht die Reparaturkosten angesetzt werden.
Ein weiterer häufiger Fehler in den Abrech-nungen ist, dass manche Leasinggesellschaf-ten die einzelnen Minderwerte addieren. Sie summieren fünf kleine Schäden zu einer Gesamtsumme, die sie dem Kunden als Nach-zahlung berechnen. Ob ein Auto aber vier oder fünf kleinere Beschädigungen hat, beeinflusst den wirklichen Wert kaum. Der tatsächliche Minderwert ist also geringer, die Nachzahlung folglich niedriger.
Außerdem sei der Einsatzzweck ausschlaggebend, sagt Experte Rindsfus. »Wenn ein Kurierdienst ein Fahrzeug least, liegt es auf der Hand, dass es häufig auf Kurzstre-cken fährt. Dementsprechend hinterlässt das häufige Ein- und Aussteigen des Fahrers stärkere Spuren am Sitz als bei einem Auto für den normalen Außendienst.« Es ist also sinnvoll, den Einsatzzweck im Voraus der Leasing-gesellschaft mitzuteilen.
Schwierig wird’s bei schweren Unfallschäden. Bevor man die reparieren lässt, muss man sich immer eine Frei-gabe vom Leasinggeber holen. Kostet die Reparatur näm-lich mehr als einen gewissen Prozentsatz des Wieder-beschaffungswerts, so kann der Leasingvertrag beendet werden – wozu Peter Rindsfus rät. Aber: »Der tatsächli-che Wiederbeschaffungswert ist oft niedriger als der kalkulatorische Restwert. Hier hilft eine GAP-Versiche-rung, die der Leasinggesellschaft die Differenz erstat-tet.« Bei einem Haftpflichtschaden erstattet die Versi-cherung die Wertminderung direkt dem Leasinggeber. Der darf also bei der Fahrzeugrückgabe nicht noch ein-mal einen Minderwert geltend machen.
Tipps für die Fahrzeugrückgabe
❏✔ Einsatzzweck bei Vertragsabschluss festlegen
Schreiben Sie im Leasingvertrag die Nutzungsform fest.
Das schützt vor Ärger.
❏✔ Schadenkatalog
Fordern Sie im Vorfeld einen Schadenkatalog an, der übliche
Abnutzungsspuren beschreibt.
❏✔ Das Auto komplett zurückgeben
Ersatzschlüssel, Kofferraumabdeckung, Navikarten, abnehm-
bare Anhängekupplung oder fehlende Winterreifen gehen
richtig ins Geld.
❏✔ Reinigung innen und außen
Ein guter optischer Eindruck ist die halbe Miete. Bei einem
verdreckten Auto kommt schnell der Gedanke, dass das
Fahrzeug auch technisch nicht gepflegt wurde.
❏✔ Bei kleineren Schäden Smart Repair
Ein Zustandsbericht vom Sachverständigen hilft bei
der Entscheidung, ob und welche Schäden behoben
werden sollten.
❏✔ Dokumentation
Fotos vom Auto und der genaue Kilometerstand samt
Datum und Zeit machen Angaben der Leasinggesellschaft
überprüfbar. Noch besser ist ein eigenes Gutachten. Solche
Ausgaben können sich schnell rechnen.
❏✔ Übergabe an die Leasinggesellschaft
Ein Mitarbeiter sollte persönlich teilnehmen, ein
Übergabeprotokoll fordern, das genau lesen und
erst danach unterschreiben.
TITELTHEMA Leasing
Foto
: Ad
ob
e St
ock
/ilk
erce
lik
MANAGEMENT Ausbildung
Jeder Fuhrparkmanager hat schon einmal davon gehört, dass er im Unternehmen auch gewisse rechtliche Pflichten hat. Doch welche sind das genau? Im dreitägigen Seminar gibt
Rechtsanwältin Inka Pichler-Gieser einen umfassenden Über-blick. Dabei treten immer wieder überraschende Details zutage, die im Alltag viel Ärger sparen können, wenn man sie kennt. Zu den Halterpflichten gehört es beispielsweise, die Fahrerlaubnis all derer zu überprüfen, die mit Firmenfahrzeugen unterwegs sein dürfen. Im Wirrwarr der EU-Führerscheinklassen helfen Übersichtslisten.
Die erste Kontrolle sollte der Fuhrparkverantwortliche immer selbst übernehmen und schriftlich dokumentieren. Danach empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle, am besten unangemel-det, gern aber auch per App. Dabei gilt es, nicht nur auf die rich-tige Fahrerlaubnisklasse zu achten; auch Erkrankungen der Mitarbeiter können eine Rolle spielen, sofern sie die Fahrtaug-lichkeit einschränken.
Klassiker im Fuhrpark sind Strafzettel, die oft direkt beim Fuhrparkmanager landen. Hier reicht es nicht, den Zeugen-befragungsbogen an den betroffenen Mitarbeiter weiterzuge-ben und zu hoffen, dass der ihn fristgerecht ausfüllt und an die Behörde zurücksendet. Denn verpassen ein paar Mitarbeiter die Frist, verordnen die Behörden inzwischen gern mal eine Fahrtenbuchauflage. Man könnte meinen, das sei das Problem des Fahrers. Zu Beginn vielleicht, doch kann die Behörde wie-derholt den verantwortlichen Fahrer nicht rechtzeitig bestim-men, droht dem gesamten Fuhrpark eine Fahrtenbuchauflage.
Das musste auch ein großer Fuhrpark mit über 1.000 Strafzet-teln erfahren, der gegen eine Fahrtenbuchauflage kämpft, weil in zwei Fällen der Fahrer nicht ermittelt werden konnte. Also füllen Sie den Zeugenbefragungsbogen aus und geben Sie an, welchem Fahrer das Auto zum Tatzeitpunkt überlassen worden war. Danach nimmt die Behörde Kontakt zum Fahrer auf, und der Fuhrpark ist aus dem Schneider.
Ähnlich wichtig ist es, Halterverantwort-lichkeiten im Überlassungsvertrag an die Fahrer zu delegieren. Denn bei unklarer Grenze, wer denn nun der Halter des Fahr-zeugs ist, belangen Behörden auch meh-rere Parteien. Eine Fahrzeugunterweisung für die fahrenden Mitarbeiter ist da ebenso verpflichtend wie eine Einweisung in die richtige Ladungssicherung – selbst für die Laptoptasche auf dem Beifahrersitz.
Grundsätzlich geht von jedem Auto eine Betriebsgefahr aus. Die endet erst dann, wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß abge-stellt worden ist. Als nicht ordnungsgemäß kann schon gelten, wenn der dicke SUV über die Markierung auf der Straße hinaus-ragt oder eine Rentnerin mit ihrem Rollator an der nicht eingeklappten Anhänger-kupplung hängen bleibt. Hier kommen dann auch Versicherungen ins Spiel, die im Seminar ebenfalls ausgiebig behandelt werden. So sind Sie immer auf der rechtlich sicheren Seite.
Dekra bildet in sieben Seminaren zum Flottenmanager aus. firmenauto besucht alle Kurse.
Teil 2: Rechtsgrundlagen und Versicherungsmanagement.
Zertifizierter Fuhrparkmanager
Der Bundesverband Fuhrparkmanagement und firmenauto sind Kooperationspartner
der Ausbildung. Seminarstandorte: München,
Frankfurt/Main, Berlin, Dortmund und Hamburg.
Mehr Infos unter www.dekra-akademie.de
Mai 2019 firmenauto 37
38 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Schadenrecht
Wieder ein neuer Trick der Versicherer. Immer häufiger würden sie bei der Schadenabwicklung Kasko- und Haftpflichtschadenrecht durchein-
anderwerfen, so Rechtsanwalt Roman Kasten. Möglicher-weise, um die Geschädigten zu verunsichern. »Hat es gescheppert, geht es aber um Schadenersatz und nicht um vertragliche Ansprüche.« Schadenersatz beinhaltet alle Beträge, die nach einem Unfall beim Geschädigten hängen bleiben. Alles, was erforderlich und geschuldet werde, müsse bezahlt werden, betont der Fuhrparkexperte. Maß-stab sei immer ein ordentliches Sachverständigengutachten.
Doch gerade das greifen seiner Erfahrung nach nun einige Kfz-Versicherer an einer Stelle sehr erfolgreich an: Sie fordern, dass Unternehmen nur einen um die Umsatz-steuer reduzierten Wertminderungsbetrag erhalten. Als Grundlage berufen sie sich häufig auf ein Urteil des Amtsgerichts Remscheid (Az.: 8a C 190/16).
Die Praxis sah bisher anders aus. Allerdings bestätigt Kasten, dass sich die Versicherer bei ver-schiedenen Gerichten mit ihrer Rechtsauffassung durch setzen konnten. »Tatsächlich ist die nicht falsch.« Schließlich gebe es ein Bereicherungsverbot.
Daher rät der Anwalt den Fuhrparkchefs, unbe-dingt die Verträge mit ihren Leasinggebern zu prüfen. »Dort darf nicht mehr stehen, dass das Geld aus dem Gutachten geschuldet wird, sondern nur noch, was real von der Versicherung gezahlt wird«, erläutert Kasten. Zwar werde es noch einige Zeit dau-ern, bis der Bundesgerichtshof (BGH) endgültig über Wertminderung und Mehrwertsteuer entscheide, doch Fuhrparkverantwortliche sollten vorbauen.
Kasten kritisiert insbesondere ein Urteil, nach dem bei fiktiver Abrechnung von Unfallschäden der Nutzungsausfall nicht mehr gewährt werden soll Fo
to: A
do
be
Sto
ck/F
lch
le
Der Trick mit der Wertminderung
Nach Unfällen versuchen Versicherungen häufig, geschädigte Unternehmen
um die Mehrwertsteuer zu bringen. Und die Gerichte spielen mit.
von Uwe Schmidt-Kasparek
Mai 2019 firmenauto 39
(LG Darmstadt, Az.: 23 O 386/17 vom 05.09.2018). In solchen Fällen müsse das betroffene Unternehmen nach Meinung des Gerichts einen Mietwagen tatsächlich anmieten, um die Kos-ten für einen Ersatzwagen erstattet zu bekommen. Rechts anwalt Kasten hält die Argumentation des Gerichts aber nicht für schlüssig. Er geht davon aus, dass das Oberlandesgericht Frank-furt am Main »früher oder später« wieder zur bundesweit übli-chen Rechtsprechung zurückkehren werde, nach der auch bei fiktiver Abrechnung ein Anspruch auf Nutzungsausfall besteht. Daher rät er, ähnliche Entscheidungen anzufechten.
Viel Aufmerksamkeit sollten die Unternehmen außerdem der Fuhrpark-Compliance widmen. Um rechtlich konform entschei-den zu können, müssen sich Flottenverantwortliche intensiv und regelmäßig mit nationalem und internationalem Recht aus-einandersetzen. Nur so können sie Fehlverhalten aufdecken und entsprechend reagieren. Bestes Beispiel seien Gefälligkeits- und Telegutachten, der Verkauf verunfallter Fahrzeuge sowie Rabattierungen (Kick-backs). Grundsätzlich sollten Unterneh-mensstrukturen, die integres Verhalten gewährleisten – also die sogenannte Prävention – regelmäßig auf den Prüfstand. Hilf-reich ist hier das aktuelle »Handbuch des Fuhrparkrechts« von Kastens Kanzleikollegin Inka Pichler-Gieser. Es enthält ein umfangreiches Kapitel zum Thema Fuhrpark-Compliance.
Umsatzsteuer auf Wertminderung?
Nach Meinung etlicher Kfz-Versicherer muss die Wertminderung um die Umsatzsteuer verringert werden. Im Beispiel würde die Entschädigung um 256 Euro zu hoch ausfallen. Nach Einschätzung von Roman Kasten, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Wiesbaden, wird sich diese Rechtsprechung durchsetzen.
Entschädigung bisherneue
Rechtssprechung
Wiederbeschaffungswert vor Verkehrsunfall
16.806 Euro
Wertminderung 1.600 Euro 1.344 Euro
Wiederbeschaffungswert beziehungsweise Wiederverkaufserlös
15.462 Euro
Geschädigter erhält demnach 17.062 Euro 16.806 Euro
Differenz vor/nach Verkehrsunfall 256 Euro keineQuelle: Rechtsanwälte Kasten & Pichler, März 2019
Anzeige
Ihr perfekter Fuhrpark von morgen.
www.leaseplan.de What’s next?
Wir tun alles dafür, dass Ihr Fuhrpark perfekt auf-gestellt ist: effi zient, wirtschaftlich, hochmodern und mit einer motivierenden Fahrzeugauswahl für Ihre Mitarbeiter. Wir beraten Sie umfassend zu allen wichtigen Themen und bieten zu Ihrer Strategie immer die passende Komplettlösung aus einer Hand. Was auch immer Sie als Nächstes vorhaben, mit uns fah-ren Sie heute und morgen bestens – jedes Fahrzeug, jederzeit und überall. Jetzt mehr erfahren:
40 firmenauto Mai 2019
MANAGEMENT Abschleppen
Außendienstler können ein Lied davon singen: Ganz egal, ob in der Innenstadt unterwegs oder auf Termin im Gewerbegebiet – am Ziel angekommen, beginnt
die mühsame Parkplatzsuche. Meist drängt zudem die Zeit, und die Gegend ist gänzlich unbekannt. Ein Supermarkt-parkplatz oder ein öffentlich zugängliches Firmengelände mit freien Plätzen verlockt geradezu, seinen Wagen für ein Stündchen unbemerkt dazuzustellen. Ein Szenario wiede-rum, welches Fuhrparkleiter nur zu gut aus der Sicht des Unternehmens kennen, dessen begrenzte Stellflächen für Mitarbeiter und Besucher regelmäßig von Fremdparkern blockiert sind. Nur wenige Firmen kennen allerdings ihre Rechte, wenn es ums Abschleppen geht.
Rein rechtlich gesehen, macht es grundsätzlich kei-nen Unterschied, ob ein Fahrzeug von einem gewerb-lich genutzten oder unerlaubt zugeparkten Privat-grundstück abgeschleppt wird. In beiden Fällen wird der Besitzer des Parkplatzes daran gehindert, die Stellfläche nach seinem Willen zu nutzen, und ist dazu berechtigt, den Zustand der »Besitzstörung auf-grund verbotener Eigenmacht« (siehe § 858 Abs. 2 BGB) zu beenden (§ 859 BGB). Der Umfang der Beein-trächtigung spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist die Beeinträchtigung als solche. Unzulässig abge-stellte Fahrzeuge dürfen selbst dann abgeschleppt werden, wenn keine konkrete Behinderung vorliegt.
Foto
: Ad
ob
e St
ock
/Po
wel
l83
Nacht-und-Nebel-AktionIn dicht besiedelten Industriegebieten besetzen oft Fremdparker den spärlichen Parkraum auf
dem Firmengelände. Mit welchen Mitteln Unternehmen Parkplätze räumen lassen dürfen.
von Wolf-Henning Hammer
Mai 2019 firmenauto 41
Beispielsweise weil es noch genügend andere freie Parkplätze gibt.
Während ein Privatmann den Abschlepper aktiv anfordert und auch mit der Bezahlung in Vorleistung treten muss, vereinbaren Firmen in der Regel einen Rahmenvertrag mit dem Abschleppunternehmen. Der schleppt nicht nur die Fahrzeuge ab, sondern über-wacht auch gleich das Gelände. Das Inkassorisiko trägt der Abschleppunternehmer, der die Abschlepp-gebühr direkt vom Falschparker verlangt. Die Forde-rung selbst beschränkt sich aber auf den Abschlepp-vorgang. Kosten zur Überwachung des Parkplatzes dürfen nicht berechnet werden. Da ein Parkplatzbe-treiber einen sofortigen Anspruch auf die Beseitigung der Störung hat, besteht auch keine Wartepflicht.
Betrügerische Abschleppunternehmer versuchen dies zu ihren Gunsten auszulegen. Schließlich kön-nen sie sich bei der Durchsetzung ihrer Forderungen darauf berufen, dass sie mit dem Abschleppen berech-tigterweise ein Geschäft des Fahrzeughalters durch-geführt haben. Das mag zunächst wirr klingen, ergibt aber Sinn. Fahrer und auch Halter sind nämlich ver-pflichtet, das störende Fahrzeug zu entfernen. Sie sind also mit einer Pflicht belastet. Der Abschleppvorgang befreit sie von dieser Pflicht. Und da es hier lediglich auf die juristische Sichtweise ankommt, ist der Abschleppvorgang als vorteilhaft einzustufen. Die Kos-ten trägt der Fahrer beziehungsweise der Fahrzeug-halter. Denn übernimmt der Fahrer nicht die Verant-wortung, wird der Halter in die Pflicht genommen.
Der Anspruch des Parkplatzbetreibers wiederum ergibt sich aus dem Umstand, dass die Besitzstörung als unerlaubte Handlung im Sinne des Deliktsrechts
zu werten ist. Zudem erfolgt der Abschleppvorgang nicht willkürlich, sondern als adäquate Reaktion, die der Falsch-parker durch sein Verhalten selber herausgefordert hat. Dies gilt zumindest immer dann, wenn zwischen Park-platzbetreiber und Abschleppunternehmen vereinbart ist, dass »rechtsmissbräuchliche Abschleppvorgänge, die zum Beispiel auf bloßer Gewinnsucht des Abschleppunterneh-mens beruhen«, unterbunden werden.
Laut Bundesgerichtshof sind die Abschleppkosten auf das übliche Maß beschränkt. Man kann sie allerdings nicht unmittelbar mit den Gebühren vergleichen, welche von der Polizei oder der Verwaltungsbehörde in Rech-nung gestellt werden. Sittenwidrigkeit liegt dennoch nahe, wenn dieser Satz um mehr als 100 Prozent überschritten wird. Der Parkplatzbetreiber ist aber nicht verpflichtet, den günstigsten Anbieter zu wählen.
Gängige Praxis ist es, dass der Abschleppdienst bis zur Zahlung der Kosten das Fahrzeug nicht herausgibt. Als Folge des Zurückbehaltungsrechts des Abschlepp-unternehmers gemäß § 273 Abs. 1 BGB ist das auch rech-tens. Wer als Autofahrer die Höhe bestreitet oder die For-derung als unberechtigt ansieht, kann sein Fahrzeug gemäß § 273 Abs. 3 BGB auch ohne Zahlung verlangen, wenn er eine Sicherheits leistung erbringt. Abschleppvorgänge von Firmenparkplätzen sind nur legal, wenn zwischen dem Parkplatzbetreiber und dem Abschleppunternehmer eine Vereinbarung besteht. Wenn ein Abschlepper Fahrzeuge auf eigene Faust entfernt, liegen Betrug und Erpres-sung nahe. Wer vermutet, dass sein Auto illegal abge-schleppt worden ist, sollte im Zweifelsfall sowohl die Poli-zei als auch einen Anwalt hinzuziehen und gegebe-nenfalls Anzeige erstatten. Dubiose Rechnungen sollten keinesfalls widerspruchslos bezahlt werden.
Der Autor ist einer von 70 Anwälten der Kanzlei Voigt, die alle Bereiche rund um das Verkehrsrecht abdeckt. Mit über 27 Niederlassungen ist Voigt Ansprechpartner für die Autoindustrie und Geschäftskunden wie Autohäuser, Werkstätten, Speditionen und Fuhrparkleiter.
Firmen müssen einen Rahmenvertrag
mit Abschleppdiensten vereinbaren
42 firmenauto Mai 2019
AUTO VW T-Cross
Schon der VW Touran war 2003 ein Spätstarter, kam erst einige Jahre nach den Minivans von Renault und Mitsubishi auf den Markt. Aus dem Stand weg konnte
er die Spitze der Neuzulassungen in seinem Segment errei-chen. Ob der neue VW T-Cross diese Tradition fortführt, muss sich erst noch zeigen. Den ersten Teil der Bedingung erfüllt der kleine SUV jedenfalls schon einmal: Er kommt deutlich später auf den Markt als etwa Ford Ecosport, Kia Stonic oder Hyundai Kona. Selbst konzernintern ist der T-Cross kein Pionier, da waren die Spanier mit ihrem Seat Arona schneller.
Mit ihm teilt sich der neue VW nicht nur die Plattform, sondern auch das Produktionswerk in Spanien. Vielleicht deswegen fanden die Wolfsburger Designer den Mut, knal-lige Farben nicht nur auf der Karosserie, sondern auch auf Felgen und im Innenraum zu verteilen. Natürlich gibt es die bunten Planken an der Armaturentafel nicht umsonst, aber Firmen bevorzugen meist sowieso eher gedecktere Farben, die es im T-Cross serienmäßig gibt.
Ganz ohne Aufpreis ist der kleine Hochbeiner maus-grau, alle anderen Farben kosten extra. Dabei ist die Serien ausstattung sonst für VW-Verhältnisse beinahe schon üppig geraten: Die Rückbank ist um 14 Zentime-
Polo auf StelzenDer VW T-Cross startet spät in ein boomendes Segment, dafür haben die Entwickler ihre Vor-
bereitungszeit gründlich genutzt und einen sauber abgestimmten Mini-SUV auf die Räder gestellt.
von Immanuel Schneeberger
ter verschiebbar, ein Radio samt Farbbildschirm sowie Totwinkel- und Notbremsassistent sind immer mit dabei. Dass damit aus VW noch kein Wohlfahrts-unternehmen wurde, zeigen die Sparbemühungen an anderer Stelle. So bremsen hinten Trommeln, Klimaanlage und Make-up-Spiegel gibt es auf Wunsch – Letzteres dann allerdings ohne Beleuch-tung. Außerdem vermisste unser Beifahrer auf den ersten Testfahrten einen Haltegriff am Dach, und der Kunststoff ist überwiegend von der harten Sorte.
Mehr Platz als im Polo, einfache KunststoffeDas ändert nichts an der gewohnt routinierten Verar-beitung. Alle Spaltmaße passen, es klappert nichts, und Fahrer unterschiedlichster Größen finden eine passende Sitzposition auf den bequemen Vordersit-zen. Völlig überzeugt dann die üppige Kopffreiheit. Die kommt von der gegenüber dem Polo um knapp 14 Zentimeter höheren Karosserie, während die Sitz-position um zehn Zentimeter weiter oben liegt als beim Kleinwagen. In Verbindung mit der auf 4,11 Meter gewachsenen Länge genießen vor allem Passagiere auf den Rücksitzen absolut ausreichende Platzverhält- Fo
tos:
Imm
anu
el S
chn
eeb
erg
er (3
)
Mai 2019 firmenauto 43
nisse. Gegenüber dem zwölf Zentimeter längeren T-Roc müssen hier kaum Nach-teile in Kauf genommen werden.
Selbst der Gepäckraum ist mit mindes-tens 385 Litern geräumig. Ab der Ausstat-tung Life lässt sich der Ladeboden in zwei Höhen arretieren, sodass innen keine Stufe entsteht. Sind die Rücksitze ganz nach vorn geschoben, passen dort zwar nur noch Kin-der drauf, dafür aber 455 Liter ins Gepäck-abteil. Bei umgelegten Rücksitzlehnen und dachhoher Beladung werden 1.281 Liter daraus. Da können manche ausgewach-sene Kompaktwagen nicht mithalten.
Das gilt auch in anderen Bereichen als bei den reinen Innenmaßen. Beim Fahren wirft VW seine gesamte Kompetenz in die Waagschale: Hier kommen keine Klein-wagengefühle auf. Der T-Cross fährt sou-verän über alle möglichen Unebenheiten, das meiste verschwindet gekonnt in der komfortablen Federung. Dabei ist der T-Cross nicht zu weich abgestimmt, er neigt sich zwar in Kurven zur Seite, kommt aber nicht ins Wanken. Es geht also völlig unaufgeregt selbst über kurvige Land-straßen, die Lenkung ist leichtgängig und dennoch zielgenau.
Kultivierter Diesel, faire PreiseUnter der Motorhaube verrichten alte Bekannte ihren Dienst. Zu Beginn gibt es nur den Einliter-Dreizylinder samt Turbo-lader mit 95 oder 115 PS. Letzterer ist kultiviert und durchzugsstark, er harmo-niert gut mit den sieben Gängen desDoppel-kupp lungs getriebes, das sogar ruckfreies Anfahren beherrscht.
Im Sommer kommt ein 1.6 TDI mit 95 PS und Fünfgangschaltung, der für Langstre-cken gut geeignet ist. Er arbeitet überra-
schen kultiviert und kräftig, ab Tempo 120 übertönen die Wind-geräusche sein leises Brummen. Noch später im Jahr schiebt VW dann den kräftigen 1.5 TSI mit 150 PS nach, der das kleine Auto beinahe schon sportlich bewegen dürfte.
Preislich wird der Vierzylinder sicher deutlich über den Drei-zylindern liegen. Mit 95 PS startet die Preisliste bei 15.100 Euro, sechs Gänge und 115 PS kosten 16.300 Euro, und das komfor-table Doppelkupplungsgetriebe schlägt mit weiteren 1.250 Euro zu Buche (alle Preise netto). Empfehlenswert ist die Ausstattung Life für 1.600 Euro mehr. Dort sind Klimaanlage, Einparkhilfe, Alufelgen und Multifunktionslenkrad schon enthalten. Außer-dem sieht die Preisliste erst dann die Option auf eine Freisprech-einrichtung vor. Mit derart gutem Rüstzeug versehen, dürfte dem T-Cross eine rosige Zukunft bevorstehen. Immerhin ging für VW bisher noch jeder späte Start in ein Boomsegment gut.
VW T-Cross
0–100 Vmax Verbrauch1) CO21) Kofferraum Zuladung Preis Betriebs kosten2) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
1.0 TSI 999 cm3 3 S/5 70 kW (95 PS) 175 Nm/2.000 11,5 s 180 km/h 5,7 l S 130 g 455–1.281 l 475 kg 15.105 Euro 47,0/32,2 ct/km B
1.0 TSI 999 cm3 3 S/6 85 kW (115 PS) 200 Nm/2.000 10,2 s 193 km/h 5,7 l S 130 g 455–1.281 l 480 kg 16.303 Euro 48,5/33,2 ct/km B
Herstellerangaben, Motoren erfüllen Euro 6d-Temp; 1) WLTP 2) Bei 20.000/40.000 km pro Jahr, 60/36 Monate Laufzeit. Berechnet von
1 VW bringt viel Farbe in den T-Cross. Aller-dings sind die Kunststoffe hart.
2 Mit der »View«-Taste kann man die Ansicht im digitalen Kombiinstrument umstellen.
3 Es besteht die Wahl zwischen großer Navikarte und analogen Instrumenten.
4 Ein Band verbindet beide Rückleuchten.
1
2
4
3
44 firmenauto Mai 2019
AUTO Mercedes CLA
Verglichen mit seinem Vorgänger wurde der schi-cke CLA mit 4,69 Metern etwas länger und auch breiter, doch das Platzangebot darf weiterhin eher
als maßgeschneidert betrachtet werden.Während man sich vorn auf den Integralsitzen noch
gut aufgehoben fühlt, ist das Raumangebot hinten insbesondere für große Personen nach wie vor knapp bemessen. Die freuen sich zwar über etwas mehr Bewegungsfreiheit im Schulterbereich, doch sie müs-sen sich mit sehr wenig Kopf- und Bein freiheit zufrie-dengeben.
Vom anderen SternIm neuen Mercedes CLA steckt jede Menge wegweisende Technologie. Auf der anderen
Seite leistet sich die schicke Coupé-Limousine Schwächen im Detail.
von Guido Borck
Mercedes CLA
0–100 Vmax Verbrauch2) CO22) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten3) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
180 d 1.461 cm3 4 A/71) 85 kW (116 PS) 260 Nm/1.750 10,7 s 205 km/h 4,4 l D 117 g 460 l 510 kg 30.235 Euro 63,4/41,8 ct/km A+180 1.332 cm3 4 S/6 100 kW (136 PS) 200 Nm/1.460 9,4 s 216 km/h 5,9 l S 135 g 460 l 535 kg 26.450 Euro 62,5/42,1 ct/km B200 1.332 cm3 4 S/6 120 kW (163 PS) 250 Nm/1.620 8,5 s 229 km/h 6,1 l S 138 g 460 l 535 kg 28.225 Euro 64,7/43,6 ct/km C
220 1.991 cm3 4 A/71) 140 kW (190 PS) 300 Nm/1.800 7,0 s 241 km/h 6,8 l S 154 g 460 l 540 kg 31.210 Euro 69,6/47,3 ct/km C
250 1.991 cm3 4 A/71) 165 kW (224 PS) 350 Nm/1.800 6,3 s 250 km/h 6,8 l S 154 g 460 l 535 kg 33.200 Euro 72,3/49,3 ct/km C
Herstellerangaben, Motoren erfüllen Euro 6d-Temp; 1) Doppelkupplungsgetriebe; 2) WLTP 3) Bei 20.000/40.000 km pro Jahr, 60/36 Monate Laufzeit. Berechnet von
Dass sich der CLA eher als ein Designerstück ver-steht, beweist auch der Kofferraum. Das Gepäckab-teil ist beim Neuen von 470 Litern auf 460 Liter geschrumpft. Dank einer breiteren Öffnung lässt es sich nun etwas leichter beladen, allerdings muss hierzu das Gepäck über eine recht hohe Ladekante gewuchtet werden.
Lernende Sprachbedienung, große DisplaysModernste Fahrerassistenten, zwei hochauflösende 10,25-Zoll-Screens vor dem Fahrer und dazu eine
Mai 2019 firmenauto 45
1 Auf der Rückbank geht es eng zu. Großen Personen fehlt es an genügend Platz.
2 Das Gepäck muss im CLA über eine breite, aber hohe Ladekante gehievt werden.
3 Die Coupé-Limousine fährt sich agil und hat spürbar mehr Federungskomfort.
lernende Sprachbedienung: Beim Infotainment bedient sich der CLA bei der A-Klasse. So versteht die Sprach-bedienung jetzt auch komplexere Vor-gänge. Das internetbasierte System fin-det auf Zuruf nicht nur gewünschten Musiktitel, aktu elle Börsenkurse oder die Wettervorhersage, sondern kann für einen Restaurant besuch auch italieni-sche Lokale in der Nähe empfehlen, die weder Pasta noch Pizza anbieten.
Wirklich zielführend: Das Naviga-tionssystem ergänzt beim Abbiegen die Kartenansicht mit einem Livebild der Frontkamera. Gezeigt wird die
Situation vor dem Auto, mit Abbiege-pfeil, Straßennamen und Hausnum-mern. So viel Hilfe kostet im Naviga-tion-Premium-Paket 2.785 Euro. Auch ansonsten ist die Coupé-Limousine hochmodern. Durch Gesten wird die Innenraum beleuchtung berührungs-los gesteuert, und für die Smartphone-Integration gibt es USB-C-Schnittstel-len für schnelles Laden und schnellere Datenübertragung der angesc.
Das Fahren selbst macht richtig Spaß. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt, sodass sich der Mercedes schön agil bewegen lässt, auch dank der präzisen
Lenkung. Viel wichtiger ist allerdings der hinzugewonnene Komfort, denn im Vergleich zum Vorgänger bügelt die Federung jetzt auch derbe Bodenwel-len klaglos aus.
Der jetzt schon bestellbare 180 d deckt mit seinen 116 PS eher Grund-bedürfnisse ab, deshalb sollten Vielfah-rer zum 200 d oder 220 d greifen. Die beiden stärkeren Diesel kommen aller-dings erst im Herbst und erfüllen dann wie alle anderen Aggregate die strenge Abgasnorm Euro 6d. Ebenfalls im vier-ten Quartal startet mit dem CLA Shoo-ting Brake die Kombiversion.
Führerscheinkontrolle
• Kontrolle per App oder patentiertem
LapID Siegel in flächendeckendem
Prüfstationsnetz.
• Höchster Manipulationsschutz sorgt für
führende Sicherheit in der Halterhaftung.
Fahrerunterweisung
• DGUV-zertifizierte, interaktive Inhalte.
• Effizienter als jede Präsenzveranstaltung.
• Einfach kombinierbar mit weiteren Lernin-
halten und der Führerscheinkontrolle.
www.lapid.de
Führerscheinkontrolle &
Fahrerunterweisung
[email protected] /4 89 7210 •
Besuchen
Sie uns am
21. + 22. Mai 2019
beim bfp Fuhrpark-
FORUM
Halle B3,
Stand 32
Anzeige
1 2
3
46 firmenauto Mai 2019
AUTO Range Rover Evoque
Man muss schon zweimal hinschauen, um den neuen Evoque zu erkennen. Andererseits: Wozu ein Design ändern, das nach acht Jahren noch
so revolutionär aussieht wie am ersten Tag und das für die meisten der weltweit 770.000 Evoque-Fahrer kauf-entscheidend war? Das aktuelle Modell übernimmt das Konzept des abfallenden Dachs samt den schma-len Fensterluken, baut jedoch auf einer neuen Platt-form auf. Die bringt mehr Radstand und somit etwas mehr Platz im Innenraum, was besonders die hinten sitzenden Mitfahrer gut finden. Zudem konnten die Briten mit der neuen Architektur technisch einiges ändern und vieles in die umfangreiche Preisliste auf-nehmen, was mittlerweile in einen modernen Firmen-wagen gehört. Matrix-LED-Scheinwerfer etwa, Head-up-Display oder ein digitales Cockpit.
Zusätzlich hat sich bei den Motoren einiges getan. Abgesehen vom Basisdiesel mit Handschaltung sind alle als Mild-Hybriden mit 48-Volt-Netz ausgelegt. Später sollen Dreizylinder folgen, darunter ein Plug-in Hybride. Alles natürlich, um den Verbrauch und den für die Hersteller wichtigen CO
2-Flottenausstoß
zu senken. Dass das in der Praxis funktioniert, konnte die erste Testfahrt jedoch nicht bestätigen. Trotz ruhi-ger Fahrweise meldete der Bordcomputer des allrad-getriebenen 240-PS-Diesel einen Schnitt von üppi-gen neun, der des 250-PS-Benziners über elf Liter. Und das, obwohl die 48-Volt-Systeme den beim Brem-sen gewonnenen Strom zum Boosten verwenden, die Motoren beim Beschleunigen also elektrisch unter-stützen. Außerdem wird bei geringer Last die Hin-terachse abgekoppelt.
Ein bisschen ökoSUV können toll aussehen, gut fahren und sogar ein klein
bisschen öko sein, wie der neue Range Rover Evoque zeigt.
von Hanno Boblenz
Mai 2019 firmenauto 47
Der Bildschirm in der Mitte ist breit, aber sehr flach. Die bessere Kartendarstellung liefert
das virtuelle Cockpit.
Dass man mit rund 250 PS flott vorwärts-kommt, versteht sich von selbst. Harmoni-scher klappt das mit dem Diesel. Weil er untenrum anständig schiebt und auch im mittleren Drehzahlbereich mehr Bums hat. Alternativ gibt’s noch zwei Diesel mit 150 und 180 PS. Beide sind für Vielfahrer und Anhängerzieher erste Wahl, auch bei even-tuellen Offroadausflügen.
Der Evoque ist ein Range Rover und damit ziemlich geländetauglichDabei unterstützen elektronische Fahrhilfen. Der Fahrer muss nur die richtigen Knöpfe drücken, schon tastet sich der Wagen in der vorgewählten Geschwindigkeit selbststän-dig durch Matsch und Morast, klettert steile Berge hoch und runter oder watet durch bis zu 60 Zentimeter tiefe Bäche. Damit der Fahrer auf dem Bildschirm immer sieht, was er unter die Räder nimmt, haben die Briten gleich noch eine nach unten gerichtete Kamera unter den Kühler geschraubt.
Das Cockpit ist zeitgemäß aufgeräumt, alles wird über den breiten, aber sehr fla-chen Bildschirm gesteuert. Deshalb emp-fiehlt es sich, das virtuelle Cockpit zu ordern, das eine vernünftige Straßenkarte hinters Lenkrad projiziert. Dass der Zen-tralbildschirm auf unserer Testfahrt mehr-fach aussetzte, schreiben wir dem frühen Serienstand zu. Vielleicht brauchte die Systemsteuerung auch einfach nur ein Update, das der Evoque jetzt über die inte-grierte SIM-Karte over the air aufspielt.
Zusätzlich bietet Range Rover einen digi-talen Rückspiegel. Es ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, wenn dort ein gestochen scharfes Kamerabild läuft, aber besser, als sich bei dachhoher Bela-dung oder mit drei Personen auf der Rück-bank nur auf die beiden Außenspiegel zu verlassen. Ganz im Trend der Zeit nimmt
sich die Marke nun verstärkt des Ökothemas an. So hat das SUV bis zu 33 Kilogramm Material aus recycelten Quellen an Bord, bis hin zum Lederimitat aus 53 geschredderten Halbliter-Kunststoff-flaschen. Oder wie wär’s mit einem Eukalyptusbezug aus Natur-fasern, die wenig Wasser brauchen? Beide sehr ansehnlich und angenehm anzufassen. Man muss kein Veganer sein, um die neuen Bezüge gut zu finden.
1 Bei einem Ausflug ins Gelände helfen dem Fahrer spezielle Fahrprogramme.
2 Der Vorderbau des Autos ist nicht durchsichtig. Dieses Bild liefert eine unter der Stoßstange mon-tierte Kamera.
1
2
Range Rover Evoque
0–100 Vmax Verbrauch2) CO22) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten3) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
D150 1.999 cm3 4 S/6 110 kW (150 PS) 380 Nm/1.750 10,5 s 201 km/h 6,2 l D 165 g 591–1.383 l 583 kg 31.386 Euro 68,6/45,2 ct/km BD1801) 1.999 cm3 4 A/9 132 kW (180 PS) 430 Nm/1.750 9,3 s 205 km/h 6,6 l D 176 g 591–1.383 l 599 kg 37.479 Euro 75,4/49,8 ct/km B
D2401) 1.999 cm3 4 A/9 177 kW (240 PS) 500 Nm/1.500 7,7 s 225 km/h 6,8 l D 181 g 591–1.383 l 555 kg 40.672 Euro 79,9/53,0 ct/km B
P2001) 1.998 cm3 4 A/9 147 kW (200 PS) 340 Nm/1.300 8,5 s 216 km/h 8,8 l S 204 g 591–1.383 l 585 kg 36.638 Euro 80,3/55,2 ct/km C
P2501) 1.998 cm3 4 A/9 184 kW (250 PS) 365 Nm/1.300 7,5 s 230 km/h 8,8 l S 205 g 591–1.383 l 537 kg 40.168 Euro 84,8/58,4 ct/km C
P3001) 1.998 cm3 4 A/9 221 kW (300 PS) 400 Nm/1.500 6,6 s 242 km/h 8,9 l S 207 g 591–1.383 l 525 kg 44.033 Euro 89,8/61,5 ct/km C
Herstellerangaben; 1) Allradantrieb; 2) WLTP; Motoren erfüllen Euro 6d-Temp 3) Bei 20.000/40.000 km pro Jahr, 60/36 Monate Laufzeit. Berechnet von
48 firmenauto Mai 2019
AUTO Skoda Scala
Als Scala – Lateinisch für Treppe – soll der Nachfolger des Rapid eine höhere Stufe erklimmen – was die Verkaufszahlen
angeht, aber auch im Hinblick auf die Quali-tät. Die technische Voraussetzung liefert eine Plattform des VW-Konzerns, die bereits VW Polo und Audi A1 nutzen. Sie erlaubt beispiels-weise einen langen Radstand, der Platz im Innenraum schafft. Über mangelnde Bewe-gungsfreiheit können die Passagiere im Scala jedenfalls nicht klagen. Auf der Rückbank sind die Mitfahrer nun fast so großzügig unter-gebracht wie im Octavia. Ellbogenfreiheit, Kof-ferraum, das Display vor dem Lenkrad, der Bildschirm über der Mittelkonsole: Alles fällt einen Tick größer aus als bei Polo & Co.
Sofern man das teuerste Unterhaltungs-system bestellt, addieren sich beispielsweise die beiden Displays zusammen auf fast 20 Zoll.
Der kleine GroßeAus dem Skoda Rapid wird der Skoda Scala: top vernetzt und spürbar
gereift. Ist er nun eine Alternative zu VW Golf und Skoda Octavia?
Das macht schon was her. Speziell, wenn sich der Fahrer die Navikarte im Breitformat ins Blickfeld klickt.
Vernetzung und Infotainment spielen ja mittlerweile in allen Neuwagen eine Rolle. Auch der Scala ist im LTE-Netz permanent online. Einen WLAN-Hotspot auf-zubauen, ist so einfach, wie einen Radiosender zu suchen, und ein Smartphone lässt sich mit ein, zwei Klicks inte-grieren. Sein Fahrtziel gibt der Fahrer entweder klas-sisch über die Touchscreentastatur ein oder bereits von außerhalb des Autos via Smartphone per Skoda-App und Google Maps. Alternativ nutzt er die Spracheingabe, die nun ganze Sätze versteht.
Über die Skoda-App lässt sich der Wagen zudem ins Fuhrparkmanagement integrieren. Bis zu fünf Personen können pro Fahrzeug freigeschaltet werden und Infos wie Kilometer- oder Tankfüllstand fernabfragen. Außerdem kann der Scala eine Push-Nachricht schicken, falls er gestohlen wird, einen zuvor definierten Bereich verlässt oder hinterlegte Geschwindigkeiten überschreitet.
von Hanno Boblenz
Mai 2019 firmenauto 49
1 Ein großes Glasdach lässt viel Licht in den Innenraum.
2 Das virtuelle Cockpit bekommt man zusammen mit der großen Navigation. Über eine bordeigene SIM-Karte ist der Skoda immer online. Die unterschiedlichen Dienste kann der Fahrer über Apps abrufen.
Skoda Scala
0–100 Vmax Verbrauch2) CO22) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten3) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
1.6 TDI 1.598 cm3 4 S/6 85 kW (116 PS) 250 Nm/1.600 10,1 s 201 km/h 4,8 l D 126 g 467–1.646 l 436 kg 18.067 Euro 48,1/31,9 ct/km A
1.0 TSI 999 cm3 3 S/6 85 kW (116 PS) 200 Nm/2.000 9,8 s 201 km/h 5,7 l S 129 g 467–1.646 l 484 kg 18.025 Euro 50,8/35,0 ct/km B
1.5 TSI 1.498 cm3 4 A/71) 110 kW (150 PS) 250 Nm/1.500 8,2 s 219 km/h 6,2 l S 140 g 467–1.646 l 475 kg 21.176 Euro 54,9/17,9 ct/km B
Herstellerangaben; Motoren erfüllen Euro 6d-Temp; 1) Doppelkupplungsgetriebe; 2) WLTP 3) Bei 20.000/40.000 km pro Jahr, 60/36 Monate Laufzeit. Berechnet von
Statt Firmenlogo trägt der Scala
nun einen großen Skoda-Schriftzug auf der Heckklappe. Die
LED-Rückleuchten sind Serie.
Serienmäßig liefert Skoda nur einen radargestützten Kollisionswarner mit Bremseingriff sowie einen Spurhalteassis-tenten. Auf Wunsch gibt es aber jede Menge andere Sicherheitstechnik, darun-ter einen Totwinkelwarner, dessen Radar die Straße hinter dem Auto nicht die üb lichen 20, sondern 70 Meter weit abscannt. Dass der Abstandstempomat bis 210 km/h funktioniert, dürften allerdings die wenigsten Käufer mitbekommen. So schnell fährt nur der 1.5 TSI, ein toller Motor, drehfreudig und durchzugsstark, aber sicher nicht der Antrieb für das Gros der Käufer, da mindestens 21.200 Euro teuer. Günstiger und kaum weniger dynamisch ist man mit dem 1.0 TSI unter-wegs. Schon im Octavia überzeugt der aus-gewogene und laufruhige Dreizylinder, doch zum kleineren und leichteren Scala passt er noch besser. Trotz des bescheide-nen Hubraums hängt er ausgesprochen gut am Gas, und wer’s nicht übertreibt, kommt gut mit den als WLTP-Verbrauch angege-ben 5,7 Litern aus.
Zum gleichen Preis gibt es alternativ den 1.6 TDI, allerdings mit schlechterer Aus-
stattung. Der hörbar nagelnde und etwas ruppigere Diesel ist allerdings kein Fall für Feingeister. Er empfiehlt sich nur für budgetbewusste Kilometerfresser, die bei sparsamer Fahrweise leicht bei unter fünf Litern pro 100 Kilometer bleiben. Wer wirklich sauber und sparsam unterwegs sein will, wartet auf die für Herbst angekündigte 90 PS starke Erdgasvariante des Dreizylinders. Das Fahrwerk haben die Tschechen relativ komfortabel ausgelegt. Alternativ bieten sie ein Sportfahrwerk mit adaptiven Dämpfern und zwei Fahrmodi sowie ein höher gelegtes Schlechtwegefahrwerk an.
Ist der Scala nun doch eine Alternative zum rund 1.500 Euro teureren Octavia? Ja, solange man keinen Kombi braucht und weil er das spürbar modernere Auto ist. Zumindest bis Ende 2019. Dann kommt der neue, deutlich größere Octavia und rückt den Abstand wieder zurecht.
1 2
50 firmenauto Mai 2019
AUTO Jaguar XE
Die Premiumkonkurrenz in Form von Audi A4, BMW 3er, Mercedes C-Klasse oder Volvo S/V 60 hält die Ingenieure bei Jaguar auf Trab. Schließ-
lich soll die Mittelklasselimousine XE im sensiblen Fir-menwagengeschäft Anschluss halten. So lautete der erste Auftrag an die Stylisten: »Lasst sie etwas moder-ner aussehen.« firmenauto findet: Mission erfüllt. Mit neuen Stoßfängern, größerem Grill, Voll-LED-Schein-werfern und schicken LED-Rückleuchten ist der Jag wieder up to date.
Wesentlich mehr hat sich im Innenraum und spe-ziell bei den Business-Lösungen getan. Smartphones etwa lädt der XE kabellos. In der von Schaltern und Knöpfen weitgehend befreiten Mittelkonsole befin-det sich ein neues Infotainmentsystem, Touch Pro Duo genannt. Es vereint gleich zwei große HD-Touch-
screens im Armaturenbrett. Das zehn Zoll große Dis-play im Cockpit übernimmt vorwiegend Navi-Auf-gaben. Der kleinere Touchscreen in der Mittelkonsole steuert Klima oder Telefon. Bedient wird er durch Klicken und Wischen oder über zwei Drehregler. Das Ganze ist logisch aufgebaut, ebenso wie die virtuel-len Instrumente im Sichtfeld. Bei den Top-Versionen XE und HSE ist die digitale Kommandobrücke Serie, ansonsten kostet sie 1.555 Euro samt Navi.
Mithilfe von Algorithmen erkennt der Wagen die Vorlieben seines Fahrers, passt beim Start Spiegel und Sitz, Radio oder Klima an. Schade nur, dass mit dem Facelift ein liebevoll-schrulliges Kleinod verlo-ren ging: Statt des Drehknopfs, der sich beim Start aus der Konsole erhob, steuert nun ein herkömmli-cher Schalthebel die Automatik. Und wie schon im
KatzenwäscheOptisch nur dezent überarbeitet fährt der Jaguar XE ins neue
Modelljahr. Wesentlich mehr hat sich unter dem Blech getan.
von Guido Borck
Jaguar XE
0–100 Vmax Verbrauch1) CO21) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten2) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
D 180 1.999 cm3 4 A/8 132 kW (180 PS) 430 Nm/1.750 8,1 s 228 km/h 5,5 l D 146 g 343–549 l 550 kg 36.714 Euro 74,1/49,6 ct/km B
P 250 1.997 cm3 4 A/8 184 kW (250 PS) 365 Nm/1.300 6,5 s 250 km/h 7,5 l S 177 g 343–549 l 539 kg 37.703 Euro 80,2/55,2 ct/km C
P 300 AWD 1.997 cm3 4 A/8 221 kW (300 PS) 400 Nm/1.500 5,7 s 250 km/h 8,0 l S 190 g 343–549 l 520 kg 42.134 Euro 86,0/59,3 ct/km D
Herstellerangaben; Motoren erfüllen Euro 6d-Temp; 1) WLTP ²) Bei 20.000/40.000 km pro Jahr, 60/36 Monate Laufzeit. Berechnet von
Kooperationspartner und empfohlen von:
Handy am Steuerist Blindflug am Steuer.sicherheit.car-mobility.de
carmobility GmbH ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.
Mai 2019 firmenauto 51
jüngst vorgestellten Range Rover Evoque hat auch im XE der klassische Innenspiegel ausgedient. Er wurde durch ein digitales Exemplar ersetzt. Kann man, muss man nicht haben. Einen wirklichen Fortschritt stel-len aber die vielen zusätzlichen Ablagen dar, die bis-her fehlten. Und natürlich die erweiterte Serienaus-stattung mit elektrischer Sitzverstellung, Parkpiepsern samt Rückfahrkamera sowie Spurhalteassistenten und Müdigkeitswarner.
Kein Motor unter 180 PSJaguar-Fahrer scheinen potente Motoren zu lieben, weshalb die Briten wegen geringer Nachfrage den 163-PS-Diesel und den 200 PS starken Einstiegsben-ziner strichen. Jetzt gibt’s vorerst nur einen 180 PS starken Diesel mit Potenzial für mehr Leistung. Die Benziner starten bei strammen 250 PS, immer in Kom-bination mit der flotten Achtstufenautomatik. Beide neuen Basistriebwerke haben reichlich Reserven. Da passen das straffe Fahrwerk und die präzise Lenkung gut. So positioniert sich der Jaguar als Firmenwagen der agilen Sorte. Im Sportmodus geht das Ganze sogar noch flotter. Der Automat wechselt noch schneller seine Stufen, die Lenkung greift direkter, und das adaptive Fahrwerk spannt die Muskeln. Erfreulich außerdem, dass der Komfortmodus tatsächlich die Dämpfer weicher stellt. So wird der XE auf Knopf-druck zum sanften Gleiter.
Die weiteren Leistungen überzeugen ebenso: Zusätzlich zu den drei Jahren Garantie übernimmt Jaguar die Inspektionen für drei Jahre oder 60.000 Kilometer. So hat auch das Unternehmen Freude am XE als Geschäftswagen.
1 Zwei große Bildschirme ergänzen das auf den Fahrer zugeschnittene Cockpit.
2 Über den Touchscreen lassen sich Klimaautomatik sowie die Audio- und Telefonfunktionen einstellen.
3 Der agile Jaguar gehört eindeutig zu der Spezies der sportlicheren Firmenwagen.
Anzeige
1
2
3
Kooperationspartner und empfohlen von:
Handy am Steuerist Blindflug am Steuer.sicherheit.car-mobility.de
carmobility GmbH ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.
Kooperationspartner und empfohlen von:
Handy am Steuerist Blindflug am Steuer.sicherheit.car-mobility.de
carmobility GmbH ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.
52 firmenauto Mai 2019
AUTO Honda Civic 1.6 i-DTEC
Jetzt steht endlich mal wieder ein Kompakt-wagen auf dem Firmenparkplatz, und dann ist er so lang. Mit 4,52 Metern sprengt der
Honda Civic die Grenzen seiner Klasse. Immerhin kommt auch innen einiges von der Länge an. Der Gepäckraum fasst mit 478 Litern mehr als üblich. Leider blieb die praktische Lösung mit dem Tank unter den Vordersitzen im Vorgänger stecken. Bei umgeklappten Rücksitzen steigt die Ladeflä-che an. Mitfahrer auf der Rücksitzbank freuen sich über die üppige Kniefreiheit, an den Köp-fen wird es für Größere eng. Auf den Vorder-sitzen reichen Kopf- und Beinfreiheit aus, die tiefe Sitzposition integriert den Fahrer gut in das Auto. Die Bedienung hakelt: Eine verwor-rene Menüführung und kleine Schaltflächen auf dem Touchscreen kosten Zeit. Immerhin lassen sich Smartphones verbinden.
Spannender ist bei Honda der Blick unters Blech. Dort werkelt ein 1,6-Liter-Diesel mit 120 PS, seine Abgase verlassen ohne Adblue-Reinigung Euro-6d-Temp-sauber den Auspuff. Der Selbstzünder läuft kultiviert und erstaun-
Länge läuftDer Honda Civic wurde mit dem letzten Modellwechsel deutlich länger und flacher. Damit
sprengt er fast den Rahmen der Kompaktklasse. Sein sparsamer Dieselmotor überzeugt.
lich kraftvoll. Die Neunstufenautomatik hat stets einen passen-den Gang parat und vermeidet unnötiges Hin-und-her-Schalten. Das niedrige Drehzahlniveau ist gut für den Verbrauch, der bei vorsichtigem Gasfuß unter fünf Litern bleibt und nur durch unsere schnell zurückgelegten Autobahnkilometer über die Sechs-Liter-Marke anstieg. Den positiven Fahreindruck unterstützen das gelungen abgestimmte Fahrwerk und die steife Karosserie. Spur-, Notbrems- und Abstandsassistent sind Serie.
So ist der feine Diesel ab 18.000 Euro zu haben. Leider gibt es kaum Einzeloptionen, weswegen die Elegance-Version mit Info-tainmentsystem, Einparkhilfe und einigen Komfortextras das Minimum für einen Geschäftswagen darstellt. Das Paket kostet 5.000 Euro, das Automatikgetriebe weitere 1.760 Euro. Empfeh-lenswertes LED-Licht bietet Honda erst im noch mal 2.500 Euro teureren Executive. Doch selbst dann bleibt der Honda noch unter vergleichbar ausgerüsteten deutschen Modellen.
von Immanuel Schneeberger
Honda Civic1.6 i-DTEC Automatik Elegance
Hubraum/Zylinder 1.597 cm3/4 Getriebe/Gänge A/9Leistung 88 kW (120 PS)Dreh moment 300 Nm bei 2.000/min0–100 km/h 10,9 sHöchstgeschwindigkeit 200 km/hTestverbrauch 4,9–7,2; Ø 6,3 l Dfirmenauto-Normrunde1) 4,9 l DWLTP-Verbrauch/CO2
5,1 l D/136 gEffizienzklasse A Kofferraum/Zuladung 478–1.245 l/500 kgPreis 24.782 EuroBetriebskosten2) 57,4/37,8 ct/kmMotor erfüllt Euro 6d-Temp; 1) 200 km lang, 2) 20.000/40.000 km p. a., 60/36 Monate
Das Heck fällt flach ab, doch darunter verbergen
sich 478 Liter Gepäckraum.
Wie sicher sind Ihre Fahrer?sicherheit.car-mobility.de
carmobility GmbH ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.
Kooperationspartner und empfohlen von:
54 firmenauto Mai 2019
AUTO Kaufberatung Kia Ceed
So Ceed es ausIn Rüsselsheim entwickelt, in der Slowakei gebaut: Der Kia Ceed ist ein
durch und durch europäisches Auto. Und als Firmenwagen eine durchaus
ernst zu nehmende Alternative in der Kompaktklasse. Eine Kaufberatung.
von Hanno Boblenz
Mai 2019 firmenauto 55
1 Die dritte Generation des Kia Ceed kam Mitte 2018 auf den Markt.
2 Übersichtliches Cockpit mit klassischen Instrumenten.
3 Auch von hinten kann sich der Fünftürer sehen lassen.
Kia Ceed, Verkaufsstart Juni 2018, Preis ab 13.437 Euro
Die Konkurrenten
Fragt man Flottenmanager nach dem Kia Ceed, so erntet man meist ein Kopf-schütteln. »Irgendwas Koreanisches«,
oder »Golf-Klasse« fällt vielen spontan ein. Tatsächlich tummelt sich das Kompaktmo-dell bereits seit 2006 zwischen Astra, Focus und Golf auf deutschen Straßen, damals noch als Cee’d.
Auch die seit Mitte 2018 verkaufte dritte Generation wurde in Rüsselsheim entwor-fen und läuft in der Slowakei vom Band. Sie verlor zwar den Apostroph im Namen, gewann dafür aber enorm an Format. Nicht nur, weil sie die bei einer Neuauflage übli-chen paar Zentimeter in jede Richtung gewachsen ist. Vielmehr stellen die Korea-ner mit dem aktuellen Ceed einen rundum ausgewogenen, hochwertigen und ernst zu nehmenden Kompaktwagen auf die Räder, welcher der etablierten Konkurrenz qualitativ auf die Pelle rückt. Außerdem bietet die Baureihe eine enorme Band-breite, vom Fünftürer für Alltagseinsätze bis zum geräumigen Kombi für Funktions-flotten. Der Proceed als attraktiver Shoo-ting Brake könnte manchem designorien-
tierten User-Chooser gefallen. Zudem hat Kia ein kompaktes Cross-over-Modell auf Basis des Ceed angekündigt.
Im Vergleich zum eher unauffälligen Vorgänger wirkt der aktuelle, flachere Ceed frisch und dynamisch, verzichtet dabei auf Design-spielereien. Extravaganzen wie Raumbeduftung, farbige Innenaus-leuchtung, lernfähige Sprachbedienung oder digitale Cockpits über-lässt Kia den Premiummarken. Hinterm Lenkrad sitzen hervorragend ablesbare analoge Rundinstrumente, das Navi läuft auf einem auf die Mittelkonsole gepflanzten Bildschirm, und sämtliche Schalter und Tasten sind logisch angeordnet. Das Ganze konsequent auf Nut-zerfreundlichkeit getrimmt, wie aus den Tagen, als sich Autos noch blind bedienen ließen.
In Sachen Sicherheit lässt das Entwicklungsteam ebenfalls nichts anbrennen. Im Test von »auto motor und sport« etwa brauchte
2
1
3
Ford Focus Verkaufsstart September 2018 Preis ab 15.714 Euro
Opel Astra Verkaufsstart Oktober 2015 Preis ab 15.500 Euro
Peugeot 308 Start 09/2013; Facelift 09/2017 Preis ab 16.386 Euro
Varianten und Motoren
Mit Fünftürer, Kombi und Shooting Brake ist der Ceed für alle Einsatzzwe-cke breit aufgestellt. Wer viel transportiert, kommt am Kombi mit seinem riesigen Gepäckraum nicht vorbei. Besonders praktisch ist die Öffnungs-automatik der Heckklappe: Nähert sich der voll bepackte Fahrer von hinten, surrt sie von selbst hoch. Der Kofferraum des Proceed schluckt ebenfalls viel, wegen der abfallenden Dachlinie ist er aber flacher.Den 100-PS-Basismotor mit 1,4 Liter Hubraum können wir nicht emp-fehlen. Der Spaßbremse fehlt ein Turbo. Der quirlige Einliter-Dreizylinder passt in der Stadt, tut sich allerdings bei höherem Tempo oder voller Beladung wegen des kleinen Hubraums etwas schwer. Vielfahrer mit 20.000 Kilometern und mehr können beruhigt zum Diesel (Speicherkat mit Adblue) greifen. Der mit 115 oder 136 PS lieferbare Selbstzünder überzeugt mit Laufruhe, anständigem Durchzug und ist sehr sparsam. Lediglich die leichte Anfahrschwäche stört. Zum dynamischen Proceed mit seiner sportlichen Ausstattung passen die beiden Turbobenziner jedoch besser. Der 140-PS-Motor ist ausgewogener, der 1.6 etwas spitzer ausgelegt. Dass da 204 PS losgelassen werden wollen, merkt man erst jen-seits von 4.000 Umdrehungen. Als Alternative zur knackig direkten Schal-tung gibt es für den stärkeren Diesel und die beiden großen Benziner ein sehr harmonisches Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (1.345 Euro).
56 firmenauto Mai 2019
AUTO Kaufberatung Kia Ceed
Kia Proceed
0–100 Vmax Verbrauch1) CO21) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten2) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
1.6 CRDi 1.598 cm3 4 S/6 100 kW (136 PS) 280 Nm bei 1.500/min 10,4 s 200 km/h 4,8 l D 125 g 594–1.545 l 462 kg 24.866 Euro 57,6/38,3 ct/km A+
1.4 T-GDI 1.353 cm3 4 S/6 103 kW (140 PS) 242 Nm bei 1.500/min 9,1 s 210 km/h 5,9 l S 135 g 594–1.545 l 462 kg 23.269 Euro 59,1/41,2 ct/km B
1.6 T-GDI 1.591 cm3 4 S/6 150 kW (204 PS) 265 Nm bei 1.500/min 7,6 s 230 km/h 7,4 l S 168 g 594–1.545 l 459 kg 26.210 Euro 65,6/46,1 ct/km C
Herstellerangaben; Motoren erfüllen Euro 6d-Temp; 1) WLTP. 2) Bei 20.000/40.000 km/Jahr und 60/36 Monaten Nutzung.
Kia Ceed Sportswagon
0–100 Vmax Verbrauch1) CO21) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten2) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
1.6 CRDi 1.598 cm3 4 S/6 85 kW (115 PS) 280 Nm bei 1.500/min 11,1 s 192 km/h 4,6 l D 121 g 625–1.694 l 495 kg 18.899 Euro 49,4/32,8 ct/km A+
1.6 CRDi 1.598 cm3 4 S/6 100 kW (136 PS) 280 Nm bei 1.500/min 10,4 s 198 km/h 4,7 l D 125 g 625–1.694 l 495 kg 21.000 Euro 52,0/34,4 ct/km A+
1.4 1.368 cm3 4 S/6 73 kW (100 PS) 134 Nm bei 3.500/min 12,6 s 183 km/h 6,6 l S 153 g 625–1.694 l 503 kg 14.277 Euro 47,7/33,1 ct/km C
1.0 T-GDI 998 cm3 3 S/6 88 kW (120 PS) 172 Nm bei 1.500/min 11,1 s 190 km/h 5,5 l S 127 g 625–1.694 l 506 kg 16.882 Euro 51,5/35,5 ct/km B
1.4 T-GDI 1.353 cm3 4 S/6 103 kW (140 PS) 242 Nm bei 1.500/min 9,1 s 208 km/h 5,8 l S 135 g 625–1.694 l 498 kg 18.899 Euro 54,8/38,0 ct/km B
Kia Ceed
0–100 Vmax Verbrauch1) CO21) Kofferraum Zuladung Preis Betriebskosten2) EffizienzHubraum Zyl. Getriebe Leistung Drehmoment
1.6 CRDi 1.598 cm3 4 S/6 85 kW (115 PS) 280 Nm bei 1.500/min 10,9 s 192 km/h 4,6 l D 121 g 395–1.291 l 492 kg 18.059 Euro 48,9/32,7 ct/km A+
1.6 CRDi 1.598 cm3 4 S/6 100 kW (136 PS) 280 Nm bei 1.500/min 10,4 s 198 km/h 4,7 l D 125 g 395–1.291 l 442 kg 20.160 Euro 51,3/33,9 ct/km A+
1.4 1.368 cm3 4 S/6 73 kW (100 PS) 134 Nm bei 3.500/min 12,6 s 183 km/h 6,6 l S 152 g 395–1.291 l 500 kg 13.437 Euro 47,1/32,5 ct/km C
1.0 T-GDI 998 cm3 3 S/6 88 kW (120 PS) 172 Nm bei 1.500/min 11,1 s 190 km/h 5,5 l S 127 g 395–1.291 l 503 kg 16.042 Euro 50,9/35,0 ct/km B
1.4 T-GDI 1.353 cm3 4 S/6 103 kW (140 PS) 242 Nm bei 1.500/min 9,1 s 208 km/h 5,8 l S 135 g 395–1.291 l 455 kg 18.563 Euro 54,2/37,1 ct/km B
1.6 T-GDI 1.591 cm3 4 S/6 150 kW (204 PS) 265 Nm bei 1.500/min 7,5 s 230 km/h 6,3 l S 168 g 395–1.291 l 354 kg 24.025 Euro 64,1/44,8 ct/km D
4.310 mm
1.4
47 m
m
2.650 mm
Der schicke Shooting- Brake-Proceed ist das jüngste Modell der Ceed-Familie.
Je nach Ausstattung ist der Kombi Funk-tionsfahrzeug oder
Dienstwagen.
Kia Ceed 1.6 CRDiHubraum/Zylinder 1.598 cm3/4 Getriebe/Gänge S/6
Motorleistung 100 kW (136 PS) Drehmoment 280 Nm bei 1.500/min
0–80/–100/–140 km/h 7,0/10,1/17,0 s1) Höchstgeschwindigkeit 198 km/h
60–100 km/h 5,7 s1) 80–120 km/h 7,4 s1)
Bremsweg kalt aus 100/130 km/h 33,5/57,2 m1)
Wendekreis rechts/links 11,1/11,1 m1)
Leergewicht 1.388 kg
WLTP-Verbrauch/CO2 4,7 D/125 g Effizienzklasse A+
firmenauto-Normrunde2) 5,2 l D Testverbrauch 4,3–6,0; Ø 5,7 l D1) Messwerte von »auto motor und sport« für 1.6 CRDi Kombi; 2) 200 km lang
Multimedia
748 Euro kostet das Navigationssystem inklusive Achtzollbildschirm, DAB-Radio und vernünftig klingender Lautsprecher. Das System überzeugt, da es logisch aufgebaut und einfach zu bedienen ist. Karten werden übersichtlich abgebildet, und wer plötzlich von der Route abweicht, bekommt blitzschnell eine Alternative präsentiert. Außerdem ist es onlinefähig – da keine SIM-Karte verbaut ist, allerdings nur über ein Smartphone samt Hotspot, dessen Datentarif das System nutzt. Nachteil: Zum Empfang kann das Handy nicht die Autoantenne nutzen. Zudem muss man die WLAN-Verbindung zum Handy bei jedem Start neu aktivie ren. Trotzdem funktioniert die Anbindung gut. Das Navi zeigt nicht nur Onlineverkehrsdaten, sondern auch freie Parkhäuser und Tankstellen samt Kraftstoffpreisen. Bei unseren Testfahrten lotste das Online-Navi sogar genauer als Google Maps.
der Kombi bei einer Vollbremsung aus 100 km/h nur 33,5 Meter, bis er stand. Neben standfesten Bremsen punktet das Modell mit einer umfangreichen Sicher-heitsausstattung. Einen jedoch unangenehm stark in die Lenkung eingreifenden Spurhaltehelfer gibt’s ebenso wie Abstandstempomat oder Totwinkelwarner.
Wer wirklich viel transportieren muss, dem legen wir den Sportswagon ans Herz. Für knapp 800 Euro
Aufpreis bekommt man einen Wagen, dessen Koffer-raum manchen Mittelklassekombi alt aussehen lässt.
Der Sitzkomfort passt in allen Modellen der Bau-reihe. Die straffen Polster lassen einen selbst nach einem langen Tag hinterm Steuer ohne Rücken-schmerzen aussteigen, und Platz genug hat man auch auf der Rückbank. Da stört nur die tiefe Kante der Vordersitze. Füße passen kaum darunter.
In Sachen Agilität hat der Ceed deutlich gewon-nen. Der Fünftürer federt gut und lässt sich durch-aus dynamisch bewegen, wozu auch die direkte Len-kung beiträgt. Sportswagon und Proceed sind etwas härter abgestimmt. Der Kombi, weil er eher vollge-laden wird, der Proceed wegen seines tiefergelegten Sportfahrwerks. Spaß beim Fahren machen sie alle. Vorbei sind also die Zeiten, als man einen Kia einzig deswegen kaufte, weil es vernünftig war.
Allerdings sind die Preise auch nicht mehr ganz so volkstümlich wie früher. Sie starten zwar bei nur 13.436 Euro, doch mehr als die Auto-Basics bekommt man mit dem 100 PS starken Sauger des 1.4 Attract auch nicht. Will man einen Ceed als vernünftig aus-gestatteten Firmenwagen fahren, sollte man mit gut 21.000 Euro rechnen.
Dafür liefert Kia entweder einen 140 PS starken Turbobenziner oder für knapp 22.350 Euro den 136 PS starken Diesel, jeweils in der Ausstattung Spirit. Ein vergleichbarer Peugeot 308 (Benziner und Diesel, je 130 PS) kostet rund 1.300 Euro mehr, ein ähnlicher Astra in Business-Ausstattung bewegt sich in glei-chen Preisregionen. Der Kia punktet dafür mit sie-ben Jahren Garantie, was speziell Unternehmen mit gekauften Firmenwagen einen echten Vorteil beim Wiederverkauf bringt.
1 Die Platzverhältnisse hinten gehen in Ordnung.
2 Auch der Kofferraum ist groß genug.
3 Die Heckklappe des Fünf-türers schwingt wie beim Kombi weit hoch, was das Beladen erleichtert.3
1
2
58 firmenauto Mai 2019
AUTO Kaufberatung Kia Ceed
Ausstattung
Kia unterteilt das Angebot in sechs Ausstattungslinien, wobei nur der 100-PS-Benziner für 13.437 Euro in der Basisversion Attract angeboten wird.Alle Ceed-Modelle kommen mit einem guten Sicherheitspaket in Form von sechs Airbags, aktivem Spurhalte assistenten, Kollisionswarner samt Bremsein-griff und LED-Tagfahrlicht. Dazu gibt’s ein Radio samt Bluetooth. Edition 7 (plus 1.680 Euro; Basis für 1.0 T-GDI, 1.6 CRDi 115 PS) bringt Klimaanlage, 16-Zöller und den variablen Ladeboden. Dieses Niveau reicht für Funk-tionsflotten.Ab Vision (weitere 2.100 Euro; Basis für 136-PS-Diesel, 1.4 T-GDI) rollt der Ceed auf 16 Zoll
großen Alurädern und leuchtet mit statischem Abbiegelicht in die Kurve. Dazu kommen etliche Features, die man im Firmenwa-gen nicht missen will, etwa die Smartphone-Anbindung per Apple Car Play, Lederlenkrad, Sitzheizung und die wegen der unübersichtlichen Karosserie sinnvollen Parkpiepser samt Rückfahrkamera.Die für den Geschäftswagen empfehlenswerteste Linie heißt Spirit (weitere 1.200 Euro). Sie beinhaltet wichtige Assistenten wie Totwinkel- oder Querverkehrswarner. Außerdem reagiert der Kollisionswarner erst in dieser Version auf Fuß-gänger. DAB-Radio, 17-Zöller und LED-Scheinwerfer sind
weitere Goodies, die man nicht missen will.Die sportlich ausgelegte GT-Line (plus 700 Euro) bringt hauptsächlich optische Ände-rungen wie einen schwarzen Kühler, Zierleisten und Alupe-dale. Die Sitze sind in einer Stoff-Ledernachbildung bezogen.Zum echten Sportler wird der Ceed nur als 204 PS starker 1.6 T-GDI GT: Hier kombiniert Kia optische Gimmicks wie 18-Zoll-Räder, Seitenschwel-ler, den Klappenauspuff oder rote Bremssättel. Dazu gibt’s Leder-Velours-Sitze mit roten Ziernähten.Als Platinum (4.300 Euro mehr als GT-Line) ist der Ceed voll ausgestattet. Geliefert werden
beispielsweise beheizbare Ledersitze, induktive Ladeschale oder Navi inklusive Verkehrs-zeichenerkennung. Selbst der Parkassistent fehlt nicht.Zusätzlich hat Kia jede Menge Ausstattungspakete aufgelegt, die sich allerdings nicht mit allen Linien kombinieren lassen. Grundsätzlich gilt: je höher die Linie, desto mehr Extras. So gibt es für den 100-PS-Benziner Attract lediglich noch die Option, eine Klimaanlage (832 Euro) und die Fußgängererken-nung (327 Euro) zu bestellen. Für die von uns präferierte Ausstattung Spirit empfehlen wir die Navigation (748 Euro) und das große Glasdach für 832 Euro).
1 Apple Car Play ist ab Vision Serie, die induktive Ladeschale ab Spirit erhältlich.
2 Für die stärkeren Motoren gibt es ein 1.360 Euro teures Siebengang-Doppelkupplungs-getriebe.
3 Alle Ceed haben LED-Tagfahr-licht vorn. LED-Scheinwerfer sind ab Spirit Serie.
4 Parkassistent zum Quer- und Längseinparken.
5 Die Diesel brauchen Adblue. Der Einfüllstutzen sitzt prakti-scherweise unterm Tankdeckel.
6 Geschickt: Der Spurhalte-assistent lässt sich schnell per Knopfdruck abschalten.
7 Bis zu 18 Zoll große Räder.
1
5
3
2
4
Preise 1.6 CRDi (136 PS)Vision 20.159 EuroSpirit 22.345 EuroGT-Line 23.100 EuroPlatinum 27.470 Euro
6 7
Mai 2019 firmenauto 59
Antrieb 1.598 cm3; 4 Zylinder; 6-Gang- Schaltung, FrontantriebLeistung 136 PS; Drehmoment: 280 Nm; 0–100 km/h: 10,4 s; Vmax: 198 km/hWLTP-Verbrauch 4,7 l D; 125 g CO2
Karosserie L/B/H: 4.310/1.800/1.447 mmKofferraum 395–1.291 l; Zuladung: 442 kg
Grundpreis 20.160 EuroTeuerung 3.210/1.869Gebundenes Kapital 15.051/15.271
Festkosten in Euro/Jahr
Kapitalverzinsung 1.264/1.283Abschreibung 2.773/4.174Steuer 212Haftpflicht (HP 15, R7)1) 771Vollkasko (VK 21/TK 19, R4)1) 972Unterstellung/Garage 573Festkosten pro Jahr 6.565/7.985Festkosten in ct/km 32,8/20,0
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 5,8Reifen 2,2Wartung und Reparatur 10,5/5,9Summe variable Kosten 18,5/13,9Gesamtkosten2) 51,3/33,9 ct/km
Antrieb 1.499 cm3; 4 Zylinder; 6-Gang- Schaltung, FrontantriebLeistung 120 PS; Drehmoment: 300 Nm; 0–100 km/h: 10,0 s; Vmax: 196 km/hWLTP-Verbrauch 4,6 l D; 117 g CO2
Karosserie L/B/H: 4.378/1.825/1.454 mmKofferraum 375–1.354 l; Zuladung: 532 kg
Grundpreis 21.345 EuroTeuerung 3.399/1.979Gebundenes Kapital 15.383/15.683
Festkosten in Euro/Jahr
Kapitalverzinsung 1.292/1.317Abschreibung 3.164/4.751Steuer 195Haftpflicht (HP 15, R7)1) 771Vollkasko (VK 21/TK 17, R4)1) 972Unterstellung/Garage 573Festkosten pro Jahr 6.966/8.579Festkosten in ct/km 34,8/21,5
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 5,9Reifen 2,1Wartung und Reparatur 10,7/6,0Summe variable Kosten 18,7/14,0Gesamtkosten2) 53,5/35,5 ct/km
Antrieb 1.598 cm3; 4 Zylinder; 6-Gang- Schaltung, FrontantriebLeistung 136 PS; Drehmoment: 320 Nm; 0–100 km/h: 9,4 s; Vmax: 213 km/hWLTP-Verbrauch 4,8 l D; 127 g CO2
Karosserie L/B/H: 4.370/1.809/1.485 mmKofferraum 370–1.210 l; Zuladung: 522 kg
Grundpreis 19.958 EuroTeuerung 3.178/1.850Gebundenes Kapital 14.103/14.805
Festkosten in Euro/Jahr
Kapitalverzinsung 1.185/1.244Abschreibung 3.003/4.357Steuer 216Haftpflicht (HP 16, R7)1) 807Vollkasko (VK 22/TK 20, R4)1) 1.053Unterstellung/Garage 573Festkosten pro Jahr 6.837/8.250Festkosten in ct/km 34,2/20,6
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 5,9Reifen 2,2Wartung und Reparatur 10,4/5,9Summe variable Kosten 18,5/14,0Gesamtkosten2) 51,7/34,6 ct/km
Antrieb 1.499 cm3; 4 Zylinder; 6-Gang- Schaltung, FrontantriebLeistung 130 PS; Drehmoment: 300 Nm; 0–100 km/h: 9,8 s; Vmax: 204 km/hWLTP-Verbrauch 4,5 l D; 118 g CO2
Karosserie L/B/H: 4.253/1.804/1.457 mmKofferraum 420–1.228 l; Zuladung: 555 kg
Grundpreis 21.513 EuroTeuerung 3.426/1.994Gebundenes Kapital 16.201/16.440
Festkosten in Euro/Jahr
Kapitalverzinsung 1.361/1.381Abschreibung 2.907/4.354Steuer 195Haftpflicht (HP 18, R7)1) 890Vollkasko (VK 23/TK 21, R4)1) 1.113Unterstellung/Garage 573Festkosten pro Jahr 7.038/8.505Festkosten in ct/km 35,2/21,3
Variable Kosten in ct/km
Kraftstoff 5,7Reifen 2,2Wartung und Reparatur 10,0/5,3Summe variable Kosten 17,9/13,2Gesamtkosten2) 53,1/34,5 ct/km
Bei 20.000 km/Jahr und 60 Monaten Nutzung
Bei 40.000 km/Jahr und 36 Monaten Nutzung
Modell Wartung Verschleiß Summe Wartung Verschleiß Summe
Kia Ceed 1.6 CRDi 758 1.869 2.627 1.006 1.409 2.415
Ford Focus 1.5 Eco Blue k. A.1) k. A.1) k. A.1) k. A.1) k. A.1) k. A.1)
Opel Astra 1.6 Diesel 1.321 1.550 2.871 1.076 1.273 2.349
Peugeot 308 130 Blue HDi 943 1.193 2.126 830 908 1.738Angaben in Euro. 1) Daten liegen nicht vor
ModellPreis inkl.
Ausstattung
Wertverlust bei 20.000 km/Jahr und
60 Monaten Nutzung
Wertverlust bei 40.000 km/Jahr und
36 Monaten Nutzung
Kia Ceed 1.6 CRDi 23.386 61,9 % 14.350 62,1 % 14.400
Ford Focus 1.5 Eco Blue 23.386 69,5 % 16.250 68,7 % 16.050
Opel Astra 1.6 Diesel 22.951 72,9 % 16.750 72,4 % 16.600
Peugeot 308 130 Blue HDi 24.739 69,3 % 17.150 68,7 % 17.000
Händlereinkaufswerte in Euro
Kia Ceed
1.6 CRDi Vision
Ford Focus
1.5 Eco Blue Trend
Opel Astra
1.6 Diesel Business
Peugeot 308
Blue HDi 130 Active
Foto
s: T
ho
mas
Kü
pp
ers
(11)
Betriebskosten
Restwert prognosen
Wartungs- und Verschleiß kosten
Herstellerangaben. 1) Versicherung (70 Prozent) mit 500 Euro SB einschließlich Teilkasko mit 150 Euro SB. 2) Bei 20.000/40.000 km/Jahr und 60/36 Monaten Nutzung.
Der Ceed ist das jüngste Modell in der Kompaktklasse. Trotzdem erstaunt es, dass die Restwertprognose für den Korea-ner so hoch ausfällt. Auch das ein Zeichen für die hohe Qualität des Wagens.
Sowohl bei hohen Laufleistungen und kurzer Haltedauer als auch bei längerer Nutzung fallen die Werkstattkosten beim Peugeot 308 deutlich günstiger aus als bei den Vergleichsmodellen.
Motor erfüllt Euro 6d-Temp Motor erfüllt Euro 6d-Temp Motor erfüllt Euro 6d-Temp Motor erfüllt Euro 6d-Temp
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der
BMW 3er um einen Rang verbessert.
3
2
1
Mercedes macht anschei-nend gute Preise: Obwohl die C-Klasse nicht eben zu den Schnäppchen zählt, schafft sie’s auf Rang zwei.
Am VW Passat kommt man nicht vorbei. Warum auch, er ist einfach ein gutes und vielseitiges Auto.
Betriebskosten, Restwert, Wartungsaufwand: Der Kostenvergleich
nimmt in jedem Heft ein anderes Segment unter die Lupe und nennt
die Kosten für die meistverkauften Firmenwagen.
Kostenvergleich
Mittelklasse
Die meistverkauften Mittelklasse-Firmenwagen
1 VW Passat Variant 2.0 TDI
2 Mercedes C-Klasse T-Modell 220 d
3 BMW 3er Touring 320d
4 Audi A4 Avant 2.0 TDI
4 Skoda Superb Combi 2.0 TDI
6 Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel
7 Ford Mondeo Turnier 2.0 Eco Blue
8 BMW 3er Gran Turismo 320d xDrive
9 Audi A5 Sportback 40 TDI
10 Volvo V60 D4
Zeitraum: September 2018 bis Februar 2019 verbessert verschlechtert gleich
60 firmenauto Mai 2019
AUTO Kostenvergleich
von Hanno Boblenz
Die sparsamsten Diesel1)
Die sparsamsten Benziner1)
Wartungs- und Verschleißkosten
Bei 20.000 km/Jahr und 60 Monaten Nutzung Wartung Verschleiß Summe
Bei 40.000 km/Jahr und 36 Monaten Nutzung Wartung Verschleiß Summe
1 Skoda Superb Combi 2.0 TDI 1.004 1.553 2.557 1 Volvo V60 D4 1.030 1.178 2.208
2 Volvo V60 D4 1.215 1.459 2.674 2 Skoda Superb Combi 2.0 TDI 1.101 1.269 2.370
3 VW Passat Variant 2.0 TDI 1.145 1.697 2.842 3 Opel Insignia ST 2.0 Diesel 1.083 1.440 2.523
4 Opel Insignia ST 2.0 Diesel 1.459 1.791 3.250 4 VW Passat Variant 2.0 TDI 1.178 1.403 2.581
5 BMW 320d GT xDrive 1.020 2.322 3.342 5 BMW 320d GT xDrive 1.394 1.836 3.230
6 BMW 320d Touring 1.017 2.382 3.399 6 BMW 320d Touring 1.376 1.898 3.274
7 Audi A5 Sportback 40 TDI 1.309 2.131 3.440 7 Audi A5 Sportback 40 TDI 1.606 1.712 3.318
8 Audi A4 Avant 35 TDI 1.414 2.184 3.598 8 Audi A4 Avant 35 TDI 1.732 1.734 3.466
9 Ford Mondeo Turnier 2.0 EB k. A.1) k. A.1) k. A.1) 9 Ford Mondeo Turnier 2.0 EB k. A.1) k. A.1) k. A.1)
10 Mercedes C 220 d T-Modell k. A.1) k. A.1) k. A.1) 10 Mercedes C 220 d T-Modell k. A.1) k. A.1) k. A.1)
Angaben in Euro. 1) Keine Daten verfügbar
Wertverlust
Preis inkl. Ausstattung
Bei 20.000 km/Jahr und 60 Monaten Nutzung
Bei 40.000 km/Jahr und 36 Monaten Nutzung
1 Skoda Superb Combi 2.0 TDI 30.706 65 % 19.800 63 % 19.250
2 Audi A5 Sportback 40 TDI 41.122 66 % 27.050 65 % 26.750
3 BMW 320d GT xDrive 44.647 68 % 30.200 67 % 29.700
4 Volvo V60 D4 36.924 70 % 25.950 68 % 24.950
5 BMW 320d Touring 39.815 70 % 27.750 68 % 27.150
6 Audi A4 Avant 35 TDI 38.601 71 % 27.500 69 % 26.750
7 VW Passat Variant 2.0 TDI 31.655 72 % 22.650 69 % 22.000
8 Opel Insignia ST 2.0 Diesel 31.454 72 % 22.650 70 % 21.850
9 Mercedes C 220 d T-Modell 43.223 72 % 31.250 70 % 30.250
10 Ford Mondeo Turnier 2.0 EB k. A.1) k. A.1) k. A.1) k. A.1) k. A.1)
Angaben in Euro. 1) Keine Daten verfügbar
Betriebskosten
Hubraum Zylinder Leistung Verbrauch1) CO21) Preis Betriebskosten2)
1 Skoda Superb Combi 2.0 TDI 1.968 cm³ 4 110 kW/150 PS 5,4 D 142 g 26.429 Euro 60,1/39,8 ct/km
2 Opel Insignia ST 2.0 Diesel 1.956 cm³ 4 125 kW/170 PS 5,6 D 148 g 26.097 Euro 60,9/40,2 ct/km
3 VW Passat Variant 2.0 TDI 1.968 cm³ 4 110 kW/150 PS 5,3 D 139 g 28.080 Euro 62,0/41,1 ct/km
4 Ford Mondeo Turnier 2.0 EB 1.995 cm³ 4 110 kW/150 PS k. A. k. A. 27.395 Euro 65,3/42,7 ct/km
5 Audi A4 Avant 35 TDI 1.968 cm³ 4 110 kW/150 PS 5,5 D 143 g 34.412 Euro 68,8/45,7 ct/km
6 Volvo V60 D4 1.969 cm³ 4 140 kW/190 PS 5,1 D 134 g 34.202 Euro 69,0/46,0 ct/km
7 Mercedes C 220 d T-Modell 1.950 cm³ 4 143 kW/194 PS 5,5 D 144 g 36.970 Euro 71,9/47,2 ct/km
8 BMW 320d Touring 1.995 cm³ 4 140 kW/190 PS 5,5 D 145 g 35.420 Euro 72,7/47,4 ct/km
9 Audi A5 Sportback 40 TDI 1.968 cm³ 4 140 kW/190 PS 5,3 D 139 g 36.933 Euro 73,3/48,4 ct/km
10 BMW 320d GT xDrive 1.995 cm³ 4 140 kW/190 PS 6,2 D 164 g 40.462 Euro 77,2/51,3 ct/km
Modell erfüllt Euro 6d-Temp. 1) WLTP 2) Bei 20.000/40.000 km/Jahr und 60/36 Monaten Nutzung.
Audi, BMW, Mercedes, VW – in keiner Liga sind die deutschen Hersteller so gut vertreten wie in
der Mittelklasse. Wer hier den Fuß in die Tür der Fuhrparks bekommt, kann mit hohen Stückzahlen rechnen. Es ist bekannt in der Branche, dass dies oft über kräftige Nachlässe klappt. Da kön-nen und wollen viele Importeure ein-fach nicht mithalten. Andererseits erfül-len Passat, C-Klasse & Co. perfekt die Anforderungen an einen Geschäfts-wagen. Obwohl sich Assistenzsysteme
und Konnektivitätslösungen in allen Fahrzeugklassen verbreitet haben, ist die Auswahl in der Mittelklasse immer noch am größten.
Ob irgendwann ein anderes Modell die Vormachtstellung des Passat knackt? Bleibt abzuwarten. Der ewig Erste bekommt im Herbst 2019 ein Facelift. Doch auch die anderen schla-fen nicht. Der neue Peugeot 508 hat auch viel zu bieten und könnte nächs-tes Jahr durchaus unter den Top Ten zu finden sein.
1) Alle Angaben nach NEFZ.
Mai 2019 firmenauto 61
Peugeot 508 Blue HDi 130; 130 PS; 28.529 Euro
1
Kia Optima 2.0 GDI PIH; 205 PS; 31.235 Euro2)
1 37 g CO2
1,6 l S/100 km
VW Passat 1.6 TDI DSG; 120 PS; 27.370 Euro
2 107 g CO2
4,1 l D/100 km
Volvo S60 T8 PIH; 390 PS; k. A.
2 44 g CO2
1,9 l S/100 km
Mercedes C 200 d; 160 PS; 31.340 Euro
3 108 g CO2
4,1 l D/100 km
Ford Mondeo 2.0 Hybrid; 187 PS; 33.487 Euro
3 96 g CO2
4,2 l S/100 km
VW Passat 2.0 TDI; 150 PS; 27.160 Euro
3 108 g CO2
4,1 l D/100 km
Lexus IS 300h; 223 PS; 32.353 Euro
4 104 g CO2
4,6 l S/100 km
VW Arteon 2.0 TDI; 150 PS; 33.050 Euro
4 109 g CO2
4,2 l D/100 km
Skoda Superb 1.5 TSI ACT; 150 PS; 23.403 Euro
5 118 g CO2
5,2 l S/100 km
99 g CO2
3,8 l D/100 km
1) Alle Angaben nach NEFZ.2) 3.000 Euro Umweltbonus bereits abgezogen
62 firmenauto Mai 2019
AUTO Vergleich Sprachassistenten
Sag’s frei SchnauzeNach Apple Siri und Google Assistant drängt mit Amazon Alexa ein weiterer
Sprachassistent ins Auto. Mercedes kontert mit dem eigenen, besonders aufs
Auto ausgelegten Dienst MBUX. Wer gehorcht am besten?
von Dirk Gulde
»Hey Mercedes, ich hab’
Kohldampf«
Mai 2019 firmenauto 63
Sprachassistenten sollten in der Lage sein, logische Schlüsse aus den Kommandos zu ziehen.
Von Liebe auf das erste Wort kann bei der Sprach-bedienung im Auto nun wirklich keine Rede sein. Obwohl die Entwicklung schon in den 1980er-
Jahren begann, redeten Mensch und Maschine lang aneinander vorbei. Mehr als schlichte Navi-Adressen oder Telefonnummern verstand die einfache Auto-Hardware bis vor Kurzem meist nicht.
Die Sprachassistenten der drei großen Internetkon-zerne laden Kommandos hingegen auf ihre Server, wo sie von leistungsfähigen Rechnern analysiert wer-den. Dies versetzt sie in die Lage, natürliche Sprache zu verstehen, ohne dass Anwender an Schlüsselbe-griffe oder konkrete Formulierungen denken müs-sen. Über ein gekoppeltes Handy funktionieren Apple Siri und Google Assistant auch im Fahrzeug und lassen die Eingabesysteme der meisten Autobauer ziemlich alt aussehen. Jetzt drängt mit Amazon ein weiteres IT-Schwergewicht ins Fahrzeug, und Seat gelang es als erstem Hersteller, Amazons Assisten-tin Alexa zu integrieren.
Mercedes MBUXDoch die Autobauer wollen Sprachassistenten nicht mehr länger anderen überlassen. Beim Infotainment-System MBUX, das in der A-Klasse debütierte, nutzt Mercedes ebenfalls das Cloud-Prinzip. Autohersteller haben prinzipiell den Vorteil, die Sprach-assistenz mit Fahrzeugfunktionen koppeln zu können, um auch Heizung oder Bordcomputer zu steuern.
Das funktioniert zum Teil prima. So genügt es, »Hey, Merce-des, wie viel Sprit ist im Tank?« zu sagen, und schon nennt die Assistentin die Restreichweite in Kilometern. Selbst Nebensäch-liches wie »Stell das Ambientelicht auf Rot« setzt das System ohne Nachfrage um. Zudem ist das zusammen mit Nuance ent-wickelte System in der Lage, logische Zusammenhänge zu erkennen: »Mir ist kalt« deutet MBUX als Aufforderung, die Heizung ein Grad höher zu schalten. Infotainment-Eingaben wie Navigationsadressen versteht MBUX ebenfalls mit hoher Trefferquote. Um mit der A-Klasse sprechen zu können, muss mindestens das Basis-Navigationspaket für 1.140 Euro bestellt werden, das mit einer SIM-Karte zum Datenaustausch ausge-stattet ist.
Doch zu hohe Erwartungen sollte man nicht hegen: Mit »Fahr mich zur günstigsten Tankstelle« fing das System nichts an, obwohl auf dem Bordmonitor die Spritpreise umliegender Zapf-säulen angezeigt werden. Bei »Navigiere mich zu einem Bäcker auf meiner Route« wurden auch Bäckereien genannt, die abseits davon liegen. Und die für Mietwagenfahrer interessante Frage »Auf welcher Seite ist der Tankdeckel?« führte zu kompletter Verwirrung.
Mercedes teilt hierzu auf Nachfrage mit, dass das System am Anfang seiner Entwicklung stehe und nach und nach mit wei-teren Funktionen versehen werde. Dafür punktet MBUX auf zwei anderen Gebieten: Da die klassische Onboard-Sprach-steuerung parallel zur Cloud-Variante eingebaut wird, lassen sich viele Sprachfunktionen auch im Funkloch nutzen. Und wer lieber mit Assistenten aus Fleisch und Blut redet, ruft einfach den Concierge-Service an.
Amazon Alexa Zudem funktioniert MBUX auf Anhieb, was man von Alexa im Seat nicht behaupten kann: Um den Dienst im Kompakt-SUV Ateca zum Laufen zu bekommen, muss zunächst Seats Media-Control-App aufs Handy geladen werden. Das Smartphone wird dann per Bluetooth gekoppelt, anschließend auch noch als WLAN-Hotspot, um überhaupt eine Internetverbindung aufbauen zu können.
Doch was die Steuerung von Fahrzeugfunktionen betrifft, lohnt sich der Aufwand nur bedingt: Beim Test ließen sich zwar Radiostationen und Navigationsadressen eingeben, doch Anfra-gen zum Spritvorrat oder zu Sonderzielen entlang der Route verliefen ergebnislos. Auch die Klimaanlage ließ sich nicht ein-stellen. Kurios endete die Frage nach Staus, worauf im Handy-Display eine Internetseite mit der aktuellen Verkehrslage erschien – in winziger Schrift.
Bei Funktionen, die nichts mit dem Auto zu tun haben, stellte sich der Dienst wesentlich besser an: Den nächsten Termin
64 firmenauto Mai 2019
AUTO Vergleich Sprachassistenten
Viele allgemeine Funktionen
Problemlose Installation, pfiffige Dienste, gute Erkennung Fummelige Instal-
lation, Smartphone wird als Modem benötigt
Keine Verbindung zur Fahrzeug-elek tronik, keine Offline-Funktionen
im Kalender nannte Alexa umgehend. Zudem greift sie bei entsprechendem Abo auf Millionen Songs von Amazon Music zu oder nimmt Bestellungen der Ver-sandhaus-Mutter entgegen, sofern die 1-Click-Option eingestellt wurde. Auch vernetzte Heimgeräte lassen sich so steuern. Doch all dies funktioniert auch mit der Alexa-App auf dem Handy, der Mehrwert durch die Verbindung mit der Autoelektronik hält sich in überschaubaren Grenzen.
Siri und Google AssistantDie Assistenten von Apple und Google sind ohnehin ans Handy gebunden, sie lassen sich jedoch auch im Fahrzeug nutzen, sofern das eingebaute Infotainment-System Apple Car Play oder Android Auto unterstützt. Das Reisen machen die Systeme komfortabler, weil sie Restaurants am Zielort per Sprachsuche finden, die Wetteraussichten kennen oder sich Whatsapp-Nach-richten diktieren lassen, ohne dass die Hände vom Lenkrad genommen werden müssen. Wird ein Radio-
Amazon Alexa Apple Siri
Trotz Integration in die Ateca-Elektronik ließen sich nur wenige Fahrzeugfunkti-onen steuern, dafür umso mehr Dienste, die nichts mit Autofahren zu tun haben. Alexa unterstützt inzwischen über 50.000 Skills. So heißen die vernetzten Dienste, mit denen sich die smarte Tech-nik verschiedenster Hersteller steuern lässt.
Um Siri über die Car-Play-Oberfläche zu nutzen, genügt ein USB-Kabel, bei einigen BMW- und Audi-Modellen so-gar Bluetooth und WLAN. Dann lassen sich ausgewählte Apps wie Whatsapp, Spotify oder die Navi-App-Karten per Sprache steuern. Sonderziele entlang der Route findet Siri jedoch nicht.
TestergebnisAmazon Alexa1)
Apple Siri2)
Google Assistant3)
Mercedes MBUX
Bewertung FunktionsumfangFunktionsumfang Fahrzeug/Infotainment 10 4 3 4 6
Funktionsumfang Reise/Sonstiges 10 6 8 8 5
Zwischenergebnis Funktionsumfang 20 10 11 12 11
Sonstige BewertungskriterienOffline-Modus 3 0 0 0 3
Concierge-Dienste 2 0 0 0 2
Erkennungsqualität 5 3 3 5 4
Bedienung/Installation 5 1 4 3 5
Summe 15 4 7 8 15
Gesamtergebnis 35 14 18 20 261) via Seat; 2) über Car Play; 3) über Android Auto
Mai 2019 firmenauto 65
Beste Erkennungs-qualität im Test, viele allgemeine Funktionen
Einfache Bedienung, auch offline nutzbar
Keine Auto- Anbindung, Bluetooth- und USB-Verbindung erforderlich
Funktionsumfang ausbaufähig
sender gewünscht, öffnet Google die Internetradio-App Tune In, während Apple auf den UKW-Tuner im Auto schaltet und den zuletzt eingestellten Sender spielt – immerhin.
Wer die Navigationsfunktion des Handys nutzt, kann zudem Zieladressen aufsprechen oder sich zu Geschäften und Sonder-zielen entlang der Route führen lassen. Sich Staus auf der Strecke durchsagen zu lassen, funktionierte jedoch in beiden Fällen nicht, obwohl Google Maps und Apple-Karten diese
Google Assistant Mercedes MBUX
Über ein per Android Auto gekoppel-tes Handy macht sich Googles Assis-tant unterwegs nützlich. Wer Google Maps nutzt, kann sich während der Zielführung von vielen praktischen Sprachdiensten unterstützen lassen. Allerdings können nur Apps gesteuert werden, die kompatibel mit Android Auto sind.
Ohne zusätzlichen Installationsauf-wand startet der Sprachassistent von Mercedes auch ohne Knopfdruck auf den Befehl »Hey, Mercedes«. Die Er-kennungsqualität war sehr ordentlich, obwohl nicht alle Befehle ausgeführt werden konnten. Hier gibt es noch sehr viel Luft nach oben.
detailliert einzeichnen und die Behinderungen daher kennen müssten. Dafür lassen sich die unterstützten Musik-Apps wie Spotify per Sprache steuern.
Zudem begeistern beide Systeme mit ihrer hohen Erkennungsrate bei den Sprachansagen. Google hatte hier die Nase vorn und schnitt von allen vier Assis-tenten am besten ab. Selbst lange und undeutlich dahingenuschelte Befehle wurden fast immer kor-rekt verstanden.
FazitDie Alexa-Integration im Seat Ateca enttäuscht durch die komplizierte Anbindung und den begrenzten Funktionsumfang bei Fahrzeugdiensten. Obwohl bei-des bei Mercedes besser gelöst ist, spürt man deutlich, dass sich das System am Anfang seiner Karriere be findet. Mercedes muss schnell nachlegen, um es lebendig zu halten. Wie komplex das Thema ist, zeigt sich daran, dass selbst bei den Software-Profis Apple und Google nicht alles rundläuft.
Alexa zum Nachrüsten
Auch Fahrer älterer Autos sollen die Sprachassistentin bald an Bord holen können. In den USA bietet Amazon für 25 US-Dollar ein kleines Kästchen mit dem Namen Echo Auto an. Über acht Mikrofone soll es Kommandos auch bei Fahrgeräuschen im Hintergrund verstehen. Gekoppelt wird’s per Smartphone- Alexa-App, Strom kommt über USB oder Zigarettenanzünder. Wann Echo nach Deutschland kommt, ist noch unklar.
firmenauto – Mobilität & Management
ISSN 1618-4998
Redaktion firmenauto/ www.firmenauto.de Hanno Boblenz (Chefredakteur), Martin Schou, Immanuel Schneeberger, Juliane Dünger/Sumita Brumbach (Assistenz)
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Annett Boblenz, Guido Borck, Thilo Jörke (Dekra), Dirk Gulde, Wolf-Henning Hammer (Kanzlei Voigt), Peter Ilg, Uwe Schmidt-Kasparek, Alex Manschatz, Axel Schäfer (Fuhrparkverband)
Grafik/Produktion: Frank Haug (Ltg.); Florence Frieser, Monika Haug, Oswin Zebrowski, Marcus Zimmer
Schlussredaktion: Schlussredaktion.de
Internet: Thorsten Gutmann (Ltg.); Jan Grobosch (Grafik/Produktion)
Sekretariat, Leserservice: Uta Sickel, Tel.: 07 11/7 84 98-31
Verlag: EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH Das Gemeinschaftsunternehmen von Dekra, Motor Presse Stuttgart und VF Verlagsgesellschaft
Geschäftsführer: Oliver Trost
Anschrift von Verlag und Redaktion: Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Tel.: 07 11/7 84 98-31 Fax: 07 11/7 84 98-88 Internet: www.firmenauto.de E-Mail: [email protected]
Anzeigen: Thomas BeckTel.: 07 11/7 84 98-98 Fax: 07 11/7 84 98-29 Anzeigenverwaltung: Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG Anzeigenabteilung firmenauto Nicole Polta Postfach, 70162 Stuttgart Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart Tel.: 07 11/1 82-13 87Vertrieb: Bernd Steinfeldt (Ltg.) Gerlinde Braun, Tel.: 07 11/7 84 98-14Sylvia Fischer, Tel.: 07 11/7 84 98-18E-Mail: [email protected]: Thomas EiseleDruck: Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 168 34121 Kassel Printed in Germany
Erscheinungsweise: jährlich 11 Hefte,
Einzelheft 4,00 Euro, Bezugspreis für
Deutschland jährlich 44,00 Euro. Studenten
bezahlen gegen Vorlage einer Immatrikula-
tionsbescheinigung 26,40 Euro im Inland.
Bezugspreis für die Schweiz jährlich 85,80
sfr, Bezugspreis für Österreich jährlich
49,50 Euro, übrige Auslandspreise auf
Anfrage.
Die Mitglieder von Dekra erhalten
firmenauto im Rahmen ihrer Mitglied-
schaft als Beilage in trans aktuell. Höhere
Gewalt entbindet den Verlag von der
Lieferungspflicht, Ersatzansprüche können
nicht geltend gemacht werden. Alle Rechte
vorbehalten, © by ETM Verlags- und
Veranstaltungs-GmbH.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte,
Fotos oder Zeichnungen übernimmt der
Verlag keine Haftung. Alle Preise im Heft
ohne Mehrwertsteuer außer bei Büchern,
Software und Gebühren.
Abonnenten-/Leserservice:
firmenauto, Vertrieb
Postfach 81 02 07, 70519 Stuttgart
Tel.: 07 11/7 84 98-14/-18
Fax: 07 11/7 84 98-46
E-Mail: [email protected]
Web: www.firmenauto.de/shop
Anzeigenpreisliste Nr. 25,
2019
Gerichtsstand Stuttgart
66 firmenauto Mai 2019
Das Thema der Leasingrückgabe war schon in den 90er-Jahren aktu-ell. Auch damals beleuchtete
firmenauto die typischen Mängel, die Leasinggesellschaften monieren. Und auch damals schon gab es detaillierte Kataloge, welche Beschädigungen in der Regel akzeptiert würden. »Hingenom-men werden kleine Beulen an Türen und Stoßstangen. Diese sollten allerdings nicht größer als ein bis drei Zentimeter und nicht tiefer als ein Millimeter sein«, so hieß es im Text. Außerdem seien kleine Bohrlöcher außerhalb des Sicht-
felds, wie sie etwa für die Befestigung von Zubehör nötig seien, kein Problem. Heute hingegen akzeptieren die Leasing-firmen derartige Beschädigungen eher nicht.
Hauptproblem vor 20 Jahren: Einige Leasingnehmer glaubten, mit den Raten sei alles bezahlt. Dass es den Leasing-gesellschaften nicht um Abzocke gehe, wollten deren Vertreter klarstellen. »Keine Leasinggesellschaft kann es sich leisten, den Zustand bei der Rücknahme anders zu bewerten als etwa ein Händ-ler«, sagte Horst Kolditz von der ALD.
Impressum
Ende mit SchreckenWas firmenauto 1999 über die Leasingrückgabe schrieb.
FIRMENAUTO Ausgabe 05/1999
FIRMENAUTO VOR 20 JAHREN • IMPRESSUM
Ohne Probleme geht
Gummiabrieb an Stoß-
stangen, Spoilern und
Zierleisten durch.
firmenauto-Autor Hans-Jürgen Götz
Schwäbisch Hall18. Oktober 2019
Siegen15. Oktober 2019test drive
test drive
Wählen Sie aus zwei Terminen
15. Oktober 2019 in Siegen 18. Oktober 2019 in Schwäbisch Hall
TIPP: Kombinieren Sie den fi rmenauto test drive mit dem Signal Flottentag am 17. Oktober 2019in Schwäbisch Hall. Informationen und Anmeldung: www.fl ottenbeschrifter.de/fl ottentag
Weitere Infos und Anmeldung: www.fi rmenauto.de/testdrive2019
Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihre kostenlose Teilnahme!
Exklusives Fahrevent für Fuhrparkleiter +
WorkshopsWLTP und kein Ende – alles zu Euro 6d-Evap
Der passende Antriebfür jeden Einsatz
Foto
: Fo
tolia
(1)
Kraftstoff verbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Jeep® Compass MY19 Longitude 1.4l MultiAir 103 kW (140 PS) E6D 4x2 MT6:
innerorts 8,7; außerorts 5,7; kombiniert 6,8. CO2-Emission (g/km): kombiniert 155.
Eine schnelle, leistungsstarke Geschäftswelt braucht ein genauso starkes Fahrzeug:
Der Jeep® Compass bietet reizvolle Extras für Geschäftskunden zu attraktiven Konditio-
nen. Genießen Sie die Annehmlichkeiten der ausgewählten Materialien sowie innovativen
Technologien und Konnektivitätslösungen, die jede Geschäftsreise komfortabel und
besonders sicher machen.
BUSINESS LEASING AB MTL. 214,– € NETTO1
DIE NEUE GESCHÄFTSWAGENKLASSE.DER JEEP® COMPASS.
¹ Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbe-kunden, für den Jeep
® Compass MY19 Longitude 1.4l MultiAir 103 kW (140 PS) E6D 4x2 MT6 zzgl. Überführungskosten
und MwSt., inkl. GAP-Versicherung; Monatsrate 214,– € (exkl. MwSt.), Gesamtlaufl eistung 40.000 km, Laufzeit 48 Monate, ohne Leasingsonderzahlung.
² 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Jeep® Neuwagenanschlussgarantie inkl. europaweiter Mobilitäts-
garantie der Allianz Versicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen.
Angebot für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Jeep® Compass
MY19 Longitude 1.4l MultiAir 103 kW (140 PS) E6D 4x2 MT6 bis 30.06.2019. Nicht kombinierbar mit allen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Jeep
® Partnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.