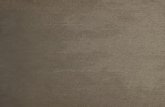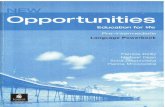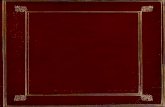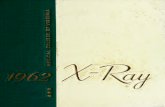Akteure, Akten und Archive
Transcript of Akteure, Akten und Archive
Jakob Tanner: Akteure, Akten und Archive, in: Claudia Kaufmann, Walter Leimgruber (Hg.), Was Akten bewirken können, Zürich 2008, S. 150-160, französische Übersetzung: Ce que des Dossiers peuvent provoquer, Ebd., S. 161-170.
Prof. Jakob Tanner, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
und Historisches Seminar der Universität Zürich
Akteure, Akten und Archive
Die folgenden Ausführungen können bei diesem thematisch weit gespann
ten Thema weder eine Zusammenfassung noch einen summarischen
Parcours durch das Programm der Tagung und des Bandes bieten. Es ist auch
nicht sinnvoll, eine Schwachstellenanalyse zu versuchen. Was folgt, ist
eine problemorientierte Bündelung einiger Erkenntnisse und Überlegungen,
die an einigen Stellen theoretisch vertieft werden. Man könnte sagen,
dass ich eine Reflexion versuche, die sich um das dreht, was möglicherweise
die «blinden Flecken» der Tagung sind. Damit verwende ich eine Metapher,
die während der Präsentationen schon gefallen ist. «Blinde Flecken»
lassen sich durch ihre Identifikation nicht auflösen, sondern höchstens
etwas verschieben.
Das Spektrum der argumentativen Positionen, die in den Beiträgen eingenommen wurden, war sehr weit. Es fielen einige Namen, die Referenzpunkte in theoretischen Debatten markieren. Ungefähr die Hälfteder Beiträge rekurrierte allerdings auf Max Weber und Michel Foucault(vgl. Weber ~002 und Foucault 2003, 2004, 2005). Diese beiden Exponenten geraten in der Literatur häufig in scharfen Widerstreit. Es gibtdie Anhänger des einen, die mit dem anderen nichts anfangen können,und umgekehrt. Ich denke, es ist eine Qualität dieser Tagung, sich nichtauf diese Spiegelfechtereien eingelassen, sondern sich einfach einmaleinige Optionen offen gehalten zu haben. Das schien mir keine K~~pitu
lation vor theoretischen Herausforderungen zu sein. Vielmehr zeigt sichhier eine Art produktiver Eklektizismus, eine pragmatische Hybridisierung theoretischer Potenziale. Da kann etwas dabei herauskommen. Soweit einige Vorbemerkungen. Die weiteren Ausführungen gliedern sichin drei Stichworte: Betroffene, Akten und Formulare, Archiv.
AkteureHier möchte ich zunächst etwas Grundsätzliches erwähnen zum Prob-lemhorizont, den das NFP 51 aufgespannt hat. Die Begriffe Integrationund Ausgrenzung sind fundamental ambivalent. Innerhalb des norma-
150
tiven Koordinatensystems einer modernen Gesellschaft, eines demokratischen Verfassungs- ~undRechtsstaats,wird Integration in der Regelpositiv und Ausschluss negativ bewertet. Dies deshalb, weil diese Gesellschaften aufeine Dynamisierung der Integration angelegt sind, was sichauch in der langen Ge·schichte von sozialen Emanzipationsbewegungenzeigt, die es - häufig mit Erfolg - geschafft haben, zu ihrem Recht zukommen, das heisst Rechte einzufordern, die andere schon hatten unddie sich auf diese Weise generalisiert haben. Zu erwähnen ist die Emanzipation der Juden, die im schweizerischen Bundesstaat erst 1874 gleichberechtigte Bürger wurden, oder der langwierige Kampf der Frauen umdas Stimm- und Wahlrecht, der auf Bundesebene erst 1971 zum Erfolgführte. Ein trauriges Kapitel forcierter Ausgrenzung stellen auch diegegen so genannte «Zigeuner», gegen Roma, Sinti und Jenische gerichteten Diskriminierungsmassnahmen (wie die Einreisesperre von 1906, das«Zigeunerregister» von 1911 und die Kindswegnahmen des «Hilfswerksfür die Kinder der Landstrasse» ab 1926) dar, die erst seit den 1970erJahren öffentlich kritisiert und zurückgenommen wurden. Ausschlussund Ausgrenzungsprozesse sind aus dieser Perspektive negative Phänomene, sie werden von einem rechtsstaatlichen Standpunkt aus als Indikatoren für Funktionsdefizite und misslingende Solidarität gedeutet.
Nun hat aber die Geschichte des modernen Nationalstaats seitdem 19. Jahrhundert auch gezeigt, wie rasch Integration in Anpassungszumutungen, in Assimilations- und Internalisierungszwänge sowie inInternierungsgewalt umschlagen kann. Die Heterotopie des Gefängnisses und der Anstalt realisierte sich im 19. Jahrhundert durch dasParadigma des Ausschlusses durch Einschliessung. Es zeigen sich hierFormen der Ausgrenzung, die in umgekehrter Blickrichtung als Internierung oder erzwungene Integration sichtbar werden. Auch wenn eHeLegitimation solcher Institutionen fin der bürgerlichen Gesellschaftgrundsätzlich nicht bestritten wurde, entzündeten sich an den Kriterien und Modalitäten der Einschliessung doch immer wieder moralische und politische Konflikte. Der moderne Nationalstaat, der auf derTrias «Volk, Territorium und Staat» basiert, verhärtete im 19. Jahrhundert nicht nur die Grenzziehung nach aussen, sond~ern setzte auch eineHomogenisierungstendenz nach innen frei, die sich nach dem ErstenWeltkrieg auch mit völkischen und ethnischen Reinheitsvorstellungenund - insbesondere in der Schweiz - mit einer obsessiven Überfremdungsangst paarte. Es lässt sich neben Al.lsgrenzungsreflexen auch einAssimilationsdruck feststellen, der sich mit dem Angriff auf Freiheitsräume und Persönlichkeitsrechte paarte. Im «Hilfswerk für die Kinderder Landstrasse» zeigt sich auch diese Tendenz zur Zwangsassimilation:Gleichzeitig mit der Ausgrenzung der «Zigeuner» integrierte man diemitunter auch mit brachialer Gewalt von ihren Eltern entrissenen Kin-
151
der in «normale» und «ordentliche» SchweizerfamiUen. In solchen Assimilationsaktionen manifestiert sich ein «Nicht-Aushalten-Können» vonDifferenz. Es verschwindet der Respekt vor dem Anderssein. Angesichtssolcher Phänomene wird der Schutz einer kultur~l1komplex differenzierten Gesellschaft vor den Homogenitätszumutungen des Nationalprinzips zu einem Postulat, das sich auch menschenrechtlich begründen lässt. Es gilt, das Recht auf das «Nicht-Dazugehören-Müssen» zuverteidigen. Es ist nicht nötig, alles Fremde entweder zurückzuweisen
oder es im Eigenen auflösen zu wollen.Wenn wir allerdings vom Recht auf Differenz und vom Respekt
vor dem Fremden ausgehen, so müssen wir uns wiederum mit demProblem des otheringauseinander setzen. Mit otheringwird in der Kulturwissenschaft die Tendenz bezeichnet, andere Gruppen als fremdwahrzunehmen, was es möglich macht, sich der eigenen Identität durcheine verstärkte Wahrnehmung und Verabsolutierung von Differenzengegenüber anderen Gruppen zu versichern. Die Gesellschaft erscheintdann als von unterschiedlichsten Gruppierungen bevölkert, die so weitvoneinander entfernt sind, dass sie sich nur in einer gleichgültigen Multikulturalität begegnen können (gleichgültig im Doppelsinne des Wortesvon «indifferent» und «gleich gültig»). Die Tendenz, die Anderen durchein othering zu Fremden zu machen, die man dann als «Andere» allenfalls respektieren kann, ist selbst Ausdruck der Integrationsprobleme,die sich in einer durch Migration gekennzeichneten modernen Gesellschaft stellen. Diese äussern sich in einer Identitätssuche, die durch Differenzproduktion zu ihrem Ziel kommt. Die positive Bewertung dieserkulturellen Unterschiede kann allerdings selbst als Resultat einer Ausund Abgrenz~ngsbewegunginterpretiert werden, welche die Kehrseiteder Assimilationszumutung darstellt. Es zeigt sich hier eine Zirkularitätin der Problemstellung, die keine einfache Zuordnung ermöglicht. Menschenrechte weisen in ihrer Anwendungslogik generell eine aporetischeStruktur auf. Wer sie als universelle Prinzipienverteidigt, neigt gleichzeitig zu einer apodiktischen Haltung und Rechthaberei, die betriebsblindwird für kulturelle Differenz und die persönliche Rechte wiederum verletzen kann. Wer umgekehrt eine kulturrelativistische Sichtweise postuliert und einen generalisierten Respekt vor dem «Anderen» fordert,praktiziert allenfalls Toleranz gegenüber Menschenrechtsverletzungen.Deshalb ist auch bei der Analyse menschenrechtlicher Positionen einehistorische Perspektive gefordert. Wann Integration in Zwangsassimilation umschlägt und unter welchen Bedingungen Ausgrenzung auch dasRecht auf autonome Freiräume beinhalten kann, hängt von konkretengesellschaftlichen Konstellationen ab. Wir müssen also die entsprechenden Kategorien zu historisieren versuchen. Das heisst, wir müssen aufkontextsensitive Analysen hinarbeiten, die dem Bedeutungs- und Funk-
152
tionswaildel dieser Kategorien gerecht werden können. In seinem Einleitungsstatement erklärte Walter Leimgruber, dass die Frage nach denBetroffenen einen wichtigen Ausgangspunkt des NFP 51 darstelle. Dasheisst: Es geht nicht a~straktum Ein- und Ausschluss, sondern es wirduntersucht, was mit Betroffenen passiert. Wenn wir jetzt sagen würden,die Betroffenen, das sind einfach Menschen, mit denen was passiert, dieverwaltungstechnisch traktiert werden, dann würde das auf eine sehreinfache Versuchsanordnung hinauslaufen. Man könnte dann einfachschauen, was ist mit ihnen passiert. Schwieriger wird es, wenn Betroffene effektiv betroffen werden durch das, was ihnen widerfährt undwas sie erleben. Wenn ihr Selbstverständnis, ihre Subjektivität durchdie politischen Autoritäten, die Formen bürokratischer Herrschaft,die medizinische Definitionsmacht und die rechtlichen oder klinischen Kategorien geprägt werden, wird die Analyse komplexer. Betroffene sind dann auch in ihren authentischen Äusserungsformen Teil derperformativen Macht von Verwaltungsroutinen und sozialen Beziehungen. Wir wissen, und die Labeling-Theorien haben das immer wieder gezeigt, dass stigmatisierende oder ganz einfach charakterisierende Etiketten die Eigenschaft haben, jene, die sie tragen oder denensie aufgedrückt wurden, zu beeinflussen. lan Hacking spricht hier vonlooping effects, das heisst von Prozessen, durch die Heterostereotypenund Selbstverständnisse wechselseitig verstärkt werden (vgl. Hacking1999 und 2006). Je nach den Etiketten, mit denen sie versehen werden,je nach den bürokratischen Umgangsformen, in die sie involviert sind,
~ werden sie zu anderen «Betroffenen». Machtausübung verändert Selbstbilder, Persönlichkeitsvorstellungen und Subjektivierungsweisen. AuchAkten als papierenes Substrat bürokratischer Herrschaft sind ein Element dieser Veränderungsdynamik. Deshalb können wir nicht ohneweiteres in Kategorien wie «hat sein Einverständnis gegeben» oder «hatfreiwillig mitgemacht» arbeiten, denn dieses Einverstandensein ka,;nnselbst das Resultat der festgelegten Prozedur sein, der eine «Betroff@he»oder ein «Betroffener» ausgesetzt wird. Hier äussert sich die performative Macht von therapeutischen Routinen und Verwaltungsmassnahmen als das Fehlen von Alternativen oder als Erwartungsdruck. DieseEffekte zeigen sich nicht nur bei Patientinnen und Patienten, sondernauch auf Seiten der Ärzte. Es ist sinnvoll, vom «Subjekt» in seiner Doppeldeutigkeit auszugehen - das ist ein Punkt, der sich weiter ausführenliesse -: Das Subjekt - im Sinne von subjectere - als das Unterworfene,das schon immer einer Macht Unterstellte, und das Subjekt als subjectum, als das Zugrundeliegende - zugrunde liegend auch in dem Sinne,dass Subjekte auch in ihrer Unterworf~nheitimmer' wieder als eigensinnig Handelnde, die neue Weisen der Aneignung praktizieren, kenntlich werden (vgl. Tanner 2004).
153
Akten
Der Basler Historiker Martin Schaffner hat einen Aufsatz «VerrückterAlltag» publiziert, der sich nochmals mit Erving Göffrnan (1973) befasst(vgl. Schaffner 2007). Schaffner setzt sich mit Fallmaterial auseinander,er interessiert sich für die formale und inhaltliche Ausgestaltung vonPsychiatrieakten, in denen sich Prozesse sedimentierten, die sich um1900 in ganz Europa beschleunigten. Es geht um Quellenaggregate, dieAusdruck der zunehmenden Effizienz bürokratischer Zugriffe auf Devianz sind. Und es steht die Verrechtlichungstendenz zur Diskussion, diedamals im «Irrenwesen» - und auch in anderen Bereichen - festzustellen war. Diese bürokratischen Verfahren des Protokollierens, des Kommunizierens, des Evaluierens·können meines Erachtens am besten aufdrei Effekte hin untersucht werden, die heute alle zur Sprache kamen,die ich nochmals systematisieren möchte:
Einmal geht es um die Routinisierung der Erfassung, um eineserielle, standardisierte Umgangsweise mit Formularen, aber auch mitMenschen, die sie - aktiv schreibend - ausfüllen oder die - als Objekteeiner Investigation - ausgefragt oder beobachtet werden. Beide Malewerden bestimmte Merkmale, Angaben und Sachverhalte in Felder eingetragen. Ein durch solche formale Schablonen geschärfter Blick siehtdie Welt gleichsam durch einen Raster bürokratischer Erfassung hindurch. Durch diesen werden soziale Interaktionen und Kommunikationssituationen strukturiert. Formulare weisen eine synchrone Synopsis auf, sie werden häufig in Aktenbeständen aufbewahrt, die diachronangeordnet sind und in denen sich auch Dokumente finden, die Regieanweisungen für Handlungsabläufe geben und die Verwaltungsaktein ihrer Kon~ekution organisieren. Administrative Dokumente strukturieren komplexe Verfahren über längere Zeiträume hinweg und stellen wiederum eine Materialisierung solcher Strukturen dar. So gesehen sind Akten beides: Repräsentationen und performative Kräfte. Inihrer ersten Funktion repräsentieren sie Verwaltungshandeln, die wirpost festum als Spuren der Vergangenheit lesen können. In der letzterenFunktion können wir sie als handlungsleitende Vorschriften lesen, diemit ihrer agency einen von den Intentionen der Beteiligten unabhängigen Einfluss auf den Gang der Dinge ausüben und diese auf administrative Pfadabhängigkeiten festlegen. Diese Problematik ist - das hat sichgezeigt - schwierig zu fassen. Ob sie überhaupt erkannt wird, hängt vomStandort, von der Perspektive, ab. Die Sozialgeschichte hat es in ihrerklassischen Ausformung fertig gebracht, Menschen als Akteure generell zu annullieren, sie auf Struktureffekte zu reduzieren. Einmal zuPunkten in einer statistischen Repräsentation, in einer Streuwolke vonTatbeständen geworden, kann man sie anschliessend mathematischmodellieren. Heraus kommen dann langfristige konjunkturelle Wech-
154
sellageri, .Strukturen sozialer Ungleichheit oder Muster der räumlichenVerteilung von Menschen. Auf analoge Weise lassen sich auch Aktenstilllegen, indem man sie verdinglicht und als Dokumentation von vergangenem Handeln v.on Menschen betrachtet. Demgegenüber hat dieGeschichtswissenschaft schon seit langem gefordert, dass die Produktionsbedingungen der Dokumente und die Formen ihrer Tradierunganalysiert werden müssen. Da, würde ich sagen, lohnt sich ein anderesVerständnis auf die Akten - auf diesen Punkt komme ich bei den Archiven noch zurück.
Zweites kann man lernen, dass es Verfahren der Klassifikation,der Kategorisierung, der Sortierung, der Rubrizierung sind, die durchFormulare und Akten vorgespurt und angeleitet werden. Mit dieseradministrativen Normierung wird auch ein Kosmos der Abweichungengeschaffen. Es werden - als Abweichungen vom Zustand der Gesundheit - Krankheitsbilder definiert, womit eine klassifikatorische Ordnung in die Unordnung des Pathologischen gebracht werden kann. Inder Zeit um 1900 entstand in der Psychiatrie ein neues nosologischesSystem, das aufeine Ätiologie, das heisst aufAnnahmen über die Krankheitsursachen, bezogen wird. Wir stossen auf grundlegende Innovationen, wie jene von Eugen Bleuler, der 1911 den Begriff der Schizophrenieprägte, und wir erkennen die Herausbildung eines forensisch-psychi- ..atrischen Praxisfeldes, mit dem sich die Psychiater mit ihren Gutach-ten und ihrer Expertise ihren Aktionsradius in die Gesellschaft hineinerweitern (vgl. hierzu Germann 2004). Dies hatte Auswirkungen auf dieStrafjustiz, auf das, was wir als eugenisches Feld bezeichnen können,oder auf die im Ersten Weltkrieg geschaffene «Fremdenpolizei», diesich mit der «Ausländerfrage» befasste. Es wäre wichtig, diese Unterscheidungskriterien und Klassifikationssysteme, ihre Überlappungenund dann auch ihre Unterschiede in einer vergleichenden Perspektivezu analysieren.
Der dritte Punkt auf den ich hinweisen möchte, ist das Problemder gesellschaftlichen bzw. der gruppen-, schicht- und religionsspezifischen Akzeptanz dieses Umgangs mit Devianz und Krankheiten. Wienahmen unterschiedliche Bevölkerungsschichten diese Abweichungen wahr? Es lässt sich eine verblüffende Normalität im Umgang mitNormabweichungen konstatieren. Wir haben heute manchmal Mühezu verstehen, wie einfach Massnahmen durchgeführt werden konnten,die nicht nur aus heutiger Sicht sehr problematisch sind, sondern dieschon damals nur schwer zu vereinbaren waren mit dem ordre public.Es gibt die Meinung, die fehlende Problematisierung sei das Resultat derdamaligen Mentalitäten, Ideologien und Sensibilitäten, die sich von denheutigen unterscheiden. Wenn Menschen damals eben eine andere Einstellung hatten, konnten sie etwas, was wir heute kritisieren, als normal
155
empfinden. Das ist ein klassisches Argument. Man könnte es durch einweiteres ergänzen. Es gibt die Legitimation durch Verfahren. MaxWeberhat diesen Punkt in seiner Theorie der Modernisierung stark betont (vgl.Weber 2002). Die Ordentlichkeit, die formulargesteuerte Kortektheit,die regelkompatible Durchführung von Massnahmen, die sich in diesenAkten niederschlagen, erweist sich selbst als eine Quelle von Legitimation. Das heisst auch, dass Akten durch ihren Entstehungsprozess selbstgesellschaftliche Unterstützung für genau jene Massnahmen stiften, diesie nahe legen und dokumentieren. Aktenförmiges Handeln suggeriert,dass «alles seine Ordnung» habe. Bürokratische Rationalität produziert- auch in der Medizin und in der Psychiatrie - Ordnung. Das finde ichdeshalb einen wichtigen Aspekt, weil er Historikerinnen und Historikerdavor bewahren kann, das Mentalitätenargument zu überstrapazieren.Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Dokumentengenerierung und die Aktenführung direkte Auswirkungen auf die Legitimationvon psychiatrischen - und auch anderen - Massnahmen in der Gesellschaft haben. In Bezug auf die Psychiatrie lässt sich von einem «Schattenmandat» sprechen, das darin besteht, über die Verwahrung, Heilungund Rehabilitierung kranker Menschen hinaus zur gesellschaftlichenOrdnung beizutragen, was, wenn es, wie im 19. und weit ins 20. Jahrhundert hinein oft der Fall, um die schiere Aufrechterhaltung der Ordnunginnerhalb der Anstaltsmauern ging, mit dem deklarierten Auftrag wenigoder nichts mehr gemeinsam haben musste.
ArchivArchive sind, woraufmehrere hingewiesenhaben, genealogischmitHerr-schaftssicheru.ng verbunden. Das moderne Archiv, das für die Bürgerinnen und Bürger eines Staats zugänglich ist, stellt eine Errungenschaftder Französischen Revolution dar. Damals wurden Demokratisierungsprozesse ausgelöst, aus denen auch eine demokratische Öffentlichkeithervorging, die wiederum die Forderung nach dem Zugang zu Archiven unterstützte. Man könnte sagen, dass Verwaltungshandeln, und aufdieses haben wir heute fokussiert, eine starke Zentrierung auf den Staatmit sich bringt. Allenfalls wird die Perspektive auf so genannte «privateRegierungen» - aufVerbände und unterschiedliche Organisationen, diein den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess intervenieren -, ausgeweitet. In der Schweiz mit ihrer starken föderalistischen Struktur und ihrem parastaatlichen Interessenvermittlungssystem spricht man etwa von Verhandlungs- oder Verbandsdemokratie.Nun ist die administrative Aktivität tatsächlich sehr wichtig; Bürgerinnen und Bürger werden auf unterschiedlichste Weise darin einbezogen,indem sie ihre Stimme abgeben, Steuern zahlen, öffentliche Dienstleistungen beanspruchen, Regeln einhalten, Formulare ausfüllen oder sich
156
an Erhebungen beteiligen. Ich habe selbst Haushaltsrechnungen untersucht, wo man sehr deutlich sieht, wie stark staatliche bzw. verbandsgestützte Informationsbeschaffungssysteme auch in den Privatbereichder Familie eingreifen können.
Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass gerade dann, wenn es umdie Interessen und Intentionen der Betroffenen geht, diese Staatsfixierung, diese Ausrichtung auf die «wichtigen» Einrichtungen der Gesellschaft, ein Problem darstellt. Die ganze Überlieferung von Traditionenläuft nämlich auch über Myriaden von Mikroarchiven, von dezentralisierten und unscheinbaren Beständen, die eine grosse Fülle ganz unterschiedlicher Dokumente, Relikte und Souvenirs enthalten. Über das,was Menschen so alles aufbewahren, weil es ihnen wichtig ist, wird nirgends Buch geführt. Mit solchen Beständen lässt sich aus historischerSicht deshalb nur beschränkt rechnen. Dennoch sorgen solche Mikroarchive immer wieder für ganz erstaunliche Entdeckungen. Dies waretwa in der Film- und Fotogeschichte der Fall, wo man lange Zeit gedachthatte, ganze Archivwelten seien in den politischen Verwerfungen des20. Jahrhunderts weggebrochen, um nun zu sehen, dass vieles durchaus noch vorhanden ist. Gerade die so genannte «Wende» von 1989 hatin Deutschland dazu geführt, dass verloren geglaubte Quellenbeständeplötzlich wieder auftauchten oder erneut in den Operationsbereich derhistorischen Forschung gerückt wurden. Es geht hier darum, dass vieleMenschen Sachen sammeln, dass sie Briefe schreiben, Tagebücher fü~ren, Fotos archivieren, Filme aufheben, Gegenstände aufbewahren,sodass sich unendlich viel Material irgendwie anstaut und irgendwostapelt. Und man soll die Einsicht in die Wichtigkeit dieses dezentralenMaterials keinesfalls gegen gut funktionierende staatliche und damitöffentliche Archive ausspielen. Es ist aber wichtig, dass gesehen wird,dass es daneben - oder darunter - diesen riesigen Bereich von Privatem,Intimem, Unentdecktem gibt. Der Berliner Kulturwissenschaftler Wolf~'(gang Ernst spricht in diesem Zusammenhang vom «Anarchivischen»(Ernst 2002). Der Begriff macht eine Anspielung auf die Anarchie, diesich jenseits staatlicher Herrschafts- und Ordnungsansprüche ausbreitet. Er macht es leichter, die kolossale Unordnung einer breiten Überlieferung anzuerkennen, die jedoch im sozialen Raum zerstreut ist. Stattder Konzentration von Akten in Archiven haben wir hier die Zerstreuung von Überlieferungsmaterial in erinnerten und vergessenen Traditionsbeständen vor uns. Dieses dezentrierte Material ist in unterschiedlichsten kleineren und grösseren sozialen Formationen zu finden, bishin zu einzelnen Individuen, die mit persönlichem Material ihre eigene«biographische Illusion» (Bourdieu 1998) dokumentieren. Die französischen Annales-Historiker, insbesondere Lucien Febvre, haben schonin den 1930er-Jahren darauf insistiert, dass es eine wichtige Aufgabe
157
der Historiker sei, diesen Bereich ins Visier der Forschung zu nehmen(vgl. Febvre 1988). Es gilt gleichsam, die demokratisierten Archive indem Moment, wo man sie benutzen kann - und hier auch eine oft grandiose Unterstützung geniesst - auch wieder zu verlassen und sich nachanderen Quellengattungen umzusehen. Die Ordnungsanstrengungender staatlichen Archiveinrichtungen, die selbstverständlich wichtigund eine zentrale Grundlage der Geschichtsschreibung sind, könnenallerdings das anarchivische Moment der Überlieferung nicht aufheben. Und es ist gerade dieses, das uns vielleicht helfen könnte, so etwaswie «Betroffene» zu konturieren. An dieser Stelle müsste nun mehr überdie oral history gesagt werden; stattdessen möchte ich darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe von psychiatriegeschichtlichen Untersuchungen gibt, die mit grossem Gewinn von dieser Methode Gebrauchgemacht haben.
Die so genannte nouvelle histoire, die sich in Frankreich in den1970er-Jahren bemerkbar machte, betrachtete die Reflexion auf das, wasein «historisches Dokument» ist, als eine ihrer wichtigen Aufgaben. DieVorstellung eines wertfreien Dokuments - das den Glauben an die Reinheit der Quelle zum Korrelat hat - wird hier aufgegeben zugunsten derEinsicht in die gesellschaftliche Bedingtheit dessen, was wir als Dokument analysieren. Es gilt somit, die Struktur dieser Dokumente aufzulösen, um die Bedingungen ihrer Produktion freizulegen. Damit zeigtsich, dass es nicht nur eine Sprache der Vergangenheit, sondern auch ihrSchweigen gibt. Wie einleitend festgehalten, lassen sich «blinde Flecken»nicht zum Verschwinden bringen, sie weisen jedoch ihre eigene Symptomatik auf.
Für eine Analyse des Zusammenhangs von Archiv und elektronischer Daten~erarbeitungbleibt hier kein Platz. Dazu nur so viel: DerEinsatz von Computern und digitalen Speichermedien hat seit einigenJahrzehnten die Bedingungen für die historische Forschung signifikant verändert. Mit dem world wide web ist der Zugriff auf Findmittel,Quellenfaksimile und ganze Archivbestände gewaltig ausgeweitet underleichtert worden. Es zeigen sich völlig neue Möglichkeiten und Probleme bei der Akquisition, Lagerung, Erschliessung und Nutzung historischen Quellenmaterials. Was das Thema der heutigen Tagung betrifft,so gilt es zu sehen, dass mit der Digitalisierung von Informationen undihrer maschinengestützten Speicherung und Verarbeitung die Möglichkeit da ist, dass Datensätze, die in ganz unterschiedlichen Kontextenerhoben wurden, auf Verbund geschaltet werden können. Das bringtvöllig neue Möglichkeiten gegenüber traditionellen Formen der Aktenführung, die sehr stark segmentiert war und gleichsam der Logik dereinzelnen bürokratischen Apparate folgte.
158
Die Dilemmata des aufklärerischen Projekts
Zum Schluss mächte ich nochmals das Bild, das Hansjakob Müller amEnde seines Tagungsbeitrags einblendete, evozieren. Wir sahen dieseTür mit dem Pfeil, der vom dunklen Drinnen ins helle Draussen zeigt.Das ist die Grundmetapher der Aufklärung: vom Dunkel ins Licht, vonden tenebres zu den lurnieres. Das aufklärerische Projekt ist nicht zuEnde, es bleibt eine Aufgabe. Eine solche kann es aber nur bleiben, wennwir uns sensibilisieren für Ambivalenzen, die mit ihm verbunden sind.Der bequeme Kollektivsingular «der Fortschritt» hat viele Probleme, mitdenen sich auch eine Psychiatriegeschichte und eine Geschichte gesellschaftlicher Inklusions- und Exklusionsprozesse auseinander setzenmüssen, zum Verschwinden gebracht. Es gilt, mit einer ambivalentenBewertung der Aufklärung auch ein Bewusstsein für die in ihr wirkendeDialektik und die darin angelegten Dilemmata zu entwickeln. Auchheute ist Wissen Macht und als solche funktioniert sie kapillar und überden Zugriff über den Menschen, über seinen Körper und seine Kulturtechniken. Das ist unvermeidlich. Doch darüber lässt sich reflektieren,was auch heisst, dass Wissenschaft ein probates Mittel gegen Eatalismu~
sein kann.
Literatur
Bourdieu, Pierre (1998), Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handeins, Frankfurta.M.: Suhrkamp.
Castei, Robert (1979), Die psychiatrische Ordnung. Das goldene Zeitalter des Irrenwesens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Ernst, Wolfgang (2002), Das Rumoren der Archive: Ordnung aus Unordnung. Berlin:Merve.
Febvre, Lucien (1988), Das Gewissen des Historikers, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach.
Foucault, Michel (2005), Die Heterotopien. Der utopische Körper. Frankfurt a. M.:Suhrkamp.
Foucault, Michel (2004), Die Geburt der Biopolitik. Vorlesungen am College deFrance 1978-1979 (=Geschichte der Gouvernementalität. Michel Sennelart, Hrsg.,2. Bd. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Foucault, Michel (2003), Le pouvoir psychiatrique. Cours au College de France,1973-1974. Paris: Gallimard/Seuil.
Germann, Urs (2004), Psychiatrie und Strafjustiz: Entstehung, Praxis und Ausdifferenzierung der forensischen Psychiatrie in der deutschsprachigen Schweiz1850-1950, Zürich: Chronos.
Goffman, Erving (1973), Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patientenund anderer Insassen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hacking, lan (2006), Historische Ontologie. Michael Hampe, Hrsg. Zürich: Chronos.Hacking, lan (1999), Multiple Persönlichkeit. Zur Geschichte der Seele in der
Moderne. Frankfurt a. M.: Hanser.Huonker, Thomas; Regula Ludi (2001), Roma, Sinti, Jenische. Schweizerische Zigeu
nerpolitik zur Zeit des Nationalsozialismus. Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz-Zweiter Weltkrieg, Bd. 23. Zürich: Chronos.
159
Meier, Marietta; Brigitta Bernet, Roswitha Dubach und Urs Germann (2007), Zwangzur Ordnung: Psychiatrie im Kanton Zürich 1870-1970. Zürich: Chronos.
Nellen, Stefan; Martin Schaffner und Martin Stingelin, Hrsg. (2007),Paranoia City:Der Fall Ernst B.: Selbstzeugnis und Akten aus der Psychiatrie um 1900. Basel:
Schwabe.Schaffner, Martin (2007), Verrückter Alltag. Ein Historiker liest Goffman, Österrei-
chische Zeitschrift für Soziologie, 32: 72-89.Tanner, Jakob (2004), Historische Anthropologie zur Einführung. Hamburg: Junius
Verlag.Weber, Max (2002), Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden
Soziologie. Tübingen: Mohr Siebeck.
AutorJakob Tanner ist Professor für Geschichte der Neuzeit an der Forschungsstelle fürSozial- und Wirtschaftsgeschichte und am Historischen Seminar der Universität
Zürich.Jakob Tanner war Mitglied der «Unabhängigen Expertenkommission Schweiz-
Zweiter Weltkrieg» (1996-2001) und Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin(2001/2002). Er ist Permanent Fellow am Collegium Helveticum (Universität/ETHZürich), Gründungsmitglied des Zentrums für die Geschichte des Wissens(Universität/ETH Zürich) sowie Präsident des Schweizerischen Sozialarchivs(Zürich). Zusammen mit Marietta Meier leitete er die Forschungsprojekte «Zwangsmassnahmen in der Zürcher Psychiatrie 1870-1970» (finanziert durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, 2001/2002) und des gleichnamigen NFP-51-Projekts (2004-2006). Seine Forschungsschwerpunkten sind die Europäischvergleichende Wirtschafts- und Finanzgeschichte, die Sozialgeschichte der Schweiz,die Wissenschafts-, Medizin- und Körpergeschichte.
Publikationen zum Thema: Ordnungsstörungen: Konjunkturen und Zäsurenin der Geschichte der Psychiatrie, Schlusswort in: Marietta Meier, Hrsg., (2007),Zwang zur Ordnung: Psychiatrie im Kanton Zürich 1870-1970. Zürich: Chronos,271-306; Der fremde Blick: Möglichkeiten und Grenzen der historischen Beschreibung einer psychiatrischen Anstalt, in: Wulf Rössler, Hrsg., (2005), Psychiatriezwischen Autonpmie und Zwang. Heidelberg: Springer, 45-66.
160
Prof. Jakob Tanner, «Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte»
et «Historisches Seminar» de l'Universite de Zurich
Acteurs, dossiers et archives
Vu I'ampleur thematique du sujet, cette contribution ne saurait etre ni un
resume, ni un tour d'horizon du programme du colloque ou du present
ouvrage.1I ne serait pas non plus judicieux de tenter une analyse des points
faibles. Ce qui suit est une tentative de regrouper quelques decouvertes
et reflexions en les orientant vers des problemes et en les approfondissant
quelque peu du point de vue theorique. Je tente en quelque sorte une
reflexion tournant autour des eventuels «angles morts» du colloque.
J'utilise la une metaphore qui a ete employee pendant les presentations. Le
fait d'identifier des «angles morts» ne suffit pasa les supprimer, tout au
plus ales decaler quelque peu.
L'eventail des positions et argumentaires adoptes dans les differentescontributions etait tres large. Quelques noms servant de references dansles debats theoriques ont ete cites. Environ la moitie des contributionsrenvolent cependant aMax Weber et Michel Foucault (voir Weber 2002
et Foucault 2003, 2004, 2005), ces deux grandes figures frequemmentcontroversees dans la litterature. Les partisans de l'un rejettent souventl'autre et inversement. Je pense qu'une qualite de ce colloque a ete de nepas entrer dans ces controverses mais d'avoir accepte plusieurs optiofisen laissant le debat ouvert. A mon avis, il ne s'agissait pas d'une capitulation face au defi theorique. 11 s'agissait plutöt d'un eclectisme productif, d'une hybridation pragmatique de potentieis theoriques. 11 peuten sortir quelque chose. Mais treve de remarques preliminaires. La suites'articule autour de trois concepts: personnes concernees, dossiers etformulaires, archives.
Acteurs
J'aimerais tout d'abord mentionner un aspect crucial des problematiques exposees par le PNR 51. Les concepts d'integration et d'exclusionsont fondamentalement ambivalents. Au sein du systeme de coordination normatif d'une societe moderne, d'un Etat de droit constitutionneldemocratique, l'integration a generalenient une connotation positive et
161
1'exclusion une connotation negative. Et ce parce qu'une teIle socü~te estorganisee autour de la dynamique de 1'integration, que 1'on observe egalement dans la longue histoire des mouvements ·d'emanGipation sociale qui se sont efforces - souvent avec succes - d.'obtenir leurs. droits,c'est-a-dire de revendiquer des droits que d'autres avaient deja et qui sesont ainsi generalises. Citons par exemple 1'emancipation des juifs, quine sont devenus qu'en 1874 des citoyens apart entiere de la Confederation helvetique, ou la longue lutte des femmes pour le droit de vote passif et actif, qu'elles n'ont obtenu a 1'echelle nationale qu'en 1971. Un tristechapitre de 1'exclusion sont les mesures de discrimination qui ont eteprises contre ceux que l'on appelait des «tsiganes» - Roms, Sinti et Yeniches -, par exemple l'interdiction d'entree sur le territoire de 1906, le«registre des tsiganes» de 1911 ou le retrait d'enfants aleurs parents parl'«CEuvre des enfants de la grand-route» a partir de 1926, pratiques quin'ont ete publiquement critiquees et .. stoppees qu'~ partir des annees1970. De ce point de vue, l'exclusion et les processus d'exclusion sont desphenomenes negatifs; dans un Etat de droit, on les considere comme desindicateurs de dysfonctionnement et d'echec de la solidarite.
Cependant, 1'histoire de 1'Etat-nation moderne a partir du XIxesiecle a aussi montre que 1'integration peut vite se transformer en exigence demesuree d'adaptation, en contrainte d'assimilation et d'internalisation ainsi qu'en pouvoir d'internement. L'heterotopie de la prisonet de l'asile se realise au XIxe siecle par le biais du paradigme de 1'exclusion par 1'enfermement. Ces formes d'exclusion se manifestent inversement sous forme d'internement ou d'integration forcee. Meme si la legitimite de teIles institutions n'etait pas fondamentalement remise encause dans la. societe civile, des conflits moraux et politiques ont toujours eclate au sujet des criteres et des modalites de 1'enfermement.L'Etat-nation moderne, base sur la triade «peuple, territoire, Etat», nonseulement durcit au XIxe siecle ses frontieres vers 1'exterieur mais promut encore, a 1'interieur, une tendance a 1'homogeneisation, laquelle,apres la Premiere Guerre Mondiale, etait egalement associee ades representations de purete du peuple et de la race et - en particulier en Suisse- a une peur obsessionnelle de «l'envahissement» par les etrangers. Onconstate des reflexes d'exclusion, mais aussi une pression a 1'assimilation, couplee ades attaques contre les espaces de liberte et les droits dela personnalite. L'« CEuvre des enfants de la grand-route» revele cettetendance a 1'assimilation forcee: en meme temps que 1'on ecartait les«tsiganes», on integrait de force dans des familles suisses «normales» et«honneteS» des enfants arraches parfois avec la plus grande brutalite aleurs parents. De teIles actions d'assimilation manifestent une incapacite a supporter la difference. Le respect de la difference disparait. Vuces phenomenes, la protection d'une societe connaissant des specifici-
162
tes culturelles complexes vis-a-vis d'exigences d'homogeneite insupportables au nom du principe national devient un postulat qui se justifiedu point de vue des droits de 1'homme. 11 s'agit de defendre le droit a «nepas etre oblige de faire partie». 11 n'est necessaire ni de rejeter tout ce quiest etranger, ni de s'efforcer de le fondre dans ce qui est propre.
Mais si nous partons d'un droit a la difference et d'un respect de1'etranger, nous devons nous pencher sur le probleme de ce que les sciences culturelles appellent othering. On entend par la la tendance a percevoir d'autres groupes comme etrangers, de sorte que 1'on peut se rassurer sur sa propre identite en renforc;ant cette perception de la differenceet en en faisant un absolu. La societe apparait alors comme peuplee degroupes les plus divers, tellement eloignes les uns des autres qu'ils nepeuvent se rencontrer que dans une multiculturalite indifferente (indifferente dans les deux sens de «non different» et de «sans preference »).La tendance a faire de 1'autre par otheringun etranger que 1'on peut toutau plus respecter est elle-meme 1'expression de problemes d'integrationqui se posent dans une societe moderne caracterisee par la migration.Ceux-ci s'expriment par une recherche d'identite qui parvient a son buten produisant la difference. Le jugement positifporte sur ces differencesculturelles peut cependant etre lui-meme interprete comme le produitd'un mouvement d'exclusion et de delimitation qui represeite le reversde 1'exigence demesuree d'assimilation. On s'aperc;oit ici que ·le probleme pose se mord la queue et ne permet pas de reponse simple. Lalogique d'application des droits de 1'homme presente en general unestructure aporetique. Si on les defend en tant que principes universeis,on a tendance a prendre une position apodictique et ergoteuse qui rendaveugle a la difference culturelle et risque d'empieter sur les droits delapersonnalite. Si, en revanche, on postule un point de vue de relativismeculturel et qu'on exige un respect general de «l'autre», on risque de tolerer les infractions aux droits de 1'homme. C'est pourquoi 1'analysepositions sur les droits de 1'homme doit elle aussi se placer dans uneperspective historique. Quand l'integration se transforme-t-elle en assimilation forcee? Dans quelles conditions 1'exclusion comprend-elle ledroit ades espaces de liberte autonomes? La reponse aces questionsdepend de constellations concretes de la societe. 11 faut donc s'efforcerd'historiser les categories correspondantes. Cela signifie de tendre versune analyse sensible au contexte, capable de rendre compte de 1'evolution de la signification et de la fonction de ces categories. Dans son allocution d'introduction, Walter Leimgruber a explique que la question despersonnes concernees etait un point de depart crucial du PNR 51. C'esta-dire qu'il ne s'agit pas de 1'integration et de 1'exclusion en tant queconcepts abstraits, mais d'etudier ce qui arrive aux personnes concernees. Si nous disions que les personnes concernees sont tout simple-
163
ment des personnes auxquelles il arrive quelque chose, qui sont importunees par l'administration, tout serait relativement simple. 11 suffiraitde regarder ce qu'on leur a fait. Mais tout est plus complique lorsque lespersonnes concernees sont effectivement touchees par ce qui leurarriveet ce qu'elles vivent. Si leur perception d'elles-memes, leur subjectiviteest marquee par les autorites politiques, le pouvoir bureaucratique, lesdefinitions medicales et les categories juridiques ou cliniques, l'analysese complique. Dans leurs formes d'expression authentiques, les personnes concernees participent alors du pouvoir performatif des routinesadministratives et des relations sociales. Nous savons, et les theories dulabelingl'ont montre a maintes reprises, que les etiquettes qui stigmatisent ou simplement caracterisent, ont la particularite d'influencer ceuxqui les portent ou a qui elles sont imposees. lan Hacking parle a cetegard de looping effects, c'est-a-dire de processus par lesquels les heterostereotypes et la perception de soi-meme se renforcent mutuellement(voir Hacking 1999 et 2006). Les personnes «concernees» le sont differemment selon les etiquettes qui leur sont appliquees et selon les formesde bureaucratie dans lesquelles elles sont impliquees. L'exercice du pouvoir transforme l'image de soi, la representation de la personnalite et lamaniere de subjectiviser. De meme, les dossiers en tant que substrat enpapier du pouvoir bureaucratique sont un element de cette dynamiquede transformation. C'est pourquoi nous ne pouvons pas travailler avecdes categories teIles que «a donne son consentement» ou «a participe deson plein gre» car ce consentement peut lui-meme etre le resultat d'uneprocedure immuable a laquelle la «personne concernee» est confrontee. Le pouvoir performatif des routines therapeutiques et des mesuresadministratives s'exprime alors sous forme d'absence d'alternatives oude pression exercee par ce qui est attendu. Ces effets se manifestent chezles patient-e-s, mais aussi chez les medecins. Il faut partir du «sujet»dans toute son ambiguYte, un point que l'on pourrait approfondir: lesujet en tant que subjectere est ce qui est subordonne depuis toujours aun pouvoir et le sujet en tant que subjectum est la cause ou le motif, c'esta-dire aussi qu'il agit, meme dans sa subordination, de maniere autonome et independante et pratique de nouvelles formes d'appropriation(voir Tanner 2004).
DossiersL'historien bälois Martin Schaffner a publie un essai intitule «Verrückter Alltag» (<< la folie quotidienne ») qui se penchea nouveau sur ErvingGoffman (1973) (voir Schaffner 2007). Martin Schaffner se penche surdes documents de cas, il s'interesse a la forme et au contenu de dossierspsychiatriques dans lesquels se sedimentent des processus qui. s'accelerent dans l'Europe des annees 1900. Il s'agit d'un corpus de sources qui
164
expriment l'efficacite croissante des interventions bureaucratiques surla deviance. 11 y a Heu de soumettre a discussion la tendance a legifererque l'on constate a l'epoque au sujet des «alü~nes» et dans d'autres domaines. Ces processus bureaucratiques consistant a prendre des notes,a communiquer et a evaluer peuvent amoh avis etre etudies au mieuxsous trois aspects, qui ont tous ete abordes aujourd'hui, mais que j'aimerais reprendre systematiquement.
Premü~rement,il s'agit de la saisie de routine, d'une gestion enserie, standardisee de formulaires, mais aussi de personnes qui lesremplissent activement par ecrit ou qui, en tant qu'objets d'investigation, sont questionnees ou observees. Dans les deux cas, des caracteristiques, des donnees et des faits sont inscrits dans des cases. Unregard cadre par un tel modele formel voit le monde en quelque sorte atravers une grille de saisie bureaucratique. Celle-ci structure les interactions sociales et les situations de communication. Les formulaires ontune synopsis synchronisee, ils sont souvent conserves dans des dossiersmis en place de maniere diachronique et dans lesquels on trouve aussides documents qui donnent des directives de marche a suivre et organisent le classement dans le temps des dossiers administratifs. Lesdocuments administratifs structurent des processus complexes sur unelongue periode et representent en meme temps la materialisation de cesstructures. Les dossiers sont donc deux choses: representations et forcesperformatives. Dans leur premiere fonction, ils representent l'activiteadministrative que nous pouvons lire aposteriori en tant que traces dupasse. Dans leur deuxieme fonction, nous pouvons les considerer commedes prescriptions qui dirigent les activites, et, par leUj agency (action)ont sur l'evolution des processus une influence independante de lavolonte des personnes impliquees et mettent ces processus sur une voi~
administrative determinee. 11 est bien apparu que cette problematiqueest difficilement saisissable. La reconnait-on seulement? Cela depen:trdu point de vue, de la perspective. L'histoire sociale classique a reussi aannuler d'une maniere generale l'homme en tant qu'acteur et ale reduirea des effets structurels. Une fois qu'on l'a reduit a un point dans unerepresentation statistique, dans une nebuleuse de faits, on peut en realiser un modele mathematique. On obtient alors des conjonctures a longterme, des structures de l'inegalite sociale ou des modeles de distribution de l'homme dans l'espace. Par analogie, on peut paralyser les dossiers en les chosifiant et en les considerant comme des documents d'activites passees de l'homme. L'histoire au contraire reclame depuislongtemps que l'on analyse les conditions de production des documentset les formes de leur transmission. Amon avis, il est acet egard interessant de comprendre les dossiers d'une autre maniere - j'y reviendrai apropos des archives.
165
Deuxiemement, on peut apprendre que ce sont des processus declassification, de categorisation, de triage, de mise sous rubriques quisont traces et orientes par les formulaires et les dossiers. Cette creationadministrative de normes cree en meme temps une myriade d'ecarts.On definit des maladies en tant qu'ecarts par rapport a la sante, ce quipermet de mettre un ordre de classification dans le desordre du pathologique. Vers 1900, un nouveau systeme nosologique apparait en psychiatrie, lequel renvoie a une etiologie, c'est-a-dire ades hypotheses surles causes des maladies. Nous rencontrons des innovations fondamentales, teIles que celIes d'Eugen Bleuler qui inventa en 1911 le concept deschizophrenie, et nous observons la formation d'un champ de pratiquede psychiatrie legale par lequel les psychiatres, par leurs expertises,elargissent leur rayon d'action et le font penetrer dans la societe (voir ace sujet Germann 2004). Ceci a des effets sur la justice penale, sur ce quel'on pourrait appeler un champ eugenique ou sur la «police des etrangers» creee pendant la Premiere Guerre Mondiale et qui s'occupait de la«question des etrangers ». 11 serait important d'effectuer une analysecomparative des criteres de differenciation et des systemes de classification, de leurs recoupements et de leurs differences.
Le troisieme aspect que je souhaite mentionner est le problemede l'acceptation sociale, specifique aux groupes, aux classes sociales etaux religions de cette gestion de la deviance et de la maladie. Commentdifferentes couches de population ont-elIes per<;u ces ecarts? On constate une normalite etonnante dans la gestion des ecarts a la norme.Nous avons aujourd'hui parfois du mal a comprendre combien il a puetre facile de mettre en application des mesures qui non seulement noussemblent auj0l:lrd'hui tres problematiques, mais etaient, deja a l'epoque,difficiles a accorder avec l'ordre public. Une interpretation est que cetteabsence de remise en question serait le resultat des mentalites, ideologies et sensibilites de l'epoque, differentes de celIes d'aujourd'hui. Si lesmentalites etaient differentes a l'epoque, il se peut que les gens aienttrouve normal ce que nous critiquons aujourd'hui. 11 s'agit la d'un argument classique. On pourrait le completer par un autre. 11 existe une legitimation par le processus. Dans sa theorie de la modernisation, MaxWeber a insiste sur cet aspect (voir Weber 2002). L'ordre qui regne dansles dossiers, la correction guidee par les formulaires, l'execution demesures conformement aux reglements qui se refletent dans les dossierssont eux-memes une source de legitimation. Cela signifie aussi que lesdossiers produisent eux-memes, par leur processus de creation, le soutien social pour les mesures qu'ils favorisent et documentent. L'actionqui a lieu sous forme de dossiers donne l'impression que «tout est enordre ». La rationalite bureaucratique produit de l'ordre, egalement enmedecine et en psychiatrie. Cet aspect me semble important parce qu'il
166
est susceptible d'empecher leshistorien-ne-s d'utiliser a l'envi l'argument des mentalites. 11 est important de prendre conscience du fait quela creation de documents et la tenue de dossiers ont des effets directs surla legitimation de mes,ures psychiatriques et autres dans la societe. Pource qui est de la psychiatrie, on peut parler d'un «mandat occulte» quiconsiste, en plus de garder, soigner et reeduquer les malades, a contribuer a l'ordre public. Or, lorsqu'il s'agissait, comme souvent au XIxe etmeme xxe siecles, du maintien pur et simple de l'ordre au sein des mursde l'asile, il n'avait plus grand-chose a voi;r avec le mandat explicite.
Archives
Comme il a ete signale dans plusieurs contributions, les archives sontreliees du point de vue genealogique avec le maintien du pouvoir. Lesarchives modernes, auxquelIes les citoyen-ne-s de l'Etat ont acces, sontune conquete de la Revolution fran<;aise. CelIe-ci declencha des processus de democratisation qui donnerent naissance a une opinion publique democratique, laquelle appuya la revendication d'acces aux archives. On pourrait dire que les activites de l'administration, sur lesquellesnous avons concentre aujourd'hui notre attention, entrainent une focalisation sur l'Etat. Tout au plus la perspective s'elargit-elIe en directionde ce que l'on appelle les «gouvernements prives», c'est-a-dire les associations et organisations qui interviennent dans les processus de developpement de la volonte politique et des decisions politiques. La Suisse,avec sa structure federale et son systeme paraetatique de mediation desinterets, est qualifiee de democratie de negociation ou de democratieassociative. Or, l'activite administrative est tres importante et lescitoyen-ne-s y sont impliques de diverses manieres: ils votent, payentleurs impöts, font appel a des services publics, se conforment a·· desreglements, remplissent des formulaires ou reponcf'ent ades enquetes.J'ai moi-meme etudie des budgets familiaux OU l'on voit bien a quel poi:ritles systemes de releve d'informations de l'Etat ou des associations peuvent intervenir dans le domaine prive de la familIe.
Cependant, c'est justement lorsqu'il s'agit des interets et desintentions des personnes concernees que cette orientation exclusivevers l'Etat, vers les institutions «importantes» de la societe, representeun probleme. La transmission des traditions repose en effet egalementsur des myriades de microarchives, de fonds decentralises et anodins enapparence, comprenant des quantites de documents, vestiges et souvenirs les plus divers. Personne ne tient de registres de tout ce que lesgens conservent parce que c'est important pour eux. Les historien-ne-sne peuvent donc compter sur ce type de documents que dans certaineslimites. Et pourtant, de teIles microarchives reservent souvent des surprises. Tel a ete le cas dans l'histoire du cinema et de la photographie: on
167
a longtemps cru que des pans entiers de l'histoire avaient disparu dansles conflits politiques du xxe siecle, pour s'apercevoir finalement qu'ilrestait beaucoup de choses. En particulier le «tournant» de 1989 en Allemagne a fait tout a coup reapparaitre des sources que l'on croyait disparues ou les a fait revenir a la portee de la recherche historique. Nombrede gens collectionnent des objets, ecrivent des lettres, tiennent un journal, archivent des photos, conservent des films et des objets, de sorteque des quantites incroyables de materiel s'empilent ici et la. Et il nes'agit pas de mettre en avant l'importance de ce materiel decentralise audetriment d'archives d'Etat bien tenues et accessibles au public. Il estsimplement important de voir qu'il y a a cöte de celles-ci (ou en dessous)cette couche immense de renseignements prives, intimes a decouvrir.Wolfgang Ernst, specialiste berlinois en sciences culturelles, parle a cetegard d'«anarchives» (Ernst 2002). Ce concept evoque l'anarchie quis'etend en dehors du pouvoir et de l'ordre de l'Etat. Il aide a reconnaitrele desordre colossal d'un vaste heritage disperse dans l'espace social. Aulieu d'une concentration de dossiers dans des archives, nous avonsaffaire a la dispersion de materiels dans des stocks de traditionsrememores et oublies. Ce materiel decentralise se trouve dans les formations sociales les plus diverses, petites et grandes, jusqu'aux individusqui conservent par le biais de materiel personnelleur propre·« illusionbiographique» (Bourdieu 1998). Les historiens franvais de l'Ecole desAnnales, Lucien Febvre en tete, ont insiste des les annees 1930 sur le faitqu'une tache importante des historiens consiste a etudier ce domaine(voir Febvre 1988). Il s'agit en quelque sorte d'utiliser les archives democratisees au moment ou c'est possible - et ou on dispose souvent d'unsoutien extraord~naire- puis de les quitter pour se mettre ala recherched'autres types de sources. Les efforts de mise en ordre des archivesd'Etat, qui sont bien sur importants et representent une base cruciale del'historiographie, n'abolissent cependant pas le moment anarchiviste dela transmission. C'est peut-etre justement ce moment qui peut nousaider a cerner les «personnes concernees ». 11 faudrait maintenant parlerde la tradition orale (oral history), mais je me contenterai de dire quenombre d'etudes d'histoire de la psychiatrie ont tire un benefice considerable de cette methode.
Ce que l'on appelle la nouvelle histoire, apparue en France dansles annees 1970, considerait comme une de ses taches importantes lareflexion sur ce qu'est un «document historique». Elle abandonnaitl'idee du document neutre, liee a la croyance en la purete de la source,au profit de la conviction que ce que nous analysons en tant que document est socialement conditionne. Il faut donc deconstruire la structurede ce document pour degager les conditions de sa production. Parconsequent, il n'existe pas seulement une langue du passe, mais
168
aussi un° silence du passe. Comme je l'ai signale en introduction,les «angles morts» ne disparaitront pas,mais ils ont leur propre symptomatique.
Une analys~ des rapports entre les archives et le traitementelectronique des donne'es menerait trop loin. Quelques mots seulement:au cours des dernieres decennies, l'utilisation d'ordinateurs et de supports numeriques de memoire a modifie de maniere significative lesconditions de la recherche historique. Le Web a etendu et facilite l'accesa des instruments de recherche, des facsimiles de sources et des fondsentiers d'archives. Des possibilites entierement nouvelles mais aussi denouveaux problemes se font jour au niveau de l'acquisition, du stockage,de l'exploitation et de l'utilisation de sources historiques. Pour ce qui estde la thematique de notre colloque de ce jour, il faut voir que la numerisation d'informations et leur enregistrement et traitement sur ordinateur permet de relier des donnees relevees dans les contextes les plusdivers. Ceci ouvre des possibilites entierement nouvelles par rapport ala tenue de dossiers classiques, fortement segmentee et obeissant a lalogique de chaque appareil bureaucratique.
Les dilemmes du projet d'« Aufklärung»
En guise de conclusion, j'aimerais evoquer l'image presentee par Hansjakob Müller a la fin de son expose. Nous y avons vu une porte avec unefleche partant de l'interieur sombre et indiquant l'exterieur lumineux.TeIle est la metaphore de base de l'«Aufklärung»: de l'ombre a la clarte,des tenebres aux lurnieres. Le projet de l'«Aufklärung» n'est pas acheve,c'est toujours une tache a accomplir. Mais il ne peut le rester que si noussommes sensibles aux ambivalences qui y sont liees. :we singulier collectifbien commode «le progres» a fait disparaitre plusieurs problemes surlesquels une histoire de la psychiatrie et une histoire des processussociaux d'inclusion et d'exclusion devraient se pencher. Il faut, en eva9>luant 1'«Aufklärung» de maniere ambivalente, developper une conscience de la dialectique qui lui est propre et des dilemmes que ceIle-cicomporte. Aujourd'hui encore, savoir, c'est pouvoir et ce pouvoir fonctionne par capillarite et via l'acces a l'homme, a son corps et a ses techniques culturelles. C'est inevitable. Mais on peut y reflechir, ce qui signifie aussi que la science est un bon moyen de lutter contre le fatalisme.
Bibliographie
Bourdieu, Pierre (1998), Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handeins, Francfortsur-Ie-Main: Suhrkamp.
Castel, Robert (1979), Die psychiatrische Ordnung. Das goldene Zeitalter desIrrenwesens. Francfort-sur-Ie-Main: Suhrkamp.
Ernst, Wolfgang (2002), Das Rumoren der Archive: Ordnung aus Unordnung. Berlin:Merve.
169
Febvre, Lucien (1988), Das Gewissen des Historikers, Berlin: Verlag Klaus WagenbachFoucault, Michel (2005), Die Heterotopien. Der utopische Körper. Francfort-sur-Ie
Main: Suhrkamp.
Foucault, Michel (2004), Die Geburt der Biopolitik. Vorlesungen am College deFrance 1978-1979 (=Geschichte der Gouvernementalität. Michel SenneHart, Hrsg.,2. Bd. Francfort-sur-Ie-Main: Suhrkamp.
Foucault, Michel (2003), Le pouvoir psychiatrique. Cours au College de France,1973 -1974. Paris: Gallimard/Seuil.
Germann, Urs (2004), Psychiatrie und Strafjustiz: Entstehung, Praxis und Ausdifferenzierung der forensischen Psychiatrie in der deutschsprachigen Schweiz1850-1950, Zurich: Chronos
Goffman, Erving (1973), Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patientenund anderer Insassen. Francfort-sur-Ie-Main: Suhrkamp.
Hacking, Ian (2006), Historische Ontologie. Michael Hampe, Hrsg. Zurich: Chronos.Hacking, Ian (1999), Multiple Persönlichkeit. Zur Geschichte der Seele in der
Moderne. Francfort-sur-Ie-Main: Hanser.
Huonker, Thomas; Regula Ludi (2001), Roma, Sinti, Jenische. Schweizerische Zigeunerpolitik zur Zeit des Nationalsozialismus. Publications de la CommissionIndependante d'Experts Suisse - Seconde Guerre Mondiale, vol. 23. Zurich:Chronos.
Meier, Marietta; Brigitta Bernet, Roswitha Dubach und Urs Germann (2007), Zwangzur Ordnung: Psychiatrie im Kanton Zürich 1870-1970. Zurich: Chronos.
Nellen, Stefan; Martin Schaffner und Martin Stingelin, Hrsg. (2007), ParanoiaCity. Der Fall Ernst B.: Selbstzeugnis und Akten aus der Psychiatrie um 1900.Bäle: Schwabe.
Schaffner, Martin (2007), Verrückter Alltag. Ein Historiker liest Goffman, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 32: 72-89.
Tanner, Jakob (2004), Historische Anthropologie zur Einführung. Hambourg: JuniusVerlag.
Weber, Max (2002), Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehendenSoziologie. Tübingen: Mohr Siebeck.
Auteur
Jakob Tannerest professeur d'histoire moderne ala «Forschungsstelle für Sozialund Wirtschaftsgeschichte» et au «Historisches Seminar» de l'Universite de Zurich.Jakob Tanner a ete membre de la «Commission Independante d'Experts SuisseSeconde Guerre Mondiale» (1996-2001) et Fellow au Wissenschaftskolleg de Berlin(2001/2002). Il est Permanent Fellow au Collegium Helveticum (Universite/EPFde Zurich), membre fondateur du «Zentrum für die Geschichte des Wissens» (Universite/EPF de Zurich) et president de «Schweizerisches Sozialarchiv» (Zurich).Il a dirige avec Marietta Meier les projets de recherche «La contrainte en psychiatrie:l'exemple de Zurich entre 1870 et 1970» (finance par la Direction de la sante ducanton de Zurich, 2001/2002) et le projet eponyme du PNR 51 (2004-2006). Ses grandsthemes de recherche sont l'histoire economique et financiere comparative europeenne, l'histoire sociale de la Suisse, l'histoire des sciences, de la medecine et ducorps.
Autres publications ace sujet: Ordnungsstörungen: Konjunkturen und Zäsuren in der Geschichte der Psychiatrie, Schlusswort in: Marietta Meier, Hrsg., (2007),Zwang zur Ordnung: Psychiatrie im Kanton Zürich 1870-1970. Zürich: Chronos,271-306; Der fremde Blick: Möglichkeiten und Grenzen der historischen Beschreibung einer psychiatrischen Anstalt, in: Wulf Rössler, Hrsg., (2005), Psychiatriezwischen Autonomie und Zwang. Heidelberg: Springer, 45-66.
170