Kriterien für nachhaltige Hochschulen – am Beispiel der Universität Tübingen
2011 Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum am Beispiel der...
Transcript of 2011 Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum am Beispiel der...
PRÄHISTORISCHE ARCHÄOLOGIE IN SÜDOSTEUROPA
BAND 27
DER SCHWARZMEERRAUM VOM ÄNEOLITHIKUM
BIS IN DIE FRÜHEISENZEIT (5000–500 v. Chr.)
BAND 2GLOBALE ENTWICKLUNG VERSUS LOKALGESCHEHEN
Internationale Fachtagung von Humboldtianern für Humboldtianerim Humboldt-Kolleg in Chişinǎu, Moldavien
(4. – 8. Oktober 2010)
Herausgegeben vonEUGEN SAVA, BLAGOJE GOVEDARICA
undBERNHARD HÄNSEL
Verlag Marie Leidorf GmbH . Rahden/Westf.2011
284 Seiten mit 201 Abbildungen
Bibliografi sche Information der Deutschen Nationalbibliothek
Sava, Eugen / Govedarica, Blagoje / Hänsel, Bernhard (Hrsg.):Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.) ; Band 2: Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen / hrsg. von Blagoje Govedarica… .Rahden/Westf.: Leidorf 2011
(Prähistorische Archäologie in Südosteuropa ; Bd. 27)ISBN 978-3-89646-598-6
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e.Detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten© 2011
Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel
Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.
Tel: +49/(0)5771/ 9510-74Fax: +49/(0)5771/ 9510-75
E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de
ISBN 978-3-89646-598-6ISSN 0723-1725
Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, Internet oder einemanderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
PC-Texterfassung und Scans: Die AutorenRedaktion: Alix Hänsel mit Nikolaus Boroffka, Elke Kaiser und Emily SchalkSatz, Layout und Bildnachbearbeitung: Enns Schrift & Bild GmbH, Bielefeld
Druck und Produktion: DSC-Heinz J. Bevermann KG, Fleethweg 1, D-49196 Bad Laer
Gedruckt mit Unterstützung derAlexander von Humboldt-Stiftung
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum am Beispiel der Malteserkreuzdarstellungen (2. Hälfte 8.-7. Jh. v.Chr.) 1
Maja Kašuba, St. Petersburg
Zusammenfassung:
In dem vorliegenden Artikel wird ein Überblick über die Deutungsvorschläge für bestimmte Bildszenen der Osthallstattkulturwelt gemeinsam mit bestimmten Darstellungen und Zeichen des Basarabi-Kultur-Komplexes in Südosteuropa gegeben. Malteserkreuze werden als „Heilszeichen“ interpretiert, die eine große Verbreitung von der südostalpinen Zone bis zum Nordpontikum (Waldsteppenzone des Mitteldneprgebietes) hatten. Eine Bearbei-tung der Keramik aus Fundorten im nördlichen Schwarzmeerraum, auf der das Malteserkreuz abgebildet ist, erlaubt deren Klassifi kation: Typ 1 – ein Kreuz aus vier geometrischen Figuren, Typ 2 – ein Kreuz aus fünf geo-metrischen Figuren (Kreuz mit Dreiecksarmen). Die Kontexte, in denen sie geborgen wurden, lassen eine Präzisie-rung der Datierung von Malteserkreuzendarstellungen im Nordpontikum zu, wo sie seit der Mitte des 8. Jh. v. Chr. aufzufi nden sind. Das Anbringen von Malteserkreuzen auf Henkeln von bestimmten Schöpfkellen ist eine Beson-derheit, die nur für das Mitteldneprgebiet charakteristisch ist. Für solche Schöpfkellen mit hohem Henkel wird angenommen, dass sie als Kultobjekte eine bestimmte Rolle bei „Kultfesten“ („Stammesfesten“) mit gemein-samen Mahlzeiten und Trinkbräuchen spielten. Die weite Verbreitung ähnlicher Rituale von der südostalpinen Zone bis in das Nordpontikum umschreiben einen „sakralen Raum“ des Basarabi-Kultur-Komplexes.
Abstracts:
The present article gives an overview of the proposed interpretation for some scenes of the Eastern Alpine Hallstatt culture together with certain images of signs from the Basarabi-Culture-Complex of south-eastern Europe. Maltese Crosses are considered as „Signs of Hail“, having a wide distribution from the south-east alpine region to the northern Pontic area (Forest-Steppe zone of the Middle Dnepr region). An analysis of the pottery from sites of the northern Black Sea region, on which Maltese Crosses are found, permits a classifi cation: Type 1 – a cross from four geometric fi gures, Type 2 – a cross from fi ve geometric fi gures (Cross with triangular arms). The contexts from which they were recovered allow a precise dating of the Maltese Cross images in the northern Pontic region, where they are found since the middle of the 8th century BC. The placement of Maltese Crosses on handles of specifi c ladles is a characteristic only of the Middle Dnepr region. It is proposed that such ladles with high handles played a role as ritual objects, which were employed in „Cult-Feast“ („Tribal Feasts“), including communal eating and drinking. The wide distribution of similar rituals from the eastern Alpine area to the nort-hern Pontic region mark the „sacred space“ of the Basarabi-Culture-Complex.
In der prä- und frühskythischen Zeit (das entspricht Ha C der mitteleuropäischen Chronologie) ist aus dem nördlichen Schwarzmeergebiet eine kleine, doch sehr ausgeprägte Reihe von geometrischen Darstellungen auf Keramik in Form des Malteserkreuzes bekannt. Dabei handelt es sich um ein Kreuz mit dreieckigen Armen (Abb. 1-6). Man geht davon aus, dass das Motiv des Malteserkreuzes eines der Zeugnisse für die Existenz eines
1 Der beim Humboldt-Kolleg in Chişinău gehaltene Vortrag (s. Kašuba / Daragan 2009a, 44-46) kann aus Gründen, die nicht von der Autorin abhängen, nicht in dem hier vorgelegten Tagungsband publiziert werden. Doch der an dessen Stelle aufge-nommene Artikel entspricht in vollem Umfange der Thematik der in Chişinău am 4.–8. Oktober 2009 stattgefundenen Kon-ferenz. Das Thema ist eine Fortsetzung der Auseinandersetzung der Autorin mit der Hallstattperiode im nördlichen Schwarz-meergebiet. Für das Zusammentragen der Informationen wurde erste Unterstützung von ukrainischen Kollegen zuteil (vgl. Anm. 8), die weitere Untersuchung erfolgte durch die Verfasserin. Ich bin Frau Dr. Elke Kaiser sowie Prof. Dr. Blagoje Gove-darica für die freundliche Hilfe bei der Übersetzung und Korrektur des Manuskriptes sehr dankbar.
237
Maja Kašuba238
Einfl usses des Basarabi-Kultur-Komplexes im Nordpontikum bildete (vgl. in der russischsprachigen Literatur: Andrienko 1995, 11-12; Daragan 2004, 118 f.; Brujako 2005, 28; Šramko I. 2006, 40 f.; Daragan/Kašuba 2008, 55). Auch wenn aus dem Verbreitungsraum des Basarabi-Kultur-Komplexes eine relativ geringe Zahl an Belegen bekannt ist (das Kreuz kommt hier allein oder in einer vertikalen Reihe vor), so streut das Motiv selbst weit vom Südostalpenraum bis zum linksufrigen Becken des Flusses Dnepr (Abb. 1). Daran ist nicht nur das Kulturareal des Basarabi-Kultur-Komplexes sowie das Ausstreuen seiner Importe zu erkennen, sondern auch der Einfl uss der hallstättischen Peripherie (Metzner-Nebelsick 1992, 361 ff. Karte 3; dies. 2010, 136 ff.; Eibner 1996, 105 ff.; dies. 2001, Karte 1-2; Brosseder 2004, 293-297 Abb. 188; Vulpe 2001, 327 ff.; Kašuba 2007, 369 ff.; Ailincăi 2010, 351 ff.; u.a.). In Südosteuropa erscheint das Malteserkreuz mit der zweiten Phase des Basarabi-Kultur-Komplexes, was der Mitte des 8. Jh. v.Chr. entspricht. Später im 7. Jh. v.Chr. ist es nur noch selten anzutreffen (Metzner-Nebelsick 1992, 361 ff.; Zverev 2003, 247 ff.)2.
Auch wenn die Serie dieser geometrischen Motive zahlenmäßig begrenzt ist, so erfordert sie doch eine umfas-sende Untersuchung in vielerlei Hinsicht, zunächst die Synchronisierung der Malteserkreuzdarstellungen in Südosteuropa und im nördlichen Schwarzmeergebiet sowie damit verbunden eine Erörterung der lokalen Beson-derheiten des Basarabi-Kultur-Komplexes sowie dann die Herausarbeitung der weiten Verbreitung dieses Motivs und seine mögliche symbolische Bedeutung.
2 Eine eigene Betrachtung verdient zweifelsohne das Material aus dem italienischen Raum, wo Gegenstände mit Darstel-lungen des Malteserkreuzes (Keramik, Bronzefi beln und -rasiermesser) bereits aus dem 9. Jh. v.Chr. bekannt sind (s. Bross-eder 2004, 293-294 Anm. 485).
Abb. 1. Verbreitung des Basarabi-Kultur-Komplexes (a), die östlichen Importe des Basarabi-Kultur-Komplexes (b), Malteserkreuze auf Keramik (c) in Südosteuropa und im Nordpontikum. Fundorte im Nordpontikum: 1 – Nagorjane-Pidmet; 2 – Nemirov; 3 –Trachtemirov; 4 – Kalinovka; 5 – Makeevka, Kurg. 455; 6 – Tenetinka, Kurg. 219; 7 – Žabotin; 8 – Požarnaja Balka; 9 – Mačuchi; 10 – Dikan’ka; 11 – Lichačjevka; 12 – Bel’sk (nach Vulpe 1986, Metzner-Nebelsick 1992, Gumă 1993; ders. 1995,
Eibner 2001, Ursuţiu 2002, Brosseder 2004, Kašuba 2007, dies. 2008).
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 239
Die Darstellungen des Malteserkreuzes in der späten prä- und frühskythischen Zeit im nördlichen Schwarzmeergebiet
Das Malteserkreuz ist im Nordpontikum vor allem auf Keramik abgebildet, die in Siedlungen der Waldstep-penzone geborgen wurde. Seine Darstellungen können in zwei Typen unterteilt werden: Typ 1 – ein Kreuz aus vier Figuren: die großen gleichschenkligen Dreiecke laufen mit ihren Spitzen im Zentrum zusammen (Abb. 2,1.2.6.8; 4,6); Typ 2 – ein Kreuz aus fünf Figuren: an der Spitze eines großen Rhombus sind vier kleinere Drei-ecke miteinander verbunden (Kreuz mit Dreieckarmen). Manchmal handelt es sich auch um vier Winkel. Bei Variante 2.1 sind die Dreiecke recht klein, während sie bei Variante 2.2 größer sind und fast die Ausmaße des zentralen Rhombus haben (Abb. 2,3-5.7; 3,1-3.5.6; 4-5).
Die geometrischen Figuren selbst, die das Malteserkreuz bilden (Rhomben und Dreiecke) sind mit Schrägstri-chen gefüllt. In seltenen Fällen (so in Žabotin, Makeevka Kurgan 455 und Siedlung Požarnaja Balka) tragen die schrägen Striche Querkerben (Abb. 2,3.4; 3,5). Vereinzelt sind auch nicht gefüllte Figuren anzutreffen (Siedlung Požarnaja Balka – Andrienko 1995, 12). In der Regel sind die Malteserkreuze auf Keramik einzeln dargestellt; vertikale Reihen sind nur in wenigen Fällen überliefert (Abb. 3,1-2; 5,4).
Die Analyse der aus dem nördlichen Schwarzmeergebiet bekannten Malteserkreuze zeigt, dass hier vor allem der Typ 2 (Kreuz mit Dreieckarmen) verbreitet ist. Er ist deutlich im linksufrigen Dneprgebiet konzentriert (Abb. 1). Gerade dieser Typ, der sich aus fünf Figuren zusammensetzt, kann direkt mit den Malteserkreuzdar-stellungen aus dem Zentrum der Basarabi-Kultur an der mittleren Donau verglichen werden (s. Abb. 6).
Typ 1, der aus vier Figuren besteht, wurde in einem deutlich breiterem Kontext aufgefunden – so ist er in den vier zonalen Ornamentkompositionen mit Rosetten und sogar bei dem Stempelmotiv „Kreuz im Kreis“ (wo es praktisch das Negativ bildet) auf Keramikgefäßen der Zeit zu fi nden, die dem Basarabi-Kultur-Komplex voran-geht und/oder teilweise zeitgleich mit ihm ist. Als Beispiel seien hier aus dem Nordpontikum angeführt: Fund-plätze der Cozia-Saharna-Kultur (Kašuba 2000, Abb. XXII,II; XXIII; Daragan/Kašuba 2008, 47 ff. Abb.
Abb. 2. Malteserkreuzdarstellungen auf Keramik im Nord-pontikum: 1 – Nagorjane-Pidmet; 2 – Nemirov; 3,4,6-8
– Žabotin; 5 – Trachtemirov (nach Šovkopljas 1954, Kovpanenko 1967, Daragan 2004, Smirnova 1996).
Abb. 3. Malteserkreuzdarstellungen auf Keramik im Nord-pontikum: 1 – Mitteldneprgebiet (Platonows Sammlung); 2 – Kalinovka; 3 – Tenetinka, Kurg. 219; 4,6 – Žabotin,
S. 2; 5 – Makeevka, Kurg. 455 (nach Kovpanenko/Ševčenko 1981, Il´inskaja 1975, Galanina 1977, Daragan 2006).
Maja Kašuba240
2,1.4.8.13.15; Niculită u.a. 2008, Fig. 59,8; 63,2; 69,16; 77,2; Niculiţă/Nicic 2008, Fig. 4,21.31.33; 5,18; 6,17; 13,3; 18,7), der späten Černoles-Kultur (Terenožkin 1961, Abb. 41,14; Smirnova 1983, Abb. 2,5; 4,II.13.III.2), die Sied-lung Žabotin (Daragan 2004, Abb. 8,1-3; 31,11; Daragan/Kašuba 2008, Abb. 5,9; 6,4.20), Gräber der frühen Rei-ternomaden (Machortych 2005, Abb. 61,11; 98,6; 100,4.5; 125,10; 137,10; Brujako 2005, Abb. 2,7.8; 3), frühsky-thische Gräber (Il´inskaja 1975, Tab. I,3; XXVI,12) u.a. In diesem Fall realisieren die Rosettenkompositionen das Prinzip des liegenden Kreuzes, womit sie die Idee des Zentrums unterstreichen3.
Bemerkenswert ist auch die Position der Malteserkreuze auf den Gefäßen. Sie wurden zwar auch auf deren Wänden aufgebracht (Abb. 2,2-4.7; 3,1; 4,9.12; 5,6), doch vor allem auf den Henkeln von Schöpfkellen, insbeson-dere auf deren oberem Teil am Rand des Gegenstands. Dadurch konnte derjenige, der sich anschickte, aus die-sem Gefäß zu trinken, das Kreuz sehen. Nur in einem Fall (Siedlung Požarnaja Balka – Andrienko 1995, 11) ist das Malteserkreuz (Typ 2) auf dem umgebogenen Rand eines großen Gefäßes aufgebracht (Abb. 5,11).
Die Untersuchung der chronologischen Stellung der Gegenstände mit Malteserkreuzdarstellung und die Datie-rung der Komplexe, aus denen sie stammen, lässt die Forscher die Funde des Typs 2 (Kreuz mit Dreieckarmen) aus dem Makeevka Kurgan 455 und aus der Siedlung Požarnaja Balka als die ältesten in der nordpontischen Region ansehen, denn diese datieren in das letzte Viertel bzw. Ende des 8. Jh. v.Chr. (Andrienko 1995, 11-12; ders. 2000, 100 ff.; Brujako 2005, Tab. I-II). Eine wichtige Ergänzung für die Datierung der Keramik mit Malte-serkreuz bildete das vor kurzem veröffentlichte Material aus dem Zol’nik № 5 der Westlichen Befestigung der Gorodišče von Bel’sk. Dabei wurde der frühe Horizont ihrer Besiedlung herausgearbeitet, der mit dem Buchsta-ben „A“ bezeichnet wurde. Alle dort freigelegten Keramikfragmente, auf denen ein Malteserkreuz abgebildet ist (Abb. 4,3-6.9.11.12), wurden dem Horizont A2 zugeordnet, der seinerseits zunächst an den Beginn des 7. Jh. v.Chr. gestellt wurde, was der frühen Phase der Siedlung Požarnaja Balka entspricht (Šramko I. 2006, 40 f.). Hier muss
3 Die Untersuchung von Spinnwirteln und spulenförmigen Objekten aus Ton, die aus der Zeit zwischen dem 7. und dem beginnenden 3. Jh. v.Chr. am linksufrigen Dneprgebiet geborgen wurden, zeigten hinsichtlich der auf ihnen aufgebrachten Motiven nur ein vereinzeltes Auftreten des Malteserkreuzes (Typ 1 – in sieben Fällen; Ščerban’ 2007, Abb. 28,5-8.11; 41).
Abb. 4. Malteserkreuzdarstellungen auf Keramik im Nord-pontikum: 1,2,8,10 – Bel’sk, Westliche Befestigung (Aus-grabungen 1906), Aschenhügel 4; 7 – Bel’sk, West liche
Befestigung (Ausgrabungen 1906), Aschenhügel 1; 3-6,9,11-12 – Bel’sk, Westliche Befestigung (Ausgrabungen 1998-
2004), Aschenhügel 5 (nach Šramko 1996, Šramko I. 2006).
Abb. 5. Malteserkreuzdarstellungen auf Keramik im Nord-pontikum: 1 – Dikan’ka-Fjedorovka; 2,4,5,8,9,12 –
Dikan’ka-Dmitrenkova Balka; 3,6,11 – Požarnaja Balka; 7,10 – Dikan’ka-BAM; 13 – Lichačjevka (nach Andrienko
1992, Ščerban /Rachno 2006, Moruženko 1989).
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 241
folgendes angemerkt werden: die Ausgräberin konnte überzeugend darlegen, dass der von ihr herausgestell-te Horizont A2 mit den Phasen 2-3 der Siedlung Ža -botin und damit mit der zweiten Etappe des Basarabi-Kultur-Komplexes zu synchronisieren ist (Šramko I. 2006, 37 f.). Das bildet wiederum die Grundlage für eine konkretere Älterdatierung nicht nur des Hori-zontes A2 sondern auch des ihm vorangegangenen Horizontes A1. Hier müssen zweifelsohne die Kontexte und deren Datierung als Indikatoren für die chronolo-gische Bestimmung eingehender betrachtet werden, wobei auch auf andere Artefakte ausgegriffen wird, die detaillierte Analogien ergeben. Als gute Reserve erweist sich hier, dass die früheren Schichten aus der westlichen Befestigung der Gorodišče von Bel’sk begründet älter datiert werden können. So können die Zerstörungsschichten des Zol’niks № 5 der West-lichen Befestigung von Bel’sk (der Horizont „A“) und die Schicht A2 mit dem Horizont Žabotin-II gleich-gesetzt werden, womit diese in die zweite Hälfte des 8. Jh. v.Chr. datiert werden (Daragan/Podobed 2009, 22 ff.; Šramko I. 2010, 38).
Insgesamt bietet die Siedlung Žabotin, die im rechts-ufrigen Dneprgebiet gelegen ist, eine gute Grundlage für die Datierung des ersten Auftretens des Malteser-kreuzes im Nordpontikum. Hier wurden einige sol-cher Motive auf großen Gefäßen und den Henkeln von Schöpfkellen entdeckt (Abb. 2,3.4.6-8; 3,6). Die neue Periodisierung der Siedlung Žabotin, die mit regionalen Chronologien, den neuesten europäischen und osteuropäischen Datierungsschemata abgestimmt ist, erlaubt es, drei Hauptetappen dieses Fundplatzes zu defi nieren, wobei die älteste am Übergang vom 9. zum 8. Jh. v.Chr. anzusetzen ist (Daragan 2004, 118 ff.; dies. 2006). Die Keramikfragmente mit Malteserkreuz wurden ausschließlich in den Komplexen des Hori-zonts II von Žabotin geborgen. Nicht nur die Fundlage sondern auch typologische Überlegungen lassen den Beginn dieses Horizonts in die Mitte des 8. Jh. v.Chr.
legen (Daragan 2004, 120 ff.; Daragan/Kašuba 2008, Abb. 1). Die Brandschichten in dem Horizont Žabotin-II lassen sein Ende durch Zerstörung nicht später als an das Ende des dritten Viertels des 8. Jh. v.Chr. ansetzen (Daragan/Podobed 2009, 30-31). Ob dies tatsächlich für den gesamten Horizont Žabotin-II zutrifft oder ob er in kürzere zeitliche Abschnitte zu unterteilen ist, werden weitere Forschungen zeigen.
Die Gegenüberstellung der Keramik mit Malteserkreuz und ihre Verbreitung im nördlichen Schwarzmeerge-biet mit den neuen Untersuchungen zur Kultur Basarabi-Şoldăneşti am mittleren Dnestrlauf (Kaşuba 2008a, 37 ff.) erlaubt neue Aussagen über den Charakter des Basarabi-Kultureinfl usses in dieser Region. Früher herrschte die Ansicht vor, dass der Einfl uss des Basarabi-Kultur-Komplexes im nördlichen Schwarzmeergebiet eine Folge ihrer östlichen Variante war, die über die Şoldăneşti-Kultur in das mittlere Dnestrbecken vermittelt wurde. Es stellte sich heraus, dass die Sachkultur und damit das Erscheinen des Basarabi-Kultur-Komplexes im Nordponti-kum durch 1) Denkmäler ihrer östlichen Peripherie – der Basarabi-Şoldăneşti-Kultur am Mittleren Dnestrlauf, 2) direkte Importe, wie Keramik, einzelne Artefakte, Opferstellen aus Lehm innerhalb des lokalen Milieus und 3) lokale Nachahmungen von Basarabi-Formen (vor allem bei der Keramik) repräsentiert ist (Abb. 1). Der Ein-fl uss des Basarabi-Kultur-Komplexes konnte innerhalb seiner lokalen Erscheinungsformen näher beschrieben
Abb. 6. Gegenüberstellung von Malteserkreuzdarstellun-gen auf Keramik des Basarabi-Kultur-Komplexes (A/1-8) und ausgewählten Funden aus dem nördlichen Schwarz-
meergebiet (B/9-18). 1 – Vašica-Gradina na Bosutu; 2 – Bucureşti-Măgurele; 3 – Čurug; 4 – Sopron, Tum.
80/140; 5 – Poiana; 6 – Balta Verde, Tum. 20; 7 – Maie-risch, Gr. 38; 8 – Schirndorf, Hüg. 89; 9,17 – Dikan’ka-Dmitrenkova Balka; 10 – Mitteldneprgebiet (Platonows
Sammlung); 11 – Kalinovka; 12 – Bel’sk, Westliche Befe-stigung; 13-14 – Požarnaja Balka; 15 – Trachtemirov;
16 – Lichačjevka; 18 – Dikan’ka-Strilycja-2 (nach Medović 1978, Vulpe 1965, ders. 1986, Berciu/Comşa 1956, Rei-chenberger 2000, Kovpanenko/Ševčenko 1981, Šramko
1996, Šramko I. 2006, Andrienko 1992, Kovpanenko 1967, Moruženko 1989, Ščerban /Rachno 2006).
Maja Kašuba242
werden: so drangen kleine Kollektive (kleine Gruppen, vielleicht auch nur einzelne Individuen) in das Mittlere Dneprgebiet vor, wobei sie das Mittlere Dnestrgebiet mit der hier überlieferten Şoldăneşti-Kultur umgingen (Kašuba 2007, 369 ff.; dies. 2008b, 29; dies. 2010, 371 ff.; Daragan/Kašuba 2008, 55 ff.). Eine Folge dieser ver-schiedenen kulturellen Zufl üsse bildet auch das Aufkommen der Darstellung des Malteserkreuzes (insbesondere des Kreuzes mit Dreieckarmen) im Dneprbecken, vor allem auf seinem linken Ufer, während es im Mitteldnestr-gebiet fehlt.
Für das hier zu erörternde Thema ist zunächst die Tatsache wichtig, dass im nördlichen Schwarzmeergebiet das Malteserkreuz belegt aber von geringerer Bedeutung ist, dass es hier auch bereits ab der Mitte des 8. Jh. v.Chr. vorkommt. Das entspricht der Zeit der größten Verbreitung dieses Symbols im Areal des Basarabi-Kultur-Komplexes, sowohl in dessen Zentrum an der mittleren Donau, aber auch insgesamt in Südosteuropa.
Was verbirgt sich hinter der Darstellung des Malteserkreuzes und welche zusätzliche Bedeutungen mag es innegehabt haben?
Kreuz und Malteserkreuz
Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, in denen sich die Lebenswelt des Menschen widerspiegelt, wurden in vorgeschichtlichen und traditionellen Gesellschaften nicht nur als Sachgut sondern auch als Zeichen verstanden. Ihre physischen, sozusagen „rationalen“ Eigenschaften erhielten häufi g die Bedeutung kulturanzeigender Merk-male, während die Objekte selbst als bemerkenswert galten und aus dem allgemeinen Bereich hervorgehoben wurden, d.h. es entwickelte sich ihre Semantisierung. Die so auf einem hohen Niveau mit Bedeutung versehenen Objekte (in unserem Falle: die Alltagsgegenstände) wurden zu „Symbolen“, die einen bestimmten Sinngehalt und Information sowohl für die Mitglieder einer Gemeinschaft aber auch außerhalb dieser innehatten (s. Bajbu-rin 1981, 216 ff.). Und in dieser Funktion wurden sie ebenfalls zu kulturanzeigenden Merkmalen. Die Steigerung der symbolträchtigen Funktion der Dinge führte dementsprechend zu einer Maximierung der zu übermittelnden Information. Sie konnte alle möglichen unterscheidbaren und nichtunterscheidbaren Zusätze erfahren, unter denen zweifellos das Ornament eine besondere Rolle spielte (bezüglich der frühskythischen Schöpfkellen vgl. Gorbov 2002, 243). Unter den verschiedenen Verzierungselementen nimmt die Darstellung des „Kreuzes“ eine besondere Stellung ein.
Das Kreuz ist eine geometrische Figur, die sich aus zwei sich überschneidenden Linien oder Rechtecken zusammensetzt, wobei mindestens eine der beiden Linien genau in ihrer Mitte durchschnitten werden soll. Eine der Erscheinungsformen des Kreuzes ist das achteckige oder Malteserkreuz. Das Kreuz gehört zu den am besten bekannten „Zeichen“ und ist somit ein universelles Symbol. Es ist weit in verschiedenen Kulturräumen und -zeiten verbreitet. Das Kreuz unterstreicht die Idee des Zentrums (der Punkt des Überschneidens von Oben und Unten sowie Rechts und Links) und der Hauptrichtungen, doch bei allem versinnbildlicht das Kreuz die Vereini-gung dualistischer Systeme zu einer Gesamtheit. Die „kreuzförmige“ Darstellung des Menschen mit ausge-streckten Armen führt zum Kreuz als Modell des Menschen. Das Kreuz ist ebenfalls eine der geometrisierten Varianten des Lebensbaums, nur mit dem Akzent auf der anthropozentrischen Idee. Und dadurch wird das Kreuz zu einem Bindeglied zwischen dem Lebensbaum (mit dem auch zoomorphe Darstellungen verbunden sind) und dem Menschen, ein geometrisierender Ausdruck des einen und des anderen. Die Universalität des Kreuzes als Symbol für die Einheit von Leben und Tod, für Fruchtbarkeit und Unsterblichkeit (der Sonnenlauf am Himmel, der die Nacht zum Tag verwandelt), für den männlichen Anfang, Erfolg und Blüte, kommt in jener wichtigen Rolle zum Ausdruck, die das Kreuz im Ritual und Ritualverhalten, in der Magie, in der Volksmedizin und -glauben, in der archaischen Kunst spielt (Toporov 1992а, 12-14).
Sich auf diese grundlegenden Charakteristiken stützend, führt es den Forscher dazu, Kreuzdarstellungen in den konkreten kulturhistorischen Traditionen zu betrachten. So werden spezifi sche geometrische Symbole (Rhombus mit Haken; mit Strichschraffur gefüllte Dreiecke, Rechtecke, Kreuze, darunter auch das Malteser-kreuz) in der Ornamentik in verschiedenen kulturhistorischen Traditionen und vor dem Hintergrund allgemein-geschichtlicher Materialien als Symbole der Erde, Ackerland, ja als fruchtbare Erde allgemein angesehen (Ambroz 1965, 14 ff.). Diese Symbole in der Keramikverzierung der frühen Eisenzeit, einschließlich der uns hier interessierenden prä- und frühskythischen Zeit, werden als Symbole interpretiert, die vor allem mit den Kulten ackerbautreibender Gesellschaften und dem „Heiligen Baum“ zusammenhängen (Andrienko 1975, 14 f.; ders. 1995, 12; Moruženko 1989, 250 ff.; Gorbov 2002, 244 ff.). Ein solches Verständnis geht völlig mit der Universa-
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 243
lität der Kreuzsymbolik überein, wie bereits ausgeführt wurde. In jedem Falle zeugt diese Symbolik davon, dass das Kreuz immer mehr Bedeutungsinhalt mit sich führte, als nur das Wesen einer geometrischen Figur.
Über das „Pantheon“ in der Hallstattzeit
Das polytheistische „Pantheon“ bzw. die Götterwelt der Hallstattzeit beinhalten die Personifi zierung der Son-ne sowie der lebenden, sterbenden und wiedererstehenden Natur. Es lässt sich an verschiedenen, meist indi-rekten Zeugnissen erraten, aber besonders anhand des fi gürlichen Darstellens, die uns vor allem in den osthall-stattzeitlichen Kulturen – und hier wieder besonders eminent in der Kalenderbergkultur – überliefert sind (s. Frey 1976, 578 ff.; Dobiat 1980, 218 f.; ders. 1982, 279 ff.; Eibner-Persy 1980; Eibner 1996, 105 ff.; dies. 1997, 129-145; Teržan 1990, 124 ff.; dies. 1996, 507 ff.; Nebelsick 1992, 401 ff.; Reichenberger 2000; Studeníková 2004, 15 ff.; u.a.). Zu Beginn der frühen Eisenzeit nimmt die Verkörperung des Göttlichen in Mitteleuropa, ins-besondere in der Alpenzone eine anthropomorphe Gestalt an, meist eine weibliche. Die Göttin selbst wird in Begleitung von pfl anzlichen und astralen Symbolen dargestellt. Es kann ein heterogenes und eindrucksvolles Bild der religiösen Vorstellung mit unterschiedlichen Ausdrucksformen rekonstruiert werden: unter den Perso-nifi kationen fi ndet sich die Darstellung der Göttin in der frühen Phase HaC1 als „Hüterin der Tiere“ (vgl. hierzu Kossack 1999, 138 ff.; Metzner-Nebelsick/Nebelsick 1999, 69 ff.; Teržan 2001, 75 ff.; dies. 2005, 255 f.; u.a.).
Die ikonographische Entwicklung der göttlichen Figur (Göttinnen, Boten und Hüter der Helden mit göttlichem Status) zeigt, dass in der frühen Phase (HaC1) die Göttin in speziellen Szenen des Zweikampfes und in Prozessi-onen inmitten von Menschen, die Tierkostüme tragen (paarweise angeordnete Figuren in Hirsch-, Pferd-, Vogel- und Katzenmaskierungen, Abb. 7,1-6.8). Später (HaC2) wird die Gottheit unterschiedlich dargestellt und hat vielfältige Bedeutung, als „Große Göttin“ und „Herrin der Tiere“ und besonders als „Göttin auf dem Streitwa-gen“, die mit Lanze, Schwert und Helm bewehrt ist. In den jüngeren Etappen der Hallstattzeit (HaD1-D2) ist die Ikonographie deutlich individualisierter und mit festen Attributen ausgestattet, am häufi gsten in Gestalt der bewaffneten Göttin auf dem Streitwagen. Mittels Kombinationsstatistiken und stilistischen Analysen sind die hallstattzeitlichen Grabinventare, in denen Gefäße mit anthropomorphen Darstellungen vorkamen, ausgewertet worden (Nebelsick 1992, 406 ff. Tab. 1-5; ders. 1996, 327 ff.; Teržan 2001, 75 ff.). Sie belegen, dass die ältesten solcher Bestattungen in den Gräberfeldern von Basarabi und Fischau-Feichtenboden die von Frauen sind. Das wiederum gab Anlass zu der Vermutung, dass die so beigesetzten Frauen zu Lebzeiten eine besondere Rolle in den Ritualen und im Kultgeschehen innehatten, als Botinnen oder Opferpriesterinnen. In fast allen jüngeren Gräbern (На D1-D2), in denen anthropomorphe Gefäße vorkamen, befanden sich Männer. In diesem Fall kön-nen die Götterdarstellungen als „Göttin-Hüterin“ ansehen, als Wahrerinnen/Botinnen des Schicksals und Schüt-zerinnen des Sieges, als Schicksalsgöttinnen oder Hüterinnen der Heroen (Teržan 1997, 653 ff.; dies. 2001, 84).
Die anthropomorphen Darstellungen auf hallstattzeitlicher Keramik und Bronzegegenständen (besonders auf den Situlen) beschreiben verschiedene Szenen, die faktisch die ehemalige riesige Welt der vielfältigen Rituale und Opferhandlungen wiedergeben. Dies sind Prozessionen mit Trägern von Gefäßen, „die Heilige Jagd“, der Zweikampf und der Wettstreit, Kampfszenen und Frauen auf dem Streitwagen, das Spinnen und Entwirren von Fäden, gemeinsame Mahlzeiten, Austeilen und Zusichnehmen von Getränken, „Feste“ mit Musikanten, Tän-zern, Prozessionen mit verkleideten Personen u.v.m. (Frey 1976, 578 ff.; Dobiat 1980, 218 f.; ders. 1982, 279 ff.; Nebelsick 1992, 406 ff. Tab. 1-2; ders. 1996, 327 ff.; Eibner 1993, 101-116; dies. 1996, 105 ff.; dies. 1997, 129-145; Teržan 1997, 653 ff.; dies. 2001, 75 ff.; dies. 2005, 251 ff.; Reichenberger 2000, 100 ff.; Koch 2003, 347 ff.; u.a.).
Neben so vielen eindeutigen anthropomorphen und zoomorphen Darstellungen sind auf vielen Gegenständen (selbstverständlich auch auf Keramik) geometrische Muster aufgebracht, die von geometrisch aufgefassten Figuren zu unterscheiden sind. Besonders verbreitet waren Dreiecke, deren Bedeutung stark variieren kann und auch die Stilisierung einer anthropomorphen Gestalt beinhaltet. Das Dreieck selbst ist das Symbol der Verkörpe-rung und des Ausdrucks einer bestimmten unsichtbaren Realität. So zeigt die Analyse der Darstellung eines einzelnen Dreiecks als geometrisiertes anthropomorphes Muster, dass in den meisten Fällen mit ihm eine Frauen-fi gur ausgedrückt wird: das Dreieck mit Fähnchen steht allgemein für eine menschliche Figur mit erhobenen Armen (Adorantenhaltung), das mit Strichschraffur gefüllte Dreieck in Kombination mit einem Kreuz auf dem oberen Scheitelpunkt symbolisiert die Sonnengottheit (Dobiat 1982, 279 ff. Abb. 1; 3; 13-14; Nebelsick 1997a, 120 ff. Abb. 46; Eibner 1997, Abb. 47; dies. 2002, 125 ff.; Brosseder 2004, 248 ff., Abb. 163-168; 174-175; Teržan 2005, 253 ff.). Doppelte, an ihren Scheitelpunkten verbundene horizontale Dreiecke bilden oft die Körper von
Maja Kašuba244
zoo- und ornithomorphen Figuren oder sind mit fi gürlichen Motiven in Prozessionsszenen kombiniert, hinter den genannten Dreiecken verbergen sich zwei als Tiere verkleidete Personen (s. Eibner 1996, 107 ff. Taf. 6). Daneben existieren noch zahlreiche weitere geometrische Darstellungen und ihre Kombinationen, deren geheim-nisvolle Botschaften und Gedanken wir heute erst allmählich zu nähern beginnen.
Das „Pantheon“ der Hallstattzeit und die Basarabi-Kultur
Die Suche nach vielen fi gürlichen, einschließlich auch anthropomorpher Darstellungen, die so deutlich in der Hallstattzeit aufscheinen, führt zu den Darstellungen der vorangegangenen bronzezeitlichen Kulturen in Mittel- und in Südosteuropa sowie der Ägäischen Welt (s. Kossack 1999, 108 ff.; Hänsel 2000, 331 ff.; ders. 2003, 28 ff.; Teržan 1997, 653 ff.; dies. 2005, 241 ff.; Brosseder 2004, 248 ff. 337 ff.; Studeníková 2004, 15 ff.; u.a.).
Das besondere Augenmerk liegt dabei auf dem Basarabi-Kultur-Komplex, eines der wichtigsten „Kulturgebil-de“ in Südosteuropa während der Hallstattzeit. Gerade aus seinem Verbreitungsareal sind zahlreiche zoo-, orni-tho- und anthropomorphe Darstellungen bekannt. Unter den einfacheren und demzufolge uns weniger verständ-lichen geometrischen Abbildungen sind vor allem Dreiecke und verschiedene Kreuzformen sowie Kombinati-onen aus ihnen verbreitet. Alles dieses bildet letztlich den spezifi schen Basarabi-Stil, der insbesondere in den Kulten und der Ornamentik zum Ausdruck kommt und damit die gleichnamige Kultur in ihrem Verbreitungs- und Einfl ussgebieten von anderen absetzte (Vulpe 1986, 49 ff.; Gumă 1983, 65 ff.; ders. 1993, 208-235; Dular 1973, 544 ff.; Teržan 1990, 71 ff.; Tasić 1991, 239 ff.; Metzner-Nebelsick 1992, 349 ff.; Eibner 1996, 105 ff. Taf. 6,3-22; dies. 2001, 182 ff. Karte 1-2; Roeder 1997, 601 ff.; Zverev 2003, 224 ff.; u.a.).
Welche Bedeutung mag diese oben beschriebene „Götterwelt“ der Hallstattzeit, und damit sind auch die Mal-teserkreuzdarstellungen in dem Basarabi-Kultur-Komplex gemeint, in der synchronen prä- und frühskythischen Zeit im nördlichen Schwarzmeergebiet gehabt haben?
Das Malteserkreuz als „Heilszeichen“ – eine Erörterung
Die Sichtung der Malteserkreuze im nördlichen Schwarzmeergebiet und ihre anschließende Analyse erlauben einige Schlussfolgerungen und das Aufzeigen weiterer Perspektiven für dier Forschung:
A. Es konnte bestätigt werden, dass das nördliche Schwarzmeergebiet zu der Interessenssphäre der Bevölke-rung gehörte, deren materieller Komplex in der archäologischen Kultur mit Namen Basarabi zum Ausdruck kommt. Elemente dieses Kultur-Komplexes treten, so konnte ebenfalls gezeigt werden, ab der Mitte des 8. Jh. v.Chr. auf. Das wiederum gibt eine zusätzliche Grundlage, zum Vergleich mit nordpontischem Fundgut auch andere Materialien des Basarabi-Kultur-Komplexes heranzuziehen.
B. Interesse rufen die Positionen hervor, an denen das Malteserkreuz auf der Keramik aufgebracht ist – sie befi nden sich vorwiegend auf den Henkeln von Schöpfkellen. Das ist insbesondere kennzeichnend für das linksufrige Dneprgebiet. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt des frühesten Auftretens von diesem besonderen Typ der Schöpfkelle im Nordpontikum noch nicht abschließend geklärt ist. Bei dem Typ handelt es sich um fl ache, mit einem hohen Henkel, der in einer Öse endet, versehene Stücke, die schma-len Fortsätze an der Henkelbiegung und ein radiales, vom Zentrum des Boden aus verlaufendes geometrisches Muster tragen. Durchaus überzeugend scheint ihre Herleitung aus der Kultur mit kannelierter Keramik, Gáva-Holigrady (oder auch Gáva-Holigrady-Grăniceşti) im östlichen Karpatenraum (Leviţchi 2006, 42 ff.; Kašuba/Levitskij 2011). Jedoch fand gerade im mittleren Dneprraum eine Weiterentwicklung der morphologischen Merkmale dieser Gefäße statt: der Akzent wurde auf den Henkel gelegt, an dem schaufelförmige und „Hörnchen”-Fortsätze angebracht wurden, sowie auf radiale Ornamente. Damit wurde ihre Funktion als Gefäß zum Schöp-fen einer Flüssigkeit aus einem anderen Behältnis betont. Solche Schöpfkellen wurden typisch und spezifi sch in dieser Region, wo in vergleichsweise großer Anzahl gefunden wurden.
C. Damit tut sich bereits die nächste Frage auf: womit kann die große Produktion dieser so kennzeichnenden Form zusammenhängen? Die hier vorgestellte Analyse der symbolischen Funktion der Schöpfkellen (bei der das radiale Ornament als eines der vielfältigen Sonnensymbole aufzufassen ist) führt zu dem Schluss, dass sie sakralen Charakter hatten und als rituelle Gegenstände in Kulten verwendet wurden. Sie sind Objekte zum Schöpfen von irgendeiner Flüssigkeit aus Gefäßen (Welt der Dinge, utilitaristisch), die in rituellen Handlungen
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 245
(Vorstellungswelt, Symbolcharakter) Benutzung fanden, bei deren Vollzug, allem Anschein nach zu urteilen, berauschende Getränke eine Rolle spielten (vgl. Gorbov 2002, 243 ff.; Toporov 1982b, 256 ff.). Die Fundumstän-de einiger Schöpfkellen mit Malteserkreuz deuten tatsächlich auf ihren ehemals rituellen Gebrauch hin, zum Beispiel befand sich ein solches Exemplar auf einer steinernen Plattform in der Siedlung Žabotin (Abb. 3,4.6). Bemerkenswert sind auch die Materialien von der Siedlung Lichačejvka, wo eine Plattform (ovale Form, 3,8 x 1,9 m, aus festgestampftem Sand mit viel Holzkohle) für den zeremonialen Gebrauch freigelegt wurde, auf der auch zwei Schöpfkellen (eine davon trug ein Malteserkreuz – Abb. 5,13) und die Reste von geopferten Tieren lagen. Außerdem fanden sich die Rückstände von neun weiteren Opferstellen in einem Radius bis zu 9 m in einem Halbkreis um diese Plattform angeordnet (Moruženko 1989, 252). Der genaue Fundkontext der Schöpf-kellen mit Malteserkreuzen auf der Siedlung Požarnaja Balka muss noch konkretisiert werden, doch gibt es mit Skeletten von Hunden und Schweinen Hinweise ebenfalls auf das Vorhandensein solcher Opferplattformen (Moruženko 1989, 257).
D. Anhand von Kultartefakten unterschiedlicher Ausprägung (einschließlich der symbolischen Darstellungen der Sonne, der Erde, des Ackerlandes und des heiligen Baumes) wurde auf ein entwickeltes ackerbäuerisches Kultgeschehen bei den lokalen Stämmen der Waldsteppenzone in der skythischen Zeit geschlossen (Andrienko 1975, 17 f.; Moruženko 1989, 253 ff.). Auf die Existenz von damit verbundenen Bräuchen und Festen lässt sich mittels ethnographischer und historischer Parallelen folgern (s. Moruženko 1989, 253 ff.). Hier sei an die For-schungen von M. Artamonov (1947, 7) erinnert, der anhand der genealogischen Legende von Herodot über die heiligen goldenen Gaben [Hrd. IV, 5,7] die Existenz eines alljährlichen Frühjahrsfestes nachwies, das mit rei-chen Opferhandlungen begangen wurde. Den Höhepunkt dieses Festes bildete der Traum vom heiligen Gold – ein magischer Traum, der die „Mutter Erde“ befruchtete. D. Raevskij (1977, 112 ff.) zeigte in der Folge die Ver-bindung dieses Festes mit dem Beginn eines neuen Zeitzyklus, des anbrechenden Sonnenjahres, das am Tag des Frühjahräquinoktiums einsetzte.
E. Assoziationen und Analogien kann man in der „Götterwelt“ der hallstattzeitlichen Kulturen suchen. Denn das Sachgut des Basarabi-Kultur-Komplexes (und dazu zählt auch die Darstellung des Malteserkreuzes) „ver-band“ nicht nur die voralpine Zone und den nördlichen Schwarzmeerraum einschließlich des Dneprbeckens, sondern geometrische Muster dieser Kultur bilden die Grundlage für viele fi gürliche Darstellungen, wie sie aus den Osthallstattkulturen bekannt sind (in Kürze dargestellt bei Eibner 2002, 125 ff.).
Am Ende des hier behandelten Themas kehren wir zu den oben beschriebenen Darstellungen von Prozessions-szenen und so genannten „Kult- bzw. Stammesfesten“ zurück. Unter den bei ihnen agierenden Personen begeg-nen auch Träger von Gefäßen. Diese können groß sein, sie werden bei Prozessionen transportiert. Oder sie sind vergleichsweise klein und werden auf Frauenköpfen getragen. Große Gefäße (darunter auch verschiedene Kes-sel) wurden nicht nur übermittelt, sondern sie konnten auch auf mit speziellen Attributen ausgestatteten oder „einfacheren“ Wagen stehen (Abb. 7,7). Ein unerlässliches Attribut in den Szenen von „Stammesfesten“ bilden Trinkgelage und die Zusichnahme von Getränken (Abb. 7,8). Alle diese Szenen verdeutlichen die große Bedeu-tung der dargestellten Handlungen, die mit gemeinsamen Mahlzeiten zusammenhängen, wozu auch das Trinken bestimmter Getränke gehörte4 (Eibner 1997, Abb. 49,3; 50,1-2).
Vollständige Ensembles von Trinkgefäßen, die die Gräber von Eliten begleiteten, bilden einen Ausdruck des Reichtums und den besonderen Status der in ihnen Bestatteten und treten seit dem Beginn der Hallstattzeit auf, beispielsweise in den Kulturen des Karpatenbeckens. Das auf diese Weise aufscheinende besondere und neue Ritual lässt sich mittels des Dionysos-Mythos im Mittelmeerraum erklären, wo dessen Kult bereits seit der mykenischen Zeit bekannt war. Eine mit Dionysos verbundene Ikonographie lässt sich im Grabkult Griechen-lands seit der geometrischen Periode feststellen (Nebelsick 1994, 307 ff.; ders. 1997b, 384 f.)5.
In jedem Fall haben die in den Ritualen verzehrten, berauschenden Getränke vielfältige semantische Be -
4 Letzteres wird durch die besondere Stellung von Kesseln und anderer großer Gefäße für Flüssigkeiten unterstrichen (vgl. auch Gleirscher 2004, 264 f.).5 An dem Umbruch vieler Schöpfkellenhenkel aus dem linksufrigen Dneprgebiet sind doppelte Fortsätze angebracht, die als Stierhörner interpretiert werden können. Der Stier ist das Symbol des Dionysos-Mythos. Die Wahrscheinlich der Existenz eines Dionysos-Kultes bei der Bevölkerung in der Waldsteppen des linksufrigen Dneprgebiets während der frühskythischen Zeit wur-de bereits mehrfach behandelt (Šramko 1987, 129 f. 161 f.; ders. 1996, 85; Bojko/Berestnev 2001, 62 f.). Hier sei nur an die von Herodot beschriebene Stadt Gelonos im Land der Budiner erinnert, in der B.A. Šramko (1987) die Gorodišče von Bel’sk identifi -zierte, sowie an folgendes Zitat: „Und alle drei Jahr feiern sie dem Dionysos ein Fest und sind in Bakchoswut“ [Hrd. IV, 108].
Maja Kašuba246
deutung, doch steht an ihrem Ende das Erreichen einer Gleichheit von Realem und Irrealem, von „Logos“ und „Mythos“ (Toporov 1992b, 256 ff.). Wahrscheinlich ge -hörte zu den „Stammesfesten“ im nördlichen Schwarz-meergebiet unbedingt der Konsum von bestimmten (berauschenden?) Getränken6. Eben für diesen Zweck wurden hier so viele besondere Schöpfkellen herge-stellt. Diese Gefäße waren tatsächlich für einen be -stimmten Gebrauch vorgesehen und so wurde ihre Funktion als Schöpfi nstrument noch durch die Form und ein radiales Sonnenmuster betont. Die Anpassung fremder Motive (wie das hier besprochene Malteser-kreuz, Typ 2, Kreuz mit Dreiecksarmen) an die Orna-mentik der Kellen belegt die Wahrnehmung neuer Ele-mente oder neuen Brauchtums durch die lokale Bevöl-kerung. Aller Wahrscheinlichkeit nach stellen die Schöpfkellen mit besonderen Zeichen (einschließlich des Malteserkreuzes) einen materialisierten Ausdruck ritualisierter Handlungen dar, die ein solches „Fest“ begleiteten, und drücken gleichfalls die Identität einer Gruppe der Bevölkerung aus, die diese Rituale beging. Das ist wiederum der Grund, weshalb direkte Analo-gien zu den fl achen Schöpfkellen nicht existieren. Die große Zahl an entsprechenden Funden und die Vielfalt der radialen Muster auf ihnen zeugt von ihrem indivi-duellen Gebrauch7.
Dementsprechend kann das hier behandelte Malte-serkreuz (sowie „Heilszeichen“ im Ganzen) als erkennbare Naturalisierung einer unsichtbaren Realität verstan-den werden und erlaubt seine Interpretation trotz der bereits verlorenen Realität. Berücksichtigt man die Kon-texte solcher Funde, so ist hier nicht nur von der Gemeinsamkeit der ackerbäuerischen Kulte in ihrer weiten Verbreitung in Mittel-, Südosteuropa und im Nordpontikum die Rede. Weiterhin gilt es noch, auch den Charak-ter der religiösen Vorstellungen, unter denen, allen Fakten nach zu urteilen, zweifelsohne der Sonnenkult prä-sent war, zu ermitteln. Doch wichtig ist vor allem eins – die Einbeziehung selbst weit entfernt voneinander gele-gener Territorien in einen gemeinsamen kulturellen Kontext (Abb. 1; 6) zeugt von der Existenz mehr oder weni-ger identischer Rituale, die einen „sakralen Raum“ des gesamten Basarabi-Kultur-Komplexes markieren.
6 Bezüglich des Vorhandenseins von großen Gefäßen und Kesseln im Nordpontikum sei noch angemerkt, dass sie aus Holz sein konnten. Lokales Schnitzhandwerk konnte anhand des Silexinventars der Siedlung Tătărăuca Nouă XV am mittleren Dnestrlauf nachgewiesen werden, das in die späte Černoles’-Kultur datiert (Larina/Kašuba 2005, 212 f.). Auch die Anzahl der bronzenen Gefäße im mittleren Dneprgebiet war recht hoch (Magura 1930, 53 f. Tab. IV), wenn man die vielen Exem-plare hinzuzählt, die Gegenstände aus umgearbeiteten, kaputten Kesseln darstellen (s. Terenožkin 1961, 73 Abb. 101,10; Rjabkova 2008, 88 ff.).7 Ein schönes Beispiel für ein ähnliches Fehlen von Analogien liegt mit dem Gräberfeld Lăpuş (nördliches Transsilvanien) vor, das hauptsächlich während BrD – Ha A1 belegt wurde. Die hier beigesetzten Führer einer Kriegerelite hielten die Kon-trolle über ein Territorium mit Metalllagerstätten und demzufolge hier ausgeübtem Metallhandwerk. Sie drückten sich selbst in Waffen und reich ornamentierter Keramik mit fi gürlichen Darstellungen sowie Protomen aus. Die Keramik von Lăpuş wurde speziell gefertigt, um die Identität der hiesigen Eliten zu bedienen, und hat keinerlei direkte Vergleiche in Zeit und Raum (Teržan 2005, 250-251).
Abb. 7. „Stammesfeste“ der Hallstattzeit in Südost- und Mitteleuropa – Darstellungen und Fundgut (Auswahl): 1-3
– Unterzögerdorf; 4 – Basarabi, Tum. III/S1; 5 – Nové Košariská, Tum. I; 6 – Fischau-Feichtenboden, Tum. V; 7
– Fertőendréd; 8 – Kuffern, Situla (nach Frey 1980, Dobiat 1982, Eibner 1997, Teržan 2001, Gőmőri 2002).
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 247
Liste der Fundorte im Nordpontikum mit Keramik, auf der das Malteserkreuz abgebildet ist8:
I. Offene und befestigte Siedlungen I.1. Offene Siedlungen
Nagorjane-Pidmet, Mittleres Dnestrbecken (Abb. 1,1)Lit.: Šovkopljas 1954, 104 Abb. 7Symbol: Malteserkreuz (Typ 1 – Abb. 2,1) auf dem Boden der Pyxis
Žabotin, rechtes Ufer am mittleren Dnepr (Abb. 1/7)Lit.: Daragan 2004, Abb. 27,1-2; 31,8.11; 32,8.9; Daragan/Kašuba 2008, Abb. 5,8; 9,3; 10,10Symbol: Malteserkreuz auf den Wänden eines großen Gefäßes (Typ 2 – 2 Ex., Abb. 2,3.4), auf den Wänden (Typ 2 – 2 Ex., Abb. 2,7; 3,6) und auf den Henkeln (Typ 1 – 2 Ex., Typ 2 – 3 Ex., Abb. 2,6.8) von Schöpfkellen
Kalinovka -Zasribljanka, rechtes Ufer am mittleren Dnepr (Abb. 1,4)Lit.: Kovpanenko/Ševčenko 1981, Abb. 6,9Symbol: Malteserkreuz (Typ 2 – Abb. 3,2) auf dem Henkel einer Schöpfkelle
Požarnaja Balka, linkes Ufer des mittleren Dnepr (Abb. 1,8)Lit.: Andrienko 1992, Abb. 7,8; Ščerban´ 2007, Abb. 7.11; im Ganzen unpubliziertSymbol: Malteserkreuz auf dem umgebogenen Rand eines Gefäßes (Typ 2 – 1 Ex., Abb. 5,11), auf den Wänden (Typ 2 – Abb. 5,6) und auf den Henkeln (Typ 2 – Abb. 5,3) von Schöpfkellen; auf zwei fl achen, spulenförmigen Objekten aus Ton (Typ 1)
Dikan’ka-Dmitrenkova Balka, BAM, Fjedorovka, Strilycja-2, Sobakar ova Balka, linkes Ufer des mittleren Dnepr (Abb. 1,10)Lit.: Ščerban /Rachno 2006, Abb. 2,6; 4,2; 5,5.6; Ščerban´ 2007, Abb. 28,5; teilweise unpubliziertSymbol: Malteserkreuz auf den Henkeln (Typ 2 – 8 Ex., Abb. 5,1.2.4.5.7-10) von Schöpfkellen; auf zwei fl achen, spulenförmigen Objekten aus Ton (Typ 1 – Abb. 5,12).
Lichačejvka, linkes Ufer des mittleren Dnepr (Abb. 1,11)Lit.: Moruženko 1989, 242 ff. Abb. 35,20; 36; unpubliziert Symbol: Malteserkreuz auf den Wänden (Typ 1) und auf den Henkeln (Typ 2 – Abb. 5,13) von Schöpfkellen.
Mačuchi-Desjate Pole, linkes Ufer des mittleren Dnepr (Abb. 1,9)Lit.: Rudinskij 1949, 53 ff.; Moruženko 1989; Andrienko 1995; Ščerban´ 2007, Abb. 28,6; 29,1-2; im Ganzen unpubliziertSymbol: Malteserkreuz auf den Henkeln von Schöpfkellen; auf drei fl achen, spulenförmigen Objekte aus Ton (Typ 1).
Šampai, linkes Ufer des mittleren Dnepr Lit.: Moruženko 1989; Andrienko 1995; unpubliziertSymbol: Malteserkreuz auf den Henkeln von Schöpfkellen
I.2. Befestigte SiedlungenNemirov, mittlerer Lauf des Südlichen Bugs (Abb. 1,2)Lit.: Smirnova 1996, Abb. 7,5Symbol: Malteserkreuz (Typ 1 – Abb. 2,2) auf der Wand einer Schöpfkelle
8 Die Verfasserin dankt herzlich den ukrainischen Kollegen Dr. G. Kovpanenko, N. Ševčenko, Dr. V. Andrienko, Dr. A. Ščerban’ und Dr. I. Šramko für die freundliche Erlaubnis, das hier vorgestellte Material zu veröffentlichen, und für die Hilfe bei dessen Zusammentragung (s. Kašuba/Daragan 2009b, 65 ff.).
Maja Kašuba248
Trachtemirov, rechtes Ufer am mittleren Dnepr (Abb. 1,3)Lit.: Kovpanenko 1967, Abb. 7Symbol: Malteserkreuz (Typ 2 – Abb. 2,5) auf dem Henkel einer Schöpfkelle
Bel’sk, Westliche Befestigung, linkes Ufer des mittleren Dnepr (Abb. 1,12)Lit.: Šramko 1996, Tab. IX,1-3.7; Šramko I. 2006, Abb. 8,15.16; 9,15; 10,19.20.25.35Symbol: а – Zol’nik 4, Ausgrabungen 1906 von V. Gorodcov: Malteserkreuz (Typ 2 – 4 Ex., Abb. 4,1.2.8.10) auf den Henkeln von Schöpfkellen;b – Zol’nik 5, Ausgrabungen 1998-2004 von I. Šramko: Malteserkreuz auf den Wänden (Typ 2 – 3 Ex., Abb. 4,9.12) und auf den Henkeln (Typ 1 – 1 Ex., Typ 2 – 4 Ex., Abb. 4,3-6.11) von Schöpfkellen
II.1. GräberMakeevka, Kurgan 455, rechtes Ufer am mittleren Dnepr (Abb. 1,5)Lit.: Il´inskaja 1975, Tab. XIX,4; Galanina 1977, Tab. 8,3Symbol: Malteserkreuz (Typ 2 – Abb. 3,5) auf dem Henkel einer Schöpfkelle
Tenetinka, Kurgan 219, rechtes Ufer am mittleren Dnepr (Abb. 1,6)Lit.: Il´inskaja 1975, Tab. XXXI,7Symbol: Malteserkreuz (Typ 2 – Abb. 3,3) auf dem Henkel einer Schöpfkelle
Literaturverzeichnis
Ailincăi 2010: S. C. Ailincăi, New observations of the First Iron Age discoveries at Revărsarea-Cotul Tichileşti, Isaccea, Tulcea county. In: N. Bolohan, F. Măţău, F.A. Tencariu (eds.), Signa praehistorica: studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno (Iaşi 2010) 343–371.
Ambroz 1965: А. К. Амброз, Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крюками»). Советская Археология 3, Москва (1965) 14–27.
Andrienko 1975: В. П. Андриенко, Земледельческие культы племен лесостепной Скифии VII-V вв. до н.э. Автореф. дисс. канд. ист. Наук (Харьков 1975).
Andrienko 1992: В. П. Андриенко, Комплекс начала скифского времени на поселении Пожарная Балка (раскоп 11). In: В.А. Посредников (ред.), Донецкий археологический сборник, вып. 1, Донецк 1992, 73–88.
Andrienko 1995: В. П. Андриенко, Об изображениях «мальтийского креста» в Лесостепной Скифии (хронология и семантика). In: В.Ф. Бурносов (отв.ред.), Тезисы докладов вузовской научной конференции профессорско-препо-давательского состава по итогам научно-исследовательской и методической работы: исторические науки (Донецк, апрель 1995 г.), Донецк 1995, 11–12.
Andrienko 2000: В. П. Андриенко, О нижней хронологической дате поселения Пожарная Балка. In: Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий, Донецк 2000, 100–101.
Artamonov 1947: М. И. Артамонов, О землевладении и землевладельческом празднике у скифов (Геродот, кн. IV, гл. 7). In: А. И. Молок (отв. ред.), Учëные записки ЛГУ № 95, серия исторических наук, вып. 15, Ленинград 1947, 3–20.
Bajburin 1981: A. K. Байбурин, Семиотический статус вещей и мифология. In: Б.Н. Путилов (отв.ред.), Материаль-ная культура и мифология. Сборник Музея Антропологии и Этнографии, т. XXXVIII, Ленинград 1981, 215–226.
Berciu / Comşa 1956: D. Berciu / E. Comşa, Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950). Materiale şi Cercetari Arheologice II, Burureşti 1956, 251–489.
Bojko / Berestnev 2001: Ю. Н. Бойко / С. И. Берестнев, Погребения VII-IV вв. до н.э. курганного могильника Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени) (Харьков 2001).
Brosseder 2004: U. Brosseder, Studien zur Ornamentik hallstattzeitlicher Keramik zwischen Rhônetal und Karpatenbek-ken. UPA 106 (Bonn 2004).
Brujako 2005: И. В. Бруяко, Ранние кочевники в Европе (X – V вв. до н.э.) (Кишинëв 2005).Daragan 2004: M. N. Daragan, Periodisierung und Chronologie der Siedlung Žabotin. Eurasia Antiqua 10, 2004, 55–146.Daragan 2006: М. Н. Дараган, Жаботинский этап раннего железного века Днепровской Правобережной лесостепи
(по материалам Жаботинского поселения). Диссертация на соискание учëной степени канд. ист. наук. НА ІА НАНУ, рукопись (Киев 2006).
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 249
Daragan / Kašuba 2008: M. Дараган / М. Кашуба, Аргументы к ранней дате основания Жаботинского поселения. Revista Arheologică, SN, vol. IV, nr. 2 (Chişinău 2008), 40–73.
Daragan / Podobed 2009: М.Н. Дараган / В.А. Подобед, О датировке слоя разрушения (горизонт Жаботин II) на Жабо-тинском поселении начала раннего железного века. In: Матерiали конференцiї «Проблемы скiфо-сарматської археологiї Пiвнiчного Причорномор’я», Запорiжжя 2009, 22–31.
Dobiat 1980: C. Dobiat, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Schild von Steier, Beih. 1 (Graz 1980).
Dobiat 1982: C. Dobiat, Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik – eine Bestandsaufnahme. Acta Arch. Hun-garicae 34 (Budapest 1982), 279–322.
Dular 1973: J. Dular, Bela krajina v starohalštatskem obdonju [Die Bela krajina in der frühen Hallstattzeit]. Arheol. Vestnik 24 (Ljubljana 1973) 544–591.
Eibner 1993: A. Eibner, Zur Lesbarkeit der Bildsymbolik im Osthallstattkreis. Thraco-Dacica, t. XIV,1-2 (Bucureşti 1993) 101–116.
Eibner 1996: A. Eibner, Die Bedeutung der Basarabi-Kultur in der Entwicklung des Osthallstattkreises. In: M. Garašanin / P. Roman (Hrsg.), Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Südosteuropa. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (7.-9. November 1996) (Bukarest 1996) 105–118.
Eibner 1997: A. Eibner, Die „Grosse Göttin“ und andere Vorstellungsinhalte der östlichen Hallstattkultur. In: J.-W. Neuge-bauer (Hrsg.), Hallstattkultur im Osten Österreichs. Wissenschaftliche Schriften Niederösterreich 106-109 (St. Pölten 1997) 129–145.
Eibner 2001: A. Eibner, Der Donau-Drave-Save-Raum im Spiegel gegenseitiger Einfl ussnahme und Kommunikation in der frü-hen Eisenzeit. Zentralorte entlang der "Argonautenstraße". In: A. Lippert (Hrsg.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vor-christlichen Jahrtausend. Akten des Internationalen und Interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg. UPA 78 (Bonn 2001) 181–190.
Eibner 2002: А. Eibner, Woher stammt die Figuralverzierung im Osthallstattkreis? In: Sborník národního muzea v Praze. Řada A – Historie LVI, 1-4 (Praha 2002) 125–142.
Eibner-Persy 1980: A. Eibner-Persy, Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg). Wiss. Arb. Burgenland 62 (Eisen-stadt 1980).
Frey 1976: O.-H. Frey, Bemerkungen zu fi gürlichen Darstellungen des Osthallstattkreis. In: Festschrift R. Pittioni I. Arch. Austriaca, Beih. 13 (Wien 1976) 578–587.
Frey 1980: O.-H. Frey, Werke der Situlenkunst. In: Die Hallstattkultur. Frühform europäischer Einheit. Internationale Aus-stellung des Landes Oberösterreich 25. April bis 26. Oktober 1980, Schloss Lamberg, Steyr (Linz 1980) 138–149.
Galanina 1977: Л. К. Галанина, Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н.Е. Бранденбурга). Свод Археологических Источников, вып. Д1-33 (Москва 1977).
Gleirscher 2004: P. Gleirscher, Zum Bleiwagen aus Frög bei Rosegg. Kessel- oder Prunkwagen. Arheološki vestnik 55, 2004, 251–266.
Gőmőri 2002: J. Gőmőri, Grab der Osthallstattkultur mit Wagengefäß aus Fertőendréd (Kom. Sopron, Ungarn). In: URL www.ag-eisenzeit.de/2002 (Sopron), sopron_abstracts.pdf, 12–13.
Gorbov 2002: В. Н. Горбов, О сакральной функции архаических черпаков Лесостепной Скифии. In: Структурно-семиотические исследования в археологии, т. 1 (Донецк 2002) 243–255.
Gumă 1983: М. Gumă Contrubuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat. Banatica VII, 1983, 65–138.Gumă 1993: М. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fi erului în sud-vestul României. Bibl. Thracologica 4 (Bucureşti 1993).Hänsel 2000: B. Hänsel, Die Götter Griechenlands und die südost- bis mitteleuropäische Spätbronzezeit. In: B. Gediga /
D. Piotrowska, Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej [Die symbolische Kultur des Urnenfelderkreises in der Bronze- und frühen Eisenzeit Mitteleuropas] (Warszawa, Wrocław, Biskupin 2000) 331–344.
Hänsel 2003: B. Hänsel, Wie sich die Sonne zum Sonnengott wandelte. Die Bedeutung des Lichts für Kulturen der Bronze-zeit. Wissenschaftsmagazin der FU Berlin 1 (Berlin 2003) 28–35.
Il´inskaja 1975: В. А. Ильинская, Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII-VI вв. до н.э.) (Киев 1975).Kašuba 2000: М. Т. Кашуба, Раннее железо в лесостепи между Днестром и Сиретом (культура Козия-Сахарна) [Early
Iron in Forest-Steppe between Dniester and Siret (Cozia-Saharna culture)]. Stratum plus 3 (Санкт-Петербург–Киши-нев–Одесса–Бухарест 2000) 241–488.
Kašuba 2007: M. Kašuba, Zur Entstehung der Basarabi-Kultur in Osteuropa. In: M. Blečić et al. (Hrsg.), Scripta praehistorica varia in honorem Biba Teržan. Monographienreihe Situla, Bd. 44 (Ljubljana 2007) 369–380.
Maja Kašuba250
Kaşuba 2008a: M. Kaşuba, Materiale ale culturii Şoldăneşti în bazinul Nistrului de Mijlociu – observaţii preliminare. Tyragetia, SN, vol. II(XVII), nr. 1 (Chişinău 2008) 37–50.
Kašuba 2008b: M. Кашуба, О восточных (северопричерноморских) памятниках и импортах культурного комплекса Басарабь, VIII – начало VII вв. до н.э. In: Проблемы iсторiï та археологiï Украïни: Матерiали VI Мiжнародноï науковоï конференцiï, присвяченоï 150-рiччю з дня народження академiка В.П. Бузескула (Харькiв, 9-11 октября 2008 p.) (Харькiв 2008) 29.
Kaşuba 2010: M. Kaşuba, Primă epocă a fi erului (sec. XII – VIII/VII î. Hr.). Începuturile relaţiilor de clasă. Cultura Şoldă-neşti (Basarabi-Şoldăneşti). In: Istoria Moldovei. Epoca preistorică şi antică (Chişinău 2010) 371–381.
Kašuba / Daragan 2009a: M. Kašuba / M. Daragan, Offener oder geschlossener Raum: die Transformation der Kulturland-schaft infolge der Entwicklung der früheisenzeitlichen Befestigungen im Nordpontikum. In: E. Sava (Hrsg.), Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v.Chr.): Globale Entwicklung versus Lokal-geschehen. Humboldt-Kolleg in Chişinău, Republica Moldova (4.-8. Oktober 2009). Programm (Chişinău, 2009) 44–46.
Kašuba / Daragan 2009b: М. Кашуба / М. Дараган, «Чудесные знаки» галльштаттского периода в Юго-Восточной Европе и Северном Причерноморье: 1. Мальтийский крест. In: Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur (Chişinău 2009) 65–86.
Kašuba / Levitskij 2011: М. Т. Кашуба / О. Г. Левицкий, Заметка о происхождении одной категории сосудов для питья позднейшего предскифского – раннескифского времени в Северном Причерноморье. In: И.Б. Шрамко (отв. ред.), Сборник статей в честь 90-летия со дня рожд. проф. Б.А. Шрамко. (Харьков 2011 im Druck).
Koch 2003: L. C. Koch, Zu den Deutungsmöglichkeiten der Situlenkunst. In: U. Veit u.a. (Hrsg.), Spuren und Botschaften: Interpretationen materieller Kultur. Tübinger Arch. Taschenb. 4 (Münster–New York–München–Berlin 2003) 347–367.
Kossack 1999: G. Kossack, Religiöses Denken in dinglicher und bildlicher Überlieferung Alteuropas aus der Spätbronze- und frühen Eisenzeit (9.–6. Jahrhundert v.Chr.). Abhandlungen Bayer. Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse NF 116 (München 1999).
Kovpanenko 1967: Г. Т. Ковпаненко, Раскопки Трахтемировского городища. In: П.П. Толочко (отв.ред.), Археологи-ческие исследования на Украине в 1965-1966 гг. Информационные сообщения, вып. 1 (Киев 1967) 103–106.
Kovpanenko / Ševčenko 1981: Г. Т. Ковпаненко / Н. П. Шевченко, Отчет о работе Скифской Лесостепной Право-бережной экспедиции ИА АН УССР. НА ИА НАНУ, ф. 1981/23 (Киев 1981).
Larina / Kašuba 2005: О. В. Ларина / М. Т. Кашуба, Позднейшие позднечернолесские материалы поселения Тэтэрэ-укa Ноуэ XV в Среднем Поднестровье. Revista Arheologică, SN, vol. I, nr. 1 (Chişinău 2005) 212–239.
Leviţchi 2006: O. Leviţchi, Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca – „Drumul Feteştilor”. Bibliotheca Archaeologica Moldaviae III (Iaşi 2006).
Magura 1930: C. Магура, Дві мідяні посудини з Черкащини. In: В. Козловська (ред.), Хроніка археології та мистецтва, ч. I, Київ 1930, 53–55, табл. IV, фото 1–3.
Machortych 2005: С. В. Махортых, Киммерийцы Северного Причерноморья (Киев 2005).Medović 1978: P. Medović, Naselja starijeg gvozdenog doba u jugoslovenskom podunavlju. Dissertationes et monographiae,
T. XXII (Beograd 1978).Metzner-Nebelsick 1992: C. Metzner-Nebelsick, Gefäße mit basaraboider Ornamentik aus Frög. In: A. Lippert, K. Spindler
(Hrsg.), Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. UPA 8 (Bonn 1992) 349–383.
Metzner-Nebelsick 2010: C. Metzner-Nebelsick, Aspects of Mobility and Migration in the Eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas in the Early Iron Age (10th –7th centuries BC). In: K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik (eds.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe. Prace Archeologiczne Studies No. 63 (Kraków 2010), 121–151.
Metzner-Nebelsick / Nebelsick 1999: C. Metzner-Nebelsick / L. Nebelsick, Frau und Pferd – ein Topos am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit Europas. Mitteil. Anthropol. Gesellschaft Wien 129 (Wien 1999) 69–106.
Moruženko 1989: A. A. Моруженко, История населения лесостепного междуречья Днепра и Дона в скифское время. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. НА ИА НАНУ, ф. 12/689 (Киев 1989).
Nebelsick 1992: L. Nebelsick, Figürliche Kunst der Hallstattzeit am Nordostalpenrand im Spannungsfeld zwischen alteuro-päischer Tradition und italischem Lebensstil. In: A. Lippert, K. Spindler (Hrsg.), Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. UPA 8 (Bonn 1992) 401–432.
Nebelsick 1994: L. Nebelsick, Der Übergang von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit am nördlichen Ostalpenrand und in Transdanubien. In: P. Schauer (Hrsg.), Archäologische Untersuchungen zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit zwischen Nordsee und Kaukasus. Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg 28.–30. Oktober 1992 (Bonn 1994) 307–367.
Erscheinungsformen hallstattzeitlicher Stammesfeste im Nordpontikum 251
Nebelsick 1996: L. Nebelsick, Herd im Grab? Zur Deutung der kalenderberg-verzierten Ware am Nordostalpenrand. In: E. Jerem / A. Lippert (Hrsg.), Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums Sopron, 10.–14. Mai 1994. Archaeolingua 7 (Budapest 1996) 327–364.
Nebelsick 1997a: L. Nebelsick, Die Kalenderberggruppe der Hallstattzeit am Nordostalpenrand. In: J.-W. Neugebauer (Hrsg.), Hallstattkultur im Osten Österreichs. Wissenschaftliche Schriften Niederösterreich 106-109 (St. Pölten 1997) 9–128.
Nebelsick 1997b: L. Nebelsick, Trunk und Transzendenz. Trinkgeschirr im Grab zwischen der frühen Urnenfelder- und späten Hallstattzeit im Karpatenbecken. In: C. Becker u.a. (Hrsg.), Χρόυος. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel (Espelkamp 1997) 373–387.
Niculiţă / Nicic 2008: I. Niculiţă / A. Nicic, Habitatul din prima epocă a fi erului de la Saharna-Ţiglău. Consideraţii prelimi-nare [Early Iron Age settlement of Saharna-Ţiglău. Preliminary research results]. Tyragetia, SN, vol. II[XVII], nr. 1, 205–232.
Niculită u.a. 2008: I. Niculită / A. Zanoci / T. Arnăut, Habitatul din mileniul I a.Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna). Biblioteca „Tyragetia” XVIII (Chişinău 2008).
Raevskij 1977: Д. С. Раевский, Очерки идеологии скифо-сакских племен: опыт реконструкции скифской мифологии (Москва 1977).
Reichenberger 2000: A. Reichenberger, Bildhafte Darstellungen der Hallstattzeit. Beitr. zur Vorgesch. Nordostbayerns 3 (Nürnberg 2000).
Rjabkova 2008: T. B. Рябкова, Бронзовый сосуд из кургана 524 у с. Жаботин. In: Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст. Материалы темат. научной конференции, Санкт-Петербург, 16-19 декабря 2008 г. (Санкт-Петербург 2008) 88–91.
Roeder 1997: M. Roeder, Zur Bedeutung der im Basarabi-Stil verzierten Keramik. Heiligtümer in der Hallstattzeit? In: C. Becker u.a. (Hrsg.), Χρόνος. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel (Espelkamp 1997) 601–618.
Rudinskij 1949: М. Я. Рудинський, Мачухська експедицiя Iнституту археологiï в 1946 р. In: Археологiчнi пам’ятки УРСР, т. 2 (Киïв 1949) 53–79.
Ščerban 2007: А. Щербань, Прядiння i ткацтво у населення Лiвобережного лiсостепу Украïни VII – початку III столiття до н.е. (за глиняними виробами) (Киïв 2007).
Ščerban / Rachno 2006: А. Л. Щербань / К.Ю. Рахно, Глиняні черпаки початку доби раннього заліза з пам’яток поблизу Диканьки. In: Археологічний літопис Лівобережної України 2 (Полтава 2006) 29–39.
Smirnova 1983: Г. И. Смирнова, Материальная культура Григоровского городища (к вопросу о формировании чер-нолесско-жаботинских памятников). Археологический Сборник Государственного Эрмитажа 23 (Ленинград 1983) 60–71.
Smirnova 1996: Г. И. Смирнова, Предварительные данные о Немировском городище (По первым результатам обра-ботки полевой документации и коллекции находок). In: О.Б. Супруненко (вiдп.ред.), Бiльське городище в контек-стi вiвчення пам’яток раннього залiзного вiку Європи (Полтава 1996) 183–198.
Šovkopljas 1954: I. Г. Шовкопляс, Поселення ранньоскiфського часу на Середньому Днiстрi. Археологiя IX, 1954, 98–105.
Šramko 1987: Б. А. Шрамко, Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) (Киев 1987).Šramko 1996: Б. А. Шрамко, Раскопки В.А. Городцова на Бельском городище в 1906 г. (по материалам коллекции ГИМ). In: О.Б. Супруненко (вiдп.ред.), Бiльське городище в контекстi вiвчення пам’яток раннього залiзного вiку Європи (Полтава 1996) 29–54.
Šramko І: 2006: І. Б. Шрамко, Раниій період в історії геродотівського Гелону (за матеріалами розкопок зольника № 5). In: Є. Черненко (від.ред.), Більске городище та його округа (до 100-річчя початку польових досліджень), (Київ 2006) 33–56.
Šramko 2010: И. Б. Шрамко, Бельское городище: основные этапы развития. In: Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VII Международной научной конференции. 28–29 октября 2010 года, Харьков (Харьков 2010) 38.
Studeníková 2004: E. Studeníková, Symbolika niektorých fi gurálnych motívov doby halštatskej. In: E. Krekovič, T. Podo-linská (Hrsg.), Kult a mágia v materiálnej kultúre (Bratislava 2004) 15–26.
Tasić 1991: N. Tasić, Antropomorfne, zoomorfne i ornitomorfne fi gure na Basarabi keramici. In: Zbornik radova posveće-nih akademiku Alojzu Bencu. Akad. Nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja 95/27 (Sarajevo 1991) 239–245.
Terenožkin 1961: А. И. Тереножкин, Предскифский период на Днепровском Правобережье (Киев 1961).
Maja Kašuba252
Teržan 1990: B. Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem [The Early Iron Age in Slovenian Styria]. Katalogi in monografi je 25 (Ljubljana 1990).
Teržan 1996: B. Teržan, Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. In: E. Jerem / A. Lippert (Hrsg.), Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums Sopron, 10.-14. Mai 1994. Archaeolingua 7 (Buda-pest 1996) 507–536.
Teržan 1997: В. Teržan, Heros der Hallstattzeit. Beobachtungen zum Status an Gräbern um das Caput Adriae. In: C. Becker u.a. (Hrsg.), Χρόνος. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bern-hard Hänsel (Espelkamp 1997) 653–669.
Teržan 2001: B. Teržan, Richterin und Kriegsgöttin in der Hallstattzeit. Versuch einer Interpretation. Prähist. Zeitschr.76,1, 2001, 74–86.
Teržan 2005: B. Teržan, Metamorphose – eine Vegetationsgottheit in der Spätbronzezeit. In: B. Horejs u.a. (Hrsg.), Interpre-tationsraum Bronzezeit. Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet. UPA 121 (Bonn 2005) 241–261.
Toporov 1992a: В. Н. Топоров, Крест. In: С.А. Токарев (гл.ред.), Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах, т. 2 (Москва 1992) 12–14.
Toporov 1992b: В. Н. Топоров, Опьяняющие напитки. In: С.А. Токарев (гл.ред.), Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах, т. 2 (Москва 1992) 256–258.
Ursuţiu 2002: A. Ursuţiu, Etapa mijlocie a primei vârste a fi erului în Transilvania (cercetările de la Bernadea, comuna Bah-nea, jud. Mureş). Interferenţe etnice şi culturale 5 (Cluj-Napoca 2002).
Vulpe 1965: A. Vulpe, Zur Mittleren Hallstattzeit in Rumänien (Die Basarabi-Kultur). Dacia, NS 11, 1965, 105–132.Vulpe 1986: A. Vulpe, Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabikultur. Dacia NS 30,1-2 (Bucureşti
1986) 49–90.Vulpe 2001: A. Vulpe, Prima epocă a fi erului. Perioada mijlociu (cca. 850 – 650 a.Chr.). In: M. Petrescu-Dîmboviţa, Al.
Vulpe (coord.), Istoria Românilor, I. Moştenirea timpurilor îndepărtate (Bucureşti 2001) 327–339.Zverev 2003: E. Зверев, Хронология культуры Басарабь по данным орнаментации на керамической посуде [Chronology of
the Basarabi Culture Based on the Ornamentation of the Ceramic Vessels]. Stratum plus 3 (Санкт-Петербург–Кишинев–Одесса–Бухарест 2003) 224–254.
Maja Kashuba, PH. D. Übersetzung Dr. Elke KaiserInstitute of the History of Material CultureRussian Academy of Sciences.18 Dvortsoveianab.RUS 191186 St. Petersburg / [email protected]
































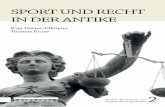
![pkS- cYywjke xksnkjk jktdh; dU;k egkfo|ky;] Jh xaxkuxj](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336155329fb49e5aa0b0ede/pks-cyywjke-xksnkjk-jktdh-duk-egkfoky-jh-xaxkuxj.jpg)
![oknh Jh- fnid jked`”.k dksGh] iksyhl fujh{kd] rRdk](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632705476d480576770d11f9/oknh-jh-fnid-jkedk-dksgh-iksyhl-fujhkd-rrdk.jpg)




