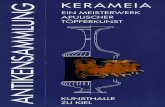Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften? Entwicklung einer Typologie am Beispiel...
Transcript of Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften? Entwicklung einer Typologie am Beispiel...
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ?Entwicklung einer Typologie am Beispiel
chinesischer Social Media
Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
1 Einleitung1
Ein junger Mann im Rollstuhl fährt am Abend des 20. Juli 2013 in den größten Flughafen der chinesischen Hauptstadt, den Beijing International Capital Airport. Aus einer braunen Tasche holt er Flugblätter und beginnt, sie an vorbeilaufende Passanten zu verteilen. Schnell werden Sicherheitskräfte auf ihn aufmerksam und versuchen, ihn an der Verteilung weiterer Flyer zu hindern. Daraufhin greift der Mann noch einmal in seine Tasche. Er zieht eine Bombe hervor und zündet den Sprengsatz um 18.24 Uhr vor dem Arrival Gate des Flughafens. Dabei verletzt er sich selbst schwer und verursacht ein mehrstündiges Chaos, durch das der Flug-verkehr teilweise lahmgelegt wird (Xinhua News Agency 2013).
Nur zehn Minuten nach der Explosion erscheinen die ersten Bilder des Man-nes mit der Bombe in der Hand auf Sina Weibo, einer der beliebtesten Social Me-dia-Plattformen Chinas. Es handelt sich um Aufnahmen, die Zeugen der Explo-sion mit ihren Smartphones aufgenommen haben. Diese Bilder missfallen den Zensoren offensichtlich; nach kurzer Zeit werden sie von der Plattform gelöscht. Allerdings zu spät: Die Explosion im Flughafen war zu diesem Zeitpunkt bereits ein populäres Thema auf Weibo und verbreitete sich schnell weiter. Obwohl die ersten Bilder der Zensur zum Opfer fielen, hatten andere Nutzer die ursprüng liche Nachricht bereits gesichert, erneut auf Weibo gepostet und wiederum mit den ori-ginalen Bildern versehen. Diese Lawine zusätzlicher Posts war für die Zensoren nicht rechtzeitig zu stoppen und zeigte Wirkung: Eine Stunde nach dem Vorfall berichtet die englischsprachige chinesische Tageszeitung „China Daily“ über den Vorfall (China Daily 2013) und bezog sich in ihrem Bericht unter anderem auf die Bilder des ursprünglichen Weibo-Beitrags. Später fanden die Bilder durch einen
1 Wir danken Tobias Füchslin für seine Unterstützung beim Verfassen dieses Textes.
J. Rössel, J. Roose (Hrsg.), Empirische Kultursoziologie, DOI 10.1007/978-3-658-08733-3_12, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
324 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
gleichermaßen auf Weibo und Twitter aktiven chinesischen Bürgerjournalisten ihren Weg in internationale Medien wie BBC (2013) und Sky News (2013).
Etwas ähnliches wiederholte sich einige Tage später noch einmal: Chinesische „Netizens“ hatten recherchiert, dass der Mann im Rollstuhl 2005 von staatlichen Sicherheitskräften in einer chinesischen Provinz zusammengeschlagen wurde, weil er einen illegalen Taxi-Betrieb führte. Er trug eine Querschnittslähmung da-von und wollte, nachdem er die Behörden jahrelang erfolglos auf Schadenersatz verklagt hatte, mit dem Bombenanschlag auf seinen Fall aufmerksam machen. Diese Hintergrund-Informationen führten erneut zu einer intensiven Debatte auf Weibo, in deren Verlauf eine Vielzahl von Nutzern über Willkür und Ungerechtig-keiten regionaler und lokaler Sicherheitskräfte klagte. Unter ihnen befanden sich bekannte Weibo-Nutzer wie Zuoyeben – mit fast sieben Millionen Followern ei-ner der prominentesten Nutzer, wenn man einmal von „Celebrities“ absieht (Sina Technology 2012). Er schrieb, in China sei gegenwärtig „jeder Mensch, der un-gerecht behandelt wurde, eine tickende Zeitbombe“.2 Auch dieser Beitrag wurde umgehend zensiert – zuvor jedoch mehr als 17 000 Mal weitergeleitet.
Diese Beispiele machen einerseits deutlich, dass Kontrolle und Zensur im chi-nesischen Internet schnell und effektiv eingesetzt werden können, um kritische Inhalte zu entfernen. Sie zeigen andererseits aber auch, wie in chinesischen Social Media dennoch kritische Öffentlichkeiten entstehen können, die unter bestimm-ten Bedingungen Zensur und Kontrolle umgehen, offene Debatten ermöglichen und durchaus reale Auswirkungen haben. In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl derartiger Fälle beschrieben worden – v. a. in politik- und kommunika-tionswissenschaftlichen Arbeiten, in Fallstudien aus den Area bzw. China Studies sowie in Medienberichten aus China und aus anderen Ländern. Wir haben diese Fälle zusammengetragen und durch eigene Analysen ergänzt. Betrachtet man die-ses Material in seiner Gesamtheit, dann lassen sich darin Muster erkennen; die Einzelfallbeschreibungen verdichten sich zu einer begrenzten Zahl idealtypischer Öffentlichkeiten: zu den „Multiple Public Spheres of Weibo“ (Rauchfleisch und Schäfer 2015).
Diese Typologie, mittels derer sich die Fülle bisheriger Studien konzeptionell verdichten und systematisieren lässt, steht im Mittelpunkt dieses Artikels. Im Fol-genden stellen wir zunächst die Bedeutung und Charakteristika von Öffentlich-keiten und insbesondere Online-Öffentlichkeiten dar (Abschnitt 2). Anschließend legen wir dar, warum Online-Öffentlichkeiten gerade in autoritären Gesellschaf-ten bedeutsam sind, exemplifizieren dies am Beispiel Chinas (Abschnitt 3) und stellen dann anhand der wichtigsten chinesischen Social Media-Plattform Sina Weibo sieben Idealtypen von Online-Öffentlichkeiten vor (Abschnitt 4).
2 Dieses Zitat wurde – ebenso wie mehrere weitere – von den Autoren ins Deutsche übersetzt.
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 325
2 Bedeutung und Charakteristika von Öffentlichkeiten und Online-Öffentlichkeiten
Seit den 1960er Jahren beschäftigen sich Sozialwissenschaftler verstärkt mit dem Thema Öffentlichkeit – anhand unterschiedlicher zeitgenössischer und histori-scher Beispiele und fußend auf unterschiedlichen empirischen und normativen Konzepten (vgl. überblicksweise Marcinkowski 2008; Gerhards 1998). Bis heute gibt es keine einheitliche Konzeption von Öffentlichkeit, wohl aber einige grund-legende Annahmen, die die meisten Öffentlichkeitstheorien teilen: Sie verstehen Öffentlichkeiten als Kommunikationsforen oder -arenen, in denen kollektiv be-deutsame Themen von einem diversen Set von Akteuren mit unterschiedlichen Argumenten debattiert werden können. Und auch wenn die normativen Vorstel-lungen darüber weit auseinandergehen, ob und inwieweit derartige Debatten ra-tional und unter Einhaltung kommunikativer Grundregeln bestritten werden sollten (vgl. überblicksweise Ferree et al. 2002a), so konvergieren viele der ein-schlägigen Arbeiten doch in der Betonung von drei Grunddimensionen, entlang derer Öffentlichkeiten auch empirisch beschrieben werden können: Öffentlichkei-ten lassen sich differenzieren anhand ihrer Offenheit, d. h. des Spektrums debat-tierbarer Themen und des Ausmaßes, in dem auch kritische Äußerungen gegen-über politischen Institutionen und Entscheidungsträgern möglich sind; anhand ihrer zeitlichen Beständigkeit, d. h. der Frage, inwieweit die betreffenden Debatten auf Dauer gestellt sind oder ob sie nur kurzfristig existieren können; und anhand ihres Umfangs an Partizipation, d. h. der Frage, ob alle resp. welche interessierten Parteien die Möglichkeit haben, an den Debatten teilzunehmen.
In den meisten Öffentlichkeiten wurden und werden diese Kriterien – Offen-heit, Beständigkeit und Partizipation – nur zum Teil realisiert (vgl. etwa die vielfäl-tigen Kritiken am normativ anspruchsvollen Habermas’schen Öffentlichkeitsent-wurf und seiner historischen Grundlage in Calhoun 1992). In unterschiedlichen Ländern, in verschieden weitreichenden und thematisch variierenden Öffentlich-keiten werden sie in unterschiedlichem Maße eingelöst.
Dabei sind derartige Öffentlichkeiten oftmals keine homogen miteinander zusammenhängenden Kommunikationsräume, sondern in mehrfacher Weise segmentiert. Einerseits lassen sich horizontal differenzierte, auf unterschiedli-che gesellschaftliche Bezugssysteme hin ausgerichtete Öffentlichkeits-Foren resp. Arenen finden (am prominentesten sicherlich bei Hilgartner und Bosk 1988; Fer-ree et al. 2002b). Andererseits sind Öffentlichkeiten vertikal differenziert. Die be-kannteste Konzeption einer solch hierarchischen Segmentierung haben Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt in den frühen 1990ern vorgelegt (Gerhards und Neidhardt 1991; Gerhards et al. 1998), die – systemtheoretisch unterfüttert – drei Ebenen gesellschaftlicher Öffentlichkeit unterscheiden:
326 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
■ Auf der Mikro-Ebene beschreiben sie Encounter-Öffentlichkeiten (Gerhards und Neidhardt 1991, S. 50 ff.), d. h. unstrukturierte, nicht-institutionalisierte Interaktionssysteme, bei denen Menschen heterogener Herkunft zufällig zu-sammen finden und kommunizieren. Beispiele sind Gespräche auf der Straße, in Kneipen oder auf Märkten. Derartige Encounter-Öffentlichkeiten sind the-matisch sehr offen; und sie weisen wenige strukturell angelegte Restriktionen auf, was die Themen und Argumente der Kommunikation angeht. Zudem gibt es kaum infrastrukturelle resp. technische Voraussetzungen für ihr Zustande-kommen. Dafür ist der Grad der Verarbeitung und gesellschaftlichen Anwen-dung der dort kommunizierten Inhalte gering, die entsprechenden Themen und Argumente bleiben gesellschaftlich tendenziell unwirksam und diese Öf-fentlichkeitsebene weitgehend ineffektiv.
■ Veranstaltungsöffentlichkeiten (Gerhards und Neidhardt 1991, S. 52 ff.) – andern-orts auch „Themenöffentlichkeiten“ genannt (Donges und Imhof 2001) – kon-stituieren die mittlere Ebene von Öffentlichkeit. Es handelt sich um thematisch zentrierte Interaktionssysteme, die zudem oft eine Differenzierung der Teil-nehmerrollen in Leiter und Publikum aufweisen. Beispiele sind Vorlesungen und Vorträge, Gerichtsverhandlungen oder Demonstrationen. Veranstaltungs-öffentlichkeiten sind thematisch weniger offen als Encounter-Öffentlichkeiten; typischerweise wird ein Thema vorgegeben. Dafür sind Informationsverarbei-tung und anwendung bei Versammlungsöffentlichkeiten deutlich ausgeprägter, und sie sind gesellschaftlich tendenziell wirksamer.
■ Die oberste Öffentlichkeitsebene macht schließlich die Massenmedienkommu-nikation (Gerhards und Neidhardt 1991, S. 54 ff.) aus. Hierbei handelt es sich um institutionalisierte, auf Dauer gestellte, thematisch grundsätzlich univer-selle, aber hochselektive Kommunikationssysteme. Während sie auf Seiten der Massenmedien von professionalisierten Leistungsrollenträgern – den Journa-listen – betrieben werden, bleiben die Handlungsmöglichkeiten des Publikums beschränkt. Die resultierende Kommunikation wird stark von kollektiven Ak-teuren geprägt und ist kaum für individuelle Akteure zugänglich. Dafür ist diese Öffentlichkeitsebene gesellschaftlich hochwirksam: Massenmedial kom-munizierte Inhalte werden in hohem Maße gesellschaftlich verarbeitet und an-gewendet (Fuchs und Pfetsch 1996).
Massenmedien werden in diesem Verständnis also einerseits als gesellschaftlich besonders einflussreich, mithin als „Masterforum“ (Ferree et al. 2002b) von Öf-fentlichkeit interpretiert. Andererseits wird auch auf die starke Selektivität und Fokussierung massenmedialer Inhalte hingewiesen. Dieser Topos findet sich be-reits in der Habermas’schen Problematisierung der Rolle von Massenmedien im Strukturwandel der Öffentlichkeit (Habermas 1990), in der Massenmedien als
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 327
kommerziell beeinflusstes, „vermachtetes“ Öffentlichkeitsforum beschrieben wer-den, das randständige Akteure und Themen ausschließe – eine Kritik, die ih-ren Nachhall u. a. in der News Bias-Forschung (vgl. Shoemaker und Reese 1995, S. 39 ff.) oder der Debatte um Medienkonvergenz (Krüger 1998) fand.
In den 1990er und 2000er Jahren sahen viele Autoren die Lösung dieser Pro-bleme massenmedial vermittelter Öffentlichkeit im Aufkommen von Online-Me-dien. Aus „cyber-optimistischer“ (Oates 2008), „utopischer“ (Papacharissi 2002, S. 9) resp. „netz-enthusiastischer“ (Dahlberg 1998, S. 70) Perspektive legten sie eine große Zahl von Arbeiten vor, in denen darauf verwiesen wurde, dass Online-Medien potenziell vorteilhafte strukturelle Eigenheiten im Vergleich zu tradierten Massenmedien aufweisen (vgl. überblicksweise Gerhards und Schäfer 2007, 2010). Es wurde darauf hingewiesen, dass die technischen, finanziellen und juristischen Zugangshürden für das Publizieren von Inhalten online deutlich niedriger seien als bei Massenmedien, dass online mehr Raum zur Beschreibung auch längerer Sachverhalte zur Verfügung stünde und zudem multimediale und interaktive Ge-staltungsmöglichkeiten verfügbar seien. Eine verbreitete Hoffnung war, dass auf dieser Basis Online-Öffentlichkeiten entstünden, in denen es mehr Menschen als zuvor möglich sei, ihre Sichtweisen publik zu machen:
„[It] might ‚empower‘ those who have always wanted to engage in public debate but were previously marginalized by traditional media, e. g. individuals vis-à-vis institu-tions, smaller vis-à-vis larger, more powerful organizations, dissidents vis-à-vis au-thoritarian governments, or stakeholders from peripheral regions or developmental countries vis-à-vis ‚Western‘, first-world stakeholders.“ (Schäfer 2014)
Eine Reihe empirischer Studien hat – vornehmlich anhand westlicher Gesellschaf-ten – untersucht, inwieweit diese Hoffnungen eingelöst wurden (vgl. überblicks-weise Schäfer 2014). In der Zusammenschau machen sie deutlich, dass für die Beantwortung dieser Frage eine differenzierte Betrachtung von Online-Kommu-nikation notwendig ist.
Für diese Differenzierung lässt sich abermals das beschriebene Öffentlichkeits-modell von Gerhards und Neidhardt adaptieren: Auch online lassen sich – wenn-gleich weniger trennscharf – drei Ebenen von Öffentlichkeit differenzieren (Ger-hards und Schäfer 2010, S. 146; Zimmermann 2008), die sich in ihrer Offenheit, ihren infrastrukturellen Voraussetzungen und ihren Auswirkungen unterschei-den:
„The online counterpart of the traditional ‚encounter public sphere‘ is internet-based inter personal communication such as e-mailing or instant messaging. The organisa-tional prerequisites to keep this forum going are rather low, and the opportunities for
328 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
participants to make themselves heard are high, but the impact on the larger societal debate remains low due to the small amount of people reached. Internet fora, discussion boards, and blogs constitute the second level of the internet public sphere (although some of them, due to very small readership, may actually come close to inter personal communication.) Here, the structural prerequisites are a bit more sophisticated: these fora usually concentrate on certain topics and the selectivity for each participant to get his voice heard is somewhat higher compared to the first level, but the amount of peo-ple who can be reached increases, as does societal impact. Finally, mass media, which have a developed infrastructure and the greatest impact, are mirrored online by large, content organizing portals such as search engines.“ (Gerhards und Schäfer 2010, S. 146)
Die Differenzierung dieser Ebenen von Online-Öffentlichkeiten macht, wie schon das Gerhards/Neidhardt’sche Originalmodell, relevante ebenenspezifische Unter-schiede deutlich: So lässt sich für die USA, für Deutschland und andere westliche Länder zeigen, dass die oberste Ebene von Online-Öffentlichkeiten in ihren Ak-teurs- und Themenstrukturen nicht diverser und damit nicht „ermächtigender“ ist als klassische Massenmedien. Im Gegenteil konnte gezeigt werden, dass die Se-lektion und Präsentation von Inhalten, wenn sie wie bei Suchmaschinen überwie-gend oder ausschließlich nach technischen Kriterien resp. Algorithmen erfolgt, eine Kommunikation nach sich ziehen kann, die in Quellen, Inhalten und Bewer-tungen noch einseitiger ist als die Debatten in den als vermachtet kritisierten tra-ditionellen Massenmedien (vgl. Gerhards und Schäfer 2010, 2007; Pariser 2011; Sunstein 2009). Die Differenzierung macht aber auch deutlich, dass unterhalb der wirkungsmächtigen oberen Ebene durchaus ein größeres Spektrum an Themen und Akteuren existiert.
„It is here where the Internet most obviously makes a contribution to the public sphere. There are literally thousands of Web sites having to do with the political realm at the lo-cal, national, and global levels; some are partisan, most are not. We can find discussion groups, chat rooms, alternative journalism, civic organizations, NGOs, grass roots is-sue-advocacy sites[,] and voter education sites“ (Dahlgren 2005, S. 152).
Allerdings ist diese Kommunikation in hohem Maße fragmentiert, entsprechend schwer aufzufinden (Pariser 2011) und bleibt in ihrer Reichweite und Relevanz hinter den höheren Ebenen von Online-Öffentlichkeiten zurück (Sunstein 2009). Viele Autoren zweifeln daher daran, dass sich online politisch relevante Öffent-lichkeiten herausbilden können (bspw. Papacharissi 2010; Sunstein 2001; Dahl-berg 2007).
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 329
3 Online-Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften. Der Fall China
Für die Einschätzung des Potenzials von Online-Öffentlichkeiten sind autoritäre Staaten besonders interessante Fälle. Dies liegt teils an den Charakteristika des Forschungsfeldes, in dem es zu autoritären Staaten nur wenige Analysen gibt, weil sich die meisten Arbeiten auf westliche Gesellschaften beziehen (wenngleich es Ausnahmen wie Studien zum „Arab Spring“ gibt, z. B. Wolfsfeld et al. 2013). Au-toritäre Staaten sind aber auch konzeptionell von besonderem Interesse. Denn in diesen Ländern haben politische Eliten die Möglichkeit, öffentliche Debatten in traditionellen Massenmedien wie Zeitungen oder Fernsehen wirksam zu steu-ern (vgl. z. B. Zheng und Wu 2005). Damit ist die einflussreichste Öffentlichkeits-Ebene in diesen Ländern limitiert oder gar blockiert. Unter diesen Bedingungen werden Öffentlichkeiten unterhalb dieser Ebene umso bedeutsamer. Schon Ger-hards und Neidhardt beschrieben, wie in „totalitären Herrschaftssystemen – seien es nun feudale oder sozialistische, die keine ausdifferenzierten, autonomen Öf-fentlichkeiten zulassen“ (Gerhards und Neidhardt 1991, S. 51), Encounter-Öffent-lichkeiten relevante Gegenöffentlichkeiten darstellen könnten. Denn gerade „die Unbestimmtheit [ihrer] Entstehung und die Schnelligkeit [ihrer] Vergängnis ma-chen eine politische Kontrolle dieser Ebene so schwierig und aufwendig“ (Ger-hards und Neidhardt 1991, S. 51).
Diese beiden Vorteile weisen Online-Öffentlichkeiten in besonderem Maße auf, wie das eingangs geschilderte Beispiel illustriert: Sie entstehen anhand von Anlässen, die teils unvorhersehbar sind und diffundieren dann unter Umständen sehr schnell. Entsprechend könnten sie gegenöffentliche Funktionen in autoritä-ren Gesellschaften durchaus erfüllen, und dabei die Möglichkeiten von Offline-Encounter-Öffentlichkeiten noch erweitern. Immerhin ermöglichen es Online-Medien grundsätzlich, losgelöst von raum-zeitlichen Restriktionen mit anderen Individuen in Kontakt zu treten und kollektiv relevante Themen in einem größe-ren Rahmen zu besprechen. Daraus resultiert, dass neue und insbesondere soziale Medien für viele Personen in autoritären Ländern besonders attraktiv erscheinen und dass sie in diesen Ländern möglicherweise sogar wichtiger sind als in Län-dern mit freien Nachrichtenmedien. Umgekehrt liegt darin auch der Nachteil die-ser Öffentlichkeiten – da sie zur Aggregation einer größeren Zahl von Bürgern der technischen Vermittlung bedürfen, sind sie aus Sicht staatlicher Regime sowohl ein lohnendes als auch, im Vergleich zu den flüchtigeren Encounter-Öffentlich-keiten offline, greifbareres Ziel für Kontroll- und Zensurmaßnahmen.
Das wohl relevanteste Land, anhand dessen sich diese Ambivalenz analysieren lässt, ist China – das bevölkerungsreichste Land der Welt und eine aufsteigende politische und ökonomische Supermacht. In China zeigen sich die beschriebe-
330 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
nen Merkmale autoritärer Staaten in ausgeprägter Form: Zum einen ist die staat-liche Kontrolle der gesellschaftlichen Öffentlichkeit stark (Freedom House 2014) und umfasst nicht nur die traditionelle Massenmedienkommunikation, sondern auch die Online-Kommunikation. China limitiert erfolgreich den Influx ausländi-scher Online-Angebote und stellt international verbreitete Angebote wie Google, Facebook oder Twitter innerhalb seiner Grenzen nicht zur Verfügung (Canaves 2011). Stattdessen hat das Land einen eigenen Mikrokosmos an Online-Medien eta bliert, was die Kontrolle von Online-Öffentlichkeiten tendenziell vereinfacht und das chinesische Internet zu einem besonders interessanten Testfall für die Analyse der Entstehung und Rolle von Online-Öffentlichkeiten macht. Zum an-deren ist China auch deshalb ein interessanter Fall, weil Online-Medien dort im Vergleich zu anderen Schwellenländern recht verbreitet sind. Im Juli 2013 gab es in China 618 Millionen Internetnutzer bei einer Internet-Penetrationsrate von 45,8 % (China Internet Network Information Center 2014). Diese ist zwar niedriger als in den meisten westlichen Ländern, aber deutlich höher als in anderen Schwellen-ländern wie Indien (12,6 %) oder Südafrika (41 %) (International Telecommunica-tion Union 2013).
Unter den chinesischen Internetdiensten und -plattformen ist der weit ver-breitete Microblogging-Dienst Sina Weibo – oft nur „Weibo“ genannt – beson-ders relevant. Der Dienst hat 536 Millionen registrierte Nutzer, wird täglich von 54 Millionen Nutzern genutzt (Sina Hubei 2013) und gehört zu den fünf meistbe-suchten Seiten des chinesischen Internets (Alexa 2013). „Weibo“ ist das chinesi-sche Wort für „Microblog“ und teilt folgerichtig eine Reihe von Eigenschaften mit dem US-basierten Microblogging-Dienst Twitter: Nutzer dürfen Nachrichten von maximal 140 Zeichen Länge veröffentlichen, können sich durch das „@“-Symbol aufein ander beziehen und ihre Posts durch „#“-Hashtags einem Thema zuordnen. Sie können unter allen Nutzern wählen, wem sie folgen wollen und sehen dann deren Beiträge auf ihrer eigenen Timeline. Der womöglich wichtigste Unterschied zu Twitter liegt darin, dass das Limit von 140 Zeichen auf beiden Plattformen zwar technisch identisch ist, in der chinesische, zeichenbasierten Sprache aber eine ge-ringere Einschränkung bedeutet – bzw. mit den Worten des Künstlers Ai Weiwei: Ein Weibo-Post von 140 Zeichen kann anstatt eines Satzes eine ganze „Novelle“ enthalten (zitiert in Sullivan 2013, S. 5; vgl. Liao 2013).
Über die Frage, ob sich im chinesischen Internet, in dortigen Social Media oder konkret auf Weibo Öffentlichkeiten finden lassen, die Funktionen überneh-men, die andernorts und insbesondere in den Massenmedien des Landes nicht erfüllt werden, diskutieren Sozialwissenschaftler seit Jahren. Ihr Öffentlichkeits-verständnis entspricht dem eingangs dargelegten: Während einige Autoren wie Abbott (2012) oder Jiang (2010) versuchten, Habermas’ Modell einer deliberati-ven Öffentlichkeit auf den chinesischen Fall zu übertragen, bezweifeln die meisten
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 331
die Übertragbarkeit des für Europa entwickelten Konzepts auf China (e. g. Yang und Calhoun 2007; Huang 1993; Madsen 1993; Rowe 1990). Viele von ihnen ver-wenden ein basaleres Verständnis von Öffentlichkeiten, die sie als kommunikative Räume mit „1) disregard for status; 2) a domain of common concern, and 3) inclu-sivity“ (Abbott 2012, S. 334) bzw. als Foren öffentlichen Ausdrucks, sozialer Inter-aktion, kollektiver Identitätsbildung, bürgerlicher Gemeinschaft und öffentlichen Protests (Yang 2003) verstehen.
Zur Frage, ob derartige Öffentlichkeiten im chinesischen Internet und konkret auf Weibo entstehen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Einerseits verweisen Skeptiker wie He und Warren (2011) oder Jiang (2010) auf die ausgeprägte staat-liche Zensur als zentrale Hürde. Und in der Tat ist das chinesische Internet nach einer Frühphase vergleichsweise schwacher Kontrolle (Liang und Lu 2010) in den letzten Jahren einer zunehmenden und intensiven Regulation und Zensur unter-worfen (Endeshaw 2004).
Dies betrifft auch Weibo, wo Inhalte von der Betreiberfirma Sina auf zweier-lei Arten kontrolliert bzw. zensiert werden (Hui und Rajagopalan 2013): Zum ei-nen werden bestimmte Inhalte schon bei der Erwähnung von Schlüsselwörtern wie „Tiananmen Incident“, „Falun (Gong)“ or „Taiwan Independence“ automa-tisch blockiert oder verzögert (Fu et al. 2013; Bamman et al. 2012). Zum anderen beschäftigt Sina eine große Zahl menschlicher Zensoren, die Beiträge permanent auf problematische Inhalte durchsuchen (Hui und Rajagopalan 2013) und gegebe-nenfalls löschen (Zhu et al. 2013). Da sich auch die Präsenz chinesischer Behör-den auf der Plattform in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet hat (Sul-livan 2013), argumentieren Skeptiker, auf Weibo könne keine politisch relevante Öffentlichkeit entstehen. Die Plattform bleibe ein apolitischer, unterhaltungs-orien tierter Kommunikationsraum (Sullivan 2012), in dem Zensur gepaart mit ausgeprägter staatlicher Propaganda freie und politische Debatten erfolgreich un-terminierten (MacKin non 2011; vgl. Morozov 2011, S. 117). Zudem sei denkbar, dass selbst Kritiker zögerten, sich an heiklen Online-Debatten zu beteiligen, weil sie on- und offline mit Repressalien und Sanktionen rechnen müssten (Human Rights Watch 2013).
Demgegenüber verweisen optimistische Autoren auf die technischen Mög-lichkeiten der Plattform und vor allem auf die Schwierigkeit einer effektiven Kontrolle der enormen Nutzerzahlen. Zudem wird darauf verwiesen, dass die chinesische Regierung ein gewisses Maß an öffentlicher Diskussion im Inter-net erlaube, etwa um sich selbst über Missstände in weit entfernten Provinzen zu informieren (Jiang 2010). Nicht zuletzt gebe es eine Vielzahl von Beispielen für Fälle, in denen erfolgreich kritische Debatten initiiert wurden (Yang 2003; Yang und Calhoun 2007). Online-Kommunikation und gerade das vielgenutzte Weibo eigneten sich daher durchaus dazu, um Behörden zu überwachen, punk-
332 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
tuell kollektiven Widerstand zu organisieren (Noesselt 2014) und vielleicht sogar eine „social and political transformation“ der chinesischen Gesellschaft einzulei-ten (Xiao 2011, S. 60).
Sowohl auf der skeptischen als auch optimistischen Seite der akademischen Debatte über Online-Öffentlichkeiten in China finden sich gewichtige Argumente. Während die optimistische Seite dazu neigt, das Potential von Weibo und anderen Online-Medien in China zu überschätzen, dürfte die ausgeprägte Skepsis ebenfalls unzutreffend sein. Denn staatliche Kontroll- und Zensur-Bemühungen limitieren zwar durchaus den Umfang, den Inhalt und die Reichweite von Kommunikation auf Weibo, aber sie verunmöglichen die Entstehung von Online-Öffentlichkeiten nicht – wie wir im Folgenden anhand von Sina Weibo zeigen werden.
4 Neue Öffentlichkeiten auf Sina Weibo
Die Kommunikation auf Sina Weibo ist in ihrem Ausmaß und ihrer Diversität enorm. Weite Teile dieser Kommunikation sind apolitisch (Sullivan 2012), und zu vielen Themen können keine umfassenden Debatten entstehen, weil sie schnell und effektiv zensiert werden. Doch diesen Umständen zum Trotz haben Studien eine beträchtliche Zahl von Fällen dokumentiert, in denen Themen von kollekti-ver Bedeutung in einer Weise debattiert werden können, die den oben genannten Kerndimensionen von Öffentlichkeit entspricht: Sie werden offen und teils kri-tisch (Offenheit) und/oder von einer großen Zahl beteiligter Akteure (Partizipa-tion) und/oder dauerhaft (Beständigkeit) auf Weibo thematisiert. Wir haben diese Beschreibungen zusammengetragen, sie durch Medienberichte aus China und an-deren Ländern sowie eigene Forschungsergebnisse ergänzt und auf dieser Basis eine Typologie von sieben idealtypischen Öffentlichkeiten entwickelt, die sich auf Weibo finden lassen.
Keine dieser Öffentlichkeiten erfüllt alle drei eingeführten Öffentlichkeits-Kri-terien in vollem Umfang. Aber jede von ihnen erfüllt eines oder mehrere dieser Kriterien. Jede dieser Öffentlichkeiten lässt sich durch eine größere Zahl von Bei-spielen illustrieren, von denen wir je ein bis zwei ausgewählte Ankerbeispiele vor-stellen werden.
4.1 Themenöffentlichkeiten
Zu einer Reihe von Themen kann auf Weibo nicht oder nur in stark eingeschränk-ter Form kommuniziert werden. Beiträge, welche etwa die etablierte Ein-Parteien-Herrschaft offen in Frage stellen, Korruption unter politischen Eliten öffentlich
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 333
Ta
be
lle
1
Idea
ltypi
sche
Öffe
ntlic
hkei
ten
auf W
eibo
im Ü
berb
lick
Them
en-
Öff
en
tlic
hk
eit
en
Tem
porä
re
Öff
en
tlic
hk
eit
en
Vers
chlü
ssel
te
Öff
en
tlic
hk
eit
en
Loka
le
Öff
en
tlic
hk
eit
en
Impo
rtie
rte
Ö
ffe
ntl
ich
ke
ite
n
Mob
ile
Öff
en
tlic
hk
eit
en
Met
a-
Öff
en
tlic
hk
eit
en
Ge
ltu
ng
s-
be
reic
h
Von
staa
tlich
er
Seite
ane
rkan
nte
Prob
lem
lage
n
Plöt
zlic
he, u
ner-
war
tete
The
men
un
d Er
eign
isse
Als
sen
sibe
l be-
kann
te T
hem
en
Sub-
natio
nale
Er
eign
isse
und
Th
emen
Polit
isch
e Er
eig-
niss
e un
d Th
e-m
en a
us d
em
Aus
land
Onl
ine
gelö
sch-
te T
hem
en u
nd
Post
s
Them
atis
ieru
ng
von
Zens
ur a
ls
solc
her
Be
stä
nd
igk
eit
/
Da
ue
r
Hoc
h/
Lang
fris
tigN
iedr
ig/
Kurz
fris
tig
Eher
nie
drig
Va
riier
tVa
riier
t Va
riier
tVa
riier
t
Off
en
he
it/
Ein
flu
ss
vo
n Z
en
sur
Sehr
offe
n/
Ger
ing
Wen
ig o
ffen/
Star
k W
enig
offe
n/St
ark
Offe
n/G
erin
g Va
riier
t Ke
ine
Varii
ert
Au
sma
ß a
n
Pa
rtiz
ipa
tio
n
Um
fang
reic
h U
mfa
ngre
ich
Unt
ersc
hied
lich
Ger
ing
Unt
ersc
hied
lich
Ger
ing
Unt
ersc
hied
lich
334 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
machen wollen, die Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 resp. deren Nieder-schlagung durch die chinesische Regierung thematisieren oder den Status von Taiwan als unabhängigem Land kommentieren, werden sofort oder nach kurzer Verzögerung zensiert, d. h. von Weibo gelöscht (Bamman et al. 2012). Im Gegen-satz dazu existiert jedoch eine Reihe von Themen, über die auf Weibo offen disku-tiert werden kann, zu denen also Themenöffentlichkeiten bzw. „issue publics“ (vgl. Kim 2009) entstehen. Dabei handelt es sich durchaus nicht nur um apolitische, le-bensweltliche Themen (wie es etwa Sullivan (2012) vermutet), sondern durchaus auch um Gegenstände von kollektiver Relevanz, die Konsequenzen für die poli-tische Verwaltung auf lokaler, regionaler und teils sogar nationaler Ebene haben.
Das zentrale, in der Forschungsliteratur mehrfach analysierte Beispiel hierfür sind Umweltthemen, welche in China zum Aufkommen einer „green“ oder „en-vironmental public sphere“ (Liu 2011; Yang und Calhoun 2007) geführt haben. Themen wie die Luftverschmutzung in chinesischen Städten (Holdaway 2013), Le-bensmittelsicherheit (Yang 2013) oder der Klimawandel (Yang 2010) können auf Weibo offen debattiert werden. Einer der Hauptgründe dafür ist die offizielle An-erkennung dieser Probleme durch die chinesische Regierung (Holdaway 2013). Da Themen wie Luftverschmutzung und Lebensmittelsicherheit durch die Bevölke-rung im Alltag direkt erfahrbar sind, können diese Themen schwer von der Regie-rung ignoriert werden.3
Abbildung 1 illustriert dieses Phänomen quantitativ: Während sich im Verlaufe eines Monats kein einziger Weibo-Post zu den Protesten auf dem Tiananmen-Platz 1989 finden lässt (vgl. Bamman et al. 2012) und die entsprechende Kurve entlang der x-Achse verläuft, zeigen sich für die Themen Lebensmittelsicher heit und Klimawandel lebhafte Weibo-Debatten mit bis zu 223 Beiträgen pro Stunde und einer Gesamtzahl von 21 375 (Lebensmittelsicherheit) resp. 5 168 (Klimawan-del) Beiträgen. Diese Debatten enthalten sowohl kritische Einschätzungen der Si-tuation als auch Kritik gegenüber politischen Entscheidungsträgern. So kritisierte etwa der chinesische Immobilienmagnat Pan Shiyi in seinen Weibo-Posts die Un-genauigkeit der offiziellen Messungen der Luftverschmutzung in chinesischen Städten (Oster 2013) – aber als Reaktion wurden seine Beiträge nicht zensiert, son-dern die chinesische Regierung veröffentlichte bessere Messungen.
Themenöffentlichkeiten dieser Art – gerade rund um den Themenkomplex Umwelt oder Lebensmittelsicherheit – existieren in chinesischen Social Media in großer Zahl, wie Yang (2013) zeigt. Sie genügen auch anspruchsvollen Krite-rien von Öffentlichkeit, bestehen sie doch aus lang andauernden, oftmals inten-
3 Dazu passt, dass in den letzten Jahren auch die Berichterstattung über das Thema Lebens-mittelsicherheit in chinesischen Zeitungen stark zugenommen hat Yang (2013).
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 335
Ab
bil
du
ng
1
Im E
in-S
tund
en-T
akt e
rfas
ste
Akt
ivitä
t von
Wei
bo-P
osts
zu
den
Them
en L
eben
smitt
elsi
cher
heit,
Klim
awan
del u
nd d
en P
ro-
test
en a
uf d
em T
iana
nmen
-Pla
tz 19
89. D
ie D
aten
wur
den
mit
Hilf
e de
r Suc
hfun
ktio
n ei
nes
R So
ftw
are-
Pake
ts (L
i 201
3) a
us W
eibo
ext
rahi
ert.
050100
150
200
17 S
ep
19 S
ep
21 S
ep
23 S
ep
25 S
ep
27 S
ep
29 S
ep
01 O
kt
03 O
kt
05 O
kt
07 O
kt
09 O
kt
11 O
kt
13 O
kt
15 O
kt
17 O
kt
Dat
um 2
013
Sina Weibo Nachrichten pro Stunde
Sch
lag
wo
rt
Lebe
nsm
ittel
sich
erhe
it
Klim
awan
del
Tian
anm
en-Z
wis
chen
fall
Schl
agw
ortv
ergl
eich
auf
Sin
a W
eibo
336 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
siven Debatten über Probleme von allgemeinem Interesse, an denen eine große Zahl von Bürgern mit sehr unterschiedlichen Argumenten und Bewertungen teil-nimmt. Sie machen das Handeln politischer, wirtschaftlicher und weiterer Ent-scheidungsträger transparent, ermöglichen dabei ein Maß an Offenheit und Kri-tik, das ausländische Beobachter überraschen mag (Qian und Bandurski 2011; Yang 2011) und entfalten, wie gezeigt, durchaus politische Wirkungen.
4.2 Temporäre Öffentlichkeiten
Zensur auf Sina Weibo ist, wie beschrieben, eine Kombination aus Vor- und Nach-zensur: Zum einen werden Inhalte von Beiträgen automatisch mit einer „schwar-zen Liste“ abgeglichen. Enthalten sie Themen und Schlagworte, die aus Sicht der Zensoren als problematisch gelten, werden sie gar nicht erst veröffentlicht oder aufgehalten, bis der Beitrag von Sina genehmigt wurde (Zhu et al. 2013). Zum an-deren gibt es auf Sina Weibo eine ausgeprägte Nachzensur. Veröffentlichte Bei-träge werden von menschlichen Zensoren beobachtet und gegebenenfalls nach-träglich entfernt. Dies geschieht innerhalb weniger Stunden: Etwa 30 % der als problematisch angesehenen Beiträge werden innerhalb von 30 Minuten nach ihrer Veröffentlichung gelöscht, 90 % innerhalb eines Tages (Zhu et al. 2013).
Besonders effektiv ist diese Form der Zensur, wenn sich die Zensoren auf ein Ereignis vorbereiten können, wie es bspw. für die Jahrestage der Proteste auf dem Tiananmen-Platz gilt. Weniger effektiv ist sie allerdings bei überraschenden, plötzlichen Ereignissen, die den Zensoren keine Zeit zur Vorbereitung lassen. In diesen Fällen kann die hohe Verbreitungsgeschwindigkeit, mit der Inhalte auf so-zialen Medien diffundieren, dafür sorgen, dass sie eine große Zahl von Personen erreichen und von diesen kommentiert und wiederum weiter verbreitet werden können – es entstehen temporäre Öffentlichkeiten.
Ein erstes Beispiel für eine solche temporäre Öffentlichkeit wurde bereits ein-leitend beschrieben: der Bombenanschlag am Beijing International Airport, des-sen Beschreibung und Hintergründe sich schnell und erfolgreich auf Weibo ver-breiteten, von den Zensoren nicht mehr eingefangen werden konnten und für eine kritische Debatte sowie für massenmediale Berichterstattung im In- und Ausland sorgten.
Weitere Beispiele für temporäre Öffentlichkeiten finden sich in der Weibo-Kommunikation über das Fehlverhalten chinesischer Spitzenpolitiker. Als etwa das ehemalige Politbüro-Mitglied Bo Xilai 2013 wegen Korruption vor Gericht stand, eröffnete die chinesische Regierung einen Weibo-Account, um über das Verfahren zu berichten und unter anderem einen Weibo Live-Stream aus dem Ge-richtssaal zur Verfügung zu stellen. Zwar wurden schon früh die Kommentar-
Neue Öff entlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 337
funktion und das weitere Teilen von Beiträgen dieses Accounts staatlicherseits ge-stoppt, aber die Entstehung einer temporären Öff entlichkeit war dennoch nicht zu verhindern: Als sich der prominente Weibo-Nutzer Zuoyeben während des Prozesses über eine Handhaltung Bo Xilais lustig machte und ihre Bedeutung als „alles ist bestens“ interpretierte, wurde sein Beitrag innerhalb von zwölf Minu-ten mehrere tausend Mal geteilt – bis der Beitrag selber und Zuoyebens Benut-zerkonto zeitweise gelöscht wurden. Als sein Benutzerkonto wieder frei geschal-tet wurde, meldete er sich mit einem Emoticon zurück, das die Handhaltung Bo Xilais wiederholte (siehe Abbildung 2), und erneut wurde sein Beitrag mehrere tausend Mal geteilt.
Ein ähnlicher Fall ist die Weibo-Diskussion über die mutmaßliche Korruption in der Familie des chinesischen Premierministers Wen Jiabao. Nachdem die „New York Times“ im Oktober 2012 einen Artikel über entsprechende Vorwürfe publi-zierte (Barboza 2012), nahm die Weibo-Kommunikation über das Th ema schlag-artig zu. Obwohl der Begriff „New York Times“ und einige weitere wenige Stun-den später auf Weibo blockiert und die offi zielle Weibo-Seite der Zeitung entfernt
Abbildung 2 Links der erste Weibo-Post, der ein Foto des Bombenanschlags auf den Flug-hafen Beijing zeigt (FreeWeibo.org 2013). Rechts der Weibo-Post, in dem der Nutzer Zuoye-ben die Handhaltung Bo Xilais in seinem Korruptionsprozess als Botschaft an die breitere Öff entlichkeit interpretiert.
338 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
wurden (Bradsher 2013), kamen die Zensoren zu spät: Zwischen 4:34 Uhr in der Nacht und „früh morgens“ chinesischer Zeit konnte noch auf 185 000 Beiträge mit dem Schlagwort „New York Times“ zugegriffen werden, von denen viele den be-treffenden Artikel erwähnten und teils die Legitimität der Kommunistischen Par-tei in Frage stellten (Lu 2012).
Temporäre Öffentlichkeiten sind, wie ihr Name schon sagt, nicht langlebig. Ihre Stärke ist die Schnelligkeit, mit der Inhalte online verbreitet werden können – bzw. mit den Worten Zhu Ruifengs, des Betreiber einer chinesischen Whistle-blowing-Homepage: „Our hopes in this country are in the Internet. Weibo’s ability to transmit information is too quick“ (Bloomberg News 2013). Aufgrund dieser Schnelligkeit können in temporären Öffentlichkeiten auf Weibo auch von staat-licher Seite als heikel angesehene Themen angesprochen werden – die bspw. das Verhalten nationaler Politiker und Grundfesten des chinesischen politischen Sys-tems in Frage stellen. Sie können sehr große Teilnehmerzahlen erreichen, gerade wenn sie von prominenten Nutzern und/oder Massenmedien initiiert werden, und teilweise mehrere Tage aufrecht erhalten werden (Chen et al. 2013).
4.3 Verschlüsselte Öffentlichkeiten
Die Proteste auf dem Tiananmen-Platz können auf Weibo, wie beschrieben, nicht explizit diskutiert werden, weil die entsprechenden Schlagworte sofort und au-tomatisch erkannt und die betreffenden Posts (vor)zensiert werden (siehe Abbil-dung 1). Dennoch ist es möglich, auch derart heikle Gegenstände zu thematisie-ren – wenn man dies in verschlüsselter Form tut. Dies geschieht häufig als direkte Reaktion auf die Zensur, d. h. als bewusster Versuch, diese zu umgehen, indem man Sachverhalte bildlich oder sprachlich codiert.
Im Falle der Tiananmen-Proteste von 1989 entsteht eine solch verschlüsselte Öffentlichkeit jedes Jahr. Zum Jahrestag des Ereignisses versuchen Nutzer an die Proteste zu erinnern – was wiederum den Zensoren bewusst ist und sie in erhöhte Alarm bereitschaft versetzt. Da explizite Erwähnungen der Vorfälle geblockt oder umgehend entfernt werden, nutzen die Weibo-User verschlüsselte Darstellungen in ihren Posts, um an die Proteste zu erinnern. 2013 wurden bspw. Bilder des „Tank Man“ – der sich 1989 mehreren chinesischen Panzern allein in den Weg stellte – auf Weibo veröffentlicht, wobei jedoch die Panzer im Bild durch gelbe Gummi-enten ersetzt wurden (Abbildung 3). Weitere Versionen des Bildes verwendeten Lego- und Angry Bird-Motive anstelle der Panzer. Und diese Versuche blieben nicht ohne Erfolg: Während explizite Erwähnungen des Jahrestags von Beginn an verunmöglicht und von der Vorzensur erfasst wurden, waren die manipulierten Bilder für einige Zeit auf Weibo verfügbar.
Neue Öff entlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 339
Abbildung 3 Im Uhrzeigersinn von oben links: a) Das „grass mud horse“ – ein fi ktiona-les Tier, das im chinesischen Internet u. a. dafür benutzt wird, um staatliche Zensur zu mar-kieren und kritisieren. b) Auf Weibo gepostetes Bild des „tank man“ auf dem Tiananmen Platz – dem „Platz des himmlischen Friedens“ – bei dem die Panzer des Original-Fotos durch Gummienten ersetzt wurden. c) Weibo-Diskussion über das Löschen des Benutzerkontos von Zuoyeben, inkl. eines Screenshots des gelöschten Kontos und einer Befragung der Wei-bo-Nutzer dazu, ob das Löschen als gerechtfertigt angesehen wird (blau) oder nicht (rot). d) Weibo-Überblicksseite mit allen Posts zu den Präsidentschaftswahlen in den USA 2012, mit 16 480 auf das Ereignis bezogenen Posts und einer Nutzerbefragung zu ihren Wahlprä-ferenzen zwischen Barack Obama (grün) and Mitt Romney (rot).
340 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
Das wohl bekannteste Beispiel für eine solche bildliche Codierung ist das so genannte „grass mud horse“, ein Homophon des chinesischen Ausdrucks „Fick Deine Mutter“ (Abbott 2012; siehe Abbildung 3). Dieses fiktive Tier frisst angeb-lich gern „Flusskraben“, die wiederum ein Homophon des politisch aufgeladenen Begriffs „harmonisch“ sind – denn die Rechtfertigung der chinesischen Behör-den für die Zensur online ist es, eine „harmonische Gesellschaft“ gewährleisten zu wollen. Daher werden Bilder des „grass mud horse“ oftmals eingesetzt, um ge-gen Zensur zu demonstrieren. Ein Beispiel findet sich u. a. im Kontext des ein-gangs beschriebenen Bombenanschlags am Flughafen Beijing: Die Weibo-Nut-zerin, welche die ersten Bilder des Anschlags veröffentlichte und deren Beiträge daraufhin gelöscht wurden, veröffentlichte zwei Tage später mehrere Bilder des „grass mud horse“ – mutmaßlich als Reaktion auf die Zensur und zweifelsohne von vielen ihrer Follower als solche verstanden.
Neben bildlichen Verschlüsselungen finden sich auch sprachliche Codie-rungen: Spezifische Namen werden durch generische Namen ersetzt, es werden Homo phone oder Homographe verwendet oder einzelne Bestandteile eines Wor-tes in lateinische Schrift umgewandelt (Chen et al. 2013). Weil sich die Nutzer der Zensurmechanismen auf Weibo bewusst sind, beginnen sie oft schon innerhalb der ersten Stunden einer Debatte über ein heikles Thema, d. h. bevor die Zensur einsetzt, diese abgewandelten Wörter zu verwenden.
Charakteristisch für derartige, verschlüsselte Öffentlichkeiten ist, dass sie be-wusste Reaktionen auf die Zensur im chinesischen Internet sind und versuchen, diese zu umgehen. Auf diese Weise können sie einerseits auch höchst diffizile The-men öffentlich machen. Dies hat, andererseits, einen Preis: Um einen Code ver-stehen zu können, benötigt das Publikum den entsprechenden Schlüssel – mithin vorgängig vorhandenes Wissen, um die Codes auch entziffern zu können. Dass dieses Wissen bei den Zensoren nicht vorhanden ist, ist beabsichtigt und der Ver-breitung der Botschaften zuträglich. Aber es kann zugleich das Verständnis bei breiteren Nutzergruppen behindern. Während etwa das „grass mud horse“ bei Zensoren und Publikum gleichermaßen bekannt ist, müssen Verschlüsselungen heiklerer Themen schwerer zu entziffern sein und bleiben dennoch nur für be-grenzte Zeit online – als Teil eines Katz-und-Maus-Spiels zwischen Nutzern und Zensoren. Die Zahl der Teilnehmer derartiger verschlüsselter Öffentlichkeiten hängt entsprechend davon ab, wie schwierig die Informationen zu entschlüsseln sind. Die Bilder des „tank man“ auf dem Tiananmen-Platz etwa sind unter den jungen Chinesen wenig bekannt (MacKinnon 2011) und auch deren Verschlüsse-lung erschloss sich vermutlich nur wenigen Nutzern.
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 341
4.4 Lokale Öffentlichkeiten
Eine weiterer Typus von Öffentlichkeit auf Weibo beschäftigt sich mit Themen von kollektivem Interesse und oftmals politischer Brisanz, die jedoch zum Zeitpunkt ihrer Diskussion (noch) nicht auf nationaler, sondern auf subnationaler Ebene an-gesiedelt sind. Bürger „use Weibo to publicize localized incidents“ (Sullivan 2013, S. 10) – es handelt sich um lokale oder regionale Öffentlichkeiten.
Exemplifizieren lässt sich eine solche lokale Öffentlichkeit anhand von Yang Hu, einem 16 Jahre alten Schüler. Dieser kritisierte auf Weibo die Ermittlungen lokaler Behörden zum Tod eines Angestellten einer Karaoke-Bar, und veröffent-lichte Bilder einer entsprechenden Demonstration. Daraufhin wurde er von der Polizei vor Ort verhaftet. In der Folge intensivierte sich die Weibo-Kommuni-kation über den Fall. Er erregte die Aufmerksamkeit der nationalen Regierung – kurz darauf wurde Yang Hu wieder freigelassen (Kaiman 2013).
Derartige lokale Öffentlichkeiten existieren aus zwei Gründen. Erstens wer-den sie von der nationalen Regierung toleriert, weil Debatten über lokale oder re-gionale Angelegenheiten meist nicht direkt die nationale kommunistische Par-tei in Frage stellen und stattdessen Gelegenheiten sind, durch Interventionen die Legitimität der nationalen Regierung zu erhöhen (Noesselt 2014). Zweitens sind lokale Öffentlichkeiten auch möglich, weil Zensur auf nationaler Ebene, mit-hin zentral organisiert wird, Zensoren in den chinesischen Metropolen mit auf-kommenden lokalen Problemen oft nicht vertraut sind und ihre Aufmerksamkeit erst auf diese Probleme richten, wenn sie in größerem Umfang diskutiert werden (Zhu et al. 2013).
Lokale Öffentlichkeiten bleiben einerseits, naturgemäß, in ihrer thematischen und geographischen Reichweite sowie der Anzahl ihrer Teilnehmer limitiert. In ihnen können jedoch gravierende Missstände aufgegriffen, subnationale politi-sche Akteure deutlich kritisiert und teilweise auch entsprechende politische Reak-tionen herbeigeführt werden.
4.5 Importierte politische Öffentlichkeiten
Auch nationale politische Themen können eine Rolle auf Weibo spielen – sofern sie die nationale Politik in anderen Ländern betreffen. Präsidentschaftswahlen und -kandidaturen, Wahlkampagnen etc. in anderen Ländern werden auf Weibo offen diskutiert, oftmals unter Beteiligung der Weibo-Accounts chinesischer Mas-senmedien. Relevant ist, dass bei der Diskussion dieser Themen oftmals Bezüge zur Situation in China hergestellt und teils Kritik an einheimischen Problemen geäußert wird – nicht selten unter Beteiligung von Chinesen im Ausland, etwa
342 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
chinesischer Auswanderer oder chinesischer Studenten, die für ihr Studium in ein anderes Land gezogen sind (Yang 2003).
Das Paradebeispiel hierfür sind die Weibo-Debatten über Wahlen in den USA. Das Interesse junger Chinesen an den Vereinigten Staaten ist sehr ausgeprägt (Ji et al. 2012), und entsprechend wurden auch US-Präsidentschaftswahlen wie die von 2012 auf Weibo ausführlich und intensiv diskutiert. Über 16 000 Weibo-User schrieben Beiträge mit dem Hashtag der Präsidentschaftswahlen 2012 und führ-ten sogar ihre eigene Wahl durch, die Obama mit 78,9 % der Stimmen gewann (siehe Abbildung 3). Inhaltlich beschäftigte sich die Diskussion dabei durchaus nicht nur mit dem Rennen zwischen Barack Obama und Mitt Romney, sondern auch generell mit demokratischen Wahlen als politischer Institution und mit der Wünschbarkeit selbiger im chinesischen Kontext. Teilweise formulierten Nutzer ihre Frustration über das eigene politische System und forderten etwa, „China should hold such an election, then China will move towards democracy and dic-tatorship should be over“.4
Derartige, gewissermaßen importierte politische Öffentlichkeiten, sind da-durch restringiert, dass sie eines externen Anlasses bedürfen und zeitlich begrenzt bleiben. Es handelt sich aber um eine weitere Form internetöffentlicher Ausein-andersetzung, die es den Nutzern in China ermöglicht, anlässlich eines Ereignis-ses in einem anderen Land auch heikle Aspekte des eigenen politischen Systems anzusprechen.
4.6 Mobile Öffentlichkeiten
Mobiltelefone sind in China so weit verbreitet, dass 49,5 % aller Mobiltelefon-nutzer mit Internetzugang Weibo über ihr Mobiltelefon nutzen (China Inter-net Network Information Center 2013). Viele von ihnen erhalten ihre abonnier-ten Weibo-Beiträge sofort nach deren Veröffentlichung als Push-Mitteilung auf ihr Mobiltelefon. Diese auf dem Endgerät offline gespeicherten Mitteilungen wer-den auch dann nicht gelöscht, wenn sie problematische Inhalte enthalten und die entsprechenden Beiträge online, auf der Weibo-Plattform selbst, entfernt werden. Selbst wenn Sina Weibo ein Benutzerkonto – wie das der New York Times – kom-plett löscht, bleibt es auf den Mobiltelefonen im Hintergrund sichtbar, lediglich versehen mit der Meldung, das Benutzerkonto existiere nicht mehr.
Auf diese Weise können auch zu heiklen, auf Weibo selbst umgehend zen-sierten Themen Öffentlichkeiten entstehen, die wiederum Anschlusskommunika-tion produzieren. Diese Anschlusskommunikation kann einerseits interpersonale
4 Der Name der entsprechenden User wird hier nicht genannt, ist den Autoren aber bekannt.
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 343
Kommunikation sein, etwa wenn Beiträge mit der Familie, Freunden und ande-ren diskutiert werden. Andererseits kann Anschlusskommunikation auch Weibo selbst wieder erreichen und zensierte Themen und Debatten neu beleben. Wie die Explosion am Flughafen in Beijing oder der Prozess gegen Bo Xilai illustrieren, er-scheinen gelöschte Beiträge häufig erneut auf Weibo, weil Nutzer den ursprüngli-chen Beitrag auf ihren Mobiltelefonen offline speichern und ihn anschließend ein weiteres Mal auf Weibo veröffentlichen (siehe Abbildung 2). Derartige Re-Posts sind für Zensoren besonders schwer zu erfassen, wenn gelöschte Beiträge nicht als Texte, sondern als Screenshots wieder erscheinen, mithin als Grafiken, die durch eine automatische Schlagwortsuche nicht erfasst werden können. Menschliche Zensoren können diese Nachrichten dennoch auffinden und nachzensieren, aber nur mit einem entsprechenden zeitlichen Verzug.
Offline-Öffentlichkeiten können beträchtliche Wirkungen entfalten, weil sie Anschlusskommunikation ermöglichen und zugleich Zensur in einer Weise trans-parent machen, die es in anderen Medien nicht gibt: In traditionellen Medien ist Zensur für das Publikum nicht erkennbar, weil Artikel und audiovisuelle Inhalte vor der Publikation (vor)zensiert werden. Für Weibo-Nutzer mit Mobiltelefonen wird Zensur jedoch sehr deutlich und kann entsprechende Reaktionen auslösen. Dies führt uns zum letzten Typus von Weibo-Öffentlichkeiten.
4.7 Meta-Öffentlichkeiten
Existenz, Stoßrichtung und Art der Zensur auf Weibo dürften vielen Nutzern der Plattform aus unterschiedlichen Gründen bewusst sein: Teils erhalten sie Push-Mitteilungen auf ihre Mobiltelefone, deren Äquivalente auf Weibo nicht mehr auf-zufinden sind. Teils werden sie darüber informiert, dass Benutzerkonten von Sina gelöscht wurden. Teils machen sie die Erfahrung, dass eigene Beiträge von Zen-soren entfernt werden. Teils wissen sie, dass Themen wie der Tiananmen-Zwi-schenfall – wie andernorts auch – nicht angesprochen werden dürfen. Dieses Be-wusstsein der Existenz und des Charakters von Zensur führt dazu, dass auf Weibo Meta-Öffentlichkeiten entstehen, d. h. Debatten, in denen die Zensur selbst zum Thema gemacht wird.
Nach dem oben genannten Bombenanschlag am Flughafen Beijing etwa gab Weibo-Nutzer Zuoyeben seinem Unmut offen Ausdruck, nachdem Zensoren sei-nen Beitrag gelöscht hatten. „Weibo hat wieder ein Zensurdurcheinander“, schrieb er und fügte hinzu „immer mehr [Nutzer] verstehen euch nicht mehr“. Dieser Beitrag wurde über 13 000 Mal geteilt und führte zu Diskussionen über die Lösch-praktiken auf der Plattform. In den Kommentaren zu diesem Beitrag diskutierten die Nutzer bspw. offen Strategien, die geeignet seien, um die Zensur zu umgehen.
344 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
Einer von ihnen empfahl anderen Nutzern, sie sollten „einen Screenshot anferti-gen und wieder hochladen“, weil Sinas schlagwortbasiertes Zensur-System diese Bilder nicht gut analysieren könne.
In einem anderen Fall wurde Zuoyebens Benutzerkonto nach dem Prozess gegen Bo Xilai zweimal gelöscht, was eine Weibo-Debatte über sein Verschwin-den auslöste. Während seiner Abwesenheit auf Weibo wurden über 37 000 Bei-träge veröffentlicht, die sein Verschwinden diskutierten. Darunter befanden sich Screenshots originaler, älterer Beiträge Zuoyebens sowie seines Benutzerkontos, welches noch auf Mobiltelefonen zusammen mit einer „Benutzer existiert nicht“-Nachricht sichtbar war.
Derartige Meta-Öffentlichkeiten thematisieren explizit die Zensurpraktiken auf Weibo. Sie machen die existenten Einschränkungen von Weibo-Kommuni-kation noch zusätzlich transparent, diskutieren deren Nutzen und veröffentlichen zudem mögliche Gegenmaßnahmen.
5 Fazit und Ausblick
Entstehungsprozesse, Formen und gesellschaftliche Folgen von öffentlicher Kom-munikation sind bereits seit Jahrzehnten ein zentrales Thema verschiedener So-zialwissenschaften. Diese Diskussion ist von Jürgen Gerhards’ konzeptionellen und empirischen Arbeiten zu den Charakteristika politischer Öffentlichkeit (Ger-hards und Neidhardt 1991; Gerhards 1994) und ihrem normativen Kern (Gerhards 1997; Ferree et al. 2002a), zur Neustrukturierung von Öffentlichkeiten in postmo-dernen Gesellschaften (Gerhards 1993a) oder zu transnationalen Öffentlichkeiten in Europa (Gerhards 1993b, 2000) und darüber hinaus (Gerhards et al. 2011; Ger-hards und Schäfer 2014, 2012) maßgeblich mitgeprägt worden.
Der vorliegende Beitrag schloss an diese Diskussion an und griff ein aktuelles Thema auf, das in den vergangenen zehn Jahren an Aufmerksamkeit gewann: die Entstehung und Rolle von Online-Öffentlichkeiten jenseits westlicher Länder. In dieser Hinsicht besonders interessant sind autoritäre Staaten, in denen einerseits staatliche Restriktionen und Zensur-Bemühungen ausgeprägt sind, in denen an-dererseits aber gerade Online-Medien als Ventil für kritische Meinungen dienen können, die in etablierten Massenmedien nicht geäußert werden können.
China ist das wohl relevanteste Beispiel für ein solches autoritäres Land, und zudem ein Fall, für den die Rolle von Online-Medien bereits ausführlich und kon-trovers zwischen Optimisten und Skeptikern diskutiert worden ist. Unsere Ana-lyse beschreitet dabei einen Mittelweg zwischen diesen Positionen – die einer-seits auf die Stärke von staatlicher Zensur und Propaganda online verweisen und andererseits auf die große Zahl und Kreativität kritischer „Netizens“ setzen. Am
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 345
Beispiel Sina Weibos, der mit Abstand verbreitetsten chinesischen Social Media-Plattform, haben wir dargelegt, dass Zensur und staatliche Kontrolle die dortige Kommunikation durchaus einschränken, aber kritische Debatten nicht gänzlich zum Schweigen bringen können. Im Gegenteil: Auf Basis unterschiedlicher Evi-denzen lässt sich zeigen, dass Typen von Weibo- resp. Online-Öffentlichkeiten existieren, die bezogen auf unterschiedliche Themen unterschiedlich stark kon-trollierbar sind und mit unterschiedlicher Dauer und Teilnehmerzahl öffentliche Debatten ermöglichen.
Thematische Öffentlichkeiten existieren nur bei einer begrenzten Anzahl an Themen; es lassen sich dort aber Phänomene von allgemeinem Interesse und mit politischen Konsequenzen offen, dauerhaft und mit großen Teilnehmerzahlen dis-kutieren. Temporäre Öffentlichkeiten können innerhalb kurzer Zeitspannen sen-sible Themen aufgreifen, die auf anderen Kanälen – etwa Massenmedien – nicht diskutiert werden. Verschlüsselte Öffentlichkeiten machen es möglich, kurzzeitig und innerhalb eines kleinen Kreises Eingeweihter auch hochproblematische Er-eignisse zu thematisieren. Lokale Öffentlichkeiten machen die offene, dauerhafte und in mehreren dokumentierten Fällen folgenreiche Kommunikation über sub-nationale Themen und Missstände möglich. Importierte Öffentlichkeiten bieten die Möglichkeiten, chinesische Themen unter Bezugnahme auf ausländische Er-eignisse wie Wahlen in den USA aufzugreifen und dort auch explizite Kritik an der einheimischen Situation zu äußern. Mobile Öffentlichkeiten, die v. a. aufgrund der hohen Verbreitung von Mobiltelefonen in China entstehen, ermöglichen An-schlusskommunikation außerhalb Weibos und das erneute Posten problemati-scher Inhalte innerhalb der Plattform selbst. In Meta-Öffentlichkeiten schließlich können Nutzer die Zensur in China resp. auf Weibo thematisieren und, in Gren-zen, kritisieren.
Diese Typologie speist sich auf der einen Seite aus einer Vielzahl einschlägi-ger Fallstudien und Überblicksarbeiten, die einzelne Facetten des hier Beschriebe-nen darstellen, aber nicht in einen Zusammenhang setzen. Auf der anderen Seite liegen ihr eigene Recherchen und Erhebungen zu Weibo-Debatten zu Grunde. Nichtsdestotrotz muss die Validität und Passgenauigkeit der vorgestellten Typolo-gie in weiteren Arbeiten überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden – auch weil sich die Rahmenbedingungen in China kontinuierlich verändern (Liang und Lu 2010). Diese Arbeiten sollten auch untersuchen, welche empirische Verbrei-tung die von uns idealtypisch herausgearbeiteten Öffentlichkeitstypen haben, und welche Wirkungen sie auf Nutzer (Tang und Huhe 2013) oder auch traditionelle Massenmedien (Tang und Sampson 2012) zeitigen.
Dennoch dürfte der generelle Befund unserer Arbeit auch weiteren Prüfungen standhalten: dass es auch unter Bedingungen ausgeprägter staatlicher Kontrolle einflussreiche und – in Grenzen – wirksame Online-Gegenöffentlichkeiten geben
346 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
wird, und dass sich dabei über isolierte Einzelfälle hinaus distinkte Typen derarti-ger Öffentlichkeiten unterscheiden lassen.
Dies hat eine Reihe von Gründen: Erstens scheint es, als ob die Kommerzia-lisierung von Medien- und Kommunikationsangeboten – die in westlichen Län-dern als wesentliches Hemmnis für die Herausbildung gehaltvoller Öffentlichkei-ten gesehen wird – der Entstehung von Öffentlichkeiten in Ländern wie China durchaus förderlich sein kann. Der Fall Weibo kann dies illustrieren: Die hinter Weibo stehende Firma Sina hat als privates Unternehmen, das einem Shareholder Value Modell folgt, an der NASDAQ notiert und auf den Cayman Islands regis-triert ist (Sina Corporation 2013), primär kommerzielle Interessen. Gewinne wer-den vornehmlich durch Werbeeinahmen erzielt, die durch eine hohe Aktivität der Nutzer auf Weibo gesteigert werden können. Schon zu Zeiten von klassischen On-lineforen stellte Yang (2009) fest, „between online activism and the market there exists an unusual synergy“ (S. 15). Entsprechend ist Sina nicht nur daran inter-essiert, Zensuranordnungen der chinesischen Behörden umfassend umzusetzen, sondern auch daran, dauerhaft ein weithin genutztes Forum für Kommunikation anbieten – und dabei versucht Sina, Weibo so offen wie möglich zu halten. Derar-tige Hybrid-Akteure mit ambivalenten Zielsetzungen dürften ein lohnender Ge-genstand weiterer Forschung sein.
Zweitens gibt es auch eine Ambivalenz in den Reaktionen der chinesischen Regierung auf Online-Kommunikation: Während bestimmte Inhalte von Online-Kommunikation identifiziert und entfernt werden sollen (Buckley 2013), versucht man auch, diese Medien als Indikator öffentlicher Meinung nutzbar zu machen. „Data mining“ oder „opinion mining“ in diesen Medien dienen dazu, die Mei-nungen der chinesischen Bevölkerung zu erfassen und gegebenenfalls darauf zu reagieren, mit dem Ziel, die eigene Machtposition zu stabilisieren (Denyer 2013; vgl. Zhang 2006).
Drittens schließlich demonstriert der vorliegende Beitrag die Widerständig-keit von Gesellschaften in autoritären Staaten: Kommunikation und insbesondere Online-Kommunikation – bei der seit dem Aufkommen der Social Media der Austausch mit anderen Bürgern möglich ist – verläuft nicht einseitig von staat-lichen Autoritäten zu einem passiven Publikum. Auch, und vielleicht gerade, in autoritären Staaten müssen Publika als aktive Rezipienten begriffen werden, die sich der vorherrschenden Zensur- und Kontrollpraktiken bewusst sind, sich die-sen anpassen und auf kreative Weise reagieren. Hierfür sind Online-Medien auf-grund ihrer Reichweite – zumindest in China – wohl wirksamer als traditionelle Encounter-Öffentlichkeiten.
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 347
Literatur
Abbott, Jason. 2012. [email protected] Revisited: analysing the socio-political impact of the internet and new social media in East Asia. Third World Quar-terly 33: 333 – 357.
Alexa. 2013. Top Sites in China. The top 500 sites in China. http://www.alexa.com/top-sites/countries/CN (Zugegriffen: 11. Oktober 2013).
Bamman, David, Brendan O’Connor, und Noah Smith. 2012. Censorship and deletion practices in Chinese social media. First Monday 17.
Barboza, David. 2012. Billions in Hidden Riches for Family of Chinese Leader. http://www.nytimes.com/2012/10/26/business/global/family-of-wen-jiabao-holds-a-hidden-fortune-in-china.html (Zugegriffen: 20. Oktober 2013).
BBC. 2013. China’s Beijing airport hit in blast protest. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-23388448 (Zugegriffen: 26. September 2013).
Bloomberg News. 2013. China Reins in Popular Voices With New Microblog Controls. http://www.bloomberg.com/news/2013-09-15/china-reins-in-popular-online-voices-with-new-microblog-controls.html (Zugegriffen: 19. November 2014).
Bradsher, Keith. 2013. China Blocks Web Access to Times After Article. http://www.nytimes.com/2012/10/26/world/asia/china-blocks-web-access-to-new-york-times.html (Zugegriffen: 20. Oktober 2013).
Buckley, Chris. 2013. China Takes Aim At Western Ideas. http://www.nytimes.com/ 2013/08/20/world/asia/chinas-new-leadership-takes-hard-line-in-secret-memo.html?pagewanted=all (Zugegriffen: 19. November 2014).
Calhoun, Craig J., Hrsg. 1992. Habermas and the Public Sphere. Cambridge, Mass, London: MIT Press.
Canaves, S. 2011. China’s social networking problem. Spectrum, IEEE 48: 74 – 77.Chen, Le, Chi Zhang, und Christo Wilson. 2013. Tweeting under pressure: analyz-
ing trending topics and evolving word choice on sina weibo. In COSN ’13 Pro-ceedings of the first ACM conference on Online social networks, Hrsg. Muthu Muthukrishnan, Amr El Abbadi und Balachander Krishnamurthy, 89 – 100. New York: ACM.
China Daily. 2013. Weibo photos show explosion at airport. http://www.chinadaily.com.cn/photo/2013-07/20/content_16806293.htm (Zugegriffen: 25. September 2013).
China Internet Network Information Center. 2013. Dì 32 cì zhōngguó hùlián wăngluò fāzhăn zhuàngkuàng tŏngjì bàogào [32nd Statistical Report on Internet Devel-opment in China].
China Internet Network Information Center. 2014. Jīchŭ shùjù [Basic Data].Dahlberg, Lincoln. 1998. Cyberspace and the Public Sphere. Exploring the Democratic
Potential of the Net. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 4: 70 – 84.
Dahlberg, Lincoln. 2007. Rethinking the fragmentation of the cyberpublic. from con-sensus to contestation. New Media & Society 9: 827 – 847.
Dahlgren, Peter. 2005. The Internet, Public Spheres, and Political Communication. Dispersion and Deliberation. Political Communication 22: 147 – 162.
348 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
Denyer, Simon. 2013. China monitors online chatter as users threaten state hold on the internet. Guardian Weekly.
Donges, Patrick, und Kurt Imhof. 2001. Öffentlichkeit im Wandel. In Einführung in die Publizistikwissenschaft, Hrsg. Otfried Jarren und Heinz Bonfadelli, 101 – 133. Bern, Stuttgart, Wien: Paul Haupt (UTB).
Endeshaw, Assafa. 2004. Internet regulation in China: the never‐ending cat and mouse game1. Information & Communications Technology Law 13: 41 – 57.
Ferree, Myra M., William A. Gamson, Jürgen Gerhards, und Dieter Rucht. 2002a. Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. Theory and Society 31: 289 – 324.
Ferree, Myra Marx, William A. Gamson, Jürgen Gerhards, und Dieter Rucht. 2002b. Shaping abortion discourse. Democracy and the public sphere in Germany and the United States. Cambridge, UK, New York: Cambridge University Press.
Freedom House. 2014. Freedom in the World 2014: Freedom House.FreeWeibo.org. 2013. Uncensored and Anonymous Sina Weibo Search. https://freeweibo.
com/ (Zugegriffen: 29. Oktober 2013).Fu, King-wa, Chung-hong Chan, und Michael Chau. 2013. Assessing Censorship on
Microblogs in China. Discriminatory Keyword Analysis and the Real-Name Registration Policy. Internet Computing, IEEE 17.
Fuchs, Dieter, und Barbara Pfetsch. 1996. Die Beobachtung der öffentlichen Meinung durch das Regierungssystem. In Kommunikation und Entscheidung. Politische Funktionen öffentlicher Meinungsbildung und diskursiver Verfahren (WZB-Jahrbuch), Hrsg. van den Daele, Wolfgang und Friedhelm Neidhardt, 103 – 138. Berlin: edition sigma.
Gerhards, Jürgen. 1993a. Neue Konfliktlinien in der Mobilisierung öffentlicher Mei-nung. Eine Fallanalyse. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Gerhards, Jürgen. 1993b. Westeuropäischen Integration und die Schwierigkeiten der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Zeitschrift für Soziologie 22: 96 – 110.
Gerhards, Jürgen. 1994. Politische Öffentlichkeit. Ein system- und akteurstheoretischer Bestimmungsversuch. In Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Öffentlichkeit und soziale Bewegungen, Hrsg. Friedhelm Neidhardt, 77 – 105. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Gerhards, Jürgen. 1997. Diskursive versus liberale Öffentlichkeit. Eine empirische Aus-einandersetzung mit Jürgen Habermas. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 49: 1 – 34.
Gerhards, Jürgen. 1998. Öffentlichkeit. In Politische Kommunikation in der demokra-tischen Gesellschaft. Ein Handbuch mit Lexikonteil, Hrsg. Otfried Jarren, Ul-rich Sarcinelli und Ulrich Saxer, 268 – 274. Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Gerhards, Jürgen. 2000. Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. In Sonderheft 40 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Die Europäisierung nationaler Gesellschaften, Hrsg. Maurizio Bach, 277 – 305. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 349
Gerhards, Jürgen, und Friedhelm Neidhardt. 1991. Strukturen und Funktionen mo-derner Öffentlichkeit. Fragestellungen und Ansätze. In Öffentlichkeit, Kultur, Massenkommunikation – Beiträge zur Medien- und Kommunikationssoziolo-gie, Hrsg. Stefan Müller-Doohm und Klaus Neumann-Braun, 31 – 89. Olden-bourg: BIS.
Gerhards, Jürgen, Friedhelm Neidhardt, und Dieter Rucht. 1998. Zwischen Palaver und Diskurs. Strukturen öffentlicher Meinungsbildung am Beispiel der deutschen Diskussion zur Abtreibung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Gerhards, Jürgen, und Mike S. Schäfer. 2007. Demokratische Internet-Öffentlichkeit ? Ein Vergleich der öffentlichen Kommunikation im Internet und in den Print-medien am Beispiel der Humangenomforschung. Publizistik 52: 210 – 228.
Gerhards, Jürgen, und Mike S. Schäfer. 2010. Is the Internet a better public Sphere ? Comparing old and new media in Germany and the US. New Media and Soci-ety 12: 143 – 160.
Gerhards, Jürgen, und Mike S. Schäfer. 2012. Terrorismus-Berichterstattung zwischen nationalen Spezifika und globaler Standardisierung. Medien & Kommunika-tion, Sonderband „Grenzüberschreitende Medienkommunikation“: 115 – 140.
Gerhards, Jürgen, und Mike S. Schäfer. 2014. International terrorism, domestic cov-erage ? How terrorist attacks are presented in the news of CNN, Al Jazeera, the BBC, and ARD. International Communication Gazette 76: 3 – 26.
Gerhards, Jürgen, Mike S. Schäfer, Ishtar Al Jabiri, und Juliane Seifert. 2011. Terroris-mus im Fernsehen. Formate, Inhalte und Emotionen in westlichen und arabi-schen Sendern. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaft.
Habermas, Jürgen. 1990. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
He, Baogang, und Mark E. Warren. 2011. Authoritarian Deliberation: The Delibera-tive Turn in Chinese Political Development. Perspectives on Politics 9: 269 – 289.
Hilgartner, Stephen, und Charles L. Bosk. 1988. The rise and fall of social problems. A public arenas model. American Journal of Sociology 94: 53 – 78.
Holdaway, Jennifer. 2013. Environment and Health Research in China: The State of the Field. The China Quarterly 214: 255 – 282.
Huang, Philip C. 1993. „Public Sphere“/„Civil Society“ in China ?: The Third Realm be-tween State and Society. Modern China 19: 216 – 240.
Hui, Li, und Megha Rajagopalan. 2013. At Sina Weibo’s censorship hub, China’s Little Brothers cleanse online chatter. http://www.reuters.com/article/2013/09/12/us-china-internet-idUSBRE98A18Z20130912 (Zugegriffen: 20. Oktober 2013).
Human Rights Watch. 2013. China: Draconian Legal Interpretation Threatens Online Freedom. http://www.hrw.org/news/2013/09/13/china-draconian-legal-inter-pretation-threatens-online-freedom (Zugegriffen: 19. November 2014).
International Telecommunication Union. 2013. Measuring the Information Society 2013.
Ji, Shaoting, Mingwei Hai, und Xiaoqing Xu. 2012. Zhōngguó qīngnián guānzhù zhōnggòng shíbā dà hé měiguó dàxuăn [Chinese youth pays attention to the 18th National Congress of the CPC and the US election]. http://news.xinhuanet.com/world/2012-11/06/c_113621088.htm (Zugegriffen: 10. Oktober 2013).
350 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
Jiang, Min. 2010. Spaces of Authoritarian Deliberation: Online Public Deliberation in China. In The Search for Deliberative Democracy in China, 2. Aufl., Hrsg. Ethan Leib und Baogang He, 261 – 287. New York: Palgrave.
Kaiman, Jonathan. 2013. Chinese police chief suspended after teenage blogger’s arrest: Boy was held for posting ‚rumours‘ about death Angry web users retaliated with posts about officials. The Guardian: 27.
Kim, Young M. 2009. Issue Publics in the New Information Environment: Selectivi-ty, Domain Specificity, and Extremity. Communication Research 36: 254 – 284.
Krüger, Udo Michael. 1998. Zum Stand der Konvergenzforschung im Dualen Rund-funksystem. In Fernsehforschung in Deutschland, Hrsg. Walter Klingler, Gun-nar Roters und Oliver Zöllner, 151 – 184. Baden-Baden: Nomos.
Li, Jian. 2013. Rweibo: An interface to the Weibo open platform.Liang, Bin, und Hong Lu. 2010. Internet Development, Censorship, and Cyber Crimes
in China. Journal of Contemporary Criminal Justice 26: 103 – 120.Liao, Hang-Teng. 2013. How much can one express in 140 characters ? Comparison
between English and other languages like Chinese. http://people.oii.ox.ac.uk/hanteng/2013/04/16/how-much-can-one-express-in-140-characters-compari-son-between-english-and-other-languages-like-chinese/ (Zugegriffen: 19. No-vember 2014).
Liu, Jingfang. 2011. Picturing a green virtual public space for social change. a study of Internet activism and Web-based environmental collective actions in China. Chinese Journal of Communication 4: 137 – 166.
Lu, Rachel. 2012. Weibo reaction to Wen Jiabao’s corruption. http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/10/26/chinese_social_media_reaction_to_wen_jiabaos_cor-ruption (Zugegriffen: 19. November 2014).
MacKinnon, Rebecca. 2011. China’s „Networked Authoritarianism“. Journal of Democ-racy 22: 32 – 46.
Madsen, Richard. 1993. The Public Sphere, Civil Society and Moral Community: A Re-search Agenda for Contemporary China Studies. Modern China 19: 183 – 198.
Marcinkowski, Frank. 2008. Public Sphere. In The International Encyclopedia of Com-munication, Hrsg. Wolfgang Dosenbach, 4041 – 4045. Oxford, Malden: Black-well.
Morozov, Evgeny. 2011. The net delusion. How not to liberate the world. London: Al-len Lane.
Noesselt, Nele. 2014. Microblogs and the Adaptation of the Chinese Party-State’s Governance Strategy. Governance 27: 449 – 468.
Oates, Sarah. 2008. An Introduction to Media and Politics. London: Sage.Oster, Shai. 2013. China’s Rich Want Their Say on Policy Reform. http://www.business-
week.com/articles/2013-08-29/chinas-rich-want-their-say-on-policy-reform (Zugegriffen: 19. November 2014).
Papacharissi, Zizi. 2002. The virtual sphere. the internet as a public sphere. New Me-dia and Society 4: 9 – 27.
Papacharissi, Zizi. 2010. A Private Sphere. Democracy in a Digital Age. Cambridge: Polity.
Neue Öffentlichkeiten in autoritären Gesellschaften ? 351
Pariser, Eli. 2011. The Filter Bubble. What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin.
Qian, Gang, und David Bandurski. 2011. China’s Emerging Public Sphere: The Impact of Media Commercialization, Professionalism, and the Internet in an Era of Transition. In Changing media, changing China, Hrsg. Susan L. Shirk, 38 – 76. New York: Oxford University Press.
Rauchfleisch, Adrian, und Mike S. Schäfer. 2015. Multiple public spheres of Weibo: a typology of forms and potentials of online public spheres in China. Informa tion, Communication & Society 18: 139 – 155.
Rowe, William T. 1990. The Public Sphere in Modern China. Modern China 16: 309 – 329.
Schäfer, Mike S. erscheint 2014. Digital Public Sphere. In The International Encyclo-pedia of Political Communication, Hrsg. Gianpietro Mazzoleni, Kevin Barn-hurst, Ken’ichi Ikeda, Rousiley Maia und Hartmut Wessler, o. S. London: Wiley.
Shoemaker, Pamela J., und Stephen D. Reese. 1995. Mediating the Message. Theories of Influence on Mass Media Content. 2. Auflage. New York: Longman.
Sina Corporation. 2013. Sina Corporation Annual Report 2012.Sina Hubei. 2013. 2013 Shàng bàn niándù húběi qūyù xīnlàng wēibó báipíshū [2013
half year Hubei region Sina Weibo white paper]. http://hb.sina.com.cn/news/d/ 2013-08-26/0845100157.html (Zugegriffen: 20. Oktober 2013).
Sina Technology. 2012. xīnlàng wēibó fābù 2012 niándù pándiăn tuī niándù sān dà rèmén băng dān [Sina Weibo released the 2012 annual three hottest lists]. http://tech.sina.com.cn/i/2012-12-19/13447902817.shtml (Zugegriffen: 20. Oktober 2013).
Sky News. 2013. 20 July, 13:00 Breaking NewsBeijing Airport. Chinese Media: Explo-sion in the arrivals hall of terminal three at Beijing Capital International Air-port.
Sullivan, Jonathan. 2012. A tale of two microblogs in China. Media, Culture & Soci-ety 34: 773 – 783.
Sullivan, Jonathan. 2013. China’s Weibo: Is faster different ? New Media & Society 16: 24 – 37.
Sunstein, Cass. 2001. Republic.com. Princeton & London: Princeton University Press.Sunstein, Cass. 2009. Republic 2.0. Princeton & London: Princeton University Press.Tang, Lijun, und Helen Sampson. 2012. The interaction between mass media and the
internet in non-democratic states: The case of China. Media, Culture & Soci-ety 34: 457 – 471.
Tang, Min, und Narisong Huhe. 2013. Alternative framing: The effect of the Internet on political support in authoritarian China. International Political Science Re-view: 1 – 18.
Wolfsfeld, Gadi, Elad Segev, und Tamir Sheafer. 2013. Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First. The International Journal of Press/Politics 18: 115 – 137.
Xiao, Qiang. 2011. The Battle for the Chinese Internet. Journal of Democracy 22: 47 – 61.Xinhua News Agency. 2013. 1st Ld: Explosion hits Beijing International Airport. Bei-
jing: Xinhua News Agency.
352 Mike S. Schäfer und Adrian Rauchfleisch
Yang, Guobin. 2003. The Internet and the Rise of a Transnational Chinese Cultural Sphere. Media, Culture & Society 25: 469 – 490.
Yang, Guobin. 2009. The power of the Internet in China. Citizen activism online. New York: Columbia University Press.
Yang, Guobin. 2010. Brokering Environment and Health in China: issue entrepreneurs of the public sphere. Journal of Contemporary China 19: 101 – 118.
Yang, Guobin. 2011. The power of the internet in China. Citizen activism online. Paper-back ed. New York: Columbia University Press.
Yang, Guobin. 2013. Contesting Food Safety in the Chinese Media: Between Hegemony and Counter-Hegemony. The China Quarterly 214: 337 – 355.
Yang, Guobin, und Craig J. Calhoun. 2007. Media, Civil Society, and the Rise of a Green Public Sphere in China. China Information 21: 211 – 236.
Zhang, Lena L. 2006. Behind the ‚Great Firewall‘: Decoding China’s Internet Media Poli cies from the Inside. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 12: 271 – 291.
Zheng, Yongnian, und Guoguang Wu. 2005. Information Technology, Public Space, and Collective Action in China. Comparative Political Studies 38: 507 – 536.
Zhu, Tao, David Phipps, Adam Pridgen, Jedidiah R. Crandall, und Dan S. Wallach. 2013. The Velocity of Censorship: High-Fidelity Detection of Microblog Post Deletions. arXiv preprint.
Zimmermann, Ann. 2008. Demokratisierung und Europäisierung online ? Massen-mediale politische Öffentlichkeiten im Internet. Dissertation. Berlin.