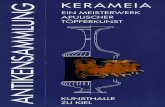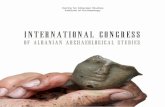Die Entwicklung der Nephridien und Gonoblasten bei Tubifex ...
Bildung für nachhaltige Entwicklung zwischen Kompetenzentwicklung und Werteorientierung
-
Upload
uni-vechta -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bildung für nachhaltige Entwicklung zwischen Kompetenzentwicklung und Werteorientierung
Bildung für nachhaltige Entwicklung zwischen Kompetenzentwicklung und Werteorientierung
Tagung „Normativität, Positionierung, Reflexivität: (Selbst)Kritische Perspektiven“
26.-27. März 2015, Münster
Prof. Dr. Marco RieckmannInstitut für Soziale Arbeit,
Bildungs- und Sportwissenschaften
26.03.2015 1Marco Rieckmann
Nachhaltige Entwicklung
„Große Transformation“ (WBGU 2011):„Es geht um einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung. […] Der Gesellschaftsvertrag kombiniert eine Kultur der Achtsamkeit (aus ökologischer Verantwortung) mit einer Kultur der Teilhabe (als demokratische Verantwortung) sowie mit einer Kultur der Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen (Zukunftsverantwortung)“ (WBGU 2011: 2)gesellschaftlicher Verständigungs-, Lern- und Gestaltungsprozess
26.03.2015 3Marco Rieckmann
Bildung für nachhaltige Entwicklung …
… macht durch die Zielorientierung an der Vision einer sich nachhaltig entwickelnden Gesellschaft die eigene Zukunft zum sinnstiftenden Moment von Bildungsprozessen.… eröffnet den Diskurs über gesellschaftliche Werte und erstreckt sich nicht im Nachvollziehen anerkannter gesellschaftlicher Normen, sondern umfasst das Erlernen des Umgangs mit vielen, auch einander widersprechenden Wertvorstellungen. … unterstützt und fördert die Entwicklung sehr anspruchsvoller Kompetenzen – Kompetenzen, die in der derzeitigen Generation der Erwachsenen höchst defizitär ausgeprägt sind. Ohne diese Kompetenzen sind die vorher umrissenen Bildungsziele nicht zu erreichen.
Rost 2001
26.03.2015 4Marco Rieckmann
BNE 1 / instrumentelle BNE
Förderungen von Verhaltensänderungen
Förderung von Verhaltens- und Denkweisen, wo deren Notwendigkeit klar identifiziert und unumstritten istLernen für nachhaltige Entwicklung
BNE 2 / emanzipatorische BNEEntwickeln der Fähigkeit, kritisch über Expertenmeinungen nachzudenken und Ideen einer nachhaltigen Entwicklung zu prüfenEntdecken der Widersprüche eines nachhaltigen Lebens
Lernen als nachhaltige Entwicklung
Strömungen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung
Vare / Scott 2007; Wals 2011
26.03.2015 5Marco Rieckmann
Plädoyer für BNE 2 / emanzipatorische BNE
pädagogische Perspektive spricht für BNE 2 (vgl. Vare/Scott 2007) bzw. den „emancipatory approach“ (vgl. Wals 2011).„Pädagogik hat ihre Grenzen in der Ermöglichung nachhaltigen und gerechten Handelns. Wie sich die Handlungen der Kinder und Jugendlichen letztendlich ausgestalten, dafür kann und soll die Pädagogik eine Verantwortung jenseits des schulischen Kontextes nicht übernehmen. Zentral bleibt nur, dass die Edukanden Kenntnis davon haben, was es heißt nachhaltig und gerecht zu handeln, und abschätzen können, welche Auswirkungen jeweils das nachhaltige und nicht-nachhaltige, das gerechte und das nicht-gerechte Handeln für sie und andere haben. Die Bewertung dieser Auswirkungen hingegen […] darf Schule ihnen nicht vorgeben“.
de Haan et al. 2008: 123
26.03.2015 6Marco Rieckmann
Bildung für nachhaltige Entwicklung …
„… ermöglicht es dem Individuum, aktiv an der Analyse und Bewertung von nicht nachhaltigen Entwicklungsprozessen teilzuhaben, sich an Kriterien der Nachhaltigkeit im eigenen Leben zu orientieren und nachhaltige Entwicklungsprozesse gemeinsam mit anderen lokal wie global in Gang zu setzen.“
de Haan 2008
Zentrales Bildungsziel: Erwerb von nachhaltigkeitsrelevanten Schlüsselkompetenzen („Gestaltungskompetenz“)
26.03.2015 7Marco Rieckmann
Kompetenz zur PerspektivübernahmeKompetenz zur AntizipationKompetenz zur disziplinenübergreifenden ErkenntnisgewinnungKompetenz zum Umgang mit unvollständigen und überkomplexen InformationenKompetenz zur KooperationKompetenz zur Bewältigung individueller EntscheidungsdilemmataKompetenz zur PartizipationKompetenz zur MotivationKompetenz zur Reflexion auf LeitbilderKompetenz zum moralischen HandelnKompetenz zum eigenständigen HandelnKompetenz zur Unterstützung anderer
Gestaltungskompetenz
de Haan et al. 2008
26.03.2015 9Marco Rieckmann
Schlüsselkompetenzen für Globales Denken und Handeln in der Weltgesellschaft
Kompetenz zum vernetzten Denken und Umgang mit KomplexitätKompetenz zum vorausschauenden DenkenKompetenz zum kritischen DenkenKompetenz zum gerechten und umweltverträglichen HandelnKompetenz zur Zusammenarbeit in (heterogenen) GruppenKompetenz zur PartizipationKompetenz zu Empathie und PerspektivwechselKompetenz zum Interdisziplinären ArbeitenKompetenz zu Kommunikation und MediennutzungKompetenz zur Planung und Umsetzung innovativer Projekte und VorhabenBewertungskompetenzKompetenz zur Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz
Rieckmann 2010
26.03.2015 10Marco Rieckmann
Wertorientierung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
nachhaltige Entwicklung als gesellschaftlicher Lern-, Verständigungs- und Gestaltungsprozess (vgl. Michelsen 2007)Teil des Prozesses, sich auf bestimmte Wertorientierungen zu verständigen (vgl. Wals 2011)Nachhaltigkeit keine „theory about everything“ (vgl. Ott/Döring 2004)Bildung für nachhaltige Entwicklung ist nicht beliebigOrientierung an den Ideen der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit markiert (vgl. de Haan 2008)wertbezogene Ziel, zu einer „Sensibilisierung für eine Überlebensverantwortung“ (Mokrosch 2008: 38) beizutragen
26.03.2015 11Marco Rieckmann
Wertorientierung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
Auseinandersetzung mit Werthaltungen, die mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung verbunden sind (Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Menschenwürde und Gerechtigkeit) (vgl. Stoltenberg 2009)Beitrag zur „Werteklärung“ (Mokrosch 2008: 36) und damit zu einem kritischen Wertediskurs (vgl. Rieckmann et al. 2014)Anregungen, die eigenen Werte zu reflektieren und Stellung zu nehmen in der Wertedebatte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung (vgl. Barth 2012) Beitrag zur Erweiterung des Wertehorizonts der Lernenden (z.B. lateinamerikanische Diskurse zum Buen Vivir (Gutes Leben) und zu den Rechten der Natur)„Wertewandel zur Nachhaltigkeit“ (vgl. WBGU 2011) Entwicklung einer reflexiven Kompetenz
26.03.2015 12Marco Rieckmann
Bekenntnis zum Bürgersinn und den Tugenden eines guten Staatsbürgers, der sein Handeln unter einen Legitimitätsvorbehalt stellt und am Gemeinwohl ausrichtet.Republikanisch-liberaler
Bürgerethos
Moralische Urteils- und Entscheidungsfähigkeit
• Reflexionsbereitschaft• Verständigungs-
bereitschaft
Fähigkeit zur Reflexion, Beurteilung und Entscheidung auch komplexer, kontroverser Entscheidungssituationen mit normativem Gehalt.
Moralisches WissenMoralische Urteilsfähigkeit
Schlüsselkompetenzen für nachhaltige Entwicklung
Bündel an Schlüsselkompetenzen, die die Individuen zur Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung, zur ökonomischen „Mythenjagd“ und einer nachhaltigen Lebensführung befähigt.
Schlüsselkompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung der Weltgesellschaft
Wirtschaftlicher Sachverstand und entsprechende Fachkompetenzen
Konstitute des „Nachhaltigkeitsbürgers“
Moralischer MutMoralische
Reflexionskompetenz
KompromissbereitschaftLegitimationsbereitschaft
Rieckmann / Schank
26.03.2015 13Marco Rieckmann
Didaktische Gestaltung
Kritischer WertediskursGelegenheiten zur expliziten Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sowie unterschiedlichen Werthaltungen Kompetenzentwicklung als Erfahrungslernen bzw. als situiertes Lerneneigenständiges Handeln der LernendenErmöglichung der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen Reflexion von normativen und moralischen Fragen
26.03.2015 14Marco Rieckmann
Überfrachtung des Individuums?
Hohe Verantwortung des Individuums für die Bewältigung von gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsproblemen, z.B. in seiner Rolle als (nachhaltige_r) Konsument_inMögliche Überfrachtung des Individuums und einer Marginalisierung der öffentlichen Verantwortung der politischen Akteure ebenso wie der Rolle der (multinationalen) Unternehmenüberfordern die Komplexität und Unsicherheit, die mit nachhaltigkeitsrelevanten Entscheidungen verbunden sind, die Individuen –ihnen fehlt häufig das erforderliche WissenZweitens können selbst bei vermeintlich eindeutig nachhaltigen Verhaltensweisen trade offs auftreten. Drittens wird die Trennung in eine öffentliche und eine private Sphäre aufgeweicht
vgl. Grunwald 2010
26.03.2015 15Marco Rieckmann
Überfrachtung des Individuums?
Dominanz und Permanenz von gesellschaftlichen Strukturen und kulturellen Mustern„Wir werden niemals Nachhaltigkeit schaffen, während wir ins gegenwärtige Finanzsystem verstrickt sind. Keine Steuer, kein Zinssatz und keine Veröffentlichungspflicht können die vielen Hindernisse beseitigen, mit denen das gegenwärtige Geldsystem Nachhaltigkeit blockiert“ (Meadows in Lietaer et al. 2013: 19f.).Bedeutung struktureller FragenNicht nur die individuelle Ebene ist zu fokussieren, sondern auch die Frage nach den Strukturen, nach der „Großen Transformation“ (vgl. WBGU 2011). Nachhaltigkeit ist keine Privatsache, sondern eine öffentliche Aufgabe (vgl. Grunwald 2010).
26.03.2015 16Marco Rieckmann
Geteilte Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung
Durch die Entwicklung von nachhaltigkeitsrelevanten Schlüsselkompetenzen, Reflexion von strukturellen Barrieren sowie die Auseinandersetzung mit einem mehrdimensionalen Beziehungs- und Verantwortungsgeflecht können Individuen befähigt werden, an der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken.Gleichzeitig sollte Bildung für nachhaltige Entwicklung aber auch Prozesse sozialen Lernens befördern (vgl. Wals 2011; Barth 2012). Hier gilt es dann auch, Verantwortungsträger der Makro- und der Mesoebene, sprich (über-)staatliche Akteure und private Organisationen wie Unternehmen, sowie das Spannungsverhältnis zwischen ihnen in den Blick zu nehmen.
26.03.2015 17Marco Rieckmann
FazitEinbettung von Schlüsselkompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung, die für sich allein auch als instrumentell und wertfrei charakterisiert werden können, in einen normativ-ethischen Rahmen Eine ausschließliche Fokussierung individueller Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung ist kritisch zu betrachten. Die Auseinandersetzung mit strukturellen Fragen und der geteilten Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung sollte ein wesentlicher Bestandteil von Bildung für nachhaltige Entwicklung sein. Nur so kann erreicht werden, dass es weder zu einer unzulässigen noch zu einer unzweckmäßigen Überfrachtung des Individuums kommt.
26.03.2015 18Marco Rieckmann
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Prof. Dr. Marco RieckmannJuniorprofessor für Hochschuldidaktik,
Schwerpunkt SchlüsselkompetenzenInstitut für Soziale Arbeit, Bildungs- und
Sportwissenschaften
Fon +49. (0) 4441.15 481E-Mail [email protected]
26.03.2015 19Marco Rieckmann
LiteraturBarth, M. (2012): Social Learning Instead of Educating the Other, in: GAIA, Vol. 19/No. 3, 91–94.de Haan, G. (2008): Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Bormann, I./Haan, G. de (Hrsg.): Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Operationalisierung, Messung, Rahmenbedingungen, Befunde. Wiesbaden, S. 23–43.de Haan, G. et al. (Hrsg.) (2008): Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Grundlagen und schul-praktische Konsequenzen. Berlin, Heidelberg.Grunwald, A. (2010): Wider die Privatisierung der Nachhaltigkeit. Warum ökologisch korrekter Konsum die Umwelt nicht retten kann, in: GAIA, Jg. 19/Heft 3, 178–182.Mokrosch, R. (2008): Zum Verständnis von Werte-Erziehung: Aktuelle Modelle für die Schule, in: Mokrosch, R./ Regenbogen, A. (Hrsg.): Werte-Erziehung und Schule. Ein Handbuch für Unterrichtende, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 32–40.Rieckmann, M. (2011): Schlüsselkompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung der Weltgesellschaft: Ergebnisse einer europäisch-lateinamerikanischen Delphi-Studie. In: Gaia 20 (1), S. 48–56. Rieckmann, M./Fischer, D./Richter, S. (2014): Nachhaltige Ernährung im Wertediskurs – Beiträge einer Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung, in: Schank, C./Vorbohle, K./Quandt, J.H. (Hrsg.): Perspektive Nahrungsmittelethik. München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 29–58.Rost, Jürgen (2002): Umweltbildung - Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was macht den Unterschied? In: ZEP - Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 25(1), S. 7-12
26.03.2015 20Marco Rieckmann
LiteraturVare, P./Scott, W. (2007): Learning for a Change: Exploring the Relationship between Education and Sustainable Development. In: Journal of Education for Sustainable Development, 1. Jg., Heft 2, S. 191–198.Wals, A. E. J. (2011): Learning Our Way to Sustainability. In: Journal of Education for Sustainable Development 5 (2), S. 177–186.WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2011): Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Zusammenfassung für Entscheidungsträger, Berlin.Wiek, A./Withycombe, L./Redman, C. L. (2011): Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. In: Sustainability Science 6 (2), S. 203–218.