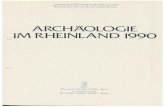Die Entwicklung der Christlichen Archäologie in Slowenien
Transcript of Die Entwicklung der Christlichen Archäologie in Slowenien
~,~ ISSN 003'5-7812
fiir Chrlstliche Altertumskunde und Kirchengeschichte
IMAUFTRAGE
des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico in Rom und des Romischen Instituts der Gorres-Gesellschaft
IN VERBINDUNG MIT
Wolfgang Bergsdorf, Thomas Brechenmacher, Dominik Burkard, Jutta Dresken-Weiland,
Pius Engelbert, Stefan Heid, Paul Mikat, Rudolf Schieffer
HERAUSGEGEBEN VON
Erwin Gatz und Theofried Baumeister
BAND 105, HEFT 1-2
'.
2010
HERDER
ROM FREIBURG WIEN
INHALT
Tagung zur Geschichte der Christlichen Archaologie I (Osteuropa) RAJKO BRATOŽ: Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowe-
n1en ................................... . BRANKA MrcoTTr: Die Geschichte der friihchristlichen Archaologie in
N ordkroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMILIO MARIN: Christliche Archaologie in Kroatien - Personen und
Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETER TusoR: Christliche Archaologie und Christliche Archaologen in
Ungarn ................................. . ALBERT Ovmru: Ion Barnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMIL IVANOV: Die Entwicklung der theologischen Schule der Christlichen
Archaologie in Bulgarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HRISTO PRESHLENOV: Friihchristliche Archaologie an der bulgarischen
Schwarzmeerkiiste (1878-2008) .................. . ELZBIETAjASTRZJ?BOWSKA: Christliche Archaologie in Polen .... . Bo:ZENA lwASZKIEWICZ-WRONIKOWSKA: Christliche Archaologie m
Polen - Ein historischer Abriss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EuGENIA CHALKIA: Geschichte der Christlichen Archaologie in Grie
chenland - ein Uberblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERNST DASSMANN und GERHARD REXIN: Christliche Archaologie in Bonn
REZENSIONEN
THEOFRIED BAUMEISTER: Juliane Ohm, Daniel und die Lowen HELMUT MoLL: Andreas Resch, Wunder der Seligen 1991-1995
Redaktion: Erwin Gatz
Redaktionsassistenz: Jutta Dresken-Weiland
1
3
22
32
45 52
61
78 106
121
129 143
163 167
Die »Rčimische Quartalschrift« erscheint in der Rege! jahrlich in zwei Doppelheften. Umfang eines jeden Doppelheftes ca. 144 Seiten. Preis pro Doppelheft 90,-€; Jahres-Abonnement 178,-€, ermalligtes Jahres-Abonnement fiir private Bezieher 148,- €. Manuskripte und Rezensionsexemplare an die Redaktion der » Rčimischen Quartalschrift«, Via della Sagrestia, 17, I-00120 Citta del Vaticano. Nichtangeforderte Biicher werden angezeigt. Besprechung erfolgt nach Tunlichkeit, Riicksendung nur, wenn Porto beiliegt. - Abkiirzungen und Sigla richten sich - soweit nicht eigens
angezeigt- nach dem »Lexikon fiir Theologie und Kirche«, 3. Aufl. Bd. 11.
VERLAG HERDER FREIBURG IM BREISGAU
Satz: SatzWeise, Fčihren Druck: fgb · freiburger graphische betriebe 2010
Bestellnummer 00160
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien
Von RAJKO BRATOŽ
Wegen der ausdriicklichen Diskontinuitat zwischen Spatantike und friihem Mittelalter auf fast dem gesamten Territorium des heutigen Sloweniens hat sich kein materielles Zeugnis aus der friihchristlichen Zeit erhalten, das ununterbrochen von der Spatantike bis in die heutige Zeit seinem urspriinglichen oder einen veranderten Zweck gedient hatte. Den Untergang der romischen Stadte, die schon im 5. Jh., zur Zeit der germanischen und hunnischen Bewegungen, hart betroffen wurden, sowie den Verfall der Hohensiedlungen im spaten 6. Jh. zur Zeit der slawischen und awarischen Angriffe iiberlebte in situ kein Objekt aus der friihchristlicher Zeit, nicht einmal im slowenischen Teil der Kiiste Istriens, der von der Mitte des 6. Jh. bis zum spaten 8. Jh. einen Teil des byzantinischen Italien darstellte. Ebenso iiberliefern die schriftlichen Quellen keine brauchbaren Angaben. In der christlichen Literatur der Spatantike wird nur ein Kirchenbau auf diesem Territorium erwahnt, und zwar von Theodoretos von Kyrrhos in Zusammenhang mit der Beschreibung der Schlacht am Frigidus im Jahre 394, im oberen Vipavatal in Westslowenien. Weil sich diese Notiz aber in einem stark hagiographisch stilisierten Passus seiner Kirchengeschichte befindet, kann der Beleg nicht als historisch eingestuft werden 1
• Den Autoren der wenigen mittelalterlichen Texte aus diesem Gebiet, sowohl hagiographischen als historischen, war kein solches Objekt bekannt2
• Die ersten Sammlungen antiker Inschriften von der Zeit des Humanismus bis zum friihen 19. Jh. beinhalten keine friihchristliche Inschrift, ebenso war kein Objekt oder Gegenstand aus der friih-
1 Theodoretos, Hist. eccl. 5, 24, 4 (GCS NF 5 [Berlin 1998] 325,2). In der Nacht vor der Schlacht am Frigidus sollte Theodosius in einer Kapelle (oikiskon eukterion) auf dem Berggipfel, wo sich sein Militarlager befand, beten. Rufinus (hist. eccl. 11(2) 33), Sokrates (hist. eccl. 5,25) und Sozomenos (hist. eccl. 7,24,4), aus denen Theodoret schiipfte, erwahnen jedoch das Gebet Kaisers auf dem Schlachtfeld nach dem ersten, fiir Theodosius verlustreichen Teil der Schlacht, wobei Rufinus als Ort des Geschehens einen hohes Fels (in edita rupe) auf dem Schlachtfeld erwahnt. Theodoret erwahnt das Gebet des Kaisers auf dem Schlachtfeld nicht, jedoch sein Gebet und die nachtliche Vision in der Kapelle auf dem Berggipfel. Es handelt sich offensichtlich um eine Erfindung des syrischen Historikers. In der Kirchengeschichte des Theodoros Anagnostes (Lectar), einer Kompilation aus Sokrates, Sozomenos und Theodoretos, und in ihrer lateinischen Ubersetzung, die als Cassiodors „Historia ecclesiastica tripartita" bekannt ist, finden sich beide Szenen: zuerst das Gebet Kaisers in der Kapelle (in quodam mante oratorium invenisset, nach Theodoret), in der Fortsetzung jedoch (nach Sokrates und Sozomenos) sein Gebet auf dem Schlachtfeld nach dem ersten verlustreichen Tei! der Schlacht (Hist. eccl. trip. 9,45,9 [CSEL 71, 574]). 2 R. BRATOŽ, Lo sviluppo degli studi di antichita cristiana nella odierna Slovenia dagli inizi ai nostri giorni. Rassegna bibliografica, in: Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e Storia Patria N.S. 34 (86 der Reihe) (1986) 21-47 (23f).
4 Rajko Bratož
christlichen Zeit den lokalen Chronisten und Kirchenhistorikern des 17. und 18. Jh. bekannt3
• Bis zur Mitte des 19. Jh. existierte auf dem Territorium Sloweniens keine materielle Hinterlassenschaft aus der friihchristlichen Zeit, die als solche erkannt wurde.
Die chronologisch konzipierte Ubersicht der friihchristlichen Archiiologie auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens folgt dem Grundsatz der „Prosopd~raphie der Christlichen Archiiologie", nach dem nur die verstorbenen Forscher beriicksichtigt werden, wobei jene unter ihnen, die in der „Prosopographie" mit eigenem Stichwort vorgestellt werden, bei der ersten Erwiihnung mit Sternchen c:·) versehen werden. Einem kurzen Uberblick der Hauptergebnisse leitender Archiiologen vergangener Generationen folgt eine zusammenfassende Einschiitzung des derzeitigen Forschungstandes.
1. Die Anfange (von der Mitte des 19. Jh. bis 1918)
a. Zufallige Funde
Die zweite Halfte des 19. Jh. und der Anfang des 20. Jh. sind die Zeiten der wichtigen Zufallsfunde von Gegenstiinden aus der friihchristlichen Epoche. Im Juni 1858 wurden bei Bauarbeiten fiir die Eisenbahn in Rogoznica, am Ostrand der Stadt Ptuj (Pettau), zwei bronzene friihchristliche Kerzenleuchter gefunden. In beiden Fiillen bildet die Basis des Leuchters ein Christogramm (Durchmesser 6,1 bzw. 8,2 cm) mit einer eingeritzten Inschrift. Am oberen Teil des Christogramms ist im ersten Fall ein Leuchteruntersatz befestigt, im zweiten Fall aber wachsen aus dem oberen Teil des Christogramms zwei Arme als Untersatz fiir zwei Kerzenleuchter (Abb. 1). Die beiden Objekte (heute im Kunsthistorischen Museum in Wien, Antikensammlung, Inv. Nr. VI 727-728) sind bis heute ohne sichere Parallelen. Ihre Datierung (2. Hiilfte des 4. Jh. [?]) und ihre Zweckbestimmung (Votivgabe, Grabinventar, liturgisches Geriite) sind nicht genau bekannt4
•
' V. KOLŠEK - J. ŠAŠEL, Zupančičev rokopis celejanskih spomenikov iz leta 1812 [Handschrift!iches Verzeichnis romischer Antiken ~us Celje vom 1812], in: Arheološki vestnik 34 (1983) 399-407; BRATOŽ (Anm. 2) 24-31; M. SAŠEL Kos, The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia, Situla 35 (Ljubljana 1997) 20-51. 4 CIL III 4098/1-2; ILCV 1922/a-b; W; ScHMID, Ptujske krščanske starosvetnosti [Friihchrist!iche Denkmaler in Poetovio], in: Casopis za zgodovino in narodopisje 31 (1936) 97-115 (108); V. HoFFILLER - B. SARIA, Antike Inschriften aus Jugoslavien (im Folgenden AIJ) (Zagreb 1938) 443-444; J. KLEMENC, Starokrščanska svetišča v Sloveniji [Altchrist!iche Heiligtiimer in Slowenien], in: Arheološki vestnik 18 (1967) 111-135 (120f.); P. KOROŠEC, Starokrščanska svečnika iz Rogoznice v Ptuju [Zwei altchrist!iche Kandelaber aus Rogoznica in Ptuj], in: Arheološki vestnik 31 (1980) 55-61; E. T6TH, „Et lux perpetua luceat ei", in: Romisches Osterreich 17-18 (1989-1990) 261-279; T. KNIFIC - M. SAGADIN (Hg.), Pismo brez pisave-Carta sine litteris (Ljubljana 1991) 48; R. BRATOŽ-S. CrGLENEČKI, L'odierna Slovenia, in: Antichita Altoadriatiche 47 (2000) 489-531 (507); G. Cuscno, Bronzi paleocristiani di Aquileia, in: Antichita Altoadriatiche 51 (2002) 379-414 (389-392); R. BRATOŽ (unter Mit-
(,' - • (! . \Jl(,,~,;1,\_'\\\ o ~ ,g,"'"-'\. f'\
;(' '")) r
\.\ C n\ r'1_,„y\~ !"~V'--"
1(f"C' ( /L C,t: V ;1) 1~) d
Ar,.,,._
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 5
Abb. 1: Der friihchristliche Kerzenleuchter mit zwei Armen aus Rogoznica
Wahrend der prahistorisch orientierten Forschungen von Carlo Marchesetti in den Grotten von Škocjan in Westslowenien (zwischen 1886 und 1902) wurden in „Tominčeva jama" (Tominz-Grotte) friihchristliche Gegenstande gefunden: ein schlecht erhaltenes bronzenes Christogramm (Durchmesser 8,6 cm), zwei vollstandig erhaltene friihchristliche Tonlampen (eine mit dem Motiv der Menorah) und die Fragmente von mindestens sechs anderen Tonlampen. Alle Gegenstande befinden sich im Stadtmuseum in Triest (Civico Museo di Storia ed Arte, Triest, Inv. Nr. 11096)5
•
Schon 1892 wurden in Ljubljana Fragmente der ersten wahrscheinlich friihchristlichen Grabinschrift aus dem 4. Jh. gefunden6
• In den Jahren 1911-1912 entdeckte Walter Schmid~- (1875-1951) wahrend der Ausgrabungen im Siidbereich des antiken Emona friihchristliche Gegenstande: in der sog. Insula 12
arbeit von T. KNIFIC), Cristianesimo antico ne! territorio della Slovenia, in: A. TILATTI (Hg.), La cristinizzazione degli Slavi nell'arco alpino orientale (secoli VI-IX) (Roma - Gorizia 2005) 109-143 (137); M. LAUBENBERGER, Candeliere a una luce; Candeliere a due luci, in: S. PrnssI (Hg.), Cromazio di Aquileia 388-408 al crocevia di genti e religioni [Katalog der Ausstellung Udine Nov. 2008-Marz 2009] (Milano 2008) 458 (Abb. X.18-19); 466 (Kommentar). 5 C. MARCHESETTI, Ricerche preistoriche nelle caverne di San Canziano presso Trieste, in: Bolletino della Societa Adriatica di Scienze Naturali 11(1889)1-19; A. DEGRASSI, Scritti vari di antichita II (Roma 1962) 732-735 (N achdruck des Beitrags: Le grotte carsiche in eta romana, in: Le Grotte d'Italia 3 [1929] 166-171), mit Abb. von beiden gut erhaltenen Tonlampen und dem fragmentarisch erhaltenen Christogramm; KNIFIC - SAGADIN (Anm. 4) 28 Abb. 67 (Christogramm); M. VmuLLI ToRLO, Lucerna ebraica, in: PrnssI (Anm. 4) 168 (V. 22: Abbildupg der Ollampe mit Menorah); 173 (Kommentar). 6 SAŠEL Kos (Anm. 3) Nr. 76 (251 ff. [= CIL III 14354,18]); von den verstorbenen zwei Kindern hatte loannes einen biblischen Namen, wahrend der Name seines Bruders, Marcellinus, im 4. Jh. unter Christen verbreitet war; vgl. J.-P. CAILLET, L'evergetisme monumental chretien en Italie et a ses marges (= Collection de l'Ecole frarn;:aise de Rome 175) (Rome 1993) 367 (Celeia); in Grado und Emona als Frauenname Marcellina (ebd. 196 und 375f).
I 1
6 Rajko Bratož
im J ahre 1911 ein Christogramm aus Bronze (Durchmesser 9 cm, Hohe 13,2 cm) aus dem 4. Jh. sowie drei Tonlampen; in der sog. Insula 9 im Jahre 1912 ein Bronzetafelchen (1,4 x 9,5 cm) aus dem 4. Jh. mit der Inschrift „Pardus vivas in Deo". Die Gegenstande befinden sich im Kunsthistorischen Museum in Wien (Christogramm Inv. Nr. VI 4499, Tonlampen Inv. Nr. V 2803, Bronzetafelchen Inv. Nr. VI 4502)7.
b. Die Ausgrabungen in Celeia und Emona
Die ersten friihchristlichen Ausgrabungen auf dem Territorium Sloweniens fanden im Jahre 1897 in Celje statt. Im Ostteil der antiken Stadt Celeia wurden bei Fundamentausschachtungen fiir das Postgebaude nordwestlich des Bahnhofs Reste einer friihchristlichen Kirche gefunden: Dies waren die Apsis mit Priesterbank und Apsisumgang hinter der Bank sowie ein Tei! des Hauptschiffs. Die Kirche war mindestens 29 m (bis maximal ca. 35 m?) lang und mehr als 13 m breit, wobei die Ma6e der Seitenraume nicht bekannt sind. Von den Bodenmosaiken im Hauptschiff und im Apsisumgang (bJpht,!latoriuµi) sind 13 Stifterinschriften erhalten geblieben. Die Ausgraber Emanuel Riedl und Georg Schon haben die Ergebnisse bald nach ihrer Grabungstatigkeit publiziert8
• Wahrend E. Riedl das nordwestlich von der Kirche gelegene Gebaude mit Apsis in eine altere Epoche datierte, setzte sich spater jedoch die Ansicht durch, da6 beide Bauten gleichzeitig entstanden seien und ein Bischofzentrum mit Doppelkirchenanlage bildeten 9 • Eine neuerliche Uberpriifung der Befunde fiihrte dann zu
7 J. DosTAL, Ein Bronzemonogramm Christi aus Emona, in: RQ 28 (1914) 187-194;]. KLEMENC, Krščanstvo v Emoni [Das Christentum in Emona], in: Nova pot 14 (1962) 349-360; DERS. (Anm. 4) 132f (die Abb. des Christogramms steht auf dem Kopf); R. NoLL, Zwei unscheinbare Kleinfunde aus Emona, in: Arheološki vestnik 19 (1968) 79-88 (84-87: Christogramm, Tonlampe, Bronzet~felchen mit dem Vermerk, dass der Name Pardus auch in Aquileia belegt ist); A. ET J. SAŠEL, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt, Situla 19 (Ljubljana 1978) 1103 (Christogramm); 1104 (Pardus-Inschrift mit dem Lesungsvorschlag von W. Schmidt [Coipus vives in Deo] die sich auf die gleiche oder auf eine andere Inschrift bezieht); KNIFIC - SAGADIN (Anm. 4) 49 (Nr. 3, Christogramm). ' E. RIEDL, Reste einer alt-christlichen Basilica im Boden Celeja's, in: Mittheilungen der k.k. Zentral- Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmaler, NF 24 (Wien 1898) 219-225 (mit Tafel); G. ScHČ>N, Mosaikinschriften aus Cilli, in: Jahreshefte des Osterreichischen archaologischen Institutes 1. Beiblatt (Wien 1898) 29-36. Spatere wichtigere Darstellungen: CIL III Suppl. 4, 14368 (8-20); J. ZEILLER, Les origines chretiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire romain (Paris 1918) 179; 184f.; H. LECLERCQ, Illyricum, in: DACL 7,1 (1926) 123-127 Abb. Nr. 5780-5784; ILCV 1873-1876; HoFFILLER - B. SARIA (Anm. 4) 63-73; KLEMENC (Anm. 4) 124-130; B. DJURIC, Antični mozaiki na ozemlju SR Slovenije [Les mosai:ques antiques sur le territoire de la R. S. de Slovenie], in: Arheološki vestnik 27 (1976) 537-625 (552ff.) Taf. XIVb-XXI. Die Darstellungen der Kirche von Celeia bis 1984 basieren ausschlieBlich auf den Ergebnissen von E. Riedl und G. Schon, bibliographische Angaben bei CAILLET (Anm. 6t356f. 9 KLEMENC (Anm. 4) 124f.; ahnlich J. SAŠEL, in: Celeia, RE Suppl. 12 (1970) 139-148 (hier 147) = DERS„ Opera selecta, Situla 30 (Ljubljana 1992) 587; P. PETRU - Ttt. ULBERT, Vranje
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 7
einer Bestatigung der These Riedls: Die Reste des nordlichen kleineren Gebiiudes gehoren zu einer Badeanlage aus dem 2. und 3. Jh. 10
, wiihrend die Kirche mit ihren Mosaiken um 400 oder zumindest in der ersten Hiilfte des 5. Jh. entstanden ist; diese Datierung wird durch vergleichbare Bauten, wie die Kirche in Beligna bei Aquileia und die Bischofskirche von Salona unterstiitzt11
•
Past ein Jahrhundert nach den Ausgrabungen von E. Riedl und G. Schon haben neue Entdeckungen das Bild des christlichen Celeia wesentlich vervollstiindigt: es geht um das Baptisterium (9 m x 8,40 m) aus der Zeit um 400 mit einem achteckigen Taufbecken (iiuBerer Durchmesser 1,60 m, innerer Durchmesser 1,20 m) mit Resten einer Marmorverkleidung und Baldachinanlage12
•
Die Entdeckung dieses Bauwerks warf erneut die Prage nach der Gestalt des Kirchenzentrums von Celeia auf. Das Baptisterium gehorte allem Anschein nach nicht zur Basilika, die von Riedl und Schon entdeckt wurde, da es von ihr zu weit entfernt lag (bis 100 m). Wahrscheinlich gehorte es zu einer anderen, noch nicht entdeckten Kirche, die siidlich oder besser siidwestlich von der ersten Kirche lag. Das Kirchenzentrum von Celeia hiitte in diesem Pall aus einer Doppelkirchenanlage mit Baptisterium bestanden. Preilich ist dies lediglich eine Arbeitshypothese, die sich jetzt nicht nachpriifen liiBt13
• Die friihchristlichen Kleinfunde sind nicht zahlreich 14
•
Aus den Kirchen von Celeia stammen wahrscheinlich auch zwei Christogramme, die als Teile von Kerzenleuchtern anzusprechen sind und in die Zeit
pri Sevnici. Starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu- Vranje bei Sevnica. Priihchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski gradec (Ljubljana 1975) 63ff. (eine Vermutung, die sich nicht nachpriifen lalh); DJURIC (Anm. 8) 553. 10 V. KoLŠEK, Nekaj podatkov o zgodnjem krščanstvu v Celeji [Einige Angaben iiber das Priihchristentum in Celeia], in: Arheološki vestnik 35 (1984) 342-345; auf dieser Grundlage R. BRATOŽ, The development of the Early Christian Research in Slovenia and lstria between 1976 and 1986, in: Actes du Xle congres international d'archfologie chretienne 11, vol. III (Roma 1989) 2345-2388 (hier 2349) und KNIFIC -SAGADIN (Anm. 4) 12f. 11 CAILLET (Anm. 6) 370; F. GLASER, Priihes Christentum im Alpenraum. Eine archaologische Entdeckungsreise (Regensburg - Ki:iln 1997) 66f. (Grundrifš der Kirche mit schematischer Darstellung des Mosaikfufšbodens); S. TAVANO, Da Ag,uil_€'!i<l~~g9,ri~i;i,, Scritti scelti (= Fonti e studi per la storia della Venezia Giiil1a. Studi 17) (Trieste 2008) li'.!J. KLEMENC (Anm. 4) 123 datierte die Entstehung der Kirche in die Zeit nach 452 (nach der angeblichen Zersti:irung Celeias wahrend des Peldzugs Attilas nach ltalien). 12 A. VOGRIN, Arheološko najdišče Kreuh (Archaologischer Pundort Kreuh), in: Celeia antiqua [Katalog der Ausstellung] (Celje 1991) 18 f.; 24; 28f. (Plan). Vgl. auch KNIFIC - SAGADIN (Anm. 4) 12f. 13 V. KOLŠEK in: VOGRIN (Anm. 12) 8 und 14; R. BRATOŽ, Doppelkirchen auf dem i:istlichen Einflufšgebiet der aquileiensischen Kirche und die Prage des Einflysses Aquileias, in: Antiquite Tardive 4 (1996) 133-141(hier134); l. LAZAR, Celeia, in: M. SAŠEL Kos - P. ScHERRER (Hg.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia: Noricum - Die autonomen Stadte in Noricum und Pannonien: Noricum (Ljubljana 2002) 71-101(hier95f„ mit Abb. 34f.). Zur Prage des Kirchenzentrums von Celeia vgl. auch GLASER (Anm. 11) 67; TAVANO (Anm. 11) 145 .. 14 KoLŠEKlAom. 10) 342 (die Tonlampe mit Abbildung des Kerzenleuchters; der Deckel eines kleinen Sarkophags, das vielleicht als Reliquiar diente; fragmentarisch erhaltene christliche lnschrift).
8 Rajko Bratož
um 400 n. Chr. datiert werden; gefunden wurden sie im J ahre 1993 auf dem Berg Vipota (rund 3 km siidlich von Celje). Das erste Bronzemonogramm (Durchmesser 25,4 cm, Hohe 28,8 cm) ist gut erhalten, wahrend das zweite (Durchmesser 25,2 cm) mit stilisierten Abbildungen von Delphinen, sechs erhaltenen Kettengliedern und einem Teil des blatterartigen Kerzenhalters, nur in Fragmenten erhalten ist15
• Vom gleichen Fundort stammt noch ein kleineres Christogramm (Durchmesser 9,8 cm, Hohe 14,05 cm), das erst vor kurzem veroffentlicht wurde 16
•
Neue Impulse in der Forschung haben in der Zeit nach 1990 zur Analyse der Mosaikinschriften gefiihrt17
• Von den 26 Namen, die auf 13 lnschriften belegt sind, weisen die meisten Parallelen im nordadriatischen Raum auf (Emona, Aquileia, lstrien, Siidnoricum). Einmalig ist der Name Abraham Sirus, der sich jedoch in den sozialen und ethnischen Kontext der Kirchegemeinden im nordadriatischen Raum einfiigt (mit insgesamt 18 semitischen Namen in Aquileia, Grado und Tergeste). Zwei Personen (Simplex und Simplicius) trugen Namen, die die Demut und die Selbstverachtung der Trager ausdriickten. Die lnschriften ermoglichen ferner einen Einblick in die soziale Struktur der Kirchengemeinde. Diese umfa6te Mitglieder, die von Sklaven ( 4 famuli) bis zu einem Ehepaar aus der Schicht der Senatoren (vir clarissimus und femina clarissima) reichten. Bei zwei Stiftern findet man auch Berufsangaben vor ( diaconus und scolasticus ), wobei fiir den letzten zwei Erklarungen moglich sind: als defensor scholasticus (kirchlicher „Rechtsanwalt", das erste Mal 407 in Afrika erwahnt) oder als Schulleiter (Synonym zum magister puerorum); fiir beide Deutungen existieren Parallelen im Raum Aquileias und in lstrien. Die Pedaturangaben (erhalten bei 8 lnschriften; nicht erhalten bei dem Senatorenpaar und beim scolasticus) erstrekken sich von 30 pedes (damals rund 1 Solidus) bis zu 240 pedes (8 Solidi) und machen damit rund 60 m2 oder ungefahr ein Viertel der gesamten Mosaikflache (200-250 m2
) aus. Obwohl wahrscheinlich nicht die ganze Mosaikflache aus Stiftermosaiken bestand wurde und auch andere Details unbekannt sind, ermoglichen diese Angaben doch einen Einblick in die lokale Gemeinde. Die Mosai-
15 S; CIGLENEČKI, Zgodnjekrščanske najdbe z Vipote nad Pečovnikom [Friihchristliche Funde von der Vipota oberhalb von Pečovnik], in: Arheološki vestnik 44 (1993) 213-221 (grundlegende Erstveroffentlichung). Kurze Darstellungen: R. BRATOŽ, Cristogramma in bronzo di Vipota, in: S. TAvANo - G. BERGAMINI (Hg.), Patriarchi. Quindici secoli di civilta fra l' Adriatico e l'Europa Centrale (Milano 2000) 83 ff. (VI.S, nur das erste Christogramm); S. CIGLENEČKI in: P. BITENC - T. KNIFIC, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti [Von den Romern zu den Slawen. Die Gegenstande] (Ljubljana 2001) 18f. Abb. 30-31; BRATOŽ-KNIFIC (Anm. 4) Abb. lf. (nach S. 124); T. KNIFIC, Cristogramma; Cristogramma con delfini, in: PrnssI (Anm. 4) 456 (Abb. X.10-11); 464f (Kommentar). 16 T. KNIFIC, Cristogramma per asta, in: PrnssI (Anm. 4) 456 (Abb. X.12); 465 (Kommentar). 17 CAILLET (Anm. 6) 369f.; 458-465; GLASER (Anm. 11) 66f.; BRATOŽ - CIGLENEČKI (Anm. 4) 517-521; A. ZETTLER, Offerenteninschriften auf den friihchristlichen MosaikfuBboden Venetiens und Istriens. RGA Suppl. 26 (Berlin - New York 2001) 61; 186ff.; zuletzt kurz R. BRATOŽ, La diffusione del cristianesimo tra la Venetia et Histria e l'Illirico, in: PrnssI (Anm. 4) 406-415 (410).
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 9
zierung der Kirche stifteten rund 30 Familien, die zum Kern der Kirchengemeinde gehorten 18
•
Die systematischen Ausgrabungen von Emona in den J ahren 1909 bis 1912 (Publikation 1914) unter der Leitung von Walter Schmid, die ungefahr ein Drittel der Stadtflache (17 Insulae im Siidteil der antiken Stadt) erfa{hen, brachten mit Ausnahme einiger bereits vorgestellter Kleinfunde 19 keine verla6lich verwertbaren Ergebnisse fiir die Christliche Archaologie20
• Auf Grund dieser Ausgrabungen auBerte Josip Klemenc 1962 und 1967 die Hypothese, daB in Insula 12, aus welcher einige friihchristliche Kleinfunde stammen, im 4. Jh. eine friihchristliche Saalkirche existierte. Seine Vermutung laBt sich nicht bestatigen21
•
Die erste Phase in der Entwicklung der christlichen Archaologie auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens, die von der Mitte des 19. Jh. bis zum ersten Weltkrieg dauerte, brachte im Vergleich mit den Nachbarlandern wie Karoten, Friaul oder Istrien, wo schon wichtige Ausgrabungen abgeschlossen und publiziert worden waren, nur bescheidene Resultate. Es wurde nur eine friihchristliche Kirche (Celeia) entdeckt, daneben in mindestens drei Orten (Poetovio, Emona, die Grotten von Škocjan) mindestens neun friihchristliche Kleinfunde (5 Ollampen, 2 Kerzentrager, 2 Inschriften und ein Christogramm), die sich heute in den Museen von Wien und Triest befinden.
2. Zwischenkriegszeit
Als Zufallsfund wurde im Jahre 1925 in Št. Pavel bei Prebold, rund 13 km westlich von Celje, die wichtigste friihchristliche Inschrift auf dem Gebiet Sloweniens entdeckt. Es geht um das metrische Epitaph des Bischofs Gaudentius mit seinem Namenim Akrostichon. Die Inschriftplatte (1,02 m x 0,84 m) diente bis 1896 als Altarplatte in der alten Kirche, danach wurde sie fiir fast drei Jahrzehnte -von der Fachwelt unbemerkt - in die auBere Seite der Nordwand der Kirche eingemauert. Die Inschrift entdeckte oder besser identifizierte und veroffentlichte im J ahre 1925 der Historiker Franc Kovačič, ein J ahr dana:ch der Patrologe Franc Ksaver Lukman. Den grundlegenden Kommentar zur Inschrift publizierte Rudolf Egger im Jahre 192722
; im darauffolgenden Jahr veroffentlichte F. K. Lukman eine weitere Publikation zur Inschrift, in der er die Aus-
18 Vgl. CAILLET (Anm. 6) 356-370; BRATOŽ- CrGLENEČKI (Anm. 4) 517-521. 19 S. Anm. 7. 20 W. ScHMID, Emona. Erster Teil, in: Jahrbuch fiir Altertumskunde 7 (1913, erschienen 1914) 61-217 (mit 18 Taf. und 93 Abb.). 21 KLEMENC (Anm. 7); DERS. (Anm. 4) 130-133, auf Grund von ScHMID (Anm. 20) 151-159 (bes. 154-156) T. XII. Wegen der Bescheidenheit der Funde bezeichne5e NoLL (Anm. 7) 84 die Deutung Klemencs als eine Annahme; sehr zuriickhaltend auch J. SAŠEL, Emona, in: RE Suppl. 11(1968)540-578 (568) = DERS„ Opera selecta (1992) 574. 22 R. EGGER, Eine altchristliche Bischofsinschrift, in: Mitteilungen des Vereins klassischer Philologen in Wien 4 (1927) 3-6; Nachdruck in DERS„ Romische Antike und friihes Christentum I (Klagenfurt 1962) 111-115.
10 Rajko Bratož
legungen Eggers unterstiitzte und die Deutung bekraftigte, daB Gaudentius sehr wahrscheinlich der Bischof von Celeia war23
• Die Inschrift wurde s pater vielmals veroffentlicht, iibersetzt und kommentiert24
• Diese einzige Bischofsinschrift auf dem Gebiet Noricums, die sich leider nur annahernd datieren lafšt (Ostgotenzeit), weist auf die hohe Bildung ihres Autors hin. Trotz einiger Verstofše gegen die Metrik und der vulgarlateinischen Ausdrucksformen ist die spirituelle und pastorale Tatigkeit des Bischofs in schweren Zeiten meisterhaft vorgestellt. Mit dieser Inschrift stieg die Zahl der friihchristlichen Inschriften auf dem slowenischen Territorium, die vor dem 2. Weltkrieg bekannt und im Jahre 1938 von Viktor Hoffiller und Balduin Saria veroffentlicht wurden, auf 16, wobei noch eine Inschrift aus Poetovio mit dem Namen eines staatlichen Wiirdentragers (Lampridius [. .. } Crescens ... comes sacrorum thesaurorum) als vermutlich christlich identifiziert wurde25
•
Bei den Ausgrabungen der spatantiken Festung auf dem Hiigel Velike M~lence, ca. 2 km siidwestlich von der Miindung des Flusses Krka in die Save, die von Balduin Saria'f (1893-1974) in denJahren 1929/1930 durchgefohrt wurden, wurde in der zweiten Phase (4. Jh.) der GrundriB einer ungewohnlicherweise nach Westen ausgerichteten Kirche (21,20 x 10,30 m) mit einer Apsis entdeckt26
•
0-ber diese in chronologischer Reihung zweite auf dem Territorium Sloweniens entdeckte friihchristliche Kirche ist wenig bekannt. Weil die gesamte Ausgrabungsdokumentation in der Kriegszeit verloren gegangen ist, basiert unsere
23 F. K. LUKMAN, Epitafij škofa Gaudentija [Epitaph des Bischofs Gaudentius], in: Bogoslovni vestnik 8 (1928) 117-122. 24 Eine Auswahl der Veroffentlichungen: HoFFILLER - SARIA (Anm. 4) 16; P. PETRU, Zaton antike v Sloveniji. Katalog razstave [Untergang der Antike in Slowenien, Katalog der Ausstellung] (Ljubljana 1976 ), mit slowenischer Ubersetzung von K. GANTAR (in der unpaginierten Publikation S. 11 vom Ende aus gezahJt); KNIFIC - SAGADIN (Anm. 4) 11und55 (Nr. 16); GLASER (Anm. 11) 68ff.; 98 Abb. 4; M. SPELIČ, Zgodnjekrščanska latinska poezija [Friihchristliche lateinische Poesie] (Ljubljana 1997) 100-103 (mit slowenischer -Obersetzung und mit der Vermutung, daB Gaudentius selbst der Autor des Epigraiyms gewesen sein konnte); J. KASTELIC, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih. Sempeter v Savinj~ki dolini [Sepulchral Symbolism of the Mythological Imagery on Roman Tomb Monuments. Sempeter in the Valley of Savinja] (Ljubljana 1998) 582 f.; 595 Anm. 33 (mit slowenischer Dbersetzung auf S. 582); BRATOŽ, Epigrafe di Gaudentius, in: TAVANO - BERGAMINI (Anm. 15) 131 f.; BITENC - KNIFIC (Anm. 15) 20 (Nr. 37); BRATOŽ - KNIFIC (Anm. 4) 123f und Abb. 7. 25 HoFFILLER - SARIA (Anm. 4) aus dem Jahre 1938 fiihren die Inschriften folgendermaBen an: Nr. 16 (Gaudentius-Inschrift); 63-73 (Celeia, unter Nr. 65 drei Inschriften); 443-444 (Kerzenleuchter aus Rogoznica). Fraglich bleibt eine als Fragment erhaltene Inschrift (Nr. 442), die von R. EGGER, Ein Denkmal des christlichen Poetovio, in: Casopis za zgodovino in narodopisje 29 (1934) 58f. als eine Inschrift von der Briistung eines Kirchenambons interpretiert wurde. 26 B. SARIA, Začasno poročilo o izkopavanjih na Gradišču pri Vel. Malenci [Vorlaufige Mitteilung iiber die Ausgrabung auf Gradišče bei Vel. Malence], in: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 10 (1929) 11-17 (15: Abbildungen, unter Nr. 4 GrundriB der Kirche; 16: kurze Beschreibung der Kirche); B. SARIA, Drugo začasno poročilo o izkopavanjih na Gradišču pri Vel. Malenci [Zweite vorlaufige Mitteilung iiber die Ausgrabungen auf Gradišče bei Vel. Malence], in: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 11 (1930) 5-12 (8: zusatzliche Beobachtungen).
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 11
Kenntnis auf einer bescheidenen Skizze und einigen generellen Beobachtungen in den Ausgrabungsberichten aus den J ahren 1929/193027
•
Die einzigen Ausgrabungen in der Zwischenkriegszeit mit wichtigen Ergebnissen fiir die Christliche Archaologie fanden unter der Leitung von Walter Schmid in Poetovio statt. In den Jahren 1935/1936 wurden sogar an fiinf verschiedenen Punkten Reste friihchristlicher Architektur (Elemente der lnnenausstattung von Kirchen, vor allem Chorschranken) gefunden. Von diesen ist zweifellos der Pfeiler einer Chorschranke mit folgendem Motiv friihchristlich: Aus einer Vase streben Reben empor; auf ihren oberen Rankenpaaren sitzt eine Taube, iiber deren Brust ein Reliefkreuz liegt. Jedoch konnte die Hypothese Schmids von fiinf Kirchen in der Stadt ( eine auf dem Areal der Propsteikirche des HI. Georg, eine auf dem Hiigel Panorama, eine im ostlichen Vorort Rogoznica sowie jeweils eine in den westlichen Vororten Spodnja Hajdina und Zgornji Breg) nicht bestatigt werden28
• Im Fall von Rogoznica (gefunden wurden zwei friihchristliche Kerzenleuchter, keine Reste von Architektur) und Zgornji Breg (gefunden wurde hier die schon erwahnte fragmentarische lnschrift aus dem 4. Jh. mit dem Namen des Wiirdentragers Lampridius Crescens; der Kontext der gefundenen Architekturreste bleibt unklar) reichen die Funde fiir den Nachweis einer Kirche nicht aus, fiir Spodnja Hajdina (schlecht erhaltene Architekturreste) ist die Existenz einer Kirche fraglich.
3. Friihchristliche Forschungen nach 1945
a. Poetovio
Die in der Mitte der drei6iger Jahre von Walter Schmid abgeschlossenen Ausgrabungen in Poetovio (Ptuj) wurden in den Nachkriegsjahren von Josip Klemenc'' (1898-1967) fortgesetzt. In denJahren 1946/1947 entdeckte er auf dem Burghiigel die bescheidenen Reste einer friihchristlichen Kirche, vermutlich ein dreischiffiger Bau mit zwei Apsiden. Von den friihchristlichen Funden sind -
27 Vgl. S. CIGLENEČKI, Hohenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum (Ljubljana 1987) 99 f.; DERS., Monumenti del primo cristianesimo nella Savia e nella provincia Valeria Media, in: PrnssI (Anm. 4) 440-447 ( 443 ff. mit Abb. 12). 28 W. ScHMID, Poetovio. Raziskovanje Muzejskega društva y Ptuju jeseni 1835 [Poetovio. Forschungen des Musealvereins in Ptuj im Herbst 1935), in: Casopis za zgodovino in narodopisje 30 (1935) 129-)55; DERS., Ptujske krščanske starosvetnosti [Friihchristliche Denkmaler in Poetovio] in: Casopis za zgodovino in narodopisje 31 (1936) 97-115, Abb. 16-19). J. KLEMENC, Ptujski grad v kasni antiki- The Castle of Ptuj in the Late Antiquity (Ljubljana 1950) 18, iibernahm als gesichert folgende vier Kirchen: Rogoznica, Spodnja Hajdina, Panorama und Propsteikirche des hi. Georg. Skepsis zu den Schliissen von W. Schmid aufšerten (mit verschiedener Akzentuierung): I. MIKL-CURK, Poetovio v pozni antiki [Poetovio in der Spatantike], in: Arheološki vestnik 29 (1978) 405-411 (408f.; 411); F. GLASER, Die Christianisierung von Noricum Mediterraneum bis zum 7. Jahrhundert nach den archaologischen Zeugnissen, in: E. BosHOF - H. WoLFF (Hg.), Das Christentum im bairischen Raum. Von den Anfangen bis ins 11. Jahrhundert (Koln - Weimar- Wien 1994) 193-229 (209 ff.); BRATOŽ - CIGLENEČKI (Anm. 4) 508ff.; BRATOŽ- KNIFIC (Anm. 4) 113-116.
12 Rajko Bratož
abgesehen von mehr als einem Dutzend Stein- und Mosaikfragmenten - besonders die Reste von zwei Altaren wichtig, fiir die mehrere Vergleichsbeispiele im Ostalpen- und Nordadriaraum aus dem 5. Jh. bekannt sind. J. Klemenc datierte die Entstehung der Kirche in die Epoche zwischen 378 und dem friihen 5. Jh., ihre Zerstorung verband er mit dem Italienzug Attilas im Jahre 45229
• An ihrer Stelle soll in der Ostgotenzeit eine kleine Festung von annahernd gleichen Dimensionen (etwa 17,80 x 21 m; das innere Gebaude 9 x 8,5 m) erbaut worden sein, deren Reste archiiologisch viel besser erkennbar sind als die Uberreste der Kirche30
• Klemencs Deutung wurde in der Folgezeit von Jaroslav Šašel in Prage gestellt, der eine friihe Chronologie vorschlug (Entstehung der Kirche in der Zeit Konstantins, Bau der Festung in der Zeit Valentinians )31
• J edoch sprechen die Architekturreste der lnnenausstattung wohl mehr fiir eine Datierung in das friihe 5. Jh. als das friihe 4. Jh.
Am wichtigsten waren die Forschungen auf dem Hiigel Panorama nordwestlich der Burg von Ptuj, wo schon Walter Schmid in den drei:Biger Jahren einige friihchristliche Architekturfragmente gefunden hatte; zu diesen gesellten sich weitere Einzelfunde aus den Nachkriegsjahren32
• Besondere Aufmerksamkeit kam dabei einer fragmentarisch erhaltenen griechischen lnschrift zu, die von einigen Autoren als friihchristlich, sogar als Epitaph des Martyrerbischofs und Schriftstellers Victorinus interpretiert wurde. Die Richtigkeit dieser Vermutung la:Bt sich leider nicht bestatigen33
• Neue Impulse zur Erforschung der friihchristlichen Reste auf dem Hiigel Panorama gab die Entdeckung eines Bodenmosaiks im J ahre 1983, das auf Grund seiner dekorativen Motive sicher zu einer Kirche aus dem 5. Jh. gehorte. Zu diesem Mosaik gibt es Vergleichsbeispiele in Emona, Celeia, Parentium (sog. basilica praeeufrasiana) und in Pola (Felicitas-Kirche), die alle aus dem friihen 5. Jh. datieren und stark von der Mosaikkunst Aquileias beeinflu:Bt worden sind34
• Zu den Resten der neu gefundenen Kirchenausstattung gehorten noch Reste einer Schrankenplatte und Fragmente von drei kleinen Saulen35
•
Zusammenfassend sind die Kenntnisse des friihchristlichen Poetovio, die uns
29 KLEMENC (Anm. 28) 9-17; T. 2, 2; 15, 1und2;16, 2; KLEMENC (Anm. 4) 112f. (mitAbb. 2); CICLENEČKI (Anm. 27) 55. 3° Kf;;EMENC (Anm. 4) 113-118 (mit Abb. 3-7). 31 J. SAŠEL, K zgodovini Ptujskega gradu v arheoloških obdobjih in nekaj novih najdb na zahodnem vznožju [Zur Geschichte der Burg von Ptuj durch die archaologischen Zeitabschnitte und einige neue Funde auf dem westlichen Abhang], in: Krogika 9 (1961) 120-128; CIGLENEČKI (Anm. 27) 55 (seiner Meinung nach ist die Chronologie Sašels wahrscheinlicher). 32 ScH,MIDT (Anm. 28) 110, Abb. 26 a-b; KLEMENC (Anm. 4) 122f. 33 M. SAŠEL Kos, Fragment einer widerspriichlich interpretierten griechischen Inschrift aus Poetovio, in: Linguistica 20 (1980) 11-20; vgl. R. BRATOŽ, II Cristianesimo aquileiese prima di Costantino fra Aquileia e Poetovio (Udine - Gorizia 1999) 185 f.; Abb. 6. 34 KNIFIC-SAGADIN (Anm. 4) 16f. Abb. 16-19; I. TUŠEK, Die friihchristliche Basilika in Ptuj auf Panorama, in: Acta XIII congressus internationalis archaeologiae christianae, Bd. III (Citta del Vaticano -Split 1998) 737-742; BRATOŽ- KNIFIC (Anm. 4) 116ff. 35 KNIFIC - SAGADIN (Anm. 4) 16-19, Abb. 20ff. (Schrankenplatte); Abb. 23ff. (Saulchen).
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 13
die materiellen Funde bieten, recht bescheiden. Dber die groište und wichtigste romische Stadt auf dem heutigen slowenischen Territorium, die mit dem Bischof Victorin schon im spaten 3. Jh. ein wichtiges Zentrum der christlichen Literatur darstellte36 und die ein J ahrhundert spater neben einer rechtglaubigen auch eine konkurrierende arianische Kirchengemeinde hatte37
, ist von der Warte der Christlichen Archaologie aus betrachtet leider nur wenig bekannt. Von den fiinf vermutlichen Kirchen Walter Schmids und der sechsten, die vonJosip Klemenc auf dem Burghi.igel ausgegraben wurde, wurde ein annahernder Grundriiš nur in zwei Fallen vorgelegt (Spodnja Hajdina und am Burghiigel von Ptuj), wobei dieser in beiden Fallen teilweise hypothetisch und unklar geblieben ist. Wegen der starken Beschadigung der antiken Kulturschichten durch tiefes Pfli.igen auf dem Hiigel Panorama in den Nachkriegsjahren ist auch die Kirche in diesem Stadtareal kaum zu erkennen. In den anderen drei Fallen basiert die Annahme von der Existenz einer Kirche auf Zufallsfunden von Architekturresten, deren Interpretation nicht immer eindeutig ist38
• Wenig ist leider auch iiber den Untergang der christlichen Gemeinde von Poetovio bekannt; dieser diirfte sich in der recht bewegten Epoche von der Mitte des 5. Jh. bis zum spaten 6. Jh. vollzogen haben39
•
b. Emona
Die Kenntnis des friihchristlichen Emona basierte bis 1967 auf wenigen Zufallsfunden (zu verdanken den Ausgrabungen Walter Schmids), auf hypothetischen Versuchen einer Lokalisierung des friihchristlichen Zentrums und auf Analysen der literarischen Quellen wie den Berichten iiber die Asketen Emonas in zwei Briefen Hieronymus' aus dem Jahre 374 und iiber der Teilnahme des Bischofs Maximus an der Synode von Aquileia 381 (Josip Klemenc)40
• Die Ent-
36 M. DuLAEY, Victorin de Poetovio premier exegete Jatin I-II, Collection des Etudes Augustiniennes, Sfrie Antiquite 139 (Paris 1993) bes. 221-307; BRATOŽ (Anm. 33) 267-354; DERS„ Der Bischof Victorinus und die Kirchengemeinde von Poetovio (2. Halfte des 3. Jahrhunderts ), in: R. M ULLER (Hg. ), Christentum in Pannonien im ersten J ahrtausend, Zalai Muzeum 11 (2002) 7-20; S. KRAJNC (Hg.), Mednarodni znanstveni simpozij ob 1700-letnici smrti sv. Viktorina Ptujskega. Zbornik razprav [Internationales Symposium aus Anlass des 1700- Todesjahres des hi. Viktorin von Pettau. Sammelband der Beitrage] (Ptuj 2003). 37 BRATOŽ - CIGLENEČKI (Anm. 4) 492-506. 38 BRATOŽ- CIGLENEČKI (Anm. 4) 508f.; BRATOŽ- KNIFIC (Anm. 4) 118. 39 Vgl. S. CIGLENEČKI, Results and problems in the archaeology of the late antiquity in Slovenia, in: Arheološki Vestnik 50 (1999) 297-309 (hier 291); DERS., The archaeological investigations of the decline of antiquity in Slovenia, in: R. BRATOŽ (Hg.), Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo - Slowenien und die Nachbarlander zwischen Antike und karolingischer Epoche (Ljubljana 2000) 119-139 (hier 120f.); H. WoLFF, Vermutungen zum Ende antiker Lebensformen im siidostlichen Alpenraum, in: ebd. 27-40 (hier 32f.); P. Kos, The Numismatic Evidence for the Period from the 5th to the 10th Centuries in the Area of Modem Slovenia, in: ebd. 111-114; kurze Skizze bei BRATOŽ- KNIFIC (Anm. 4) 120 f. 4° KLEMENC (Anm. 4) 130-133 (mit unbegriindeten Schliissen als Konsequenz seiner Quellenanalyse, wie z. B. der Existenz von „mindestens zwei Klostern" in der Stadt und der Teilnahme der Bischofe von Emona an „zahlreichen Synoden").
14 Rajko Bratož
deckung und die Erforschung des friihchristlichen Zentrums (1967 bis 1975) mit seiner Prasentierung in situ und die Veroffentlichung der Ergebnisse (1983) stellen das Lebenswerk von Ljudmila Plesničar-Gec'' (1931-2008) dar, die als Erste unter den slowenischen Archaologen sich vor allem der Christlichen Archaologie widmete 41
• Das friihchristliche Zentrum umfa6te eine gesamte Insula (Insula 32 im Nordwestteil der antiken Stadt) mit einer Flache von 3038 m2
, von der allerdings nur die nordliche Halfte freigelegt wurde. In der ersten Phase in der zweiten Halfte des 4. Jh. bestand das Zentrum aus zwei apsidenlosen Salen, von denen der gro6ere (29 x 15 m), dessen Boden von einem Mosaik bedeckt wurde, als Kirche diente. Im friihen 5. Jh. (Datierungsanhalt sind hier numismatische Funde aus der Zeit zwischen 408 und 423) wurde das Zentrum umgebaut und vergro6ert. Es wurde mit einem Baptisterium (8,5 x 8,5 m, mit oktogonalem Taufbecken, iiber dem sich eine Baldachinkonstruktion erhob) und einer Porticus (18 X 3,9 m) erganzt, wahrend der kleinere der alteren Sale eine dreischiffige Raumaufteilung erfuhr. Weil nur im Fall dieser zwei Raume ihre Funktion bekannt ist, bei den Raumen nordlich davon aber nicht (hypothetisch als basilica, katechumeneum, episcopium bezeichnet), und weil das iiberbaute Areal siidlich der Porticus nicht ergraben wurde ( es wurden allerdings Mosaikreste eines als basilica bezeichneten Raumes gefunden), ist die Interpretation des gesamten Areals nur hypothetisch moglich; wie vermutlich in Celeia, sicher aber in Aquileia sowie im Falle einiger Kirchenzentren in Istrien (Parentium, Pola, Nesactium) und in der weiteren Umgebung (Norditalien, Ostalpenraum, Dalmatien)42
,
umfa6te das Bischofzentrum in Emona mutmaBlich eine Doppelkirche samt Baptisterium43
•
Die Porticus und das Baptisterium waren mit einem Mosaikboden ausgestattet, dessen gesamte Flache rund 100 m2 betrug. Die Ornamentierung folgt dem Stil der Mosaiken von Aquileia (in der sog. Basilica postteodoriana) und hat viele
41 L. PLESNIČAR-GEc, Starokrščanski center v Emoni - Old Christian Center in Emona (Ljubljana 1983) 9-32 (slowenischerText); 33-51 (englische Ubersetzung). Auswahl von Veroffentlichungen Plesničar-Gecs zum Thema: L. PLESNIČAR-GEC, Emona v pozni antiki [Emona dans l'antiquite avancee], in: Arheološki Vestnik 21-22 (1970-1971) 117-122; Drns., La citta di Emona ne! tardoantico e suoi ruderi paleocristiani, in: Arheološki Vestnik 23 (1972) 367-375; Drns., Poznoantična in starokrščanska Emona [Das spatantike und das christliche Emona], in: Materiali XII: 9. kongres arheologa Jugoslavije (Zadar 1976) 231-238 (mit 4 Beilagen); Drns., Emona ne! IV secolo. Problemi e collegamenti con Milano e l'area padana, in: Felix temporis reparatio. Atti del convegno Milano capitale dell'Impero romano (Milano 1992) 219-226; Drns., Zgodnjekrščanski center v Emoni [Friihchristliches Zentrum in Emona (popularwissenschaftliche Publikation)] (Ljubljana 1999); DIES., Emona v pozni antiki v luči arhitekture [Die Architektur Emonas in der Spatantike], in: Arheološki vestnik 48 (1997) 359-370. 42 J.-P. SomNr - K. KoLOKOTSAS, Aliki, II: La basilique double, in: Etudes Thasiennes 10 (1984) 255-326 (260-279); der Stand der Forschung bis um 1995 bei N. DuvAL- J.-P. CAILLET (Hg.), Les eglises doubles et les familles d'eglises, in: Antiquite Tardive 6 (1996) bes. 22-50; 115-159. 43 Vgl. PLESNIČAR-GEc (Anm. 41) 29ff.; 49; vgl. BRATOŽ (Anm. 13) 134; GLASER (Anm. 11) 84f.
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 15
Gemeinsamkeiten mit den zeitgleichen Mosaiken aus Celeia 44• Besonders wert
voll sind zwolf Mosaikinschriften ( 4 in der Porticus, 8 im Baptisterium); in einem Fall handelt es sich um eine Bauinschrift (Inschrift des Archidiakon Antiocus in der Porticus), in anderen Fallen geht es um Stifterinschriften, von denen vier sehr fragmentarisch erhalten und kaum lesbar sind. Unter den rund 30 bekannten friihchristlichen Inschriften auf dem Territorium Sloweniens liefert diese Bauinschrift den einzigen Beleg fiir einen Sakralbau, und zwar in vulgarlateinischer Form (Baptisterium als battesterium). Die wissenschaftliche Bearbeitung der Mosaiken und die Veroffentlichung samt einem umfassenden Kommentar wurde von Jaroslav Šašel'; (1924-1988) besorgt45
•
Die Veroffentlichung der wichtigen friihchristlichen Ausgrabungen in Emona lieferte einige neue Erkenntnisse. Der Ausgangspunkt war die Eingliederung Emonas in den breiteren Kontext der christlichen Welt im friihen 5. Jh. und der Vergleich mit anderen Bischofszentren dieser Zeit46
• An dieser Stelle sollen nur einige Feststellungen und Hypothesen erwahnt werden, die sich vor allem auf die sozialen und okonomischen Verhaltnisse der Kirchengemeinde von Emona im friihen 5. Jh. beziehen und die eine Vermehrung unserer Erkenntnisse iiber diese Gemeinde bedeuten konnten: (1) der materielle Aufwand der Gemeinde bei dem Ausbau des Kirchenzentrums und der Mosaikboden im Baptisterium und der Porticus47
; (2) ein Vergleich mit Celeia, der auf ahnliche ethnische und soziale Strukturen der beiden Gemeinden hinweist48
; (3) hinsichtlich der Bauinschrift des Archidiakons Antiocus in der Porticus wurde die Frage gestellt, ob am zerstorten Anfang der Inschrift (mit einer oder mehreren fehlenden Zeilen?) nicht der Bischofsname stand; in diesem Fall ginge es um eine Bauinschrift eines
44 D.(,URIC (Anm. 8) 587f. Taf. 60-63. 45 J. SAŠEL, Napisi v mozaičnih tleh emonske krstne kapele in cerkvenega portika - Inscriptions on the Mosaic Floor in t~e Baptismal Chapel and Church Portico in Emona, in: PLEsNIČAR-GEc (Anm. 41) 52-59; SAŠEL (Anm. 9 [1992]) 783-794. 46 CAILLET (Anm. 6) 370-379, Abb. 292-312 (neue Veri:iffent!ichung der Inschriften); 427-465 (vergleichende Analyse der Stifterinschriften); BRATOŽ- CrGLENEČKI (Anm. 4) 512-517 (Vergleich mit den Stifterinschriften in Celeia und im nordadriatischen Raum anhand der Namen und der Pedaturangaben); ZETTLER (Anm. 17) 108ff. (Gruppierung der Stifter nach den Pedaturangaben); 218-221 (Veri:iffentlichung der lnschriften mit einigen Berichtigungsvorschlagen). 47 CAILLET (Anm. 6) 433; das gesamte Zentrum kostete nach seinen Schatzungen ungefahr 2000-2500 Solidi (wenn man die Kosten des annahernd ebenso grofšen Bischofszentrums in Narbonne (Narbo) aus der Zeit um 441-445 als Vergleichsgri:ifše heranzieht); die gesamte mit Mosaik bedeckte Flache in Emona (rund 100 m2
) kostete nach Caillet ungefahr 33 Solidi (wenn man die Preise des Mosaiks der Synagoge von Hammat Gadar in Palestina aus der ersten Halfte des 5. Jh. als Kalkulationsgrundlage zugrunde legt). GLASER (Anm. 11) weist mit Recht auf die grofšen Dimensionen des Kirchenzentrums in Emona hin, das sich mit jenen in Genava (Genf) und Aquileia vegleichen lafšt. 48 BRATOŽ- CrGLENEČKI (Anm. 4) 512-521. Der Durchschnitt bei den Pedaturangaben ist in Emona 77 pedes (6,7 m2
, ca. 2,3 Solidi), in Celeia 87 pedes (7,6 m2, ca. 2,5 Solidi). Ein Vergleich
mit den Angaben in Tergeste (altere Phase der Kirche in Madonna del Mare, mit dem Durchschnitt 100 pedes bzw. 3 Solidi) und Parentium (basilica Praeeufrasiana, mit dem Durchschnitt 124 pedes bzw. 3,7 Solidi) weist auf vergleichbar bessere i:ikonomische Verhaltnisse in den Kiistenstadten lstriens hin.
16 Rajko Bratož
Bischofs, wie sie damals iiblich war, und die Rolle des Archidiakons ware nur von sekundarer Bedeutung49
•
Die Befunde der Rettungsgrabungen auf dem Forum von Emona im Jahre 1968 unter der Leitung von Ljudmila Plesničar-Gec sind nicht eindeutig. Im Zuge dieser Grabungen trat eine Rotunde mit dem Durchmesser von 13,5 m zutage, die von der Ausgraberin als ein friihchristlicher Bau interpretiert wurde. Diese Annahme stiitzte sich u. a. auf den Fund von zwei spatantiken Pilasterkapitellen in sekundarer Lage in der Nahe50 und die Entdeckung eines kleinen ovalen Beckens (Durchmesser 2,2 m, Tiefe 0,2 m) nordlich der Rotunde. Nachdem das prachtige Kirchenzentrum im nordwestlichen Teil der Stadt nach der Meinung von Plesničar-Gec wahrscheinlich schon vor Attilas Italienzug 452 untergegangen war, sollte das kirchliche Leben in wesentlich bescheideneren Verhaltnissen im Bereich des Forums (mehr als 200 m siidostlich davon) bis in die zweite Halfte des 6. Jh. weiterexistiert haben. Leider laBt sich diese Hypothese sich beim heutigen Forschungsstand nicht verifizieren51
• Recht kompliziert sind im Licht der neueren Forschungen auch die Fragen nach dem Untergang der Stadt und ihrer christlichen Gemeinde, die das letzte Mal am Ende des 6. Jh. Erwahnung findet52
•
c. Die Kirchen in den Hohensiedlungen: Vranje und Rifnik
Um 1970 begann eine N euorientierung in der slowenischen archaologischen Forschung zur Spatantike, die nach rund vier Dezennien noch immer vorherrschend ist. Wahrend bis zu dieser Zeit die Erforschung der antiken Stadte im Vordergrund stand, verlagerte sich damals der Forschungsschwerpunkt auf die befestigten Hohensiedlungen, die bis dahin nur wenige Archaologen (wie Emanuel Riedl, Walter Schmid und besonders Balduin Saria) interessierten53
• Die
49 ZETTLER (Anm. 17) 218. Zu den rund 20 Bauinschriften in ltalien (ausgenommen Rom) und im Westbalkanraum, wo - mit Ausnahme Emonas(!)- immer der Bischof an erster Stelle genannt wird, vgl. G. Cusc1To, Vescovo e cattedrale nella documentazione epigrafica in Occidente, in: Actes du XI congres international d'archeologie chretienne (=Studi di antichita cristiana 41) (= Collection de l'Ecole fran~aise de Rome 123) (Rome 1989) 735-776 (757ff.). 50 PLESNIČAR-GEC (Anm. 41[1970-1971])119f. 51 PLESNIČAR-GEC (~nm. 41 [1997]) 364-370; die Hypothese wurde von B. V1č1č, Colonia lulia Emona, in: M. SAŠEL Kos - P. ScHERRER (Hg.), The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia - Die autonomen Stadte in Noricum und Pannonien. Pannonia I (Ljubljana 2003) 21-45 (hier 37) aufgenommen; kritisch hingegen aufgrund der unsicheren Datierung BRATOŽ - CIGLENEČKI (Anm. 4) 511 und C1GLENEČK1 (Anm. 39 [2000]) 120; vgl. auch Kos (Anm. 39) 111 ff. ( der auf die vollige Abwesenheit von Miinzfunden in Emona nach der Mitte des 5. Jh. hinweist). 52 Vgl. WoLFF (Anm. 39) 29-34. 53 E. Riedl fiihrte die Ausgrabungen auf dem Ajdovski Gradec bei Vranje, W. Schmid auf dem Rifnik durch. Beide Ausgriiber haben die Reste der Kirchen allerdings nicht erkannt; fiir SARIA s. Anm. 26. Vgl. die kurze Ubersicht der Forschungen bei S. C1GLENEČKI, Castra und Hohensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien, in: V. BIERBRAUER- H. SrnuER (Hg.), Hohensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter (= RGA-Erg. Band 58) (Berlin - New York 2008) 481-532 (hier 482).
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien
Abb. 2: Friihchristliche Architektur in Slowenien
6 .4. Jh. und er~e Halite des 5 Jh i zweite HaHre des 5_ Jh. und 6. Jh.
o 40km
17
Ergebnisse dieser Verlagerung des Forschungsinteresses sind nicht nur fiir die Kenntnis der spatantiken Besiedlung Sloweniens von entscheidender Bedeutung (identifiziert wurden mehr als 50 Siedlungen, von denen rund 25 besser erforscht sind), sondern auch fiir die Christliche Archaologie. Wahrend vor dem 2. Weltkrieg in Slowenien nur zwei friihchristliche Kirchen bekannt waren, sind heute rund 40 Kirchen bekannt oder zumindest festgestellt, davon mehr als 30 in den Hohensiedlungen (Abb. 2)54
•
Unter den Ausgrabungen der spatantiken Hohensiedlungen um 1970, die wichtige Ergebnisse fiir die Christliche Archaologie erbrachten, sind besonders zwei in der slowenischen Steiermark zu nennen. Bei den Ausgrabungen auf dem Hiigel Rifnik (570 m) ostlich von Celje unter der Leitung von Lojze Bolta~· (1923-1998), die mit Unterbrechungen von 1962 bis 1980 andauerten, wurde oberhalb der spatantiken Siedlung eine einschiffige Saalkirche (ca. 9,50 x 16 m) entdeckt (die wahrscheinlich an der Stelle eines Tempels der lokalen Gottheit Aquo erbaut wurde), die in einer zweiten Bauphase (datiert in die 2. Halfte des 6. Jh.) um ein Baptisterium an der Nordseite, einen Narthex an der Westseite und zwei Nebenraume an der Siidseite vermehrt wurde, so dafš das gesamte Bau-
54 S. CIGLENEČKI, Friihchristliche Kirchenanlagen in Slowenien, in: R. SENNHAUSER (Hg.), Friihe Kirchen im i:istlichen Alpengebiet. Von der Spatantike bis in ottonische Zeit (= Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Abhandlungen NF Heft 123, Bd. 2) (Miinchen 2003) 581-595; DERS., Friihchristliche Kirchen in Slowenien und die Elemente ihrer Innenausstattung, in: Horms artium medievalium 9 (2003) 11-20; BRATOŽ - KNIFIC (Anm. 4) 130-136; CIGLENEČKI (Anm. 53) 490-502.
18 Rajko Bratož
ensemble (alle Raume haben unregelmatšige Formen) nach diesen Erweiterungen insgesamt rund 20 x 20 m maK Anfangs wurde die Kirche als Doppelkirchenanlage interpretiert, danach richtigerweise als eine Kirche mit Nebenraumen55. Auf dem gesamten Areal der befestigten spatantiken Hohensiedlung (200 x 130 m) zwischen der Kirche und der Wehrmauer wurden 9 Bauten entdeckt, vor allem Wohnhauser, dazu autšerhalb der Siedlung noch eine Nekropole mit 109 Skelettgrabern. In der Siedlung lebte anscheinend auch eine barbarische Gruppe56 . Bei den spateren Ausgrabungen wurde noch eine kleine Kirche mit Apsis (10,5 x 6,5 m) entdeckt, die von der ersten mindestens 80 m entfernt liegt und daher mit dieser in keiner Weise verbunden ist. Einige Forscher vertreten die Meinung, datš diese Kirche einer arianischen (gotischen oder langobardischen) Gruppe als Versammlungsraum diente57 .
Annahernd gleichzeitig wie auf dem Rifnik verliefen die Ausgrabungen auf dem Hiigel Ajdovski Gradec oberhalb vom Vranje (445 m), siidostlich von Celje. Am Fundort, wo schon 1811 antike Funde (ein Grabdenkmal sowie ein Sarkophag) entdeckt worden waren und wo Emanuel Riedl in den Jahren 1901-1905 einen Teil der spatantiken Siedlung entdeckte58, fanden in den Jahren 1970-197 4 gemeinsame slowenisch-deutsche Ausgrabungen ( durchgefiihrt vom Slowenischen Nationalmuseum in Ljubljana und dem Institut fiir Vor- und Friihgeschichte der Universitat Miinchen) unter der Leitung von Peter Petru':· (1930-1983) und Thilo Ulbert statt. Die Ergebnisse der internationalen Forschungsgruppe, die bald veroffentlicht wurden, waren fiir die Christliche Archaologie von grotšer Bedeutung: Entdeckt wurden die obere Kirche (13,75 x 8 m), die untere Kirche (16,50 x 7,40 m) sowie das Baptisterium (16,50 x 5,40 m), die zusammen eine Doppelkirchenanlage mit Baptisterium bildeten59. Die darauffolgenden archaologischen Forschungen der slowenischen
55 Grundlegende Veroffentlichung: L. BOLTA, Rifnik pri Šentjurju. Poznoantična naselbina in grobišče [Rifnik. Spatantike Siedlung und Graberfeld] (Ljubljana 1981) 1-40 (slow. Text); 41-53 (deutsche Zusammenfassung); 38 Tabellegseiten. Andere Beitrage Boltas (Auswahl): L. BpLTA, Poznoantično grobišče na Rifniku pri Sentjurju [Spatantikes Graberfeld auf Rifnik bei Sentjur], in: Arheološki Vestnik 21-22 (1970-1971) 127-140; DERS., Starokrščanski baziliki v poznoantični naselbini na Rifniku. Rezultati izkopavanj v letih 1971/72 [Die friihchristlichen Basiliken in der spatantiken Siedlung auf Rifnik. Resultate der Ausgrabungen in den Jahren 1971/1972], in: Celjski zbornik 1973-1974 (Celje 1974) 309-324; DERS., Rifnik, provinzialromische Siedlung und Graberfeld, in: Arheološki Vestnik 29 (1978) 510-517. Vgl. SomNI - KoLOKOTSAS (Anm. 42) 276f.; CIGLENEČKI (Anm. 27 [1987]) 56ff.; BRATOŽ (Anm. 10) 2355f.; DERS. (Anm. 13) 136ff. 56 BOLTA (Anm. 55 [1981]) 14-53 und zahlreiche Tafeln. 57 D. PIRKMAJER, Rifnik. Arheološko najdišče. Vodnik - Archaologischer Fundort. Fiihrer (Celje 1994) 48; 52f. Zur Frage der Zugehorigkeit der Kirche zu einer Gruppe arianischer Kirchen vgl. BRATOŽ (Anm. 13) 138 Anm. 24 (mit Skepsis); zu dieser Deutung neigen CIGLENEČKI (Anm. 54 [2003]) 588; GLASER (Anm. 11) 72; F. GLASER, I Goti e l'arianesimo nei territori alpini, in: J.-J. AILLAGON et al. (Hg.), Roma e i barbari. La nascita di un nuovo mondo (Venezia - Milano 2008) 385 ff. (hier 387) und 627 f. 58 PETRU - ULBERT (Anm. 9) 22f. 59 PETRU - ULBERT (Anm. 9) 9-20 (Topographie und Geschichte des Fundortes von P. PETRu); 21-77 (grundlegende Analyse des Kirchenkomplexes von TH. ULBERT). Andere Beitra-
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 19
Archaologen ( abgeschlossen 1986) hatten vor allem die Erfassung der Siedlung zum Ziel60
• Aufgrund dieser Forschungen gehort Ajdovski gradec zu den am besten bekannten spatantiken Hohensiedlungen im gesamten siidostlichen Voralpen- und Ostalpenraum61
•
In einem Abrifš der Entwicklung der Christlichen Archaologie, einer Vorbereitungsarbeit fiir die „Prosopographie der Christlichen Archaologie", darf man jene Forscher nicht auslassen, die entweder vor dem Abschlufš ihrer Arbeit gestorben sind und daher ihre Ergebnisse unpubliziert geblieben sind oder diejenigen, welche die friihchristlich-archaologischen Forschungen nur mit einzelnen Beitragen bereichert haben. Zu der ersten Gruppe gehoren Andrej Valič (1931-2003), der die Kirche in der spatantiken Bergsiedlung Ajdna (1054 m) ausgegraben und in einigen Aufsatzen der Fachwelt zuganglich gemacht hat62
, oder Alenka Vogrin (1950-1998), die das Baptisterium in Celeia entdeckte63
• Einige wichtige Beitrage steuerten auch Emilijan Cevc (1920-2006) mit der Veroffentlichung eines friihchristlichen Mosaiks 64, Vera Kolšek (1930-2007) mit ihrem Beitrag zum friihchristlichen Celeia 65 oder Paola Korošec (1913-2006) mit ihren Analysen der Kleinfunde bei66
• Einige slowenische Archaologen widmeten sich der Forschung in anderen Teilen des damaligen Jugoslawiens, wie z. B. die Prahistorikerin und provinzialromische Archaologin Irma Čremošnik~· (1916-1990) in Bosnien67 oder die Epigraphiker Ana und Jaroslav Šašel mit ihren Veroffentlichungen der friihchristlichen Inschriften68
• Mit slowenischen friihchristlichen
ge von P. PETRU: Die provinzialromische Archaologie in Slowenien, in: ANRW II, Bd. 6 (Berlin 1977) 500-541 (hier 536ff.); DERS„ Vranje pri Sevnici, Arheološki vestnik 29 (1978) 517f. (kurze Zusammenfassung in engl. Sprache); DERS„ Stavba A (episkopij?) na Ajdovskem gradcu nad Vranjem pri Sevnici [Das Gebaude A (Episcopium?) auf dem Ajdovski gradec oberhalb Vranje bei Sevnica], in: Arheološki Vestnik 30 (1979) 726-731. Vgl. auch BRATOŽ (Anm. 10) 2353ff. 60 T. KNIFIC, Vranje near Sevnica: A Late Roman Settlement in the Light of Certain Pottery Finds, in: Arheološki Vestnik 45 (1994) 211-237. 61 Zusatzliche Ubersicht (in Auswahl) und die Erorterung einzelner Aspekte: CIGLENEČKI (Anm. 27) 65ff.; BRATOŽ (Anm. 10) 2353ff.; KNIFIC - SAGADIN (Anm. 4) 19-23; Bratož (Anm. 13) 136f.; Glaser (Anm. 11) 73-78. 62 F. LEBEN - A. VALIČ, Ajdna, in: Arheološki Vestnik 29 (1978) 532-545; A. VALIČ, Ajdna nad Potoki, in: Varstvo spomenikov 27 (1985) 265-272. Vgl. BRATOŽ (Anm. 10) 2360ff.; M. SAGADIN, Ajdna nad Potoki (Ljubljana 1997). 63 VOGRIN (Anm. 12). 64 E. CEvc, Poznoantični mozaik iz Tuhinjske doline [Spatantikes Mosaik aus Tuhinjska dolina], in: Kamniški zbornik 6 (1960) 35-48. 65 KoLŠEK (Anm. 10). 66 KQROŠEc (Anm. 4). 67 I. CREMOŠNIK, Rimski ostaci na gradini Zecovi [Restes romains sur la gradina de Zecovi], in: Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Nova serija 11 (Sarajevo 1956) 137-146. 68 A. ET J. ŠAŠEL, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt, Situla 5 (Ljubljana 1963) 166 (Indices: 4 christliche Inschriften); Drns„ Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt, Situla 19 (Ljubljana 1978) 234 (Indices: 6 christliche Inschriften); Drns„ Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt, Situla
20 Rajko Bratož
Funden haben sich einige auf internationaler Ebene wichtige Forscher des friihen Christentums der vergangenen Generationen beschaftigt wie beispielsweise Jacques Zeiller, Henri Leclercq, Rudolf Egger, Attilio Degrassi und Rudolf Noll69
• In der heute aktiven Generation bereicherten die friihchristlichen archaologischen Forschungen in Slowenien folgende international anerkannte Forscher auf dem Gebiet des friihen Christentums: Thilo Ulbert (und seine Mitarbeiter)7°, Gian Carlo Menis 71
, Sergio Tavano72, Giuseppe Cuscito73
, JeanPierre Caillet74
, Endre T 6th75, Franz Glaser76
, Alfons Zettler77 und Phil Mason78,
um nur einige zu nennen. Abschliefšend sei noch bemerkt, dafš der Versuch einer Einschatzung der Ent
wicklung und der Ergebnisse der Christlichen Archaologie in Slowenien in einer mehr als ein J ahrhundert langen Zeitspanne nur moglich ist im Vergleich mit der Entwicklung auf internationaler Ebene und besonders im Vergleich mit der Entwicklung in den Nachbarlandern. Objektiv gesehen ist ihr Beitrag zur gesamten friihchristlichen Forschung gering. Das Territorium des heutigen Sloweniens war im gesamten „Orbis Christianus" klein (etwas mehr als ein halbes Prozent der gesamten Flache des Imperium Romanum zur Zeit Kaiser Theodosius'), in ihm entstand kein iiberregional bedeutendes Zentrum des Christentums. Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien wurde bis in die neueste Zeit durch die recht kleine Zahl an Forschern und Institutionen bestimmt. Fiir ihre Zukunft ist es bedauernswert, da6 es an den slowenischen Universitaten noch immer keinen Lehrstuhl fiir Christliche Archaologie gibt. Auf der anderen Seite kann man aber feststellen, dafš die Christliche Archaologie in Slowenien
25 (Ljubljana 1986) 51Q (Indices: rund 120 christliche Inschriften, vorwiegend aus Dalmatien); B. MARUŠIC - J. SAŠEL, De la cella trichora au complexe monastique de St. Andre a Betika entre Pula et Rovinj, in: Arheološki Vestnik 37 (1986) 307-342 (hier 329-333). 69 DEGRASSI (Anm. 5); NoLL (Anm. 7); ZEILLER (Anm. 8); LECLERCQ (Anm. 8); EGGER (Anm. 22 und 25). 70 P. PETRU - Ttt. ULBERT (Anm. 9); als auslandische Mitarbeiter sind in diesem Band ebenfalls prasent: C. VoGELPOHL, Der Katalog der Kleinfunde aus der Kirchenanlage, 79-82; W. BACHRAN, Kleinfunde aus dem Kirchenbereich, 82-94; DERS., Das Graberfeld, 99-115. Vgl. auch Ttt. ULBERT, Zur Siedlungskontinuitat im siidi:istlichen Alpenraum (vom 2. bis 6. Jahrhundert n. Chr.). Dargestellt am Beispiel von Vranje (ehem. Untersteiermark), in: Von der Spatantike zum friihen Mittelalter. Vortrage und Forschungen 25 (1979) 141-157; DERS., Vranje bei Sevnica. Siedlungsgeschichtliche Untersuchungen, in: Arheološki Vestnik 30 (1979) 695-725. 71 G. C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle regioni delle Alpi Orientali, in: Antichita Altoadriatiche 9 (1976) 375-420; DERS., Rapporti ecclesiastici tra Aquileia e la Slovenia in era paleocristiana, in: Arheološki Vestnik 29 (1978) 368-378. 72 TAVANO (Anm. 11) 127-152. 73 Cuscno (Anm. 4); DERs. (Anm. 49) 757ff. 74 CAILLET (Anm. 6) 356-379. 75 T6TH (Anm. 4). 76 GLASER (Anm. 11) 65-87; 94f.; DERS. (Anm. 28) 207-211. 77 ZETTLER (Anm. 17) 108ff.; !86ff.; 218-221. 78 PH. MAsoN, Late Roman Crnomelj and Bela Krajina, in: Arheološki Vestnik 49 (1998) 285-313.
Die Entwicklung der Christlichen Archaologie in Slowenien 21
schon von den Anfangen an stark in die internationale Forschungstatigkeit eingebunden war. Ihre Verbindungen mit den Nachbarlandern waren die ganze Zeit intensiv. Parallel zu den Forschungen in Nordkroatien, Ungarn, Osterreich und Nordostitalien vertiefte sie die Kenntnis der spatantiken christlichen Strukturen in der historisch bedeutenden Kontaktzone zwischen dem antiken Italien und Illyricum.
Abbildungsnachweis: Abb. 1: Autor; Abb. 2: S. Ciglenečki, Friihchristliche Kirchenanlagen in Slowenien, in: H. R. Sennhauser, Friihe Kirchen im ostlichen Alpengebiet. Von der Spatantike bis in ottonische Zeit (Miinchen 2003) 593, mit freundlicher Genehmigung des Autors
Die Geschichte der friihchristlichen Archaologie in N ordkroatien ::·
Von BRANKA MIGOTTI
Die Geschichte der friihchristlichen Archaologie in Nordkroatien unterscheidet sich von jener der siidkroatischen Regionen Istriens und Dalmatiens. Wahrend sich letztere im Kiistenbereich vom Beginn oder wenigstens der Mitte des 19. J ahrhunderts an kontinuierlich bis heute entwickelt hat, kann man wohl ohne Ubertreibung sagen, dass die friihchristliche Archaologie im nordlichen Kroatien niemals in dieser ausgepragten Form vorhanden war. Dort war vielmehr die Erforschung des friihen Christentums von Anfang an Teil der ungarischen Geschichtsforschung, und dies aus zwei Griinden. Erstens war Nordkroatien zusammen mit Ungarn Teil einer gemeinsamen romischen geographischen und administrativen Region - namlich der Provinz Pannonia. Zweitens war Kroatien seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918 Teil des ungarischen Konigreiches innerhalb der Habsburgermonarchie. Aus diesem Grund war und ist es iiblich, dass ungarische Archaologen im Rahmen ihrer Studien zur Archaologie und Geschichte Pannoniens auch den kroatischen Teil der Provinz (eben Siidpannonien) mit einbeziehen 1• In der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart war und ist es unter ungarischen Fachkollegen iiblich, literarische, epigraphische und in geringerem Umfang auch archaologische Quellen in ihre Untersuchungen einzubeziehen, die aus dem heute kroatischen Teil der Pannonia stammen2
• Der Grund fiir die sparliche Verwertung archaologischer Quellen lag bis vor kurzem vor allem in der Tatsache begriindet, dass nur wenig friihchristliche Fundstellen und Objekte in Nordkroatien bekannt waren.
Ein gewisses Quantum an friihchristlichem archaologischen Material existiert in Nordkroatien. Darunter befinden sich auch einige Funde von auBerordentlicher Bedeutung und hohem Wert. Dennoch sah sich die archaologische Erforschung des Friihchristentums in dieser Region immer vom historischen und theologischen Forschungsinteresse an den Rand gedrangt, das sich mit der Ausbreitung des Christentums in der Region, der Hagiographie und Martyrologie,
,_ Ubersetzung aus dem Englischen durch Niclas-Gerrit Weilt 1 Vgl. A. LENGYEL - G. T. B. RADAN (Hg.), The Archaeology of Roman Pannonia (Lexington - Budapest 1980). 2 Vgl. T. NAGY, Die Geschichte des Christentums in Pannonien bis zu dem Zusammenbruch des romischen Grenzschutzes, in: Dissertationes Pannonicae, Ser. II. No. 12 (Budapest 1939); E. B. THOMAS, Christianity, in: LENGYEL - RADAN (Anm. 1) 193-206; E. T6TH, Das Christentum in Pannonien bis zum 7. Jahrhundert nach den archaologischen Zeugnissen, in: E. BosHOF - H. WoLFF (Hg.), Das Christentum im bairischen Raum von den Anfangen bis ins 11. Jahrhundert (Koln - Weimar - Wien 1994) 241-272; D. GA.sPAR, Christianity in Roman Pannonia. An evaluation of Early Christian finds and sites from Hungary, in: British Archaeological Reports Intern. Ser. 1010 (Oxford 2002).
Romische Quartalschrift- Supplementhefte
39: CLIFFORD W. MAASt, The German Community in Renaissance Rome 1378-1523, ed. by PETER HEERDE. 207 Textseiten, 1981. 41: RAINER WARLAND, Das Brustbild Christi. Studien zur spatantiken und friihbyzantinischen Bildgeschichte. 288 Textseiten und 139 Tafelabbildungen, 1986. 42: BIANCA KuHNEL, From the Earthly to the Heavenly Jerusalem. Representations of the Holy City in Christian Art of the First Millenium. 279 Textseiten und 125 Tafelabbildungen, 1987 (vergriffen). 43: ERWIN GATZ (Hg.), Der Campo Santo Teutonico in Rom. Band l: ALBRECHT WEILAND, Der Campo Santo Teutonico in Rom und seine Grabdenkmaler (868 Textseiten, 153 Tafelabbildungen, 4 Plane). Band II: ANDREAS ToNNESMANN und URSULA VERENA FISCHER PACE, Santa Maria della Pieta. Die Kirche des Campo Santo Teutonico in Rom. 119 Tafelabbildungen. 1988. 44: MARCEL ALBERT, Nuntius Fabio Chigi und die Anfange desJansenismus 1639-1651. Ein romischer Diplomat in theologischen Auseinandersetzungen. 301 Textseiten, 1988. 45: CHRISTOPH WEBER, Die altesten papstlichen Staatshandbiicher. Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegium Urbis 1629-1714. 794 Textseiten, 1991. 46: BERTRAM STUBENRAUCH, Der Heilige Geist bei Apponius - Zum theologischen Gehalt einer spatantiken Hoheliedauslegung. 256 Seiten, 1991. 47: STEPHAN KREMER, Herkunft und Werdegang geistlicher Fiihrungsschichten in den Reichsbistiimern zwischen Westfalischem Frieden und Sakularisation. Fiirstbischofe - Weihbischofe - Generalvikare. 512 Seiten, 1991. 48: AcHIM FuNDER, Reichsidee und Kirchenrecht. Dietrich von Nieheim als Beispiel spatmittelalterlicher Rechtsauffassung. 424 Seiten, 1993. 49: ERWIN GATZ (Hg.), Priesterausbildungsstatten der deutschsprachigen Lander zwischen Aufklarung und Zweitem Vatikanischem Konzil. Mit Weihestatistiken der deutschsprachigen Diozesen. 280 Seiten, 1994. 50: MICHAEL FIEDROWICZ, Das Kirchenverstiindnis Gregors des Grofšen. 416 Seiten, 1995. 51: MICHAEL F. LANGENFELD, Bischofliche Bemiihungen um Weiterbildung und Kooperation des Seelsorgeklerus. Pastoralkonferenzen im deutschen Sprachraum des 19. Jahrhunderts. 504 Seiten, 1997. 52: MARCEL ALBERT, Die katholische Kirche Frankreichs in der Vierten und Fiinften Republik. 224 Seiten, 1999. 53: DOMINIK BuRKARD, Staatskirche - Papstkirche - Bischofskirche. Die „Frankfurter Konferenzen" und die Neuordnung der Kirche in Deutschland nach der Sakularisation. 832 Seiten, 2000. 54: KNUT SCHULZ, Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die altesten Mitgliederverzeichnisse (1500/01-1536) und Statuten der Bruderschaft. 440 Seiten, 2002. 55: JuTTA DRESKEN-WEILAND, Sarkophagbestattungen des 4.-6. Jahrhunderts im Westen des Romischen Reiches. 488 Seiten, 2003. 56: MARTIN LEITGČ>B, Vom Seelenhirten zum Wegfiihrer. 320 Seiten, 2004. 57: KNtrT SCHULZ/CHRISTIANE ScHUCHARD, Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften im Rom der Renaissance. 720 Seiten, 2005. 58: EDELTRAUD KLUETING/HARM KLUETING/HANS-JOACHIM SCHMIDT (Hg.), Bistiimer und Bistumsgrenzen vom friihen Mittelalter bis zur Gegenwart. 272 Seiten, 2006. 59: RAINALD BECKER, Wege auf den Bischofsthron. Geistliche Karrieren in der Kirchenprovinz Salzburg in Spatmittelalter, Humanismus und Konfessionellem Zeitalter (1448-1648). 528 Seiten, 2006. 60: lNGO HERKLOTZ, Die Academia Basiliana. Griechische Philologie, Kirchengeschichte und Unionsbemiihungen im Rom der Barbarei, 312 Seiten, 2008. 61: THEOFRIED BAUMEISTER, Martyrium, Hagiographie und Heiligenverehrung im christlichen Altertum. 352 Seiten, 2009.
Theofried Baumeister:
Martyrium, Hagiographie und Heiligenverehrung
im christlichen Altertum
Romische Quartalschrift, Supplementband 61 352 Seiten, Leinen, Verlag Herder Freiburg/Br., € 88,ISBN 978-3-451-27141-0
Der Band mit Beitragen zur Frommigkeitsgeschichte des Christentums im Altertum enthalt zunachst eine chronologisch geordnete Reihe von Auf satzen zum Martyrium. Den Abschluss dieses Teils bildet eine langere Studie zum Thema „Konstantin der Grofše und die Martyrer", die hier erstmals veroffentlicht wird. Mit dem Ende der Verfolgungszeit wurden die Martyrer verstarkt als Helden gesehen, mit denen sich der Kaiser von der als verfehlt beurteilten Politik seiner Vorganger absetzte. Der Verf. behandelt sowohl die Dokumente der kaiserlichen Kanzlei wie auch die archaologischen Fragen der Kirchenstiftungen in Rom und Konstantinopel und beachtet besonders Tod und Begrabnis Konstantins. Ein zweiter Komplex umfasst Aufsatze zur hagiographischen Literatur vor allem des 3. bis 6. Jahrhunderts, wobei Schwerpunkte auf der Legendenforschung und der Hagiographie Agyptens liegen. Der dritte Teil vereinigt Studien liber die Genese der Martyrer- und Heiligenverehrung, ein Forschungsgebiet, das in letzter Zeit innerhalb der Altertumswissenschaften besondere Aufmerksamkeit gefunden hat. Das Niltal einschlie6lich Nubien und der Kult prominenter Heiliger sowie etwa die Michaelsverehrung bis ins Mittelalter sind Schwerpunkte der behandelten Themen. Eine Bibliographie des Autors bis 2006 und ein Register runden die Arbeit ab. - Das Werk ist bedeutsam for die Bereiche Kirchengeschichte, Patrologie, Christl. Archaologie, Liturgiewissenschaft, Koptologie, Christl. Orient, Klassische Philologie, Alte Geschichte, Legendenforschung, Theologie und Altertumskunde insgesamt.
HERDER
N 1
""""" f-1 i;i... ~ l: -o """"" o N .._. l.t') o """"" o z < ~ . f-1 i;i... to-!
~ l: u rJ)'.
~
~ ~ < ~ o ~ l: u rJ) to-!
~ :Q ~