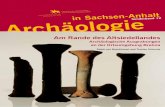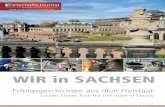Die Ausgrabungen auf der Rudelsburg in den Jahren 2005 und 2006 – ein Vorbericht. Archäologie in...
Transcript of Die Ausgrabungen auf der Rudelsburg in den Jahren 2005 und 2006 – ein Vorbericht. Archäologie in...
in Sachsen-Anhalt
Archäologie7/14
Richard-Wagner-Str. 9 06114 Halle Tel. 0345 · 5247 – 30 Fax. 0345 · 5247 – 351 [email protected]
2014
7
Archäologie in Sachsen-A
nhalt
Band 7 / 2014 Archäologie in Sachsen-Anhalt
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V.
impreSSum
Herausgeber Harald Meller, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Thomas Weber, Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V.
Erscheinungsweise jährlich, Beihefte unregelmäßig Bibliographische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliogra-phische Daten sind im Internet über http//portal.dnb.de abrufbar. gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier
isbn 978-3-9445o7-o7-1
issn 161o-6148
Wissenschaftliche Redaktion Bernd W. Bahn, Sven Roos, Manuela Schwarz, Ines Vahlhaus
Layout und Satz Rita Borcherdt, Iris Döring, Nora Seeländer
Gesamtredaktion Manuela Schwarz Für den Inhalt der Arbeiten sind die Autoren eigenverantwortlich.
© by Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen- Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlag Titelseite Perlen aus Wanzleben, Foto: A. Hörentrup (s. S. 215)
Umschlag Rückseite Grabkammer, Menhir und Turm von Langeneichstädt, Foto: E. Hunold (s. S. 3oo)
Schriften FF Celeste, BT News Gothic
Gestaltungskonzept CarolynSteinbeck•Berlin
Produktion Thomas Blankenburg, Rita Borcherdt, Iris Döring, Nora Seeländer, Marion Spring, Mario Wiegmann
Druck und Bindung Salzland Druck GmbH & Co. KG
Die Zeitschrift »Archäologie in Sachsen-Anhalt« dient den Zielen der Satzung, die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte des Bundes-landes zu fördern und breiten Bevölkerungskreisen zu vermitteln sowie einen großen Mitglieder- und Interessentenkreis aufzubauen.
issn 161o-6148isbn 978-3-9445o7-o7-1
in Sachsen-Anhalt
Archäologie7/14
Richard-Wagner-Str. 9 06114 Halle Tel. 0345 · 5247 – 30 Fax. 0345 · 5247 – 351 [email protected]
2014
7
Archäologie in Sachsen-A
nhalt
Band 7 / 2014 Archäologie in Sachsen-Anhalt
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V.
impreSSum
Herausgeber Harald Meller, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Thomas Weber, Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V.
Erscheinungsweise jährlich, Beihefte unregelmäßig Bibliographische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliogra-phische Daten sind im Internet über http//portal.dnb.de abrufbar. gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier
isbn 978-3-9445o7-o7-1
issn 161o-6148
Wissenschaftliche Redaktion Bernd W. Bahn, Sven Roos, Manuela Schwarz, Ines Vahlhaus
Layout und Satz Rita Borcherdt, Iris Döring, Nora Seeländer
Gesamtredaktion Manuela Schwarz Für den Inhalt der Arbeiten sind die Autoren eigenverantwortlich.
© by Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen- Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlag Titelseite Perlen aus Wanzleben, Foto: A. Hörentrup (s. S. 215)
Umschlag Rückseite Grabkammer, Menhir und Turm von Langeneichstädt, Foto: E. Hunold (s. S. 3oo)
Schriften FF Celeste, BT News Gothic
Gestaltungskonzept CarolynSteinbeck•Berlin
Produktion Thomas Blankenburg, Rita Borcherdt, Iris Döring, Nora Seeländer, Marion Spring, Mario Wiegmann
Druck und Bindung Salzland Druck GmbH & Co. KG
Die Zeitschrift »Archäologie in Sachsen-Anhalt« dient den Zielen der Satzung, die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte des Bundes-landes zu fördern und breiten Bevölkerungskreisen zu vermitteln sowie einen großen Mitglieder- und Interessentenkreis aufzubauen.
issn 161o-6148isbn 978-3-9445o7-o7-1
Aktuelle Forschungen
Weitere Beiträge
5 Harald Meller und Thomas Weber Vorwort
7 Franziska Knoll, Roland R. Wiermann und Christian-Heinrich Wunderlich
»weiss, schwarz und rot« – eine Gruppe bemalter Steinkistengräber der späten Bronzezeit im Kreis Bernburg
14 Daniel Berger, Maja Bettina Bremen, Kerstin Bullerjahn, Mirko Gutjahr, Marcus Jung und Ralf Kluttig-Altmann Das Projekt »Lutherarchäologie« – ein Forschungsbeitrag zum Reformationsjubiläum
24 Susanne Friederich, Björn Schlenker und Torsten Schunke Radiometrische Mehrfachbeprobungen an archäologischen Befunden aus Salzmünde, Saalekreis. Ein Diskussionsbeitrag zur Interpretation von 14C-Daten
33 Roland R. Wiermann Rhythm is it – Ein trichterförmiges Tonobjekt aus Halle-Radewell
36 Mechthild Meinicke Der Himmel über dem Erdwerk Salzmünde
40 Monika Hellmund und Volker Wennrich Zur Vegetationsentwicklung im östlichen Harzvorland – Ein Pollendiagramm vom Süßen See, Lkr. Mansfeld-Südharz
55 Sandra Sosnowski Der polykulturelle Fundplatz Quenstedt, Flur »Schalkenburg«, Lkr. Mansfeld-Südharz. Neue Ergebnisse zu Besiedlungsstruktur und -abfolge
70 Norma Literski-Henkel Ein bisher unbekanntes Lappenbeil aus dem Hortfundkomplex von Frankleben, Saalekreis
72 Diethelm Runck Schön verziert – Ein Sandsteinwirtel aus der Gemarkung Pouch, Lkr. Anhalt-Bitterfeld
76 Friedrich Karl Azzola Überlegungen zu dem verzierten Bruchstück eines Grabsteines aus der Wüstung Marsleben bei Quedlinburg, Lkr. Harz
79 Friedrich Karl Azzola Das Bruchstück einer hochmittelalterlichen Grabplatte – wiederverwendet als Eckstein an der Kirche in Cörmigk, Salzlandkreis
88 Daniel Berger und Michael Malliaris Frühe Belege mittelalterlicher Zinngießer in Zerbst, Lkr. Anhalt-Bitterfeld
In h A lt
Grabungsberichte
135 Artur Kögler† Noch einmal zu Wetzrillen und Näpfen
139 Ralf Kluttig-Altmann Gewusst, wo?! Die Erfassung der mittelalterlich-neuzeitlichen Funde Sachsen-Anhalts für eine Auskunfts-Datenbank
152 André Schürger Das 1. Internationale Treffen der Schlachtfeldarchäologen in Lützen (27.09.–04.10.2009)
159 Uwe Weiß Von Eiszeittieren und Kellern – Aus der Geschichte einer Burger Stadtparzelle
168 Matthias Sopp Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen an der geplanten Ortsumgehung (B 81) Kroppenstedt, Lkr. Börde
178 Peter Ettel und Christiane Schmidt Die Ausgrabungen auf der Rudelsburg in den Jahren 2005 und 2006 – ein Vorbericht
190 Michael Krecher und Ralf-Jürgen Prilloff Archäologische und archäozoologische Untersuchungen auf den kaiserzeitlichen Fundplätzen Volgfelde und Vinzelberg, Lkr. Stendal
213 Johannes Litzel Glasperlen für die Ewigkeit – Die Gräber von Wanzleben, Lkr. Börde
222 Ulrich Müller Grabungen auf der Trasse der Ortsumgehung Steuden, Saalekreis
230 Volkhard Hirsekorn Grubenhäuser und Wasserleitungen – archäologische Baubegleitung 2009 im Stadtkern von Arneburg, Lkr. Stendal
237 Volkhard Hirsekorn Vorgeschichtliche Feuerstellen, ein geschleiftes Stadttor, frühe Straßenbefestigungen und ein Bauopfer in Arneburg, Lkr. Stendal? – Archäologische Baubegleitung 2010
244 Ulrich Müller Grabungen auf der Trasse des Autobahnzubringers Halle-Neustadt
251 Volkhard Hirsekorn Stadttor, Hölzer, Brunnen – Archäologische Baubegleitung in Werben, Lkr. Stendal
258 Manfred Böhme Ein Komturhof in Werben, Lkr. Stendal. Annäherung an eine Parzelle des 13.–15. Jh.
266 Holger Rode Die archäologischen Untersuchungen im Bereich der Dommitzscher Straße in Bad Schmiedeberg, Lkr. Wittenberg, 2006
271 Hans-Joachim Born Die wechselnden Funktionen des 2006 in Bad Schmiedeberg, Lkr. Wittenberg, Dommitzscher Straße, gefundenen hölzernen Bauwerks
274 Uwe Weiß und Reinhard Heller Von Mönchen, Kranken, Armen und Bibliothekaren – Archäologische Untersuchungen um das ehemalige Refektorium des Franziskanerklosters in Stendal, Lkr. Stendal
In h A lt
Mitteilungen
Museen
Personalia
293 Peter Pacak Ein Kachelofen auf freiem Feld? – Neue Befunde aus dem schwedischen Lager von Latdorf, Salzlandkreis
299 Bernd W. Bahn und Wernfried Fieber† Exkursion zum Grab der Dolmengöttin Rund um Langeneichstädt im Gedenken an Bodendenkmalpfleger Gerhard Schmidt
304 Bernd W. Bahn und Wernfried Fieber† Die Dölauer Heide im Wandel der Zeiten Eine archäologisch-kulturgeschichtliche Tageswanderung
314 Bernd W. Bahn Faustkeil, Bandkeramik und Domfreiheit Exkursion zur Archäologie und Stadtgeschichte von Naumburg (Saale)
322 Mandy Poppe Bericht über die Jahrestagung der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V. vom 24. bis 26.04.2009 in der Leucorea, Wittenberg
332 Ines Vahlhaus Zwischen Lausitzer Kultur und Slawenburgen, Köhlermeilern und Spreewaldgurken Exkursion der Archäologischen Gesellschaft in die Niederlausitz 2010
341 Mechthild Klamm Wochenendexkursion der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V. nach Kalkriese und Umgebung (26. bis 28.06.2009)
346 Ines Vahlhaus 19. Jahrestagung der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt vom 23. bis 25.04.2010 in Bernburg
351 Thomas Weber Erstmals in der Landeshauptstadt – Jahrestagung der Archäologischen Gesellschaft im Jahr ihres 20jährigen Bestehens 2011
357 Ines Vahlhaus und Mechthild Klamm Moorleichen, Hünengräber, Wurten ... Exkursion der Archäologischen Gesellschaft nach Nordwestdeutschland vom 8. bis 10.07.2011
363 Ines Vahlhaus Jahrestagung mit Mitgliederversammlung und Neuwahl des Vorstandes der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V. vom 20. bis 22.04.2012 in Alterode
373 Thomas Ruppel Die archäologischen Sammlungen im Börde-Museum Burg Ummendorf
382 Uwe Lachmuth Museum Egeln
387 Andreas Neubert Zum Gedächtnis an Roland Fleischmann (26.10.1953–10.01.2010)
389 Jubiläumstage und Todesfälle ehrenamtlich Beauftragter für archäologische Denkmalpflege der Jahre 2011 bis 2013
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014178
g r a bu n g s be ri c h t e
In den Jahren 2oo5 bis 2oo6 führte der Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Rahmen des Teilprojekts »Die Höhensiedlungen der Mikro- und Makroregion um Nebra« innerhalb der DFG-Forschergruppe »Der Aufbruch zu neuen Horizonten. Die Funde von Nebra, Sachsen-Anhalt, und ihre Bedeutung für die Bronzezeit Europas« Ausgrabungen auf mehreren Höhensiedlungen in Sachsen-Anhalt durch. Im Zentrum der Untersuchungen stand hier vor allem die Rudelsburg (Abb. 1), stellte sie doch nach den Ausführungen von K. Simon (199o) eine vielversprechende Höhensiedlung der Früh-bronzezeit nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Mitteldeutschland dar, die entsprechende Siedlungsbefunde und auch eine Befestigungs-konstruktion erwarten ließ.
höhensiedlungen der Frühbronzezeit in Mitteldeutschland
Ein großräumig wirksamer Prozess der Zentrums-bildung mit teils vor- und frühurbanen Strukturen erfasste am Übergang von der Früh- zur Mittel-bronzezeit (Bz A2/B1) in Verbindung mit der kul-turellen Entwicklung im Mittelmeergebiet gesamt Südosteuropa, große Teile Mitteleuropas (Chrop-ovský 1982; Chropovský/Herrmann 199o; Gedl 1985; Jockenhövel 199o) und auch Mitteldeutsch-land, in dessen Folge es zur Gründung von Höhen-siedlungen und zum Bau von Befestigungen kam. Die Anzahl der Höhensiedlungen in Mitteleuropa aus der Übergangszeit von der Früh- zur Mittel-
bronzezeit beträgt annähernd 28o (Abb. 2)1. Sie finden sich im kartierten Gebiet nördlich des Alpenkamms in der Schweiz, Österreich, Süd-deutschland, Slowakei, Tschechien, Mitteldeutsch-land und Polen. Höhensiedlungen treten konzen-triert vor allem in der Südwestslowakei – vielleicht kennzeichnenderweise an der Kontaktstelle zu den donauländischen Tellkulturen, in der Hatvan-, Otomani-, Mad’arovce- und Jungaunjetitzer Kul-tur – entlang der Täler von Eipel, Gran und Waag auf und ziehen sich entlang der March und ihren Zuflüssen nach Böhmen. In Böhmen ist eine wei-tere Konzentration entlang der Moldau, Beraun und Eger zur Elbe hin zu erkennen. Die Elbe stellt eine Verbindung zu den nördlich des Erzgebirges gelegenen Höhensiedlungen in Mitteldeutschland, in Sachsen, Thüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt her. In Süddeutschland liegen zwar entlang des Flusslaufs der Donau und in allernächster Nähe viele Höhensiedlungen, doch schon wenig nördlich davon lichtet sich das Bild. In Franken finden sich vergleichsweise verstreut nur wenige Höhensiedlungen im Einzugsgebiet des Mains und nördlich des Thüringer Waldes an Saale und Unstrut sind nur vereinzelt Höhensiedlungen anzutreffen. Die Verbreitung endet dann endgül-tig auf der Höhe des Harzes. Im Westen könnten Höhensiedlungen vielleicht noch bis an die Leine gereicht haben, obgleich die Fundverhältnisse und Datierungen für die fünf Höhensiedlungen im südlichen Niedersachsen bislang noch recht unsicher und mit Fragezeichen zu versehen sind (Grote 1983/1984, bes. 31 f.). In Hessen scheinen Höhensiedlungen bislang gänzlich auszubleiben (Jockenhövel 198o, 39 f.). Damit ist die größte Ausbreitung von Höhensiedlungen am Übergang von der Früh- zur Mittelbronzezeit nach Norden und Westen beschrieben – der polnische Raum mit befestigten Siedlungen wie Biskupin, Jedrychowice oder der wieder neu untersuchten Siedlung von Bruszczewo bleibt hier zunächst unberücksichtigt (Gedl 1985a; Müller/Czebreszuk 2oo3; Ettel 2o1o)
Die Konzentration in der Slowakei, insbeson-dere im südwest- und angrenzenden mittelslowa-kischen Gebiet, tritt deutlich zutage. Die archäo-logisch untersuchten Burgen in dieser Region vermitteln mit aufwendigen Holz-Erde-Konstruk-tionen und auch steingeschützten Befestigungen wie z. B. Spišský Štrvtok und Nitriansky-Hrádok (Vladár 1977; Točik 1981; Marková 2oo1; Havlice/Hrubý 2oo2) zweifellos einen Eindruck von mili-
Die Ausgrabungen auf der Rudelsburg in den Jahren 2005 und 2006 – ein Vorbericht Peter Ettel und Christiane Schmidt, Jena
abb. 1 Höhensiedlung Rudelsburg, Burgenlandkreis.
179Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014
g r a bu n g s be ri c h t e
tärischer Stärke. Die Burgen in der Slowakei weisen zudem eine funktional gegliederte, sozial diffe-renzierte Struktur und Bebauung auf und besitzen nahezu protourbanen Charakter mit Arbeitstei-lung, Werkstattviertel und Gemeinschaftsleistun-gen wie Befestigungsmauer und Kultstätten. Je weiter man sich von den Zentren entfernt, schei-nen einerseits Höhensiedlungen eine geringere Rolle insbesondere nach Norden hin zu spielen, andererseits aber vor allem der Bau von Befesti-gungen auf diesen Höhensiedlungen quantitativ und qualitativ abzunehmen.
Für Mitteldeutschland ist die Bedeutung der Aunjetitzer Höhensiedlungen erst durch die Arbei-ten von Coblenz (1982) und vor allem Simon (199o; 199oa) in das Bewusstsein getreten. Noch 1982 stellte D. W. Müller das Fehlen von Höhensied-lungen im Gegensatz zur Věteřov-Kultur fest, wies aber auch bereits auf die Alteburg bei Arnstadt hin (Müller 1982, 123). In seinen Aufsätzen hat Simon zunächst den Forschungsstand für Mittel-deutschland zusammengefasst und in den über-regionalen Vergleich gestellt (Abb. 3). Demnach streuen die Höhensiedlungen von Dresden die Elbe abwärts über Mittelsachsen in den Hallenser Raum und von dort in das westsaalische Gebiet an der Unstrut bis in das nordwestliche Harzvor-land. Ferner ist es Simon gelungen, mit der Rudelsburg (Simon 1991) eine der bislang in der Fülle des Fundmaterials am besten bekannten
bronzezeitlichen Höhensiedlungen in der Region um Nebra herauszuarbeiten und gleichbedeutend neben die bereits länger bekannten wie Arnstadt (Ettel 2o1o, Nr. 128) und Dohna (Ettel 2o1o, Nr. 13o) in Mitteldeutschland zu stellen.
Insgesamt sind für den mitteldeutschen Raum nach Simon (199oa) ca. 12 Höhensiedlungen be-kannt. Neben Rudelsburg, Mutzschen, Dohna handelt es sich um Langenstein, Quenstedt, Halle- Moritzburg, Querfurt, Grabe, Orlishausen, Arn-stadt, Göhrich und Löbsal. Römhild liegt bereits südlich der Mittelgebirge.
Die Genese der einzelnen Höhensiedlungen in Mitteldeutschland macht deutlich, dass es sich um mehrmals aufgesuchte und genutzte, dazu oftmals befestigte Fundplätze handelt, die in der Vor- und Frühgeschichte wie im Mittelalter eine bedeut-same Rolle spielten. Ihre topographische Lage an wichtigen Kommunikationswegen wie Flüssen und Pässen ist auffallend und spricht für eine verkehrsgeographische und -regulierende Bedeu-tung bei Tausch und Handel.
K. Simon hat darüber hinaus die Nähe der Höhensiedlungen zu Kupferlagerstätten, Salzsie-dertum herausgestellt und versucht, in Verbindung mit Großgrabhügeln, Deponierungen, Metaller-zeugnissen, Briquetage, Importgütern und ein-geführten Rohmaterialien, die Fernkontakte und weitverzweigte Handelsverbindungen zu belegen, ihre Funktion im Sozialgefüge der Früh-/Mittel-
N
Legende
Höhensiedlung
befestigte Höhensiedlung
0 100 km
abb. 2 Höhensiedlungen in Mitteleuropa. Kartiert sind Deutschland, Tschechien, Slowakei, Polen, Österreich und Schweiz nördlich des Alpen-kamms.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014180
g r a bu n g s be ri c h t e
bronzezeit in Anlehnung an südosteuropäische Verhältnisse zu verstehen (Abb. 3). Folgerichtig hat er die Höhensiedlungen der älteren Bronze- zeit im Elb-Saale-Gebiet als regionale, politisch-administrative und ökonomische Zentralorte dargestellt.
Zwei Höhensiedlungen waren in Mitteldeutsch-land nachweislich befestigt – Mutzschen (s. u.; Ettel u. a. 2oo9) und Quenstedt, wo jeweils ein Graben belegt ist. Die Schalkenburg von Quen-stedt (Ettel 2o1o, Nr. 14o) ist ein nach Südsüdwest gerichteter Vorsprung eines Hochflächensporns von 16o m x 9o m mit ca. 1 ha Ausdehnung. Von 1967 bis 1986 fanden Ausgrabungen statt, die Gräber der Aunjetitzer Kultur, Einzelfunde wie eine zyprische Schleifenadel in einer spätbronze-zeitlichen Grube, aber ansonsten keine Besied-lungsbefunde im Innenraum erbrachten. Der Graben ist allerdings nach seiner stratigraphischen Position nur jünger als Bernburger Kultur und älter als Jüngstbronzezeit zu datieren (Simon 199o, 296 f.; Sosnowski 2oo6, 83). Bei einigen Siedlungen wie Löbsal, Dohna und auch Rudelsburg ist eine Befestigung aufgrund der Topographie vielleicht zu erwarten, aber nicht nachgewiesen, so dass für Mitteldeutschland der weitaus überwiegende Teil der Höhensiedlungen bislang als unbefestigt einzuordnen ist.
Die Größe der Höhensiedlungen betrug zwi-schen o,4 und 2,8 ha, ihre Flächen waren demnach im Durchschnitt weitaus kleiner als die der spät-bronze- oder eisenzeitlichen Anlagen. Neben Römhild (Ettel 2o1o, Nr. 141) weicht die mit 7oo m x 4oo m ca. 25 ha weitaus umfangreichere, nach drei Seiten steil abfallende Abschnittsbefestigung Alteburg bei Arnstadt (Ettel 2o1o, Nr. 128) von der Regel ab. Sie beherrschte einen wichtigen Passweg über den Thüringer Wald und wies im Fundgut neben Keramik auch Bronzeobjekte auf. Zudem lassen sich im Material deutliche Verbindungen zur Straubinger Kultur erkennen. Damit unter-scheidet sich die Alteburg auch in dieser Hinsicht von den Aunjetitzer Höhensiedlungen, wenn-gleich süddeutsche Kontakte auch andernorts fassbar werden wie z. B. auf der Rudelsburg.
Die Datierung der Höhensiedlungen beruht bislang hauptsächlich auf Keramik von Altfunden und Lesefunden – von neueren Grabungen wie bei Mutzschen oder Rudelsburg abgesehen. Gräber der Aunjetitzer Kultur liegen in Querfurt, Quen-stedt und möglicherweise in Grabe vor, ein Hort-fund in Orlishausen (Simon 199o, 288 ff.). Der Umfang der Funde ist unterschiedlich, von zahl-reichen Funden wie auf der Rudelsburg, Mutzschen bis hin zu wenigen Funden wie für Querfurt oder Langenstein, deren Datierungsansätze schon nach
N
0 50 km
36
62
63
50
44
11
58
17
24
28
40
82536
57
45
2927
1548
2
54
18
55
26
31
40
2338
10
46
42
3347
3032
64
43
59
14 57
3453
52
7 12
60
6
20
4
13
413 5 22
21
37
51
16
3549
39
61
19
1
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
CuCu
Sn
Sn
a b c
d e f
g h i
j k l
m n o
p qCuSn
Legende
abb. 3 Höhensiedlungen in Mitteldeutschland. Oben: 1 Arn-
stadt , 2 Rudelsburg bei Bad Kösen, 6 Dohna, 7 Göhrich,
8 Grabe, 10 Halle-Moritzburg, 11 Langenstein, 12 Löbsal,
14 Mutzschen, 15 Orlishausen, 17 Quenstedt, 18 Querfurt,
19 Römhild, a sichere Höhen-siedlungen, b fragliche Höhen-siedlungen, c sichere Fürsten-
gräber, d fragliche Fürstengräber, e reiche Horte mit mehr als 25 massiven Metallgegenständen, f reiche Horte mit mehr als 50
massiven Metallgegenständen, g links geschäftete Stabdolche, rechts verzierte Äxte und Beile verschiedenen Typs, h Doppel-äxte, i Halsringbarren, j Span-
genbarren, k Zungenbarren, l Tondüsen, m Rillenschlägel,
Verhüttungsreste, Gussformen, Gusskuchen, n Briquetage,
o Kupfererzaustritt im siedlungs- und/oder verkehrsnahen Bereich, p nicht näher lokalisierte Kupfer-
bzw. Zinnerzvorkommen, q rekonstruierte Verkehrs-
leitlinien.
181Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014
g r a bu n g s be ri c h t e
Simon freilich mit Unsicherheiten behaftet sind und bei neuerer Durchsicht nicht mit letzter Sicherheit bestätigt werden konnten (Wehmer 2oo6). Der frühere Abschnitt der Frühbronzezeit (A1) fehlt einheitlich (Simon 199o, 298 ff.). Ebenso wie in den südlichen Nachbargebieten Tschechien, Slowakei und Süddeutschland scheinen die Höhen-siedlungen erst in der zweiten Hälfte oder gegen Ende der Frühbronzezeit gegründet worden zu sein und teilweise bis in den Übergang zur Mittel-bronzezeit bestanden zu haben (Chropovský 1982; Jockenhövel 199o, 213; Rind 1999, 2 ff.).
Ungewiss in der Einschätzung ist die große Zahl von Höhensiedlungen, für die bislang nur wenige Keramikscherben, meist Streu- oder Lese-funde, eine Siedeltätigkeit anzeigen, aber offen bleiben muss, inwieweit sie nur periodisch auf-gesucht oder über längere Zeit hinweg tatsächlich intensiv besiedelt und genutzt waren. Dies gilt insbesondere für Mitteldeutschland.
Ist die Bedeutung der Höhensiedlungen in Mitteldeutschland somit seit den Arbeiten von Simon grundsätzlich bekannt, so lässt sich zusam-menfassend jedoch feststellen, dass der Forschungs-stand sich auf Lesefundmaterial und wenige, meist schon in älterer Zeit vorgenommene Grabungen stützt, die keine sichere Ansprache des Befesti-gungsaufbaus ermöglichen, kaum Siedlungsbe-funde erfassten und schon gar nicht eine Gesamt-beurteilung der Innenbebauung erlauben. Auf dieser Basis ist für Mitteldeutschland bislang keine übergeordnete weitergehende Diskussion über Bedeutung und Funktion der Höhensiedlungen in der Frühbronzezeit zu führen – etwa vergleich-bar der Slowakei mit einer Unterscheidung von Agrarzentren, Produktions- und Handelszentren, Stammeszentren, sakralen Zentralorten und Wach-stationen (Vladár 1977). Damit bleibt die Frage: Handelt es sich in Mitteldeutschland tatsächlich um Zentralorte von Macht, Herrschaft, Wirtschaft und Kult, die die Funktion von befestigten Kon-trollorten für den Handel an topographisch güns-tig gelegenen Punkten innehatten, oder aber auch um repräsentative Zeichen einer sozial und kul-tisch abgehobenen Herrschafts- und Priester-schicht, die sich vielleicht auch auf die Erzeugung und den Handel mit Kupfer und Salz begründeten? Oder anders ausgedrückt: Lebten die in den Fürs-tengräbern vom Typ Leubingen Bestatteten auf entsprechend repräsentativen Höhensiedlungen?
Diesem Forschungsdesiderat wird von der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte) seit 2oo5 mit neuen Untersuchungen im Teilprojekt »Die Höhensied-lungen der Mikro- und Makroregion um Nebra« innerhalb der DFG-Forschergruppe »Nebra« nach-gegangen. Dazu gehört einerseits die Analyse bekannter Höhensiedlungen und ihres Umfeldes (Wehmer 2oo6), andererseits sind die von K. Simon aufgeführten und vom Gelände wie Fundmaterial
aussichtsreichen Fundplätze Rudelsburg, Querfurt und Mutzschen mit weiteren Ausgrabungen unter-sucht worden. Zudem wurden mehrere durch Luftbildarchäologie und vorbereitende Begehun-gen allgemein in die Bronzezeit datierte Anlagen zu Beginn des Projektes systematisch mit Sonda-geschnitten untersucht und auch die in der Mik-roregion um den Mittelberg benachbarten Höhen-siedlungen in die Untersuchungen mit einbezogen. Auch neu entdeckte bzw. nach erneuter Durchsicht als frühbronzezeitlich erkannte Höhensiedlungen, wie der Alte Gleisberg (Ettel 2oo9), eventuell die Monraburg bei Beichlingen und der Clausberg bei Vogelsberg (Ettel 2o1o), wurden in das Projekt mit aufgenommen (Abb. 4), so dass letztendlich der Untersuchungsraum gesamt Mitteldeutsch-land mit Schwerpunkt auf Sachsen-Anhalt abdeckte.
P. E.
ausgrabungen auf der rudelsburg 2005 und 2006
Die Hauptuntersuchungen des Projektes fanden auf der Rudelsburg statt. Sie befindet sich in Sporn-lage 3 km südlich der Stadt Bad Kösen an der rechten Flanke des mittleren Saaletals, welches hier, an der sog. Porta Thuringica, knapp 15o m eingeschnitten ist, sich östlich davon aber beträcht-lich weitet (Simon 1991, 59–13o).
Der Sporn fällt im Norden teilweise fast senk-recht 1oo m zur Saale hin ab, im Süden und Westen wird das Plateau durch ein Seitental abgegrenzt, welches durch eine Erosionsrinne zusätzlich eingeschnitten ist (Abb. 5). Nur im Osten verbleibt ein wenige Meter breiter Sattel, der den leicht zu kontrollierenden Zugang zum 42o m langen, 2o–7o m breiten und somit ca. 2,1 ha großen Plateau bildet.
Bereits Ende des 19. Jh. wurden die ersten prähistorischen Funde von diesem Plateau gebor-gen. Seit dieser Zeit sind mehrere kleinere Gra-bungen durchgeführt worden, deren Dokumen-tation jedoch spärlich ausfiel und deren Funde heute zum Teil verschollen sind. Eine zeitliche Einordnung erfolgte nach den Grabungen von 193o in die Endphase der Urnenfelder- und den Übergang zur Hallstattzeit (Simon 1991, 63). Erst durch die systematischen Geländebegehungen von Manfred Böhme in den Jahren 1987 und 1988 konnte über Oberflächenfunde (Abb. 6) eine Besiedlung für den Sporn und Teile des Vorburg-geländes auch in der frühen Bronzezeit nach-gewiesen werden (Simon 1991, 1o7), welche die Grundlage für die Untersuchung in diesem Projekt bildete.
Die Ausgrabungen des Bereichs für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena fanden in den Jahren 2oo5 unter der Leitung von M. Böhme M.A. und 2oo6 unter der Leitung
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014182
g r a bu n g s be ri c h t e
von Dr. des. C. Schmidt und T. Spazier statt. Dabei wurde eine Fläche von ca. 415 m² mit insgesamt 83 Befunden aufgedeckt und dokumentiert.
Die Grundlage für die Grabungen bildete die geomagnetische Prospektion der Firma Schweit-zer-GPI, Burgwedel2, bei der im März 2oo5 eine 19o m lange und 23–33 m breite Fläche auf dem Vorburggelände untersucht wurde. Diese Fläche wurde anschließend in fünfzehn 2,5o m x 2,5o m großen Schnittquadraten ergraben (Abb. 5).
Das Grabungsareal von 2oo6 teilt sich in vier Schnitte. Davon befinden sich zwei Schnitte im Bereich des heutigen Vorburgplateaus und zwei Schnitte am Hang. Der Längsschnitt durch die Vorburgwiese ist 4 m breit und 6o m lang. Er er-fasst den Bereich, in dem von K. Simon (1991, 64) eine vormittelalterliche Befestigung angenommen wurde. Die anderen Schnitte sollten ein Gesamt-profil von der Plateaumitte bis über die Hang-terrasse hinaus liefern, um so die Entwicklung des Fundplatzes durch natürliche und anthropo-gene Faktoren zu beleuchten.
Durch die lange und intensive Nutzung des Geländes vom Mittelalter bis heute ist die Schich-tenfolge in den gegrabenen Bereichen sehr kom-plex. Die älteren Schichten sind immer wieder durch neuere Bodeneingriffe verändert worden. Dies zeigt sich auch und vor allem an den vielen
prähistorischen Scherben innerhalb mittelalter-licher Befunde und Kulturschichten. Somit muss mit einer starken, stellenweise vielleicht sogar mit der völligen Zerstörung der prähistorischen Be-fundzusammenhänge gerechnet werden.
Dennoch wurden 31 teilweise recht gut erhal-tene prähistorische Befunde dokumentiert, die entweder direkt in den Löss oder in eine Schicht mit prähistorischer Keramik eingetieft waren und teilweise auch unter den besonders mächtigen mittelalterlichen Schichten zutage kamen. Diese Schichten haben eine Stärke von bis zu 3,5o m. Im mittleren Bereich des Längsschnittes betragen sie mindestens 2 m, jedoch konnte ihre Unterkante bei der Grabung aus technischen Gründen nicht erreicht werden.
Die gut erhaltenen Grabungsfunde bestehen aus Keramik, menschlichen und tierischen Kno-chen, Hüttenlehm, Silex, Felsgestein, gebranntem Lehm und Eisen- und Bronzegegenständen.
Befunde
Bei den dokumentierten Befunden handelt es sich um fünf mittelalterliche Mauern, die Baugrube einer Mauer, zwei Verfüllschichten des mittel-alterlichen Kellers, 68 Gruben, zwei Gräben und fünf Pfostenlöcher.
Werra
elaaS
mlI
turtsnU
retslE .
W
erhO
edoBelaaS
reppiW
eblE
eßieN
Schw. Elstereer
pS
erhO
5
1
2
3
4
6
7
16
8
9
10
1112
13
14
15
g n i m ä l F
L a u s i t z e r L a n d r ü c k e n e
d i e
H r e
n e b
ü D
N
Höhensiedlungen Bz A2/B1
Fundort der Himmelsscheibe
Höhensiedlungen Bz D–Lt A/B
Legende
0 50 km
abb. 4 Höhensiedlungen in Mitteldeutschland. 1 Langen-
stein; 2 Quenstedt; 3 Halle- Moritzburg; 4 Querfurt; 5 Grabe; 6 Orlishausen; 7 Rudelsburg bei
Bad Kösen; 8 Arnstadt; 9 Römhild; 10 Mutzschen;
11 Göhrich; 12 Löbsal; 13 Dohna; 14 Monraburg
bei Beichlingen; 15 Clausberg bei Vogelsberg; 16 Alter
Gleisberg bei Graitschen.
183Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014
g r a bu n g s be ri c h t e
Zu den mittelalterlichen Mauerzügen gehört die Ringmauer, die das Plateau auf der Südseite umgibt (Abb. 7). Sie ist teilweise im Gelände heute noch sichtbar. In den Grabungsschnitten konnten sowohl die Innen- als auch die Außenseite erfasst werden. Die Breite beträgt hier zwischen 1,15 m und 1,28 m, die erhaltene Höhe des aufgehenden Mauerwerkes liegt bei ca. o,6o m, die des Funda-mentes bei ca. o,8o m. Sie war als Schalenmauer-werk aus in Kalkmörtel gesetzten Quadern mit Ritzputz aufgebaut, dessen Zwischenraum mit groben, unbehauenen Steinen verfüllt war. Das Fundament, welches in Schnitt 1 dokumentiert werden konnte, besaß ein Unterfundament aus in Lehm gesetztem Kalksteinbruch (opus spicatum) und ein Oberfundament aus Kalksteinbruch mit z. T. plattenförmig in den Lehm gesetzten Ortho-staten. In Schnitt 1 wurde im Profil direkt an die Mauer angrenzend eine Grube dokumentiert. Es könnte sich dabei um die Reste der Baugrube für die Mauer handeln.
Neben der Ringmauer wurden in den Gra-bungsschnitten von 2oo5 und 2oo6 die Mauern und die Verfüllung eines mittelalterlichen Kellers, die Grundmauern eines mittelalterlichen Gebäu-des direkt an der Ringmauer (Abb. 7), teilweise mit Baugrube, und zwei weitere einzeln stehende, S–N verlaufende Mauerstücke dokumentiert, die jedoch nicht weiter zu interpretieren sind.
Bei den Gruben kann eine Trennung in mittel-alterliche und prähistorische Befunde vorgenom-men werden.
Aus den mittelalterlichen Gruben sticht beson-ders die nicht ganz erfasste, scheinbar rechteckige Grube 38 heraus (Abb. 8). Sie besitzt eine Größe von mindestens 6 m x 4 m und war maximal ca. 2,3o m tief. Die Wandung verläuft sehr steil, teils senkrecht, der Boden gerade. Das umgebende Sedi-ment ist an der Wandung komplett und am Boden in großen Teilen durch Hitzeeinwirkung rötlich verfärbt. Diese Verfärbung ist im Wandungsbereich bis zu 16 cm, am Boden bis zu 1o cm dick. Die Ver-füllung der Grube besteht aus unzähligen Schich-ten, die hauptsächlich schräg von Ost nach West einfallen. Erwähnenswert ist hier die unterste Schicht. Es handelt sich dabei um eine sehr helle Schicht aus Kalk mit einigen Kalksteinen, Rot-lehm- und teils sehr großen Holzkohlestücken.
Bei den anderen Gruben handelt es sich um zumeist runde oder ovale, teils auch sehr unregel-mäßige Befunde mit kessel-, seltener trichter-, kegelstumpfförmigem oder rechteckigem Profil. Darunter befinden sich auch besonders große Befunde von ca. 3,6o m (Bef. 2o; 35) bzw. 5,6o m (Bef. 67) max. Ausdehnung.
Die prähistorischen Befunde der Rudelsburg setzen sich aus 29 Gruben, einem Pfostenloch und einem Gräbchen zusammen. Das Gräbchen wurde in Schnitt 17 dokumentiert. Es verläuft quer durch den hier ca. o,5o m breiten Schnitt. Im Profil zeigt es sich 1,38 m breit und knapp o,7o m tief. Der obere Bereich ist wannenförmig ausgebildet mit einer mittigen, trichterförmigen Eintiefung. Auf-grund der an dieser Stelle nur ausschnitthaften
B
A
C
D
E
F
G
H
160
N
0 100 m
abb. 5 Höhensiedlung Rudels-burg, Burgenlandkreis. Plan mit Grabungsschnitten 2005 und 2006 (rot).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014184
g r a bu n g s be ri c h t e
1 2
3
4
5 6 7
8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19
20 21 22
abb. 6 Höhensiedlung Rudelsburg, Burgenlandkreis. Auswahl älterbronzezeitlicher Keramik nach Simon (M. 1:4).
2
185Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014
g r a bu n g s be ri c h t e
Grabung verbietet sich eine Interpretation dieses Befundes.
Direkt an eine Grube angrenzend wurde das Pfostenloch Befund 83 entdeckt. Es befindet sich in Fläche 18 und ist bei einem Durchmesser von 3o cm 16 cm tief.
Bei den Gruben handelt es sich v. a. um im Planum runde, ovale oder unregelmäßige Befunde. Im Profil zeigen sich neun der Gruben kegel-stumpfförmig (Abb. 9), die anderen meist kessel- oder wannenförmig oder besitzen einen unrregel-mäßigen Profilverlauf.
Funde
Aus den Grabungsschnitten der Jahre 2oo5 und 2oo6 konnten insgesamt über 4o.ooo Keramik-scherben, dazu unzählige Tierknochen, Holz-kohle, gebrannter Lehm und Gegenstände aus Bronze, Eisen und Glas geborgen werden. Unter den mittelalterlichen Funden, die ca. 75 % des Fundmaterials ausmachen, fanden sich unter anderem die Figur eines Pferdes mit Reiter aus Ton, der Kopf eines Aquamanile und der Deckel einer Brakteatendose (Abb. 1o).
Die prähistorischen Funde umfassen ca. 12.ooo Keramikscherben, darunter über 25oo Rand-, Boden- oder verzierte Scherben. Sie stam-men u. a. aus den 29 prähistorischen Gruben, hauptsächlich jedoch aus den mittelalterlichen Befunden und Verfüllschichten. Der originale Fundzusammenhang wurde demnach zerstört, was die chronologische Einordnung der Funde erheblich erschwert.
Nach der ersten Sichtung der Keramik deutet sich an, dass neben vereinzelten Scherben und einigen Steingeräten aus dem Neolithikum auch die meisten metallzeitlichen Phasen im Material vertreten sind. Die Menge der frühbronzezeit- lichen Keramik, die unter den Altfunden etwa
mit einem Drittel vertreten war (Simon 1991, 84), wurde durch die Funde der Grabungen von 2oo5 und 2oo6 relativiert. Während nur wenige früh- und mittelbronzezeitliche Funde dokumentiert werden konnten, stieg die Anzahl der spätbronze-zeitlichen Keramik erheblich. Dieses drückt sich in einer relativ großen Zahl von riefenverzierter Keramik (Abb. 11,1), Scherben von Turbanrand-schalen (Abb. 11,2.4) und mehrfach facettierten Rändern (Abb. 11,3.5) aus.
Auch aus der älteren und jüngeren Eisenzeit konnten zahlreiche Funde geborgen werden. Es handelt sich unter anderem um Scherben mit flä-chendeckenden Warzen (Abb. 12,1.2), Kammstrich- (Abb. 12,7) und S-Stempelverzierungen (Abb. 12,3.4) und Drehscheibenware (Abb. 12,3–6).
C. S.
abb. 7 Höhensiedlung Rudels-burg, Burgenlandkreis. Grund-mauern eines mittelalterlichen Gebäudes direkt an der mittel- alterlichen Ringmauer (im Hin-tergrund).
abb. 8 Höhensiedlung Rudels-burg, Burgenlandkreis. Mittel- alterliche Grube mit verziegelter Wandung (Bef. 38).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014186
g r a bu n g s be ri c h t e
1
2
3
0 5 cm
abb. 9 Höhensiedlung Rudels-burg, Burgenlandkreis. Prähisto-
rische, kegelstumpfförmige Grube (Bef. 14) unter mittel-
alterlichem Mauerfundament.
abb. 10 Höhensiedlung Rudelsburg, Burgenlandkreis.
Mittelalterliche Funde. Kopf eines Aquamanile (1), Deckel
einer Brakteatendose (2), Figur eines Pferdes mit Reiter aus
Ton (3).
187Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014
g r a bu n g s be ri c h t e
Zusammenfassung und Fazit
Die Ergebnisse der Ausgrabungen3 auf der Rudels-burg sind in Bezug auf die Frühbronzezeit zusam-menfassend eher ernüchternd und bestätigen keineswegs das Bild von K. Simon (1991). Die Grabungen der Jahre 2oo5 und 2oo6 zeigen zwar, dass eine Erhaltung prähistorischer Befunde, z. B. aus der späten Bronze- oder der Eisenzeit, unter den zu erwartenden dominierenden Befunden und Schichten des Mittelalters durchaus gegeben ist, eindeutige frühbronzezeitliche Befunde fehl-ten jedoch gänzlich und auch die frühbronzezeit-lichen Funde sind gegenüber den früheren Lese-
funden deutlich unterrepräsentiert. Eine intensive Besiedlung in der Frühbronzezeit ist so, zumindest in den untersuchten Bereichen, auf der Rudelsburg auszuschließen. Es fehlen Hinweise auf Haus-bauten oder eine Befestigung. Das Gleiche gilt mit Ausnahme von Mutzschen auch für die übrigen untersuchten Höhensiedlungen. Der frühbronze-zeitliche Siedlungsniederschlag ist, wenn über-haupt vorhanden, weitaus geringer, als nach K. Simon zu erwarten war4.
Die Ausgrabungen in der Makroregion Nebra zeigten, dass es weit weniger eindeutig belegte Höhensiedlungen der Aunjetitzer Kultur in Mittel-
1
2
34
5
0 5 cm
abb. 11 Höhensiedlung Rudelsburg, Burgenlandkreis. Spätbronzezeitliche Funde. Riefenverzierte Keramik (1, 3), Scherben von Turbanrand- schalen (2, 4) und Keramik mit mehrfach facettierten Rändern (5).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014188
g r a bu n g s be ri c h t e
deutschland gibt, als nach K. Simon (199o) anzu-nehmen war. Die frühbronzezeitliche Innenbe-siedlung auf der Rudelsburg ist kaum belegt, Hinweise auf eine frühbronzezeitliche Befesti-gung fehlen. Eine Ausnahme bildet weiterhin Mutzschen, wo der bereits 197o entdeckte Graben in einer Grabung 2oo7 erneut erfasst werden konnte (Ettel u. a. 2oo9). Dort fand sich in den unteren Schichten ausschließlich frühbronzezeit-liches Material, das allerdings in der Zusammen-setzung noch Fragen aufwirft und so vor abschlie-ßender Analyse noch keine sichere Ansprache der Funktion des Grabens, insbesondere als Teil einer Befestigung, erlaubt. Ohne der abschließenden Beurteilung vorzugreifen, ist festzustellen, dass Aunjetitzer Höhensiedlungen in Mitteldeutsch-land sowohl hinsichtlich ihrer Befestigung als auch der Intensität und des Umfangs der Innen-
bebauung als weniger bedeutend einzuschätzen sind. Dies schränkt auch eine zentralörtliche Funktion der Höhensiedlungen ein und deutet insgesamt an, dass die Rolle der Höhensiedlungen in der Randregion der nördlichen Verbreitung der frühbronzezeitlichen Burgen Mitteleuropas in der bisherigen Forschung überschätzt wurde, auch als repräsentative Darstellung der politisch-sozialen Oberschicht, die bisher gerne als Abbild der Verhältnisse in der Otomani- und Mad'arovce-Věteřov-Kultur in der Slowakei und den angren-zenden Regionen gesehen wurde. Zurzeit muss davon ausgegangen werden, dass die in den mit-teldeutschen Fürstengräbern vom Typ Leubingen Bestatteten nicht auf entsprechend repräsenta-tiven Höhensiedlungen gelebt haben.
P. E./C. S.
1
2
3
4
5
6
70 5 cm
abb. 12 Höhensiedlung Rudelsburg, Burgenlandkreis.
Eisenzeitliche Funde. Scherben mit flächendeckenden Warzen
(1, 2), S-Stempelverzierung (3, 4), Kammstrichverzierung (7) und Drehscheibenware (3–6).
A n m e R k u n g e n 1 Siehe Kartierungsnachweis zu Abb. 2 mit jeweiliger Literatur zu den Hö-hensiedlungen in Ettel 2o1o.
2 C. Schweitzer, Magnetometer-Pro-spektion auf drei Fundstätten früh-bronzezeitlicher Höhensiedlungen in Rudelsburg, Großwangen und Kuckenburg; unpubl. Bericht (Burg-wedel 2oo5).
3 Grabungsbericht und Verlängerungs-antrag P. Ettel/C. Schmidt im DFG-Projekt; die örtliche Grabungsleitung hatten M. Böhme M. A. 2oo5, ab 2oo6 Dr. des. C. Schmidt und Gra-bungstechniker Th. Spazier inne.
4 Darüber hinaus erbrachten die Son-dagegrabungen auf den Höhensied-lungen jedoch Hinweise auf sehr gut
erhaltene Befestigungskonstruk- tionen und auch Innenbesiedlung des Jungneolithikums, der Spät- bronzezeit, genauso des Frühmittel-alters. Dazu zählt z. B. die Kucken-burg bei Esperstedt.
189Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · 7 · 2014
g r a bu n g s be ri c h t e
L i t e R At u R Chropovský 1982 B. Chropovský (Hrsg.), Beiträge zum
bronzezeitlichen Burgenbau in Mit-teleuropa (Berlin, Nitra 1982).
Chropovský/Herrmann 199o B. Chropovský/J. Herrmann (Hrsg.),
Beiträge zur Geschichte und Kultur der mitteleuropäischen Bronzezeit (Berlin, Nitra 199o).
Coblenz 1982 W. Coblenz, Zu den bronze- und früh-
eisenzeitlichen Befestigungen der sächsisch-lausitzischen Gruppe. In: B. Chropovský (Hrsg.), Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mittel-europa (Berlin, Nitra 1982) 149–157.
Ettel 2oo9 P. Ettel, Neue Forschungen auf dem
Alten Gleisberg. Neue Ausgrabungen in Thüringen 5, 2oo9, 17–26.
Ettel 2o1o P. Ettel, Die frühbronzezeitlichen
Höhensiedlungen in Mitteldeutsch-land und Mitteleuropa – Stand der Forschungen. In: H. Meller/F. Berte-mes (Hrsg.), Der Griff nach den Ster-nen. Wie Europas Eliten zu Macht und Reichtum kamen. Int. Sympo-sium in Halle (Saale) 16.–21. Februar 2oo5 (Halle [Saale] 2o1o) 351–38o.
Ettel u. a. 2oo9 P. Ettel/C. Schmidt/R. Grabolle, Die
Sondagegrabung 2oo7 auf dem Schloßberg von Mutzschen, Lkr. Leipzig. Arbeits- u. Forschber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 51/52, 2oo9/2o1o, 265–286.
Gedl 1985 M. Geld (Hrsg.), Frühbronzezeitliche
befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien zur Internationalen Arbeitstagung vom 2o.–22. Septem-ber in Kraków. Arch. Interregionalis (Warszawa 1985).
Gedl 1985a M. Gedl, Frühbronzezeitliche befes-
tigte Siedlung in Jędrychowice und die Probleme der Nowa Cerekiew-Gruppe in Oberschlesien. In: M. Gedl (Hrsg.), Frühbronzezeitliche befes-tigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien zur Internationalen Arbeitstagung vom 2o.–22. September
in Kraków. Arch. Interregionalis (Warszawa 1985) 27–44.
Grote 1983/1984 K. Grote, Höhensiedlungen vom mitt-
leren Neolithikum bis zur frühen Bronzezeit im südlichen Niedersach-sen. Die Kunde N. F. 34/35, 1983/1984, 13–26.
Havlice/Hrubý 2oo2 J. Havlice/P. Hrubý, Betrachtungen
über die Burgwälle und Höhensied-lungen am Ende der Frühbronzezeit in Südböhmen. In: M. Chytráček/ J. Michálek/K. Schmotz (Hrsg.), Arch. Arbeitsgemeinschaft Ostbayern 11 (Rahden/Westf. 2oo2) 42–61.
Jockenhövel 198o A. Jockenhövel, Bronzezeitliche
Höhensiedlungen in Hessen. Arch. Korrbl. 1o, 198o, 39–47.
Jockenhövel 199o A. Jockenhövel, Bronzezeitlicher
Burgenbau in Mitteleuropa. Untersu-chungen zur Struktur frühmetallzeit-licher Gesellschaften. In: Orientalisch-ägäische Einflüsse in der europäischen Bronzezeit. Ergebnisse eines Kollo-quiums. RGZM Monogr. 15 (Bonn 199o) 2o9–228.
Marková 2oo1 K. Marková, Befestigte Siedlungen
der älteren Bronzezeit im Süden der Mittelslowakei. In: A. Lippert/ M. Schultz/S. Shennan/M. Teschler-Nicola (Hrsg.), Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Internat. Arch. – Arbeitsgem., Symposium, Tagung, Kongress 2 (Rahden/Westf. 2oo1) 149–152.
Müller 1982 D. W. Müller, Die späte Aunjetitzer
Kultur des Saalegebietes im Span-nungsfeld des Südosten Europas. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 65, 1982, 1o7–127.
Müller/Czebreszuk 2oo3 J. Müller/J. Czebreszuk, Bruszczewo –
eine frühbronzezeitliche Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Groß-polen. Vorbericht zu den Ausgrabun-gen 1999–2oo1. Germania 81, 2oo3, 443–48o.
Rind 1999 M. M. Rind, Der Frauenberg oberhalb
Kloster Weltenburg I. Regensburger Beitr. Prähist. Arch. 6 [Höhenbefesti-gungen der Bronze- und Urnenfelder-zeit] (Regensburg 1999).
Simon 199o K. Simon, Höhensiedlungen der älte-
ren Bronzezeit im Elbsaalegebiet. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 73, 199o, 287–33o.
Simon 199oa K. Simon, Altbronzezeitliche Höhen-
siedlungen in Sachsen. In: B. Chro-povský/J. Herrmann (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte und Kultur der mittel-europäischen Bronzezeit (Berlin, Nitra 199o) 421–442.
Simon 1991 K. Simon, Ur- und frühgeschichtliche
Höhensiedlung auf der Rudelsburg bei Bad Kösen. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 74, 1991, 59–13o.
Sosnowski 2oo6 S. Sosnowski, Der polykulturelle
Fundplatz Quenstedt 4, Flur »Schal-kenburg«, Ldkr. Mansfelder Land. Untersuchungen zu Besiedlungs-struktur und -abfolge anhand der Siedlungsbefunde. Unpubl. Magister-arbeit (Halle [Saale] 2oo6).
Točik 1981 A. Točik, Nitriansky Hrádok-Záme-
cek. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Maďarovce-Kultur. Materialia Arch. Slovaca 3 (Nitra 1981).
Vladár 1977 J. Vladár, Zur Problematik der befes-
tigten Siedlungen der ausgehenden älteren Bronzezeit in der Slowakei. Marburger Stud. Vor- u. Frühgesch. 1, 1977, 175–192.
Wehmer 2oo6 M. Wehmer, Bronzezeitliche Höhen-
siedlungen und ihr Umfeld in Mittel-deutschland. Unpubl. Magisterarbeit (Jena 2oo6).
A b b i L D u n g S n A c h w e i S 1 R. Schwarz, LDA 2 Ettel 2o1o 3 Simon 199o, 3o1 Abb. 12 4 Ettel 2o1o 5 Simon 199o, 292 Abb. 5,
Grabungsschnitte 2oo5/2oo6 ergänzt
6 Simon 199o, 293 Abb. 6 7–12 Bereich f. Ur- und Früh- geschichte, FSU Jena