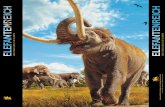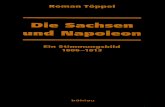Am Rande des Altsiedellandes: archäologische Ausgrabungen an der Ortsumgehung Brehna. Archäologie...
Transcript of Am Rande des Altsiedellandes: archäologische Ausgrabungen an der Ortsumgehung Brehna. Archäologie...
Rückenstärke: x mm(hier 25 mm) **** **
in Sachsen-Anhalt
ArchäologieRichard-Wagner-Str. 9 06114 Halle Tel. 0345 · 5247 – 30 Fax. 0345 · 5247 – 351 [email protected] www.archlsa.de
Archäologie in Sachsen-A
nhalt Sonderband: Brehna
12
Sonderband 12Archäologie in Sachsen-Anhalt
Sonderband 12
v. Rauchhaupt / Schunke
Am Rande des AltsiedellandesArchäologische Ausgrabungen an der Ortsumgehung Brehna
Ralph von Rauchhaupt und Torsten Schunke
herausgegeben von Harald Meller Halle (Saale) 2010
Am Rande des AltsiedellandesAchäologische Ausgrabungen an der Ortsumgehung BrehnaRalph von Rauchhaupt und Torsten Schunke
IMPRESSUM
Herausgeber Harald Meller, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte
Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier
isbn 978-3-939414-39-1
Erscheinungsweise unregelmäßig
Wissenschaftliche Redaktion Claudia Trummer • Frankfurt/M., Manuela Schwarz • LDA Technische Redaktion Thomas Blankenburg • Halle (Saale), Nora Seeländer • LDA
Für den Inhalt der Arbeiten sind die Autoren eigenverantwortlich.
© by Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landes-museum für Vorgeschichte Halle (Saale). Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover-filmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlagfoto vorne J. Lipták • München
Umschlagfoto hinten J. Lipták • München
Schriften FF Celeste, BT News Gothic Gestaltungskonzept Carolyn Steinbeck • Berlin
Layout und Satz Susanne Kubenz • Halle (Saale)
Produktion Susanne Kubenz • Halle (Saale)
Druck Salzland Druck GmbH & Co. KG, Staßfurt
Vorwort 5 Harald Meller
1. Rahmenbedingungen 7 Einleitung
2. Befunde 15 Befundanalyse
3. Neolithikum 25 Neolithische Funde und Befunde
4. Frühe Bronzezeit 43 Befunde der frühen Bronzezeit
5. Jungbronze- bis frühe Eisenzeit 57 Die jungbronze- bis früheisenzeitliche Siedlung
6. Slawenzeit 163 Eine slawische Siedlung des 9.–11. Jahrhunderts
7. Mittelalter und Neuzeit 175 Mittelalterliche und neuzeitliche Feld- und Flurbegrenzungen
8. Zusammenfassung 181 Von der Bandkeramik bis zur Neuzeit
183 Literatur
187 Autorenverzeichnis
5Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
Vorwort
Das Fach Vor- und Frühgeschichte erreichte in den letzten beiden Jahrzehnten nie erwartete Erfolge. Großartige Einzelentdeckungen verbun-den mit großflächigen Ausgrabungen ganzer Siedlungs- und Gräberareale erbrachten zusam-men mit einer rasanten Co-Entwicklung bei den Naturwissenschaften spektakuläre Ergebnisse in Umfang und Qualität, wie sie wohl kaum einer der Forschenden erwartet hätte. Im Zusammen-hang damit ist die Literatur selbst für Spezialge-biete nahezu unüberschaubar geworden. Entspre-chend großräumige Zusammenfassungen vor allem allgemein verständlicher Natur fehlen jedoch häufig.
All diese Erfolge können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vor- und frühgeschicht-liche Archäologie eine vergleichsweise junge Wissenschaft mit riesigen weißen Flecken nicht nur an der Peripherie, sondern gerade auch in Altsiedellandschaften ist. Dies betrifft in beson-derem Maße Mitteldeutschland, obwohl diese Region als relativ gut erforscht gilt. Ganze Zeit-spannen, wie etwa das mittlere Neolithikum, sind uns im Wesentlichen lediglich aus einer Fundgat-tung, nämlich den Gräbern bekannt. Im Allge-meinen verzeichnen wir für zahlreiche Perioden nicht nur das Fehlen vollständig ergrabener Sied-lungen oder gar von Siedlungslandschaften, son-dern sogar das Fehlen einzelner Hausbefunde. Ähnlich schlecht erforscht oder nur aus dem Luft-bild bekannt waren bis vor wenigen Jahren auch andere Befundgattungen, wie etwa die Kreisgra-benanlagen der verschiedensten Zeitstellungen. Lediglich den Gräbern und Gräberfeldern wurde stets eine große Aufmerksamkeit zuteil, wenn-gleich auch hier der Publikationsstand für einzelne Zeitabschnitte zu verbessern wäre.
Seinen Grund hatte dies vor allem in den beschränkten Möglichkeiten zum Öffnen großer Flächen seitens der Archäologie vor 199o. Zwar wurden in den Tagebauregionen großflächig
archäologische Kulturdenkmale vernichtet, doch gelang wegen des allumfassenden Diktates der Produktion sowie zu schwacher Kräfte seitens der Archäologie meist nur ein punktueller Rettungs-einsatz. Obwohl von hoher Forschungsqualität und weitsichtiger Planung geprägt, blieben not-gedrungen auch die anderen archäologischen Aufschlüsse, wie etwa Forschungsgrabungen, vergleichsweise klein.
Dies änderte sich erst mit der politischen Wende und einem Aufbau der Infrastruktur in der Mitte Deutschlands, wie er in der Vergangenheit seines-gleichen sucht. Damit ergab sich für diese Regio-nen erstmals die Möglichkeit zu flächendeckenden und großflächigen archäologischen Untersuchun-gen. Im Zuge dessen konnten zahlreiche Lücken in der Kenntnis der Kulturdenkmale sowie des Fundstoffes geschlossen werden. Besonders frucht-bar erweist sich hier das Zusammenwirken von so genannten Rettungsgrabungen im Rahmen der oben genannten Infrastrukturmaßnahmen und gezielten Forschungsgrabungen, beispielsweise in den Kreisgrabenanlagen von Goseck, Pömmelte, Belleben und an zahlreichen anderen Stellen.
Dass gerade im Bereich der großflächigen Ret-tungsmaßnahmen die Beobachtung und konse-quente Betreuung jedes einzelnen Bauvorhabens wesentlich ist, zeigen in exemplarischer Weise die ausgezeichneten archäologischen Ergebnisse auf der Umgehungsstraße der Ortschaft Brehna. Hier kamen bislang kaum bekannte Einzelbe-funde, wie etwa ein frühbronzezeitlicher Töpfer-ofen mit Sekundärbestattungen, aber auch groß-flächige Siedlungsstrukturen der Spätbronze- und Früheisenzeit zutage, die in ihrer Komplexität zusammen mit der dort nachgewiesenen Salzsie-derei eine empfindliche Lücke unserer bisherigen Kenntnisse schließen.
Die vorliegende Publikation dient zum einen – wie die meisten anderen Bände dieser Reihe – der Bekanntmachung der wichtigsten Funde und
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 20106
VO RWO R T
Befunde in der akademischen Welt, um den Kol-legen, die Spezialstudien betreiben, den Material-zugang zu ermöglichen; zum anderen macht sie aber auch den an der Archäologie interessierten Laien mit den hervorragenden Entdeckungen dieses Projektes bekannt. Dabei entheben die Publikationen dieser Reihe die Kollegen in den seltensten Fällen der Notwendigkeit, in den Archi-ven selbst die Originalbiopsie am Fundmaterial vorzunehmen. Schließlich handelt es sich hier lediglich um etwas erweiterte Vorberichte, die allerdings verhindern, dass das Fundmaterial, wie bei den Rettungsgrabungen und Notbergungen in der Nachwendezeit häufig geschehen, unbeach-tet von der wissenschaftlichen Gemeinschaft in den Magazinen der Landesämter verwindet.
Auf Großgrabungen der vorliegenden Art bedarf es herausragender Projekt- und Grabungs-leiter, die auf Basis der richtigen wissenschaft-lichen Fragestellung entschieden, schnell und zielstrebig handeln. Dies war bei der vorliegenden Maßnahme in besonders glücklicher Weise der Fall. Projektleiter und Organisator war in bewähr-
ter Weise Herr Dr. Dresely, dessen Organisations-talent, großer Erfahrung und Weitsicht wir auch zahlreiche andere erfolgreich durchgeführte Groß-projekte des Landes verdanken. Grabungsleiter vor Ort waren Herr Ralph von Rauchhaupt sowie Herr Torsten Schunke, der seit vielen Jahren immer dann vor Ort war, wenn es Bedeutsames zu finden gibt, oder aber es wurde Bedeutsames gefunden, wenn er vor Ort war. Das Engagement beider, denen ich auch für die schnelle Abfassung des Textes danke, zeigt sich sicherlich am deutlichsten in ihren Experimenten zu den in der eisenzeit-lichen Siedlung aufgefundenen Kochgruben.
Keines dieser Projekte wäre erfolgreich ohne verständnisvolle und kulturinteressierte Partner auf Seiten der Bauausführenden. Hier sei stellver-tretend Herrn G. Puhlmann für das Autobauamt Halle (heute Landesbetrieb Bau Süd) für die stets produktive Zusammenarbeit gedankt.
Harald Meller
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 43
4. Frühe Bronzezeit
Befunde der frühen Bronzezeit
Innerhalb der Suchschnitte der Voruntersuchung auf Fläche 1 waren einzelne frühbronzezeitliche Befunde (Siedlungsgruben, Einzelgefäße) aufge-deckt worden, so dass die Hoffnung bestand, den randlichen Bereich des bekannten, aber undatier-ten Bodendenkmals zu fassen und dokumentieren zu können, das Anfang der 199o er Jahre beim Bau eines großen Einkaufsmarktes großflächig zerstört wurde. Im Verlauf der nachfolgenden archäologischen Untersuchungen konnte eine lockere Streuung frühbronzezeitlicher Befunde im mittleren und nordöstlichen Teil der Fläche 1 und im südlichen Teil der Fläche 2 beobachtet werden1 (Abb. 1). Mehrheitlich handelte es sich um Siedlungsgruben und Einzelgefäße sowie um Bestattungen innerhalb einer technischen Anlage und einer Siedlungsgrube. Pfostengruben, die zu Hausgrundrissen zusammengefasst werden konn-ten, fielen für die Früh bronzezeit gänzlich aus.
Einzelgefäße
Erstaunlich waren die Funde dreier Einzelgefäße, bei denen keine oder nur geringe Befundverfär-bungen erkennbar waren (Abb. 2). Eines war der Boden mit einem Stück des Wandungsansatzes einer Tasse, leider ohne Umbruch (Bef. 1, Abb. 3,2). Dieses Gefäß stand ohne sichtbare Grube im Anstehenden. Die Tassenfragmente zeigen eine braun-dunkelbraune Färbung, besitzen einen mittelharten Brand und sind mittelfein gemagert. In der Tassenfüllung konnten einige Stücke kal-zinierter Knochen beobachtet werden, so dass eine Interpretation als Urne nahe liegend war.
Das andere Gefäß (Bef. 1o, Abb. 3,1), ca. 4o5 m südwestlich des Erstgenannten gelegen, wies eine ganz ähnliche Befundsituation auf. Auch hier war im Anstehenden der Ring eines Gefäßrestes erkennbar, der einzelne kalzinierte Knochenfrag-mente enthielt (nach grober Ansprache von
H.-J. Döhle [LDA] handelt es sich um den Leichen-brand eines Tieres in der Größe eines Hasen oder eines kleinen Hundes). Das geborgene, rötlich-braune, gut geglättete, tassenartige Gefäß besaß einen eingezapften Henkel. Seine zeitliche und kulturelle Einordnung gestaltet sich aufgrund der fragmentarischen Erhaltung schwierig. Es könnte sich um eine weniger stark profilierte Tasse der Mittelstufe der Aunjetitzer Kultur gehandelt haben. Die Einzapfung der Henkel ist charakte-ristisch für Gefäße dieser Kultur (Schunke 2ooo, 39 Anm. 16o; 61 Anm. 321), kommt jedoch auch an eisenzeitlichen Gefäßen gelegentlich vor. Bei dem bestimmbaren Leichenbrand handelt es sich um die Reste eines Tieres. Der Befund ist konse-quenterweise als Tierbrandbestattungen anzu-sprechen. Die sehr schlechte Erhaltung der beiden Befunde deutet darauf hin, dass die Urnen nur flach eingegraben waren. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass sich im Umfeld noch weitere Gräber befunden haben dürften, die der jahrhunderte-langen Überpflügung zum Opfer gefallen sind. Brandbestattungen sind in der Aunjetitzer Kultur Mitteldeutschlands bisher nicht sicher belegbar (Kluttig-Altmann 2oo1, 115), wohingegen sie im Karpatenbecken in dieser Zeit die dominierende Bestattungsform sind (Primas 1978, 77 ff.; 8o f.). Insofern ist eine eisenzeitliche Datierung der Urnen wahrscheinlicher. Eine 14C-Analyse eines der Leichenbrände ist in Auftrag gegeben2.
Als sicheres Einzelgefäß der Aunjetitzer Kultur wurden im südlichen Teil der Fläche 1 die Reste eines groben Siedlungsgefäßes von brauner bis dunkelbrauner Farbe geborgen. Die stark zer-scherbten Gefäßreste lagen unterhalb der Humus-deckschicht (Bef. 11) auf dem anstehenden Lehm. Kalzinierte Knochenstücke wie in den beiden angesprochenen Befunden waren nicht zu beob-achten.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
44
Siedlungsbefunde
Neben den Einzelgefäßen konnten acht Siedlungs-gruben dokumentiert werden, die einen chrono-logischen, nicht aber räumlichen Zusammenhang besaßen. Eine kleinere Konzentration an Sied-lungsbefunden zeichnete sich im mittleren Teil der Fläche 1 ab, eine zweite, leichte Häufung im nördlichen Bereich der Fläche 1 und an der süd-
lichen Grenze von Fläche 2. Allgemein kann festgestellt werden, dass die frühbronzezeitlichen Siedlungsgruben in der Grundfläche relativ groß waren und eine stärkere Eintiefung als jene aus den anderen vertretenen Zeithorizonten aufwie-sen. Mit ihren Grubenmaßen übertrafen sie die anderen Siedlungsgruben weit und lagen in der mittleren Länge bei 1,89 m/Median 1,95 m, in der
Abb. 1 Grabungsplan mit früh-bronzezeitlichen Befunden (rot).
F RÜ H E B RO N Z E Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 45
durchschnittlichen Breite bei 1,53 m/Median 1,47 m und im Tiefenmittel bei o,68 m/Median o,69 m. Im Planum wiesen sie einen unregelmä-ßig-rundlichen oder unregelmäßig-ovalen Grund-riss auf und im Profil zeigten sie in drei Fällen eine Kastenform, in drei weiteren Fällen eine Trichterform und in je einem Fall eine Wannen- oder eine unregelmäßige Form. Sechs der acht Gruben wiesen eine Schichtung auf und zwei waren inhomogen verfüllt (vgl. Kap. 2).
Eine Stratigraphie war bei Bef. 93 zu beobach-ten (Abb. 4), der von einem slawischen Gruben-haus überlagert wurde, welches mittelneolithi-sches (Baalberger) Keramikinventar barg. Die aus dieser Grube stammenden Gefäßreste können mehrheitlich der Siedlungsware zugewiesen wer-den und besitzen eine hellbraun-braun-dunkel-
braune Färbung, eine mittelgrobe bis grobe mineralische Magerung sowie einen mittelharten Brand. Einzelne Scherben der meist tonnenför-migen Gefäße zeigen einen groben, warzigen Schlickerüberzug. An Handhaben sind Knubben und Henkel zu nennen. Aus diesem Spektrum hebt sich die Profilscherbe eines weißlich-hell-grau-hellbraunen Zapfenbechers heraus, auf des-sen Schulter eine Doppelknubbe saß, die stark an einen rudimentären Schwalbenschwanzgriff erin-nert (Abb. 5,1). Weiterhin lag in dieser Grube das Fragment eines dickwandigen grob gearbeiteten
Abb. 2 Kalzinierte Knochen innerhalb einer fragmentarisch erhaltenen Tasse (Bef. 1, Planum 1).
Abb. 3 Als »Urnen« genutzte Gefäße der Vorrömischen Eisenzeit (vgl. Anm. 2), oben die Tasse aus Bef. 10,
unten aus Bef. 1, M. 1:3.
Abb. 4 Bef. 93/ Profil 1. Die frühbronzezeit liche Siedlungs-grube wurde von einem slawischen Grubenhaus überlagert.
Abb. 5 Gefäße aus einer Siedlungsgrube (Bef. 93) der Aunjetitzer Kultur; M 1:3.
2
4
5
3
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
46
Topfes mit Zylinderhals, das einen von einer Knubbe begleiteten, kleinen senkrechten, rund-stabigen Henkel aufweist (Abb. 5,2).
Das Fragment einer stark profilierten, klassi-schen Tasse stammt aus Bef. 94 (Abb. 6,1), aus dem weitere Scherben grober Siedlungsware geborgen wurden. Das Fundgut aus den Gruben Bef. 43, 67 und 98 lässt sich in das Spektrum der schon genannten Siedlungsware einordnen und zeigt zylindrische oder tonnenförmige Gefäße, deren Hals geglättet und deren Unterteil mitunter mit einem warzigen Schlickerüberzug versehen war. Besonders gut gearbeitet ist ein großes, geschweif-tes Gefäßfragment aus Bef. 67, das ein geglättetes Oberteil und ein schräg warzig geschlicktes
Unterteil besitzt (Abb. 7). Als Verzierungselemente traten auch umlaufende plastische Fingertupfen-leisten auf. Die Keramik weist mehrheitlich einen Mischbrand auf, ist von rötlich brauner bis braun-grauer Färbung und mittelgrob gemagert. Neben gröberer Siedlungsware wie der Randscherbe eines zylindrischen Gefäßes mit Bandhenkel (Abb. 6,3) und einem Steinbeilfragment (Abb. 8) stam-men die Scherben einer weiteren klassischen Tasse aus Bef. 13 (Abb. 6,2), der Bef. 12 (dem Kera-mikbrennofen s. u.) südwestlich vorgelagert war.
Auch aus Bef. 95 stammt ein Steinbeil (Abb. 9). Diese Beilform dürfte typisch für die Aunjetitzer Kultur sein, wenn auch erst vier Exemplare aus Felsgestein in ihrem nördlichen Verbreitungsge-biet (Mitteldeutschland bis Schlesien) belegt sind (Zich 1996, 243 und Karte 1o7). Grund für die Annahme, dass sie tatsächlich erst in der frühen Bronzezeit hergestellt und nicht älteren jungstein-zeitlichen Gräbern oder Siedlungshinterlassen-schaften entnommen worden sind, ist die Beob-achtung, dass beide in Brehna aufgefundenen Exemplare wohl aus dem gleichen graugrünen Gestein bestehen und nur sehr grob, nicht in der üblichen neolithischen Manier zugerichtet sind.
Ein Keramikbrennofen der frühen Bronzezeit
Zunächst unscheinbar wirkte auf Fläche 1 eine etwa 1,67 m x 1,5o m große, unregelmäßige, leh-mig-humose, rötlich braun-graue Verfärbung, auf deren Planum sich im östlichen Teil eine stärkere Konzentration gebrannten Lehms befand und die mit einigen kalzinierten Knochen und etwas Keramik durchsetzt war. Nach Aufnahme des ersten Planums wurde ein Kreuzschnitt angelegt und mit dem Abteufen der einzelnen Kästen begonnen. Ab Planum 2 zeichnete sich deutlich ein im Grundriss ovaler, 1,76 m x 1,62 m großer Grobenofen ab, dessen aschige, lehmig-humose Füllung mit Holzkohleflitter, sekundär gebrann-ten Keramikfragmenten, Stücken einzelner Rei-beplatten und zerfeuerten Steinen sowie Teilen der Ofenkuppel durchsetzt war (Abb. 1o). Als
Abb. 6 Funde der Aunjetitzer Kultur aus verschiedenen
Befunden. 1 Bef. 94, 2–3 Bef. 13, M 1:3.
Abb. 7 Siedlungsware aus Bef. 67; M 1:3.
F RÜ H E B RO N Z E Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 47
besondere Funde traten daneben in großen Men-gen Fragmente von Ovalwannen auf. Deutlich war im Randbereich des Befundes die angeziegelte Ofenwandung erkennbar, die sich bis in den Anstehenden fortsetzte. Beim weiteren Abteufen (Abb. 11) war festzustellen, dass sich die Frag-mente von Ovalwannen hauptsächlich auf den südlichen und südwestlichen Bereich des Ofens konzen trierten, Gefäßfragmente, Bruchstücke der Ofenkuppel und Steine in der nördlichen Hälfte gehäuft vorkamen. Im Planum 3 des Befundes (Abb. 12) konnte eine dem Ofen im südöstlichen Bereich vorgelagerte, unregelmäßige, etwa 1,5o m x 1,38 m große, mit Humus, Holzkohleflitter und Asche verfüllte Grube beobachtet werden, die als Schürgrube zu interpretieren war – eine Lücke in der Ofenwandung im südöstlichen Teil dürfte somit das Schürloch gewesen sein.
Eine Änderung der Befundsituation zeichnete sich in Planum 6 ab (Abb. 13 und 14). Auch hier waren starke Konzentrationen von Ofenkuppel-bruchstücken, Scherben sekundär gebrannter Gefäße und Ovalwannen (Abb. 15) im östlichen wie im westlichen Bereich der Ofengrube festzu-stellen. Zur Überraschung der Ausgräber lagen zwischen diesen Funden eingebettet die Bestat-tungen einer adulten und einer infantilen Person. Beide Skelette waren Süd-Nord ausgerichtet und befanden sich in rechter Hocklage. Diese Merk-male entsprechen dem aus der Aunjetitzer Kultur gewohnten Bild. Das Skelett des Kindes war unmittelbar östlich im Winkel von Beinen und Oberkörper des Erwachsenen niedergelegt wor-
den und blickte nach Osten. Der Schädel der erwachsenen Person war stark verdreht und der Unterkiefer abgetrennt, was eine Störung der Skelettlage durch Wühltiere wahrscheinlich macht. Beide Skelette waren gut erhalten bei einem etwas stärkeren Abbau der Knochensub-stanz des Kinderskeletts (Abb. 16). Auffällig waren bei beiden Bestatteten die stark angehockten Beine und die vor dem Brustkorb verschränkten Arme. Wie sich später herausstellte, waren beide direkt auf der Sohle des Ofens niedergelegt wor-den (Abb. 17 und 18). In den Profilen zeichnete sich die Ofengrube deutlich ab und besaß eine Kastenform. Die Verziegelungsspuren waren
Abb. 8 Steinbeilfragment aus Bef. 13.
Abb. 9 Steinbeil aus Bef. 95.
Abb. 10 Planum 2 des Keramikbrennofens (Bef. 12).
8
9
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
48
besonders stark oberhalb der Sohle nachzuweisen, wie es für eine Grube charakteristisch ist, auf deren Boden ein intensives Feuer gebrannt hat.
Die aus dem Ofen geborgene Gefäßkeramik weist mehrheitlich eine bauchige Tonnenform (Abb. 19) auf und ist mit Knubben, plastischen Leisten, die auch gekerbt auftraten, bzw. Finger-tupfenleisten verziert. Unterhalb dieser Zierleiste ist bei einzelnen Gefäßen eine grobe warzige
Schlickung zu beobachten. Mehrheitlich weisen die Gefäßreste einen starken Sekundärbrand auf, sie waren teilweise aufgebläht und zerschmolzen. Neben dieser Siedlungsware ist das Fragment einer stark profilierten, klassischen Tasse hervor-zuheben, die als Feinkeramik anzusehen ist.
Wie bereits erwähnt, stammt aus der Ofenfül-lung eine Vielzahl von Fragmenten der sonst seltenen Ovalwannen (Abb. 2o und 21). Sie weisen einen oxydierenden Brand, eine länglich-ovale Form sowie einen abgesetzten, geraden Boden auf. Wie üblich sind sie recht grob geformt und bestehen aus einer Bodenplatte, an welche die plattigen Wandungsteile angesetzt wurden. Auf-fällig ist die extrem dünne Wandung, die sich zum Rand hin verjüngt. Die pflanzliche Magerung, die sich durch feine, strichartige Hohlräume zu erkennen gibt, in denen zum Teil noch verkohlte, nadelartige Pflanzenfasern stecken, ist charakte-ristisch (Matthias 1976, 376). Durch den Brehnaer Befund ist belegt, dass mindestens zwei Varianten
Abb. 11 Bei der Freilegung des Keramikbrennofens.
Abb. 12 Planum 3 des Ofens (Bef. 12).
Abb. 13 Detail Kasten D/ Planum 5 des Ofens, bereits
erkennbar die Schädel der beiden Bestattungen.
12
11
F RÜ H E B RO N Z E Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 49
gleichzeitig existierten: Die feiner gearbeitete Form ist etwas niedriger und dünnwandiger als die gröbere Variante. Das Maß der einzelnen Salzsiedewannen schwankte zwischen 38 und 45 cm Länge, 1o–12 cm Breite und 7–8 cm Höhe. Nach Matthias (1976, 373–394 besonders 376 ff.) gehören die aus dem Brehnaer Ofen stammenden Salzsiedewannen damit zu den großen Wannen der im mittleren Saaleraum auftretenden Brique-tageform der frühen Bronzezeit. Ovalsäulen, die als Stützen der Salzsiedewannen gedient haben könnten, wurden nicht beobachtet.
Kann auch kein direkter Nachweis für eine frühbronzezeitliche Salzproduktion um Brehna erbracht werden, so gelingt dieser indirekt über die für einen Transport ungeeigneten, fragilen Salzsiedewannen. Zudem deutet die Tatsache, dass die Wannen und Gefäße nicht nur durch Hitze zerplatzt, sondern teilweise auch über die Risse hinweg stark verzogen sind, darauf hin, dass sie vor dem Überfeuern zusammengesunken sein müssen. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie nicht sekundär gebrannt, sondern beim primären Brand zerbarsten, somit als Fehlbrände anzusprechen sind. Sie wurden vor Ort hergestellt. Ein Zusammenhang zwischen den Gefäßen und der Ofengrube, in der sie gefunden wurden, liegt dabei nahe. Mit einiger Sicherheit kann der Befund daher als Keramikbrennofen angespro-chen werden, der sekundär als Bestattungsplatz genutzt wurde. Der Ofen war über o,5 m in den anstehenden Boden eingegraben und, wie ein-zelne Bruchstücke der Wandung belegen, über-kuppelt. Diese Kuppel dürfte direkt auf die ursprüngliche Oberfläche aufgesetzt worden sein, da der untere, als Brennraum dienende Bereich eine Verziegelung des anstehenden Lehms an Wandung und Sohle aufwies. Dieser bildete auf-grund seiner Stabilität und Konsistenz bereits eine sehr geeignete Wandung, so dass keine Ofenwand eigens eingebracht werden musste, wie es auch für die später vorzustellenden spätbronze-/ früheisenzeitlichen Erdöfen experimentell nach-gewiesen werden konnte (vgl. Kap. 5). Eine Loch-tenne besaß der Brehnaer Ofen wohl nicht, da entsprechende Bruchstücke, wie auch überregio-nal für diese Zeit zu beobachten, fehlen. Töpfer-öfen konnten bisher aus der frühen Bronzezeit in
Mitteldeutschland noch nicht nachgewiesen wer-den. Ein einziger möglicherweise so zu deutender Befund aus Meuselwitz, Lkr. Altenburger Land (Billig 1958, 66 f. und Zich 1996, 37, 514), wird in seiner kulturellen Zuweisung sehr unterschiedlich bewertet.
Nach Beendigung des Brennprozesses dürfte die Ofenwandung aufgebrochen und die Keramik üblicherweise entnommen worden sein. Vermut-lich war es während des Brennprozesses in Brehna zu einem »Unfall« gekommen. Nach Entnahme der Keramik wurde der Ofen komplett ausgeräumt und die Bestattungen auf der Ofensohle nieder-gelegt. Danach wurde mit der Verfüllung begon-nen, wobei das aus dem Ofen stammende Material (Steine, Gefäßfehlbrände, Ovalwannenfragmente, Asche, Teile der Ofenkuppel usw.) Verwendung fand. Dass es keinen zeitlichen Bruch zwischen Ofenberäumung und Bestattung gab, belegen einerseits die gleichmäßige Verfüllung innerhalb
Abb. 14 Kasten C/Profil 3. Detail der Ofenverfüllung.
Abb. 15 Detail Kasten C von Bef. 12: Bruchstücke von Salz-siedewannen in situ.
Abb. 16 Planum 6 des Aunjetitzer Ofens mit zwei Bestattungen, die gleich nach Aufgabe des Ofens direkt auf der Ofensohle niedergelegt worden waren.
14 15
N
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
50
des Befundes und andererseits das Fehlen von Spuren einer später eingebrachten Grabgrube. Fraglich muss bleiben, ob die beiden Toten im Bezug zu dem Ofen standen und sich der »Unfall«
im Zusammenhang damit ereignete oder ob man die Anlage eher zufällig nutzte.
Die zeitliche Einordnung des Brehnaer Töpfer-ofens innerhalb der Aunjetitzer Kultur kann
Abb. 17 Planum 6 des früh- bronzezeitlichen Keramikbrenn-
ofens. In dem ausgeräumten Ofen wurden die Körper eines
Erwachsenen und eines Kindes in Hocklage bestattet. Der aufge-
brochene Ofen wurde anschlie-ßend mit dem Ofenmaterial, Fehl-
bränden, Steinen etc. verfüllt.
Abb. 18 Zeichnerische Dokumentation von Planum 6
des Keramikbrennofens (gelb – Knochen, rot – Keramik,
blau – Steine).
F RÜ H E B RO N Z E Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 51
anhand der Scherben der klassischen Tasse erfol-gen, die nach den herkömmlichen typologischen Einordnungen für eine Datierung nach 2ooo v. Chr. spricht. Auch andere Briquetagefunde waren bisher, wenn sie feintypologisch verwertbare Gefäßreste enthielten, direkt oder indirekt mit klassischen Tassen korreliert (Matthäuser 2oo3 a, 67 Abb. 2; Petzschmann 2oo3, 83 Abb. 1; Becker u. a. 2oo4, 195 Abb. 14; 197). Da jedoch neuere 14C-Datierungen eine lange Laufzeit der einzelnen geborgenen Keramiktypen zu belegen schienen3, wurde für den vorgestellten Befund auch eine radiometrische Datierung vorgenommen4. Danach wurde der Ofen mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3 % (1 Sigma) zwischen 1924 und 1767 v. Chr. erbaut. Mit 95,4 % Wahrscheinlichkeit (2 Sigma) lag seine Errichtung zwischen 2o21 und 1693 v. Chr. Damit wurde die typologische Einordnung bestätigt.
Eine weitere Aunjetitzer Bestattung in einer Siedlungsgrube
Etwa 32 m nordöstlich des Aunjetitzer Keramik-brennofens lag Bef. 95, der im Baggerplanum als Siedlungsgrube angesprochen wurde (Abb. 22). Im ersten Planum war eine ovale und leicht unre-gelmäßige, braun-graue, lehmig-humose Verfär-bung von 2,51 m x 2,15 m Größe erkennbar, die im Folgenden durch ein Längsprofil geschnitten wurde. Beim Abteufen wurden in ca. o,8o m Tiefe die ersten menschlichen Knochen freigelegt und ein Teilplanum erstellt. Um das Skelett komplett bearbeiten zu können, wurde ein Teilprofil doku-mentiert und der Gegenkasten auf die Höhe von Planum 2 abgeteuft. Hier zeichnete sich eine etwa rechteckige, graubraune bis dunkelbraun-ocker-
farbene, lehmig-humose Grabgrube von noch ca. 1,o8 m x 1,o5 m Größe ab. Der Rumpf der etwa Süd-Nord ausgerichteten Bestattung nahm den zentralen und südöstlichen Teil des Befundes ein, der Schädel tangierte die südöstliche Gruben-grenze. Das Skelett befand sich in einer rechten Hocklage. Das linke Bein war angezogen und Unter- sowie Oberschenkel lagen fast parallel West-Ost ausgerichtet. Der Fuß befand sich unter-halb des Gesäßes. Das rechte Bein war stärker angezogen und lag vor dem Bauchraum, das Knie berührte den rechten Ellenbogen. Die Arme waren vor der Brust verschränkt, wobei die Oberarme parallel zum Brustkorb lagen und die Unterarme sich auf Höhe der Handgelenke kreuzten. Die Blickrichtung des Skelettes ging in Richtung Ostnordost (Abb. 23). Die zur Bestattung genutzte Grube zeigte wie jene des Ofens im Profil eine Kastenform und reichte bis ca. o,86 m Tiefe unter das Baggerplanum.
Der bestatteten Person waren keine echten Beigaben mitgegeben worden. Eine Datierung und kulturelle Einordnung des Befundes kann jedoch sowohl über den typischen Bestattungs-ritus als auch durch die aus der Grubenfüllung geborgenen Ovalwannenfragmente erfolgen. Das Fragment eines aus der oberen Füllung stammen-den, groben Steinbeils (vgl. Abb. 9) dürfte sekun-där in die Grube gelangt sein und findet seine Parallele in dem Steinbeilfragment aus Bef. 13 (siehe Abb. 8).
Nicht nur aus den beiden Befunden mit Bestat-tungen, sondern auch aus zwei weiteren Sied-lungsgruben konnten Fragmente von Ovalwan-nen geborgen werden (Bef. 13 und 159). Sieht man von den ebenfalls als Befund angesprochenen Einzelgefäßen ab, so wurden aus vier der acht
Abb. 19 Gefäße und Salzsiede-wannen aus dem Töpferofen Bef. 12. Die Gefäße sind bei zu starkem Brand in sich zusammen gesunken.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
52
Aunjetitzer Siedlungsbefunden Teile solcher Wan-nen geborgen. Das deutet neben der großen Streu-ung der Siedlungsbefunde und dem Fehlen von Pfostenlöchern darauf hin, dass in dem ergrabe-nen Ausschnitt der frühbronzezeitlichen Siedlung wohl vor allem wirtschaftliche Tätigkeiten aus-geübt wurden und sich der eigentliche Wohn-bereich an anderer Stelle befand, wahrscheinlich im Areal des heutigen Einkaufsparkes.
Ovalwannen – Indikator für eine Salzproduktion?
Die Brehnaer Funde von Ovalwannen stellen den bisher umfangreichsten derartigen Fundkomplex dar. Es liegen über 1oo Fragmente vor, die die Teile von mindestens einem Dutzend Wannen darstellen, von denen während der Grabungen zwei Exemplare komplett und ein weiteres fast vollständig zusammengesetzt werden konnten. Die Deutung der Ovalwannen als Briquetage ist nicht völlig gesichert, da bisher noch keine dieser Wannen in einem entsprechend eindeutigen Befundzusammenhang beobachtet werden konnte. So werden relativ ähnliche Gefäße, die sich eben-falls durch eine grobe, von anderen Gefäßen
abweichende Machart und eine charakteristische organische Häcksel-Magerung auszeichnen, in Südosteuropa als Backwannen gedeutet (Hoch-stetter 1984, 164–168; Horejs 2oo5, 86 f.). Für die mitteldeutschen Ovalwannen haben sich seit der bahnbrechenden Arbeit von Matthias aus dem Jahr 1976 eine Reihe weiterer Belege ergeben, die ein deutlicheres Licht auf die Verbreitung dieser speziellen Fundgruppe werfen. Den Nachweisen von Ovalwannen und wohl zugehörigen Ovalsäu-len von 32 Fundstellen im mittleren Saalegebiet lassen sich nun 16 weitere, später veröffentlichte sowie elf noch unpublizierte Fundstellen durch Aufnahme der Verfasser hinzufügen (Abb. 24).
Dabei dürfte die Dunkelziffer der nicht erkann-ten und als gebrannter Lehm oder einfache Kera-mik angesprochenen Briquetage noch hoch sein, denn kleinere Fragmente lassen sich nur bei Kenntnis dieser speziellen Materialgruppe auf-grund ihrer Machart und Magerung gut erkennen. Eine systematische Durchsicht der Fundkomplexe der letzten beiden Jahrzehnte würde sicher zu einer weiteren deutlichen Vermehrung der Nach-weise führen. Selbst Altfundkomplexe bergen hier Überraschungen, wie die stichprobenartig durch
Abb. 21 Umzeichnung zweier Salzsiedewannen aus
Bef. 12; M 1:4.
Abb. 20 Detail der Salzsiede-wannen aus dem Töpferofen
Bef. 12.
F RÜ H E B RO N Z E Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 53
die Verfasser überprüften Funde von Eisleben, Lkr. Mansfeld-Südharz, Lodersleben, Saalekreis, und Weißenfels, Burgenlandkreis, zeigten, da sich die Aufnahme dieser speziellen Brique tageform durch W. Matthias offensichtlich auf das erwei-terte Stadtgebiet von Halle konzentriert hatte.
Mit den neuen Belegen hat sich das Kartenbild der Verbreitung der Ovalwannen – durch Brehna besonders nach Nordosten hin – abgerundet und unterstreicht die Bindung des Auftretens an das mittlere Saalegebiet, entsprechend der Verbrei-tung der später entwickelten, eindeutig als solche anzusprechenden Briquetagetypen der Jung-bronze- bis Eisenzeit. Die Vorkommen liegen innerhalb der viel größeren Ausdehnung der Aunjetitzer Kultur und es wäre kaum vorstellbar, dass allgemein nutzbare Geräte wie etwa Back-wannen diese abgegrenzte Verbreitung innerhalb eines Kulturgebietes aufweisen könnten. Der räumliche Bezug der Verbreitung der Ovalwannen und -säulen der Frühbronzezeit mit dem der Briquetage der Jungbronze- bis frühen Eisenzeit wird – neben dem Stadtgebiet von Halle – in Queis und Brehna besonders deutlich, wo ebenfalls Briquetage dieser Horizonte nebeneinander auf-tritt. Er belegt nicht zwingend eine Siedlungs- oder Bevölkerungskontinuität, sondern entstand wohl durch das Vorhandensein einer Kombination von Standortfaktoren, die Voraussetzung für die Salz-produktion waren, wie der Zugang zu Sole und Brennmaterial. Als bisher singuläres Auftreten sind den Funden aus Mitteldeutschland Nach-weise von Ovalwannen in Hitzacker, Lkr. Lüchow-Dannenberg, anzuschließen5. Neben der Tatsache, dass es sich mit dem Lüneburger Bereich um ein Gebiet handelt, in dem alte Solevorkommen gesi-chert sind, ist bemerkenswert, dass die Grabungen eindeutige Hinterlassenschaften der Aunjetitzer Kultur geliefert haben. Möglicherweise geben diese Ovalwannenfunde erste Hinweise auf einen wirtschaftlichen Hintergrund für die Bildung
dieser Exklave der Aunjetitzer Kultur innerhalb des Verbreitungsgebietes der endneolithischen Becherkulturen.
Neben der Verbreitung sprechen weitere Fakten für die Funktion der Ovalwannen als Briquetage. Auch wenn gelegentlich angezweifelt werden kann, dass die Wannen auf den Ovalsäulen standen6, dürfte es kein Zufall sein, dass unter den zur Aufstellung von Matthias hinzugekommenen Nachweisen sechsmal Wannen- und Ovalsäulen-fragmente von einer Fundstelle belegt sind. Bezeichnenderweise sind es die Großgrabungen, die der zufälligen Einzelentdeckung bei kleineren
Abb. 22 Aunjetitzer Bestattung in einer Siedlungsgrube/Bef. 95.
Abb. 23 Detailaufnahme der Bestattung in Bef. 95.
N
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
54
Untersuchungen ein statistisch sichereres Funda-ment entgegensetzen. Akzeptiert man die Zusam-mengehörigkeit von Säulen und Wannen als funktionelle Einheit, so lässt sich das neu gewon-nene Kartenbild weiter ausdeuten. Die gefäß-artigen Stücke, die Wannen, könnten nach dem Auskristallisieren des Salzes durchaus mit dem
Salz weitere Strecken transportiert worden sein, wie es für die Gefäßbriquetagen (Kelchoberteile und Hohlkegel) der späten Bronzezeit dann ein-deutig belegt ist. Die Füße hingegen (Ovalsäulen) waren ausschließlich am Produktionsort sinnvoll nutzbar. Dies verdeutlicht das Kartenbild, denn die Ovalsäulen weisen eine – gegenüber den Wan-
Abb. 24 Fundstellen frühbronzezeitlicher Briquetage im Mittelelbe-Saale-Gebiet; blauer Kreis – Wannen (W); gelber Kreis – Ovalsäulen (OS); rotes Quadrat – Ovalsäulen und Wannen; die blau unterlegte Fläche bezeichnet die Verbreitung der Aunjetitzer Kultur (nach Zich 1996, Beilage).
Fundorte: Aseleben, Lkr. Mansfeld-Südharz (W; nach freundlicher Mitteilung von A. Hoppel); Bad-Kösen-Rudelsburg, Burgenlandkreis (W; Simon 1991, 70 Abb. 6,16; 17); Benkendorf, Saalekreis (W; eigene Materialdurchsicht); Brehna, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (W); Burgliebenau, Saalekreis (OS, W; Archiv Halle; Simon
1990, 312 Anm. 27); Eisleben, Lkr. Mansfeld-Südharz, Clingesteinstraße (W; eigene Materialdurchsicht, Neumann 1929, 94 f.); Esperstedt, Lkr. Mansfeld-Südharz (OS, W; Bogen 2006, 124 f.); Eulau, Burgenlandkreis (OS, W; Küchenmeister 2007, 52; 54 Abb. 13); Friedensdorf, Lkr. Merseburg-Querfurt (OS, W; Matthias 1976, 376); Gutenberg, Saalekreis (W; Nitzschke/Stahlhofen 1978, 227); Halle-Ammendorf (OS; Matthias 1976, 377); Halle-Bruckdorf (Kiesgrube Klepzig) (OS; Matthias
1976, 378); Halle-Giebichenstein (Wittekind) (OS, W; Matthias 1976, 378); Halle-Giebichenstein (Fährstraße) (W; Matthias 1976, 378); Halle-Kröllwitz (Weinberg), (OS; Matthias 1976, 378); Halle-Marktplatz (OS; freundliche Mitteilung V. Herrmann); Halle-Schloßberg/Bergstr. (W; Paul 1988, 209 Abb. 1; 210 Abb. 2e.f); Halle-
Trotha (Klausberge) (OS; Matthias 1976, 378); Halle-Trotha (Trothaer Str.), (OS; Matthias 1976, 378); Halle-Trotha (Sandgrube E-Werk) (OS, W; Matthias 1976, 381); Halle-Trotha (Kiesgrube Brömme), (OS, W; Matthias 1976, 381); Halle-Trotha (Kiesgrube Gäbs Söhne und Parsch), (OS, W; Matthias 1976, 381); Halle-Trotha (Kies-
grube Reiche), (OS, W; Matthias 1976, 381); Helfta (Untere Topfsteinbreite), Lkr. Mansfeld-Südharz (OS; Matthias 1976, 383); Helfta (»Große Klaus«), Lkr. Mans-feld-Südharz (OS; Donat 1988, 228 Abb. 25,13; 232); Helfta, (Strohhügel), Lkr. Mansfeld-Südharz, (W; nach freundlicher Mitteilung von O. Kürbis, LDA); Helfta, Lkr.
Mansfeld-Südharz (W; freundliche Mitteilung von A. Hoppel u. C. Matthies); Helfta (Langelochbreite), Lkr. Mansfeld-Südharz (W, Lesefund Fricke im Stadtarchiv Eisle-ben, dort rekonstruiert und als neolithisch angesprochen); Hitzacker, Lkr. Lüchow-Dannenberg (W, siehe S. 53 und Anm. 3); Karsdorf, Burgenlandkreis (W, OS?;
Behnke 2007, 70); Kleingräfendorf, Saalekreis (W, Ausgrabung 2009, freundl. Mitteilung Ch. Bogen); Kleinlauchstädt, Ot. von Bad Lauchstädt, Saalekreis (OS, W; unpubl. Grabung D. Menke/T. Schunke 2008); Krumpa-Lützkendorf, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 383); Leuna-Daspig, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 376); Lodersleben, Saalekreis (W; Vogel 1975, 17 f.); Maßlau, Ot. v. Horburg, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 383); Merseburg, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 383);
Morl-Beidersee, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 376); Obermöllern, Burgenlandkreis (W; Akten Halle; Simon 1990, 312 Anm. 27); Obhausen (Kiesgrube Böther), Saalekreis (OS; Matthias 1976, 383); Obhausen (Grundstück Wiegner), Saalekreis (OS; Matthias 1976, 383); Oechlitz, Saalekreis (OS, W; Ausgrabung 2008, freundliche Mitteilung Frau K. Schwertfeger); Queis, kreisfreie Stadt Halle (OS, W; Matthäuser 2003a, 68 f.; 71 f. Abb. 11; Petzschmann 2003, 83 Abb. 1,1);
Röblingen, Lkr. Mansfeld-Südharz (OS, W; Akten Halle; Simon 1990, 312 Anm. 27); Schafstädt, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 383); Schiepzig, Saalekreis (OS, W aus verschiedenen Befunden der Grabungen C. Damrau, B. Duchnewski, A. Moser und R. v. Rauchhaupt; eigene Materialdurchsicht); Schraplau, Lkr. Mansfeld-Südharz
(OS, W; Akten Halle; Simon 1990, 312 Anm. 27); Sennewitz, Saalekreis (OS; Matthias 1976, 384); Serbitz, Lkr. Nordsachsen (W; Ickerodt/Schwerdtfeger 2001); Sittichenbach, Lkr. Mansfeld-Südharz (OS; Matthias 1976, 384); Tröbsdorf, Burgenlandkreis (W; Matthias 1976, 384); Uichteritz, Burgenlandkreis (W; Matthias 1976, 384); Volkstedt, Lkr. Mansfeld-Südharz (OS; Matthias 1976, 384); Weideroda-Zauschwitz, Lkr. Leipzig (OS; Coblenz 1956, 73 ff.; Matthias 1976, 384 f.);
Weißenfels, Burgenlandkreis (OS; Vogel 1975, 29/30); Zwenkau, Lkr. Leipzig (W; Schunke 2000, 71 f.; Taf. 12,2); ohne Fundort (Umgebung Halle) (OS, Matthias 1976, 385); ohne Fundort (Umgebung Querfurt) (W; Matthias 1976, 385).
F RÜ H E B RO N Z E Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 55
nen – engere Verbreitung auf, die sich deutlich an den Gebieten orientiert, die Solequellen aufzuwei-sen hatten. Daher kann auch dieses Kartenbild als ein Argument für die Deutung der Ovalwannen und -säulen herangezogen werden.
Die vorgestellten außergewöhnlichen Befunde lenken die Überlegungen auf die Salzproduktion in Brehna als solche und ihre Stellung innerhalb des Wirtschaftslebens dieser Siedelgemeinschaft. Auch wenn die Ovalwannen nun sicherer als Briquetage angesehen werden können, ist bis heute nicht zu beantworten, welche genaue Funk-tion sie innerhalb der Salzproduktion inne hatten. Klar ist, dass sie üblicherweise mit Feuer in Berührung kamen. Die Frage, ob das Salz in den Wannen gesiedet wurde oder ob diese nur bei der Trocknung und Formung des Salzbreies Verwen-dung fanden, ist noch unbeantwortet. Da für die
Umgebung von Brehna heute kein Vorkommen einer Solequelle belegt ist, muss über die Form der örtlichen Salzproduktion nachgedacht werden. Denkbar wären verschiedene Transportvarianten eines getrockneten Zwischenproduktes oder einer höher konzentrierten Sole, die vor Ort ausgesiedet wurde, da das notwendige Heizmaterial sicher vorhanden war. Weiter gehende Überlegungen diesbezüglich werden im Zusammenhang mit der Vorstellung der spätbronzezeitlichen und früh-eisenzeitlichen Briquetage angestellt (vgl. Kap. 5).
Es konnte gezeigt werden, dass die frühbronze-zeitliche Bevölkerung des Gebietes um Brehna in die frühbronzezeitliche Salzproduktion des mitt-leren Saaleraumes einbezogen war und damit einerseits anteilig die Grundlagen für den mate-riellen Wohlstand in der frühen Bronzezeit des Mittelsaalegebietes schuf und andererseits wohl
Abb. 25 Frühbronzezeitliche Siedlungsbestattungen; rotes Quadrat – mit Briquetage; schwarzer Kreis – ohne Briquetage. Mit Briquetage: Brehna (Töpferofen mit Erwachsenem/Kind und Grube mit Erwachsenem); Eisleben-Clingesteinstraße, Lkr. Mansfeld-Südharz (Siedlungsgrube mit Erwachsenem; Grabungsbericht Holter 1925; Neumann 1929, LDA); Esperstedt, Lkr. Mansfeld-Südharz (Grube mit Bestattung eines Jungen von 12–15 Jahren mit Kupfer/Bernstein-Kollier; Bogen 2006, 124 f.); Kleinlauchstädt, Ot. von Bad Lauchstädt, Saalekreis (zwei Bestattungen: Grube mit spätadulter/maturer Frau, Grube mit Resten zweier Kleinstkinder; Grabungen D. Menke und T. Schunke 2008); Queis (Grube mit frühadulter Frau und Mann(?); Matthäuser 2003, 68 f.); Schiepzig, Saalekreis (Grube mit Bestattung, mit freund licher Genehmigung von C. Damrau, Leipzig); Serbitz, Saalekreis (große Grube mit Mehrfachbestattung: mindestens fünf Individuen; zwei männliche Erwachsene, zwei Kinder, weitere Individuen nicht bestimmbar; Ickerodt/Schwerdtfeger 2001); Sittichenbach, Lkr. Mansfeld-Südharz (Siedlungsbestattung; Matthias 1976, 384 f.); Weideroda-Zauschwitz, Lkr. Leipzig (Grube mit jugendlichem Individuum; Coblenz 1956, 73 ff.; Matthias 1976, 384 f.). Ohne Briquetage: Dieskau, Saalekreis (Jarecki 2003, 72 f.); Erfurt-Gispersleben, kreisfreie Stadt (Müller 1982, 114–119); Eulau, Burgenlandkreis (Küchenmeister 2007, 51; nicht kartiert, da es sich wohl nicht um eine Primärbestattung handelt); Halberstadt-Winterberg, Lkr. Harz (fraglich; Fischer 1956, 175; Zich 1996, 395); Hausneindorf, Lkr. Harz, mögliche Siedlungsbestattung (fraglich; Matthias 1953; Fischer 1956, 177); Karsdorf, Burgenlandkreis (Behnke 2007, 72 f., im Umfeld Gruben mit Briquetage); Kleingräfendorf, Saalekreis (Grabung 2009, freundl. Mitteilung Ch. Bogen); Kleinlauchstädt, Ot. von Bad Lauchstädt, Saalekreis (drei Bestattungen ohne Briquetage; Grabungen D. Menke und T. Schunke 2008); Oechlitz, Saalekreis (mind. vier Bestattungen, Grabung 2008/2009, freundl. Mitteilung K. Schwerdtfeger); Schkopau, Saalekreis (Vogel 1975, 21 f.).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
56
in einem gewissen Maße an ihm partizipierte. Auch wenn reiche Grabausstattungen im Umfeld von Brehna bislang fehlen, sprechen die nicht weit, in einer Entfernung von 6,5 und ca. 1o km gelege-nen reichen Schmuckhortfunde mit Bronzen und Bernstein von Kyhna, Lkr. Nordsachsen (Coblenz 1986), und Halle-Queis (Breuer/Meller 2oo4) für »Gewinne«, die aus der Salzproduktion erwachsen sein dürften. Auch in Queis wurde Briquetage nachgewiesen (Matthäuser 2oo3 a, 68/69; 71/72 Abb. 11; Petzschmann 2oo3, 83 Abb. 1,1).
Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei den beiden Befunden mit Bestattungen aus Brehna um Niederlegungen im Bereich einer Siedlung, somit um so genannte Siedlungsbestattungen. Das wird auch durch den fehlenden Gräberfeld-charakter der Befundverteilung deutlich. Sied-lungsbestattungen konnten bisher, wahrschein-lich aufgrund der früher raren Ausgrabungen in Siedlungsarealen, äußerst selten nachgewiesen werden (Fischer 1956, 242). Es ist sehr auffällig, dass in mindestens zehn der 23 bzw. 24 den Ver-fassern bekannten Siedlungsgruben mit Bestat-tungen neben weiteren Gefäßresten auch die insgesamt doch seltenen Wannen- und/oder Ovalsäulenfragmente beobachtet wurden (Abb. 25). Und das, obwohl diese Reste nicht als Gefäßbei-
gabe, sondern vermutlich nur durch die Tatsache ihres Vorhandenseins in der Nähe in die Gruben gelangten. Zieht man nur das mittlere Saalegebiet in Betracht, in welchem überhaupt frühbronze-zeitliche Briquetage gefunden wird, ist das Ver-hältnis noch deutlicher. Wurden hier Menschen bestattet, die in irgendeiner Weise mit der Salz-produktion verbunden waren oder einen Bezug zum jeweiligen Produktionsareal außerhalb der Wohnsiedlung hatten? Und wenn ja, wurden sie aufgrund dessen nicht mit den anderen Personen auf den regulären Gräberfeldern bestattet? Besa-ßen sie eine besondere, vielleicht niedere Stellung in der Gesellschaft, wie es historisch und ethno-graphisch für viele mit Feuer umgehende Hand-werksberufe bzw. -kasten belegt ist, z. B. für die Schmiede in den germanischen Gesellschaften?
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die zahlenmäßig wenigen Befunde der Aunjetitzer Kultur aus Brehna aufgrund ihres besonderen Fund- und Befundcharakters außergewöhnliche Beobachtungen zulassen. Es wird sich zukünftig erweisen müssen, ob die ersten hier dargelegten Überlegungen in die richtige Richtung zielen.
R. v. R./T. S.
A N M E R K U N G E N 1 Auf Fläche 1 handelte es sich um
Bef. 1, 1o, 11 und 35 (Einzelgefäße) und Bef. 13, 43, 67, 93, 94 und 98 (Siedlungsgruben). Bef. 95 stellte eine Siedlungsgrube mit Bestattung dar und Bef. 12 war ein Keramikbrenn-ofen mit einer Doppelbestattung. Weitere, zeitgleiche Siedlungsgruben (Bef. 159 und 162) lagen auf Fläche 2.
2 Das Ergebnis der 14C-Datierung des Leichenbrandes aus Bef. 1o erreichte die Verfasser kurz vor der Druck-legund, so dass eine Umarbeitung des Kapitels nicht mehr möglich war. Das Datum (KIA 39286:2425 +/- 25 BP) verweist mit einer 2 Sigma-Wahr-scheinlichkeit in die Zeit zwischen 746–4o3 v. Chr. Damit sind die Befunde als Reste eines früheisen-
zeitlichen Bestattungsplatzes anzuse-hen, der zeitlich und wohl auch kultu-rell den nordöstlich davon gelegenen Gehöftansiedlungen zuzuordnen ist.
3 Vgl. dazu Müller 2oo1, 69 ff.; 72 Abb. 19 a; 73 Abb. 19 b, 7; Müller 2oo4, 27 Abb. 11–13.
4 Die Untersuchung der 14C-Probe erfolgte am Physikalischen Institut der Universität Erlangen. Das gemes-sene Alter beträgt 3522 +/- 59 (Erl-78o6).
5 Für diese Informationen und die Ermöglichung der Einsichtnahme in die Dokumentation sind Verfasser Frau A. Moser, Prießeck, und Herrn Dr. C. Sommerfeld, Kiel, zu großem Dank verpflichtet.
6 Vgl. die Wannen mit etwas gerunde-ten Böden aus Serbitz, Lkr. Nordsach-sen (Ickerodt/Schwerdtfeger 2oo1, 288–291, bes. 29o Abb. 3). Es gibt aber auch Ovalsäulen, die eine konkave Auflagefläche besitzen wie jene aus Weideroda-Zauschwitz, Lkr. Leipzig. Vielleicht handelte es sich bei den Wannen aus Serbitz ebenfalls um Fehlbrände, denn derartige Gefäße sind in Mitteldeutschland bisher nie als echte Grabbeigaben, sondern nur als Siedlungsabfälle aufgetreten und auch der Serbitzer Befund ist in den Rahmen der Siedlungsbestattungen zu stellen.
A B B I L D U N G S N A C H W E I S 1 N. Seeländer, LDA. 2 LDA. 3 Ch. Petruniv, LDA. 4 LDA. 5 M. Wiegmann, LDA. 6 Ch. Petruniv, LDA.
7 M. Wiegmann, LDA. 8–9 A. Hörentrup, LDA. 1o–15 LDA. 16 R. v. Rauchhaupt, LDA. 17 LDA. 18 R. v. Rauchhaupt, LDA.
19–2o A. Hörentrup, LDA. 21 M. Wiegmann, LDA. 22 R. v. Rauchhaupt, LDA. 23 LDA. 24–25 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 57
5. Jungbronze- bis frühe Eisenzeit
Die jungbronze- bis früheisenzeitliche Siedlung
Datierung und kulturelle Einordnung der jungbronze- und jüngstbronze- bis früheisenzeitlichen Funde
Gefäßkeramik
Nach der frühbronzezeitlichen Besiedlung, die in Fläche 1 und dem äußersten Südteil von Fläche 2 nachgewiesen werden konnte, ist auf den Grabungsflächen erwartungsgemäß der für große Teile Mitteldeutschlands übliche Hiatus in der mittleren Bronzezeit zu beobachten. Aus dem Zeithorizont der Wiederbesiedlung in Ha A (P III/IV) liegen von den Flächen 2 und 3 die frühesten Funde vor (Abb. 1). Die folgende Analyse beruht auf einer ersten Durchsicht des Fundmaterials, ohne dass daraus ein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden kann.
Typologisch ältester Fund ist eine Scherbe aus Bef. 3o3, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Hofbuckelgefäß stammt (Abb. 2, rechts unten). Auch die lederbraune Farbe spricht für ihre Verbindung zur frühen Lausitzer Kultur. Die Datierung der Herstellungszeit dieses Stückes in die so genannte Fremdgruppenstufe nach W. Grünberg (1943) und W. Coblenz (1952) ist anzunehmen, da ältere Grabverbände mit reiner Hofbuckelkeramik im Saale bis Muldemündungsgebiet nicht auftreten. Das Stück aus Bef. 3o3 gelangte mit Sicherheit später, wohl als Altstück, in den Befund, denn es kam zusammen mit typischen, zum Teil vollständig geschlickten eiförmigen Töpfen mit Trichterhals und ausgelegtem Rand vor, die eindeutig nach Ha A bzw. Ha A2/B1 (P IIIb bis P IV) datiert werden müssen.
Das jungbronzezeitliche Fundspektrum erscheint relativ standardisiert. Als charakteristischste Erscheinung der Lausitzer Kultur und der von ihr beeinflussten Bereiche sind an erster Stelle die scharfkantigen Doppelkoni zu nennen. Sie weisen meist eine Rillung über dem Umbruch auf, die Unterteile sind geritzt, gerillt oder geschlickt
(Bef. 117, 535, 549, 1134, 1152, 1159). Während Exemplare, die ausschließlich eine Unterteilverzierung aufweisen (Bef. 276, 285, 122o, 1534; Abb. 3,5; 4,3), ein gleiches oder auch höheres Alter besitzen können, verankern die nur über dem Umbruch und ohne Kerben verzierten Formen (Bef. 282, 381, 525, 527, 886, 1225; Abb. 5,3) ebenso wie jene mit Umbruchkerbung in Gruppen (Bef. 117) und Kammstrich am Unterteil (Bef. 1164; Abb. 5,1) einen Großteil der Befunde in der entwi-ckelten Jungbronzezeit. Auffällige Verzierungen treten dreimal in Form von kreisrunden Einstichen auf (Bef. 275, 525, 867). Aus Bef. 524/525 liegen Oberteilscherben eines Doppelkonus mit doppeltem Rillenband über dem Umbruch vor. Auf dem unteren Rillenband stehen typische Riefenbögen (Abb. 6), die das Stück in den Horizont Ha A2/B1 verweisen. Es besaß wahrscheinlich zwei Henkel in Höhe des oberen Rillenbandes. Ebenfalls eine entwickelte Sonderform der Doppelkoni – die flache, ausschließlich gerillte Variante, kam in Bef. 1139 zusammen mit einer am Unterteil gitterförmig geritzten Kegelhalsterrine vor.
Weitere Formen, die mit der Lausitzer Kultur in Verbindung stehen, sind schräg geriefte Gefäße, im Allgemeinen Terrinen (Bef. 169), Kannen (Bef. 1534) und flache Tassen. Eine echte jungbronzezeitliche Schrägriefung kam in Bef. 3oo, 525, 1159 und 1534 (Abb. 3,1) vor. Die daraus entwickelte Steil und Vertikalriefung trat beispielsweise in Bef. 169, 365, 38o, 1157 und 1545 auf.
Die flachen mehrgliedrigen Tassen weisen meist ein Randzipfelpaar (vgl. Abb. 3,2; Bef. 525, 1159) und eine Bodendelle (Abb. 7; Bef. 365) auf oder sind unverziert (Abb. 4,4; Bef. 122o). Eine andere jungbronzezeitliche Tassenform ist mit der über dem Umbruch gerillten doppelkonischen Trichterrandtasse mit randständigem Henkel aus Bef. 1295 belegt. Ein konisches Stück mit randständigem Henkel kam in Bef. 282 vor.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
58
Die scharfkantigen SProfilSchalen sind vor allem durch die unverzierte Form (Abb. 4,1; Bef. 289, 122o) vertreten. Eine etwas kleinere, die ein geschweiftes Profil aufweist, stammt aus Bef. 285. Als typische jungbronzezeitliche Schalen des Saalegebietes kommen geradwandige Exemplare in den Bef. 527 und 1159 vor. Eine gewölbte Schale mit nach außen abgestrichenem Rand und Rit
zung am Unterteil liegt aus Bef. 3o2 vor. Besonders typisch ab Ha A2 sind Fingerkniff und Tupfenrandschalen. Ein Fragment eines solchen Gefäßes liegt aus Bef. 867 vor.
Größere Kegelhalsterrinen sind im Material häufig vertreten, können aber nur selten genauer angesprochen werden. Ein ehemals fast vollständiges Exemplar stand in Bef. 1139 (Abb. 129–13o;
Abb. 1 Verbreitung der jung-bronze- bis früheisenzeitlichen
Siedlungsbefunde. Grün–Jungbronzezeit (P IV),
Rot–Jüngstbronze- bis Früheisenzeit (P V–VI).
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 59
Kapitel 6). Es wies am Unterteil eine gitterförmige Ritzung auf. Der Brand dieses, sonst gut geglätteten Gefäßes war so schlecht, dass die schiefrig gebrochenen Scherben nur kleinteilig vorliegen. Die Schulterscherbe einer Kegelhalsterrine mit großen Zonenbuckeln stammt aus Bef. 122o (Abb. 4,2). Sie weist die typische lederbraune Farbe der Lausitzer Kultur auf. Schwarz ist dagegen die Schulterscherbe einer Zylinderhalsterrine aus Bef. 282, die als Leittyp der älteren Saalemündungsgruppe gilt.
Als unspektakuläre Leitform im Siedlungsmaterial der Lausitzer Kultur können die eiförmigen Töpfe gelten. Scherben von Exemplaren mit Trichterrand (Bef. 525, 747) und häufiger Trichter oder Zylinderhals mit ausgelegtem Rand (Bef. 276, 3o2, 3o3, 353, 513, 78o, 1134, 1159) liegen vor. Die meisten dieser Gefäße sind glatt. Ihre Zeitstellung ist in den westlichen Rand und Nachbargebieten der Lausitzer Kultur nicht in der Schärfe wie in Elbsachsen und der Niederlausitz nachzuvollziehen. Hier sind sie noch charakteristischer Bestandteil der Stufe Ha A2/B1.
Scherben von großen Rautöpfen kommen in vielen der jungbronzezeitlichen Siedlungsgruben vor. Hals und Randscherben, die eine nähere Bestimmung zulassen, zeigen, dass es sich zumeist um geschweifte Töpfe mit relativ steilem bis ausschwingendem Trichterrand handelte (Bef. 276, 282, 289, 38o, 1221). Das Stück aus Bef. 365 besaß einen markanten SchulterHalsÜbergang. Zweimal kam eine Form mit Zylinderhals und ausschwingendem, getupftem Rand vor (Bef. 527, 1225; Abb. 5,4), die ihre Wurzeln in der Knovizer
Kultur Böhmens und der süddeutschen Urnenfelderkultur besitzt. Der Lausitzer Kultur sind derartige Töpfe weitgehend fremd. In Mitteldeutschland beschränkt sich diese Gefäßform vermutlich
Abb. 3 Inventar der Grube Bef. 1534. M 1:3.
Abb. 2 Keramik aus der Sied-lungsgrube Bef. 303 mit der Scherbe eines Hofbuckelgefäßes (rechts unten).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
60
auf den erweiterten Saalebereich (Schunke 2ooo, 82 bes. Anm. 52; 193).
Die Inventare weiterer Siedlungsgruben sind ebenfalls in diese Stufen zu datieren, wobei typologisch jeweils nur die Stufe Ha A2/B1 (P IV) sicher belegt ist. Ein älterer Fundniederschlag (etwa Ha A1) dürfte nicht vorhanden sein, ist aber aufgrund der Laufzeit einer Reihe der vorgestellten Typen nicht auszuschließen.
Damit ist das in Brehna vorkommende Formenspektrum der Jungbronzezeit im Wesentlichen umrissen. Die folgenden chronologischen und kulturellen Einordnungen der Keramik in die westlichen Rand und Nachbargebiete der Lausitzer Kultur beziehen sich auf die Arbeiten von v. Brunn 1954 sowie Schunke 2ooo und 2oo4. Das Fundmaterial lässt sich einheitlich in die Stufen Ha A2/B1 bzw. P IV datieren. Funde, die eine ältere Zeitstellung der Besiedlung anzeigen, sind außer dem oben aufgeführten »Altstück« (vgl. Abb. 2) nicht sicher nachweisbar. Daher muss davon ausgegangen werden, dass die Besiedlung auf den ausgegrabenen Flächen zu Anfang oder innerhalb dieses Horizontes begann. Absolutchronologisch dürfte die Aufsiedelung gegen Ende des 12. bis zum Beginn des 11. Jh. v. Chr. stattgefunden haben. Von besonderem Interesse ist die kulturelle Einordnung des Fundmaterials, da der Brehnaer Bereich bislang wenig erforscht war und als Teil eines »Übergangsgebietes« im Einflussfeld der Lausitzer Kultur, der Saalemündungsgruppe und der Helmsdorfer Gruppe, jetzt deutlicher als Mittelsaalegruppe umrissen, angesehen wurde.
Die Beziehung des typologisch ältesten Fundes, der Hofbuckelscherbe, zur Lausitzer Kultur wurde bereits erwähnt. Sie stammt aus der Zeit der tatsächlichen Einwanderung von Trägern der Lausitzer Kultur aus den östlichen Gebieten an
den östlichen Rand des engeren mitteldeutschen Altsiedelgebietes. Diese Aussage kann so absolut getroffen werden, weil das Mittelelbegebiet östlich der Mulde und nördlich ab dem Fläming unbesiedelt war, bis auf wenige kleinere Siedlungsinseln auf guten Böden in Flussnähe (wie in dem Bereich von Dresden bis Riesa). Diese Einwanderung fand in der so genannten Fremdgruppenzeit statt. Ihr deutlichster keramischer Ausdruck sind die Hofbuckelgefäße, die mit der Westgrenze ihrer Verbreitung im Bereich der unteren Mulde zwischen Dessau und Bitterfeld und dann nach Süden Richtung Leipzig die Grenze markieren. Das Brehnaer Stück gehört zu den westlichsten Funden in diesem Bereich überhaupt. Auf Anstoß bzw. unter Einfluss der Lausitzer Kultur entstand westlich der unteren Mulde die Saalemündungsgruppe, die nach kurzer lausitzischer Phase spätestens ab Ha A2/B1 ein eigenständiges Gepräge aufwies. Aus dieser Zeit stammen die Brehnaer Funde. Wie im nördlich anschließenden Bereich kommen in den Fundkomplexen immer wieder Gefäße vor, die noch die charakteristische Formgebung und Farbe von Gefäßen der Lausitzer Kultur aufweisen. Im Speziellen können hier verschiedene lederbraune und sehr gut gearbeitete Doppelkoni genannt werden, wie beispielsweise ein flaches Exemplar aus Bef. 1139.
Andere Doppelkoni zeigen durch ihre dunkle, graubraune bis schwärzliche Farbgebung bereits ihre regionale Verwurzelung an (z. B. aus Bef. 116); der Doppelkonus aus Bef. 1164 mit seinem Kammstrich (Abb. 5,1) ebenso. Auch die Gruppe der schräg bis steil gerieften Gefäße zeigt die Tendenz von lederbraunen, schräg gerieften Gefäßen der Lausitzer Kultur (vgl. Abb. 7) hin zu steiler gerieften dunklen Gefäßen (vgl. Abb. 8), welche in Bef. 1159 als Zusammenfund auftraten. Als Gefäß
Abb. 4 Inventar der jungbronze-zeitlichen Grube Bef. 1220.
M 1:3.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 61
typ der Lausitzer Kultur kann weiterhin die lederbraune Scherbe einer großen Zonenbuckelterrine (Bef. 122o) angesehen werden. Die schwarze Scherbe mit klassischer Bogenriefen und vertikaler Breitrillenverzierung aus Bef. 282 belegt den wichtigsten keramischen Leittyp der Saalemündungsgruppe, die Zylinderhalsterrine. Sämtliche Scherben, die ein »lausitzisches« Gepräge aufweisen, kommen in den aus Brehna vorliegenden Fundinventaren der Siedlungsgruben bereits vermischt mit solchen westlicher bzw. nordwestlicher Prägung vor. Das entspricht dem üblichen Bild, welches aus bekannten Siedlungen der älteren Saalemündungsgruppe überliefert ist.
Anhand des keramischen Materials ist die Abgrenzung der älteren Saalemündungsgruppe zur zeitgleichen Mittelsaalegruppe (Bz D–Ha A2/B1), die in dieser Zeit im Gebiet von Halle existierte,
sehr schwierig, da auch diese der Beeinflussung durch die Keramik der Lausitzer Kultur ausgesetzt war. Es kann festgestellt werden, dass echte keramische Leittypen der Mittelsaalegruppe in Brehna nicht gefunden wurden. Ein Blick auf das Auftreten der bronzenen Leittypen der Mittelsaalegruppe (Schunke 2oo4, Beilage 1) bestätigt dieses Bild, denn das Brehnaer Gebiet liegt außerhalb dieser Verbreitung. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die jungbronzezeitliche Besiedlungsphase aufgrund der keramischen Hinterlassenschaften der älteren Saalemündungsgruppe (P IV; Ha A2/B1) zugeordnet werden kann.
Funde, die eindeutig in die folgende, noch bronzezeitliche Stufe (P V) gestellt werden können, sind schwer aus dem homogen erscheinenden Fundmaterial des gesamten Zeitkomplexes Jüngstbronze bis Früheisenzeit herauszufiltern. Das liegt
Abb. 5 Keramik aus den Siedlungsgruben 1164 (1) und 1225 (2–4). M 1:3.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
62
nicht nur speziell an dem vorliegenden Brehnaer Material, sondern ist ein dem gesamten Fundgut des MittelelbeSaaleGebietes allgemein anhaftendes Datierungsproblem. Aus diesem Grund war es nicht möglich, auf Basis der durchgeführten Schnelldurchsicht des Fundmaterials eine stufengegliederte Phasenkartierung (P IV–P V–P VI) durchzuführen. Daher sollen im Folgenden lediglich einige Funde vorgestellt werden, die Ausdruck der jüngstbronzezeitlichen Besiedlung und damit einer möglichen Besiedlungskontinuität seit der Jungbronzezeit sein dürften. Die kulturelle Zuordnung wurde über eine Gruppe von Gräbern vorgenommen, die als »Steinkisten mit imitiert Lausitzer Keramik« der Stufe V bezeichnet worden sind (vgl. v. Brunn 1939, 5 ff.). Dieses Fundgut wurde durch v. Brunn später als charakteristisch für die so genannte jüngere Saalemündungsgruppe angesehen.
Das Gefäßfragment einer schwarzen, horizontal gerieften Kegelhalsterrine mit deutlich ausbiegendem Rand aus Bef. 4 auf Fläche 1 weist am
Hals eine Zier aus konzentrischen stehenden Halbkreisbögen auf (Abb. 9,1). Solche Gefäße wurden von Grünberg (1943, 39–41, Taf. 57,16 und besonders Taf. 57,1) in die Jüngstbronzezeit gestellt. Während der scharfe SchulterHalsKnick für eine noch bronzezeitliche Datierung spricht, weist der ausgebogene Rand bereits auf den letzen Abschnitt der Bronze bzw. in die frühe Eisenzeit. In Liebersee, Lkr. Nordsachsen, kam ein vergleichbares Gefäß in einem eindeutig jüngstbronzezeitlichen Inventar zutage (Bef. 4164; Ender 2oo3, Taf. 38,39). In Altdöbern (Lkr. OberspreewaldLausitz) wurden zwei Gräber mit Terrinen (Bönisch 1987, Abb. 12,8; 15,17), die bereits einen ausschwingenden und leicht verdickten Rand aufweisen, radiometrisch datiert. Die Daten weisen kalibriert in das 1o./9. Jh. v. Chr. (2Sigma), eindeutig noch vor das Ende von Ha B. Einschränkend ist zu konstatieren, dass das Ergebnis aufgrund der Holzkohlendatierung durch einen Altholzeffekt beeinflusst sein kann (datiert wurden einmal Kern und einmal Astholz). Die Beifunde aus der Grube Bef. 4
– es liegen weder verdickte noch abgestrichene Ränder vor – tragen kaum Näheres zur Datierung bei, aber der Rand eines großen Rautopfes kann wegen seiner ausschwingenden Form durchaus jüngstbronzezeitlich sein.
Als Besonderheit liegt aus Bef. 562 eine innen und außen graphitierte dreigliedrige Tasse mit ausschwingendem Rand vor (Abb. 9,2; 1o). Sie weist einen überrandständigen Henkel, eine horizontal geriefte Schulter und einen Omphalosboden auf. Aufgrund der Dünnwandigkeit und der Graphitierung stellt die Tasse eindeutig einen Import dar. Ihre Form steht noch in der Tradition von jungbronzezeitlichen Gefäßen und ist jüngstbronzezeitlich einzuordnen. Vergleichbare Formen finden sich im sächsischen Elbgebiet (Grünberg 1943, Taf. 55,2o; 57,18) und in der Niederlausitz, allerdings ohne Graphitauftrag. Letzterer weist wahrscheinlich in Richtung Schlesien oder Böhmen, wo derartige Tassen, teilweise innen graphitiert und etwas reicher verziert, in P V vorkommen (Gollub 196o, 15; Taf. 3o,17; 31,11; Gedl 1994, 265 Abb. 3,9; 3,1o; Podborský 197o, Taf. 55,2.11). Aufgrund der sorgfältigen Ausführung ist nicht an eine Herstellung im ostthüringischen Bereich zu
Abb. 6 Doppelkonusfragment aus den Gruben Bef. 524/525.
Abb. 7 Jungbronzezeitliche Tasse aus Bef. 365.
Abb. 8 Jungbronzezeitliche Tasse aus Bef. 525.
6
7
8
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 63
denken (wie Simon 1969, 272 Anm. 33). Die Tasse könnte durchaus in der Oberlausitz, allerdings mit dem aus Böhmen importierten, nur dort anstehenden Graphit angefertigt worden sein1. Aus Niederkaina (Lkr. Bautzen) und Liebersee liegen solche Tassen allerdings nicht vor. Das weitere aus der Grube Bef. 562 stammende Material ist nicht näher datierbar.
Aus mehreren Befunden stammen horizontal geriefte Scherben. Einige sind aufgrund der zugehörigen Funde aus den Gruben bereits eisenzeitlich. Bei weiteren ist eine jüngstbronzezeitliche Datierung wahrscheinlich. Das betrifft z. B. das Exemplar aus Bef. 1293, welches unter dem Henkel ein typologisch aus einer Bogenriefe entstandenes Sparrenornament aufweist (Abb. 11; vgl. v. Brunn 1939, Taf. 15), und eine Reihe von Scherben aus dem oberen Bereich der Lehmentnahmegrube Bef. 158.
Aus Bef. 511, 522 und 523 stammen zusammenpassende Scherben eines dunkelgrauen Gefäßes mit geschweiftem flachem Kegelhals mit Halsrillenband und am Bauch einzelnen vertikalen Riefengruppen (Abb. 12,1). Das Gefäß erinnert bereits stark an Billendorfer Gefäße. Es kommt zusammen mit einer ebenfalls dunkelgrauen Terrine vor (Abb. 12,2), deren Verzierung aus dem typisch jung bis jüngstbronzezeitlichen Verzierungsmuster der Zylinderhalsterrinen der Saalemündungsgruppe besteht – gebildet aus Bogenriefenmustern und dazwischen abwechselnden Gruppen aus Schmal und Breitriefen –und die daher noch nach HaB zu stellen sein könnte.
Ein Großteil des Fundmaterials ist eisenzeitlich (detailliert zu dieser Keramik vgl. u. a. v. Brunn 1939; Nuglisch 1965; Wendorff 1981). Das spiegelt sich klar in den üblichen Randformen der verschiedensten Topfvariationen wider, die in größerer Anzahl aus vielen Befunden vorliegen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei einerseits um keulenförmig bis lippenartig verdickte (Abb. 12,3; 13; z. B. Bef. 12o, 143, 667, 1o32) und andererseits um abgestrichene, außen verdickte Ränder (Bef. 167, 865, 791, 944, 974, 127o, 1348, 15o3, 15o4). Inte
ressanterweise kommen getupfte Topfränder nur selten vor, sie müssen von den bereits in der Jungbronzezeit aufkommenden getupften bzw. gekerbten Rändern an geradwandigen bis gewölbten Schalen (Bef. 158, 225, 559, 62o, 867) unterschieden werden. Eine Ausnahme bildet die südliche Gebäudegruppe Haus 21–24 auf Fläche 2, in deren Umfeld solche Ränder gehäuft auftraten (Bef. 168, 222, 225 [zwei Stück], Bef. 261 [zwei Stück], Bef. 818, 824, 83o [vier Stück], 834 [vier Stück]), die damit zur Gehöftinterpretation beitragen. Ansonsten lagen getupfte Topfränder nur als Einzelscherben in der nördlichen Fläche 2 in Bef. 1o36 und in Fläche 3 in den Bef. 158, 368, 5o1, 758, 782 und 117o, wobei die Scherbe aus Bef. 158, aus dem fast 35o Rand
Abb. 9 Keramik aus den Bef. 4 (1), 562 (2) und 857 (3). M 1:3.
Abb. 10 Vollständig graphitierte Tasse aus Bef. 562.
Abb. 11 Terrinenfragment aus Bef. 1293.
11 10
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
64
scherben stammen, diese Seltenheit gut verdeutlicht. Es deutet sich damit die Möglichkeit einer zeitlichen Differenzierung der Gehöfte an, auf die noch näher eingegangen wird (s. u.). Gelegentlich werden die getupften Ränder für die gesamte Hallstattzeit in Anspruch genommen (Simon 1969, 274), die Horizontalstratigraphie in Brehna deutet jedoch klar auf eine Datierung nach Ha D/Lt A hin. Die Töpfe haben meist Tonnenform bzw. sind flau profiliert (Abb. 13). Die tonnenförmigen weisen eingezogene Ränder ohne Halsbildungen (Bef. 579, 622, 624, 625, 636, 639), kurze Hälse (Bef. 635, 89o) oder nur ausschwingende Ränder (Bef. 571, 639, 1231) auf. Henkel sind an ihnen selten (Bef. 59o, 1299; Abb. 14). Ein Topf weist Ösenhenkelimitationen auf (Bef. 6o5). Die Oberflächen der Töpfe reichen von meist unsorgfältig geglättet bis bewusst geraut bzw. geschlickt. Häufig sind an der dünnwandigeren Keramik feintonige Über
fänge, die jedoch nicht selten nur unsorgfältig geglättet sind. Neben der Randtupfung tritt als Verzierung lediglich die umlaufende Tupfung auf. Sehr charakteristisch umgibt sie das Gefäß häufig am größten Durchmesser (Bef. 261, 667) oder unter dem kurzen Rand (Bef. 1o36, 1256, 1398). Relativ selten sind getupfte Leisten (Bef. 857).
Größere Kegelhalsterrinen sind meist etwas besser gearbeitet. Ihre Ränder biegen entweder den Halsschwung fortsetzend aus oder sie sind abgestrichen und ausgeknickt. In einem Fall weist ein solches Gefäß in der Art einer Kanne einen großen überrandständigen Henkel auf.
Unverzierte, annähernd doppelkonisch profilierte, terrinenartige Gefäße mit ausschwingendem Kegelhals und Halsabsatz liegen aus Bef. 339, 523, 1o28, 1o31 und 1178 vor.
Die zweithäufigste Formengruppe stellen Tassen und Schalenformen dar (vgl. Abb. 15). Die
Abb. 12 Jüngstbronze- und früh-eisenzeitliche Keramik aus ver-schiedenen Befunden: Gruben-
komplex 511/522/523 (1, 2), Gruben 1402 (3), 390 (4, 5),
505 (6), 857 (7), 782 (8), 563 (9) und 279 (10). M 1:4.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 65
mehrgliedrigen Tassen weisen oft einen kurzen steilen Trichterrand auf (Bef. 115, 857, 1186) und sind zuweilen schwer von den kleinen Kannenformen zu unterscheiden. Die eingliedrigen Tassen sind bauchig (Bef. 115, 158, 594, 7o6, 15o4) oder geschweift (Bef. 756), seltener relativ geradwandig konisch (Bef. 7o3). Ihre Henkel sind rand bis überrandständig. Eine kleine, kännchenartige, bauchige Tasse mit überrandständigem Henkel (Bef. 798) ist auffällig lederbraun und am größten Durchmesser mit einer umlaufenden Rille verziert. Gedellte Böden kommen relativ selten vor (Bef. 865, 1325). Echte Omphalosböden fehlen im einheimischen Material offensichtlich gänzlich, nur der Import aus Bef. 562 (Abb. 9,2; 1o) weist einen solchen auf.
Die Schalen sind überwiegend geschweift bis einfach gewölbt und besitzen einbiegende Ränder, wobei der Rand meist mehr oder weniger horizontal abgestrichen und dadurch innen verdickt ist (Abb. 14; 17,6; Bef. 12o, 158, 182, 635, 637, 667, 889, 921, 1266, 1299). Wenige Schalenränder sind getupft (Bef. 158, 225, 62o, 867), in einem Fall (Bef. 39o; Abb. 12,4) kommt ein alternierend gekniffelter Rand vor. Eine Schale besaß einen vermutlich umlaufend rinnenartig vertieften Rand (Bef. 337), eine weitere mit Randkerben weist einen herausgezogenen Zipfel mit einer zentral eingetupften Spitze auf (Bef. 39o; Abb. 12,5). Für diese Ausprägung lassen sich nur wenige ähnliche Funde anführen (Peschel 199o, 67 Taf. 66,39; Bönisch 1996, 112 Abb. 84,1). Bei den Resten einer
Abb. 13 Siedlungsgefäße der Jüngstbronze- (2. und 4. v. l.) und Früheisenzeit (1. und 3. v. l.).
Abb. 14 Auffällig große Schale und Randscherbe eines bauchi-gen Topfes mit randständigem Henkel aus der Siedlungsgrube Bef. 1299.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
66
Schale aus Bef. 563 ist eine mehrfache, in Gruppen angeordnete Randzipfelung zu erschließen.
Die einfachsten Schalen sind leicht gewölbt und besitzen einen mehr oder weniger einziehenden, gerundeten Rand (Abb. 16; Bef. 158, 574, 718, 889, 947, 997, 1186). Geschweifte Schalen mit leicht trichterförmigem Oberteil liegen aus Bef. 158, 574 und 1282 vor. Derartige Schalen aus Bef. 143, 158, 357 und 51o weisen einen kurzen, ausgelegten Rand auf. Sförmig profilierte Schalen bilden die Ausnahme. Zu erwähnen ist ein Exemplar mit Kammstrich aus Bef. 878 und ein steilwandiges, glattes Stück mit bereichsweise (über dem Henkel und gegenüber) tordiertem Rand aus Bef. 5o5 (Abb. 12,6; Peschel 199o, 56; Bönisch 1996). Einen kurzen Trichterrand besitzt die steilkonische, kurzschultrige Schale aus Bef. 158, die an der Randinnenseite Breitrillengruppen aufweist (Abb. 19,3). Die Henkel bzw. Ösenhenkel sind rand bis deutlich unterrandständig. Einmal tritt eine nicht durchlochte, aber ösenhenkelartige Handhabe auf. Derartige Bildungen werden als spät (Ha Dzeit
lich) angesehen (Peschel 199o, 56; vgl. Müller 1993, 437 Abb. 15,2). Die Bodenscherbe einer Schale aus Bef. 1517 ist innen durch eine konzentrische Riefung verziert, eine Tradition aus der jüngeren Bronzezeit.
Interessant ist das durch einen Glasring aus dem Westhallstattkreis nach Ha D datierbare Material aus der Siedlungsgrube Bef. 277 (vgl. Abb. 68). Es besteht neben unverzierten bzw. ge schlickten Wandungsscherben aus zwei Rändern gewölbter Schalen, einer davon schräg nach innen abgestrichen (vgl. Nuglisch 1967, 238; 239 Abb. 4k–l.r), und einem weiteren innen abgestrichenen Rand eines untypisch geschweiften Gefäßes, der leider nicht sicher orientiert werden kann.
Bemerkenswerte unverzierte Gefäßformen sind ein geradwandiges Tönnchen (Bef. 1293), ein grob geformtes, typisch eisenzeitliches »Daumenschälchen« (Bef. 599), eine kleine, flau profilierte, zweihenklige Terrine (Bef. 357) und kleinere Kannenformen mit Kegelhals bzw. kegelförmigem Oberteil und ausbiegendem Rand (Bef. 261, 782, 865, 947, 1o67).
Verzierte Scherben von Terrinen bzw. »vasenartigen« Gefäßen sind selten. Gelegentlich konnte eine meist flaue Horizontalriefung nachgewiesen werden, deren genaue zeitliche Einordnung
– jüngstbronze oder bereits früheisenzeitlich – nicht geklärt werden konnte bzw. die aufgrund der Beifunde bereits eindeutig eisenzeitlich ist. Solche Scherben liegen aus Bef. 158, 5o2, 717, 764, 782, 9o7 und 1289 vor (Abb. 19,2).
Eindeutig als Keramik der jüngstbronzezeitlichen Lausitzer bzw. der Billendorfer Tradition, teilweise wahrscheinlich als echte Importe anzusprechen sind Fragmente großer dunkelgraubrauner bzw. schwärzlicher Terrinen bzw. »Vasen«. Ihre Kegelhälse sind häufig sehr flach und geschweift. Die SchulterHalsÜbergänge sind einesteils noch ausgeprägt (Abb. 12,3), anderen
Abb. 15 Jüngstbronze- bis früh-eisenzeitliche Kleingefäße aus
verschiedenen Gruben.
Abb. 16 Kleine Schale aus Bef. 574.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 67
teils nur noch ornamental angedeutet (Abb. 12,1). In Bef. 158 (Abb. 19) kommen Scherben mehrerer derartiger Gefäße vor, die teilweise noch jüngstbronzezeitlich sein dürften und der so genannten jüngeren Saalemündungsgruppe angehören (vgl. oben). Die Hälse sind in einigen Fällen am Ansatz von einem Rillenband umgeben. Die Schulterverzierung besteht aus Horizontalriefen, die von Gruppen senkrechter Riefen unterbrochen sind und anderen aus der Billendorfer Kultur bekannten Mustern (Abb. 12,3; 12,9; 17,2). Unter dem Henkel sind in einem Fall Bogenriefen nachweisbar. Nur einmal konnte eine Delle beobachtet
werden. Ein stark ausschwingender Rand eines solchen Gefäßes ist facettiert. Die Henkel sind teilweise vertikal schmal gerieft.
Der aus kulturgeschichtlicher und chronologischer Sicht bedeutendste Fundkomplex liegt aus Bef. 12o vor (Abb. 17, 18 und 64). Der durch eine Schwanenhalsnadel (Abb. 17,16 und 67) zunächst allgemein nach Ha C/D datierbare Befund enthielt ein größeres Gefäß mit Rillen am flachen Kegelhals und Girlanden am Umbruch (Abb. 17,2). Das Unterteil zieren ebenfalls einzelne Breitrillengruppen. Das Girlandenmotiv ist charakteristisch für die Göritzer Gruppe (Giesa 1982, 42 f.) und die
Abb. 17 Inventar aus Bef. 120. Keramik M 1:4, Bronze (16) M 1:2.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
68
Billendorfer Kultur. Es gehört in der Göritzer Gruppe den Stufen II und III an, die nach Ha D/Lt A–B datiert werden (Giesa 1982, 23). Wenige Gefäße dieser Art, die aus dem Gebiet der Hausurnenkultur stammen, wurden mit der Göritzer Gruppe bereits in Verbindung gebracht (v. Brunn 1939, 77; Taf. 4oc.d; 42d). Zu dem Fund gehört weiterhin eine stark Sprofilierte dunkelgraubraune Schale mit gedelltem Boden und einer radialen Innenverzierung (Abb. 17,1). Die Linienbündel bestehen aus sehr flach eingetieften, schmalen Riefen, so dass sie einer Glättmusterverzierung nahe kommen, auch wenn keine Graphitierung nachzuweisen ist. Diese für das Gebiet außergewöhnliche Verzierung weist ebenso wie die sehr betonte und sorgfältige Formgebung – in Verbindung mit der auffällig guten Keramikqualität – darauf hin, dass das Gefäß nicht in der ausgegrabenen Siedlung hergestellt worden ist, sondern hier ein weiteres importiertes Stück vorliegt. Das Vorbild für derartige Schalen oder das Exemplar selbst entstammt zweifellos dem Hallstattkreis. In Mitteldeutschland konnten bisher nur wenige Belege namhaft gemacht werden. Diese finden sich erwartungsgemäß vorrangig im früheisenzeitlichen »Austauschzentrum«, im Stadtgebiet
von Halle, wie einige Belege für die elegante Formgebung (Töpfer 1961, 8o5 Abb. 45,6–8; Müller 1993, 436 Abb. 14,1–3) sowie ein stark übereinstimmendes Schalenfragment mit vergleichbarer Profilierung und echter Glättmusterung vom Hof des Museumsgebäudes (Nuglisch 1967, 246 Abb. 9) zeigen. Damit dürfte der Weg feststehen, über welchen das vorliegende Stück nach Brehna gelangte. Weitere, meist reich glättmusterverzierte Schalen wurden vorgelegt bzw. erwähnt aus HalleGiebichenstein; Deuben, Burgenlandkreis; Großstorkwitz, Lkr. Leipzig, und Obermöllern, Burgenlandkreis (Mildenberger 194o, 212 ff.; Simon 1969, 265 Anm. 6; Simon 1979, 2o Abb. 2,1; 27 Abb. 5,5; Taf. 5a). Damit ist ein Gebiet umschrieben, in dem aus dem Hallstattkreis importierte bemalte Gefäße vorkommen und hallstättisch wirkende Gefäße mit Graphitbemalung auch hergestellt wurden (Simon 1969; Simon 1979; Simon 1979a). Die Beziehungen werden vorrangig zu böhmischen wie zu hessischen Stücken geknüpft (Simon 1969, 273 und Karte; Simon 1979, 34 Abb. 1o; vgl. Paulík 1959, 811 Abb. 296,2a.4.6; Michálek/Lutovský 2ooo, 146 Abb. 37). Ein solcher Import konnte auch auf der Heidenschanze bei DresdenCoschütz nachgewiesen werden (Simon 198o, 23 Abb. 3,1).
Abb.18 Säulenförmige Briquetage aus Bef. 120.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 69
Abb. 19 Auswahl an Gefäß fragmenten aus der großen Lehmentnahmegrube Bef. 158. M 1:3.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
70
Wichtig im Zusammenhang mit dem vorliegenden Fundkomplex ist die Datierung dieser Stücke. Die eleganten Sprofilierten Schalen dürften im nördlichen Mitteldeutschland allgemein der späten, im wesentlichen Ha Dzeitlichen Hausurnenkultur angehören (Müller 1993, 428; 44o), die Schale mit Glättmuster aus Halle wurde mit Ha D2 parallelisiert (Nuglisch 1967, 244; Simon 1969, 265 Anm. 6). Die Stücke aus Deuben und Großstorkwitz wurden nach Lt A gestellt (Simon 1979, 26). Die starke Profilierung der Brehnaer Schale findet gute Entsprechungen im Material einer späthallstattzeitlichen Siedlung von Erfurt, kreisfreie Stadt (Böhme 2oo1, 52 Abb. 23,3; 53 Abb. 24,2.5.7; 54 Abb. 25,8), und allgemein im südlichen Mittelsaalegebiet (Simon 1985, 265 Abb. 1,6.7; 267 Abb. 2,1o). Ähnliche Profilierungen, mit kehlartigem Hals kommen an den bereits latènezeitlichen »Kehlhalsschüsseln« vor (vgl. Miron 1991; Oesterwind 1991, Abb. 2,2o–21), in Mitteldeutschland beispielsweise an einer Schale aus Nitzschka, Lkr. Leipzig (v. Rauchhaupt 2oo3, 213 Abb. 13,11; 215). Aufgrund der Verzierung wird für das Brehnaer Stück jedoch ein späthallstattzeitlicher Ansatz favorisiert. So findet sich das SechsStrahlenmuster vor allem an Hallstattkeramik aus Bayern und Hessen (Brosseder 2oo4, 258 ff.). Mit diesem Ansatz wird zugleich die Datierung der girlandenverzierten Keramik aus dem Bef. 12o bestätigt und ein nicht unwichtiges chronologisches Indiz für Ha D bezüglich des ansonsten nur allgemein nach Ha C bis D datierbaren Nadeltyps gegeben (s. u.), für den man andererseits ein latènezeitliches Alter nicht annehmen möchte. Die Datierung nach Ha D erhält auch für die ansonsten schwerlich genauer einzuordnenden einheimischen Formen aus Bef. 12o (Abb. 17,4–15) größere Bedeutung.
Unter den Einzelstücken aus Befunden der Ausgrabungsfläche sind weitere Verzierungen bemerkenswert. Sparrenmuster sind aus Bef. 563 belegt (Abb. 12,9), Dellen unter dem Henkel aus Bef. 718/719. Auf einer stark sekundär gebrannten Kegelhalsscherbe aus Bef. 1317 ist ein schräg schraffiertes stehendes Dreieck zu erkennen. Ein Gefäßunterteil aus Bef. 1296 weist einzelne Gruppen aus vertikalen Riefen am Umbruch auf. Besonders auffällig ist ein Gefäßfragment aus Bef. 14o2, welches eine geriefte Schulter und einen gerillten Halsansatz besitzt und bei dem beide von einem konzentrischen Halbkreisriefenornament unterbrochen werden (Abb. 12,3). Diese beiden Ornamente stehen übereinander. Ähnliche Gefäße sind in Niederkaina nachgewiesen (Heyd 1998, Taf. 18,17; Heyd 2ooo, Taf. 19, Grab III/29a.1). Zusammen mit weiteren Scherben aus Bef. 793, 1o47, 1122, 1258, 1362, 155o belegen diese aufgeführten Gefäßreste einen im Vergleich zur Grobkeramik zwar geringen, insgesamt jedoch vergleichsweise hohen Anteil an Billendorfer Formen im Fundgut.
An besonderen verzierten Gefäßen ist ein ovales Doppelgefäß mit Sparrenverzierung aus Bef. 782 anzuführen (Abb. 12,8), für das es in der Billendorfer Kultur eine Reihe von Belegen gibt (Peschel 199o, Taf. 66,21.24.25). Die frühere Existenz einer Scheidewand ist noch an den Klebestellen zu erkennen, an denen die Wandungsteile vor dem Brand zusammengefügt worden waren. Neben dem vorliegenden Exemplar dürften aus dem Bereich der Hausurnenkultur bisher etwa fünf echte »Importe« aus dem Billendorfer Bereich vorliegen (v. Brunn 1939, 113).
Als bekannte jungbronze bis eisenzeitliche Verzierungsart v. a. von Gefäßunterteilen kommt der Kammstrich im Brehnaer Material vor. Er ist jedoch mit den eisenzeitlichen Scherben aus Bef. 158, 1144, 1376 und 1398 sowie der bereits erwähnten Schale aus Bef. 878 selten.
Typologisch jüngstes Fundstück ist eine Scherbe »Nienburger« Art mit umlaufender Punktstichzier und Sparrenmuster aus Bef. 279 (Abb. 12,1o), die zu einem relativ offenen, tassenartigen Gefäß gehört haben muss. Ähnlich verzierte und profilierte Gefäße sind typisch für die Hausurnenkultur (Nuglisch 1967, Abb. 15). Sie gehören bereits Ha D an, da sie auch Bestandteil der späthallstatt und frühlatènezeitlichen Jastorfkultur sind.
Als außergewöhnlicher keramischer Fund ist aus Bef. 158 ein hohles, hornförmig gebogenes Fragment zu nennen, welches vielleicht die Spitze eines Tonhornes (Peschel 199o, Taf. 57,18.19; Hellström 2oo4, Taf. 41,18) oder Teil eines Tiergefäßes war (Abb. 2o). Aus Bef. 5o9 liegt ein merkwürdiger bandförmiger, sich nach einer Seite verbreiternder, »stielartiger« Gegenstand vor, der am schmaleren Ende wohl einen Henkel aufwies. Ein recht großer löffelartiger Schöpfer mit Grifflappen fand sich in der Grube Bef. 857 (Abb. 12,7; vgl. v. Brunn 1939, 114).
Technische Keramik
An technischer Keramik traten Siebgefäße, Spinnwirtel, Backteller und in großen Mengen Briquetage auf.
Die Fragmente von Siebgefäßen gehörten meist zu Stücken mit gewölbter oder geschweifter durchlochter Wandung (Abb. 21; Bef. 67, 158, 511/12, 563, 564, 593, 594, 7o1, 7o2, 896, 1o32, 1o62, 1o66, 1326). Wahrscheinlich stammt der größte Teil von beidseitig offenen Siebgefäßen (»Feuerstulpen«), denn unter den ca. 2o einzeln vorliegenden Scherben fanden sich zwar acht Randstücke und eine mit einem sekundär zugeschliffenen Rand (Bef. 563), jedoch keine mit einem Bodenansatz. Abweichend liegt in einem Fall (Abb. 22, Bef. 1293) ein konisches, napfartiges Gefäß vor, das nur am Boden und seitlich direkt am Bodenansatz durchlocht ist und vermutlich in der Milchverarbeitung Verwendung fand.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 71
Nur in Bef. 387/88 und 5o5 kamen Bruchstücke von »Backtellern« vor. Ein Exemplar ist völlig ohne Verzierung, das andere ist an einer Seite flächig durch Fingernageleindrücke verziert (Abb. 23). Sie sind im östlichen MittelelbeSaaleGebiet (Peschel 199o, 67 und Taf. 9,27) und dem Gebiet der Hausurnenkultur (z. B. Nuglisch 1964, 8o1 und Taf. 3d) vergleichsweise selten – im Gegensatz zu der anzunehmenden Häufigkeit bei einer tatsächlichen Funktion als Brotbackteller. Im Bereich der Osthallstattkultur werden sie auch als Gefäßdeckel gedeutet (Michálek/Lutovský 2ooo, 149 Abb. 4o; 315). Eine Verbindung Feuerböcke und »Backteller« ist in Brehna in dem Befundkomplex 387/388 gegeben, allerdings fehlen Tellerreste in den vielen übrigen und reichhaltigen Grubenverfüllungen völlig, so dass eine funktionsbedingte Verbindung, wie gelegentlich vermutet (vgl. Nu glisch 1965, 1o7; Gedl 1973, Taf. 32,3.4; Taf. 5o,12.14), daraus eher nicht abgeleitet werden kann. Im Bereich der Billendorfer Kultur kommen diese Teller zudem ohne die dort nicht auftretenden Feuerböcke vor. Auch der zu rekonstruierende
Durchmesser der »Backteller« entspricht nicht den Maßen der Feuerböcke.
In neun jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Befunden lagen Spinnwirtel (Abb. 24; Bef. 211, 239, 553, 577, 782, 831, 997, 1231, 2oo95). Diese gehören vier verschiedenen Typen an: Gedrückt
Abb. 20 Kleines Tonhorn aus der großen Lehmentnahmegrube Bef. 158.
Abb. 21 Jungbronze- bis früh-eisenzeitliche Siebgefäßfrag-mente aus verschiedenen Befunden.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
72
flachkugelig und nachlässig geformt ist das Exemplar aus Bef. 2oo95. Vier Stücke sind von einseitig flach halbkugeliger bis asymmetrisch doppelkonischer Form. Sie weisen eine in verschiedenem Maße eingedellte Basis auf. Zu diesen Spinnwirteln gehören das mit 4,8 cm Durchmesser größte und die beiden mit 2,4 und 2,6 cm Durchmesser kleinsten Exemplare. Dem hohen konischen Typ mit tief eingezogener Basis gehören die Spinnwirtel aus Bef. 211 und 439 (verwaschene Form) an. Das einzige verzierte Stück liegt aus Bef. 1231 vor. Es ist symmetrisch doppelkonisch und am Umbruch umlaufend gekerbt. Die Vielfalt an Typen ist nicht ungewöhnlich (Nuglisch 1967, 236/237 Abb. 3). Sie kann fast als charakteristisch für die erschlossene Zeitstellung dieser Exemplare bezeichnet werden.
Briquetage
Die Brehnaer Siedlung zeichnet sich durch eine große Menge an Briquetagefunden aus. Aufgrund der typischen Form, der charakteristischen Farbe und Zusammensetzung des verwendeten Materials sowie der typischen, sekundär gebrannten Oberflächen ist die Briquetage2 im Fundmaterial vergleichsweise gut erkennbar. Sie gehört in dem in Brehna ergrabenen Siedlungsausschnitt ausschließlich der zweiteiligen Variante mit säulenförmigem Unterteil und schalen bis halbkugelförmigem Tiegel an. Die Säulen und die Tiegel sind anhand ihrer sehr unterschiedlichen Magerung auch bei kleineren Bruchstücken gut zu unterscheiden. Insgesamt liegen 1o8,2 kg Säulenfragmente, 77,7 kg Tiegelfragmente und 1,2 kg nicht sicher zuweisbare Bruchstücke vor (Tab. 1). Im Folgenden wird der Begriff des Salzsiedens gebraucht, auch wenn die Briquetage möglicherweise nur zum Trocknen/Endformen verwendet worden ist.
Die Säulen wurden aus einem mittelstark gemagerten Ton hergestellt (Matthias 1961, 158). Das Magerungsmaterial besteht auffällig häufig bzw. in hohen Anteilen aus grobem Sand bzw. feinem Kies, vermischt mit einzelnen größeren Steinchen. Die sehr unterschiedlichen Fraktionen deuten darauf hin, dass der Kies auch in dieser Form direkt gewonnen oder ausgewaschen wurde. Das kiesige Magerungsmaterial ist wegen seiner gerundeteren Mikroformen weniger dazu geeignet, die Keramik hitzebeständig zu machen, als der meist für die Gefäßkeramik verwendete scharfkantige Gesteinssplitt, der durch Zerstoßen von Graniten und Quarzen bereitgestellt wurde. Es stellt sich daher die Frage, ob geeigneteres Magerungsmaterial nicht in ausreichendem Maße gewonnen werden konnte, ob eine höhere Brandhärte nicht vonnöten war, weil bei ihrer Nutzung keine sehr hohen Temperaturen erreicht werden mussten, oder ob die sehr hohe Dichte an Mage
Abb. 22 Napf mit durchlochtem Boden aus Bef. 1293.
Abb. 23 »Backteller« aus den Siedlungsgruben Bef. 387/388
und 505. M 1:3. 22
23
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 73
rungsbestandteilen diesen Nachteil wieder ausglich. Diesen Fragen könnte nur auf experimentellem Wege nachgegangen werden.
Aus 124 Befunden liegen Säulenfragmente in sehr unterschiedlichen Ausführungen vor. In fast allen Fällen handelt es sich um Varianten von Zylindersäulen (Matthias 1961, 154–158). Lediglich aus einem Befund (Bef. 1198) stammen zwei Bruchstücke einer Säule mit rechteckigem, »prismatischem« Schaft von 5,5 cm x 4,5 cm (Abb. 25). Dies ist eine bisher vergleichsweise selten nachgewiesene Form (Matthias 1961, 168–172). An einer Seite, wohl dem Fuß, ist ein trichterförmiges, glatt abgestrichenes Schälchen erhalten. Aufgrund des vorhandenen Schälchenansatzes am anderen Ende ist eine ehemalige Länge der Säule von ca. 25–26 cm zu erschließen. Das liegt deutlich über den für die Zylindersäulen aus Brehna festgestellten durchschnittlichen Maßen. In dem Befund lagen weiterhin zwei zylindrische Säulen.
Die zylindrischen Säulen sind sehr unterschiedlich proportioniert. Ihre Länge schwankt in den wenigen Fällen, wo dies aufgrund des Vorhandenseins beider Enden erschließbar ist, zwischen 18 und 23 cm. Dabei besitzen die Stücke einen
sehr unterschiedlichen Schaftdurchmesser, der zwischen 3 und 5 cm liegt. Einige kurze, dickere Bruchstücke weisen darauf hin, dass auch längere Säulen in Gebrauch gewesen sein dürften. Die vorliegenden Enden lassen sich grob in zwei Typen einteilen. Einerseits mit mehr oder weniger schälchenförmigen, die die Hauptmenge der aufgefundenen Enden bilden, und andererseits solche, die in drei Zipfel auslaufen. Es kommen in Brehna keine glatten, fußartigen Enden vor. Sämtliche Säulen verfügen über zwei Schälchen bzw. Zipfelenden.
Die Schälchen besitzen eine muldenförmige, relativ flache bis trichterförmig geschweifte, vergleichsweise starke Vertiefung. Sie können, meist entsprechend der Massivität des Schaftes, verschieden groß sein. Die Durchmesser bewegen sich in fast allen Fällen zwischen 4,5 und 6,o cm. Dass diese Unterschiede in den Proportionen auch Ausdruck des »Geschmacks« der herstellenden Person waren, zeigt Bef. 1151 mit mehreren zusammensetzbaren Säulen, die mit 3,5 cm Schaftdurchmesser und 7,5 cm Schälchendurchmesser ein trompetenartiges Aussehen besitzen (Abb. 26). In diese Richtung weist eine Beobachtung an Säulen
Abb. 24 Jungbronze- bis früh-eisenzeitliche Spinnwirtel aus verschiedenen Befunden.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
74
BEF.-NR. TIEGEL SÄULEN ZUORDNUNG?112 130 113 25 114 1530 115 20 280 120 20 3310 130 415 131 105 158 710 90 194 30 196 195 197 10207 265 208 745 213 170 281 430 282 20 307 25 328 60 339 90 357 120 387 75 388 80 175 389 180 399 5 20 414 55 423 4780 428 19920 429 860 430 30439 8610 4040 470 40 474 160 485 65 491 880 496 15 498 4615 507 20 504 25 508 20 524 120 539 320 560 60 563 190 315 572 135 567 10586 200 590 1770 592 190 275 598 250 599 40 10 600 110 125 620 70 625 375 627 1200 629 520 631 500 635 125 638 250 65639 200
BEF.-NR. TIEGEL SÄULEN ZUORDNUNG?640 5701 65 702 55 30 703 10 5704 245 718 140 719 2780 210 726 10730 25733 40746 45 476 747 3830 748 20 670 747/748 135 1220 752 1275 756 15757 25758 770 760 315 764 15 782 90 135789 60 790 4175 791 25 3600 798 125 190 824 30 830 50 150 834 30 10857 20889 20 890 470 896 55 897 40903 155 904 40 906 35 909 45000 911 35 110 912 580 941 90 947 55 984 240 997 370 160 1006 2260 1007 2490 1012 2620 1028 280 125 2651037 201040 40 1046 1550 1065 930 1070 40 1071 25 2240 1104 95 1123 3700 1129 5 1144 151151 4835 1154 70
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 75
aus Bef. 428 (Abb. 27): Anhand eines vollständig zusammensetzbaren Exemplars von 21,5 cm Länge ist erkennbar, dass das obere Schälchen (Dm 5,8 cm) in der Mitte eine Fingertupfenvertiefung aufweist (Abb. 28), während der Fuß ohne Tupfung ist. Diese Art der Schälchenausbildung hat sicher keinen technischen Hintergrund. Matthias (1961, 158) kannte vier derartige Exemplare. Entweder handelt es sich um eine »Verzierung« als Laune
der herstellenden Person oder um eine bewusste Markierung. Sinnvolle Markierungen könnten einen größenmäßig zusammengehörigen Satz von Säulen betreffen, eine Unterscheidung von Kopf und Fußteil ermöglichen oder den Hersteller bzw. den Besitzer anzeigen (s. a. die Zusammenfunde von Säulen). Es ist ein merkwürdiger Umstand, dass bestimmte Formen trotz gewisser Seltenheit in identischer Ausführung an verschiedenen Orten in Mitteldeutschland vorkommen, so als wären sie zentral hergestellt und innerhalb des recht großen Verbreitungs gebietes verteilt worden. Das trifft nicht nur auf bestimmte, sehr auffällige Merkmale zu wie die erwähnten getupften Schälchen oder die quadratischen Schäfte. Auch zunächst recht unauffällige, jedoch sehr charakteristisch geformte Säulenenden – wie beispielsweise die sehr kleinen und schmalen Säulen mit kleinen tiefen Schälchen und charakteristischen Knetspuren (Kehlen) an den Schälchenansätzen des später interessierenden Säulensatzes II aus Bef. 428 – finden sich weit entfernt in identischer Form (vgl. die Säulen aus QuedlinburgMoorberg, Lkr. Harz; Deffner/Henkelmann 2oo5, 164 Abb. 5).
Die zusammensetzbaren Säulen zeigen, dass jeweils an beiden Enden Schälchen gleicher Größe ausgebildet waren. Die Fußteile lassen sich in einigen Fällen dadurch erkennen, dass der Schälchenrand etwas abgestrichen ist und dadurch eine verhältnismäßig glatte Auflagefläche bietet. Da dies an den meisten Säulen aber nicht der Fall ist, dürfte eine derartige Ausformung nicht notwendig gewesen sein und sie entstand eventuell zufällig beim Herstellungsprozess, etwa beim stehenden Trocknen.
Die nur aus wenigen Befunden vorliegenden Zylindersäulen mit Zipfelenden (Matthias 1961, 163–165) sind ebenfalls unterschiedlich ausgebildet. Nur in Bef. 428 kamen mehrere Exemplare vor, die näher beurteilt werden können (Abb. 27). Die Zipfel sind in der Art eines Grifflappens zwischen Daumen und Zeigefinger aus dem Säulenende herausmodelliert und nicht angeklebt, wie dort fehlende Brüche zeigen. Abnutzungsspuren an den Zipfelenden als Folge der wiederholten Auflage von Schälchen oder als Standspuren sind nicht zu erkennen. Aus dem genannten Befund sind Einzelstücke belegt, deren Zipfel kaum ausgebildet waren, sowie Exemplare mit deutlich dickeren Zipfeln. In keinem Fall war eine Dreizipfelsäule so zusammensetzbar (vgl. Matthias 1961, 163 f.), dass beide Enden mit Sicherheit bestimmt werden konnten. Sie besaßen eine Länge von etwa 21 cm.
Als eine Zwischenform zwischen Schälchen und Zipfelenden können Schälchen angesehen werden, die in der Aufsicht nicht rund sind, sondern seitlich mehrfach so eingedrückt wurden, dass sie einem stark verrundeten, drei bis viersei
BEF.-NR. TIEGEL SÄULEN ZUORDNUNG?1155 215 1156 400 1162 30 1175 80 1178 60 115 1179 590 2200 1181-1184 9625 1186 55 1945 451187 105 1198 900 1265 195 1266 181267 480 1270 195 1282 495 1289 35 1323 15 1321 50 1324 45 1325 2970 640 1501334 201340 140 1346 201347 270 1359 25 1362 10 1363 125 1374 115 1351376 130 1374/1376 115 1397 660 1398 80 1399 135 1500 951503 15 1504 25 3 1507 18 1517 1050 1519 180 1548 710 1550 3010 1551 630 1554 190 1555 10 760 1617 5600 F27 30 Tab. 1 Die Briquetagemengen aus den einzelnen Befunden nach Gewicht in Gramm, eingeordnet nach Tiegel-, Säulen- und unsicher zuzuweisenden Bruchstücken.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
76
tigen Prisma und die so entstandenen »Ecken« den Zipfeln ähneln. Solche Säulenfragmente kommen zusammen in Bef. 747 vor (Abb. 29 vorn).
Die Säulen sind auffällig häufig an den gleichen Stellen gebrochen. Neben den wohl statisch bedingten »Sollbruchstellen« am Schälchenansatz
– die Enden waren beim Umstürzen der Säulen dem größten Druck ausgesetzt – sind die Stücke häufig im mittleren Drittel der Gesamtlänge gebrochen, obwohl die dicke zylindrische Grundform recht stabil gewesen sein dürfte. Diese Brüche sind offenbar nicht herstellungsbedingt entstanden, etwa durch eine »Klebestelle«, die während der Fertigung beim Zusammensetzen zweier Tonrollen entstanden sein könnte. Vielmehr dürften hier thermische Beanspruchungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Es fiel auf, dass neben den mehr oder weniger einfarbig rötlichen Säulen ein großer Teil sehr unterschiedliche Sekundärbrandspuren in regelhafter Kombination aufweist. Bei diesen sind die Schälchenenden rötlich, die mittleren Drittel der Säulen hingegen weisen eine graugelbliche, grauweiße bis weißliche Färbung auf und sind genau an diesen Stellen gebrochen (vgl. Abb. 26–29). Da diese Verfärbungen meist mit einer stärkeren Versinterung der Keramikmatrix einhergehen, müssen sie als Folge einer partiellen Überhitzung angesehen werden. Dass dies mit der geschilderten Regelhaftigkeit geschehen ist, kann nur auf die Lage beim Siedevorgang im Ofen und die Art der Feuerführung bzw. Beschickung mit Brennstoff zurück
zuführen sein. Leider fehlen entsprechende Experimente, die zeigen könnten, unter welchen Bedingungen bzw. bei welchen Brennverfahren solche thermischen Veränderungen an den Säulen eintreten können.
In Brehna hat sich abermals gezeigt, dass innerhalb der Briquetagevariante mit Säule und Tiegel die Form der Säulen offenbar kaum chronologische Unterschiede widerspiegelt. Abgesehen von der Tatsache, dass innerhalb des ergrabenen Ausschnittes der Siedlung, der immerhin wenigstens zwei Hausgenerationen innerhalb der Früheisenzeit aufweist, wohl keine Entwicklungstendenzen zu erkennen sind, geben die Zusammenfunde wichtige Aufschlüsse. Das Vorkommen einer Säule mit prismatischem (rechteckigem) Schaft zusammen mit Zylindersäulen in Bef. 1198 wurde bereits erwähnt (Matthias 1961, 172). Die Zylindersäulen (Abb. 25) besitzen beidseitig Schälchenenden (Dm 6 cm), haben eine Länge von 2o cm und einen Schaftdurchmesser von 4 cm.
In Bef. 428, der fast 2o kg Säulenbruchstücke enthielt, kamen sehr verschiedene Säulenvarianten vor (Abb. 27). Das ist umso bemerkenswerter, als der im Planum unregelmäßige Befund mit einer Größe von ca. 3,6 m x 2,75 m mit ca. o,2 m Tiefe sehr flach und muldenförmig war. Die Bruchstücke lagen in einer Schicht auf einer Fläche von etwa 1,3 m Durchmesser verteilt (vgl. Abb. 123) und wirkten, da mehrere nebeneinander liegende Stücke annähernd parallel lagen, wie bei einem einmaligen Vorgang hineingeschüttet. Aus dieser Grube stammen Säulen mindestens vier verschiedener Varianten – als anzunehmende herstellungstechnische Einheiten im Folgenden Säulensätze genannt – sowie viele Einzelexemplare. Während einzelne Fragmente gelegentlich durchaus als Altstücke in die Siedlungsgruben gelangen konnten, ist dies bei Säulensätzen nicht zu erwarten. Das deutet eine annähernde Zeitgleichheit dieser Funde an. Im Einzelnen handelt es sich bei Satz I um übliche Zylindersäulen (Länge ca. 2o–21 cm, Schaftdurchmesser 3,5–4,o cm) mit Schälchenenden (Dm 5,5–6,o cm); bei Satz II (Abb. 27 links) um sehr kleine Exemplare (Länge 17,5 cm, Schaftdurchmesser 3,o cm) mit kleinen tiefen Schälchen (4–4,5 cm) und charakteristischen Knetspuren an den Schälchenansätzen; Satz III (Abb. 27, Mitte rechts) wird durch die oben erwähnten Stücke (Länge 21,5 cm, Schaftdurchmesser ca. 4,o cm) mit einem innen getupften Kopfschälchen (Dm ca. 6,o cm) gebildet und Satz IV (Abb. 27 rechts) durch die Säulen mit Zipfelenden (Länge wahrscheinlich etwa 21 cm, Schaftdurchmesser 4,o cm). Aufgrund der ähnlichen Dimensionen der Sätze I, III und IV mit Längen um die 21 cm und Schaftdurchmessern um 4,o cm ist nicht auszuschließen, dass diese Sätze sogar gleichzeitig in einem »Ofen« benutzt worden sind. Es ist dagegen nicht anzunehmen, dass sie zu gleicher Zeit von gleicher
Abb. 25 Briquetagesäulen aus der Grube Bef. 1198, links mit prismatischem Schaft, rechts
mit rundem Schaft.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 77
Abb. 27 Vertreter mehrerer Säulensätze als Reste von einem oder zwei Ofensätzen aus Bef. 428.
Abb. 26 Die »trompeten-förmigen« Zylindersäulen aus Bef. 1151.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
78
Hand derart verschieden hergestellt wurden, zumal sich ihre Magerungsintensitäten leicht unterscheiden. Wahrscheinlicher ist, dass aufgrund der ständig im Produktionsprozess entstehenden Verluste an Säulen die in einem Ofen gleichzeitig benutzten Exemplare – im Folgenden Ofensatz genannt – immer wieder neu aufgefüllt werden mussten bzw. aus den nach einer zu starken Befeuerung verbliebenen Resten neue Ofensätze zusammengestellt worden sind. Kein Exemplar der oben genannten drei Säulensätze weist stärkere der sonst häufigen Überhitzungsspuren im Mittelbereich auf. Dagegen sind derartige Spuren an den Säulen des Satzes II, die viel kleiner dimensioniert sind, gut zu erkennen.
Nach diesen Erfahrungen lassen sich Säulensätze auch in einigen anderen Befunden entdecken,
die größere Mengen an säulenförmiger Briquetage erbrachten. Das betrifft in besonderem Maße die Säulen mit »trompetenartigen« Schälchen aus der Ofengrube Bef. 1151 (vgl. Abb. 26). Drei dieser Exemplare konnten vollständig zusammengesetzt werden. Sie zeigen allerdings die großen Toleranzen innerhalb eines Satzes auf, denn ihre Längen betragen 2o,5 cm, 22 cm und 23 cm bei Schaftdurchmessern unter 3,5 cm und Schälchendurchmessern zwischen 7 und 7,5 cm. Deutlich stärkere Schaftdurchmesser (4–4,5 cm), eine geringere Länge (19 cm) und Schälchendurchmesser von 6–7 cm besitzen Fragmente eines zweiten Säulensatzes aus diesem Befund. Außerdem liegen weitere Einzelsäulen vor. Ein Schälchenbruchstück ist am Rand kragenrandartig abgestrichen. Alle Säulen weisen mittig Sekundärbrandspuren auf.
Ein Säulensatz verhältnismäßig dicker, mittig stark sekundär gebrannter Exemplare (4,5–5 cm Dm) mit normalen Schälchenenden lag in Bef. 439. Ein weiterer Säulensatz konnte in der Siedlungsgrube Bef. 1179 nachgewiesen werden (Abb. 29 hinten). Ein vollständiges Stück besitzt eine Länge von 19,o cm, einen Schaftdurchmesser von 4–4,5 cm und vergleichsweise kleine und tiefe Schälchen von etwa 5,5 cm Durchmesser.
In der muldenförmigen Grube Bef. 791 (Abb. 3o und 31) lagen Teile eines Satzes aus sehr dicken (Dm 5 cm) und auffallend grob kiesig gemagerten Säulen. Daneben kamen einige ganz andersartig gemagerte, sandige Bruchstücke vor. Von Interesse ist der Grubenkomplex Bef. 1548–1553. Diese sich in ihrer Verfüllung stark ähnelnden Gruben weisen die Reste eines Satzes aus 4,5 cm starken Säulen auf, deren Schälchenenden zwar tief eingetupft, aber mit unter 5,o cm Durchmesser kaum verbreitert sind (Abb. 29 Mitte). Ihre Länge betrug
Abb. 29 Säulensätze aus ver-schiedenen Befunden: 747/748
(vorn), 1548/1553 (Mitte), 1179 (hinten).
Abb. 28 Säulen mit getupftem Schälchen aus Bef. 428.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 79
zwischen 17 und 18 cm. Zwei Teile einer einzelnen, »normal« ausgeformten Säule stammen aus den benachbarten Gruben 155o und 1551.
In Bef. 747 und 748 lagen Säulen eines Satzes mit prismatisch ausgeformten Schälchen (Abb. 29 vorn) zusammen mit einem Stück mit kaum verbreiterten Schälchen, wie sie im Grubenkomplex Bef. 1548–1553 auftraten, und Bruchstücken »normaler« Säulen.
In der flachen, muldenförmigen Grube Bef. 1181–1184, die Bef. 428 sehr ähnelte, kamen Reste zweier Säulensätze vor. Einerseits eine größere Menge sehr dicker, schlecht erhaltener »Normalsäulen«, andererseits Reste von deutlich kleineren, dünnen Säulen mit Schälchenenden. Alle Exemplare weisen mittig starke Sekundärbrandspuren auf. Ähnliche war Bef. 1oo6/1oo7/1o12. Auch in ihm lagen sekundär gebrannte, schlecht erhaltene größere »Normalsäulen« und etwas kleinere und dünnere.
Obwohl zwischen verschiedenen Befunden kaum Zusammenpassungen von Säulenbruchstücken gefunden werden konnten, sind doch in einigen Fällen so starke Ähnlichkeiten feststellbar, dass davon ausgegangen werden kann, dass Säulen eines Satzes in verschiedenen Gruben vorkommen. Das betrifft auf Fläche 3 die Bef. 1123, 1155, 1156 und 1555. Diese nebeneinander liegenden Gruben dürften annähernd zeitgleich sein. Die nicht weit voneinander liegenden Gruben Bef. 1179 und 1186 enthielten ebenfalls sehr ähnliche kurze Säulen, die sich aber in ihrem Brand unterscheiden. Möglicherweise liegen hier aus einer der beiden Gruben länger verwendete Bestandteile desselben Säulensatzes wie aus der anderen Grube vor. Auffallende Ähnlichkeiten über größere Distanzen (ca. 36 m) können zwischen den Säulen des zusammen gehörenden Befundkomplexes 1548–1553 einerseits und der Grube 747 festgestellt werden (vgl. Abb. 29). Konkret betrifft dies jeweils eine »Normalsäule« in Bef. 747 und 1551 sowie Säulen mit kaum verbreiterten Schälchen in Bef. 747 und 155o (Abb. 29 Mitte und vorn rechts). Ähnlich verhält es sich mit Bef. 114, 12o und 428 auf Fläche 2, die 11 m und 55 m voneinander entfernt lagen. Die beiden erstgenannten Gruben enthielten Bruchstücke sehr auffälliger kleiner Säulen mit markanten Formungsdetails, wie sie aus der Grube Bef. 428 in größeren Mengen vorliegen und dort als Säulensatz II bezeichnet wurden. Sollte es sich nicht um Teile desselben Satzes handeln, so kann angenommen werden, dass sie von derselben Person hergestellt wurden.
Unabdingbar für weitere Untersuchungen wäre das gleichzeitige Auslegen sämtlicher Briquetage, was im Rahmen der hier durchgeführten Aufarbeitung nicht möglich war. Die ersten Beobachtungen zeigen das Potenzial auf, welches in einer genauen Untersuchung der Briquetage, ihrer Form und Magerungsbesonderheiten, möglicher
weise unterstützt durch eine naturwissenschaftliche Bearbeitung (Dünnschliffe), und der Zusammenstellung von »Säulensätzen« liegt. Es können annähernd zeitgleiche Verfüllungsprozesse wahrscheinlich gemacht werden, die für das weitere in den Verfüllungen enthaltene Material chronologische Rückschlüsse erlauben. Von mindestens ebensolcher Bedeutung sind die über »zusammengehörende« Grubenverfüllungen zu gewinnenden Rückschlüsse auf die Siedlungsstruktur.
Methodisch sind die Säulensätze als herstellungstechnische Einheiten anzusehen, während die Ofensätze produktionstechnische Einheiten sind, die aus »Säulensätzen« oder zusammengestellten Teilen dieser bestanden. Aufgrund der mehrmaligen Verwendbarkeit der Säulen und des damit einhergehenden Ausscheidens einzelner oder mehrerer Stücke kann die exakte Unterscheidung im konkreten Fall zu unterschiedlichen Aussagen führen. Da wiederverwendbare Säulen zwischengelagert und innerhalb der Siedlung transportiert worden sein dürften, ist eine annähernde Gleichzeitigkeit nur für Grubenverfüllungen mit zerstörten »Ofensätzen« anzunehmen, die
Abb. 30 In die bereits fast voll-ständig verfüllte Siedlungsgrube Bef. 791 »entsorgte« Säulen eines Säulensatzes.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
80
sich z. B. durch Spuren vergleichbarer thermischer Einwirkungen und durch ähnliche Größen erkennen lassen (z. B. in Bef. 428, im Grubenkomplex 1123, 1155, 1156, 1555 sowie im Grubenkomplex 1548–1553). Dagegen können Exemplare desselben »Säulensatzes« aufgrund verschieden langer Verwendung stark differierende Brandspuren aufweisen und zu unterschiedlicher Zeit in den Boden gelangt sein (Bef. 1179 und 1186 sowie evtl. 114, 12o und 428). Da dieser Abstand nicht sehr groß gewesen sein dürfte, sind kaum Auswirkungen auf die archäologische Typochronologie anzunehmen. Dagegen kann dieser Unterschied für eine Analyse der erfassten Siedlungsstrukturen von Bedeutung sein, z. B. bezüglich Aktivitätszonen, Gehöftstrukturen usw.
Für den erfassten Siedlungsbereich kann zusammenfassend festgestellt werden, dass Konzentrationen von Briquetagefunden in nebeneinander liegenden Gruben mit hoher Wahrscheinlichkeit von nur einem oder wenigen kurz hintereinander stattgefundenen Siedeprozessen stammen. Das betrifft die fünf vereinzelten Konzentrationen im Osten der Fläche 3 sowie zwei Konzentrationen nördlich der Häuser 19 und 2o in Fläche 2. Die große Grubenansammlung nördlich des Gehöftes von Haus 5 spiegelt evtl. ebenfalls nur zwei bis drei Prozesse wider. Das ergibt eine relativ geringe Gesamtanzahl an nachweisbaren Salzsiedevorgängen, die damit keinen »industriellen« Charakter aufgewiesen haben können. Es bleibt zu bedenken, dass sich die Produktion nur dort klar widerspiegelt, wo
benachbarte Siedlungsgruben den »Abfall« aufnehmen konnten. Da solche Gruben für die Salzsiederei offenbar nicht nötig waren, ist das auf uns gekommene Bild ein in gewissen Anteilen zufälliges. Auch ist der Nachweis des Vorhandenseins von Säulenfragmenten vom Zerbrechen eines gewissen Anteils der benutzten Säulen abhängig. Wie häufig dies durchschnittlich geschah, ist ungewiss. Die vorliegenden Säulen der Säulensätze und Ofensätze dürften zu großen Teilen durch fehlerhaftes Befeuern der Ofenanlagen unbrauchbar geworden sein, bei dem jeweils eine größere Zahl an Säulen zerstört wurde. Dies war sicher nicht ständig der Fall. Es muss daher mit einer deutlich höheren Zahl an Salzsiedeprozessen gerechnet werden, die nicht mehr nachweisbar sind.
Mit den Säulen zusammen müssen auch die so genannten Tonballen betrachtet werden, die als Zwischenstücke, Platzhalter oder Untersätze angesehen worden sind (Matthias 1961, 166–168) und an mehreren Fundorten gleichzeitig mit den Säulen vorkommen. In Brehna konnten keine solchen Stücke nachgewiesen werden. Jedoch liefert die oben entwickelte Betrachtungsweise eine Erklärung ihres Auftretens. Die Tonballen könnten auf das Entstehen von Ofensätzen aus ganz unterschiedlich proportionierten Säulen verschiedener Sätze zurückzuführen sein. Mit solchen Ballen, ob auf oder unter der Säule angebracht, sind möglicherweise die Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Säulen eines Ofensatzes ausgeglichen worden.
Abb. 31 Die Säulenbruchstücke lagen in einer Schicht in der
Verfüllung der Siedlungsgrube Bef. 791.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 81
Ein direkter Nachweis einzelner Siedeprozesse ist durch die Tiegelfragmente zu erwarten. Die Tiegel stellen die von den Säulen getragenen eigentlichen Siedegefäße dar. Als Tiegel werden halbkugelige bis rundbodige, schalenartige Gefäße von ca. 1o cm Durchmesser bezeichnet (Matthias 1961, 174–179). So genannte Hohlkegel sind in Brehna nicht gefunden worden. Die Beschaffenheit dieser Tiegel ist sehr charakteristisch. Sie sind auffallend dickwandig, weisen eine meist höhere Magerungsintensität auf als die zugehörigen Säulen und sind deutlich schlechter gebrannt. Der zum Magern verwendete Grobsand bzw. Kies entspricht jenem der Säulen. Jedoch enthalten die Fragmente teilweise deutlich größere einzelne Steinchen. Die Oberflächen der Tiegel sind häufig kaum erhalten. In vielen Fällen sind sie von verziegeltem »Hüttenlehm« nur aufgrund ihrer Magerung zu unterscheiden.
Aus Brehna liegen ca. 77,7 kg Tiegelreste vor. Das ist die größte außerhalb des Stadtgebietes von Halle bisher festgestellte Menge innerhalb eines ergrabenen Siedlungsausschnittes. Den Hauptanteil stellt dabei die Grube Bef. 9o9, in welcher noch ca. 45 kg Tiegelreste angetroffen wurden (Abb. 32–34). Sie war ehemals vollständig mit diesen Fragmenten verfüllt worden, so dass diese in einem blockhaften Zustand freigelegt werden konnten. Nach der Bergung des Blockes wurde dieser im Grabungsstützpunkt sorgfältig auseinander genommen, um einen oder mehrere möglichst vollständige Tiegel bergen zu können. Es stellte sich heraus, dass zwar größere Teile vorhanden waren, die teilweise zur besseren Erhaltung gehärtet wurden, aber kein einziges Randstück nachgewiesen werden konnte. Auch die Innenoberflächen (Abb. 35) sind sehr klüftig, während die Außenoberflächen (Abb. 36) grob geglättet sind. Der Durchmesser konnte an einigen Stücken bestimmt werden. Er betrug ca. 13–14 cm und war damit überdurchschnittlich, wie auch die Wandungsstärke mit über 2 cm recht hoch ist. Einige Stücke dürften noch deutlich stärker gewesen sein und besitzen keine erhaltene Innenoberfläche. Zu den äußeren Bruchkanten hin verjüngen sie sich. Diese Fragmente erwecken eher den Anschein von Bruchstücken massiver Tonkugeln. Da bei einigen Teilen der Innenabschluss zwar beschädigt, aber sicher erschließbar ist, dürfte es sich aufgrund der Homogenität des Materials auch bei diesen um Tiegelfragmente handeln.
Vergleichbar dicke und grob gemagerte Tiegel kommen in vielen weiteren Befunden vor. Seltener sind gut gebrannte Stücke. Solche liegen aus Bef. 387, 439, 912, 1179 und 16o7 vor. Sie zeigen, dass die Innenoberflächen ehemals, der Außenwandung entsprechend, ebenfalls grob geglättet
Abb. 32–34 Die vollständig mit Tiegelresten verfüllte Grube Bef. 909 in verschiedenen Ausgrabungsstadien.
32
33
34
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
82
Abb. 35 Außenoberflächen der Tiegelreste aus Bef. 909.
Abb. 36 Innenoberflächen der Tiegelreste aus Bef. 909.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 83
Abb. 37 Außenoberflächen der wenigen erhaltenen Tiegel-ränder (Bef. 387, 439, 912, 1179 und 1607).
Abb. 38 Innenoberflächen der wenigen erhaltenen Tiegel-ränder (Bef. 387, 439, 912, 1179 und 1607).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
84
waren. Die wenigen erhaltenen Ränder (Abb. 37 und 38, Bef. 387, 439, 912, 1179) sind einfach gerundet. Nur aus Bef. 439 liegen mehrere Exemplare vor (Abb. 39,4.5). Diese lassen auf eine flachkugelige Halbschalenform schließen. Der Rand und gleichzeitig größte Durchmesser beträgt ca. 1o,5 cm. Ein weiteres Stück eines etwas höheren Tiegels mit leicht einbiegendem Rand hatte einen etwa ebenso großen Randdurchmesser sowie einen größten Durchmesser von ca. 13,o cm. Ein Stück aus Bef. 387 in Halbkugelform (Abb. 39,1) wies einen Randdurchmesser von ca.14,o cm auf. Während die genannten Beispiele unter dem Rand eine Wandungsstärke von ca. o,8 bis 1,2 cm aufweisen, liegt aus Bef. 1179 ein Randstück vor, welches dicker ist und eine Stärke von etwa 1,7 cm aufweist (Abb. 39,2). Der Tiegeldurchmesser ist nicht zu ermitteln.
Die aus Brehna stammenden Stücke entsprechen in Form und Maßen weitgehend den bisher bekannten aus Mitteldeutschland (Matthias 1961, 174–179; Preier 1999, 137). Beachtenswert ist, dass neben solchen mit Halbkugelform merklich flachere und wohl etwas dünnwandigere Tiegel (Abb. 39,1.5) vorliegen, auch wenn die Fragmentierung nicht immer eine sichere Orientierung zulässt. Die Existenz eines solchen Typus wurde von W. Matthias 1961 noch bezweifelt (1961, 176 f.). Hinzu kommt, dass die erhaltenen Ränder in Brehna wohl nicht nach innen schräg abgestrichen waren. Ob sich hier ein eigener Tiegeltyp herauskristallisiert oder diese Form nur eine Ausprägung innerhalb einer sehr variierenden Gruppe darstellt, wird die Zukunft zeigen müssen.
Die Tiegel waren wohl nicht oder kaum vorgebrannt und hatten möglicherweise aus diesem Grund keine den Säulen vergleichbare Härte. Vielleicht waren sie nur luftgetrocknet, bevor sie in den Ofen eingesetzt wurden. Die durchschnittlich stärkere Magerung bewirkte eventuell, dass auch bei luftgetrockneten Tiegeln eine Rissbildung unter Hitze vermieden werden konnte. Im Ofen verfestigten sich die Tiegel während des Siedens/Trocknens in sehr verschiedenem Maße,
aber offenbar recht gleichmäßig, denn die aus den verschiedenen Befunden vorliegenden Fragmente sind im Wesentlichen innerhalb eines Komplexes ähnlich stark gebrannt, z. B. in Bef. 9o9 schlecht, in Bef. 439 und 16o7 relativ gut. Möglicherweise hatten die Ränder der Tiegel im Ofen eine solche Position, dass sie weniger Hitze ausgesetzt waren und dadurch selten erhalten sind. Beim Zerschlagen der Tiegel blieben offenbar große Teile der inneren Wandung, die mit dem Inhalt verbacken und noch nicht fest gebrannt gewesen sein müssen, einschließlich größerer Magerungspartikel an dem Salzkuchen haften. Nur im Falle der oben genannten sehr seltenen, gut durchgebrannten und harten Bruchstücke blieben die innere Oberfläche sowie Randabschnitte erhalten.
Bef. 9o9 gibt zu Überlegungen über Art und Weise des Umgangs mit der Briquetage Anlass. Offensichtlich enthielt diese Grube die Reste eines Siedevorganges, wie die durchweg identischen Merkmale – Farbe, Brandhärte und Magerung – belegen. Da leider Randstücke fehlen, können diese Gefäße nicht sicher rekonstruiert werden und es ist dadurch nicht genau feststellbar, wie viele Tiegel bei diesem Sieden mindestens verwendet und schließlich in der Nähe der Grube zerschlagen worden sind. Nimmt man ein annähernd halbkugeliges Aussehen der Tiegel an, so ergibt sich eine Mindestzahl von 37. Hinzuzurechnen wären weitere aus dem oberen Bereich der Grube, die der Erosion und letztlich dem Freilegen der Fläche mit dem Bagger zum Opfer gefallen waren, sowie Stücke, die nur noch aus den aus der Grube vorliegenden Magerungsbestandteilen zu erschließen wären. Weitere gelangten vielleicht nicht in die Grube, denn eine regelhafte, gezielte Beseitigung der zerschlagenen Briquetagetiegel ist nicht anzunehmen bzw. durch die Singularität der Grube Bef. 9o9 sogar widerlegt. So ist eine Mindestanzahl von deutlich über 4o Stück anzunehmen.
Die Verbreitung der Tiegelreste innerhalb der Ausgrabungsflächen folgt jener der Säulen, zeigt aber im Gegensatz zu diesen ein deutlich eingeschränkteres Bild (Abb. 4o). Sie konzentrieren sich merklich im Bereich der »großen« Sechspfostenbauten in Fläche 3, somit im Bereich von »Haupthäusern« und Gehöften. Eine weitere Konzentration lag im Nordbereich der Fläche 2, die ebenfalls Hausgrundrisse aufweist. Eine kleinere Ansammlung befand sich sehr isoliert im Nordwestbereich der Fläche 3 (Bef. 387, 388, 5o4–5o8) und eine Grube mit etwas mehr Material lag im Mittelbereich der Fläche 2 (Bef. 423). Ansonsten streuten einzelne Funde in den zu dem südlichen Gehöft um Haus 22 liegenden Gruben (Bef. 238, 83o).
Dieses Verbreitungsbild erlaubt Rückschlüsse auf die Art des Umgangs mit den Endprodukten des Siedeprozesses: Das Salz lag nach der Öffnung
Abb. 39 Tiegelränder aus den Bef. 387 (1), 1197 (2),
439 (4, 5) M 1:3.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 85
Abb. 40 Verbreitung der Briquetagereste innerhalb der Siedlung nach Gewicht.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
86
des Ofens als »Formsalz« in den Tiegeln vor. Diese wurden offensichtlich nicht als Schutz für das Salz benutzt, wie es anhand von Funden aus der Niederlausitz belegt werden kann, wohin Kelchoberteile und Hohlkegel der anderen halleschen Briquetagevarianten offenbar zusammen mit den Salzkuchen gelangten (Bönisch 1996, 97–1oo). In Brehna dürfte das Salz direkt nach dem Produktionsprozess von den Tiegeln getrennt worden sein, denn die Tiegelreste kamen in vielen Fällen in den Gruben oder Grubenkonzentrationen vor, die auch bei der Produktion zerbrochene Säulen
enthielten (z. B. Bef. 1179/1186/1198/1617; Bef. 439; Bef. 9o9/911/912/752; Bef. 746–748; Bef. 387/388). Von den 51 Gruben mit Tiegelresten enthielten 28 Säulenfragmente. Das spricht eindeutig für eine gemeinsame Verwendung (entgegen Matthias 1961, 177 f.). Diese defekten Säulen, vor allem wenn sie in Sätzen vorliegen, wurden sicher nicht über größere Strecken innerhalb der Siedlung verbracht, sondern zeigen wohl in der Mehrheit der Fälle eine Nähe zum Produktionsort an. Warum letztlich weniger Tiegel als Säulenfragmente vorliegen, kann nur in dem geringeren Gewicht und der
Abb. 42 Konzentration von Tiegelresten in der Grube
Bef. 1177/1617.
Abb. 41 Bef. 1186 mit Säulenfragmenten, Teilen
einer Ofenwandung (?) und Rinderknochen.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 87
geringeren Haltbarkeit ersterer begründet liegen. Der Anfall an Tiegelfragmenten muss hoch gewesen sein, wie durch Bef. 9o9 belegt werden kann. Interessanterweise kam in Brehna kein Befund zutage, in dem die Reste eines vollständig missglückten Produktionsvorganges zusammen abgelagert wurden bzw. liegen blieben (vgl. Preier 1999, 135–138). So fehlen Inventare, die eine Durchmischung einer großen Anzahl an Tiegel und gleichzeitig an Säulenfragmenten aufweisen ebenso wie eindeutige Reste von Ofenwandungen bzw. Kuppeln. Sollte es solche gegeben haben, ist lediglich die Verfüllung der Grube Bef. 1186 anzuführen, wo neben mehreren Säulen, darunter drei vollständig rekonstruierbaren, auch verziegelte Wandungsteile gefunden worden sind. Auf eine »normale« Verfüllung im Siedlungsablauf deuten die darunter liegenden, wahrscheinlich gleichzeitig mit eingebrachten Skelettteile eines Rindes (Abb. 41). Die benachbarte Grube Bef. 1617 bzw. 1177 enthielt viele Tiegelbruch stücke (Abb. 42).
Die Briquetagefunde aus Brehna stammen gesichert nur aus früheisenzeitlichen Befunden. Die jungbronzezeitlichen Gruben erbrachten nur in einem Fall (Bef. 282) drei kleine Tiegelfragmente aus dem oberem Bereich, die wohl einer sekundären Einfüllung angehören. Ein Säulenfragment stammt aus Bef. 524, der eine jungbronzezeitliche Doppelkonusscherbe enthielt. Es zeigte sich, dass weitere Teile dieses Gefäßes in der von Bef. 524 geschnittenen Grube Bef. 525 lagen, so dass diese Scherbe nicht die Grubenverfüllung datiert. Datierend wirken einfache Schalenscherben früheisenzeitlicher Machart. Es kann festgestellt werden, dass für die jungbronzezeitliche Besiedlungsphase in Brehna noch keine Belege für eine Salzproduktion vorliegen. Diese setzte frühestens in der Jüngstbronze und sicher in der Früheisenzeit ein. Einer feinchronologischen Bearbeitung der Keramik bleibt es vorbehalten, den Zeitpunkt des Einsetzens der zweiteiligen Briquetage mit Tiegel in Brehna noch weiter einzuengen. Die Form selbst ist dazu vermutlich nicht geeignet. Sollten die Niederlausitzer jüngstbronzezeitlichen Hohlkegel aus Halle stammen, wäre dies ein chronologisches Indiz für eine Abfolge von Hohlkegel zu Tiegelbriquetage. Tiegelteile kommen dort nicht vor, Hohlkegel in Brehna nicht. Nach den Brehnaer Erkenntnissen, dass die Tiegel wahrscheinlich nicht mehr – wie ihre Vorgänger – als Transportbehälter dienten, wäre dies auch nicht zu erwarten und eine gleichzeitige Belieferung mit beiden Formen ist eher unwahrscheinlich.
Feuerböcke
Als Besonderheit liegen aus 25 Siedlungsgruben Reste von mindestens 28 so genannten »Feuerböcken« vor. Der Begriff wird im Folgenden als terminus technicus verstanden. Kein Exemplar ist
vollständig erhalten, in einigen Fällen konnten lediglich kleine charakteristische Bruchstücke festgestellt werden. Herausragend war Bef. 791, in dem größere Fragmente von mindestens vier Feuerböcken lagen (Abb. 43, 44). Bei mehreren Exemplaren ergaben sich Zusammenpassungen zwischen verschiedenen Gruben (Bef. 115:479, 59o:591, 637:638, 1397:1517), wobei nur bei den beiden ersten zueinander gehörige Bruchstücke aus verschiedenen, mit Abstand zueinander liegenden Gruben stammen. Die beiden anderen Fälle sind größere Grubenkomplexe, die offenbar in einem Zuge verfüllt wurden. Zumeist liegt die bereits bekannte Form Mitteldeutschlands vor. Auf einer langovalen Grundfläche steht blockartig, sich nach oben stark verjüngend, der massive Feuerbock. An den oberen Enden sind seitlich zwei Zipfel ausgeformt, so dass dazwischen ein meist leicht durchgebogener oder wieder aufgewölbter, zuweilen auch gerader Grat gebildet wird. Eine der sich in der Frontalansicht nach oben zu den Zipfeln hin verbreiternden Langseiten ist als Schauseite ausgebildet und reich verziert. Diese Seite steht teilweise steil, so dass die unverzierte Rückseite dementsprechend stärker geneigt ist. Die Feuerböcke sind meist sehr nachlässig gearbeitet (Tab. 2).
Die Verzierung der Feuerböcke ist, vor allem im Vergleich zu der Verzierungsarmut der gleichzeitigen Gefäßkeramik, auffällig reich. Trotzdem lässt sich ein sehr standardisiert wirkendes Repertoire erkennen, aus welchem immer wieder geschöpft wurde. Die Anzahl der möglichen Kombinationen dieser Einzelelemente führt dazu, dass kein Exemplar dem anderen in seiner Ausführung gleicht. In Brehna kommen folgende Varianten vor: Der obere Grat zwischen den Zipfeln ist unverziert gerundet (Abb. 44,2.3; 45,1.3; Bef. 115/479, 333, 758, dreimal 791, 1o32), weist eine (Abb. 44.1;
Abb. 43 Ein Feuerbockfragment in der unteren Verfüllung der Siedlungsgrube Bef. 791.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
88
45,4.5; 46,3; Bef. 896, 1374, 1517) und einmal sogar zwei (Abb. 46,2; Bef. 1517) parallele Furchen auf. Die Seitenkanten unter den Zipfeln sind meist entsprechend verziert. Nachgewiesen werden konnten völlig unverzierte (Abb. 44,2.3; 45,1.3.5; 46,1; Bef. 115/479, 387, 896, zweimal 791, 1o32, 1374), mit einer Furche (Abb. 44,1; 45,4; 46,3; Bef. 791, 1o32 und 1517) und mit drei Furchen (Abb. 46,2; Bef. 1517) versehene Seiten. Die Zipfel tragen in dem sehr stark gefurchten Fall aus Bef. 1517 zudem jeweils drei Fingertupfen.
Die Schauseite weist die Hauptverzierung auf. Deutlich lässt sich eine immer wiederkehrende vertikale Dreiteilung der Fläche erkennen: Die Mitte der Schauseite wird flächig durch horizontale, übereinander angeordnete Ornamente beherrscht. Beidseitig unter den Zipfeln wird diese jeweils durch ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes vertikales Element begrenzt. Die Ornamente des Mittelfeldes sind horizontale Furchen und Wellenbänder. In den einfachsten und häufigsten Fällen ist der Feuerbock ausschließlich mit mehreren, meist drei Furchen in verschiedenen Abständen verziert (Abb. 44,1.2.4; 45,1; Bef. 115/479, 798, dreimal 791). Einmal verläuft unter der unteren Furche eine Reihe aus Fingertupfen (Abb. 45,5; Bef. 896). In zwei Fällen besteht die Ornamentik unten aus horizontalen Furchen und oben aus einer relativ schwach alternierenden Wellenlinie
(Abb. 45,5; 46,2; Bef. 896, 1517). Abweichend ist ein Exemplar oben und unten mit zwei stark alternierenden Wellenlinien, die durch eine horizontale Mittelfurche getrennt sind (Abb. 46,3; Bef. 1517), und eines durch horizontale Furchen und flach eingedrückte Kreisstempel (Abb. 45,2; Bef. 798) verziert. Ein gutes Vergleichsstück zu dem erstgenannten Exemplar fand sich in QuedlinburgHakelteich, Lkr. Harz (Nuglisch 1965, Taf. 49b). Bei zwei Bruchstücken ist erkennbar, dass die unteren Furchen an beiden Enden nach oben gebogen sind (Abb. 44,3; 46,1; Bef. 791, 1545). Eine Besonderheit stellt das Stück aus Bef. 1o32 (Abb. 45,3) dar. Es trägt im Mittelfeld einen horizontalen Grat. Über diesem verlaufen parallel zwei Furchen in der Mitte ebenfalls horizontal. Beidseitig der Enden des Grates ziehen diese jedoch nach unten
– die untere bogenförmig, die obere in Wellen – und ersetzen das seitliche vertikale Element.
Die seitlichen vertikalen Elemente sind aus tiefen Fingertupfen (Abb. 44,2; 45,5; 46,2.3; Bef. 637/638, 896, 791, 1374, 1517) oder durchgehenden Löchern (Abb. 44,1.3; 45,1; Bef. 115/479, 798, zweimal 791) sowie vertikalen Furchen gebildet. Gewöhnlich enden nur die horizontalen Furchen des Mittelfeldes in einer Fingertupfung/Durchlochung (Bef. 115/479, 637/638, 798, dreimal 791, 1517), wobei nicht immer jeder Furche ein solches Ornament zugeordnet ist. Die Zipfel sind in meh
Abb. 44 Feuerbockfragmente aus der Grube Bef. 791. M 1:4.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 89
reren Fällen durch eine weitere Delle betont (Abb. 44,1.2; 45,5; 46,2; Bef. 791, 1374, 1517). Der gut erhaltene Feuerbock aus Bef. 791 (Abb. 44,1) und ein weiterer aus Bef. 1517 (Abb. 46,2) weisen als vertikales Element neben den Durchlochungen Furchen auf.
Abweichend von diesen Feuerböcken sind die Stücke aus Bef. 59o und 591 (Abb. 45,4). Sie sind aus einem sehr stark gemagerten, wenig Tonbestandteile enthaltenden, krümeligen Material hergestellt. Das Exemplar aus Bef. 591 besitzt nicht wie üblich einen im Vergleich zur Standfläche schmalen oberen Grat, sondern eine kaum verjüngte, gerundete Oberseite, über die eine Furche läuft. Die Ecke, die bei den anderen Feuerböcken einen Zipfel aufweist, ist ebenfalls nur gerundet. Die Schmalseite unter der Ecke trägt eine vertikale Furche. Die Schauseite lässt bei beiden Exemplaren lediglich eine horizontale Furchung erkennen.
Die Beobachtungen zur abweichenden Form der genannten Stücke wäre nicht überzubewerten, wenn nicht das Material des Exemplares aus Bef. 591 im Besonderen, aber auch jenes aus Bef. 59o auffällig identisch mit jenem wäre, aus dem die sehr charakteristisch erscheinenden BriquetageTiegel hergestellt sind. Hinzu treten weitere merkwürdige Fundgegenstände aus vergleichbarem Material aus Bef. 1153. Sie weisen deutliche Fingerriefen auf, die wohl bewusst aufgetragen wurden und keine zufälligen Verstrichspuren auf Lehmbewurf darstellen. Die Parallele Feuerbock–Tiegel vor Augen fällt auf, dass die »normalen« Feuerböcke mit ihrem höheren Lehmanteil dem
Grundmaterial der BriquetageSäulen ebenfalls sehr ähnlich sind. Eine Aufstellung der Verteilung der Feuerböcke über die Ausgrabungsfläche ergibt ein äußerst interessantes Bild (Tab. 2 und Abb. 47). Die Feuerbockfragmente kamen ausschließlich in den Bereichen vor, in denen auch gehäuft Briquetage auftrat. Im Folgenden ist aufgeführt, in welchen Gruben Feuerbockfragmente mit Säulen und mit Tiegeln vergesellschaftet auftraten bzw. in welchem Abstand zum nächsten Vorkommen die Grube lag (Tab. 3).
Deutlich ist zu erkennen, dass 22 der 28 Feuerböcke (78,6 %) direkt mit Briquetage vergesellschaftet vorkamen. Briquetagefragmente, davon vor allem die Tiegelreste, waren aber nicht so häufig in den Gruben enthalten, dass dieser hohe Wert banal wäre. Insgesamt wiesen nämlich nur 5o Gruben (13,8 % von Gesamt) Tiegelfragmente auf – aber 363 Gruben konnten über Fundmaterial in die Jüngstbronze bis Früheisenzeit gestellt werden. Hinzu kommen noch eine ganze Reihe von fundlosen Gruben und Ofengruben im Nordteil von Fläche 2 und der gesamten Fläche 3, die ebenfalls in diese Zeit zu stellen sind. Von diesen 5o Gruben mit Tiegelfragmenten enthielt fast ein Viertel (11 Gruben; 22 %) Teile von mindestens 17 Feuerböcken, also fast zwei Drittel (6o,7 %) des gesamten Aufkommens. Diese Tendenz wird durch die Tiegelmengen in diesen Befunden noch bestätigt. Von den 14 von 5o Gruben, die einen höheren Anteil an Tiegelteilen erbrachten (jeweils mehr als o,3 kg), enthielten mehr als ein Drittel (fünf Gruben; 35,7 %) Feuerbockteile (bei 23 Gru
BEFUND-NR. FEUERBOCKANZAHL BEMERKUNGEN115 1 Zusammenpassung mit 479158 1 204 1 333 1 387 1 388 1 479 Zusammenpassung mit Bef. 115590 1 »Briquetage«-Feuerbock, Zusammenpassung mit Bef. 591591 1 »Briquetage«-Feuerbock, Zusammenpassung mit Bef. 590637/638 1 Zusammenpassung mit Bef. 638747/748 1 758 1 791 mind. 4 798 3 896 1 912 1 978 1? fraglich997 1 1025 1 1032 1 1153 ?? briquetageartige Objekte1374 1 1397 1 Zusammenpassung mit Bef. 15171517 1 weiterer Zusammenpassung mit Bef. 13971545 1
Tab. 2 Zusammenstellung der Siedlungsgruben mit Feuer-bockfragmenten.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
90
Abb. 45 (oben) Feuerbockfragmente aus den Gruben Bef. 115/479 (1), 798 (2), 1032 (3), 591 (4), 896 (5). M 1:4.
Abb. 46 (unten) Feuerbockfragmente aus den Gruben Bef. 1545 (1) und 1517 (2, 3). M 1:4.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 91
ben mit über o,1 kg Tiegelfragmenten sind es sieben, mit 3o,5 % also ebenfalls fast ein Drittel).
Der Vergleich der feuerbock mit den säulenführenden Gruben zeigt diese Korrelation nicht in diesem Maße und unterstreicht die Verbindung Feuerbock–Tiegel dadurch noch. In 15 der 124 (von 363 datierten) Gruben mit Säulennachweisen (12,1 %) kamen Fragmente von insgesamt 18 Feuerböcken (64,3 %) vor. In diesen Gruben traten Säulen in allen Gewichtsbereichen auf. Das Verhältnis ist bezüglich der Grubenanzahl im Vergleich zur Normalverteilung etwas erhöht (34 % der jüngstbronze bis früheisenzeitlich datierten Gruben enthielten die Säulen, diese sind 6o % der FeuerbockGruben), bezüglich der Feuerbockanzahl noch deutlicher erhöht (34 % enthielten neben den Säulen 64,3 % der Feuerböcke). Da die Gruben aber nicht in Gausscher Normalverteilung über die Fläche streuen, kommt das in Tab. 3 erkennbare chorologische Argument hinzu. Nicht nur, dass die Abstände der Gruben mit Feuerböcken und ohne säulenförmige Briquetage zu solchen mit Säulenfragmenten nur zweimal im Bereich von 1o m und sonst deutlich darunter lagen (Tab. 3). Ein Blick auf den Gesamtplan zeigt auch, dass sich in der Nähe von Briquetagefunden gerade außerhalb der großen Fundkonzentrationen der Briquetage im Bereich der Häuser 3 bis 2o die Feuerböcke fanden. Dies ist im Nordteil der Fläche 3 mit den »hell« verfüllten Befunden anhand der Gruben 387/388 und ihrem Umfeld (Bef. 389, 399, 5o4, 5o7, 5o8) und der Grube 1549
mit ihrem Umfeld (Bef. 1548, 155o, 1551) sowie auch in Fläche 2 anhand der Grube 2o4 mit ihrem Umfeld (Bef. 196, 197, 2o2, 1o65, 1o7o) gut zu erkennen (vgl. Abb. 74). Besonders die isoliert liegende Grubenkonzentration Bef. 1548–1553 zeigt dies deutlich, denn in ihren völlig identisch aussehenden Verfüllungen kamen neben vielen Säulenbruchstücken (mit Zusammenpassungen zwischen den Gruben) nur wenig Keramik, aber ein Feuerbock vor. Ähnliches ist für den Grubenkomplex Bef. 747/478 festzustellen, wo neben viel Briquetage und wenig Keramik ebenfalls ein Feuerbockfragment gefunden wurde.
Vorstehende Beobachtungen und Analysen zusammen genommen lassen eine statistische Korrelation Feuerböcke–Briquetage erkennen. Diese ist in Bezug auf die säulenförmige Briquetage deutlich, aber locker, da der Anteil an Gruben mit Säulenfragmenten insgesamt recht hoch ist. In Bezug auf die tiegelförmige Briquetage ist sie stark. Die Verwendung des gut erkennbaren, wohl gleichen gemagerten Grundmaterials für die Herstellung von Tiegeln und Feuerböcken (Bef. 59o/591) in einem Fall sowie möglicherweise wiederum gleichen Materials für die Säulen und Feuerböcke in anderen Fällen verstärkt diesen Eindruck und wirft ein Licht auf die herstellungstechnische Abhängigkeit. Diese kann nicht zu dem auf uns gekommenen Bild geführt haben, denn einerseits ist die Briquetage benutzt worden, wie die vielfältigen Sekundärbrandspuren zeigen, und andererseits handelt es sich auch bei den Feuerbockfrag
BEFUND- FEUERBOCK- ABSTAND ZU BEFUNDEN ABSTAND ZU BEFUNDEN NUMMER ANZAHL MIT TIEGELN MIT SÄULEN115 1 X X158 1 X X204 1 26 m 8 m333 1 15 m 11 m387 1 X X (in 388)388 1 X X479 X (in 115) 0,5 m590 1 X 1,8 m591 1 X (in 590) 0,1 m637 1 9 m X (in 638)747/748 1 X X758 1 X 0,5 m791 mind. 4 X X798 3 X X896 1 10,5 m X912 1 X 2,5 m978 1? 9 m 7 m997 1 X X1025 1 14,5 m 6,5 m1032 1 10 m 10 m1153 ?? 1374 1 11,5 m X1397 1 13 m X1517 1 weiterer 13 m X1545 1 39 m 0,7 m
Tab. 3 Die Gruben mit Feuerböcken und ihr Abstand (gerundet) zu den nächstliegen-den Befunden mit Briquetage (X= Zusammenfund).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
92
Abb. 47 Die Verbreitung von Briquetage, Feuerböcken und Backtellern auf den Grabungsflächen 2 und 3.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 93
menten wohl nicht um Fehlbrände bzw. unbenutzte Stücke. Vielleicht liegt hier ein erster Ansatz zu der immer noch nicht gelungenen Klärung der Funktion dieser rätselhaften Gebilde. Denn das gewonnene Bild kann nur bedeuten, dass die Feuerböcke zumindest im selben räumlichen Umfeld wie die Briquetage eine Funktion besessen haben müssen. Oben konnte gezeigt werden, dass
die Tiegel aufgrund der mutmaßlichen Einmaligkeit ihrer Verwendung und ihrer Zerschlagung in der Nähe des Siedeofens, um den Salzkuchen entnehmen zu können, wohl über vergleichsweise geringe Entfernungen innerhalb der Siedlung transportiert wurden. Das ist auch für zerstörte »Ofensätze« von Säulen anzunehmen. Einzelne Säulen dagegen sind wohl, da sie nach Möglichkeit
Abb. 48 Verbreitung der früheisenzeitlichen Feuerböcke im nördlichen Mitteldeutschland; thüringische urnenfelderzeitliche Exemplare sind nicht beachtet (Ergänzung zu der Liste Müller/Nowak 1960, 222; z. T. erste Abbildungen). Roter Kreis – ein bis zwei Exemplare, gelber Kreis – fünf und mehr Exemplare: Altenweddingen, Bördekreis (1; Müller/Nowak 1960, 218); Badeborn, Lkr. Harz (1; Müller/Nowak 1960, 218); Bösenburg, Lkr. Mansfeld-Südharz (1?; Nuglisch 1965, 105); Brehna, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (mindestens 28 Exemplare); Dessau, kreisfreie Stadt (1; v. Brunn 1943, 141); Dessau, kreisfreie Stadt, Ot. Rodleben, (1; v. Brunn 1943, 140); Eichholz, Lkr. Anhalt-Bitterfeld; Akten Museum Zerbst); Erdeborn, Lkr. Mansfeld-Südharz (1; Marschall 1988, 202 Abb. 2r); Gatersleben, Salzlandkreis (mind. 5; Müller/Nowak 1960, 218–220 Abb. 1b.c; mind. 1 von der Grabung B 6n; fünf weitere Exemplare aus einer Grabung von 2004, nach freundlicher Mitteilung von T. Kubenz, Halle); Gröbzig, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1; Nuglisch 1964, Taf. 9f); Halle-Ammendorf/Beesen, kreisfreie Stadt Halle (1; v. Brunn 1943, 141); Halle-Gie-bichenstein, kreisfreie Stadt Halle (1; Töpfer 1961, 796 Abb. 37,2); Halle-Mühlberg, kreisfreie Stadt Halle (1; v. Brunn 1943, 141); Kloster-Gröningen, Bördekreis (1; Müller/Nowak 1960, 219/220 Abb. 1d; Nuglisch 1965, Taf. 47e); Köthen, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1; v. Brunn 1943, 141); Köthen-Gütersee, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1; Nuglisch 1964, Taf. 7e); Krottorf, Bördekreis (1; v. Brunn 1943, 140); Landsberg, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1?; v. Brunn 1943, 141; Müller/Nowak 1960, 222); Löbnitz, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1; Nuglisch 1965, 105; Müllerott 1998, Taf. 5); Neugattersleben, Salzlandkreis (1; Nuglisch 1964, 800); Osternienburg, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1; v. Brunn 1943, 141); Quedlinburg-Hakelteich, Lkr. Harz (5; Schirwitz 1925; Nuglisch 1965, 579/580; Taf. 49a.b); Quedlinburg-Schenkendorfstr., Lkr. Harz (1; Nuglisch 1965, Taf. 36); Quedlinburg-Schloßberg, Lkr. Harz (1; v. Brunn 1953, 140; Schirwitz 1960, Taf. 5f; Nuglisch 1965, Taf. 48c); Schönebeck, Lkr. Anhalt-Bit-terfeld (1; v. Brunn 1943, 140); Schönebeck-Frohse, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (v. Brunn 1943, 140); Stemmern, Bördekreis (11; Müller/Nowak 1960, 19–221); Unse-burg, Salzlandkreis (1; Müller/Nowak 1960, 220/221 Abb. 1a); Wulfen, Lkr. Anhalt-Bitterfeld (1; v. Brunn 1943, 141); weiterhin mindestens 26 Fragmente von insge-samt fünf Fundstellen auf der Trasse der Bundesstraße B6n nördlich Quedlinburg (Moos 2006; freundliche Mitteilung F. Gall, Halle) und zwei Exemplare ohne genaue Fundortangabe: »wohl Gegend von Magdeburg« (1; v. Brunn 1943, 140); »wohl Gegend von Bernburg« (1; v. Brunn 1943, 141).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
94
mehrmalig verwendet wurden, transportiert worden. Blickt man in diesem Bewusstsein auf das Verbreitungsbild in Brehna, so kann die schärfere Konzentrationenbildung der Tiegel diesen logischen Hintergrund haben. Zugleich bedeutete dies, dass die Feuerböcke sehr nah am direkten Produktionsort bzw. zumindest am Ort der Zerschlagung der Tiegel eine Rolle gespielt haben müssen. Ob dies eine rituelle war – zum Beispiel im Rahmen eines Produktionsvorganges – oder ob eine solche mit einer technischen Funktion gekoppelt war, muss dahingestellt bleiben. Die in Süddeutschland gelegentlich vermutete funktionsbedingte Verbindung mit den runden Keramikplatten (vgl. Nuglisch 1965, 1o7) lässt sich in Brehna nicht erkennen (siehe unter »Backtellern«).
An den Feuerböcken fehlen Merkmale technischen Gebrauchs, z. B. Abnutzungsspuren an den Oberkanten, aber auch die variable Ausformung sowie der schlechte Brand insgesamt sprechen nicht für eine Zweckform. Das schließt eine Funktion als Auflage für Holzscheite nicht aus. Die Feuerböcke können aber aufgrund ihres andersartigen Sekundärbrandes nicht innerhalb eines Siedeofens gestanden haben. Die Stücke aus Brehna weisen keine deutlichen einseitigen Brandspuren auf, wie dies bei anderen Exemplaren gelegentlich erwähnt und als Ausdruck einer Position an einem Feuer gewertet wird. Gegen eine ausschließlich technische Funktion der Feuerböcke sprechen die Zwanghaftigkeit ihrer Verzierung einerseits, v. a. im Gegensatz zur Gefäßkeramik und der technischen Keramik (Briquetage), und die Stereotypie der eingesetzten Ornamentik andererseits. Letztlich weisen die urnenfelderzeitlichen Vorläufer (»Mondidole«) auf einen zumindest ehemals vorhandenen Symbolgehalt ähnlicher Formen hin (Baumeister 1995, 396–418), selbst wenn auch diesen eine Funktion als »Feuerbock« zugestanden wird.
Ein Blick auf die Verbreitung der früheisenzeitlichen Feuerbockfunde Mitteldeutschlands (Abb. 48) zeigt, dass kein direkter technischer Zusammenhang mit der Briquetage bestehen dürfte. Zwar deckt sich die derzeitig erschließbare Verteilung der Briquetagefunde im gesamten östlichen Bereich völlig mit jener der Feuerböcke,
doch kommen diese darüber hinaus massiert im Nordharzgebiet vor, wo Briquetage bisher weitgehend fehlt. Auch dürften die anderen Feuerbockfunde nicht regelhaft mit Briquetage vergesellschaftet gewesen sein (Müller/Nowak 196o, 218–221), obwohl sich das aufgrund des Publikationsstandes schwer nachprüfen lässt. Viel deutlicher zeichnen sie offenbar, ergänzt durch eine Anzahl von Neufunden, das Verbreitungsgebiet der voll entwickelten Hausurnenkultur nach (Nuglisch 1965, 1o6; dagegen noch Töpfer 1961) und geben damit einen wichtigen Hinweis zur kulturellen Einordnung der Brehnaer Siedlung. Lediglich im niedersächsischen Nordharzgebiet, bekannt durch das Hausurnengräberfeld Beierstedt, Lkr. Helmstedt, und im Magdeburger Gebiet fehlen bisher derartige Funde. Ansonsten sind sehr ähnliche blockartige, zweizipflige Fundgegenstände, meist jedoch in deutlich geringerem Ausmaß verziert, innerhalb der frühen Eisenzeit (Ha C) regelhaft in Schlesien verbreitet (z. B. Gedl 1973, Taf. 7,6; 32,3; 5o,12).
Die vorstehenden Überlegungen zur Funktion der Feuerböcke zusammengefasst, dürfte die in Brehna nachweisbare Korrelation dieser Fundgegenstände mit der Salzproduktion eher in der räumlichen Nähe der Nutzung von Feuerböcken und Briquetage bzw. einer Verbindung von Zeremonien und Ritualen bei der Salzproduktion begründet liegen. Besonders bemerkenswert ist, dass sich die Feuerbockfunde auf der ausgegrabenen Fläche ausschließlich im Nordteil der Fläche 2 und besonders in der Fläche 3 fanden, also im Bereich der, wie unten zu zeigen sein wird, wohl älteren Gehöfte A und B, während das Umfeld des vielleicht bereits Ha Dzeitlichen Gehöftes C keine Funde geliefert hat.
Knochen- und Geweihgeräte
Aus den Siedlungsgruben liegen mindestens fünf Knochen und vier Geweihgeräte vor.
Ein sehr typisches, weder zeitlich noch kulturell näher einzuordnendes Knochengerät ist der Pfriem aus Bef. 1374 (Abb. 49), der aus einem angespitzten Knochen hergestellt wurde (vgl. Töpfer 1961, Taf. 14,1–3). Das gegenüber liegende Ende ist abgebrochen.
Rippengeräte mit abgeschliffenem Ende wie aus Bef. 59o (Abb. 49) liegen aus eindeutig früheisenzeitlichen Fundkomplexen in Mitteldeutschland vor (Nuglisch 1964, Taf. 5i.k; Taf. 8f.g; Nu glisch 1967, 235 Anm. 3; 236 Abb. 2a.b; wahrscheinlich auch Töpfer 1961, Taf. 14,1o). Das Brehnaer Stück ist aus der Rippe eines Rindes hergestellt. Die Funktion dieser Geräte ist ungeklärt. Auffällig ist ihr gehäuftes Vorkommen zusammen mit den so genannten »Flachshecheln« (Nuglisch 1967, 235 Anm. 3). Knochenfragmente mit Schnittspuren liegen aus Bef. 1179 vor. Der Form nach könnte
Abb. 49 Rippengerät aus Bef. 590 und Pfriem aus
Bef. 1374.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 95
es sich um ein Halbfabrikat für ein Knochengerät gehandelt haben.
Zwei Knochengeräte aus Bef. 594 und 1346 (Abb. 5o) wurden aus einem Rinderunterkiefer hergestellt und weisen an der gebogenen Längsseite in einem gewissen Abstand zwei Durchlochungen auf, während die gegenüber liegende Seite in der Art einer stumpfen Schneide zugerichtet ist. Die »Schneide« ist bei dem kleinen Stück gerade (Bef. 594) und bei dem auffallend großen Stück konkav (Bef. 1346). Sehr ähnliche, aus Schulterblättern, gespaltenen Kiefern oder anderen flachen Knochen hergestellte Geräte, die unter dem Begriff »Flachshecheln« geführt werden, wurden aus mehreren früheisenzeitlichen Befunden Mitteldeutschlands vorgestellt (Nu glisch
1964, insbesondere Taf. 3b; 4a; 5h; 7c; 9d; Nuglisch 1967, 235 Anm. 3; Nuglisch 1965, 74–76). Auffällig ist, dass das Stück aus Bef. 1346 ebenso wie eines aus HalleKlausberge aus einem Tierunterkiefer hergestellt wurde (Nuglisch 1964, 8oo). Die Kerben in der »Schneide« derartiger Geräte werden als charakteristisch angesehen (Nuglisch 1964, 8o1). Wie auch an einigen der erwähnten älteren Funde (z. B. Nuglisch 1964, Taf. 7c) sind solche Kerben an den Brehnaer Stücken nicht nachzuweisen. Sollte es sich bei den vorliegenden Objekten nicht um Halbfabrikate handeln, waren die Kerben für die Funktion möglicherweise gar nicht nötig und stellen an den anderen Exemplaren daher eher Abnutzungserscheinungen dar. Jedenfalls unterscheiden sich die bisher nachgewiese
Abb. 50 Knochen- und Geweih-geräte aus verschiedenen Befun-den: oben rechts Bef. 865, oben links Bef. 997, unten rechts Bef. 1346, unten links Bef. 594.
Abb. 51 Geweihgeräte aus den Bef. 143, 1375, 1179 und 605 (von unten).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
96
nen Kerbungen untereinander recht stark. Die viel diskutierte Funktion als Flachsbearbeitungsgerät käme kaum in Frage, weitere Deutungen betreffen die Verwendung als Webgerät, als Fleischlöser oder zur Herstellung von Schnüren (Nuglisch 1964, 8o1). Bemerkenswert ist das Vorkommen eines sehr ähnlichen, zweifach durchlochten Gerätes ohne Kerbe innerhalb der spätkaiserzeitlichen MasłomeczGruppe in Polen (Kokowski 1983, Taf. 3o4,2), für das keine nähere Deutung vorliegt. Ein nicht sicher als Halbfabrikat anzusehendes Stück dürfte mit dem mondsichelförmigen Fragment eines rechten Schweineunterkiefers aus Bef. 997 (Abb. 5o) vorliegen, das dem Stück aus Bef. 594 in Form und Größe sehr ähnelt, aber keine Durchlochung zeigt.
An diese Geräte anzuschließen ist ein aus einem geraden Geweihspan des Rothirsches hergestelltes Stück aus Bef. 865 (Abb. 5o), das ebenfalls zwei in größerem Abstand liegende Durchlochungen an einer Längsseite und eine stumpfe »Schneide« an der gegenüber liegenden Seite aufweist.
Drei Geweihgeräte wurden jeweils aus einer Geweihsprosse des Rothirsches hergestellt (Abb. 51; Bef. 143, 1179 und 1375). Sie weisen mit 16, 21,5 und 28 cm sehr unterschiedliche Längen auf. Die Spitzen sind bei den Stücken aus Bef. 1179 und 1375 glatt, bei dem aus Bef. 143 ausgesplittert. Vergleichbare Stücke liegen aus Kloster Gröningen, Lkr. Börde (Nuglisch 1965, Taf. 46i.k), vor. Derartige Geräte konnten vielfältig, z. B. als widerstandsfähige »Grabstöcke« eingesetzt werden. Das Exemplar aus Bef. 143 könnte an seinem abgebrochenen stumpfen Ende ein Schäftungsloch besessen haben (vgl. Töpfer 1961, Taf. 14,11).
Aus Bef. 6o5 liegt ein Artefakt vor, welches nicht sicher einzuordnen ist (Abb. 51). Es wurde wahrscheinlich aus einem längs halbierten Hornzapfen hergestellt, ist sehr kurz und an der breiteren Seite gerade abgeschnitten. Ob es sich um einen Teil eines Gerätes handelte, ist nicht feststellbar.
Ein in seiner Verwendung unklares Knochenfragment stammt aus Bef. 1186. Hierbei handelt es sich um ein Stück des linken Schienbeines eines Rindes, welches eindeutige anthropogene Nutzungsspuren trug, die beispielsweise bei der Fellreinigung durch Schaben entstanden sein könnten.
Steingeräte
Aus der Brehnaer Siedlung liegen sehr viele Steingeräte vor (Abb. 52; 53). Den Hauptanteil bilden mehr oder weniger kugelförmige, etwa faust bis leicht überfaustgroße handliche Stücke, die aus entsprechend geeigneten eiszeitlichen Geröllen hergestellt worden sind. In vielen Fällen sind sie rundum beschliffen, so dass mehrfach fast kugelrunde Exemplare entstanden. Derartige Steine, meist als Klopf oder als Reibesteine bzw. als »Bicksteine« bezeichnet, kommen in sehr verschiedenen Anteilen in spätbronze bis eisenzeitlichen Siedlungen vor. Die Funktion dieser Steine ist im Einzelfall schwierig zu bestimmen, sicher sind sie für verschiedene Tätigkeiten nutzbar gewesen.
In Zedau, Altmarkkreis Salzwedel, wurden in 57 Gruben 61 Exemplare nachgewiesen (Horst 1985, 115), die bisher größte publizierte Anzahl solcher Geräte im ElbeSaaleGebiet. Eine derartige Stückzahl dürfte bei einer Deutung als Reibestein auf eine stark agrarische Ausrichtung der Siedlung hindeuten. Problematisch ist allerdings, dass in Zedau beispielsweise nur zwei Reibeplatten nachgewiesen werden konnten, welche die Unterlage beim Mahlen gebildet haben können. In Brehna kamen immerhin in neun Befunden
Abb. 52 Die Herdgrube Bef. 901, in der sich mindestens
sieben Reib- und Klopfsteine in Sekundärnutzung als Wärmespeicher fanden.
Abb. 53 Die gut erhaltenen jüngstbronze- bis früheisenzeit-
lichen Reib- und Klopfsteine aus verschiedenen Befunden.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 97
Abb. 54 »Klopfsteine«, handliche Steingeräte mit beklopften Kanten.
Abb. 55 Zylindrisch beriebene »Reibsteine«, Steingeräte mit unberiebenen Polen.
Abb. 56 Kugelförmige »Reibsteine«, vollständig beriebene Steingeräte.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
98
BEF.-NR./ KLOPF- BZW. KLOPFSTEIN REIBESTEIN REIBE- UND PLATTIGE WETZ-, SCHLEIF-, ZEIT- REIBESTEINE KLOPFSPUREN MAHLSTEINE POLIER- UND STELLUNG ANDERE GERÄTE106 1 kugelförmig 128 1 Kanten berieben 129 1 X 130 1 tonnenförmig berieben 130 1 Kanten berieben 158 1 X 158 1? 194 1 kugelförmig 217 1 Kanten berieben 217 1 X 223 1 X kleinstes Exemplar 225 1 tonnenförmig berieben 278 1 X 279 1 Kanten berieben 279 1 Kanten berieben 279 1 X 279 1 X 281 1 kugelförmig 328 1 tonnenförmig berieben 328 1 tonnenförmig berieben 362 1 X 372 1 X 372 1 X 428 1 X 440 1 kugelförmig 517 1 kugelförmig, kleine Linsenform 561 1 Kanten berieben 594 1 X 594 1? 637 1 X 733 1 kugelförmig 757 1 X 760 1 X 782 1 Rohling? 798 1 tonnenförmig berieben 901 1 tonnenförmig berieben 901 1 tonnenförmig berieben 901 1 Kanten berieben 901 1 X 901 1 X 901 1 X 901 1 X? 941 1 tonnenförmig berieben 942 1 X 947 1 kugelförmig 947 1 kugelförmig 947 1 tonnenförmig berieben 947 1 tonnenförmig berieben 947 1 X 947 1 X 977 1 tonnenförmig berieben 977 1 einflächig 1028 1 Kanten berieben 1152 1 tonnenförmig berieben 1221 1 unregelmäßig 1256 1 X
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 99
BEF.-NR./ KLOPF- BZW. KLOPFSTEIN REIBESTEIN REIBE- UND PLATTIGE WETZ-, SCHLEIF-, ZEIT- REIBESTEINE KLOPFSPUREN MAHLSTEINE POLIER- UND STELLUNG ANDERE GERÄTE1256 1 X 1256 1 X 1299 1 dreieckig 1310 1 X 1500 1 tonnenförmig berieben 1506 1 Kanten berieben 1506 1 X 1517 1 tonnenförmig berieben 1517 1 X 20035 1 20035 1 1602 (711) 1 kugelförmig 1602 (711) 1 kugelförmig 12 Aunjetitzer Kultur klein, Kanten berieben 271 slawisch Kanten berieben 271 slawisch ? 284 slawisch Kanten berieben 284 slawisch tonnenförmig berieben 606 slawisch Kanten berieben 1214 slawisch ? 51 undatiert Rohling? 158 Plattenfragment 365 durchgebogene Platte 702 Plattenfragment 748 Plattenfragment 1139 Plattenfragment 1299 durchgebogene Platte 1600 Plattenfragment 10015 durchgebogene Platte 1317 gerade Platte 1317 gerade Platte 1317 Läufer 128 undatiert Mahlplatte bzw. Läufer 220 Baalberge 1237 Baalberge 1237 Baalberge 1237 Baalberge durchgebogene Platte 79 Schnurkeramik 877 slawisch Drehmühle 877 slawisch Drehmühle 1214 slawisch Drehmühle 1219 slawisch Drehmühle 1219 slawisch Drehmühle 158 dünne gebogene Reibeplatte158 kleine gedrückte Kugel158 kleine gedrückte Kugel158 klein, eiförmig259 oval, Reibespuren282 Datierung? Polierstein387 Grüngestein, länglich, mit Wetzkanten510 länglicher Polierstein581 oval, bestoßene Kanten795 kleine Kugel1032 Grüngestein, länglich, Wetzstein?
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
100
Fragmente von etwa 11 echten Mahlplatten bzw. Läufern vor. Diese weisen allerdings völlig plane Mahlflächen (gerade oder konkav durchgebogen) auf und es ist unmöglich, dass solche Flächen durch ein »Klopfen« oder – aufgrund der meist kugeligen Form der mit der Hand geführten »Reibesteine« – durch ein Reiben mit kleiner Auflagefläche entstanden sein können (vgl. Hennig 1966, 72). Bei einem derartigen Verfahren entstünden durch die im gleichen Maße wie an den »Reibesteinen« stattfindende Abrasion trogartige Mahlunterlagen (»Mahltröge«; Horst 1982, 34; Seidel 1996, 128 f.), wie sie in Brehna fehlen. Ein trogartig ausgeschliffenes Gerät aus Bef. 1141 ist aufgrund der geringen Größe und der feinkristallinen Struktur kein Mahlstein zum Getreidemahlen, sondern wohl ein Schleifstein.
Aus Brehna liegen mindestens 69 eindeutige jüngstbronze bis früheisenzeitliche kugelige Klopf bzw. Reibesteine vor (Abb. 53, Tab. 4). Nur das Exemplar aus Bef. 1152 ist jungbronzezeitlich. Einige weitere aus slawischen Grubenhäusern könnten aufgrund ihres Aussehens ebenfalls dieser Zeit angehört haben und gelangten wie weiteres eisenzeitliches Fundmaterial mit der Verfüllung in diese Befunde oder wurden durch die slawische Bevölkerung sekundär genutzt. Eine Durchsicht der Geräte zeigte, dass sie sehr unterschiedliche Bearbeitungsspuren aufweisen (Tab. 4).
Keineswegs wurden mit allen Steinen reibende Tätigkeiten ausgeführt. Es kommen mindestens 12 eindeutige Klopfsteine mit Narbenfeldern an den Kanten vor (Abb. 54). 34 Geräte können als Reibesteine angesprochen werden. Auch diese sind sehr unterschiedlich. Neben mindestens
neun Exemplaren, die wie die Klopfsteine vor allem an den Kanten Nutzungsspuren tragen, nur eben facettenartige, gebogene Reibeflächen, kommen auch sehr regelmäßige Stücke vor. Auffällig sind 12 mehr oder weniger gewölbt aussehende Reibesteine, deren Seiten bearbeitet wurden und deren unbearbeitete Pole häufig noch Reste der ehemaligen Oberfläche erkennen lassen, wodurch sich ein ehemals leicht plattiger »Rohling« erschließen lässt (Abb. 55). Die Steine weisen umlaufend flächige beriebene Felder mit wenigen Facetten auf. Sie müssen teilweise durch eine »rollende« Reibebewegung ihre Form bekommen haben, vielleicht indem sie üblicherweise beim Reiben an den Polen festgehalten wurden. Als weitere, besonders auffällige Reibesteinform liegen zehn sehr regelmäßig kugelige, rundum beriebene Exemplare vor (vgl. Abb. 56). Vielleicht entstanden diese aus zuvor tonnenförmig beriebenen Stücken, die so weit abgeschliffen wurden, bis die ehemalige Oberfläche an den Polen verschwunden war. Ca. 17 Geräte wiesen Klopf und Reibespuren auf, wobei die Narben bzw. Reibefelder immer an den Kanten der Gesteine lagen. Zum Teil war eine Unterscheidung zwischen Klopf und Reibespuren nicht sicher zu treffen, da die Reibeflächen an großkristallinen Steinen (groben Graniten) sehr klüftig wirken können. Sehr deutlich liegen Narben und Reibefeld bei einem Exemplar aus Bef. 158 nebeneinander, wobei das Reiben nach dem Klopfen stattgefunden hatte. Zum Teil rühren die Narbenfelder vielleicht von einer ersten groben Zurichtung des aufgefundenen Gerölles her.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit den kugeligen handlichen Steinen unterschied
BEF.-NR./ KLOPF- BZW. KLOPFSTEIN REIBESTEIN REIBE- UND PLATTIGE WETZ-, SCHLEIF-, ZEIT- REIBESTEINE KLOPFSPUREN MAHLSTEINE POLIER- UND STELLUNG ANDERE GERÄTE1141 trogförmige kleine Schleifplatte1166 Wetzstein1213 kleiner kugeliger »Reibestein«
1600 handliches Graugestein mit Stoßkante10019 Schleifstein10019 Schleifstein128 undatiert glatt mit bestoßenen Kanten42 slawisch? 280 slawisch bestoßenes Grüngeröll288 slawisch glattes Geröll mit beschliffener Kante288 slawisch Rohling?293 slawisch Wetzstein869 slawisch 1214 slawisch Wetzstein1218 slawisch Wetzstein, länglich1255 slawisch Wetzstein1255 slawisch Wetzstein?
Tab. 4 Liste der Mahl-, Reib- und Klopfsteine sowie anderer
Steingeräte der gesamten Ausgrabung. Fett: jüngstbronze-
bis früheisenzeitliche Exemplare.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 101
liche Tätigkeiten, d. h. »Reiben« und »Klopfen« im weitesten Sinne, verbunden mit diversen Arten der Handhabung und Führung der Gesteine, z. B. kleinflächiges, unregelmäßiges und andererseits ausgreifendes, »rollendes« Reiben, durchgeführt wurden. Es ist zu vermuten, dass sich hierin nicht nur persönliche Vorlieben in der Handhabung widerspiegeln, sondern verschiedene handwerkliche Tätigkeiten. Zum Mahlen von Getreide sind diese Steine zu leicht und weisen eine zu kleine Reibfläche auf, die jeweils im Kontakt zum Unterlieger steht. Mahlversuche mit solchen Steine führten zu äußerst unbefriedigenden Ergebnissen (Hennig 1966, 78), vor allem vor dem Hintergrund, dass ebene, viel effektivere Schiebemühlen in Brehna bekannt waren und genutzt wurden. Welche Funktion daneben für die kugeligen Geräte in dieser Zeit in Frage kommt, ist nicht sicher zu beantworten. So könnten regelmäßig Gesteine zerkleinert worden sein, wobei »Klopfen« und »Reiben« eine Rolle gespielt haben dürften, um bei der anzunehmenden Menge an benötigtem Magerungsmaterial für die Gefäß und Briquetageherstellung genügend Gesteinssplitt bereitzustellen. Andererseits mussten Schiebemühlen regelmäßig nachgeschärft werden, indem die zu glatt geschliffenen Oberflächen durch Bestoßen mit einem Stein aufgeraut wurden (Hennig 1966, 76; Seidel 1996, 123–125). Kugelige Klopfsteine, daher gelegentlich als »Schärfsteine« bezeichnet, eigneten sich dafür sicherlich sehr gut. Die auffallend ebenmäßig geschliffenen Kugeln aus Brehna wurden dafür jedoch sicher nicht benutzt, möglicherweise jedoch einige der unregelmäßigeren. Dies würde allerdings ihre signifikant hohe Anzahl nicht erklären.
Das Verbreitungsbild der einzelnen Ausprägungen der Reib und Klopfsteine über die Brehnaer
Abb. 57 Plattiger Mahlstein aus Bef. 1299 mit mittig liegendem Narbenfeld mit darauf liegendem »Schärfstein«(?).
Abb. 58 Die jungbronzezeitliche Grube Bef. 365 mit durchgebo-genem Mahlstein im Profil.
Abb. 59 Die jungbronzezeitliche Grube Bef. 365 mit durchge-bogenem Mahlstein und Gefäß-resten in einer holzkohlehaltigen Schicht.
58
59
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
102
Grabungsfläche lässt, wie auch bezüglich der Spinnwirtel und »Backteller«, keine spezialisierten Areale erkennen (vgl. Abb. 151). Wie bemerkt, können die aufgefundenen Mahlplatten nicht die zu den Klopf und Reibesteinen gehörenden Unterlagen gewesen sein. Lediglich in Bef. 1299 kam eine konkav durchgebogene, im Querschnitt aber plane Mahlplatte zusammen mit einem Reibestein vor (Abb. 57). Doch dieses Gerät weicht von den üblichen Reibesteinen ab (daneben ein Stück aus Bef. 799) durch einen eher dreikantigen Querschnitt mit Schliffflächen. Natürlich ist die funktionale Zusammengehörigkeit von Mahl und Reibestein aus diesem Befund nicht nachweisbar. In der Mitte der Reibeplatte fällt jedoch ein kleines Narbenfeld auf, welches Beleg für eine begonnene,
dann aber nicht fortgesetzte »Schärfung« der Platte sein könnte (vgl. Hennig 1966, 76; Seidel 1996, 124 f.), sollte es sich nicht um eine Sekundärnutzung der Platte als Unterlage zum Zerkleinern unbestimmten Materials handeln.
Die zehn Mahlplatten sind, soweit erkennbar, im Falle der großen Exemplare (in Bef. 1317) völlig plan (vgl. Keiling 1962, 413 Abb. 3o3). Die kleineren (Abb. 58, 59; Bef. 365, 1299, 1oo15) sind durch den Abschliff unterschiedlich stark konkav durchgebogen, nicht aber im Querprofil, so dass ein zugehöriger Läuferstein in Breite der Platte angenommen werden muss (vgl. Seidel 1996, 128–136). Mit Sicherheit lässt sich ein Läufer in Bef. 1317 nachweisen, in dem die Bruchstücke der zwei größten Mahlplatten gefunden wurden.
Abb. 60 Kugel- bis eiförmige Steingeräte aus jüngstbronze-
bis früheisenzeitlichen Gruben.
Abb. 61 Birnenförmiges Steingerät mit Schäftungsrille
M ca. 2:3.
Abb. 62 Kleine Polier- und Wetzsteine; M ca. 1:1.
60 61
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 103
Ansonsten liegen überwiegend Plattenfragmente vor. In einigen Fällen war eine genaue Ansprache nicht möglich. Das »fortschrittliche« Prinzip der Schiebemühle war bekannt und wurde genutzt, was wiederum die Frage nach der Funktion der im Vergleich dazu sehr häufigen kugeligen Geräte aufwirft. Während die meisten Reibe und Klopfsteine jüngstbronze bis früheisenzeitlich datieren, sind die durchgebogene Platte aus Bef. 365 und das Fragment einer wohl geraden Platte aus Bef. 1139 noch in die Jungbronzezeit (P IV; Ha A2/B1) zu stellen.
Neben den kugelförmigen Klopf und Reibesteinen kommen kugel bis eiförmige Steine vor, die durch ihre geringe Größe und vergleichsweise glatte Oberfläche auffallen (Abb. 6o; Bef. 158 – drei Stück, Bef. 759, 1213). Solche Kugeln sind bisher nur selten gefunden bzw. veröffentlicht worden. Wieder können Parallelen zu der Siedlung von Zedau gezogen werden, bei der 15 derartige Stücke beschrieben wurden (Horst 1985, 115). Ihre Funktion ist unbekannt.
Ein ei bis birnenförmiges Geröll aus einem hellen Granit weist eine umlaufende, flach eingepickte Schäftungsrille an seinem schmaleren Ende auf (Abb. 61). Es gehört einem bislang nicht
häufig gefundenen Typ (»BarhöftHammelspring«) an, der vor allem in Norddeutschland verbreitet ist (Horst 1982, 51; 6o Abb. 14b.f). Seine Funktion ist unklar.
Einige kleinere Gerölle dienten als Wetzsteine. Es kommen ein sandsteinartiges Gerät mit glatter Seite (Bef. 1166) und zwei längliche, natürliche Flussgerölle aus Grünstein vor (Abb. 62, Mitte und links; Bef. 387, 1o32), welche Wetzkanten aufweisen. Ein handliches, birnenförmiges Geröll mit sehr feiner Matrix aus Bef. 16oo lässt an seinem schmalen Ende eine gewölbte Reibefläche erkennen, die auf eine stößelartige Handhabung schließen lässt.
Das Bruchstück einer kleinen, im Gegensatz zu den Mahlplatten auch quer durchgebogenen, mörserartigen Schleifplatte aus einem fein strukturierten Geröll wurde in Bef. 1144 gefunden (Abb. 63; vgl. Hennig 1966, 77 Abb. 4). Funktional könnten zu ihm rundliche Gerölle mit Schliff bzw. Reibekanten gehört haben, wie sie aus Bef. 128 und Bef. 581 vorliegen. Ähnliche Geräte werden als Feinmahlsteine gedeutet (Seidel 1996, 138 f.).
Zum Polieren und Glätten dienten kleine Gerölle mit sehr glatter, poliert wirkender Oberfläche. Derartige Geräte kamen in dreieckiger
Abb. 63 Schleifplatte aus Bef. 1144 und funktional dazu passender »Stößel« aus Bef. 1600.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
104
Form in Bef. 282 (vgl. Abb. 62 rechts) und in länglicher Form in Bef. 51o zutage. Letzteres weist an den Enden Verfärbungen auf.
Neben den Felsgestein bzw. Geröllgeräten fanden sich in geringem Umfang Feuersteinartefakte. Mehrfach ist nicht zu entscheiden, ob die vorliegenden Feuersteintrümmer bei der gezielten Präparation von Knollen entstanden. In seltenen Fällen liegen eindeutige Artefakte vor, die eine typologische Ansprache ermöglichen. So trat in der Grube Bef. 12o, die über eine Schwanenhals
nadel und weitere Funde nach Ha D datiert werden kann, ein unretuschiertes Klingenfragment auf (Abb. 64). In Bef. 277, der aufgrund des importierten Glasringes nach Ha D zu stellen ist, lag das sekundär gebrannte Bruchstück einer dicken, an der Seitenkante retuschierten Klinge (Abb. 65,4). Im Einzelfall kann aber nicht entschieden werden, ob es sich hierbei um sekundär genutzte neolithische oder um tatsächlich metallzeitliche Geräte handelt (z. B. kamen in Zedau, wo keine neolithische Vorbesiedlung nachgewiesen werden konnte, offensichtlich keine Feuersteinartefakte vor; vgl. Horst 1985, 113).
Kleinfunde aus Metall und Glas
Wie in Siedlungen dieser Zeit üblich, ist die Anzahl an Kleinfunden vergleichsweise gering. Den größten Anteil bilden Reste von Bronzegegenständen, die jedoch meist sehr kleinstückig und korrodiert vorliegen. Am umfangreichsten ist die Gruppe der Ringe (Abb. 66). Kleinere, offene Bronzeringe kamen in zwei Befunden vor. Der teilweise stark korrodierte Ring aus Bef. 59o wurde aus vierkantigem, ca. o,22 cm starkem Draht hergestellt und weist leicht verjüngte Enden auf. Er besitzt einen Durchmesser von 2,5 cm. Aus sehr dünnem (o,o8 cm), im Querschnitt rundem Draht besteht der gut patinierte Ring aus Bef. 15oo (Durchmesser ca. 3,2 cm). Eventuell handelt es sich um das Bruchstück eines Schleifenringes. Das 2,1 cm lange Fragment eines Arm oder Fußringes kam in Bef. 16o1 zutage (vgl. Abb. 66). Er war 1,1 cm breit und besaß einen flach Dförmigen Querschnitt, wobei die Innenseite leicht konkav ist. Aufgrund seiner hellgrünen Edelpatina ist erkennbar, dass der Ring im Bereich des Bruchstückes keine Verzierung aufwies.
Das am besten erhaltene Stück ist eine über 12 cm lange Schwanenhalsnadel aus Bef. 12o (Abb. 67). Sie weist größtenteils eine hellgrüne Edelpatina auf. Das Ende der Nadel ist stumpfwinklig quer zur Halsausbildung abgebogen (»Säbel
Abb. 64 Silex aus Bef. 120; M ca. 3:2.
Abb. 65 Das Inventar der Siedlungsgrube 277. Keramik
M 1:3. Silex, Glas M 1:2.
Abb. 66 Bronzeschmuck-fragmente aus verschiedenen
Siedlungsgruben.
64 65
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 105
schaft«). Besonders markant ist ihr relativ großer Vasenkopf, dessen Mündung schälchenartig vertieft ist. Die Schälchenbildung am Kopf entspricht einer allgemeinen früheisenzeitlichen Vorliebe (Schälchenkopfnadeln). Die stumpfwinklige Umbiegung der Nadelspitze war ebenfalls ein weit verbreitetes Phänomen innerhalb dieser Zeit. Vasenköpfe sind an Schwanenhalsnadeln der Hausurnenkultur dagegen äußerst selten belegt (v. Brunn 1939, 22–24; Wendorff 1981, 167), wobei die wenigen Nachweise (bei Tackenberg 1971, Karte 39; 298 Liste 1o1) ein abweichendes Aussehen besitzen. Auch in den Verbreitungsgebieten der angrenzenden Kulturgruppen sind sie sehr selten. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich ähnliche Nadeln im Verbreitungsgebiet der Göritzer Gruppe an der unteren Oder und Warta (Griesa 1982, 45 und Karte 16) bis in den Berliner Raum (Gandert 1937) hinein finden. Gut vergleichbare Exemplare stammen aus Wartin, Lkr. Uckermark, Hügel m1 (Eggers 1964, Taf. 43,415c) und Reckenzin, Lkr. Prignitz (Bohm 1937, Taf. 29,13). Typologisch ist durch den Vasenkopf der Anschluss an die meist kleinköpfigen Vasenkopfnadeln mit gestrecktem Schaft der Stufe Ha B2/3 gesichert, doch ist die Stellung von Bronzen des Nordens innerhalb der frühen Eisenzeit schwer zu beurteilen. Im Bereich der Göritzer Gruppe werden diese Nadeln allgemein nach Ha C/D1 datiert (Griesa 1982, 45). Eine große Bedeutung erlangt der Fund aus Brehna, da er aus einem Befund stammt, der sowohl Briquetage als auch mehrere typologisch sehr interessante Keramiken erbracht hat, u. a. eine innen glättmusterartig verzierte Schale sowie ein Gefäßfragment der Billendorfer Kultur oder Göritzer Gruppe mit Girlandenmotiv. Für beide Gefäßformen ist eine Datierung nach Ha D bzw. bereits Ha D2 anzunehmen. Damit ist der recht seltene Fall gegeben, dass die Keramik genauere Informationen über die Laufzeit einer Bronzeschmuckform zulässt.
Die Reste einer weiteren Nadel lagen in der Siedlungsgrube Bef. 874. Es sind lediglich Schaftbruchstücke erhalten, so dass keine typologische Einordnung möglich ist.
Aus dem jungbronzezeitlichen Bef. 282 stammen mehrere sehr stark korrodierte Bronzereste. Das größere Stück war ein mittig zusammenge
bogenes, ehemals annähernd kreisrundes Bronzeblech. Es ist aufgrund der Korrosion weitgehend zerfallen. Wahrscheinlich handelte es sich um einen Ösenknopf. Weiterhin lagen in der Grube Reste eines Objektes aus dünnem Draht, erhalten waren noch ca. vier nebeneinander liegende dünne kurze Drahtbruchstücke. Kleine unspezifische Drahtbruchstücke befanden sich in Bef. 282 und 834.
In mindestens vier Siedlungsgruben konnten Eisenfunde geborgen werden. Mehrere plattige Eisenfragmente lagen in Bef. 637. Es ist nicht sicher feststellbar, zu welcher Art von Gerät sie ehemals gehörten. Zwar könnte eine der beiden vorliegenden Spitzen darauf hindeuten, dass es sich um Teile eines Messers handelt, doch kommt noch eine weitere stumpfe Spitze vor, die gleichschenklig dreieckige Gestalt hat und vielleicht eine rhombische Form hatte.
Aus Bef. 889 stammt ein ca. 9 cm langer Eisenpfriem mit scheinbar verbreitertem Kopfteil. Ein in der Werkstatt des LDA angefertigtes Röntgenbild legt nahe, dass es sich bei der Verbreiterung nur um Korrosionsausblühungen handelt. Eisen
Abb. 67 Die bronzene Schwanenhalsnadel mit Vasenkopf aus Bef. 120.
Abb. 68 Der Glasring aus der Grube Bef. 277 weist die typi-sche hellblaue Farbe des frühes-ten Glases auf.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
106
pfrieme sind aus Siedlungen dieser Zeit bisher sehr selten bekannt geworden.
Schaftfragmente von Eisennadeln lagen in den Bef. 563 und 727. Ein nicht näher zu bestimmendes längliches Bruchstück stammt aus Bef. 1o32.
In der Grube Bef. 834 lag auf Planum 1 ein hakenartig umgebogener vierkantiger Schmiedenagel mit typisch kantiger Kopfbildung. Seinem Aussehen nach zu urteilen, handelt es sich nicht um einen früheisenzeitlichen Fund, sondern wahrscheinlich um eine mittelalterlich/frühneuzeitliche Einmischung.
Einen besonderen Fund stellt der Glasring aus dem früheisenzeitlichen Bef. 277 dar (Abb. 65,5 und 68). Er ist leicht oval (3,3 cm x 3,5 cm) und besitzt einen runden Querschnitt von sehr unregelmäßigem Durchmesser (o,4–o,6 cm). Seine Farbe ist hellblau transluzid, eine typische Farbe sehr frühen Glases, wie es seit der jüngeren Bronzezeit gelegentlich nach Mitteldeutschland gelangte. Der Ring wurde aus einem Glasstab zusammengebogen. An der Stelle, wo die Enden verklebt wurden, ist er deutlich verdickt. Solche Ringe sind charakteristisch für den Bereich der frühkeltischen Kultur in BadenWürttemberg und der Schweiz – für die westliche Hallstattkultur (Haevernick 1975, Abb. 1). In der darauf folgenden Zeit waren sie, meist in anderen Farben bzw. mehrfarbig, im gesamten keltischen Milieu verbreitet (Zepezauer 1993, 47; Ruiz 1997, 17 f.). In der Hausurnenkultur sind sie bisher nicht vertreten gewesen. Das Brehnaer Exemplar stellt den bislang
östlichsten Fundpunkt dieses Glasringtypes überhaupt dar und ist mit Sicherheit als Import aus dem Hallstattkreis zu werten. Die zwei Exemplare aus dem zum Hallstattkreis zu zählenden südlichen Thüringen (Steinsburg, Lkr. Hildburghausen, und »im Hennebergischen«; Haevernick 1975) weisen auf den Übermittlungsweg hin. Die Datierung der hellblauen bis türkisfarbenen Ringe ist bisher sehr eng. Während Haevernick (1975, 69) noch der Meinung war, sie kämen ausschließlich in »Ha D III« vor, weisen neuere Funde aus dem Hauptverbreitungsgebiet (Drack 1985, 157 f. und Abb. 33,12; Dietrich 1998, 61 und Taf. 8,B11) sowie Böhmen (Venclová 199o, 57 Typ 162; 239 f.) auf eine Datierung allgemein nach Ha D hin. Dies ergibt eine interessante Aussagemöglichkeit bezüglich der Zeitstellung der Siedlungsgrube und der Laufzeit der gesamten Brehnaer Siedlung, denn anhand der Siedlungskeramik lässt sich im Bereich der Hausurnenkultur nur selten zwischen Ha C und Ha Dzeitlicher Stellung unterscheiden.
Die einfachen Siedlungsgruben
Die statistische Analyse der Formen jüngstbronze bis früheisenzeitlicher Gruben in Brehna wurde bereits durchgeführt (siehe Kap. 2). Im Folgenden sollen einige Auffälligkeiten bezüglich der Grubenverfüllungen vorgestellt werden. Die Verfüllung der Siedlungsgruben war häufig relativ homogen bis zweischichtig. Vergleichsweise selten traten deutlich mehrschichtige Gruben auf.
Abb. 69 Die »hell« verfüllte Grube Bef. 1430 im Planum.
Abb. 70 Die »hell« verfüllte Grube Bef. 384 im Profil.
69 70
71 72
Abb. 71 Die »dunkel« verfüllte Grube Bef. 640 im Planum.
Abb. 72 Die »dunkel« verfüllte Grube Bef. 867 im Profil.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 107
Auf Fläche 3 konnte eine Besonderheit beobachtet werden, die sich schematisiert wie folgt darstellt. Ein großer Teil der Befunde in der Nordhälfte der Grabungsfläche war auffällig hell mit sehr geringem Humusanteil verfüllt (Abb. 69, 7o). Die Farbe dieser Verfüllungen kann mit hell graubraun und hellgrau umschrieben werden. In vielen Fällen war eine homogene Feinschichtung aus hellgrauen und hell graubraunen Bändern bzw. eine Feinfleckigkeit aus Flecken der genannten Färbungen zu beobachten. Die Übergänge von völlig homogen erscheinenden Verfüllungen zu feinschichtigen bzw. feinfleckigen waren fließend und letztlich Ausdruck eines Spektrums innerhalb einer geschlossenen Gruppe von Verfüllungen.
Davon deutlich zu unterscheiden waren mehr oder weniger humos verfüllte Siedlungsgruben (Abb. 71, 72). Diese konzentrierten sich auffällig in der Südhälfte der Fläche 3. Die Farben dieser Verfüllungen wurden als mittelgraubraun, mittel-grau bzw. dunkelgraubraun und dunkelgrau bezeichnet. In einer Reihe von Fällen war eine deutliche Zweischichtigkeit feststellbar, wobei regelhaft die hell graubraune, häufig feinschichtige bzw. feinfleckige Schicht durch eine recht homogene, deutlich humosere Schicht überdeckt wurde. Die obere Schicht war dann meist stark durchhängend und zeigte die Auffüllung einer ehemals teilverfüllten Grube mit muldenförmigem Aussehen an. Gelegentlich war die Beobachtung zu machen, dass die helle Verfüllung im unteren, gut erhaltenen Teil der Grube lag, während die humosere in einer über die unteren Grubenausmaße ausgreifenden, muldenförmigen Erweiterung im oberen Teil lag (Abb. 73). Dieser
Befund kann dahin gehend gedeutet werden, dass in diesen Fällen die Gruben zunächst mit nicht humosem Material verfüllt worden sind, bevor humoser Boden in die entstandene breitere Mulde gelangte.
Letztlich bildet der beobachtete Zustand wohl verschiedene Tätigkeitsbereiche innerhalb der Siedlung ab. Wie das Gesamtbefundbild (Abb. 74) verdeutlicht, liegen die vorrangig humos verfüllten Gruben in den Arealen, die durch Hausgrundrisse
– insbesondere die größeren Sechspfostenbauten – gekennzeichnet sind. Die hell verfüllten Gruben schließen sich nach Norden hin in einem etwa 1oo m breiten Streifen an. Nach Süden hin, in Fläche 2, war dieses Bild nicht so deutlich zu beobachten. Dort überwogen die humos verfüllten Befunde. Wahrscheinlich waren die Funktionsbereiche in dieser Richtung nicht scharf abgegrenzt und die Befunde dort stammen aus einem längeren Besiedlungszeitraum, wie die von der nördlichen Häuserkonzentration abseits liegenden Hausgrundrisse im Süden von Fläche 2 nahe legen.
Herd- bzw. Ofenanlagen
Eine gesonderte Befundklasse stellen die Herd bzw. Ofenanlagen3 dar, die im gesamten jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Areal aufgedeckt werden konnten und in mehrere Typen zu gliedern sind. Neben einzelnen runden, ovalen und quadratischen Öfen sind besonders 62 Befunde von Interesse, die durch ihr »normnahes« Aussehen auffielen. Typisch für sie war ein rechteckiger oder annähernd rechteckiger bis trapezförmiger Grundriss im Planum und eine Kasten oder Muldenform
Abb. 73 Die unten »hell« und oben muldenförmig »dunkel« verfüllte Grube Bef. 154 im Profil.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
108
Abb. 74 Die Verbreitung der »hell« und der »dunkel« verfüllten spätbronze- bis früheisenzeitlichen Gruben im Norden der Grabungsflächen. Auffällig ist die periphere Lage der »hell« verfüllten Gruben.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 109
im Profil (Abb. 75–82). Wie im Planum zu beobachten, wurden die Ecken der Befunde schon bei Anlage der Gruben abgerundet, was durch die häufiger aufgetretenen verziegelten »runden« Ecken belegt ist. Bei allen war eine mehr oder weniger starke Steinpackung zu beobachten. Mehrheitlich war diese einlagig und auffällig mit Holzkohle durchsetzt, wobei die Steingrößen stark schwanken konnten (Abb. 79, 81, 82). Unter der Lage aus Steinen war in einigen besser erhaltenen Fällen ein schwärzliches Band aus Holzkohle, Asche und Lehm zu beobachten (vgl. Abb. 79–82). Die aus den Anlagen geborgenen Steine zeigten starke Hitzeeinwirkung und waren z. T. scharfkantig zerbrochen, Anpassungen zwischen den Steinen einzelner Ofengruben waren in Einzelfällen möglich. Die Verfüllungen wiesen neben den hitzezersprungenen Steinen und einzelnen Feldsteinen in der Regel keine Artefakte auf. Oberhalb dieser Steinpackung bestand die Verfüllung meist aus humosem Lehm, der erst nach der Primärnutzung eingebracht wurde (Abb. 75, 84). Dieser enthielt vereinzelte Keramikfragmente sowie noch seltener kleinste Bruchstücke von Säulen und Briquetagetiegeln. Neben den Briquetagefunden weisen die geborgenen Scherben in allen datierbaren Fällen auf ein früheisenzeit liches Alter hin.
Bei 22 (35,48 %) der Ofenanlagen zeigten sich deutliche Verziegelungsspuren des anstehenden Lehmes im Wandungsbereich, so dass mit einer großen bis sehr großen Feuereinwirkung innerhalb der Gruben zu rechnen ist4. Auffällig war, dass 5o (8o,64 % von gesamt) Befunde einen annähernd rechteckigen Grundriss besaßen, sieben waren etwa oval, drei unregelmäßig und zwei weitere hatten eine längliche Form im Planum. Im Profil zeigten 34 Anlagen eine Muldenform, 19 ein kastenförmiges Profil, vier waren wannenförmig, weitere vier besaßen eine unregelmäßige Form und in einem Fall war eine leichte Trichterform zu beobachten.
Die Maße der Ofenanlagen im Planum lagen bei einer durchschnittlichen Länge von 1,42 m mit einer mittleren Breite von 1,o1 m und wiesen eine relativ geringe Varianz auf (Länge 17,41 % und Breite 14,91 %). Die mittlere Tiefe lag bei o,2o m und variierte stärker (49,35 %), was sich aus dem stark unterschiedlichen Erhaltungszustand erklärt.
Schon bei der Dokumentation der Ofengruben waren Hauptausrichtungen erkennbar (Abb. 76, 77). Mit 28 Anlagen stellen die WestOst ausgerichteten die größte Gruppe, gefolgt von den SüdwestNordost ausgerichteten mit 22 Exemplaren. Weit dahinter bewegten sich die Gruppe der NordSüd ausgerichteten Anlagen mit acht Öfen und die der NordwestSüdost ausgerichteten mit nur vier Beispielen.
Vergleicht man die Befundmaße der unterschiedlich ausgerichteten Gruppen, so stellt sich
heraus, dass NordSüd ausgerichtete Anlagen im Grundriss wie in der Tiefe die größten Werte erreichten. Die mittlere Länge betrug 1,56 m/Median 1,55 m, die durchschnittliche Breite 1,12 m/Median 1,o9 m und das Tiefenmittel o,29 m/Median o,34 m.
Mit einer durchschnittlichen Länge von 1,42 m/Median 1,465 m, einem Breitenmittel von 1,o2 m/Median 1,o4 m und einer mittleren Tiefe von o,21 m/Median o,19 m lagen die WestOst ausgerichteten Ofengruben in ihren Maßen etwas darunter, wenig größer als die SüdwestNordost ausgerichteten Anlagen. Diese wiesen eine mittlere Länge von 1,4o m/Median 1,4o m, ein Breitenmittel von o,99 m/Median o,98 m und eine durchschnittliche Tiefe von o,17 m/Median o,18 m auf. Nicht nur der Anzahl nach, sondern auch in ihren Maßen treten die NordwestSüdost orientierten Erdöfen hinter den anderen zurück. Sie erreichten eine durchschnittliche Länge von 1,21 m/Median 1,19 m, eine mittlere Breite von o,885 m/Median o,825 m und ein Tiefenmittel von o,12 m/Median o,11 m.
Abb. 75 Viele der Ofenanlagen waren nur flach unter dem Pflug-horizont erhalten und wiesen keine erkennbaren Verziege-lungsspuren auf.
Abb. 76 Ausrichtung und Vertei-lung der 62 gut beurteilbaren Herdanlagen.
N-S-Ausrichtung
W-O-Ausrichtung
SW-NO-Ausrichtung
NW-SO-Ausrichtung
Chronologische Verteilung der Ofenanlagen (n = 62)
35,48%(22)
45,16%(28)
12,90%(8)
6,45%(4)
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
110
Zeichneten sich innerhalb der Maße der Orientierungsgruppen auch Unterschiede ab, so kann kein Rückschluss auf eine unterschiedliche technische Nutzung gezogen werden, da sich die Einzelmaße überschneiden. Da bei allen vier Gruppen, wenn auch der Anzahl nach verschieden, eine Wandung aus angeziegeltem, anstehendem Lehm5 beobachtet werden konnte (Abb. 78–82), kann dieses Merkmal als Ausdruck einer einheitlichen Nutzung dieser Anlagen angesehen werden. In seltenen Fällen war eine leichte Verziegelung der Sohle zu beobachten.
Bei der Kartierung der Ofenanlagen ist festzustellen, dass sich diese im gesamten Bereich der jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Siedlung (zumindest im untersuchten randlichen Areal) befanden, bei der Verteilung der Orientierungsgruppen ist keine Regelhaftigkeit erkennbar (Abb. 83). Selbst innerhalb der stärkeren Konzentration dieser Erdöfen im östlichen Bereich der Fläche 3 (vgl. Abb. 77) wiesen die Anlagen unterschiedliche Orientierungen auf. Bemerkenswert war, dass wohl kein Exemplar der jungbronzezeitlichen Besiedlungsphase angehörte.
Da sich gerade im östlichen Bereich der Fläche 3 verstärkt Fragmente von Säulenbriquetage und Briquetagetiegeln aus dem Inventar der umgebenden Siedlungsgruben aussortieren ließen, lag die Vermutung nahe, die Öfen wären zur Salzproduktion (Siederei oder Trocknung) genutzt worden (vgl. Pfeifer 2oo7, 41). Dies schien sich zunächst zu bestätigen, da im Bereich des gehäuften Auftretens von Briquetagesäulen und tiegeln die Mehrheit der Ofenanlagen aufgedeckt und aus ihrer oberen Verfüllung vereinzelt Briquetagebruchstücke geborgen werden konnten. Als weiteres Indiz für eine Interpretation als Salzsiedeofen konnte ein auf den ersten Blick ähnlicher Befund aus LöbnitzBennewitz, Lkr. Leipzig (Preier 1999; Stäuble 1999, 165 f. u. Abb. 7), gelten, der in dieser Weise interpretiert wurde. Nach der jüngsten, detaillierten Vorstellung (Pfeifer 2oo7) handelte sich um eine rechteckige, im Planum 2 etwa 3,15 m x 1,2 m große und ca. o,2o m tiefe Grube, die an drei Seiten eine angeziegelte Wandung aufwies und ein trapezförmiges Querprofil zeigte. Die Wände verengten sich nach oben im Winkel von ca. 1o5°. Die Grubensohle war nicht
Abb. 77 Die Erdofengruppe im Ostteil der Fläche 3 mit sechs Ost-West und zwei Nord-Süd
ausgerichteten, relativ gut erhaltenen Befunden.
N
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 111
verziegelt. Im Inneren der Grube war eine große Anzahl von Säulenbriquetagefragmenten zu beobachten, die jedoch eindeutig als Einfüllung erkannt worden sind. Daneben stammen Fragmente von Briquetagetiegeln, Sandsteine ohne erkennbare Feuereinwirkung und wenige Keramikscherben aus diesem Befund. Das Keramikinventar konnte in die Späthallstatt/Frühlatènezeit eingeordnet werden. Die Anlage von LöbnitzBennewitz hebt sich neben ihrer Größe von den Brehnaer Erdöfen insofern ab, als dass auf der Sohle fast keine Steine zu beobachten waren und sich die Briquetagefragmente oberhalb der Sohle unter einer weiteren Füllschicht befanden. Die Wandung zog nach oben ein. Die in Brehna funktionsbedingt regelhaft vorkommenden gesprungenen Steine waren in LöbnitzBennewitz nicht nachweisbar. Somit ist dieser Befund nicht für die Deutung der Brehnaer Öfen heranzuziehen.
Die Briquetagefunde der Brehnaer Grabung konzentrierten sich vornehmlich im Norden der Grabungsflächen. In diesen Bereichen konnte eine Überschneidung von Ofenanlagen und Briquetagefunden festgestellt werden. Diese Deckung kann jedoch auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass dies der Bereich mit den Hausgrundrissen der Gehöfte A und B und damit das erwartete Areal hauswirtschaftlicher und handwerklicher Tätigkeiten war. Außerhalb dieses engeren Bereiches, wo dagegen Briquetagefunde kaum noch vorkamen, wurde eine etwas kleinere Konzentration von Erdöfen im mittleren Bereich der Fläche 2, in östlicher Randlage festgestellt. Ebenso war auffällig, dass Ofenanlagen auch die Bereiche besetzten, in denen keine Briquetagefunde auftraten.
Selbst über die Funde einzelner Briquetagestücke innerhalb der rechteckigen Öfen kann kein sicherer Zusammenhang mit der Salzproduktion hergestellt werden, da in viel größerem Maße auch Fragmente von Gefäßen zum Inventar gehörten und eine Ansprache als Keramikbrennofen ebenso abwegig erscheint. Die Briquetage gelangte mit dem üblichen Hausmüll ausschließlich in die obere Grubenverfüllung, wie dies auch in den Siedlungsgruben geschah.
Für das Aussieden von Salz ist eine kontinuierliche Befeuerung notwendig, um die Sole einzudampfen oder zumindest den Salzbrei trocknen zu können. Da an keinem der Öfen Schüröffnungen beobachtet werden konnten (außer bei dem auch in anderen Details abweichenden Ofen Bef. 1137) und diese eingegraben waren, erscheint eine durchgehende Befeuerung äußerst kompliziert. Bei einem kontinuierlichen Feuerungsprozess wäre mit einer Brennmaterialversorgung über einen »längeren« Zeitraum zu rechnen, der über ein Schürloch zu bewerkstelligen wäre. Eine derartige Öffnung konnte aber bei keinem dieser Öfen beobachtet werden. Weiterhin wäre eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung notwendig,
die bei einer Abdeckung des Brennraumes mittels Briquetagetiegeln nicht vorstellbar scheint. Auch das Einleiten von in einem separaten, nicht nachweisbaren Ofenbereich erhitzten Brenngasen nach unten in eine rundum geschlossene Erdgrube ist schwer vorstellbar (wie bei Preier 1999, 136), zumal das durchgeführte Experiment (s. u.) zeigte, dass eine starke Verziegelung nur durch sehr hohe Temperaturen zu erreichen ist. Auch das Aufstellen der Briquetagesäulen auf der beobachteten Steinlage und das Aufsetzen der mit Sole oder Salzbrei gefüllten Tiegel ist technisch nicht sinnvoll, da diese fragile Konstruktion eine weitere Befeuerung nicht ermöglichen würde. Die Tatsache, dass sich in der Verfüllung kein gebrannter Lehm fand, der mit gewisser Wahrscheinlichkeit als Kuppelbruchstück angesprochen werden könnte, spricht gegen eine spezielle oberirdische Ofenkonstruktion dieser Gruben (Abb. 84).
Abb. 78 Früheisenzeitlicher Erdofen Bef. 977 mit Steinen auf der Sohle.
Abb. 79 Der angeziegelte, anstehende Lehm um die Grube Bef. 977, freigelegt als Ofenwandung.
78
79
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
112
Zweifelsfrei belegt die regelhaft festgestellte Wandung aus angeziegeltem, anstehendem Lehm eine Nutzung der Grube als Brennraum (vgl. Abb. 78 und 79). Die unterhalb der Steinlage beobachtete, stark mit Asche und Holzkohle durchmischte Schicht spricht dafür, dass ein Feuer in der Grube angefacht wurde, im dem später die Steine erhitzt wurden (Abb. 78–82; vgl. nachfolgend das Brennexperiment). Indiz dafür ist, dass an allen Steinen Brandspuren zu finden waren und ein Großteil durch die Hitze zersprungen war. Fasst man diese Beobachtungen zusammen, kann mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Steine als Wärmespeicher dienten6. Merkwürdig ist, dass die Steine in der Regel in den Gruben verblieben.
Archäologische Parallelen fanden sich in unmittelbarer Nähe zu den Befunden der Grabungsflächen. Es handelt sich einerseits um zwei völlig übereinstimmende Befunde, die östlich der Ortslage Brehna in etwa 3 km Entfernung festgestellt werden konnten7, und weiterhin 17 batterieartig angeordnete, ebenfalls gleiche Befunde aus dem nur ca. 13 km entfernten Löberitz, Lkr. AnhaltBitterfeld (Planabschnitt 1o7; Clasen 2oo4, 58 Abb. 3). Leider geben diese Nachweise keine weiteren Indizien zur Klärung, da auch aus ihnen kein Fundmaterial außer den Steinen geborgen werden konnte. Immerhin bestätigen sie den in Brehna aufgestellten »Funktionstyp«.
Weiter führt ein überregionaler Vergleich. Recht nahe liegende Beispiele bot ein Fundplatz in Maxdorf in der Altmark (Bock 2oo2, 434). Die Herdstellen wurden in die Jastorfkultur gestellt. Völlig entsprechende Erdöfen kamen bei Kolkhagen, Lkr. Lüneburg (Gebers 2oo4, 3o Abb. 17 und 18), und HamburgPoppenbüttel (Hüser 2oo8, 42) zutage. Sie waren jeweils in Reihe angeordnet. Als Deutung wird eine Nutzung als Gargruben erwogen. Ein einzelner derartiger Befund aus Waltersdorf, Lkr. DahmeSpreewald, wurde in das 4.–2. Jh. v. Chr. datiert (Brumlich/Meyer 2oo4, 175–178; 194 Abb.2o–22; 196 Abb. 25). Die detaillierte Befund beschreibung belegt die Vergleichbarkeit auch in Einzelheiten wie der Verziegelung der Wandung bei fehlender Verziegelung der Sohle, den fehlenden Kuppelteilen und der Holzkohle/Steinschicht. Der Befund wurde als Steinröstofen – zur Herstellung von Granitgrus – interpretiert. Dies ist bei der Menge der in Brehna in den Öfen verbliebenen Steine unwahrscheinlich. Auch im Waltersdorfer Befund wurden noch viele
Abb. 80 Die meist angetroffene homogene humose Verfüllung über der Steinlage im Profil (Bef. 978).
Abb. 81 Deutlich sind die im Gegensatz zur Ofensohle verziegelten Lehmwände bei Bef. 1046 zu erkennen.
Abb. 82 Bei Bef. 978 ist zu beobachten, dass die Wandung in dieser Tiefe rundum keine Öffnung besaß.
80
81
82
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 113
Steine nachgewiesen. Ein sehr großer, ansonsten ähn licher Ofen wurde bei Pratzschwitz in der Dres dner Elbtalweitung untersucht (Brestrich 2ooo, 86 f.). Er enthielt auch stark sekundär
gebrannte Scherben. Als weitere Parallelen sind wahrscheinlich ein bis zweilagige rechteckige Steinpackungen gleicher Größe aus Libehna, Lkr. AnhaltBitterfeld, anzusehen, die zwar Verziege
Abb. 83 Verbreitung der spät-bronze- bis früheisenzeitlichen Erdöfen. Im Vergleich dazu wurde die Verbreitung der Bri-quetage kartiert.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
114
lungsspuren vermissen lassen, jedoch aus erhitzten Steinen bestanden (Jarecki 2oo7, 331 Abb. 2).
Den hier behandelten ganz ähnliche, als eisenzeitliche »Feuergruben« angesprochene Befunde wurden von Hienheim, Lkr. Kelheim, vorgestellt (Modderman 1983, 7 ff.). Modderman nennt 47 rechteckige, an den Ecken abgerundete Gruben, die in ihrem Aufbau denen aus Brehna im Prinzip gleichen. Die Längsmaße schwankten zwischen 1,1o und 1,8o m und die Breite zwischen o,8o und 1,6o m. Auch hier konnten eine Verziegelung des umgebenden Anstehenden und eine einlagige Steinpackung beobachtet werden. Anders als in Brehna lagen hier die »Feuergruben« (mehrheitlich mit ihrer Längsachse) in insgesamt neun Reihen, die NordwestSüdost, NordSüd und WestOst orientiert sein konnten. Bei der Deutung der Befunde vermutet Modderman einen »kultischen« Hintergrund und sieht diese im Zusammenhang mit der Totenverbrennung, was zumindest für die Brehnaer Befunde auszuschließen ist. Zwar ist das Aussagepotenzial der Anlagen aus Hienheim nicht größer als jenes der Brehnaer Befunde, doch ist von großer Bedeutung, dass die Hienheimer »Feuergruben« wie auch die entsprechenden norddeutschen Belege in keinem Zusammenhang mit Salzsiederei stehen können und somit eindeutig einer anderweitigen Nutzung unterlagen. Weit häufiger konnten fundarme rechteckige bis runde, eingetiefte Grubenherde mit hitzezermürbten Steinen in Norddeutschland und Südskandinavien auf jungbronzezeitlichen bis früheisenzeitlichen Siedlungsplätzen beobachtet werden. Diese Befunde sind oft in langen Reihen angelegt und werden als Hinterlassenschaften von kultischen Handlungen gedeutet. Ein derartiges Bild boten über zwanzig solcher Gruben, hintereinander liegend und in mindestens drei Reihen angeordnet, aus dem Bereich der Hausurnenkultur bei Egeln, Salzlandkreis. Auch bei ihnen wurde ein kultischer Hintergrund angenommen (Pacak 2oo3). Inwieweit diese Befunde dem Brehnaer
Grubentyp gleichen, ist derzeit noch ungewiss. Interessant ist jedoch die Verbindung zu den genannten süddeutschen Reihen und zu jenen aus dem Niederelbegebiet. Ihre Anordnung kann daher offensichtlich nicht als ausschlaggebendes Kriterium für die Deutung der Gruben herangezogen werden. So wird beispielsweise auch die reihen bzw. batterieartige Anordnung von Rennöfen zur Eisenverhüttung nicht in einen kultischen Zusammenhang gestellt. Damit soll der offensichtlich kultische Charakter von Anlagen wie in Zedau (Horst 1985) nicht in Abrede gestellt werden. Wichtig für die Deutung ist unserer Ansicht nach das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Steinpackung mit Hitzespuren, da diese nicht anders als ein Wärmespeicher gedeutet werden kann und damit einen technischen Hintergrund haben dürfte. Auch unregelmäßig angeordnete Gruben mit Steinen und Feuerspuren finden sich häufig in Nordeuropa. Sie wurden anhand eines Siedlungsplatzes bei Jürgenshagen, Lkr. Güstrow, systematisiert. Lütjens stellt verschiedene Typen langgestreckter Steingruben vor, deren »kurze« lang gestreckte Variante den eingetieften Ofengruben Brehnas entspricht (Lütjens 2ooo). Ähnlich wie in Brehna weisen diese Gruben eine Lage aus hitzezermürbten Steinen auf, die sich mehrheitlich auf der Sohle befand. Zwischen und unter diesen Steinen war eine starke Konzentration von Holzkohle und Holzkohlepartikeln festzustellen und nur in wenigen Fällen – wohl aufgrund der sandigen Böden – war eine Verziegelung nachzuweisen. Wie bei den Befunden aus Brehna konnten hier keine Reihungen beobachtet werden und die Orientierung der Einzelbefunde schwankte, wenn auch eine Bevorzugung der NordSüdAusrichtung auffiel. Daneben war eine relative Fundarmut dieser Befundgruppe festzustellen, was den Verhältnissen in Brehna entspricht. Für die in Jürgenshagen aufgedeckten Steinbefunde entwirft Lütjens verschiedene Funktionsvarianten (Lütjens 2ooo, 32 ff.; vgl. auch Schmidt 2oo5). Eine Nutzung als Kochgrube, Getreidedarre oder Feuerstelle macht der Autor eher für die kleineren Varianten der Steingruben wahrscheinlich, wohingegen den langgestreckten Gruben nicht sicher eine Funktion zuzuweisen war.
Wie oben festgestellt, treten »Feuer oder Steingruben« als Befundgruppen in Süddeutschland wie in Norddeutschland und im südlichen Skandinavien auf und sind zumindest in diesen Regionen nicht im Zusammenhang mit Salzsiederei zu sehen. Für die Anlagen aus Brehna dürfte eine Interpretation als Erdöfen oder Gargruben (vgl. Gebers 2oo4, 3o) am wahrscheinlichsten sein. Diese sind als mit Blättern oder Steinen ausgelegte und mit Erde, Strauchwerk und Blättern zugedeckte Erdgruben definiert, in welchen zwischen heißen Steinen pflanzliche und tierische Nah
Abb. 84 Scharfe Trennung der funktionsbedingten holzkohle-
und steinhaltigen unteren Schicht von der darüber liegen-
den Verfüllung bei der Herdgrube Bef. 625.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 115
rungsmittel gedämpft werden (Hirschberg 1988, 124). Das Erhitzen der Steine kann innerhalb der Grube, wie in Brehna, oder außerhalb erfolgen. Die Anpassungen einzelner hitzezersprungener Steine aus verschiedenen Gruben kann als Mehrfachnutzung der Steine bzw. als Parallelnutzung zweier oder mehrerer Anlagen interpretiert werden. Ob die Gargruben einmalig oder mehrfach genutzt wurden, konnte für die aufgedeckten Anlagen nicht sicher beantwortet werden. Die dokumentierten Verziegelungsspuren können bereits bei einmaliger Nutzung entstanden sein, wie durch das unten beschriebene Experiment zu belegen war. Für die wenigen Befunde mit stärker verziegelten Wänden und mit Verziegelungsspuren auch auf der Grubensohle (Bef. 941, 1o46, 1138), die auf ein insgesamt mehrstündiges Befeuern hindeuten, ist eine (nicht zu häufige) Mehrfachnutzung nicht auszuschließen.
Ein experimenteller Brennversuch in einer Ofengrube
Um Aussagen zum Phänomen der Ofengruben zu erlangen, wurde am 25. o8. 2oo4 ein experimenteller Brennversuch durchgeführt. Die Ofengruben waren immer rechteckig oder trapezförmig mit abgerundeten Ecken bis oval. Die archäologischen Befunde belegen durch ihre meist nur seitlichen Verziegelungsspuren, dass in den Gruben Feuer gebrannt haben müssen. In sehr wenigen Fällen waren am Boden kleinere Bereiche verziegelt. Außerdem lagen in diesen Befunden, sofern sie besser erhalten waren, ein bis maximal zweilagig hitzezersprungene Steine auf bzw. in einer holzkohlehaltigen Schicht. Das regelhafte Vorkommen der Erdöfen und ihr fast standardisiert wirkendes Erscheinungsbild deuten darauf hin, dass sie eine Rolle in einem wiederkehrenden, vielleicht technischen Prozess spielten. In Brehna wäre beispielsweise an die Salzproduktion zu denken, obwohl sich in den Befunden keinerlei Hinweise auf eine derartige Verbindung fanden. Die wenigen Briquetageteilchen aus derartigen Ofengruben lagen immer oberhalb der Steinlage in der normalen, nach der Nutzungszeit der Anlage eingeflossenen Verfüllung, wie erwartungsgemäß gelegentlich einige Scherben. Die Befunde machten fast durchgängig den Eindruck einer nur einmaligen Befeuerung, da sich sonst nicht erklären ließe, warum die Steine, die bei mehrmaliger Nutzung zwischenzeitlich immer entnommen worden sein müssten, um ein Feuer darunter entfachen zu können, am Ende des jeweils letzten Prozesses in den Befunden verblieben.
Der Brennversuch verfolgte im Wesentlichen zwei Ziele. Erstes Ziel war es, in demselben anstehenden Boden zu testen, in welcher Zeit eine Verziegelung der Seitenwände erreicht wird, die jener der Befunde in etwa entspricht. Möglich
schien eine Aussage darüber, ob sich die beobachteten Verziegelungen bereits bei einer einmaligen Befeuerung einstellen oder ob die Ofengruben mehrfach genutzt worden sein können. Zweites Ziel war es zu klären, ob durch ein Grubenfeuer eine Hitze erreicht wird, in der hineingeworfene Gesteine zerspringen.
Als Ofengrube für das Experiment wurde eine Profilgrube in Fläche 2 gewählt und entsprechend erweitert, in deren direkter Nähe ein derartiger archäologischer Befund gelegen hatte. Die Grube (Abb. 85) hatte Ausmaße von ca. 1,5 m x o,7 m bei einer Tiefe von ca. o,5 m. Als Brennmaterial war zunächst natürlich gewachsenes Stamm und Astholz von Nadelbäumen gesammelt worden. Da dies nicht ausreichte, wurde in größeren Mengen altes, gut abgelagertes Bauholz (Bretter und Balken) verwendet, welches beim Abriss von Stall
Abb. 85 Die vorbereitete Herd-grube im Bereich der ausgegra-benen Erdöfen auf Fläche 2.
Abb. 86 Befeuern der Herdgrube mit Holz.
85
86
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
116
gebäuden der benachbarten Agrargenossenschaft angefallen war (Abb. 86).
Nach dem Entzünden des Feuers wurde es stark mit Hölzern beschickt, so dass ein deutlich über die Grube herausschlagendes Feuer entstand (Abb. 86–89), welches ca. eine Stunde gehalten wurde. Dabei entstand eine den Boden vollständig bedeckende AscheGlutSchicht. Danach wurden in der Umgebung gesammelte Gerölle (bis ca. 25 cm Kantenlänge), die aus den anstehenden eiszeitlichen Geschieben stammen, auf die Glut
87 89
88
Abb. 87 Einfüllen von natürlich vorkommenden Geröllen.
Abb. 88 Weiteres Befeuern der mit Steinen ausgelegten Grube.
Abb. 89 Im Inneren wurde eine sehr große Hitze erreicht.
Abb. 90 Die letzten Hölzer beim Herunterbrennen.
Abb. 91 Die Herdgrube nach dem Herunterbrennen.
Abb. 92 Auf die erhitzten Steine wurde Gargut gelegt.
90
91 92
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 117
bzw. auf die noch brennenden Balken geworfen (Abb. 87). Es wurde darauf geachtet, dass die Sauerstoffzufuhr weiterhin gewährleistet war. Über den Steinen wurde anschließend weiter befeuert. Schon nach ca. 45 Minuten zerplatzten die ersten größeren Exemplare. Aufgrund der großen Hitze und der Holzüberdeckung war dies nicht genauer zu beobachten. Ebenso war nicht festzustellen, ab wann die Seitenwände verziegelten. Grund dafür war einerseits die Hitze, die ein dichtes Herangehen an die Grube verhinderte, und andererseits die Lichtwirkung des Feuers, die die Grubenwände von Beginn an in einem rötlichen Farbton erscheinen ließ. Bereits nach ca. drei Stunden war zu erkennen, dass die Seitenwände einen bräunlichen Farbton angenommen hatten. In der Annahme, es handele sich bei dem Braunton noch nicht um die erwartete Verziegelung, wurde weiter befeuert. Dabei wurden weitere Steine eingeworfen. Nach ca. fünf Stunden ließen wir das noch vorhandene Holz herunterbrennen
(Abb. 9o). Auf die fast durchweg zersprungenen Steine wurden in Ermangelung größerer Fleischstücke und Gemüsemengen wenige Kartoffeln und in Kohlblätter eingewickelte verschiedene Ge müsesorten gepackt (Abb. 91, 92). Danach wurde die Grube mit Erde bedeckt (Abb. 93).
Die Öffnung am nächsten Tag (26. o7. 2oo4) ergab folgendes Bild: Bei Entfernen der Verfüllung stieg bereits Dampf auf, der von der immer noch vorhandenen großen Hitze zeugte. Die oberen Steine waren handwarm, die darunter liegenden dagegen noch so heiß, dass ein Anfassen nicht möglich war. Das Gemüse war übergar, Kartoffeln und Kohlrabi matschig, die eingewickelten Möhren waren entwässert, quasi mumifiziert (Abb. 94, 95). Auf der Sohle der Grube lag die Holzkohle, die teilweise noch Glut enthielt. Nachdem die Grube vollständig freigelegt war, konnten die Verziegelungsspuren untersucht werden. Es zeigte sich, dass die bereits nach drei Stunden Befeuerung erkennbar gewesene Brauntönung lediglich oberflächlich eine rotorangefarbene Verziegelung des darunter liegenden Lehms verdeckte (Abb. 96, 97). Eine Verziegelung war spätestens nach dieser Zeit bereits vorhanden. Die Seitenwände waren deutlich stärker verziegelt als in den meisten archäologischen Befunden nachgewiesen. Trotzdem wies die Sohle der Grube nur in kleinen Bereichen, vor allem in Richtung der Seitenwände, eine Verziegelung auf. Diese war deutlich schwächer als jene der Seitenwände.
Als Ergebnis ist zu konstatieren, dass das Experiment die Annahme einer meist wohl nur einmaligen Nutzung der Ofengruben unterstreicht.
Abb. 93 Das Verschließen der Grube.
Abb. 94 Die Grube nach dem Öffnen.
Abb. 95 Das übermäßig stark gegarte Gemüse.
Abb. 96 Deutliche Verziegelung an den Grubenwänden.
Abb. 97 Das adäquat den archäologischen Befunden zersprungene Gestein.93
95
97
94
96
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
118
Nur bei wenigen der ausgegrabenen Befunde erreichte die Verziegelung einen Grad, wie er bei dem Experiment beobachtet werden konnte, und der auf ein längeres einmaliges oder ein mehrfaches kürzeres Befeuern hinweisen könnte. Der Grad der Verziegelung in den Befunden kann bereits nach zwei bis drei Stunden mit einem intensiven Feuer erreicht werden, wie es auch nötig ist, um die Steine so zu erhitzen, dass sie zerspringen (vgl. Abb. 97). Abweichend von den Befunden lagen die zersprungenen Steine noch weitgehend zusammen, meist waren sie nur von Rissen überzogen, während sie in den Ofengruben verteilt lagen. Entweder wurden sie dort bei der Entnahme des Siede bzw. Gargutes vermischt (z. B. beim abschließenden Durchsuchen nach kleinerem Gargut) oder sie sind vor dem Befüllen verteilt worden. Bei letzterer Annahme wäre es möglich, dass Steine zusätzlich in außen liegenden Feuern erhitzt und vor dem Befüllen hinzugefügt wurden, wie dies ethnographisch belegt ist (Dittmann 199o). Denkbar ist abschließend die gezielte Entnahme von zermürbten Steinen als Magerungsmaterial für Gefäßkeramik bzw. Briquetage als willkommene Nebennutzung der Ofengruben.
In welchem Rahmen diese Erdöfen zum Garen genutzt wurden, bleibt natürlich spekulativ. Der relativ große Aufwand, der für ihr Funktionieren nötig ist, lässt erahnen, dass Nahrungsmittel, die eine längere Zeit eine große Hitze zum Garen benötigen, wie etwa größere Fleischmengen bzw. ganze Tiere, in ihnen zubereitet wurden. Da sie in vielen zeitgleichen Siedlungen nicht vorzukommen scheinen, ist es möglich, dass sie nicht der alltäglichen Nahrungsmittelzubereitung dienten (Schmidt 2oo5, 76). Für die nachgewiesene, meh
rere hundert Jahre andauernde Besiedlung auf der ausgegrabenen Fläche sind die sechzig derartigen Öfen selbst bei jeweils mehrmaliger Nutzung und der Einbeziehung weiterer, nicht mehr erhaltener oder außerhalb der Grabungsfläche liegender Befunde sehr wenige und weisen auf einen höchstens jährlichen Neubau hin. Andererseits konnte keine Überlagerung zweier solcher Befunde oder eine vertikalstratigraphische Position zu einer verfüllten Siedlungsgrube beobachtet werden, so dass andererseits angenommen werden kann, dass diese Befunde aus einer oder mehreren kürzeren Zeitspannen stammen.
Weitere Herd- und Ofenbefunde
Im Folgenden werden verschiedenste weitere in Brehna dokumentierte Ofenanlagen detailliert vorgestellt, da bei einer Siedlung, die in vorhandenem Umfang Briquetage geliefert hat, die Frage nach den Siedeöfen im Raume steht und aufgrund der vorhandenen Hausgrundrisse von einer insgesamt guten Befunderhaltung ausgegangen werden kann.
Ein rechteckiger Ofen
Ein auf Fläche 3 liegender Befund ähnelte den annähernd rechteckigen Herdgruben in Größe und Form zunächst und fiel lediglich durch seine NordSüdAusrichtung auf (Abb. 98). Im Planum 2 war er kaum erkennbar, so dass dort zu Beginn Befundnummern für vermeintlich zwei kaum abgrenzbare »Gruben« (Bef. 1137 und 1138) vergeben wurden. Erst nach dem Profilschnitt wurde der Befund als Ofen erkannt und entsprechend
Abb. 98 Der Ofen Bef. 1137/1138, nördlich davon
der runde Ofen Bef. 1123.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 119
ausgegraben. Er war deutlich tiefer als die anderen Ofengruben und wich auch in anderen Details von diesen ab. So war seine Wandung stärker verziegelt als bei der Mehrzahl der ähnlichen Befunde, auch die Sohle wies rötliche Verfärbungen auf. Innerhalb des Befundes lagen im Norden viele zersprungene Steine als haufenartige Konzentration, die vermutlich durchweg von einem einzigen größeren Gestein stammten. Sie befanden sich deutlich getrennt im Norden (Abb. 98, 99). Im Süden machte der Ofen den Eindruck, als wäre er ausgeräumt. Im Profil (Abb. 99) ist erkennbar, dass die Steine auf einem scharf abgegrenzten Holzkohleband lagen. Eine grubenartige Verfärbung an der südlichen Schmalseite sowie die dort fehlende Verziegelung weisen auf eine mögliche, dort liegende Ofenöffnung hin.
Bemerkenswert waren Details an den verziegelten Wandungen des Befundes, vor allem in dessen Nordostecke. Dort waren eindeutig vertikal
verlaufende Rinnen unterschiedlichen Durchmessers (bis zu 2,5 cm) erkennbar (Abb. 1oo–1o2). Als Deutung können zwei Erklärungen herangezogen werden: Einerseits könnte es sich um Abdrücke von stehenden Asthölzern gehandelt haben, die Teil einer Kuppelkonstruktion waren. Dagegen spräche die Tatsache, dass sie in den anstehenden Lehm mindestens mit ihrem halben Durchmesser hineingedrückt worden sein müssten und sich innerhalb des Ofens keine verziegelten Lehmreste der inneren Verschmierung gefunden haben. Die andere Erklärung wäre, dass es sich um Spuren des Grabwerkzeuges handelte. So könnten Geweihsprossen, wie sie aus Bef. 1179 und 1375 vorliegen, benutzt worden sein, da der anstehende Lehm sehr hart ist.
Zur Feindatierung ergaben sich keine konkreten Hinweise. Ebenso lässt sich die Funktion nicht sicher erschließen. Die auf der Sohle gefundene
Holzkohle und die Verziegelung belegen eine Befeuerung. Die Steine dienten als Wärmespeicher. Insofern ist der Befund in die Gruppe der anderen rechteckigen Ofengruben zu stellen. Diese wiesen aber keine Öffnungen auf und die innere Struktur (ebene Sohle, einseitige Ausräumung, einheitliche Gesteinsart, dünne, von den aufliegenden Steinen abgeschlossene Holzkohleschicht) weicht etwas ab. Eine seitliche Ausräumung der Steine wurde beispielsweise in Waltersdorf, Lkr. DahmeSpreewald, nachgewiesen (Brumlich/Meyer 2oo4, 194 Abb. 22; 23). Briquetage als möglicher Beleg für einen Siedeofen wurde nicht gefunden. Die Größe liegt deutlich unter jener des nachweislichen Siedeofens von LöbnitzBennewitz, Lkr. Leipzig (Pfeifer 2oo7), mit 3 m x 1,5 m, dessen Wände sich zudem nach unten trapezförmig erweiterten. Der Brehnaer Befund kann daher nicht bedenkenlos dieser Befundgruppe zugeordnet werden.
Abb. 99 Der Ofen Bef. 1137/11398 im Profil. Deutlich ist links die Verziege-lung der aufgehenden Wandung zu erkennen, die rechts fehlt.
Abb. 100 Im Streiflicht heben sich die Rinnen an der Kante des Planums deutlich ab.
99
100
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
120
Runde Öfen mit Briquetage
In Fläche 3 lagen zwei sehr ähnliche Gruben, die in mehrerlei Hinsicht von den typischen Siedlungsgruben abweichen.
Bef. 1123 (Abb. 1o3) war eine im Planum 1 leicht ovale Grube von o,97 m x o,9o m. In ihrem Inneren lag Briquetage. Im Planum 2 zeigte sich an der Südostseite eine etwa viertelkreisförmige Verziegelungsspur. In diesem Planum hatte der Befund ein kreisrundes Aussehen mit einem Innendurchmesser von o,72 m. Das Profil zeigte eine nur noch 2o cm tiefe, also flache Erhaltung der Anlage. Deutlich zogen sich die Verziegelungsspuren an der flachen, gerundet in die Wandung übergehenden Grubensohle entlang. Innerhalb der graubraunen Verfüllung des Befundes lagen in Durchmischung Briquetagesäulen und gebrannte Lehmstücke
sowie etwas Keramik. Bei den Lehmstücken könnte es sich um ehemals aufgehende Wandungsteile eines Ofens handeln. Auffällig war, dass die Säulen nicht direkt auf der Grubensohle standen, sondern in der Verfüllung etwas darüber lagen. Sie wurden offensichtlich nach Aufgabe des Ofens eingefüllt und zeugen nicht zwingend von dessen Funktion. Die im Befund zutage getretene Keramik datiert in die frühe vorrömische Eisenzeit.
Bef. 1151 (Abb. 1o4) schien mit Ausmaßen von o,81 m x o,67 m in Planum 1 etwas kleiner als Bef. 1123 zu sein. In Planum 2 war er ebenfalls annähernd kreisrund mit einem Durchmesser von ca. o,7 m. Die Sohle des etwa 25 cm tief erhaltenen Befundes wies im Profil (Abb. 1o5) keinerlei Hinweise auf Hitzeeinwirkung auf. Verziegelungsspuren waren nur im Planum 1 an einer kleinen Stelle
Abb. 101 Die vertikalen Rinnen in der nördlichen Wandung.
Abb. 102 Die vertikalen Rinnen in der östlichen Wandung.
Abb. 103 Der Ofen Bef. 1123 mit deutlichen Verziegelungs-spuren im Süden und Osten.
101 102
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 121
im Nordwesten zu erkennen. Sie belegen aber die Gleichartigkeit mit Bef. 1123. Wie in diesem lagen auch in Bef. 1151 Briquetagesäulen und gebrannte Lehmstücke. Die Lehmstücke dürften auch hier aufgehende Wandungsteile des Ofens gewesen sein. Bemerkenswert ist, dass sich einige der Säulen (Abb. 1o6) zu vollständigen Exemplaren zusammensetzen ließen. Sie sind sämtlich in der Mitte zerbrochen und auffälligerweise genau dort am stärksten sekundär gebrannt, wie ihre an dieser Stelle hellgraue Farbe belegt (vgl. Abb. 27). Wie in dem ersten Befund lagen die Funde auch in diesem Ofen innerhalb einer humosen, nach der Nutzung eingebrachten Verfüllung und können daher nicht als direkter Hinweis auf dessen Funktion gewertet werden. Die Keramik ist in die frühe vorrömische Eisenzeit zu stellen.
Die beiden Befunde sind zusammenfassend schwer zu werten. Die Korrelation von Briquetagesäulen und Ofenresten ist auffällig. Sie kam ebenfalls bei dem Ofen aus LöbnitzBennewitz vor (Pfeifer 2oo7, 24; 42). Auch die Tatsache, dass die Ofenwandungsreste mit den Säulen jeweils vermischt auftraten, deutet auf einen Zusammenhang hin, denn die Säulen sind wohl nicht zufällig, wie üblicher Siedlungsmüll, in den offen stehenden Gruben entsorgt worden. Die Menge der Säulen in Bef. 1151 spricht ebenfalls dafür. Sie gehören mehrheitlich einem »Säulensatz« (siehe Abschnitt Briquetage) an. Sollte der Zusammenhang Briquetage und Ofenwandungsreste als funktionales Ensemble akzeptiert werden, kann es sich trotz
dem nicht um Brennöfen zur Herstellung von Briquetage gehandelt haben, da die Säulen starke mittige Sekundärbrandspuren aufweisen, wie sie gewöhnlich bei benutzten Stücken auftreten. Andererseits weicht das Aussehen der Befunde auch hinsichtlich der Form von jenem des bislang einzigen relativ sicher als Siedeofen zu deutenden Befundes in Mitteldeutschland ab (vgl. Preier 1999, 135–138; Pfeifer 2oo7). Mögli cherweise ist mit den beiden Brehnaer Befunden ein anderer sehr kleiner Siedeofentyp erfasst worden.
Abb. 104 Der Ofen Bef. 1151 mit Briquetagesäulen und gebrannten Lehmstücken im Planum.
Abb. 105 Der Ofen Bef. 1151 im Profil.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
122
Weitere Ofen- und Herdbefunde von Fläche 2 und 3Bef. 1o36 zeichnete sich im Planum als etwa rechteckige, braungraudunkelbraune Verfärbung mit abgerundeten Ecken ab, deren Verfüllung aus humosem, sandigschluffigem Lehm bestand und der mit seinen Grundmaßen (Länge 1,88 m/Breite 1,22 m) stark an die oben besprochenen Erdöfen erinnerte, obwohl er in seinem oberen, östlichen Teil durch einen Graben gestört war. Da auch hier eine Steinpackung zu vermuten war, wurde ein zweites Planum angelegt. Beim Abteufen waren nach ca. o,15 m unter Planum 1 stark verziegelte Lehmbrocken zu beobachten, die sich in ca. o,25 m Tiefe zu einer ca. o,1o m mächtigen Packung verdichteten. Für das zweite Planum wurde der Befund ca. o,2o m unter Planum 1 gänzlich freigelegt. Hier war deutlich eine leicht ovale, graubraunrötlichbraune Verfärbung von etwa 1,4o m Durchmesser zu erkennen, die stark mit verziegeltem Lehm durchsetzt war. Im muldenförmigen Profil zeigte sich, dass der untere Bereich von einer Schicht ziegelroten Lehms eingenommen wurde, die durch große Hitzeeinwirkung auf dem anstehenden Boden entstanden war. Eine Steinpackung konnte nicht beobachtet werden, wodurch sich der Befund von den oben vorgestellten unterschied. Da die Schicht aus verziegeltem Lehm den ganzen unteren Bereich der Grube einnahm und auch an der ungestörten westlichen Grubenwand nachweisbar war, kann mit einer länger anhaltenden Befeuerung gerechnet werden. Aufgehende Konstruktionselemente waren nicht nachzuweisen, so dass fraglich bleiben muss, ob es sich um eine geschlossene Ofenkonstruktion oder um eine zunächst offene Grube gehandelt hatte, wobei der zweiten Variante vermutlich der Vorzug zu geben ist.
Die aus der Füllung stammenden Keramikfragmente wiesen z. T. einen Sekundärbrand auf und
gehören mehrheitlich zur gröberen Siedlungsware. Neben der häufiger auftretenden Schlickung des Unterteiles waren an einem Stück Fingertupfen auf Rand und Wandung festzustellen. Auch das Fragment einer dünnwandigen, flau Sförmig profilierten Schale stammt aus diesem Befund und datiert ihn in die früheisenzeitliche Siedlungsphase.
Als rechteckigunregelmäßige, braungraue, lehmighumose Verfärbung von ca. 2,o4 m x 1,38 m Größe zeichnete sich die Anlage Bef. 692 im Planum 1 ab. Im Inneren war deutlich ein etwa 1,5o m x 1,13 m großer, annähernd rechteckiger Bereich erkennbar, der humoser und stärker mit gebranntem Lehm sowie etwas Holzkohle durchsetzt war. In Planum 2 zeigte sich eine rundlichovale, rötlichbraungraue Packung aus verbackenen Lehmbrocken, die etwa 1,49 m x 1,1o m groß war (Abb. 1o7). Innerhalb und im Randbereich dieses Paketes befanden sich mehrere rundliche, etwa faustgroße Steine. Im Kreuzprofil zeigte der Ofen eine Wannenform. Der obere Teil bis in ca. o,27 m Tiefe war inhomogen und stark mit größeren Stücken gebrannten Lehms und Holzkohle vermischt. Darunter war eine ca. o,1o m mächtige Verziegelungszone erkennbar, die im Anstehenden auslief. Diese Verziegelung war auch an den Grubenwänden nachweisbar und umschloss einen Raum von ca. 1,1o m Durchmesser. Da an mehreren Stücken des gebrannten Lehms Rutenabdrücke erkennbar waren, könnten diese eingefüllten Lehmbrocken zu einer Kuppelkonstruktion gehört haben, die den unteren Brennraum überspannte. Mit Sicherheit wurde die Ofenanlage abgebrochen und die Kuppelbruchstücke erst sekundär eingefüllt. Da bei der Anlage keine Öffnung erkennbar war, die als Schürloch zu interpretieren wäre, muss die Befeue rungsweise fraglich bleiben. Eine eindeutige Ansprache als Back oder Keramikbrennofen kann nicht erfolgen. Sicher ist, dass es sich nicht um einen der oben vorgestellten Erdöfen handelte.
Einem ähnlichen Konstruktionsprinzip wie der Ofen Bef. 692 dürfte die Anlage Bef. 624 gefolgt sein, die auf Fläche 3 lag. Im ersten Planum zeichnete sich eine rundlichunregelmäßige, braungraudunkelgraue, humose und schluffiglehmige Verfärbung von etwa 1,6o m Durchmesser ab, deren mittlerer Bereich mit größeren Brocken gebrannten Lehms durchsetzt war. Im Kreuzprofil zeigte der Ofen deutlich eine Kasten bis Muldenform. Unterhalb der schon im Planum beobachteten Schicht aus größeren Lehmbrocken wurde beim Abteufen der Kästen eine ca. 1,27 m x o,8o m große, rechteckige bis ovale Packung aus größeren, scharfkantigen Bruchsteinen (Porphyr) sichtbar, die mit Holzkohle und humosem Material durchsetzt war (Abb. 1o8). Die Steinpackung diente vermutlich als wärmespeichernder Unterbau eines Ofens. Eine aufgehende Konstruktion
Abb. 106 Detailaufnahme der Säulen mit trompeten-
förmigen Schäften aus dem Ofen Bef. 1151.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 123
Abb. 107 (oben) Der Ofen Bef. 692 im Planum 2.
Abb. 108 (unten) Der Ofen Bef. 624.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
124
war nur fragmentarisch im östlichen Teil nachzuweisen.
Zu den kleineren, rundlichen Ofen oder Herdanlagen gehörte Bef. 67o, der sich im Planum als braungraudunkelbraune, lehmighumosaschige Verfärbung von ca. o,81 m Durchmesser abzeichnete, die von einem Ring aus gebranntem Lehm umschlossen war und deren Inneres stark mit Holzkohle, gebranntem Lehm sowie mit Bruch und Feldsteinen durchsetzt war. Im muldenförmigen Profil wurde unter der mit Holzkohle und humosem Material durchmischten Steinpackung eine Schicht aus stark angeziegeltem, anstehendem Lehm sichtbar. Da der Befund teilweise noch im BHorizont lag, kann von einer vergleichsweise geringen Eintiefung der Anlage ausgegangen werden und eine Ansprache als Herdstelle (»Freiluftherd«) liegt nahe.
In Fläche 3 waren drei weitere Befunde nachweisbar, bei denen es sich eindeutig um Öfen handelte: Bef. 921 war der Rest eines Ofens mit annähernd quadratischem, an den Ecken abgerundetem Grundriss (Abb. 1o9). Die Größe betrug o,9o m x o,8o m bei einer Tiefe von o,2 m und NordostSüdwestAusrichtung. Die vertikalen Seitenwände des Ofens waren durch die größtenteils recht starke Verziegelung des anstehenden Lehms gut erhalten. Die Verziegelung war nur in der West ecke nicht nachweisbar. Die völlig horizontale Sohle wies dagegen nur andeutungsweise im Mittelbereich (Profil 3) eine Verziegelung auf. Die Verfüllung bestand direkt über der Sohle aus stärker holzkohlehaltigem, schwärzlich grauem, darüber aus mäßig holzkohlehaltigem, dunkelgrauem, humosem Material. Eine Öffnung für die Befeuerung konnte nicht nachgewiesen werden, auch nicht an der Stelle der fehlenden Verziegelung im Westen. Zwei Scherben können in die frühe vorrömische Eisenzeit datiert werden. Zur Funktion des Ofens liegen keine aussagekräftigen Funde vor. Wahrscheinlich wurde er, wie die Intensität der Verziegelungen nahe legt, mehrfach genutzt. Er könnte aufgrund seiner Lage mit dem westlich davon befindlichen Sechspfostenbau in Verbindung gebracht werden. Im Abstand von 5–8 m liegen nördlich mehrere Befunde, die Reste von Briquetagetiegeln enthalten, darunter die Grube Bef. 9o9 mit über 4o kg dieser Funde. Für einen Zusammenhang gibt es aber außer des Lagebezuges keinerlei Belege.
Bei Bef. 157 handelte es sich um die Sohle eines Ofens, welcher auf einer bereits verfüllten Sied
Abb. 109 Der quadratische Ofen 921 im Planum.
Abb. 110 Die Basis des Ofens Bef. 157 mit einem Unterbau aus Scherben und Steinen.
Abb. 111 Das auf einer Steinschicht liegende quadratische Scherbenpflaster unter dem Ofensockel von Bef. 157; von Südosten streicht eine weitere Steinschicht unter diese Konstruktion.
109
110
111
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 125
lungsgrube erbaut worden war. Der Unterbau selbst bestand aus einer teilweise erhaltenen Schicht gebrannten Lehms mit ehemals wohl ebener Oberfläche, die auf einem annähernd quadratischen, einlagigen Scherbenpflaster von 54 cm x 47 cm auflag (Abb. 11o, 111). Die Scherben stammen von einem früheisenzeitlichen Topf. Das Pflaster war OstnordostWestsüdwest ausgerichtet und dürfte die Ausrichtung des Ofens ungefähr wiedergeben. Offenbar hatte sich die darunter liegende Grubenverfüllung zur Bauzeit des Ofens noch nicht völlig gesetzt, denn unter dem Scherbenpflaster war im Nordbereich zur Stabilisierung zuvor ein langrechteckiges, einlagiges Steinpflaster von ca. 35 cm x 6o cm aus kleineren bis faustgroßen Rollsteinen angelegt worden, unter dessen Südostecke eine weitere kleine, schräg liegende Pflasterung lag (vgl. Abb. 111).
Bef. 92o war ein kleiner ovaler Ofen in NordostSüdwestAusrichtung mit inneren Ausmaßen von 52 cm x 35 cm. Im Südwesten war die Ofengrube offen. Dort schloss sich eine ebenfalls ovale Verfärbung von 58 cm x 71 cm an, die als Rest einer Schürgrube gedeutet werden kann (Abb. 112). Der Ofen selbst bestand lediglich aus einer in den anstehenden Lehm eingetieften Grube mit muldenförmiger Sohle. Die Wandung war durch die thermische Beeinflussung deutlich rötlich verziegelt, was auf eine mehrmalige Nutzung der Anlage hindeutet. Im Inneren war der Ofen mit holzkohlehaltigem, schwärzlich grauem Material verfüllt, seine Funktion ist unklar. Er liegt jedoch wie der Ofen Bef. 92o direkt neben einem Sechspfostenbau, so dass eine Zugehörigkeit möglich ist.
Ausgewählte Grubenbefunde
Große Lehmentnahmegruben
In Fläche 3 lagen zwei große Lehmentnahmegruben (Bef. 158 und 782) und eine wahrscheinlich anzuschließende kleinere (Bef. 384). Die größere, ei bis birnenförmige Grube (Abb. 113) besaß Ausmaße von ca. 16 m x 1o m und eine Tiefe von noch ca. 2,3 m unter Planum 1. Sie war zum größten Teil mit einem kaum humosen Material verfüllt, wie es sich ähnlich auch in den »hellen« Gruben fand (siehe Abschnitt Einfache Siedlungsgruben). In Tiefe der Plana 3 bis 4 lagen durchgängige »Brandschichten« aus stark holzkohlehaltigem, ansonsten ebenfalls hellem Material (Abb. 114). Innerhalb dieser Schichten traten vergleichsweise häufiger Funde auf, auch wenn angemerkt werden muss, dass der Befund zwar vorsichtig, aber mit dem Bagger ausgegraben werden musste. Sämtliche Funde verweisen die Grube in die vorrömische Eisenzeit. In Planum 3 und deutlicher in Planum 4 zeigte sich zentral eine kreisrunde Verfärbung (Bef. 1614; Abb. 114–116), von der konzentrische und radial nach außen laufende, tonig verfüllte
»Risse« abgingen. Die Entstehung dieses Phänomens konnte nicht geklärt werden. Zur Untersuchung von Herkunft und Beschaffenheit des hellen, ascheartig wirkenden Verfüllmaterials der Grube, welches sich stark vom anstehenden Boden unterschied, wurden Proben entnommen. Da die kreisrunde Verfärbung im Profil eindeutig als jüngste Grube erkannt werden konnte (Abb. 117), kann es sich nur um eine Eintiefung in die wahrscheinlich noch feuchte Verfüllung gehandelt haben. Die kreisrunde Form deutet auf einen ehemaligen röhrenförmigen Verbau hin. Die Risse müssen durch Setzungserscheinungen entstanden sein. Vielleicht deutet die Existenz dieses zentralen Befundes auf eine Sammelgrube für die in dem Verfüllmaterial enthaltene Feuchtigkeit hin. Als Deutung wäre das Sammeln salzhaltiger Restwässer aus Aschen denkbar. Die im Längsprofil unter Planum 4 erkennbare Grubenreihe (Bef. 16o8–1614), in die sich die Lehmentnahme
Abb. 112 Der ovale Ofen Bef. 920 mit Öffnung und Schürgrube im Südwesten.
Abb. 113 Die Lehmentnahme-grube Bef. 782 während der Freilegung im Planum 2.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
126
grube (Bef. 782) nach unten hin auffächerte, hatte eine NordwestSüdostAusrichtung. Weitere Einzelgruben können außerhalb des Profilschnittes gelegen haben und wurden daher nicht dokumentiert. Sicher erfolgte die Verfüllung im unteren Bereich des Gesamtbefundes zum größten Teil von Nordwesten her. Insgesamt macht Bef. 782 den Eindruck, als habe es sich ursprünglich um eine Lehmentnahmegrube gehandelt, wie es die einzelnen »Entnahmegruben« im unteren Bereich verdeutlichen, die dann später eine bewusste Zweitnutzung erfahren hatte.
Die Nordosthälfte des Befundes konnte leider wegen eines Wassereinbruchs in den südwestlichen Profilkasten nicht mehr untersucht werden (Abb. 118 sowie Kap. 1, Abb. 11). Daher musste auf eine gezielte Ausgrabung nach den im Profil erkannten Schichtungen bzw. Einzelgruben verzichtet werden.
Die zweite Lehmentnahmegrube war im Planum 1 unregelmäßig und besaß Ausmaße von ca.
8 m x 7 m bei einer Tiefe von max. 1,8 m (Bef. 158). Sie wies in den Profilen ein sehr unregelmäßiges Aussehen auf, was auf die charakteristischen regellosen Eintiefungen zur Lehmentnahme zurückzuführen sein dürfte. Da offenbar teilweise anstehendes Material in die entstandenen Gruben eingebrochen war, ließ sich der genaue Verlauf der Grubensohlen bzw. deren Abgrenzung zum anstehenden Lehm nicht immer problemlos feststellen. Die Verfüllung war relativ regellos (Abb. 119). In den unteren Bereichen fand sich vorrangig helles, allerdings sehr verschiedenes Material, wechselnd mit Bändern aus anstehendem Lehm. Oben war die Grube deutlich humoser verfüllt und machte den Eindruck einer zuletzt durch Erosion verfüllten Mulde. Das Fundmaterial weist die Grube als früheisenzeitlich aus. Einige Funde gehören noch sicher der jüngsten Bronzezeit an.
Eine weitere Lehmentnahmegrube (Bef. 384) war mit einem Durchmesser von ca. 3,4 m deutlich kleiner. Auch sie wies im Profil die charakteris
Abb. 114 Planum 4 der Lehmentnahmegrube Bef. 782
mit dem zentral liegenden Fleck.
Abb. 115 Der zentrale Fleck mit konzentrischen »Setzungsrissen«.
Abb. 116 Die farblich abgesetz-ten Risse am Rand des
Befundes.
115 116
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 127
tische Auflösung des unteren Bereiches in Einzelgruben auf. Andere, wie Bef. 798 (Abb. 12o), zeigen zudem durch ihre schräge Sohle an, dass sie als Vorratsgruben o. ä. ungeeignet waren.
Lehmentnahmegruben sind – als Relikte der Gewinnung des Lehmes/Tones für die Herstellung der Gefäß und der technischen Keramik (Briquetage) und für den Hausbau, also eines alltäglich im bronze bis eisenzeitlichen Leben benötigten Materials – häufig als Befunde auf Ausgrabungen zu erwarten. Vergleichsbefunde wurden jedoch selten publiziert. Schöne zeitgleiche Parallelen wurden jüngst aus dem nur wenige Kilometer nördlich entfernten Löberitz, Lkr. AnhaltBitterfeld, vorgestellt (Klamm 2oo4).
Flache muldenförmige Gruben mit Briquetage
Einige Grubenbefunde zeichneten sich weniger durch ihr Aussehen im Allgemeinen, sondern durch dieses in regelhafter Kombination mit Briquetagefunden aus (Abb. 121, 122). Es handelte sich durchgängig um größere, im Planum schwer abgrenzbare, amorph wirkende humose Verfärbungen, die meist durch Tiergänge stark durchwühlt waren.
Im Profil besaßen sie ein ebenso unregelmäßiges, flach muldenförmiges Aussehen. Neben den Briquetagefragmenten enthielten sie relativ wenige Keramikreste sowie einige regellos verstreute, in einem Fall sehr große Gerölle. In ihrem Inneren traten stellenweise Verziegelungen auf.
Markanteste Vertreter dieser Befundgruppe waren Bef. 428, 631, 747, 752, 1o12 und 1181–1184. Sie waren vor ihrer Verfüllung mit Sicherheit keine
Vorratsgruben, sondern müssen bereits als vergleichsweise flache Mulden angelegt worden sein, evtl. zur Materialentnahme. Gewonnen wurde dabei jedoch vor allem humoser Boden. Diese Befundgruppe ist von Bedeutung, weil kürzlich ein ebensolcher Befund von den Grabungen in Queis, kreisfreie Stadt Halle, als Salzsiedeofen vorgestellt wurde (Petzschmann 2oo3, 84 f. Abb. 3–5; Becker u. a. 2oo4, 198 f. Abb. 16). Aus der Sicht der Brehnaer Befunde kann dies, abgesehen von dem andersartigen Aussehen des oben genannten klaren Beleges aus LöbnitzBennewitz (Preier 1999; Pfeifer 2oo7), nicht bestätigt werden. In keinem Fall konnte in Brehna eine echte Ofenwandung in situ dokumentiert werden und die Befunde zeigten keine regelhaften Strukturen.
Abb. 117 Das Profil des Befundes 782 unter Planum 4. Deutlich sind die grubenartigen Abbaumulden und -schächte erkennbar.
Abb. 118 Dokumentation des Profiles nach den ersten schweren Regengüssen.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
128
Eher handelt es sich um flache Gruben, in oder neben denen die wohl größtenteils überirdisch angelegten Siedeöfen lagen und in welche die möglicherweise noch heißen Abfälle des Siedeprozesses entsorgt wurden (Abb. 123), aber nicht um die Öfen selbst. Vielleicht wurden die Gruben zuvor ausgehoben, um Material für den Ofenbau zu gewinnen. Auch ein weiterer als Siedeofen angesprochener Befund aus Queis (Balfanz 2oo3, 76; 78 Abb. 7) ist in Analogie zu Brehnaer Befunden eher als Siedlungsgrube mit Briquetage und Ofenwandungsresten zu interpretieren.
Früheisenzeitliche SiedlungsbestattungenAuf Fläche 2 konnten zwei Bestattungen in Siedlungsgruben beobachtet werden. Die erste Grube (Bef. 225) zeichnete sich im oberen Planum als 1,64 m x 1,43 m große, braungraudunkelbraune Verfärbung mit etwas Keramik und vereinzelten Knochen ab (Abb. 124, 125). Form und Größe schienen auf eine der östlich der Hausgruppe (Gehöft) gelegenen Siedlungsgruben hinzuweisen, so dass ein Querprofil angelegt und mit dem Abteufen des ersten Kastens begonnen wurde. Nach Anlage des Profils zeichnete sich eine inhomogen verfüllte, ca. o,6o m tiefe, etwa kastenförmige Grube ab, in deren unterem Drittel eine stärkere Konzentration gebrannten Lehms und oberhalb der Sohle eine stärkere Holzkohledurchmischung dokumentiert wurden. Beim Abteufen kamen im ostsüdöstlichen Drittel der Grube in ca. o,32 m Tiefe die extrem angewinkelten Beine einer menschlichen Bestattung zutage, die nachfolgend im Planum 2 genauer untersucht wurde. Das sehr gut erhaltene Skelett war etwa NordSüd ausgerichtet, befand sich in Rückenlage und blickte nach Süden. Der Schädel ruhte ehemals auf der Brust, so dass das Kinn die Wirbelsäule berührte, wodurch der Eindruck verstärkt wurde, der Tote sei in die Grube gequetscht worden. Um den Leichnam in der bestehenden Grube »unterbringen« zu können, wurden seine Unterschenkel extrem stark zurückgebogen und wahrscheinlich mit den Oberschenkeln verschnürt. Der linke Fuß befand sich unter dem Becken, der rechte Fuß fand sich über dem Schambein (vgl. Abb. 124).
Abb. 119 Teilprofil der Lehment-nahmegrube Bef. 158, unten
mit Abbaumulden, oben humos verfüllt.
Abb. 120 Eine der verbreiteten kleineren Lehmentnahmegruben
(Bef. 798).
Abb. 121 Flache Grube mit Geröllen und Briquetage.
Abb. 122 Flache Grube mit Verziegelungsspuren und
Briquetage.
Abb. 123 Teilplanum der flachen Grube Bef. 428 mit bündelweise
eingefüllten Briquetagesäulen.
122
121
119 120
123
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 129
Die Oberarme lagen links und rechts parallel zum Oberkörper, der linke Unterarm ruhte angewinkelt auf dem Bauch und führte zum rechten Ellenbogen. Der rechte Unterarm war stark angewinkelt und die rechte Hand berührte die rechte Schulter. Um den Toten in der Siedlungsgrube bestatten zu können, musste diese im südöstlichen Bereich erweitert werden, wobei minimaler Aufwand betrieben wurde.
Das Fundmaterial belegt, dass die Siedlungsgrube nach der Einbringung des Toten zur »Abfallentsorgung« genutzt bzw. mit umliegendem Material aus der Siedlungsschicht verfüllt worden ist. Der Bezug der Bestattung zu der nebenliegenden Gehöftstruktur wird weiter unten erörtert.
Die Einordnung einer zweiten Siedlungsbestattung (Bef. 665) ist wesentlich komplizierter, stehen doch die geborgenen neolithisch anmutenden Keramikfragmente und das Bruchstück einer Silexklinge der Bestattungsweise und der gesicher
ten Datierung der umgebenden Befunde entgegen. Die Bestattung (Abb. 126, 127) lag etwa 3o,5o m nordnordwestlich des Hauptgebäudes der Gehöftgruppe und zeichnete sich deutlich als braungraudunkelbraune, rechteckige Grube von 1,32 m x o,69–o,75 m Größe ab, die relativ homogen verfüllt war. Beim Abteufen des Profils kamen die Reste eines menschlichen Skelettes zum Vorschein, das im Planum 2 dokumentiert wurde. Der Tote war in einer etwa OstWest ausgerichteten, rechten Sei
Abb. 124 Eisenzeitliche Siedlungsbestattung (Bef. 225).
Abb. 125 Die Siedlungsbestat-tung Bef. 225, Blick von Südsüd-west.
Abb. 126 Die eisenzeitliche (?) Siedlungsbestattung (Bef. 665).
Abb. 127 Die Bestattung Bef. 665, Blick von Westen.
125 124
126 127
N
N
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
130
tenlage bestattet worden. Das rechte Bein war stark angezogen, das Knie zeigte etwa nach Norden und der rechte Fuß befand sich unterhalb des Gesäßes. Das linke Bein war weniger stark angezogen und auch hier wies das Knie etwa nach Norden. Der linke Arm blieb gestreckt, führte unter dem Hals durch und zeigte nach Südost. Der rechte Arm lag leicht angewinkelt hinter dem Rücken des Toten und verlief Richtung Becken. Vom Schädel waren keine Fragmente zu beobachten, so dass, da keine Störung des Befundes festzustellen war, angenommen werden muss, dass der Tote ohne Kopf bestattet worden ist. Auffällig am Befund war die kleine Grube, die sich an den Maßen des Bestatteten (ohne Schädel) orientierte. Auch hier entstand der Eindruck, der Tote sei in die Grabgrube gequetscht worden.
Mit einiger Sicherheit dürften die neolithischen Artefakte beim Ausheben und/oder Verfüllen der Grube in das Füllmaterial und so in die Grabgrube gelangt sein. Die Art der Bestattung ohne Schädel entspricht eher eisenzeitlichen Sonder und Siedlungsbestattungen als dem Bestattungsritus der Baalberger Gruppe, die als einzige neolithische Gruppe mit Befunden im näheren Umkreis nach
gewiesen wurde. Ein Bezug zur Siedlungsbestattung aus Bef. 225 kann nicht hergestellt werden.
Die Beurteilung der Hintergründe für die so genannten Siedlungsbestattungen ist schwierig und konnte auch durch jüngere Zusammenstellungen nicht geklärt werden (Balfanz/Jarecki 2oo4). Für die Siedlungsbestattungen der Aunjetitzer Kultur aus Brehna war nachzuweisen, dass die Toten wahrscheinlich in einem wie auch immer gearteten Verhältnis zur Keramikherstellung und/oder zur Salzsiederei gestanden haben. Solche Bezüge lassen sich bei den früheisenzeitlichen Bestattungen nicht herstellen (s. u. Gehöft C).
Gruben mit größeren Gefäßresten
Einige wenige Gruben fielen dadurch auf, dass sich in ihnen fast vollständige Gefäße fanden, die zudem wohl intentional niedergelegt wurden. Da derartige Befunde auch bei anderen Siedlungsgrabungen auftreten und teilweise tatsächlich rituelle Gefäßniederlegungen, teilweise offenbar Überreste spezieller Speicherareale mit Großgefäßen darstellen, wurde ihnen in Brehna entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet. Bef. 152 enthielt einen tonnenförmigen gerauten Topf (Abb. 128; vgl. auch Kapitel 5, Abb. 13 rechts), der umgestülpt auf der Sohle nordwestlich innerhalb der Grube stand. Bei seiner Entleerung wurden keine Funde gemacht, die auf den Grund dieser Lagerung schließen ließen. Die Rekonstruktion des von Rissen durchzogenen Gefäßes zeigte später, dass es bereits im beschädigten Zustand mit einem Sprung und einer fehlenden Randscherbe in den Boden gelangt war. Es handelte sich daher nicht um ein Gefäßopfer o. ä.
Bef. 1139 fiel bereits beim Aufziehen der Flächen auf, da sich zusammenhängende Randscherben eines Gefäßes zeigten. Im Planum 2 war eine scheinbar vollständig erhaltene Terrine zu erkennen (Abb. 129), die leicht schräg innerhalb einer diffusen Grubenverfärbung am Rande eines größeren Befundes stand. Beim weiteren Ausgraben zeigte sich, dass die Terrine (Abb. 13o) einige Scherben einer gut gearbeiteten doppelkonischen Schale
Abb. 128 Der umgestülpte Topf in der Grube Bef. 152.
Abb. 129 Der Bef. 1139 im Planum 2.
Abb. 130 Die Terrine aus Bef. 1139 mit Scherben eines weiteren Gefäßes.
130129
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 131
der Lausitzer Kultur sowie ein plattiges Reibesteinfragment barg. Einige dieser Funde lagen direkt im Bodenbereich der Terrine, welcher – wie sich zeigte – der Boden fehlte. Es handelte sich auch bei diesem Fund nicht um ein gebrauchsfähiges Vorratsgefäß. Allerdings kann in diesem Fall ein bewusstes Unbrauchbarmachen des Gefäßes vor einer möglicherweise rituellen Niederlegung nicht ausgeschlossen werden, da sich der Befund sehr deutlich von den üblichen Gruben unterschied.
Eisenzeitliche Siedlungsgrube mit Küchenabfall
Von den Siedlungsgruben der jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Siedlungsphase hebt sich Bef. 455 (Abb. 131–133) wegen seiner Füllung mit diversen Knochen verschiedener Tiere und Tierarten ab. Im ersten Planum zeichnete sich eine etwa 1,53 m x 1,38 m große, rundliche, braungraudunkelgraue, humose, schluffiglehmigsandige Verfärbung ab, die im südlichen Bereich stärker mit Humus durchmischt war und in deren nördlicher Hälfte eine stärkere Konzentration tierischer Knochenfragmente zu beobachten war. Im zweiten Planum zeigte sich in der östlichen Hälfte eine Schicht aus einer Vielzahl von Extremitätenknochen, Rippen und Schulterblättern, die verschiedenen Tierarten und Individuen zuzuordnen waren. Die Knochen waren stark fragmentiert und stellen offenbar einen Querschnitt des »gewöhnlichen« Küchenabfalls dar. Mehrheitlich handelte es sich um die Fleischteile, also Extre
mitäten und Rippen, von Rind, Schaf/Ziege und Schwein sowie um vereinzelte Pferdeknochen8. Hauptsächlich ist Rindfleisch konsumiert worden. Die Reste von Schwein und Schaf/Ziege sind deutlich geringer.
Zwischen den Knochenfragmenten lagen die Reste verschiedener Gefäße. Im südöstlichen Teil befanden sich die Scherben einer Kanne, deren überrandständiger Bandhenkel abgebrochen war. Das Gefäß (Abb. 134) ist bauchig, mittelfein gemagert, mittelhart gebrannt und weist einen Mischbrand auf, dessen Farbspektrum zwischen leder
Abb. 131 Die Grube Bef. 455 mit massiver Packung aus Tierknochen.
Abb. 132 Die beschädigte Tasse innerhalb der Verfüllung von Bef. 455.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
132
braun bis dunkelbraungrau liegt. Die Kanne ist sorgsam gearbeitet, der Rand gerade abgestrichen und leicht verrundet. Im Bereich des Henkels zeigen sich Spuren eines Sekundärbrandes.
Ein zweites Gefäß (Abb. 132, 134) lag im mittleren Teil des Befundes im Profilsteg. Es handelt sich um eine grob gearbeitete, konische Tasse mit randständigem Bandhenkel, die mittelhart gebrannt und mittelgrob gemagert ist sowie einen reduzierenden Brand aufweist.
Der Hintergrund dieser singulär auftretenden Siedlungsgrube konnte nicht geklärt werden. Eine Ansprache als »Abfallgrube« ist am wahrscheinlichsten, sagt aber nichts über die primäre Nutzung der Grube aus. Eine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe des Befundes war nicht nach
weisbar, ist aber denkbar, da die Grube unweit der Grabungsgrenze aufgedeckt worden ist.
Hausgrundrisse
Bemerkenswert ist die Aufdeckung einer größeren Anzahl von Hausgrundrissen. Diese konzentrierten sich in der Südhälfte der Fläche 3, weitere dazu gehörige fanden sich nördlich in Fläche 2. Etwas abgesetzt davon lag eine kleine Gruppe im südlichen Teil von Fläche 2. In diesen Bereichen befanden sich die meisten weiteren Pfostengruben, die keinem Gebäude sicher zugeordnet werden können. Der Grund hierfür dürfte in der geringen erhaltenen Tiefe vor allem der Pfosten kleineren Durchmessers zu suchen sein, so dass vermutlich viele dieser flacheren Befunde nach dem Abziehen der Humusschicht bzw. des BHorizontes nicht mehr vorhanden waren. Von großer Bedeutung ist die Tatsache, dass viele der erkennbaren Gebäude relativ isoliert standen, so dass die Zuordnung der Pfosten zu bestimmten Konstruktionen vergleichsweise sicher ist. Weiterhin kann es als Glücksfall gewertet werden, dass Fläche 3 fast ausschließlich mit jüngstbronze bis früheisenzeitlichen und wenigen jungbronzezeitlichen Befunden belegt ist. Dadurch ist die grobe zeitliche und kulturelle Zuordnung der Grundrisse ohne Ausnahme möglich.
Sämtliche erkennbaren Pfostenbauten auf den Flächen 2 und 3 sind der jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Besiedlungsphase zuzuweisen. Zwar kommen auf beiden Flächen jungbronzezeitliche Gruben vor, doch streuen diese meist in hausfernen Arealen. Dagegen sind Siedlungsgruben, die aufgrund ihrer Lage offenbar mit Hausgrundrissen in Verbindung gebracht werden
Abb. 133 Die Grube Bef. 455 während der Freilegung der
Tierknochen.
Abb. 134 Kanne und Tasse aus der Grube Bef. 455.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 133
können, wie beispielsweise im Bereich der Häuser 5, 1o und 22, eindeutig eisenzeitlich. Dies gilt auch für die zu erschließenden Gehöftstrukturen im Umfeld dieser Häuser.
Im Folgenden sollen die sicheren und wahrscheinlichen Grundrisse vorgestellt werden. Es lassen sich mindestens vier, vielleicht fünf verschiedene Typen von Gebäuden anhand der Pfostenstellungen nachweisen, die teilweise durch eine Analyse sinnvoll differenziert werden können. Mehrfach kamen größere massivere sowie kleinere Sechspfostenbauten und daneben kleinere, schwächer gebaute Achtpfostenbauten vor. Zwei der Sechspfostenbauten weisen Reste einer ovalen »Einfassung« auf. Zweimal sind sich ähnelnde Mehrpfostenbauten und mindestens viermal kleine Vierpfostenbauten belegt. Sämtliche gesicherten Bauten der großen Gebäudegruppe im Norden sind OstWest bis OstnordostWestsüdwest ausgerichtet (vgl. Kap. 7). Eine abweichende, ungefähre NordSüdAusrichtung weisen Bauten der isolierten Gebäudegruppe im Süden der Fläche 2 auf.
Die Maße der im Folgenden aufgeführten Pfostenabstände und damit der Bauten beziehen sich immer auf die Mitte der Pfostengruben.
Die Achtpfostenbauten
Eine einheitliche Gruppe stellen die Achtpfostenbauten dar (Abb. 135). Insgesamt konnten neun derartige Gebäude sicher nachgewiesen werden. An mindestens zwei Stellen der Grabungsfläche könnten weitere gestanden haben. Charakteristisch dürfte die etwas unregelmäßige Achtpfostenstellung sein, wobei in zwei Fällen (Häuser 3 und 13) ein neunter, etwas nach Osten herausspringender Pfosten an der östlichen Schmalseite lag. Dieser gehörte zur Konstruktion. Das wird dadurch belegt, dass diese beiden Bauten die mit 2,o3 m und 2,13 m breitesten östlichen Schmalseiten aufweisen. Auch hinsichtlich der von den Pfosten aufgespannten Fläche erreichten diese Häuser mit 14,32 m² und 14,87 m² die größten Maße. Da sich diese Bauten im Prinzip nicht von den echten Achtpfostenbauten unterschieden
Abb. 135 Die sicheren Acht- bzw. Neun-Pfosten-Gerüste sowie das Haus 20, das sich aufgrund des charakteristischen Aussehens der Pfostengruben zuordnen lässt.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
134
(Flächenmaße von 7,96 m² bis 14,2 m²) und die zusätzlichen Pfosten lediglich als Verstärkung auftraten, werden sie hier unter der Bezeichnung »Achtpfostenbauten« geführt und mit behandelt. Die Pfostengruben der Achtpfostenbauten besaßen einen relativ geringen Durchmesser von 2o–35 cm (selten bis 4o cm) und waren nur gelegentlich tiefer als 1o–2o cm erhalten. Die Verfüllung bestand auffallend häufig aus einem sehr hellen Material, welches jenem der »hell« verfüllten Gruben im Norden der Grabungsfläche 3 entsprach. Eine Pfostenstandspur konnte in keinem Fall nachgewiesen werden. Die fast durchgängig zu konstatierende Unregelmäßigkeit der Bauten bestand in mehreren Details. Während die Pfostenpaare der östlichen und westlichen Schmalseiten meist relativ regelmäßig auf einer Linie quer zur Hauptachse des Gebäudes angeordnet waren, lagen die beiden mittleren Pfostenpaare häufig schräg zu dieser Achse (Häuser 2, 3,
13, 19). Besonders das östliche innere Pfostenpaar wich häufig deutlicher ab. Gelegentlich war die Mittelachse etwas gebogen (Haus 6). Auch die Langseiten bildeten meist keine Linie. Mehrfach war, besonders zwischen dem zweiten und dem dritten Pfostenpaar, ein Knick zu verzeichnen (Abb. 136), an dem das Gebäude nach Osten hin schmaler wurde (Häuser 3, 15, 16, 19). Zuweilen machte dieser Knick den Eindruck, es handele es sich nicht um einen Achtpfostenbau, sondern zwei nebeneinander liegende Vierpfostengebäude bzw. einen Vierpfostenbau mit einem östlichen Anbau (z. B. Haus 16). Da jedoch auch regelmäßigere Bauten belegt sind und die Zuordnung der Pfostengruben zu den Gebäuden gesichert ist, muss davon ausgegangen werden, dass eine größere Regelhaftigkeit nicht notwendig war und daher nicht angestrebt wurde. Die Zusammengehörigkeit der acht Pfosten wird dadurch gestützt, dass fast immer die jeweils zwei Pfosten der
Abb. 136 Abstand der Pfosten-paare (Joche) der Achtpfosten-
bauten.
Abb. 137 Die Eingrabungstiefe der Pfostengruben der Achtpfos-
tenbauten (Sohlentiefe HN), jeweils dargestellt im Verlauf
der Nord- und der Südlängsseite eines Hauses.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 135
östlichen und westlichen Schmalseiten tiefer eingegraben waren als die vier mittleren (Abb. 137). Dabei waren die westlichen meist die tiefsten. Nur bei Haus 15 war dies genau umgekehrt. Als Kontrolle können die Pfostendurchmesser betrachtet werden, wobei für diese Statistik lediglich die Pfostengruben aufgenommen wurden, von denen das Profil dokumentiert werden konnte, denn häufig wich die tatsächliche Dimension der Befunde im Profil von der zunächst beobachteten im Planum 1 ab. Betrachtet man die Durchmesser der Pfostengruben in Abb. 138, so wird deutlich, dass jeweils das westliche Pfostenpaar die größten Durchmesser aufweist. Die für die Pfostentiefen festgestellte Tendenz wird bestätigt. Bemerkenswert ist die Aussage, dass lediglich bei den Pfostendurchmessern von Haus 15 eine gegenläufige Tendenz zu verzeichnen ist. Genau dieses Haus weist auch bei den Pfostentiefen eine gegenläufige Tendenz auf. Das Haus dürfte insofern »verkehrt herum« erbaut worden sein. Durch die Analyse der Jochbreiten wird dies allerdings nicht bestätigt. Hier verhält sich Haus 15 genau wie die Häuser 3, 14 und vor allem 16 und 19, deren Jochbreiten nach Osten hin deutlich abnehmen.
Eine weitere wichtige Schlussfolgerung für die Konstruktion der Achtpfostenbauten kann aus der Analyse der Pfostentiefen (Abb. 137) gezogen werden. Der recht unregelmäßigen Stellung der Pfosten und ihrer variierenden Tiefe innerhalb der jeweiligen nördlichen und südlichen Längsreihe können wohl keine Aussagen zum Konstruktionsprinzip entnommen werden – außer dass die Eckpfosten offensichtlich bewusst etwas tiefer eingegraben wurden. Ein Vergleich des Tiefenverlaufs innerhalb der jeweiligen Längsreihen eines Hauses miteinander gibt dagegen einen deutlichen Hinweis: Nord und Südverläufe ähneln sich auffallend und sicher nicht zufällig. Die beiden sich nördlich und südlich gegenüber
liegenden Pfosten wurden bewusst ähnlich tief eingegraben, wogegen die Tiefendifferenz zu den jeweils östlich und westlich davon liegenden von geringerer Bedeutung war. Das kann nur bedeuten, dass die Konstruktion tatsächlich aus Jochen bestand, die vermutlich vor dem Aufstellen zusammengezimmert wurden und daher eine aufeinander abgestimmte Tiefe der beiden Pfosten verlangten. Die Topographie kann für die Tiefendifferenzen zwischen den Jochen innerhalb eines Hauses nicht verantwortlich sein, denn alle Bauten lagen in sehr ebenem Gelände, welches über die kurze Distanz einer Hauslänge hinweg keine markanten Höhenunterscheide aufwies.
Die Achtpfostengebäude fallen im Gegensatz zu den Sechspfostenbauten durch ihre geringen Dimensionen auf. Die Längen reichten bei immer etwas voneinander abweichenden Nord und Südseiten von knapp über 5 m bei Haus 2 bis ca. 7,5 m bei Haus 13 bei einer Konzentration der Längen zwischen 6 und 7 m. Die Diagonalen liegen bei nur ca. 5,5 m bis unter 8,o m. Noch bemerkenswerter sind die geringen Breiten. Sie reichen von ca. 1,5 m bei Haus 2 bis zu ca. 2,1 m bei den Häusern 4 und 13, wobei sich die Breiten der Westseiten um die 2 m konzentrieren und jene der Ostseiten tendenziell deutlich darunter liegen. Die geringen Dimensionen unterstreichen, dass die Nord und Südpfostenreihen kaum Außenseiten von Häusern gewesen sein dürften. Die ermittelten Grundrisse dürften daher die Reste von ehemals dreischiffigen Bauten gewesen sein und bestätigen damit indirekt die Deutung als Jochkonstruktion.
Die Sechspfostenbauten
Als andere Gruppe sich ähnelnder Bauten sind die Sechspfostenbauten anzusehen (Abb. 139). Deutlich lassen sie sich in zwei klar getrennte Größenklassen unterteilen. Eine Gruppe aus fünf Bauten
Abb. 138 Die Durchmesser der Pfostengruben der Achtposten-bauten, jeweils dargestellt im Verlauf der Nord- und der Süd-längsseite eines Hauses.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
136
(Häuser 4, 5, 8, 9, 1o) weist Längen zwischen 7 m und über 9 m auf bei Breiten von 2,5 m bis unter 4,5 m (Diagonalen 7,5 m bis über 1o m). Die durch die Pfosten aufgespannten Flächen haben Größen von 18,15 bis 38,43 m². Die andere Gruppe aus drei Bauten (Häuser 12, 17, 21) weist Längen zwischen 3,5 m und unter 5 m auf. Die Breiten liegen von 1,9 m bis über 2,6 m (Diagonalen ca. 4,5 bis 5,5 m). Ihre Flächeninhalte betragen unter 1o m².
Die kleinen Sechspfostenbauten besaßen Pfostengruben mit einem Durchmesser von ca. o,3 bis o,4 m. Die drei vorliegenden Häuser verjüngten sich in verschiedene Richtungen. Die Analyse der Pfostentiefen erbringt keine sicheren Ergebnisse. Tendenziell könnten die ähnlichen Tiefen der jeweiligen Pfostenpaare auf eine Jochkonstruktion hinweisen. Die Lage der Häuser im Gesamtplan verdeutlicht, dass die Trennung der »kleinen« von den »größeren« Sechspfostenbauten wahrscheinlich nicht zufällig und daher wohl funktional begründet ist. Zwei der drei kleinen Bauten (Häuser 17 und 21) liegen jeweils direkt neben
einem größeren Gebäude (Häuser 18 und 22) und lassen damit einen Bezug zu diesem wahrscheinlich werden. Auffälligerweise handelt es sich in beiden Fällen um ähnliche Grundrisse, die hier als Mehrpfostenbauten bezeichnet werden. Im Falle des nordnordwestsüdsüdost ausgerichteten Hauses 21 weist auch der nebenliegende Mehrpfostenbau Haus 22 diese sonst nicht vorkommende Ausrichtung auf und bestätigt damit den gegenseitigen Bezug. Der dritte kleine Sechspfostenbau liegt am Rande der Grabungsfläche und lässt daher keine derartigen Rückschlüsse zu. Mit Flächeninhalten unter 1o m², die durch die erkennbaren Pfosten aufgespannt werden, handelte es sich wohl nicht um Wohnbauten. Sie liegen im unteren Bereich der Flächeninhalte der Achtpfostenbauten. Auch bei Berücksichtigung einer möglichen Dreischiffigkeit waren diese Häuser im Vergleich zu den im Folgenden vorzustellenden Gebäuden klein.
Die großen Sechspfostenbauten konzentrierten sich im südlichen Mittelbereich von Fläche 3. Die
Abb. 139 Die »großen« (Häuser 4, 5, 8, 9, 10) und »kleinen«
(Häuser 12, 17, 21) Sechs- bzw. Siebenpfostenstellungen
sowie eine mögliche weitere von Fläche 3.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 137
Pfostengruben wiesen Durchmesser zwischen o,3 und o,6 m auf (Abb. 14o). Die vergleichbaren Tiefen der sich jeweils gegenüber liegenden beiden Pfosten (Abb. 141) deuten vielleicht auf eine Jochkonstruktion hin, auch wenn dies aufgrund der geringeren Zahl der Pfostenpaare eines Hauses nicht so sicher wie bei den Achtpfostenbauten belegt werden kann. Im Fall von Haus 9 war an der östlichen Schmalseite mittig ein dritter Pfosten (Bef. 1323) zu beobachten. Zwar könnte dies Zufall sein, doch war auffällig, dass die beiden eindeutig zum Haus gehörenden Pfostengruben Bef. 1324 und 1359 wie auch Bef. 1323 selbst kleine Briquetagefragmente enthielten. Auch hinsichtlich der Form und der Tiefe ähnelten sich die Gruben, so dass angenommen werden muss, dass dieser Pfosten zur Konstruktion gehörte. Interessanterweise besitzt Haus 9 zudem einen breiteren Ostabschluss als die echten Sechspfostenbauten. Diese Beobachtung konnte auch bei Haus 1o
gemacht werden. Dort dürfte die westliche Schmalseite einen weiteren Pfosten besessen haben. Er gleicht hinsichtlich Aussehen und Tiefe den Eckpfosten. Beide Gebäude (Häuser 9 und 1o), die Hinweise auf eine solche Verstärkung einer Schmalseite erkennen lassen, sind die breitesten der gesamten Gebäudegruppe (Abb. 142) und weisen mit 37,33 m² und 38,43 m² die weitaus größten Flächeninhalte auf, was die getätigte Annahme bestätigt. Bei der Gruppe der Achtpfostenbauten konnte zuvor eine ähnliche Beobachtung gemacht werden. Dort wiesen ebenfalls die beiden Gebäude mit dem breitesten Joch im Osten und dem größten Flächeninhalt einen zusätzlichen Pfosten auf. Da der siebente Pfosten offensichtlich nur als Verstärkung eingebaut wurde, wenn das Spannmaß einer Schmalseite eine bestimmte Länge überschritt, dürfte er nicht charakteristisch für einen bestimmten weiteren Gebäudetyp gewesen sein. Daher werden diese
Abb. 140 Die Durchmesser der Pfostengruben der Sechspfosten-bauten, jeweils dargestellt im Verlauf der Nord- und der Süd-längsseite eines Hauses.
Abb. 141 Die Eingrabungstiefe der Pfostengruben der Sechs-pfostenbauten (Sohlenhöhe HN), jeweils dargestellt im Verlauf der Nord- und der Südlängsseite ei-nes Hauses.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
138
Gebäude unter dem Begriff »Sechspfostenbauten« subsummiert. Der siebente Pfosten könnte einen Hinweis darauf geben, dass ein Eingang zu den Gebäuden nicht durch die entsprechende Seite geführt hat, auch wenn die Pfosten wohl nicht die Außenwände der Häuser markieren, sondern eine Innenkonstruktion darstellen.
Zwei der Sechspfostenbauten (Häuser 5 und 1o) besaßen zusätzlich sich ähnelnde äußere Strukturen, die sich offensichtlich auf das Pfostengerüst bezogen und wohl Reste einer ehemals
zu dem Bauwerk gehörenden Konstruktion darstellten (Abb. 143). Am deutlichsten war dies bei Haus 1o, wo die Nordseite in einem Abstand von etwas über 2,5 m von einem gebogenen Gräbchen (Bef. 1516) begleitet wurde (Abb. 144)9. Das Wandgräbchen war maximal o,5 m breit und noch ca. 2o cm tief erhalten. In seinem Inneren waren keine Pfostenstandspuren nachweisbar. Es war an seinen Enden nach Süden bzw. Südosten umgebogen, so dass es als Teil einer Umfassung des Sechspfostengerüstes angesehen werden kann. Verfolgt
Abb. 142 Abstand der Pfosten-paare (Joche) der Sechs-
pfostenbauten.
Abb. 143 Die beiden Häuser 5 und 10 mit den gesicherten ovalen Umfassungen durch
Gräbchen bzw. Pfosten sowie mögliche Relikte ähnlicher
Konstruktionen an den Häusern 8 und 9.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 139
man den möglichen Verlauf einer solchen Umfassung rund um die zentralen sieben Pfosten, so fällt auf, dass mindestens sechs der umliegenden Pfostengruben (Bef. 1353, 1361, 1396, 1368, 1369, 1571) auf einem solchen gelegen haben könnten. Einige der Pfosten standen dort hintereinander in Reihe. Der Abstand zur südlichen Pfostenreihe des zentralen Gerüstes betrüge ca. 2,2 m. In Analogie zu anderen Ausgrabungen, insbesondere Zwenkau, Lkr. Leipzig, wo eine ganze Anzahl derartiger Gebäude in verschiedenen Erhaltungszuständen freigelegt werden konnte, handelte es sich bei Haus 1o mit Sicherheit um einen Sechspfostenbau mit ovaler Umfassung.
Vor diesem Hintergrund erklären sich die Pfostenstellungen rund um den Sechspfostenbau Haus 5 (Abb. 143). Problemlos lässt sich im Westen des zentralen Pfostengerüstes ein Teil einer bei gleichen Abständen lückenlosen ovalen Einfassung aus den Pfosten Bef. 724, 726, 728, 729, 731 und 735–738 rekonstruieren. Westlich liegen genau auf dem dadurch beschriebenen Verlauf des Ovals die Pfosten Bef. 712–714 in Reihe. Trotz der teilweisen Verschiedenartigkeit in der Ausführung der Pfosten gibt es außer ihrer Lage zueinander ein weiteres Indiz für ihre Zusammengehörigkeit. Es fällt auf, dass die Verfüllungen der inneren sechs Pfostengruben (Bef. 7o6, 7o7, 7o9, 725, 727, 749) einen überdurchschnittlich hohen Anteil an gebranntem Lehm aufwiesen. Dieser ließ sich auch in einigen der äußeren, zum Oval gehörenden Pfostengruben nachweisen (Bef. 726, 735, 737). In diesem Zusammenhang ist belanglos, ob diese Funde beim Bau der Konstruktion oder (wahrscheinlicher, da die Grube Bef. 7o6 dicht mit Funden angefüllt war) bei deren Abbruch in die Gruben gelangten. Sie weisen auf eine gleichzeitige Existenz der Strukturen hin. Mit den gleichen Argumenten können die beiden Pfostengruben Bef. 7oo und 7o8 zu dieser Baustruktur gezählt werden. Sie lagen von der gedachten ovalen Umfassung parallel etwas nach innen versetzt an der Südseite des Hauses 1o (vgl. Abb. 143). Wahrscheinlich markierten sie eine ehemalige Eingangssituation. Auch südlich vor Haus 1o, bei schlechter erhaltenen Wandpfosten, konnte mit Bef. 1356 ein nach innen versetzter »Türpfosten« nachgewiesen werden. Die Tatsache, dass die vermuteten Türöffnungen bei den Häusern 5 und 1o jeweils an der gleichen Stelle der Südseite lagen, so dass die Gebäude genau mittig zwischen zwei Innenpfosten vom im Folgenden zu rekonstruierenden Hofareal her zu betreten waren, lässt ihre Funktion als gesichert erscheinen.
Dieses Hofareal von Haus 1o war durch mehrere Gräbchenabschnitte zu fassen, die den westlichen Verlauf einer Gehöfteinfassung von ca. 3o m NordSüdAusdehnung markierten. Haus 1o lag in der nordwestlichen Ecke des Areals. Diese randliche Lage innerhalb eines Gehöftes ist für
oval eingefasste Sechspfostengerüste auch aus Zwenkau belegt (s. u.).
Interpretierend kann festgehalten werden, dass sich die Sechs (bzw. Sieben) Pfostenbauten in zwei Größenklassen unterscheiden lassen: Die kleineren sind offenbar Funktionsgebäude, die zu anderen, größeren Bauten gehörten. Zwei der größeren Sechspfostenbauten können aufgrund ihrer besonderen Ausführung »Hauptgebäude« gewesen sein. Das Konstruktionsprinzip und ehemalige Aussehen der von einem Ovalgräbchen umgebenen Pfostenstellungen kann durch Analogien in Skandinavien geklärt werden (vgl. unten). Wahrscheinlich stellten die sechs bzw. sieben Pfosten nur eine die statische Hauptlast tragende Innenkonstruktion dar und die ovalen Strukturen markieren die Lage der weniger belasteten Außenwände bzw. des heruntergezogenen Daches. Die Abstände von der Mittelachse des Hauses zu den Pfosten gleichen denen von den Pfosten zu den Außenwänden. Diese Gebäude waren daher wahrscheinlich dreischiffig trotz der zunächst nur einschiffig erscheinenden Pfostenstellungen. Die geringe Erhaltungstiefe der äußeren Strukturen lässt daran denken, dass vielleicht auch andere oder sämtliche der großen Sechspfostenbauten (Häuser 4, 8 und 9) eine derartige Konstruktion besaßen. Einige Pfosten im Umfeld dieser Bauten (Bef. 769, 773, 1326, 1331, 1333, 1334, 16o6) könnten wie bei den Häusern 5 und 1o Relikte solcher Konstruktionen gewesen sein (vgl. Abb. 143).
Mehrpfostenbauten
Zwei Pfostenstellungen unterscheiden sich deutlich von den bisher behandelten. Es sind die Häuser 18 und 22 (Abb. 145). Auffällig ist die im
Abb. 144 Das nach Süden um-gebogene Gräbchen um Haus 10.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
140
Vergleich zu den bisher vorgestellten Gebäuden größere Anzahl an Pfostengruben, einhergehend mit einem deutlich geringeren Abstand der Pfosten. Trotz gewisser Unterschiede werden sie aufgrund ihrer geringen Zahl und der Abgrenzbarkeit gegen die anderen Haustypen unter einem Typ zusammengefasst. Da die Konstruktion schwierig zu beurteilen ist, soll dieser Haustyp hier neutral Mehrpfostenbau genannt werden. Für Haus 22 können zunächst elf mit einem Durchmesser von ca. o,45–o,55 m recht große Pfostengruben gesichert in Anspruch genommen werden. Ein bzw. zwei weitere (Bef. 237, 241) könnten noch zugehörig gewesen sein. Das Gebäude war annähernd NordSüd ausgerichtet. Im nördlichen Bereich zeichnete sich deutlich eine etwa quadratische Pfostensetzung (Breiten zwischen 3,17 und 3,45 m)10 aus acht bis neun stärker eingetieften Pfosten ab11, denen südlich in etwas größerem Abstand (2,51–2,66 m) eine 3,25 m breite Reihe aus drei weiteren Pfosten vorgelagert war. Etwas nördlich des südöstlichen Eckpfostens zeichnete sich mit Bef. 237 ein leicht eingestellter Pfosten ab, der eventuell als Türpfosten interpretiert werden kann und so einen separaten Eingang zum abgesetzten Bereich des Hauses gebildet
haben könnte. Da die südliche, abgesetzte Pfostenreihe etwas geringer als diejenige des nördlichen Hauptteiles eingegraben worden ist, könnte sie eine etwas leichtere Konstruktion getragen haben. Der südliche Teil des insgesamt nur 5,8–5,95 m langen Pfostengerüstes (19,83 m²) macht den Eindruck einer »Vorhalle«. Da derartige Abstände aber, wie die großen Sechspfostenbauten zeigen, ohne Probleme überspannt werden konnten, ist diese Annahme nicht zwingend.
Die insgesamt geringeren Abstände zwischen den Pfosten deuten wahrscheinlich auf ein anderes statisches Konstruktionsprinzip des Aufgehenden hin. Die Analyse der Eingrabungstiefen der Pfosten zeigt keine deutlichen Hinweise auf eine Konstruktion aus »vorgezimmerten« Jochen wie bei den Achtpfostenbauten. Vorgreifend kann auf die Rekonstruktionen ähnlicher Pfostenstellungen in anderen Regionen hingewiesen werden, bei denen die Hauptlast des Daches durch parallel zum Dachfirst verlaufende Balken, Pfetten genannt, getragen wird (Müller 1986, 162–164). Eine derart »stabile« Konstruktion kann auf eine größere Traglast des Aufgehenden hindeuten. Die Pfettendächer vertreten ein Konstruktionsprinzip, das jenem der anderen hier vorgestellten »Sparrendächer«, bei denen die Last über die Joche quer zum First verteilt wird, gegenüber steht.
Innerhalb der besprochenen Pfostenstellung lag Bef. 241 an der Stelle eines möglichen Pfostens, der den nördlichen »Hauptteil« des Gebäudes zu einer quadratischen Neunpfostenstellung und damit das gesamte Pfostengerüst zu einem Zwölfpfostenbau ergänzen würde. Dieser Befund hatte aber die Form einer flachen Grube und könnte daher auch auf Tätigkeiten innerhalb des Gebäudes hinweisen. Häufig werden solche zentral liegenden Gruben als Herdnachweise akzeptiert. Für diese Deutung gibt es im vorliegenden Fall keine Belege, wie etwa Holzkohle, Brandspuren o. Ä.
Das OstnordostWestsüdwest ausgerichtete Haus 18 war dem Beschriebenen ähnlich. Es konnten allerdings nur die zehn Außenpfosten nachgewiesen werden (vgl. Abb. 145). Mit den Ausmaßen von 5,25–5,4 m x 2,95 m (16,73 m²) war das Pfostengerüst etwas kleiner, was sich in den
Abb. 145 Die beiden Mehrpfos-tenbauten (Häuser 18 und 22).
Abb. 146 Die sicheren Vierpfostenstellungen.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 141
geringeren Durchmessern der Pfostengruben von ca. o,3–o,35 m widerspiegelt. Es weist die für das Haus 22 als charakteristisch erkannte, mit größerem Abstand zu dem »Hauptbau« gestellte DreipfostenSchmalseite, hier nach Nordnordost, auf. Dieser Abstand ist mit knapp 2,5 m jenem von Haus 22 vergleichbar. Ebenso ist auffällig, dass auch bei Haus 18 die Pfostengruben der mit Abstand stehenden Schmalseite eine geringere Tiefe aufwiesen. Als Besonderheit stehen die Mittelpfosten beider Schmalseiten bei Haus 18 um etwa o,3 m aus der von den Eckpfosten markierten Linie nach außen hervor. Ein Mittelpfosten fehlte. Möglicherweise war er aufgrund der etwas schwächeren Dimensionierung als bei Haus 22 nicht notwendig oder er fehlte erhaltungsbedingt und das Gebäude war wie Haus 22 zweischiffig.
Die Vergleichbarkeit beider Bauten lässt sich durch ihre Stellung innerhalb einer hypothetischen Gehöftstruktur unterstreichen. In beiden Fällen lagen direkt neben dem Mehrpfostenbau jeweils ein kleiner Sechspfostenbau (Häuser 17 und 21) und weitere kleinere Nebenbauten. Die Flächeninhalte der durch die Pfosten markierten Flächen liegen mit 16,73 m² und 19,83 m² im unteren Bereich der Flächeninhalte der großen Sechspfostenbauten, die aufgrund ihrer Dimensionierung als Hauptgebäude in Frage kommen.
Vierpfostenbauten
Die Gruppe der Vierpfostenbauten ist uneinheitlich (Abb. 146). Mit Sicherheit lassen sich nur vier Grundrisse (Häuser 7, 11, 23, 24) dieser Gruppe zuordnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürften
aber noch weitere zugehörig sein, die aufgrund eines erosionsbedingt fehlenden Eckpfostens nicht mehr klar erkennbar waren. Solche Pfostenkonzentrationen lagen beispielsweise südlich der Häuser 6, 9 und 18 auf Fläche 3 sowie im Nordbereich von Fläche 2. Andererseits können regelmäßige Vierpfostenstellungen auch Teile umfangreicherer Strukturen gewesen sein.
Recht einheitlich stellten sich die Häuser 7 und 11 mit einem Pfostenabstand von ca. 1,8–1,9 m dar (Flächeninhalte 3,18 und 3,21 m²). Die Pfostengruben waren vor allem im Vergleich zu jenen der Achtpfostenbauten verhältnismäßig groß. Haus 24 weist mit ca. 2,15 m eine größere Breite bei etwas trapezförmigem Grundriss (4,34 m²) auf. Die Pfosten von Haus 23 (ca. 1,7 m x 2,6 m in NordSüdAusrichtung; 4,15 m²) standen rechteckig zueinander und könnten darauf hinweisen, dass hier ein Teil eines größeren Gebäudes dokumentiert wurde. Tatsächlich fanden sich nördlich davon weitere Pfosten, die aber nicht sinnvoll zu einem regelmäßig angelegten Gebäude zusammengestellt werden können. Die Dimension der rechteckigen Pfostenstellung entspricht genau der einer Hälfte des kleinsten der kleinen Sechspfostenbauten (Haus 12).
Weitere Pfostenstellungen
Neben diesen typisierbaren Grundrissen konnten weitere Pfostenstellungen beobachtet werden, die aufgrund ihrer regelmäßigen Anordnung ehemals Teile komplexerer Konstruktionen gewesen sein können. Das trifft besonders für mehrere sich ähnelnde Pfosten zu, die jeweils in Reihen hinter
Abb. 147 Die Doppelpfosten-stellungen Bef. 1191–1194 und 1300.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
142
einander lagen, aber keinen Hausgrundriss ergeben. Solche Reihen traten zum Beispiel im Nordteil der Fläche 2 und auf Fläche 3 östlich (Bef. 323–325) und westlich (Bef. 914, 915, 917) von Haus 3 sowie südlich von Haus 18 (Bef. 131o–1312) auf. Auffällig war das Relikt einer Konstruktion mit mehreren Doppelpfosten, die nicht sinnvoll zu einem Ganzen ergänzt werden können (Abb. 147). Die Pfostengruben Bef. 1191–1194 und 13oo ähnelten sich so stark, dass sie zusammen gehören müssen und wahrscheinlich den östlichen Abschluss einer ca. 1,7 m breiten, sich nach Westen fortsetzenden Pfostenstellung bildeten. Zwei in dieser Richtung befindliche Doppelpfostenpaare lagen aber nicht in den Verlängerungen der Seiten.
Weitere kleine Pfostengruben können auf ehemalige Standplätze typischer Achtpfostenbauten hinweisen. Recht wahrscheinlich ist eine Rekonstruktion eines solchen Gebäudes zwischen den Häusern 1 und 2 mit gleicher Ausrichtung. Zu dem Hausgrundriss wären die Pfosten Bef. 1418, 142o und 1421 zu zählen, wobei letztere als Eckpfosten die SüdwestNordostDiagonale markieren würden. Das so rekonstruierte Pfostengerüst hätte Ausmaße von ca. 1,55 m x 5,45 m und gehörte damit zu den kleineren. Das nebenliegende, gesicherte Haus 2 ist noch kleiner.
Ein annähernd WestOst ausgerichteter Sechspfostenbau ließe sich aus den Pfostengruben Bef. 1522, 1524, 1527 und 1541 vervollständigen. Er besäße die Ausmaße von ca. 5,75 m x 2,45 m. Die Pfostengruben waren allerdings im Vergleich zu jenen der großen Sechspfostenbauten gering dimensioniert.
Vergleich
Die »Wertigkeit« der herausgearbeiteten Gebäudetypen einer Siedlung lässt sich nicht nur aus der Möglichkeit der Abgrenzung gegen andere Gebäudetypen und der Regelhaftigkeit ihres Vorkommens innerhalb einer Siedlung ablesen, sondern auch im regionalen und überregionalen Vergleich. Zwar kann an dieser Stelle keine umfassende wissenschaftliche Auswertung erfolgen, doch sei auf einige Parallelen verwiesen. Der Vergleich sollte zunächst mit den Hausgrundrissen ähnlicher Zeitstellung und mit gleichen zugehörigen kulturellen Hinterlassenschaften unternommen werden. Leider ist der Forschungsstand diesbezüglich äußerst schlecht. Aus der späten Saalemündungsgruppe/Hausurnenkultur lagen bis vor kurzem keine gesicherten Hausgrundrisse vor (vgl. auch Nuglisch 1965, 69 f.). Erst im letzten Jahrzehnt wurden einige sicher datierbare spätbronze bis früheisenzeitliche Pfostenstellungen bekannt, die im weiteren Sinne der Hausurnenkultur bzw. Thüringischen Kultur zugeordnet werden können. Sie wurden im Zuge der Ausgrabungen auf der Gewerbefläche bei Queis, kreis
freie Stadt Halle, aufgedeckt. Besonders wichtig ist der Nachweis eines Achtpfostengebäudes (Matthäuser 2oo3, 87 Abb. 9,1, Haus 1, C 5). Es hatte eine Breite von ungefähr 1,8 m und eine Länge von etwa 6,1 m (Pfostenmitten gemessen). Damit liegt es genau im Durchschnitt der in Brehna ermittelten geringen Maße. Selbst die OstnordostWestsüdwestAusrichtung und die geringen Pfostentiefen entsprechen den Brehnaer Verhältnissen. Das Gebäude konnte in Queis nicht sicher datiert werden (»späte Bronzezeit«), da keine Gruben im untersuchten Bereich aufgedeckt worden waren (Matthäuser 2oo3, 87).
Jüngst wurden bei Pretzsch, Burgenlandkreis, identische Achtpfostenbauten in OstWest sowie auch NordSüdAusrichtung freigelegt12. Auch sie waren sehr schwach dimensioniert. Die Gebäude lagen in einer Siedlung der älteren vorrömischen Eisenzeit zusammen mit kleinen Sechspfosten sowie Mehrpfostenbauten. Ein weiterer, in die vorrömische Eisenzeit datierter Achtpfostenbau konnte bei Groß Garz, Lkr. Stendal, aufgedeckt werden (aus der östlichen und mittleren Pfostenreihe des ergrabenen Befundes ließ sich ein Achtpfostenbau erschließen; Fabesch u. a. 2oo4, 169 Abb. 21; 171 Abb. 23), der der kleineren Variante der von Brehna bekannten Achtpfostenbauten entsprach. In Zwenkau und Großdalzig – in einem kulturell bereits etwas anders gearteten Gebiet im südlichen Leipziger Land – traten auffallend viele Achtpfostenbauten auf (Huth/Stäuble 1998, 211 Abb. 6; 215 Abb. 8; Bartelt 2oo4, 137 Abb. 16: Bau 1 und 8). Sie waren mit ca. 7–1o m Länge und ca. 3 m Breite deutlich größer dimensioniert wie auch die Gebäude aus Heinrichsberg, Bördekreis (Reichenberger/Wohlfeil 1999, 393–396 Abb. 15), und DresdenKaitz (Stäu ble/de Vries 2oo2, 15). Zudem wies ein Grundriss aus Großdalzig einen neunten Pfosten an einer Schmalseite auf (Bartelt 2oo4, 137 Abb. 16.1).
Weiterhin wurden aus HalleQueis Sechspfostenbauten mit verschiedenen Proportionen vorgestellt. Gut mit den Brehnaer Bauten sind Häuser aus unterschiedlichen Grabungsbereichen vergleichbar. Es handelt sich um fünf Bauten der »Südfläche« (Petzschmann 2oo3, Abb. 6), einen der »Nordostfläche« (Haus 3, C 8: Matthäuser 2oo3, Abb. 9,3) und eine größere Anzahl nicht detailliert vorgestellter aus dem Bereich eines früheisenzeitlichen Grabenwerkes (Balfanz 2oo3, 8o–83). Die messbaren Pfostenstellungen der anderen Flächen besaßen Breiten von 2,2–2,8 m und Längen zwischen 3,4 m und 5,8 m. Die Bauten aus dem Bereich des Grabenwerkes wiesen Breiten von 2,5–3,o m und Längen von 3,o–3,5 m auf (Balfanz 2oo3, 81). Sie sind durchweg mit den kleinen Sechspfostenbauten aus Brehna vergleichbar. Mindestens ein Gebäude besaß einen siebenten Pfosten an der nordöstlichen Schmalseite (Balfanz 2oo3, Abb. 1o). Große Sechspfostenbauten wurden offenbar nicht
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 143
nachgewiesen. Diese Situation gleicht jener in Pretzsch, wo mindestens vier kleine Sechspfostenbauten untersucht worden sind. Wieder sind aus dem südlichen Landkreis Leipzig, aus Großdalzig, interessante Vergleiche anzuführen. Die von dort bekannten Bauten lassen sich nach dem Brehnaer Schema in kleine (Bartelt 2oo4, 137, Abb. 16,3.5.6) und große (Bartelt 2oo4, 137 Abb. 16,2.11) Sechspfostenbauten unterscheiden. In Zedau gehört der größte Teil der nachgewiesenen ebenerdigen Häuser dem Typ mit sechs Pfosten an. Die durchschnittliche Länge betrug 5,4 m, die durchschnittliche Breite 2,95 m (Horst 1985, 47). Die meisten Bauten sind daher mit dem kleinen Brehnaer Sechspfostenbau zu vergleichen. Diesem Haustyp wurde in Zedau die Bezeichnung Typ »Buch« gegeben (Horst 1985, 47), die sich inzwischen in der Literatur durchgesetzt hat, obwohl in BerlinBuch derartige Grundrisse nicht sicher belegt sind. Ähnliche Bauten, ebenfalls durchgängig mit dem kleinen Sechspfostenbau vergleichbar, liegen aus einer jungbronze und früheisenzeitlichen Siedlung bei Nitzschka, Lkr. Leipzig (v. Rauchhaupt 2oo3, 221 f. Abb. 17) sowie der bereits latènezeitlichen Siedlung von Zwenkau/Hart, Lkr. Leipzig (Quitta/Kaufmann 1995, 125; 121 Abb. 2: Häuser a, c, h, e) vor. In Süddeutschland sind sie aus einer Reihe von Siedlungen bekannt und werden vorrangig als Speichergebäude gedeutet (Müller 1986, 186 ff.).
Die besten spätbronze bis früheisenzeitlichen Parallelen für die Sechspfostenbauten mit ovaler Umfassung, also dreischiffige Häuser mit gerundeten schwächeren Außenwänden, sind, wie oben erwähnt, aus Zwenkau, Lkr. Leipzig, belegt (Huth/Stäuble 1998, 211 Abb. 6). Vor dem Hintergrund der in Brehna zweimal nachgewiesenen asymmetrisch an der Längsseite liegenden Eingangskonstruktion können auch Befunde aus Zwenkau so gedeutet werden. Im Besonderen ein sehr gut erhaltenes Gehöft weist ein völlig identisches Gebäude ebenfalls mit Eingang zum Hof hin auf (Einzelhof 1: Huth/Stäuble 1998, 213 Abb. 7). Bei genaueren Untersuchungen werden sich sicher weitere hinzustellen lassen (z. B. Einzelhof 6: Huth/Stäuble 1998, 215 Abb. 8). Auch auf der über einen Kilometer entfernt liegenden, intensiv bandkeramisch besiedelten Fläche der Grabung Zwenkau fand sich ein verblüffend ähnliches Gehöft mit Graben und ovalem Sechspfostenbau mit Eingang zum Hof (Loré 1994, 67 Abb. 64, Ostbereich; Huth/Stäuble 1998, 212). Durch die Zwenkauer Befunde wird selbst die sehr variable Bauweise bestätigt, z. T. mit einzeln eingegrabenen Pfosten, zum Teil mit Gräbchen, die auf eng stehende, dünne Pfosten hindeuten (Huth/Stäuble 1998, 211 Abb. 6). Außerdem sind als Außenwände auch Stampflehm bzw. Rasensodenwände denkbar, die üblicherweise keine archäologischen Spuren hinterlassen konnten.
Ansonsten kommen die Sechspfostenbauten mit ovaler Umfassung vor allem in nördlicher Richtung, allerdings mit vergleichsweise wenigen Nachweisen in Mittel bis Norddeutschland vor, wo sich auch die großen Sechspfostenbauten konzentrieren. Diese Bauweise wird zusammen mit weiteren Indizien als Ausdruck eines nördlichen Einflusses auf das Mittelelbe und MittelsaaleGebiet in der Spätbronzezeit gewertet (Schunke 2ooo, 1o9 Anm. 699 und 7oo, 123). Die beiden Brehnaer Belege lösen erwartungsgemäß die scheinbare Isolierung der Zwenkauer Befunde, sind jedoch bereis eisenzeitlich. Anzuschließen ist vermutlich ein weiterer, jüngst vorgelegter Befund aus Großdalzig, Lkr. Leipzig (Bartelt 2oo4, 14o Abb. 17). Allgemein dürfte diese Bauweise, nicht nur auf innere Sechspfostengerüste beschränkt, eine typisch nördliche Erscheinung sein (z. B. Draiby 1984; Schäfer 2oo2, 19 Abb. 1). Ähnliche Gebäude wurden dort seit dem Spätneolithikum angelegt (Boas 1991, 133 Abb. 23; Ethelberg 1991, 153 Abb. 19). Die aus Brehna vorliegende Bauweise kommt mindestens seit P IV vor und hielt sich beispielsweise in Dänemark bis in die Römische Kaiserzeit (zur Bauweise: Jensen 2oo3, 262). In der vorrömischen Eisenzeit bzw. frühen Kaiserzeit waren Gebäude als Nebenbauten typisch, die den Brehnaer Häusern 5 und 1o nicht nur in der Dimension und dem Sechspfostengerüst, sondern sogar dem jeweils asymmetrisch an einer Längsseite liegenden Eingang völlig gleichen. Zudem ist das zurückgesetzte Türpfostenpaar dort auffallend charakteristisch (z. B. Becker 1972, 1o Abb. 5; Kaul 1985; Kaul 1999, Abb. 4; 5; 9; Jensen 2oo3, 255 Abb. unterer Bereich; vgl. Müller 1986, 12o ff.).
Nicht unbeachtet darf bleiben, dass zwei der am detailliertesten ausgearbeiteten Hausurnen einige wahrscheinlich nicht zufällige Übereinstimmungen mit den Sechspfostenbauten aus Brehna aufweisen. Es handelt sich um die bekannten Hausurnen von Woedtke aus Pommern (Behn 1924, Taf. 12b.d) (Abb. 148 rechts). Sie stammen nicht aus dem Gebiet der Hausurnenkultur selbst, doch lassen beide ein interessantes Konstruktionsdetail sehr gut erkennen: Sie stehen auf jeweils sechs Füßchen. Damit geben sie einen Hinweis darauf, wie die »kleinen« Sechspfostenbauten ausgesehen haben könnten, denn eine der Deutungen dieser Hausurnen ist, dass es sich um Nachbildungen von Speicherbauten handeln könnte (Behn 1924; Oelmann 1929; vgl. Nuglisch 1965, 96–1oo, dort auch Zusammenfassung anderer Deutungen). Sie stellen keine Wohngebäude dar, entsprechen demnach nicht den aus Brehna vorliegenden »Haupthäusern«.
Eine Rekonstruktion der kleinen Bauten aus Brehna als Pfahlbauten ist nicht unwahrscheinlich. Hochgestellte Speicher hatten wichtige Vorteile. Einerseits verhinderten sie als Getreidebergen den Zugang für flugunfähige Schädlinge wie
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
144
Insekten und Nagetiere weitgehend (man beachte die ringförmigen Wülste an den abgebildeten Hausurnen), andererseits war das Speichergut (Getreide, Salz?) besser trocken zu halten. Wie die »Haupthäuser« ausgesehen haben könnten, zeigen die Hausurnen wahrscheinlich nicht. Unter der großen Menge an Hausurnen aus Mitteldeutschland, die meist nur wenige konstruktive Details erkennen lassen, sind einige, die das Aussehen einfacher Häuser wiedergeben könnten, so z. B. das bekannte Exemplar mit rechteckigem Grundriss aus Königsaue, Salzlandkreis (Behn 1924, Taf. 1od; 29f.; 99 f.) oder eine größere Anzahl an Urnen mit ovalem (!) Grundriss (Behn 1924, 25 ff. und Taf. 8).
Quadratische Vierpfostenbauten sind relativ unspezifisch und kommen auf zahlreichen größeren Ausgrabungen vor (vgl. Müller 1986, 115 ff.). So wurden auch aus Queis und Zwenkau/Hart derartige Hausgrundrisse mit ca. 2 m Pfostenabstand und relativ großen Pfostengruben vorgestellt (Petzschmann 2oo3, 85 Abb. 6; Quitta/Kaufmann 1995, Abb. 2). Auch aus Zedau sind diese Grundrisse belegt, dort gehörten sie zumeist eingetieften Bauten an (Horst 1985, 51–53), während einige Hausurnen eindeutig Speicherbauten auf vier Pfählen darstellen (vgl. Abb. 148 links; Behn 1924, 3o–32 und Taf. 12a).
Für die beiden Mehrpfostenbauten können derzeit nur wenige sichere Vergleiche aus der näheren Umgebung herangezogen werden. Mehrere Grundrisse aus Pretzsch, Burgenlandkreis, sind noch nicht publiziert und bedürfen noch einer detaillierten Analyse13. Daneben wurden in Gatersleben, Salzlandkreis, sehr ähnliche, etwas längere Gebäudereste aus der frühen Eisenzeit dokumentiert14. Alle anderen weisen das markante Konstruktionsdetail der vorgeschobenen Schmalseite nicht auf (z. B. Balfanz 2oo3, 81 Abb. 1o; Horst 1985, 18 Abb. 8; Quitta/Kaufmann 1995, 121–127, Abb. 2–6; Stäuble/de Vries 2oo2, 12). Dass die einzelne, vorgezogene Pfostenreihe an einer Schmalseite keine zufällige Erscheinung, sondern ein konstruktives Merkmal darstellt, wird nicht nur durch den zweifachen Beleg aus Brehna, sondern
auch durch süddeutsche Parallelen bestätigt (z. B. Winghart 1983, Haus 9, 1o, 15, 16; Engelhardt u. a. 1995, 54 Abb. 23, Haus 2). Sollte Haus 22 aus Brehna nur 11 Pfosten besessen haben, so fänden sich Parallelen in Zwenkau (Campen u. a. 1997, 53 Abb. 8) und in Pliening in Bayern (Dannheimer 1976, 166 Abb. 7, Haus 2; Müller 1986, 36; »älter als die Latènezeit«). In Zedau besaßen die Häuser 12 Pfosten, also auch sämtliche möglichen Innenpfosten, die zumindest bei Haus 18 aus Brehna nicht nachgewiesen werden konnten. Mindestens in einem Fall traten in Zedau klar die größeren Abstände einer Pfostenreihe zu einer Schmalseite hin auf (Haus 2; Horst 1985, 51 Abb. 24 und Beilagen). Dieses Haus besaß hervorspringende Mittelpfosten an der Schmalseite wie Haus 18. Es hatte einen Grundriss von etwa 7,8 m x 4,7 m und war damit etwas größer als die Brehnaer Häuser. Evtl. sind auch in Zwenkau solche Pfostengerüste nachzuweisen (z. B. Huth/Stäuble 1998, 211 Abb. 6: Einzelhof 9, südlich). Das Konstruktionsdetail der hervorspringenden Mittelpfosten wurde auch in Großdalzig, Lkr. Leipzig (Bartelt 2oo4, 137 Abb. 16,1o), beobachtet. Aus Süddeutschland wurden aus Aiterhofen, Lkr. StraubingBogen, Unterhaching, Lkr. München, und Eching, Lkr. Freising, jeweils mindestens ein solches Gebäude bekannt (Christlein/Stork 198o, 46 Abb. 2; 47 Abb. 3b; Keller 1996, Beilage 3; Winghart 1983, 66 Abb. 37; Müller 1986, 128 ff.; »urnenfelderzeitlich bis früheisenzeitlich«). Hinweise zur Datierung geben fast nur die süddeutschen Parallelen. Die ältesten dürften noch der Urnenfelderzeit angehören. Die Rekonstruktion erfolgt als Bau mit Pfettendach (Müller 1986, 162–164). Diese Bauform besitzt vermutlich in Süddeutschland ein Hauptverbreitungsgebiet, weitere kommen im nördlichen Mitteleuropa vor (Müller 1986, 167 Karte 9). Während aus MecklenburgVorpommern kürzlich ein nach P V datierter 12Pfostenbau vorgestellt wurde (Schmidt 2oo5, 71 f.), fehlen aus Skandinavien bisher offensichtlich Belege aus der späten Bronzezeit. Möglicherweise ist dies ein weiterer Hinweis auf die südliche Provenienz dieser Konstruktionsweise.
Abb. 148 Darstellungen von früheisenzeitlichen Speicher-
bauten auf vier und sechs Pfählen: die Hausurne von
Obliwitz und eine der beiden aus Woedtke in Pommern (nach
Oelmann 1929, Abb. 38).
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 145
Gehöftstrukturen
Die Gehöfte A und B
Selten lassen sich auf archäologischen Ausgrabungen Gehöfteinfassungen nachweisen und datieren. Ein solcher Fall trat auf Fläche 3 ein. Dort konnte ein Gräbchen von maximal o,3 m Breite dokumentiert werden, welches in einzelnen Abschnitten (Bef. 711, 739, 1197, 13o5, 16o2, 16o3) erhalten war und dessen Verlauf über eine größere Strecke zu verfolgen war (Abb. 149, 15o). Ergänzt bildete es die etwa 31 m lange Westseite einer trapezförmigen bis quadratischen Einfriedung
mit nordwestlicher und südwestlicher Ecke (Abb. 151). An welcher Stelle tatsächliche Öffnungen vorhanden waren und wo das Gräbchen erhaltungsbedingt nicht festgestellt werden konnte, lässt sich nicht sagen. Relativ sicher ist, dass die von den sonstigen Gruben in Form und Verfüllung abweichenden Grubenkomplexe Bef. 1339–1347 und Bef. 1374–1376 (Abb. 152, 153) ausschließlich innerhalb dieser Struktur vorkamen. Im Falle der erstgenannten Gruben (Bef. 1339, 1343), die randbetonend innen lagen (vgl. Abb. 151), war ein kleiner Ausgriff nach außen feststellbar, so dass hier eine ehemalige Öffnung angenommen
149 150
Abb. 149 Das Gehöftgräbchen nördlich von Haus 5.
Abb. 150 Der westliche Verlauf des Gehöftgräbchens bis zur Südwestecke (oben).
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
146
werden kann. Die Datierung des Gräbchens ist über zwei unabhängige Fakten möglich: Einerseits lagen in dem nördlichen Abschnitt (Bef. 16o2) zwei für die jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Inventare typische Klopfsteine. Andererseits fand sich in der nordwestlichen Ecke des eingefriedeten Bereiches ein typischer Sechspfostenbau mit ovaler Einfassung (Haus 5), vermutlich sogar mit Eingangssituation in Richtung des umgrenzten
Hofareals. Dass diese Anordnung nicht zufällig ist, verdeutlichen wiederum die vielfältigen Befunde aus Zwenkau, wo sehr gut vergleichbare Bauwerke genau in den Eckbereichen der dort allerdings meist gerundet trapezförmigen Gehöftbegrenzungen nachgewiesen sind.
Häufig lassen sich in Zwenkau neben dem Hauptgebäude kleine (Speicher) Bauten und an gegenüber liegenden Seiten innerhalb des Gehöf
Abb. 151 Das Gehöfte A (links) und B (rechts) mit quadratisch
ergänzter Einfriedung. Auffällig ist die Verteilung der runden
Speichergruben, der Herdgruben bzw. Öfen und der Briquetage-funde vorrangig außerhalb des
vermutlichen Hofareals. Die Größen der Signaturen für die Briquetagefunde ergeben sich
aus dem unterschiedlichen Gewicht (vgl. Abb. 40).
Abb. 152 Von den anderen Befunden abweichende Gruben-konzentration randlich innerhalb
des Gehöftes im Planum; am linken Bildrand das endende
Gehöftgräbchen.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 147
tes weitere kleinere, z. B. Vierpfostenbauten eindeutig einer solchen Häusergruppe zuweisen (Campen u. a. 1997, 5o Abb. 5; 53 Abb. 8; Huth/Stäuble 1998, 21o–216). Ein fast vollständiges Gehöftgräbchen allerdings ohne rekonstruierbare Gebäude wurde im nur wenige Kilometer von Brehna entfernten Serbitz, Lkr. Nordsachsen, nachgewiesen (Büttner u. a. 1999, 146; 149). Es umschloss trapezförmig ein Hofareal von maximal ca. 35 m Breite. Im Fall von Haus 5 läge, ergänzt man die Gehöfteinfassung annähernd
quadratisch, der Vierpfostenbau Haus 7 an der Gegenseite des Gehöftes, womit dieser Brehnaer Komplex den Zwenkauer Beispielen sehr ähneln würde. Auffallend wenige Befunde befänden sich innerhalb des eingezäunten Areals mit ca. 115o m² Fläche, vor allem keine der typischen Gruppierungen von runden Speichergruben. Solche lägen südöstlich, westlich und vor allem nördlich knapp außerhalb des angenommenen Hofareals. Mehrere Ofengruben (Bef. 62o, 622, 624, 625, 635, 734, 1126) würden, teilweise wohl die Abgrenzung
Abb. 153 Die Konzentration aus ineinander übergehenden muldenförmigen Gruben mit kiesiger Verfüllung im Profil.
Abb. 154 Der Grabungsbefund von Raestrup, Kr. Wahrendorf, im Münsterland lässt ein ähn-liches Gehöft erschließen.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
148
begleitend, genau außerhalb des Areals liegen. Diese Gehöftrekonstruktion unterstreichend steht neben dem zweiten Sechspfostenbau mit Ovalumfassung (Haus 1o) in gleicher Entfernung und gleicher Himmelsrichtung der zweite, sehr ähnliche Vierpfostenbau (Haus 11).
Die übereinstimmenden Korrelationen Haus 5 – Haus 7 (Gehöft A) und Haus 1o – Haus 11 (Gehöft B) sind sicher nicht zufällig. Sie deuten darauf hin, dass hier gleichzeitig oder nacheinander vergleichbare, in gewissem Rahmen normiert wirkende Siedlungsstrukturen vorhanden waren. Der Hintergrund für deren Entstehung kann ganz profan der Wiederaufbau einer gewohnten Struktur nach Verfall/Zerstörung der ersten gewesen sein. Ein spätbronzezeitliches und in seinem äußeren Erscheinungsbild sehr ähnliches Gehöft von 35 m x 27 m Größe mit Speicherbau in einer Ecke und einem allerdings deutlich größeren Langhaus wurde in Raestrup, Lkr. Warendorf, entdeckt (Rettungsgrabungen 1979, 118 f.). Der Rekonstruktionsversuch vermittelt einen Eindruck da rüber, wie auch die Brehnaer Gehöfte ausgesehen haben könnten (Abb. 154).
Diese Beobachtungen geben Anlass, um Haus 1o eine hypothetische, ähnlich große Einfriedung wie bei Gehöft A zu rekonstruieren. Bei leichter Drehung der Gehöfteinfriedung gegen den Uhrzeigersinn, entsprechend der ebenso abweichen
den Ausrichtung des »Haupthauses« 1o und der Achse Haus 1o – Speicher 11, ergibt sich eine verblüffende Konstellation. Innerhalb des hypothetischen Gehöftareals B liegen noch weniger Siedlungsbefunde, vor allem keine Speichergruben und nur eine mögliche Ofengrube (Bef. 1589). Eine Grubenkonzentration (Bef. 1136, 1154, 1155, 1555, 162o) befände sich außerhalb vor der Südostecke des Gehöftareals wie bei Haus 5. Ofengruben und Öfen kämen außerhalb der Südostecke (Bef. 1123, 1137, 1138) und als ganze Batterie außerhalb der Nordostecke (Bef. 792, 794–796, 941, 943, 977, 978) und entlang der Westseite (Bef. 1363, 15o1, 15o2, 15o6, 15o7) vor. Es muss in Betracht gezogen werden, dass das auf uns gekommene Bild durch die Siedlungstätigkeit mehrerer Generationen mit wahrscheinlich auch mehreren »Hausgenerationen« entstanden ist. Ein Beleg für die gleiche innewohnende Struktur ist die Verteilung der Gruben außerhalb der Gehöfteinfassungen genau an der Seite der jeweiligen Haupthäuser (Abb. 151). Ein identisches Bild zeigt auch das ansonsten sehr ähnliche, jedoch nach Ha A2/B1 zu datierende Gehöft aus Zwenkau, Lkr. Leipzig (Schunke 2ooo, 93 und 119).
Noch weniger beweisbar ist die Zuordnung der Achtpfostenbauten zu bestimmten »großen« Sechspfostenbauten, trotzdem soll eine Beobachtung nicht verschwiegen werden: Es dürfte sicher
Abb. 155 Gehöft A (grün) und Gehöft B (blau) mit gleich groß
rekonstruiertem Hofareal. Neben der sicheren Beziehung der
»Haupthäuser« zu den jeweils östlich davon liegenden Vier-
pfostenbauten fällt die Möglich-keit einer Zuordnung der Acht- und der kleinen Sechspfosten-
bauten mit gleichen Richtungen und auch gleichen Abständen
(ca. 150 m) zu den »Haupt-häusern« auf.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 149
sein, dass die sehr schmalen und quasi in Leichtbauweise aufgeführten Achtpfostenbauten keine Wohnbauten, sondern Speicher oder Werkgebäude darstellten. Es kann durchaus ein zufällig entstandenes Bild sein (Abb. 155), dass von der Mitte des Hauses 5 (»Haupthaus« Gehöft A) die Achtpfostenhäuser 1 und 2 in westnordwestlicher Richtung in ca. 15o m Entfernung und ein Acht sowie ein kleines Sechspfostenhaus (Häuser 12 und 13) in südsüdöstlicher Richtung ebenfalls in ca. 15o m Entfernung standen. Bemerkenswerterweise finden sich in denselben Richtungen und Entfernungen von der Mitte des Hauses 1o (»Haupthaus« Gehöft B) gesehen ein Achtpfostenhaus in westnordwestlicher (Haus 3) und ein Acht sowie wiederum ein kleines Sechspfostenhaus (Häuser 16 und 17) in südsüdöstlicher Richtung. Die unbekannten Hausbefunde der umliegenden, nicht ausgegrabenen Flächen verhindern eine weitergehende Klärung der Ursachen für dieses Bild, so dass Zufall letztlich nicht ausgeschlossen werden kann. Interessant ist die Beobachtung, dass die Achtpfostenbauten in Zwenkau ebenfalls häufig außerhalb der Gehöfte und vermutlich mit ähnlich großen Abständen zu diesen vereinzelt lagen. Die großen Abstände der Gebäude zueinander könnten in Vorsichtsmaßnahmen begründet liegen. So konnten bislang keine eingetieften Salzsiede oder Trocknungsöfen festgestellt werden. Da sie vorhanden gewesen sein müssen, ist davon auszugehen, dass sie offen und frei standen. Wegen der Feuergefahr wurden sie wahrscheinlich nicht direkt neben den Wohnhäusern betrieben, sondern die zugehörigen Wirtschaftsbereiche dürften in einem gewissen Abstand dazu gelegen haben. Die Achtpfostenhäuser könnten als Wirtschaftsbauten die Lage solcher Areale verdeutlichen.
Befestigte Höfe/»Herrenhöfe«
Das Gehöft A mit den Resten einer wohl trapezförmigen bis quadratischen Einfriedung stellt in dieser Form den ersten Nachweis für das MittelelbeSaaleGebiet dar. Bereits bei den ersten Nachweisen der etwas gerundeteren Gehöfteinfassungen aus Zwenkau wurden Parallelen zu den so genannten »Herrenhöfen« bzw. ihren gehöftartigen urnenfelderzeitlichen Vorgängern Süddeutschlands gezogen (Huth/Stäuble 1998, 212 f.), die seit einiger Zeit intensiv diskutiert werden. Diese Gehöfte weisen eine mehr oder weniger quadratische Befestigung auf (vgl. Reichenberger 1994; Schauer 2oo4, 166 ff.). Allerdings sind die bisher angeführten Beispiele sehr unterschiedlich und auch zaunartige quadratische Einfriedungen wie jene aus Brehna wurden unter dem Hilfsbegriff »Herrenhöfe« subsumiert. Die Größen der »Herrenhöfe« differieren stark. Sie liegen in Bereichen von 122o m² bis über 1o ooo m² (Reichenberger 1994, 211). Das Gehöft A mit etwa 115o m² Fläche
steht damit am untersten Bereich dieser Ausmaße, die Zwenkauer sind etwas größer (Huth/Stäuble 1998, 212). Es ähnelt jenen von StraubingÖberau, kreisfreie Stadt (Reichenberger 1994, 2o4 Abb. 11; Schauer 2oo4, 172 Abb. 69) und Enkering in Oberbayern (Schaich/Rieder 1998, 49 Abb. 34). Ein besonders gut vergleichbares Gehöft der Brehnaer Größe, auch mit Sechs und Vierpfostenbauten, wurde kürzlich aus Velburg in der Oberpfalz vorgestellt (Raßhofer 2oo2, 51 Abb. 44).
Wie bereits angesprochen, lässt sich der Typ der Brehnaer Haupthäuser aus nördlicher bzw. nordwestlicher Richtung herleiten. Ob die Idee der Abgrenzung eines Hofes durch Zäune oder Gäben und Wälle aus dem süddeutschen Bereich nach Mitteldeutschland gelangt ist, lässt sich nicht feststellen, da dies eine nahe liegende und in vielen Zeiten praktizierte Idee war. Auffällig ist die ähnliche Zeitstellung, denn derartige Gehöfte sind bisher frühestens ab Ha A2/B1 bzw. Ha B in Mitteldeutschland nachgewiesen (Schunke 2ooo, 1o8 f.) und die vielfältigen Kontakte in den hallstättischen Bereich lassen sich nicht leugnen.
Besonderes Interesse verdient aber die Diskussion, die um die als Ausdruck der fortschreitenden sozialen Differenzierung der Bevölkerung gewerteten »Herrenhöfe« und ihre Vorgängergehöfte geführt wird. Die »Herrenhöfe« werden »als umwehrte, lokale Zentren außerhalb der Großsiedlungen« gesehen, die »den Anspruch ihrer Gründer auf Machtdarstellung und Repräsentationsbedürfnis« widerspiegeln (Schauer 2oo4, 166). Die Funde und Befunde aus Brehna lassen eine solche Differenzierung nicht deutlich erkennen. Die Verteilung der Funde zeigt nur in Bezug auf die Briquetage und die Feuerböcke eine Bindung an die Gehöftstruktur. Da aber die beiden nachgewiesenen Gehöfte eher nacheinander als gleichzeitig existierten, bezeichnen diese Funde nur die Wirtschaftsareale des jeweiligen Gehöftes. Zeitgleiche Wohnbauten außerhalb des Gehöftes können natürlich existiert haben, sind jedoch nicht zu belegen. Nur die graphitierte Tasse und die Reste Billendorfer Gefäße ragen aus dem üblichen Keramikspektrum der Nordfläche he raus. Erstere kam in einem Speicherareal deutlich außerhalb der Gehöftstrukturen zum Vorschein, letztere gehäuft in der ebenfalls abseits gelegenen großen Lehmentnahmegrube. Die gewöhnliche Keramik bzw. die Knochengeräte, die Siebgefäßreste, die Mahl, Reibe bzw. Klopfsteine und die Spinnwirtel sind ohne erkennbare Differenzierung über die Flächen verteilt. Nur südlich der Gehöfte A und B kamen einige besondere Funde zutage. Doch lagen gerade die Grube Bef. 12o mit Resten von Importkeramik und einer Bronzenadel sowie die Grube mit dem Glasring in einem Areal, welches vermutlich in keinem Bezug zu den Gehöften A und B, wahrscheinlich auch nicht zu Gehöft C stand und aufgrund der ausschnitthaften
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
150
Grabungsfläche keiner weiteren Gehöftstruktur zugeordnet werden kann. Sie zeigen aber schlaglichtartig, dass zumindest punktuell höherwertige Gefäße nicht nur als besondere Einzelstücke, sondern durchaus in mehreren Exemplaren innerhalb eines Haushaltes existierten. Auf die vollständigen, noch gebrauchsfähigen Schmuckstücke (Nadel und HallstattGlasring) wurde letztendlich verzichtet, nachdem sie wohl verloren gingen und nicht mit größtem Aufwand gesucht wurden; das zeugt davon, dass sie innerhalb dieses Haushaltes wohl nicht singulär gewesen sein dürften. Darauf deutet bereits der Umstand hin, dass sie überhaupt verloren gingen. Das zeitliche Verhältnis dieser
besonderen Stücke zu den Gehöften ist ohne eine detaillierte Analyse des gesamten Keramikmaterials nicht sicher zu klären. Tendenziell könnten die Gehöfte A und B etwas älter sein.
So können die Brehnaer Gehöfte vorläufig nicht als Beleg für eine soziale Differenzierung gewertet werden, der über die üblichen Indizien hinausgeht. Vielleicht führten die Rahmenbedingungen der Produktionsweisen (Umgang mit offenem Feuer, Zugang zu Holz) zu der günstigeren Bewirtschaftung der Landschaft in Einzelhöfen und eine Differenzierung vollzog sich als Resultat von Ertrag und wirtschaftlich bedingter Besiedlung in Gehöftgruppen. Diese Entwicklung führte in
Abb. 156 Lage der Gehöfte innerhalb des Grabungsareals.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 151
Mitteldeutschland jedoch vermutlich zu keiner ausgeprägten Differenzierung – außer vielleicht im Bereich von Halle –, wie das weitgehende Fehlen wirklich reicher Gräber und auch der echten »Herrenhöfe« belegt. In Brehna mündete die Entwicklung im untersuchten Bereich in die Anlage eines oder mehrerer recht einfacher weiterer Gehöfte (Gehöfte C und D).
Das früheisenzeitliche Gehöft C
Neben den beiden Gehöftstrukturen A und B mit den »Haupthäusern« 5 und 1o lassen sich weitere gehöftartige Ansammlungen von Hausgrundrissen feststellen (Abb. 156). Im besonderen Maße trifft dies für die Gebäudegruppe Häuser 21 bis 24 auf Fläche 2 zu. Durch ihre scheinbar isolierte Lage können diese Gebäude als zusammengehörig angesehen werden, zumal ein größerer Bau (Haus 22), vielleicht als »Hauptgebäude« von drei kleineren »Nebengebäuden« begleitet wird (Abb. 157). Daher kann diese Gebäudegruppe als Gehöft oder kleinerer Weiler (Gehöft C) interpretiert werden, der von einer Familie bewirtschaftet wurde und aus Wohnhaus, Wirtschaftsgebäuden und Spei
chern bestand, mit denen eine größere Anzahl von Vorratsgruben vergesellschaftet war. Das als Hauptgebäude interpretierte Haus 22 maß in seiner Längsausdehnung etwa 6 m und war etwa 3,29 m breit. Wenn auch deutlich kleiner als die Grundrisse zweischiffiger hallstattzeitlicher Ge bäude mit vorgelagerten Pfosten der Siedlung Kelheim »Kanal I«, Lkr. Kelheim, so folgt das Gebäude doch in Ausrichtung (NordSüd) und Konstruktionsprinzip diesen (vgl. Müller 1996, 14o ff.; 143 Abb. 8; Häuser 47 und 7). Auffällig war, dass das im nördlichen Teil zweischiffige, NordSüd ausgerichtete Mehrpfostenhaus im Gegensatz zu allen anderen dokumentierten Bauten nochmals eine Längsteilung aufwies. Eine sichere Rekonstruktion des Gebäudes kann nicht erfolgen, vorstellbar ist ein massiver nördlicher Bau von etwa 11,o m², dem ein südlicher Anbau von ca. 8,8 m² vorgelagert war (Grundfläche gesamt 19,8 m²) (Abb. 158).
Etwas westsüdwestlich vor Haus 22 befand sich ein ca. 8,99 m² großer, NordnordostSüdsüdwest ausgerichteter, »kleiner« Sechspfostenbau (Haus 21), der als Wirtschaftsbau angesehen werden kann. Sicher zum Gehöft gehörten die
Haus 24
Haus 21
Haus 22
Haus 23
0 10 m N
Abb. 157 Gebäudegruppe Gehöft C auf Fläche 2.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
152
beiden Vierpostenbauten (Haus 23 und Haus 24), die als Speicher interpretiert werden können. Haus 23 lag neben dem vermutlichen Wohnhaus, diesem östlich vorgelagert, und war wie Haus 22 gefluchtet. Seine rechteckige Grundfläche betrug 4,15 m². Etwa 13,5 m nordöstlich dieser Dreiergruppe stand der zweite als Speicher anzusehende, etwa quadratische Vierpfostenbau (Haus 24), der eine Grundfläche von 4,34 m² besaß.
Die Zusammengehörigkeit dieser Bauten wird durch ein interessantes Detail der Fundverbreitung bestätigt. Acht Siedlungsgruben rund um diese Gebäude weisen mit 16 Randscherben von zehn verschiedenen Gefäßen einen vergleichswei se
hohen Anteil an Gefäßfragmenten mit getupften Rändern auf. Solche Ränder kommen auf der gesamten Grabungsfläche nur weit verstreut als Einzelstücke vor. Diese Randzier ist üblicherweise feinchronologisch nicht aussagekräftig, jedoch tendenziell jünger als der Großteil der vorliegenden Keramik. Doch lagen in der Nähe dieses Gehöftes außerdem die beiden einzigen Siedlungsgruben, die ebenfalls nach Ha D datierbares Fundmaterial erbracht haben: einerseits mit der Scherbe eines schwärzlichen tassenartigen Gefäßes in »Nienburger Art« mit typischer Sparren und Punktverzierung (Bef. 279; Abb. 12.1o) und andererseits mit einem Glasring (Bef. 277; Abb.
Abb. 158 Schematische Rekons-truktion von Haupt- und zwei
Nebengebäuden des Gehöftes C.
159 160
Abb. 159 Früheisenzeitliche Siedlungsbestattung im Bereich des Gehöftes C
(Bef. 225/ Planum 2).
Abb. 160 Bestattung (Bef. 225) im Detail.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 153
65.5; 68; 165), so dass dieses Areal tendenziell später besiedelt gewesen sein dürfte als die Gehöftbereiche A und B.
Interessanterweise war im westlichen, nordöstlichen, östlichen und südöstlichen Bereich des Gehöftes auf Fläche 2 eine Konzentration von Siedlungsgruben zu beobachten, die teilweise Reste von organischen Einbauten enthielten (Bef. 277 und 282; Abb. 161–164) und vermutlich ehemalige Vorratsgruben darstellen. Hingegen konnten nördlich und nordöstlich des »Wohnhauses« keine Gruben aufgedeckt werden und südlich bzw. südwestlich von »Wohn und Wirtschaftsgebäude« traten nur wenige Siedlungsgruben auf. Vermutlich lassen sich hier Areale unterschiedlicher Wirtschaftstätigkeit fassen.
Östlich der Gebäudegruppe befanden sich einige Gruben (Bef. 144, 225, 261 und 1231), die in Tiefe und Form im Planum sowie im Profil annähernd übereinstimmten und mit Bef. 83o und 834 im westlichen Teil des Gehöfts korrespondierten. Mehrheitlich wiesen diese Gruben eine runde Form im Planum auf und hatten im Profil eine Kastenform. Die beobachteten Tiefen lagen zwischen o,48 und o,72 m, womit sie deutlich tiefer angelegt waren als die Grubengruppe, die das Gehöft westlich, südlich sowie östlich im Halbkreis umschloss (Bef. 831, 824, 227, 226 und 142; etwas weiter entfernt 818 und 144). Auch hier konnte eine große Übereinstimmung in der Grundrissform und Profilausbildung sowie in der Tiefe festgestellt werden. Diese Gruben waren deutlich flacher. Eine Interpretation der gebäudenahen tiefen Gruben als Speicher, also Vorratsgruben, ist wahrscheinlich. Eine solche Speichergrube ca. 6o m nördlich des Gehöftes zeigte die Reste einer organischen Auskleidung (Abb. 161–163), möglicherweise mittels eines Rutengeflechts. Über die Primärnutzung der flacheren gebäudeferneren Gruben kann keine Aussage gemacht werden.
Ein besonderer Befund innerhalb einer Siedlungsgrube (Bef. 225) konnte etwa auf halber Strecke zwischen Haus 22 und 24 dokumentiert werden. Auf der Sohle der Grube lag eine menschliche Bestattung in Rückenlage mit extrem angehockten Unterschenkeln (Abb. 159; 16o). Die Person war äußerst rabiat in die Grube »gelegt« worden, indem man diese im südöstlichen Teil etwas erweitert hatte, um die Beine mit Gewalt in diese Höhlung zu schieben. Wie das geborgene Fundmaterial belegt, wurde die Grube danach zur »Abfallentsorgung« genutzt bzw. mit umliegendem Material aus der Siedlungsschicht verfüllt. Dass die Bestattung zeitlich in die Existenzzeit des Gehöftes fällt, unterstreicht das Fundmaterial, welches aus Fragmenten gröberer Siedlungsware mit den erwähnten Fingertupfen auf Rand und Wandung besteht. Da sich Stücke mit Fingertupfenzier auf dem Rand auf den Bereich des Gehöftes konzentrieren, kann man mit relativer Sicher
heit von einer Gleichzeitigkeit von Gehöft und Bestattung ausgehen. Warum der Tote in unmittelbarer Nähe zum Haupthaus im Hofbereich bestattet wurde, lässt sich archäologisch nicht erschließen. Da am Skelett weder pathologische Auffälligkeiten noch postmortale Schäden zu beobachten waren, muss die Bestattung als im weiteren Sinne »regulär« angesehen werden. Derartige Siedlungsbestattungen stellen eine in der späten Bronze und vor allem der frühen Eisenzeit regelhaft ausgeübte Bestattungsart dar (Balfanz/Jarecki 2oo4). Der Grund für den angewandten Bestattungsritus muss hierbei in der Gedankenwelt und den Vorstellungen der Zeit gesucht werden15. Eine Deutung als Wiedergängerbestattung kann aber aufgrund der Nähe zur Hofanlage ausgeschlossen werden. Da der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tode bei fast allen Ethnien vor
Abb. 161 Siedlungsgrube (Bef. 282/Planum 2) mit organischem Einbau, der sich als dunkler Saum zu erkennen gibt.
Abb. 162 Teilplanum und Teilprofil von Bef. 282.
162
161
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
154
handen ist, wird der Tod nur ausnahmsweise als natürliches Hinscheiden aufgefasst. Der Verstorbene gehört weiterhin seiner »Gruppe« an, hat aber den Übergangsritus »Tod« mitgemacht und wird im Normalfall rigoros meist räumlich von den Lebenden geschieden. Somit stellt der enge räumliche Bezug der hier beobachteten Bestattung ein Phänomen dar, welches archäologisch nur schwer zu enträtseln ist.
Die Inventare der Siedlungsgruben, die den Häusern 21–24 nicht nur räumlich, sondern auch chronologisch zugeordnet werden können, geben Anhaltspunkte zur Wirtschaftsweise der Bewohner. Hervorzuheben ist, dass die wenigen Fragmente von Säulenbriquetage und Briquetagetiegeln, die im Umkreis des Gehöftes C geborgen wurden, aus den Inventaren der westlichen Gruben stammen (Bef. 824, 83o und 834). Dadurch ist, sollten es keine verlagerten Funde sein, auch
für die jüngste Phase der eisenzeitlichen Siedlung indirekt die Salzsiederei belegt.
Klopf bzw. Reibesteine sowie Geweihspitzen können als multifunktionale Werkzeuge angesehen werden und stammen ausschließlich aus dem östlichen Bereich der Gehöftanlage (Bef. 225 und 259, etwas außerhalb 223). Die Geweihspitze aus Bef. 143 bestand aus einer großen Sprosse. Das vordere, spitze Ende ist stark abgearbeitet und glatt, das hintere Ende weist einen groben Bruch auf (vgl. Abb. 51). In welcher Form die Spitze genutzt wurde, konnte nicht erschlossen werden, da verschiedene Einsatzbereiche denkbar sind, beispielsweise als »Grabstock« oder Flechthilfe. Mit dem Spinnwirtelfragment aus Bef. 831 und dem Spinnwirtel aus Bef. 1231 konnte eine häusliche Textilverarbeitung nachgewiesen werden (vgl. Abb. 24).
Dem Hauptgebäude nördlich vorgelagert (ca. 6 m Abstand) wurden zwei Befunde (259 und 26o) beobachtet, die sich durch eine stärkere Steinkonzentration hervorhoben. Bef. 259 zeichnete sich klar als rechteckige, 1,1o m x o,76 m große, einlagige Steinpackung ab, die aus zerfeuerten Steinen bestand und mit Holzkohle und Holzkohleflitter durchmischt war. Eine Ansprache als Freiluftherd oder Ofen ist wahrscheinlich. Der Befund weist große Ähnlichkeit zu den rechteckigen, früheisenzeitlichen »Ofenanlagen« auf, die im gesamten Grabungsareal aufgedeckt werden konnten, auch wenn sich hier keine Spuren angeziegelten Lehms an der Außenwandung fanden. Unmittelbar benachbart lag Bef. 26o, der nur bedingt als Ofen anzusprechen ist, da er weniger gut erhalten war.
In ihrer Anlage und Ausrichtung ähnlich waren die Öfen 3o–4o m nördlich des Gehöftes (Bef. 266, 271, 278, 279, 6o2 und 1222). Bei den Anlagen heben sich die Bef. 266, 6o2 und 1222 durch eine angeziegelte Wandung ab, die aus dem anstehenden Lehm bestand. Der Ofen Bef. 6o2 konnte nur in Resten dokumentiert werden, da er von einer Grube gestört wurde, die neben früheisenzeitlichen Fragmenten von Siedlungsware einen Hundeschädel enthielt. Der Aufbau dürfte jenem der anderen Anlagen geglichen haben.
Vom Haupthaus etwa 41 m in westsüdwestlicher Richtung entfernt liegend zeichnete sich eine orangerote Konzentration verziegelten Lehms (Bef. 168) von ca. 1,17 m Durchmesser ab (in Planum 2: 1,1o m x o,95 m), die von einem stärker humosen Bereich umschlossen war. Nach Anlage eines Kreuzprofiles war deutlich ein muldenförmiger, ca. o,12 m unter Planum 1 reichender Bereich großer Hitzeeinwirkung zu erkennen, der aus angeziegeltem anstehendem Lehm bestand und der z. T. mit Brocken gebrannten Lehms durchmischt war sowie Keramikfragmente enthielt. Da dieser Befund keine Ähnlichkeit zu den rechteckigen »Ofenanlagen« aufwies, kann hier eine andere technische Nutzung angenommen werden. Denkbar wäre, dass es sich um den
Abb. 163 Siedlungsgrube (Bef. 282/Planum 3) mit
organischem Einbau.
Abb. 164 Grube (Bef. 277) aus der Umgebung des
Gehöftes C. Auf der verziegel- ten Sohle liegt ein Glasring.
163
164
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 155
Unterbau eines Keramikbrennofens oder Backofens gehandelt hat, durch die damit verbundene Brandgefahr würde sich der größere Abstand zum Gehöft erklären. Da auch das hier geborgene Keramikinventar Randtupfen zeigte, könnte dieser Befund dem Gehöft zugeordnet werden.
Das Gehöft C zeigt mit seinem anders gearteten Haupthaus und den abweichenden Ausrichtungen
– bei Richtigkeit der angenommenen chronologischen Tendenz – einen Wandel der Siedlungsstruktur innerhalb der früheisenzeitlichen Siedlungsphase an. Warum sich Gehöftaufbau und Raumordnung änderten, konnte im Rahmen der Grabung nicht geklärt werden. Das hierin liegende Potenzial für eine Feingliederung der Keramik und die Chronologie der Baustrukturen bedarf einer weitergehenden, tiefgründigeren Untersuchung. Die Änderung vollzog sich wahrscheinlich von den durch eine etwa trapezförmige Einfriedung gekennzeichneten Gehöften A und B, deren dreischiffige Hauptgebäude (große Sechspfostenbauten) eine Ovalumfassung aufwiesen und die durch eine lockere Bebauung des Gehöftareals auffielen, zu einer engen Bebauung mit Hauptgebäude (Mehrpfostenbau) und mehreren Nebengebäuden (Gehöft C). Eine Einfriedung konnte hier nicht nachgewiesen werden. Es zeichnet sich ab, dass mit dieser Änderung auch eine andere Raumnutzung praktiziert wurde, da bei den älteren Gehöftanlagen auf Fläche 3 keine bzw. nur wenige Siedlungsgruben im Umfeld des Hauptgebäudes aufgedeckt werden konnten. Die Gehöftgruppe C folgte einem anderen Raumnutzungsprinzip, da hier eine größere Anzahl von Siedlungsgruben in unmittelbarer Nähe zum Haupthaus und den Nebengebäuden beobachtet werden konnte16.
Gehöft D
In Analogie könnte das dem Haus 22 ähnelnde Mehrpfostengebäude Haus 18 ebenso den Kern einer Gebäudegruppe gebildet haben (Abb. 166). Auch hier liegt direkt neben diesem Bau ein kleiner Sechspfostenbau. Weitere kleine Gebäude, die sich aufgrund von fehlenden Pfosten nicht eindeutig rekonstruieren lassen, deuten sich beispielsweise durch Pfostenkonzentrationen südlich von Haus 18 an.
Die großen Sechspfostenbauten Häuser 4, 8 und 9 kämen ebenfalls als Haupthäuser in Frage. Sie liegen im Bereich der wohl gesicherten Haupthäuser 5 und 1o. Vor allem die beiden Häuser 8 und 9, für die die ehemalige Existenz einer ovalen Umfassung nicht ausgeschlossen werden kann (s. o.), könnten ebenfalls Zentrum einer Gehöftgruppe gewesen sein. Leider liegen sie dicht an der östlichen Ausgrabungsgrenze, so dass keine Beobachtungen über vermeintlich zugehörige Strukturen wie beispielsweise Vierpfostenbauten möglich sind.
Jungbronzezeitliche Gehöftstrukturen?
Die beschriebenen Gehöftstrukturen außer um Haus 18 sind aufgrund der Verteilung der datierbaren Siedlungsgruben eindeutig in die Jüngstbronze bis Früheisenzeit, im Falle des Gehöftes um Haus 22 klar in die Früheisenzeit zu stellen. Das wirft die Frage nach den Siedlungsstrukturen der Jungbronzezeit auf, aus der ebenfalls ein deutlicher Fundniederschlag auf uns gekommen ist. Die Verteilung der jungbronzezeitlich datierten Gruben ergibt ein recht klares Bild17.
Problemlos lassen sich drei Konzentrationen von Gruben sowie einige kleine Häufungen aufgrund fundleerer Zwischenräume gegeneinander abgrenzen (vgl. Abb. 1). Eine sehr lockere Konzentration von über 11o m Durchmesser lag im mittleren und nördlichen Bereich der Fläche 3 mit einem Schwerpunkt im Bereich der Gruben Bef. 524/525. Eine weitere lag um das Haus 18 herum (vgl. Abb. 166) und weiter nach Norden reichend. Die in der Grabungsfläche erkennbare Ausdehnung beträgt ca. 65 m, jedoch liegt diese Häufung direkt in der Ecke der östlichen und der südlichen Grabungsgrenzen. Die gesamte Ausdehnung ist mit Sicherheit nicht erfasst. In dem nach Süden ablaufenden Kabelgraben konnten beispielsweise zwei weitere Gruben dieser Zeitstellung beobachtet werden (Abb. 1 und 156), deren südlichste zur nördlichsten Grube der entsprechenden Häufung auf Fläche 3 einen Abstand von ca. 14o m aufweist. Die dritte Konzentration von unter 4o m Durchmesser lag in Fläche 2 nordnordöstlich des Gehöftes C. In Entsprechung zu den anderen Häufungen könnten auch die Gruben Bef. 16o und 169 westlich der Häuser zugehörig sein, womit die Ausdehnung über 11o m betragen würde. Auch hier sind die Grenzen aufgrund des Trassencharakters von Fläche 2 nicht sicher bestimmbar. Bemerkenswert ist jedoch das von jungbronze zeitlichen Funden völlig freie Areal im Nordteil der Fläche 2, so dass sich ein Abstand von etwa 23o m zu den nächsten jungbronzezeitlichen Gruben auf Fläche 3 erkennen lässt.
Es dürfte sich in der Verbreitung der jungbronzezeitlichen Funde eher eine ehemals vorhandene Gehöft als eine dorfartige Struktur widerspiegeln. Die Frage nach möglichen, zu diesen Häufungen gehörenden Hausgrundrissen lässt sich nicht
Abb. 165 Die Detailaufnahme Planum 2 der Grube Bef. 277 zeigt den hellblauen Glasring in Fundlage.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
156
sicher beantworten. Oben wurde gezeigt, dass die meisten dieser Strukturen sicher jünger sind. Lediglich das mögliche »Haupthaus« 18 könnte aufgrund der Grubenverteilung (vgl. Abb. 166) dieser Zeit angehören. Doch ist die Zeitstellung des typologisch verwandten »Haupthauses« des Südgehöftes, des Mehrpfostenbaus 22, aufgrund der direkt umliegenden Gruben mit getupften Rändern mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert, auch wenn sich die südliche Konzentration jungbronzezeitlicher Gruben ebenfalls in der Nähe befindet. Somit lässt sich kein Hausgrundriss mit Sicherheit dem jungbronzezeitlichen Fundniederschlag zuordnen. Da Pfostenbauten in Brehna, wie die eisenzeitlichen Grundrisse belegen, im Gegensatz zu vielen anderen Ausgrabungen prinzipiell nachweisbar waren, muss in Betracht gezogen werden, dass in der Jungbronzezeit keine Häuser mit tiefer eingegrabenen Pfosten gebaut wurden. Das würde dem Bild entsprechen, welches aus der zeitgleichen benachbarten und – wie anhand der Keramik gezeigt werden konnte – »kulturell« verwandten Lausitzer Kultur bekannt ist. Es gibt wenige Belege für diese kaum nachweisbaren Häuser (Ericson 1999, 124–126; Wirtz 2ooo, 8o–82). Für die ältere Saalemündungsgruppe, der das Brehnaer Material zugeordnet wurde, liegen bisher ebenfalls noch keine gesicherten Hausgrundrisse vor, jedoch lässt hier der schlechte Forschungsstand keine abschließenden Aussagen zu.
Das »Haus eines Salzsieders«?
Bei der Analyse der Briquetagefunde war die These aufgestellt worden, dass die Verbreitung insbesondere der Tiegelreste den Ort der bewuss
ten Zerschlagung und damit eine Nähe zu den Produktionsstätten anzeigen könnte. Insgesamt sind einige Bereiche festzustellen, in denen sich die Tiegelfunde stärker konzentrierten. Einige lagen im Bezug zu den Gehöften A und B (Abb. 151). Bei der Suche nach Auffälligkeiten in der Umgebung dieser Konzentrationen fällt der Bereich des Hauses 4 ins Auge (Abb. 167). In weniger als 8 m Entfernung dazu lag in nordöstlicher Richtung die »Tiegelgrube« Bef. 9o9 mit der weitaus größten Menge (ca. 45 kg) und etwa 15 m in südöstlicher Richtung die Grube Bef. 719 mit der sechstgrößten Menge an Tiegelfragmenten (2,78 kg). Eine weitere Grube (Bef. 912) mit etwa einem halben Kilogramm dieser Reste lag direkt neben dem Haus. Auch Säulenfragmente von zusammen etwa 1,4 kg fanden sich in zwei benachbarten Gruben (Bef. 752, 911). Der mögliche Bezug zu Haus 4 ist von besonderem Interesse, weil sich dessen Umgebung durch weitere auffällige Befunde auszeichnet, nämlich zwei der oben vorgestellten Öfen. Neben der nördlichen Längsreihe der Pfosten lag, fast parallel zu dieser ausgerichtet, der kleine ovale Ofen Bef. 92o mit Öffnung nach Südwesten und Schürgrube. Etwa zwei Meter östlich des südöstlichen Eckpfostens befand sich der annähernd quadratische Ofen Bef. 921. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Befunde gleichzeitig existierten, auch wenn für die Öfen kein Zusammenhang mit der Salzproduktion hergestellt werden konnte. Trotzdem könnte es möglich sein, dass das Gebäude in einem wie auch immer gearteten Zusammenhang mit der Salzproduktion stand. Aufgrund seiner Größe ist es prinzipiell denkbar, dass es sich bei Haus 4 um ein Haupthaus (Wohnhaus?) handelte, jedoch fanden sich in der Umgebung der sicheren »Haupthäuser« 5 und 1o keine Spuren derartiger Öfen. Es dürfte sich daher wohl eher um ein Werk oder Speichergebäude gehandelt haben. Die Position der beiden Öfen außerhalb des Pfostengerüstes bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese sich außerhalb des Hauses befunden haben. Wenn Haus 4 eine ähnliche ovale Umbauung wie die Häuser 5 und 1o besessen haben sollte (in diesem Bereich lagen auch keine Siedlungsgruben), dann hätte zumindest der Ofen Bef. 92o sicher innerhalb des dreischiffigen Hauses gelegen, bei einer Umbauung wie bei Haus 1o auch der Ofen Bef. 921. Das spräche gegen eine Deutung als Speicherbau. Diese Funktion wurde in Brehna aufgrund ihrer Dimension und Lage sowie weiträumigen Vergleichen den Acht und den kleinen Sechspfostenbauten zugewiesen.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass Haus 4 wahrscheinlich ein Werkgebäude gewesen ist. Welcher Art die dort durchgeführten Tätigkeiten waren, ist nicht zu klären. Vermutlich wurden im Bezug zu diesem Haus größere Mengen an Salzkuchen aus ihren Behältern geschlagen. Wahrscheinlich wurde in direkter Nähe auch gesiedet.
Abb. 166 Gehöft D mit »Haupt-haus« 18 und zwei Neben-
häusern. Grün: jungbronze- bis früheisenzeitliche Gruben, Gelb:
Jungbronzezeitliche Gruben.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 157
Fazit
Zusammenfassend kann anhand der Funde eine Datierung der Siedlung in Brehna von Ha A2/B1 bis Ha D (11. Jh. bis 6. Jh. v. Chr.) vorgenommen werden. Das Einsetzen der Siedlung im 12./11. Jh. v. Chr. entspricht einem in ganz Mitteldeutschland nach einer scheinbaren Siedlungsleere in der Mittelbronzezeit zu beobachtenden Phänomen, welches sich besonders im Bereich der Saalemündungsgruppe, zu der die Brehnaer Siedlung zu zählen ist, sehr deutlich nachweisen lässt. In den erfassten Befundstrukturen und Funden sind noch stark die Bindungen an die im 13./12. Jh. v. Chr. von Osten her bis an die Mulde vorgestoßene Lausitzer Kultur fassbar, die einen wesentlichen Anteil an der Genese der älteren Saalemündungsgruppe hatte (v. Brunn 1954, 55 ff.; Schunke 2oo4, 291–293).
Zur jungbronzezeitlichen Besiedlungsphase können keine genauen Aussagen getroffen werden. Vermutlich deutet die Verteilung der Siedlungsgruben auf eine ehemals vorhandene Gehöftstruktur hin. Hausgrundrisse konnten nicht festgestellt werden, was möglicherweise auf die bekannte, archäologisch kaum nachweisbare Hausbautradition der Lausitzer Kultur (»Schwellrahmenbauten«) zurückzuführen sein könnte. Da sich in Brehna die jungbronzezeitlichen von den jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Strukturen in der Verteilung über die Fläche, dem Hausbau, der Einführung der Briquetage und der FeuerbockHerstellung unterscheiden (Abb. 168), kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob dies Ausdruck einer echten Siedlungs und Bevölkerungskontinuität von der älteren Saalemündungsgruppe
hin zur Hausurnenkultur ist – bei dann allerdings durchgreifender Veränderung der Siedel und Wirtschaftsweise. Ein Hiatus in der Besiedlung der ausgegrabenen Flächen kann nicht ausgeschlossen werden.
Von großer Bedeutung sind die in Brehna für die Hausurnenkultur nachgewiesenen verschiedenen Gebäudetypen, die unterschiedliche Funktionen gehabt haben dürften und sich ansatzweise sogar in einen größeren kulturgeschichtlichen Rahmen stellen lassen. Außerdem geben sie erste Hinweise auf Binnenstrukturen in Siedlungen dieser Kultur. Im durch die Ausgrabungen erfassten Ausschnitt der Siedlung konnten mindestens drei Gehöfte festgestellt werden, deren zeitliches Verhältnis untereinander im Rahmen dieser Auswertung nur andeutungsweise erschlossen werden konnte. Wahrscheinlich ist, dass sie nicht gleichzeitig nebeneinander existierten. Die »Haupthäuser« dieser Gehöfte gehören zwei verschiedenen Typen an, wobei jener der Gehöfte A und B eindeutige Verbindungen zum MittelelbeHavel Gebiet und darüber hinaus nach Norden aufweist. Diese Verbindungen konnten bereits früher anhand anderer materieller Hinterlassenschaften gezeigt werden, nämlich der Bronzen für das untere Saalegebiet (v. Brunn 1954, 22; 28; 35 ff.) und schließlich bei der Keramik und den Gebäudetypen für das östlich gelegene Mittelsaalegebiet (Schunke 2ooo; Schunke 2oo4, 276; 295, insbesondere Anm. 191); beides Gebiete, in deren Einflussbereich Brehna liegt. Ein kulturgeschichtlicher Hintergrund für diese Beobachtungen ist anzunehmen. Die anderen in Brehna nachgewiesenen Gebäudetypen dürften aufgrund ihrer geringen
Abb. 167 Haus 4 mit den beiden Öfen und Gruben mit Briquetage.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
158
Dimension Wirtschafts und Speichergebäude gewesen sein, die jeweils zu den Hauptgebäuden gehörten. Die vielen schmalen Achtpfostenbauten verkörperten wohl einen charakteristischen Funktionstyp. Die regelhaft zu den Haupthäusern liegenden Vierpfostenbauten dürften Speicherbauten gewesen sein.
Auch wenn innerhalb der hier vorgelegten Bearbeitung eine detaillierte Keramikanalyse nicht möglich war, kann aufgrund der chronologischen Einordnung der Funde eine tendenzielle zeitliche und räumliche Differenzierung der Befunde innerhalb der jüngstbronze bis früheisenzeitlichen Besiedlungsphase wahrscheinlich gemacht werden. So fiel auf, dass die Funde, die noch jüngstbronzezeitlich sein bzw. dem Übergang von der jüngsten Bronze zur frühen Eisenzeit angehört haben können, fast ausschließlich im Norden der Fläche 2 und in der Fläche 3 vorkamen, im Bereich der Gehöfte A und B. Genau in diesem Areal lagen die früheisenzeitlichen Keramikfragmente, die von Gefäßen der Billendorfer Kultur stammen. Ebenso verhält es sich mit den Feuerböcken und dem Großteil der Briquetagefragmente. Im Mittelteil und im Süden der Fläche 2, im Bereich des Gehöftes C, fehlen derartige Funde fast völlig. Dort konzentrierten sich dagegen die nördlich davon sehr seltenen getupften Ränder auffallend. In diesem Umfeld kamen auch die meisten der sicher nach Ha D datierbaren Funde ans Licht – z. B. ein keltischer Glasring und eine typische Scherbe der späten Hausurnenkultur. Der nach ersten Erkenntnissen nördlichste Befund mit gesicherter Datierung nach Ha D kam im Norden der Fläche 2 zum Vorschein. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann daher angenommen werden, dass die eisenzeitliche Gehöfte A und B älter als das Gehöft C sind. Auch die andersartige Bauweise des Haupthauses von Gehöft C könnte darin begründet liegen und damit einen Wandel der Bautraditionen innerhalb der frühen Eisenzeit andeuten.
Die jüngstbronze bis früheisenzeitliche Siedlung besaß den oben herausgestellten, vergleichs
weise wirtschaftlich orientierten Charakter. Die erfassten Befunde und Funde, die auf Salzsiederei hinweisen, erscheinen zwar zahlreich, doch muss bedacht werden, dass sie Relikte insgesamt wahrscheinlich mehrhundertjähriger Tätigkeiten sind. Wenn auch nur ein relativ kleiner Teil der ehemals vorhandenen Abfälle auf uns gekommen ist und nur ein kleiner Ausschnitt der Siedlung untersucht werden konnte, also ein damals nicht unwesentlich höheres Aufkommen anzunehmen ist, müssen die Brehnaer Funde nicht zwingend auf eine industrieartige Salzsiedewirtschaft schließen lassen. Schon die Wahrscheinlichkeit, dass die Hinterlassenschaften auf der Nordfläche von wenigstens zwei, wahrscheinlich noch mehr »Gehöftgenerationen« stammen, reduziert die Anzahl der dortigen Funde pro Gehöft erheblich. In der Umgebung des Gehöftes C sind die Nachweise insgesamt schwach, jedoch weist der Zusammenfund von Briquetage mit mehreren Ha D Typen in Bef. 12o auf eine Salzproduktion während der gesamten früheisenzeitlichen Existenzzeit der Siedlung hin. Es ist jedoch kaum auszuschließen, dass auch in Brehna nicht ständig bzw. ganzjährig gesotten wurde, sondern je nach Verfügbarkeit der Sole dem anfallenden Bedarf (Eigen und Handelsbedarf) und der im agrarisch geprägten Lebenszyklus zur Verfügung stehenden Zeit (vgl. Schunke 2oo4, 278–28o). Funde, die auf die üblichen Tätigkeiten innerhalb einer ansonsten auf Subsistenz ausgerichteten Siedlung hinweisen, sind Siebgefäßreste, Spinnwirtel, Backtellerfragmente sowie Knochen und Steingeräte (Mahlsteine, Feuersteingeräte), wobei nicht ganz geklärt werden kann, ob die große Anzahl an Reibe und Klopfsteinen eindeutig auf intensiven Getreideanbau hinweist (wie beispielsweise für Zedau postuliert) oder ein weiteres Spektrum an Tätigkeiten angenommen werden muss, welches nicht direkt (zum Mahlen) oder indirekt (»Schärfen« der Mahlsteine) auf diese Wirtschaftsform hinweist. Denkbar wäre ihre Nutzung zur Bearbeitung von Tiersehnen. Interessant ist die Beobachtung, dass in den zeitgleichen, sicher agrarisch
Abb. 168 Die jungbronze- bis früheisenzeitliche Entwicklung
der Brehnaer Siedlung im Spiegel verschiedener
Funde und Befunde.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 159
geprägten Siedlungen der Lausitzer bzw. Billendorfer Kultur solche Geräte wohl nicht bzw. in viel geringerem Ausmaß auftreten (vgl. Bönisch 1996), während sie im Norden weit verbreitet sind (z. B. Peters 2oo6, 77/78; Anm. 71 mit weiteren Nachweisen; zu vervollständigen durch: Seidel 1996, 124–127; 14o f; Wagner 2ooo, 53; Wietrzichowski 2oo3, 54 Abb. 5i.j). Sollte hier auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine aus den nördlichen Gebieten stammende Tradition sichtbar werden, wie es für den Hausbau gezeigt werden konnte? Die genannten Funde waren in Brehna, anders als die Briquetage und die Feuerböcke, über die gesamte durch Siedlungsbefunde dieser Zeit markierte Fläche verteilt.
Als weitere bedeutende Befundgruppe, die mit der Wirtschaftsweise innerhalb der Siedlung in Verbindung gebracht werden kann, sind die so genannten Herdgruben zu nennen. Durch ihre regelhafte, annähernd rechteckige Form, die Verziegelungsspuren und die Verfüllung mit hitzegesprungenen Gesteinen stellen sie einen Funktionstyp dar. Trotz der mit über 6o sicher zuweisbaren Exemplaren sehr großen Anzahl in Brehna konnte die ehemalige Funktion nicht sicher erschlossen werden. Aufgrund von regelmäßig wiederkehrenden Details im Aufbau, eines experimentellen Versuchs und überregionaler Vergleiche ist eine Deutung als Gargruben in Analogie zu den ethnographisch erschlossenen »Erdöfen« am wahrscheinlichsten.
Eine Mittlerstellung zwischen der schmucklosen technischen Keramik und der Gefäßkeramik der Hauswirtschaft einerseits sowie den religiösen Vorstellungen und kultischen Handlungen andererseits dürften die aus Brehna in bisher größter Anzahl für Mitteldeutschland vorliegenden Nachweise von Feuerböcken darstellen. Ihre Funktion bleibt weiterhin unklar. Als Schritt zu ihrer Deutung konnte erstmalig gezeigt werden, dass sie vorrangig in der Umgebung der »Haupthäuser« eine wie auch immer geartete Funktion erfüllt haben müssen. Vermutlich spielten sie in der ergrabenen Siedlung bei Ritualen im Ablauf der Salzsiederei eine Rolle, wie ihre enge Bindung an das Vorkommen von Siedegerät nahe legt – auch wenn dies kaum zu verallgemeinern ist. Als Datierungsindiz konnte festgestellt werden, dass ihr Auftreten auf den Bereich der tendenziell älteren eisenzeitlichen Gehöfte beschränkt war.
Die Einbindung der Brehnaer Siedlung in ein Geflecht von Austauschbeziehungen trotz vermutlich weitgehender Subsistenzwirtschaft ergibt sich aus der Tatsache, dass die zu verarbeitende Sole oder bestimmte Zwischenprodukte wohl aus der Halleschen Gegend angeliefert oder geholt werden mussten. Schon bei einer gelegentlichen Produktion für den Eigenbedarf erforderte dies Gegengaben. Die in der Siedlung zutage gekommenen Funde weisen darauf hin, dass über den
eigenen Bedarf hinaus produziert worden ist. Abnehmer für das Salz war wahrscheinlich vor allem die Bevölkerung, die östlich der Mulde siedelte und mit der Billendorfer Kultur zu verbinden ist. Das zeigt sich in der Vielzahl an Resten von Feinkeramik, die als Abfall in die nicht mehr benutzten Vorrats und Lehmentnahmegruben gelangten. Diese typische, qualitätvolle Keramik wurde wahrscheinlich nicht in der Siedlung hergestellt, sondern ist aus dem Billendorfer Kulturbereich dorthin gelangt. Ihr hoher Anteil ist ungewöhnlich für Siedlungen der Hausurnenkultur, selbst bei randlicher Lage innerhalb dieses schwer zu umreißenden Kulturbereiches. So wies ein nahe gelegenes Gräberfeld bei Schenkenberg, Lkr. Nordsachsen, ebenfalls einen relativ hohen Anteil an östlich beeinflusster oder dort hergestellter Keramik auf (Wahle 19o9, Taf. 16; 17). Aufgrund des Forschungsstandes ist derzeit nicht zu klären, ob die Austauschbeziehungen nur mit den direkt angrenzenden Bevölkerungsgruppen bestanden oder weiter nach Osten reichten. Der Bereich bis einschließlich der Niederlausitz war offenbar traditionelles »Absatzgebiet« für das mitteldeutsche Salz, wie sich an den älteren jung bis jüngstbronzezeitlichen Fragmenten der Salzbehälter (Kelchoberteile, Hohlkegel) zeigen lässt, die bis die Niederlausitz hinein verstärkt auftreten. In der Zeit der Brehnaer Salzproduktion wurden die Behälter (Tiegel) nicht mehr mit verhandelt, so dass dieser direkte archäologische Nachweis unmöglich ist. Der indirekte Beleg über die Gegengaben spricht aber eine deutliche Sprache.
Neben diesen Funden, die Ausdruck eines regionalen Austausches sind, fanden sich – außergewöhnlich für Siedlungen – echte »Importe«, die aus weiter entfernten Gegenden stammen. Es handelt sich um den Glasring und die Bronzenadel. Aus dem geschilderten Spektrum der keramischen Funde fallen weiterhin mindestens drei Gefäße durch Form und Machart deutlich heraus. Mit diesen Funden werden überregionale Beziehungen nach Nordosten, Südosten und den Süden deutlich. Die graphitierte Tasse stammt aus dem östlichen Hallstattkreis, der Oberlausitz/Schlesien oder Böhmen und könnte in Ha B oder Ha C über den Elbweg nach Mitteldeutschland gelangt sein. Reichhaltiger sind die Belege für den Ha Dzeitlichen Austausch. Die Vorbilder für die glättmusterartig verzierte Schale, die aus Bef. 12o vorliegt, finden sich – allerdings selten – von Süden kommend bis in das Mittelsaalegebiet hinein. Das Brehnaer Exemplar dürfte über das »Austauschzentrum« im heutigen Stadtgebiet von Halle verhandelt worden sein. Der genannte Befund enthielt weitere »Preziosen«, wodurch er sich als Abfallgrube eines gut situierten Haushaltes zu erkennen gab. Dies sind die bronzene Schwanenhalsnadel und ein girlandenverziertes Gefäß, die beide in die Richtung der Göritzer Gruppe an die untere Oder weisen. Als
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
R A L PH VO N R AU C H H AU P T, T O RS T E N S C H U N K E
160
Relikte der Quelle dieses Wohlstandes fanden sich zudem Briquetagereste. Ebenso bemerkenswert ist der kleine hellblaue Glasring, der in der Hallstattkultur Südwestdeutschlands oder der Schweiz hergestellt worden sein muss und dessen nächste Parallelen sich erst südlich und westlich des Thüringer Waldes finden lassen.
Zu welchem Zeitpunkt die Besiedlung im Bereich der ausgegrabenen Flächen endete, ist schwer einzuschätzen. Vermutlich sind die Hinterlassenschaften aus dem südlichen Grabungsbereich, dem Gehöftareal C mit einem abweichend konstruierten Haupthaus, die jüngsten. Wie auch in ihrem Beginn dürfte die Besiedlung bei Brehna einem allgemeinen Rhythmus im nördlichen Mitteldeutschland folgen, denn sie bricht offenbar
erst mit dem Ende der Hausurnenkultur innerhalb Ha D ab, nach Bef. 12o wohl erst in Ha D2. Dieses Ende ist in engem Zusammenhang mit dem Vordringen der Jastorfkultur von Norden her über das MittelelbeHavelGebiet nach Mitteldeutschland zu sehen (Müller 1985, 124 ff.; Müller 1992, 265 ff.), das nicht nur zu einer kulturellen Nivellierung im nördlichen Mitteleuropa, sondern auch zum weitgehenden Zusammenbrechen der mitteldeutschen Salzproduktion führte.
Eine wohl zugehörige früheisenzeitliche Gräbergruppe konnte im Bereich der Siedlung der Aunjetitzer Kultur nachgewisen werden (vgl. Kapitel 4).
T. S.
A N M E R K U N G E N 1 Freundliche Einschätzung durch
T. Puttkammer, Dresden; vgl. Buck 1973, 397; 395 Abb. 4.
2 Für Briquetage wird, im Gegensatz zu Matthias 1961, der weibliche Artikel bevorzugt, da die französische Ursprungsform des Wortes weiblichen Geschlechts ist.
3 Die Begriffe Herd und Ofen werden in der archäologischen und auch ethno graphischen Literatur sehr uneinheitlich verwendet. Im Folgenden werden die Bezeichnungen »Ofen« und »Erdofen« bevorzugt, da die Brehnaer Befunde als geschlossene Gebilde, als Öfen funktionierten, auch wenn sie offensichtlich keine Kuppelkonstruktionen besaßen und zunächst offen befeuert worden sind (s. u.).
4 Einen guten Vergleich zu den Befunden Brehnas stellen die auf der Fundstelle Löberitz, Lkr. AnhaltBitterfeld aufgedeckten Öfen dar, die ebenso in den anstehenden Lehm eingetieft waren und deutliche Verziegelungsspuren zeigten. Der von Frau Dr. S. Clasen (LDA) durchgeführte Dünnschliff der Wandung zeigt deutlich, dass Wandung und anstehender Boden aus demselben Material bestanden (vgl. Clasen 2oo4, 58 Abb. 3a.b).
5 NordSüd orientiert: drei Anlagen, NordwestSüdost orientiert: eine Anlage, SüdwestNordost orientierte sechs Anlagen und WestOst orientiert: 12 Anlagen.
6 Denkbar wäre ebenso das Einspannen einer Tierhaut innerhalb der Grube über den erhitzten Steinen (zu den ethnographischen Parallelen vgl.
Dittmann 199o, 21 ff. u. Abb. 1). In die Haut könnte die Sole eingefüllt worden sein, um diese zu gradieren und so eine höhere Salzkonzentration zu erzeugen. Durch das zusätzliche Einfüllen erhitzter Steine würde sich der Wirkungsgrad nochmals erhöhen. Archäologisch wäre dieses Verfahren schwer nachweisbar.
7 Die Befunde konnten durch Zufall während der Grabungszeit entdeckt werden, als die frei geschobenen Flächen für Wegeanbindungen von Windkraftanlagen kontrolliert wurden. Die schnelle Dokumentation wurde durch den Anhaltischen Förderverein für Naturkunde und Geschichte, WeißandtGölzau, durchgeführt. Neben den beiden Ofengruben konnten Gruben festgestellt werden, die in Verfüllung und Datierung den »hell« verfüllten Siedlungsgruben in Brehna entsprachen.
8 Die Bestimmung der Tierknochen erfolgte dankenswerterweise durch Herrn Dr. H.J. Döhle (LDA).
9 Leider lag der Hausbefund in zwei nacheinander bearbeiteten Grabungsschnitten und einer zum Abschluss der Grabungen gezielt abgezogenen Restfläche, so dass keine Gesamtdokumentation möglich war.
1o Der Abstand zwischen den Pfosten der Außenseiten betrug zwischen 1,53 m und 1,79 m; die Schiffbreite schwankte zwischen 1,55 m und 1,8o m. Die Seitenlänge der NeunPfostensetzung betrug 3,46 m x 3,26 m; mit Erweiterung betrug die Grundfläche 5,97 m x 3,26 m.
11 Der südlichste Mittel»pfosten« (Bef. 241) könnte nach Form in Planum und Profil auch eine innerhalb des Hauses angelegte Grube darstellen.
12 Diese Informationen werden einem der Ausgräber, Herrn B. Duchniewski, Köln, verdankt. Vier recht sicher ansprechbare Grundrisse haben Maße von 4,15 m x 1,7 m, 6,25 m x 1,85 m, 6,4 m x 1,9 m sowie 5,15 m x 1,75 m.
13 Vgl. Anm. 12. 14 Die Einsicht in die Grabungspläne der
jüngsten Grabungen und die Genehmigung, die Bauten hier erwähnen zu dürfen, verdanken wir Herrn T. Kubenz, Halle (Saale).
15 Sonderbestattungen sind bis in die Neuzeit zu beobachten. So wurden Selbstmörder und ungetaufte Kinder auf gesonderten Friedhöfen oder vor der Friedhofsmauer bestattet, da sie nicht in geweihter Erde ruhen durften.
16 Reste eines möglicherweise zugehörigen Brandgräberfeldes fanden sich südlich innerhalb des frühbronzezeitlichen Siedlungsareals (siehe Kapitel 4).
17 Es muss bemerkt werden, dass sich hinter einer Reihe von Gruben ohne typologisch genauer datierende Funde in diesem Umfeld, die in die Jüngstbronze bis Früheisenzeit gestellt wurden, solche der Jungbronze zeit verbergen können, da Gruben mit allgemein bronze/früheisenzeitlich wirkender Keramik bei der Schnelldurchsicht des Materials pauschal dieser Klasse zugeschlagen worden sind.
A B B I L D U N G S N A C H W E I S 1 Verfasser; N. Seeländer; LDA.
2 A. Hörentrup, LDA. 3–5 M. Wiegmann, LDA. 6–8 A. Hörentrup, LDA. 9 Ch. Petruniv, LDA. 1o–11 A. Hörentrup, LDA. 12 M. Wiegmann, LDA. 13–16 A. Hörentrup, LDA.
17 M. Wiegmann, LDA. 18 A. Hörentrup, LDA. 19 M. Wiegmann, LDA. 2o–22 A. Hörentrup, LDA. 23 M. Wiegmann, LDA. 24–29 A. Hörentrup, LDA. 3o–34 Verfasser. 35–38 A. Hörentrup, LDA. 39 M. Wiegmann, LDA.
4o T. Schunke, N. Seeländer, LDA.
41–43 Verfasser. 44–46 M. Wiegmann, LDA. 47–48 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA. 49–51 A. Hörentrup, LDA. 52 T. Schunke, LDA. 53–57 A. Hörentrup, LDA.
J U N G B RO N Z E - B IS F RÜ H E E IS E N Z E IT
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 161
58–59 Verfasser. 6o–64 A. Hörentrup, LDA. 65 M. Wiegmann, LDA. 66–68 A. Hörentrup, LDA. 69–73 Verfasser. 74 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA. 75 Verfasser. 76 R. v. Rauchhaupt, LDA. 77 Verfasser, N. Seeländer,
LDA. 78–82 Verfasser. 83 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA.
84 Verfasser. 85–97 T. Schunke, LDA. 98–123 Verfasser. 124 R. v. Rauchhaupt, LDA. 125 Verfasser. 126 R. v. Rauchhaupt, LDA. 127–133 Verfasser. 134 A. Hörentrup, LDA. 135–143 T. Schunke, LDA. 144 Verfasser. 145–146 T. Schunke, LDA. 147 Verfasser. 148 nach Oelmann 1929, Abb.
38.
149–15o Verfasser. 151 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA. 152–153 Verfasser. 154 nach: Rettungsgrabungen
1979, 12o. 155–156 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA. 157 T. Schunke, R. v. Rauch
haupt, LDA. 158 R. v. Rauchhaupt, LDA. 159–165 Verfasser. 166–168 T. Schunke, N. Seeländer,
LDA.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 183
Balfanz 2oo3 K. Balfanz, Am Anfang war … das Bild. In: H. Mel-
ler (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-An-halt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 75–82.
Balfanz 2oo3 a K. Balfanz, Die Ostkuppe in der frühen Neuzeit.
In: H. Meller (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabun-gen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sach-sen-Anhalt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 139.
Balfanz 2oo3 b K. Balfanz, Slawen auf der Südkuppe. In: H. Mel-
ler (Hrsg.), Ein weites Feld; Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-An-halt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 1o5–1o9.
Balfanz 2oo3c K. Balfanz, Siedlungsgruben auf der Ostkuppe. In:
H. Meller (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-An-halt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 51–52.
Balfanz/Jarecki 2oo4 K. Balfanz/H. Jarecki, Jung- und spätbronzezeit-
liche Sonderbestattungen in Mitteldeutschland. Quellen und Fragestellungen. Jahresschr. Mit-teldt. Vorgesch. 88, 2oo4, 339–378.
Bartelheim 1998 M. Bartelheim, Studien zur böhmischen Aunjetit-
zer Kultur – Chronologische und chorologische Untersuchungen (Bonn 1998).
Bartelt 2oo4 U. Bartelt, Beste Wohnlage am Auenrand der Wei-
ßen Elster – Siedlungsbefunde vom Frühneolithi-kum bis in die Eisenzeit bei Großdalzig, Lkr. Leip-ziger Land. Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 46, 2oo4, 115–173.
Baumeister 1995 R. Baumeister, Außergewöhnliche Funde der
Urnenfelderzeit aus Knittlingen, Enzkreis. Bemer-kungen zu Kult und Kultgerät der Spätbronzezeit. Fundber. Baden-Württemberg 2o, 1995, 422–448.
Becker 1972 C. J. Becker, Hal og hus i yngre bronzealder. Natio-
nalmuseets Arbejdsmark 1972, 5–16.Becker u. a. 2oo4 M. Becker/K. Balfanz/H. Jarecki/E. Mattheußer/
U. Petzschmann/R. Schafberg/O. Schröder/ D. Stier, Untersuchungen im Gewerbegebiet an der A 14 bei Halle/Saale – Queis. Germania 82/1, 2oo4, 177–218.
Behn 1924 F. Behn, Hausurnen (Berlin 1924).Behnke 2oo7 H. J. Behnke, Süßes aus der Bronzezeit – Sied-
lungsgunst im Unstruttal bei Karsdorf, Burgen-landkreis. Die Ausgrabungen 2oo4. Arch. Sach-sen-Anhalt 4, 2oo6 (2oo7), 63–86.
Beran 1993 J. Beran, Untersuchungen zur Stellung der Salz-
münder Kultur im Jungneolithikum des Saale-gebietes (Wilkau-Hasslau 1993).
Beran/Hensel 2ooo J. Beran/N. Hensel, Sondierungsschnitte durch
mittelalterliche Hochäcker bei Sielow, Stadt Cott-bus. Arbeitsber. Bodendenkmalpfl. Brandenburg 4, 2ooo, 247–25o.
Bergmann/Trier 1993 R. Bergmann/B. Trier (Hrsg.), Zwischen Pflug und
Fessel; Mittelalterliches Landleben im Spiegel der Wüstungsforschung. Westfälisches Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege und Westfälisches Museumsamt (Münster/Westf. 1993).
Biermann/Dulinicz 2oo2 F. Biermann/M. Dulinicz, Die frühmittelalterliche
Siedlung von Bochen im mittleren Polen. Germa-nia 8o, 2oo2, 243–267.
Billig 1958 G. Billig, Die Aunjetitzer Kultur in Sachsen (Leip-
zig 1958).Boas 1991 N. A. Boas, Late Neolithic and Bronze Age Settle-
ments at Hemmed Church and Hemmed Planta-tion, East Jutland. Journal Danish Arch. 1o, 1991, 119–135.
Bock 2oo2 H. Bock, So wohnte und lebte Familie Bierstedt.
Städte–Dörfer–Friedhöfe. Arch. in der Altmark, 2: Vom Hochmittelalter bis zur Neuzeit (Oschers-leben 2oo2) 429–439.
Böhme 2oo1 M. Böhme, Späthallstattzeitliche Keramik aus
Brunnengruben von »Sulza«. In: H.-O. Pollmann (Hrsg.), Archäologie und Bauforschung in Erfurt. Kl. Schr. Ver. Gesch. Altertumskunde von Erfurt e. V. 5 (Erfurt 2oo1) 43–56.
Bönisch 1987 E. Bönisch, Ein jüngstbronzezeitlicher Bestat-
tungsplatz der Lausitzer Kultur bei Altdöbern, Kr. Calau. Veröff. Mus. Ur- u. Frühgesch. Potsdam 21, 1987, 145–171.
Bönisch 1996 E. Bönisch, Die urgeschichtliche Besiedlung am
Niederlausitzer Landrücken (Potsdam 1996).Bönisch 2oo1 F. Bönisch, Wölbäcker als Kennzeichen früherer
Gewannfluren. Arbeitsber. Bodendenkmalpfl. Brandenburg 8, 2oo1, 2o3–212.
Bogen 2oo6 C. Bogen, Ein Jüngling mit Bernsteinschmuck –
Eine außergewöhnliche Bestattung der Aunjetitzer Kultur. In: H. Meller (Hrsg.), Archäologie auf der Überholspur – Ausgrabungen an der A 38. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonderband 5 (Halle [Saale] 2oo6) 124–13o.
Bohm 1937 W. Bohm, Die Vorgeschichte des Kreises West-
prignitz (Leipzig 1937).Brachmann 1978 H. Brachmann, Slawische Stämme an Elbe und
Saale (Berlin 1978).Brestrich 2ooo W. Brestrich, Am Elbeweg nach Böhmen – Die
Siedlung der vorrömischen Eisenzeit von Pratz-schwitz. Arch. aktuell Freistaat Sachsen 6, 1998–99 (2ooo) 84–87.
Breuer/Meller 2oo4 H. Breuer/H. Meller, Tränen der Götter. In: H. Mel-
ler (Hrsg.), Der geschmiedete Himmel. Die weite Welt im Herzen Europas vor 36oo Jahren (Stutt-gart 2oo4) 1o4–1o7.
Brosseder 2oo4 U. Brosseder, Studien zur Ornamentik hallstatt-
zeitlicher Keramik zwischen Rhônetal und Kar-patenbecken (Bonn 2oo4).
Bruchhaus/Neubert 2oo1 H. Bruchhaus/A. Neubert, Zur Rekonstruktion
endneolithischer und frühbronzezeitlicher Bevöl-kerungen im Mittelelbe-Saale-Gebiet – Ergeb-nisse einer ersten Bestandsaufnahme. Ber. RGK 8o, 1999 (2oo1) 122–161.
Brumlich/Meyer 2oo4 M. Brumlich/M. Meyer, Ofenanlagen der vorrömi-
schen Eisenzeit bei Waltersdorf, Landkreis Dah-me-Spreewald. Ein Beitrag zur frühen Eisenver-hüttung. Einsichten – Archäologische Beiträge
für den Süden des Landes Brandenburg 2oo3. Arbeitsber. Bodendenkmalpfl. Brandenburg 11, 2oo4, 167–196.
v. Brunn 1939 W. A. v. Brunn, Die Kultur der Hausurnengräber-
felder in Mitteldeutschland zur frühen Eisenzeit (Halle [Saale] 1939).
v. Brunn 1943 W. A. v. Brunn, Probleme thüringischer Burgwälle.
Germania 27, 1943, 113–146.v. Brunn 1954 W. A. v. Brunn, Steinpackungsgräber von Köthen
(Berlin 1954).Buck 1973 D.-W. Buck, Siedlungswesen und gesellschaftliche
Verhältnisse bei den Stämmen der früheisenzeit-lichen Billendorfer Gruppe. Ethnogr.-Arch. Zeit-schr. 14, 1973, 385–423.
Büttner u. a. 1999 A. Büttner/H. Preier/H. Stäuble, Archäologie in
Kiesgruben: Ein Beispiel aus Serbitz, Lkr. Delitzsch. Arch. aktuell Freistaat Sachsen 5, 1997 (1999) 144–15o.
Campen u. a. 1997 I. Campen/V. Heyd/H. Stäuble/C. Tinapp, Neuere
Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen im Vorfeld des Tagebaus Zwenkau. Arch. aktuell Freistaat Sachsen 4, 1996 (1997) 45–55.
Christlein/Stork 198o R. Christlein/S. Stork, Der hallstattzeitliche Tem-
pelbezirk von Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern. Jahresber. Bayer. Boden-denkmalpfl. 21, 198o, 43–55.
Clasen 2oo4 S. Clasen, Blick in den Untergrund – Zur Geologie
im Trassenverlauf. In: Von Peißen nach Wiede-ritzsch. Archäologie an einer Erdgas-Trasse (Grö-bers 2oo4) 56–58.
Coblenz 1952 W. Coblenz, Grabfunde der Mittelbronzezeit Sach-
sens (Dresden 1952).Coblenz 1956 W. Coblenz, Skelettgräber von Zauschwitz, Kreis
Borna. Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Boden-denkmalpfl. 5, 1956, 57–119.
Coblenz 1986 W. Coblenz, Ein frühbronzezeitlicher Verwahr-
fund von Kyhna, Kr. Delitzsch. Arbeits- u. For-schungsber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 3o, 1986, 37–88.
Cujanová-Jílková 1971 E. Cujanová-Jílková, Žárové hroby na sídlištích z
rozhraní starší a strední doby bronzové v cesko-bavorské oblasti – Brandgräber in Siedlungen aus dem Übergang der älteren zur mittleren Bronze-zeit im böhmisch-bayerischen Bereich. Arch. Rozhledy 23, 1971, 683–699.
Dannheimer 1976 H. Dannheimer, Siedlungsgeschichtliche Beobach-
tungen im Osten der Münchner Schotterebene. Bayerische Vorgeschichtsbl. 41, 1976, 1o7–12o.
Deffner/Henkelmann 2oo5 A. Deffner/S. Henkelmann, Urgeschichtliche Salz-
sieder in Quedlinburg – Die Ausgrabung auf dem künftigen Institutsgelände der Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen in Qued-linburg auf dem Moorberg. Arch. Sachsen-Anhalt 3, 2oo5, 162–166.
Dietrich 1998 H. Dietrich, Die hallstattzeitlichen Grabfunde aus
den Seewiesen von Heidenheim-Schnaitheim (Stuttgart 1998).
Literaturverzeichnis
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
L IT E R AT U RV E R Z E I C H NIS
184
Dittmann 199o A. Dittmann, Das Kochen mit Steinen. Ein Bei-
trag zur Entwicklungsgeschichte der Nahrungs-zubereitung. Marburger Stud. Völkerkunde 7 (Berlin 199o).
Donat 1988 P. Donat, Der Königshof Helfta. II. Vormittelalter-
liche und mittelalterliche Funde – Ergebnisse der Grabungen 1977–1981. Zeitschr. Arch. 23, 1988, 225–259.
Drack 1985 W. Drack, Drei hallstattzeitliche Grabhügel bei
Bonstetten, Kanton Zürich. Jahrb. Schweizeri-schen Ges. Ur- u. Frühgesch. 68, 1985, 123–172.
Draiby 1984 B. Draiby, A Late Bronze Age Settlement from
Fragtrup, Jutland. Aarbøger for Nordisk Oldkyn-dighed og Historie 1984, 127–216.
Eggers 1964 H. J. Eggers, Pommersche Funde und Ausgrabun-
gen aus den 3o er und 4o er Jahren. 1o. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte (Hamburg 1964).
Egold 2oo4 A. Egold, Zwei Gräber – zwei Kulturen. In: Von
Peißen nach Wiederitzsch. Archäologie an einer Erdgastrasse (Gröbers 2oo4) 14.
Einicke 1994 R. Einicke, Linienbandkeramik (LBK). In:
H.-J. Beier/R. Einicke (Hrsg.), Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet und der Altmark (Wil-kau-Hasslau 1994) 27–47.
Ender 2oo3 P. Ender, Liebersee. Ein polykultureller Bestat-
tungsplatz an der sächsischen Elbe Band 4. Ver-öff. Landesamt Arch. Landesmus. Vor gesch. Dresden 41 (Dresden 2oo3).
Engelhardt u. a. 1995 B. Engelhardt/Z. Kobylinski/D. Krasnodebski/
R. Wojtaszek, Eine urnenfelderzeitliche Siedlung von Altdorf, Friedhofsparkplatz. Das arch. Jahr in Bayern 1995, 53–56.
Ericson 1999 C. Ericson, Häuser der Lausitzer Kultur in Dahlen,
Lkr. Torgau-Oschatz. Arch. aktuell Freistaat Sach-sen 5, 1997 (1999) 124–127.
Ethelberg 1991 P. Ethelberg, Two more House Groups with Three-
aisled Long-houses from the Early Bronze Age at Højgård, South Jutland. Journal Danish Arch. 1o, 1991, 136–155.
Fabesch u. a. 2oo4 U. Fabesch/U. Fiedler/B. Fritsch/P. Pacak, Archäo-
logische Ausgrabungen in der nördlichen Alt-mark im Vorfeld der Verlegung der Ferngas-leitung 227 (Steinitz-Quitzow). Arch. Sachsen-Anhalt, N. F. Heft 2, 2oo4, 154–175.
Fischer 1956 U. Fischer, Die Gräber der Steinzeit im Saalege-
biet (Berlin 1956).Furholt 2oo3 M. Furholt, Die absolutchronologische Datierung
der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien (Bonn 2oo3).
Gandert 1937 O.-F. Gandert, Vorgeschichte. In: M. Arendt/
O.-F. Gandert/E. Faden, Geschichte der Stadt Ber-lin (Berlin 1937) 1–43.
Gebers 2oo4 W. Gebers, Ein langer Suchschnitt – Die Pipeline-
trasse Stade-Teutschenthal. In: F. Mamoun (Hrsg.), Begleitschrift zur Ausstellung Archäolo-gie Land Niedersachsen. 25 Jahre Denkmal-schutzgesetz – 4ooooo Jahre Geschichte (Stutt-gart 2oo4) 24–31.
Gedl 1973 M. Gedl, Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu,
pow. Głubczyce (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdansk 1973).
Gedl 1994 M. Gedl, Archäologische Untersuchungen zum
Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Polen. In: P. Schauer (Hrsg.), Archäologische Untersu-chungen zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit zwischen Nordsee und Kaukasus. Regensburger Beitr. Prähist. Arch. 1 (Regensburg 1994) 263–3o5.
Gollub 196o S. Gollub, Endbronzezeitliche Gräber in Mittel-
und Oberschlesien (Bonn 196o).Griesa 1982 S. Griesa, Die Göritzer Gruppe. Veröff. Mus. Ur- u.
Frühgesch. Potsdam 16 (Berlin 1982).Grünberg 1943 W. Grünberg, Die Grabfunde der jüngeren und
jüngsten Bronzezeit im Gau Sachsen (Berlin 1943).
Haevernick 1975 T. E. Haevernick, Hallstattglasringe und Hage-
nauer Perlen. Trierer Zeitschr. 38, 1975, 63–73.Hein 199o M. Hein, Untersuchungen zur Kultur der Schnur-
keramik in Mitteldeutschland (Bonn 199o).Hellström 2oo4 K. Hellström, Das mehrperiodige Gräberfeld von
Altlommatzsch bei Meißen. Bronze- und frühe Eisenzeit. Veröff. Landesamt. Arch. mit Landes-mus. Vorgesch. Dresden 45 (Dresden 2oo4).
Hennig 1966 E. Hennig, Beobachtungen zum Mahlvorgang an
ur- und frühgeschichtlichen Getreidemühlen. Ethnogr.-Arch. Zeitschr. 7, 1966, 71–87.
Herrmann 1989 J. Herrmann (Hrsg.), Archäologie in der Deut-
schen Demokratischen Republik, Denkmale und Funde, 2 (Jena, Berlin 1989).
Heyd 1998 V. Heyd, Das prähistorische Gräberfeld von Nie-
derkaina bei Bautzen, Bd. 3. Veröff. Landesamt Arch. mit Landesmus. Vorgesch. Dresden 26 (Stuttgart 1998).
Heyd 2ooo V. Heyd, Das prähistorische Gräberfeld von Nie-
derkaina bei Bautzen, Bd. 4. Veröff. Landesamt Arch. mit Landesmus. Vorgesch. Dresden 29 (Stuttgart 2ooo).
Hirschberg 1988 W. Hirschberg (Hrsg.), Neues Wörterbuch der
Völkerkunde (Berlin 1988).Hochstetter 1984 A. Hochstetter, Kastanas – Ausgrabungen in
einem Siedlungshügel der Bronze- und Eisenzeit Makedoniens 1975–1979. Die handgemachte Keramik Schichten 19 bis 1. Prähist. Arch. Süd-osteuropa 3 (Berlin 1984).
Horejs 2oo5 B. Horejs, Kochen am Schnittpunkt der Kulturen – zwischen Karpatenbecken und Ägäis. In: B. Horejs/R. Jung/E. Kaiser/B. Terzan (Hrsg.), Interpretationsraum Bronzezeit. Festschrift für B. Hänsel (Bonn 2oo5) 71–94.
Horst 1982 F. Horst, Bronzezeitliche Steingeräte aus dem
Elbe-Oder-Raum. Bodendenkmalpfl. in Mecklen-burg, Jahrb. 1981 (1982) 33–83.
Horst 1985 F. Horst, Zedau – Eine jungbronze- und eisenzeit-
liche Siedlung in der Altmark (Berlin 1985).Hüser 2oo8 A. Hüser, Spätbronzezeitliche Gargruben unterm
Golfplatz. Arch. in Deutschland 2/2oo8, 41–42.Huth/Stäuble 1998 C. Huth/H. Stäuble, Ländliche Siedlungen der
Bronzezeit und der älteren Eisenzeit. Ein Zwi-schenbericht aus Zwenkau. In: A. Lang/P. Schauer (Hrsg.), Archäologische Forschungen in urge-schichtlichen Siedlungslandschaften (Festschrift G. Kossack) (Regensburg, Bonn 1998) 185–23o.
Ickerodt/Schwerdtfeger 2oo1 U. Ickerodt/K. Schwerdtfeger, Eine Aunjetitzer
Mehrfachbestattung von Serbitz, Lkr. Delitzsch.
Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Bodendenkmal-pfl. 43, 2oo1, 288–291.
Jarecki 2oo3 H. Jarecki, Fünf Jahre Archäologie an der ICE-
Trasse Erfurt-Halle/Leipzig. Eine Übersicht. Jah-resschr. Mitteldt. Vorgesch. 86, 2oo3, 53–83.
Jarecki 2oo3 a H. Jarecki, Feld- und Flureinteilungen im archäo-
logischen Befund. In: H. Meller (Hrsg.), Ein wei-tes Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis, Arch. Sachsen-Anhalt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 135–138.
Jarecki 2oo7 H. Jarecki, Prähistorische Salzsieder bei Libehna,
Ldkr. Köthen. Arch. Sachsen-Anhalt 4, 2oo6 (2oo7), 331–335.
Jensen 2oo3 J. Jensen, Danmarks Oldtid. Ældere Jernalder 5oo
f.Kr.–4oo e. Kr. (København 2oo3).Kahlke 1955 H.-D. Kahlke, Schnurkeramische »Kettenhocker«
aus Thüringen. Ein Beitrag zur Kenntnis der mit-teldeutschen Schnurkeramik. Alt-Thüringen 1, 1955, 153–181.
Kalicz 1968 N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn
(Budapest 1968).Kaul 1985 F. Kaul, Priorsløkke – en befæstet jernalder-
landsby fra ældere romersk jernalder ved Horsens. Nationalmuseets Arbejdsmark 1985, 172–183.
Kaul 1999 F. Kaul, Vestervig – an Iron Age village mound in
Thy, NW Jutland. In: C. Fabech/J. Ringtved (Hrsg.), Settlement and Landscape (Gylling 1999) 53–67.
Keiling 1962 H. Keiling, Ein Bestattungsplatz der jüngeren
Bronze- und vorrömischen Eisenzeit von Lanz, Kreis Ludwigslust. Bodendenkmalpfl. Mecklen-burg, Jahrb. 1962 (Schwerin 1962).
Keller 1996 E. Keller, Die urnenfelderzeitliche Siedlung und
das spätrömische Kalkbrennerviertel in Unter-haching, Lkr. München. Ber. Bay. Bodendenkmal-pfl. 36/37, 1995/96 (1996) 113–158.
Klamm 2oo4 M. Klamm, Die Anfänge der Baustoffgewinnung.
In: Von Peißen nach Wiederitzsch. Archäologie an einer Erdgastrasse (Gröbers 2oo4) 53–55.
Kluttig-Altmannn 2oo1 R. Kluttig-Altmann, Bronzezeitliche Siedlungs-
spuren bei Glesien, Lkr. Delitzsch. Ausgrabungs-ergebnisse im Zuge der Erweiterung des Flugha-fens Leipzig-Halle. Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 43, 2oo1, 111–122.
Kokowski 1983 A. Kokowski, Période Romain tardive civilisation
de Cernjachov. Inventaria Archaeologica, Polo-gne, Taf. 3o4 (Warszawa, Łódz 1983).
Krüger 1989 B. Krüger, Dessau-Mosigkau. In: J. Herrmann
(Hrsg.), Archäologie in der Deutschen Demokrati-schen Republik, Denkmale und Funde, 2 (Jena, Berlin 1989) 696–698.
Kubenz 1994 T. Kubenz, Baalberger Kultur. In: H.-J. Beier/
R. Einicke, Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet und in der Altmark (Wilkau-Hasslau 1994) 113–128.
Küas 1976 H. Küas, Das alte Leipzig in archäologischer Sicht.
Veröff. Landesmus. Vorgesch. Dresden 14 (Berlin 1976).
Küchenmeister 2oo7 R. Küchenmeister, Vorgeschichtliche Befunde
aus dem Kieswerk Eulau bei Naumburg (Saale). Arch. Sachsen-Anhalt 4, 2oo6 (2oo7), 46–57.
Lange 2oo3 D. Lange, Frühmittelalter in Nordwestsachsen,
Siedlungsgrabungen in Delitzsch, Lissa und Gle-
L IT E R AT U RV E R Z E I C H NIS
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010 185
sien. Veröff. Landesamt Arch. mit Landesmus. Vorgesch. Dresden 4o (Dresden 2oo3).
Lies 1963 H. Lies, Die vor- und frühgeschichtlichen Dreh-
mühlsteine im Bezirk Magdeburg. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 47, 1963, 287–323
Loré 1994 F. Loré, Zwischen Neolithikum und 2o. Jahrhun-
dert – Archäologie im Tagebau Zwenkau, Lkr. Leipziger Land. Arch. aktuell Freistaat Sachsen 2, 1994, 65–76.
Lütjens 2ooo I. Lütjens, Ländliche Siedlungen, Langgestreckte
Steingruben auf einem jungbronzezeitlichen Siedlungsplatz bei Jürgenshagen, Kreis Güstrow. Offa 56, 1999 (2ooo) 21–44.
Marschall 1988 O. Marschall, Ein Salzsiedofen der späten
Bronze-/frühen Eisenzeit bei Erdeborn, Kr. Eisle-ben. Ausgr. u. Funde 33, 1988, 199–2o4.
Matthäuser 2oo3 E. Matthäuser, Befunde der späten Bronzezeit im
Nordwestbereich. In: H. Meller, (Hrsg.), Ein wei-tes Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 86–9o.
Matthäuser 2oo3 a E. Matthäuser, Befunde der Aunjetitzer Kultur im
Nordwestbereich. In: H. Meller, (Hrsg.), Ein wei-tes Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 67–74.
Matthäuser 2oo3 b E. Matthäuser, Ein Trapez der Baalberger Kultur
im Nordwestbereich. In: H. Meller, (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 4o–42.
Matthias 1953 W. Matthias, Ein Grab der frühen Bronzezeit mit
Siedlungskeramik von Hausneindorf, Kreis Aschersleben. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 37, 1953, 237–243.
Matthias 1961 W. Matthias, Das mitteldeutsche Briquetage –
Formen, Verbreitung und Verwendung. Jahres-schr. Mitteldt. Vorgesch. 45, 1961, 119–225.
Matthias 1976 W. Matthias, Die Salzproduktion – ein bedeuten-
der Faktor in der Wirtschaft der frühbronzezeit-lichen Bevölkerung an der mittleren Saale. Jah-resschr. Mitteldt. Vorgesch. 6o, 1976, 373–394.
Matuschik 1998 I. Matuschik, Der »Kettenhocker« von Senkofen –
Ein Beitrag zur Kenntnis der Schnurkeramischen Kultur in Südbayern. In: B. Fritsch u. a. (Hrsg.), Tradition und Innovation: prähistorische Archäo-logie als historische Wissenschaft. Festschrift für C. Strahm (Rahden/Westf. 1998) 223–255.
Mechelek 1989 H. W. Mechelek, Rötha. In: J. Herrmann (Hrsg.),
Archäologie in der Deutschen Demokratischen Republik, Denkmale und Funde, 2 (Jena, Berlin 1989) 758–759.
Michálek/Lutovský 2ooo J. Michálek/M. Lutovský, Hradec u Nemetic (Stra-
konice, Praha 2ooo).Mildenberger 194o G. Mildenberger, Eine glättmusterverzierte
Schale der jüngeren Hunsrück-Eifelkultur aus Mitteldeutschland. Mannus 32, 194o, 212–219.
Miron 1991 A. Miron, Die späte Eisenzeit im Hunsrück-Nahe-
Raum – Mittel- und spätlatènezeitliche Gräberfelder. In: A. Haffner/A. Miron (Hrsg.), Studien zur Eisen-zeit im Hunsrück-Nahe-Raum (Trier 1991) 151–236.
Modderman 1983 P. J. R. Modderman, Eisenzeitliche Feuergruben
aus Hienheim, Lkr. Kelheim. Ber. Bay. Boden-denkmalpfl. 24/25, 1983/84 (1984), 7–11.
Möbes 1983 G. Möbes, Baalberger Grabanlagen im Thüringer
Becken. Alt-Thüringen 19, 1983, 43–58.Moos 2oo6 U. Moos, Feuerböcke? In: H. Meller (Hrsg.),
Archäologie XXL – Archäologie an der B 6n im Landkreis Quedlinburg. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonderband 4 (Halle [Saale] 2oo6) 149–15o.
Müller 1996 A. Müller, Zu den Befunden der urnenfelder- und
frühhallstattzeitlichen Siedlungen von Kelheim »Kanal I« (Niederbayern). Archäologische Arbeits-gemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Archeologická pracovni skupina východni Bavor-sko/západni a jižni echy. 5. Treffen 21. bis 24. Juni 1995 in Sulzbach-Rosenberg. Resümees der Vor-träge (Espelkamp 1996) 134–147
Müller 1982 D. W. Müller, Die späte Aunjetitzer Kultur des
Saalegebietes im Spannungsfeld des Südostens Europas. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 65, 1982, 1o7–127.
Müller 2oo1 J. Müller, Zur Radiokarbondatierung des Jung-
bis Endneolithikums und der Frühbronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet (41oo–15oo v. Chr.). Ber. RGK 8o, 1999 (2oo1), 28–9o.
Müller 2oo4 J. Müller, Typologieunabhängige Datierungen
und die Rekonstruktion prähistorischer Gesell-schaften. Arch. Sachsen-Anhalt 2, 2oo4, 21–29.
Müller 1985 R. Müller, Die Grabfunde der Jastorf- und Latène-
zeit an unterer Saale und Mittelelbe (Berlin 1985).Müller 1992 R. Müller, Zur Besiedlung Mitteldeutschlands im
ersten Jahrtausend v. Chr. – vor dem Zeugnis his-torischer Namen. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 75, 1992, 255–275.
Müller 1993 R. Müller, Das Gräberfeld von Trotha und die
»hallesche Kultur der frühen Eisenzeit«. Ber. RGK 74, 1993, 413–443.
Müller 1986 U. Müller, Studien zu den Gebäuden der späten
Bronzezeit und der Urnenfelderzeit im erweiter-ten Mitteleuropa. Unveröff. Diss. (Berlin 1986).
Müller/Nowak 196o H.-H. Müller/H. Nowak, Neue Feuerböcke aus
Mitteldeutschland. Jahresschr. Mitteldt. Vorge-sch. 44, 196o, 218–222.
Müllerott 1998 H. Müllerott, Eine frühmittelalterliche Siedlung
in Löbnitz an der Bode. Quellen zur Vor- und Frühgeschichte der käfernburg-schwarzburgi-schen Lande 2 (Arnstadt 1998).
Münchow u.a. 2oo3 K. Münchow/R. Kirste/I. Toni (Hrsg.), Brehna
1o53–2oo3, 95o Jahre Ersterwähnung Brehna – eine Stadt im Wandel. Begleitheft zur Ausstel-lung (Brehna 2oo3).
Neugebauer 1991 J.-W. Neugebauer, Die Nekropole F von Gemeinle-
barn, Niederösterreich (Mainz 1991).Neumann 1929 G. Neumann, Die Entwicklung der Aunjetitzer
Kultur in Mitteldeutschland. Prähist. Zeitschr. 2o, 1929, 7o–144.
Neumann 1954 G. Neumann, Ausgrabungen im Lande Sachsen.
Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Bodendenkmal-pfl. 4, 1954, 163–266.
Nitzschke/Stahlhofen 1978 W. Nitzschke/H. Stahlhofen, Ausgewählte Neu-
funde aus den Jahren 1975/76. Jahresschr. Mit-teldt. Vorgesch. 62, 1978, 221–233.
Nuglisch 1964 K. Nuglisch, Einige Typen von früheisenzeit-
lichen Knochengeräten im Ostharzgebiet. Wiss. Zeitschr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg,
Gesellschafts- u. Sprachwiss. Reihe, Jg. 13, Heft 11/12, 1964, 799–812.
Nuglisch 1965 K. Nuglisch, Die ältere Eisenzeit im östlichen und
nordöstlichen Harzvorland. Unveröff. Diss. (Halle [Saale] 1965).
Nuglisch 1967 K. Nuglisch, Die früheisenzeitliche Siedlung vom
Gelände des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale). Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 51, 1967, 231–258.
Oelmann 1929 F. Oelmann, Hausurnen oder Speicherurnen?
Bonner Jahrb. 134, 1929, 1–39.Oesterwind 1991 B. Oesterwind, Zur Frage der Mittellatènezeit im
Neuwieder Becken. In: A. Haffner/A. Miron (Hrsg.), Studien zur Eisenzeit im Hunsrück-Nahe-Raum (Trier 1991) 241–261.
Pacak 2oo3 P. Pacak, Herd an Herd. Arch. Deutschland 6,
2oo3, 5o–51.Paul 1988 M. Paul, Stadtarchäologie in Halle (Saale). Ausgr.
u. Funde 33, 1988, 2o6–215.Paulík 1959 J. Paulík, Nález mladohalštatskej mohyly v Malej
nad Hronom, okres Štúrovo. Arch. Rozhledy 11, 1959, 796–818.
Peschel 199o K. Peschel, Die Billendorfer Kultur westlich der
Elbe (Berlin 199o).Peters 2oo6 S. Peters, Die jüngstbronze- bis ältereisenzeitliche
Siedlung Wustermark 14, Lkr. Havelland (Wüns-dorf 2oo6).
Petzschmann 2oo3 U. Petzschmann, Bronze- und eisenzeitliche
Befunde auf der Südkuppe. In: H. Meller (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbege-biet Halle/Queis. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonder-band 1 (Halle [Saale] 2oo3) 83–85.
Petzschmann 2oo3 a U. Petzschmann, Die hochmittelalterliche Wüs-
tung »Gelte Mark« auf der Südkuppe. In: H. Mel-ler (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Arch. Sachsen-An-halt, Sonderband 1 (Halle [Saale] 2oo3) 11o–112
Petzschmann 2oo3 b U. Petzschmann, Befunde aus dem Mittelneo-
lithikum auf der Südkuppe. In: H. Meller (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbege-biet Halle/Queis. Arch. Sachsen-Anhalt, Sonder-band 1 (Halle [Saale] 2oo3) 37–39.
Pfeifer 2oo7 S. Pfeifer, Ein hallstattzeitlicher Salzsiedeofen bei
Löbnitz-Benneweitz, Lkr. Leipziger Land. Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 47, 2oo5 (2oo7), 21–49.
Podborský 197o V. Podborský, Mähren in der Spätbronzezeit und
an der Schwelle der Eisenzeit (Brno 197o).Preier 1999 H. Preier, Den Salzsiedern auf der Spur. Arch.
aktuell Freistaat Sachsen 5, 1997 (1999), 134–138.Preuß 1966 J. Preuß, Die Baalberger Gruppe in Mitteldeutsch-
land (Berlin 1966).Primas 1978 M. Primas, Untersuchungen zu den Bestattungs-
typen der ausgehenden Kupfer- und frühen Bron-zezeit. Ber. RGK 58, 1977 (1978), 1–16o.
Quitta/Kaufmann 1995 H. Quitta/H. Kaufmann, Die latènezeitliche Sied-
lung in der Hart bei Zwenkau, Lkr. Leipziger Land. Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Boden-denkmalpfl. 37, 1995, 117–134.
Raßhofer 2oo2 G. Raßhofer, Eine hallstattzeitliche Siedlung in
Velburg. Das arch. Jahr in Bayern 2oo2, 5o–53.
Archäolog ie in Sachsen-Anhal t · Sonderband 12 · 2010
L IT E R AT U RV E R Z E I C H NIS
186
v. Rauchhaupt 2oo3 R. v. Rauchhaupt, Die eisenzeitliche Siedlung vom
Windmühlenberg bei Nitzschka. Arbeits- u. Forsch-ber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 45, 2oo3, 197–23o.
Reichenberger 1994 A. Reichenberger, »Herrenhöfe« der Urnenfelder-
und Hallstattzeit. In: D.-W. Buck (Hrsg.), Archäo-logische Untersuchungen zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit zwischen Nordsee und Kaukasus. Regensburger Beitr. Prähist. Arch. 1 (Regensburg 1994) 187–215.
Reichenberger/Wohlfeil 1999 A. Reichenberger/J. Wohlfeil, Vorbericht zu den
archäologischen Untersuchungen beim Bau der Pipeline Rostock-Böhlen im Streckenabschnitt zwischen Wahrenberg, Ldkr. Stendal, und Glin-denberg, Ldkr. Ohrekreis. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 81, 1999, 371–41o.
Rettungsgrabungen 1979 Westfälisches Landesmuseum für Vor- und Früh-
geschichte (Hrsg.), Archäologische Denkmäler in Gefahr. Rettungsgrabungen der Bodendenkmal-pflege in Westfalen 1973–1978 (Münster 1979).
Riehm 196o K. Riehm, Die Formsalzproduktion der vorge-
schichtlichen Salzsiedestätten Europas, Jahres-schr. Mitteldt. Vorgesch. 44, 196o, 18o–217.
Riehm/Nuglisch 1963 K. Riehm/K. Nuglisch, Der Heinrich-Heine-Fel-
sen (Lehmanns-Felsen) in Halle (Saale) als spät-bronze- und früheisenzeitliche Siedlungsstätte. Wiss. Zeitschr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wit-tenberg 12, 1963, 923–942.
Ruckdeschel 1978 W. Ruckdeschel, Die frühbronzezeitlichen Gräber
Südbayerns (Bonn 1978).Ruiz 1997 E. R. Ruiz, Perles en verre provenant de la nécro-
pole ibérique d'El Cigrralejo, Mula (Murcia, Espag ne), V.–II. Siècle av. J.-C. In: U. v. Freeden/ A. Wieczorek (Hrsg.), Perlen – Archäologie, Tech-niken, Analysen (Bonn 1997) 13–41.
Schäfer 2oo2 A. Schäfer, Häuser der Eisenzeit. Arch. Nieder-
sachsen 5, 2oo2, 18–2o.Schaich/Rieder 1998 M. Schaich/K. H. Rieder, Eine hallstattzeitliche
Siedlung mit »Herrenhof« im Anlautertal bei Enkering. Das arch. Jahr in Bayern 1998, 48–5o.
Schauer 2oo4 P. Schauer, Archäologische Untersuchungen auf
dem Bogenberg, Niederbayern II. Beiträge zur Besiedlungsgeschichte (Bonn 2oo4).
Schirwitz 1925 K. Schirwitz, Ein seltener Fund aus dem Harzge-
biet. Mannus 16, 1924 (1925) 74–77.Schirwitz 196o K. Schirwitz, Die Grabungen auf dem Schloss-
berg zu Quedlinburg. Jahresschr. Mitteldt. Vorge-sch. 44, 196o, 9–5o.
Schlenker 1998 B. Schlenker, Die archäologischen Befunde und
Funde im Bereich der Erdgastrasse Wernigerode-Oschersleben, Sonderstrecke 2. Veröff. Landes-amt Arch., Landesmus. Vorgesch. Sachsen-An-halt 53 (Halle [Saale] 1998).
Schmidt 2oo5 J.-P. Schmidt, Grillfest oder Opferkult? – Der Feu-
erstellenplatz von Jarmen, Lkr. Demmin. In: U. M. Meier (Red.), Die Autobahn A 2o – Nord-deutschlands längste Ausgrabung, archäologi-sche Forschungen auf der Trasse zwischen Lübeck und Stettin. Arch. in Mecklenburg-Vor-pommern 4 (Schwerin 2oo5) 71–76.
Schönfelder u. a. 2oo4 G. Schönfelder/F. Gränitz/H. T. Porada (Hrsg.), Bit-
terfeld und das untere Muldetal. Eine landes-kundliche Bestandsaufnahme im Raum Bitter-feld, Wolfen, Jeßnitz (Anhalt), Raguhn, Gräfen-hainichen und Brehna, Landschaften in
Deutschland. Werte der deutschen Heimat 66 (Köln, Weimar, Wien 2oo4).
Schulz 1925 W. Schulz, Über Hausurnen. Mannus 17, 1925,
81–89.Schunke 2ooo T. Schunke, Die keramischen Funde aus dem
Bereich des frühbronzezeitlichen Grabenwerkes der Aunjetitzer Kultur im Braunkohlentagebau Zwenkau-West. Unveröff. Magisterarbeit, Mar-tin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg 2ooo.
Schunke 2oo4 T. Schunke, Der Hortfund von Hohenweiden-
Rockendorf und der Bronzekreis Mittelsaale. Ein Beitrag zur jungbronzezeitlichen Kulturgruppen-gliederung im Mitteldeutschland. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 88, 2oo4, 219–337.
Seidel 1996 R. Seidel, Beobachtungen zur Funktion von Mahl-
steinen an Beispielen aus Ostholstein. Arch. Nach-richten aus Schleswig-Holstein 7, 1996, 121–146.
Simon 1969 K. Simon, Eine hallstattzeitliche Töpferei für gra-
phitbemalte Keramik aus Mitteldeutschland. Zeitschr. Arch. 3, 1969, 256–293.
Simon 1979 K. Simon, Glättmusterverzierte Keramik der frü-
hen Latènezeit von Großstorkwitz, Kr. Borna. Ausgr. u. Funde 24, 1979, 19–34.
Simon 1979a K. Simon, Ein »Grabservice« mit Graphitbemalung
aus der frühen Hallstattzeit von Crauschwitz, Kr. Naumburg. Ausgr. u. Funde 24, 1979, 174–179.
Simon 198o K. Simon, Eine Kalenderbergscherbe von der Hei-
denschanze bei Dresden-Coschütz. Ausgr. u. Funde 25, 198o, 17–27.
Simon 1983 K. Simon, Eine Siedlung der entwickelten Thürin-
gischen Kultur im Stadtgebiet von Weimar. Alt-Thüringen 19, 1983, 59–82.
Simon 1985 K. Simon, Zur Datierung des säulenförmigen Bri-
quetages im Saalegebiet. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 68, 1985, 263–277.
Simon 199o K. Simon, Höhensiedlungen der älteren Bronze-
zeit im Elbsaalegebiet. Jahresschr. Mitteldt. Vor-gesch. 73, 199o, 287–33o.
Simon 1991 K. Simon, Ur- und frühgeschichtliche Höhensied-
lungen auf der Rudelsburg bei Bad Kösen. Jahres-schr. Mitteldt. Vorgesch. 74, 1991, 59–13o.
Stäuble 1999 H. Stäuble, Von der Linie zur Fläche. Archäolo-
gische Großprojekte im Südraums Leipzigs. Vorträge des 17. Niederbayerischen Archäologen-tages (Rahden/Westf. 1999) 149–19o.
Stäuble 2oo2 H. Stäuble, Lineare Gräben und Grubenreihen in
Nordwestsachsen. Eine Übersicht. Arbeits- u. Forschungsber. Sächs. Bodendenkmalpfl. 44, 2oo2, 9–49.
Stäuble/de Vries 2oo2 H. Stäuble/P. de Vries, Am Rand und dennoch
nicht Peripherie. Ausgrabungen an der Autobahn 17. Dresdner Geschichtsbuch 8, 2oo2, 7–22.
Steinmann 2ooo C. Steinmann, Der nächste Schnitt – Ausgrabun-
gen an der JAGAL. Arch. aktuell Freistaat Sach-sen 6, 1998–99 (2ooo) 48–57.
Struve 1955 K. Struve, Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Hol-
stein und ihre kontinentalen Beziehungen (Neu-münster 1955).
Tackenberg 1971 K. Tackenberg, Die jüngere Bronzezeit in Nord-
westdeutschland (Hildesheim 1971).Töpfer 1961 V. Töpfer, Die Ugeschichte von Halle (Saale).
Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, Ges.-Sprachwiss. X/3, 1961, 759–848.
Venclová 199o N. Venclová, Prehistoric glass in Bohemia (Praha
199o).Vermeulen/Antrop 2oo1 F. Vermeulen/M. Antrop, Ancient lines in the
landscape. A geo-archaeological study of proto-historic and Roman roads and field systems in northwestern Gaul (Leuven, Paris, Sterling 2oo1).
Vogel 1975 C. Vogel, Die Siedlungskeramik der Aunjetitzer
Kultur, aufgezeigt an ausgewählten Beispielen aus dem Bezirk Halle/Saale. Ungedr. Diplomar-beit (Halle [Saale] 1975).
Vogt 1989 H.-J. Vogt, Groitzsch. In: J. Herrmann (Hrsg.),
Archäologie in der Deutschen Demokratischen Republik, Denkmale und Funde 2 (Jena, Berlin 1989) 754–758.
Voigt 1956 T. Voigt, Bemerkenswerte spätneolithische
Brandgrabfunde von Biederitz, Kreis Burg. Jah-resschr. Mitteldt. Vorgesch. 4o, 1956, 1o9–127.
Wagner 2ooo K. Wagner, Neuentdeckte jungbronzezeitliche
Siedlung in Berlin-Lichterfelde, Bezirk Steglitz. In: J. Haspel/W. Menghin, Miscellanea Archaeo-logica – Festgabe für Adriaan von Müller zum 7o. Geburtstag, Beiträge Denkmalpfl. Berlin, Sonder-band (Berlin 2ooo) 42–7o.
Wahle 19o9 E. Wahle, Vorgeschichtliche Urnenfriedhöfe bei
Schenkenberg, Kreis Delitzsch. Jahreschr. Mit-teldt. Vorgesch. 8, 19o9, 153–213.
Wendorff 1981 C. Wendorff, Die Gräberfelder der Hausurnenkul-
tur von Beierstedt, Kreis Helmstedt, und Eilsdorf, Kreis Halberstadt, im Harzvorland. Neue Ausgr. u. Forsch. in Niedersachsen 14, 1981, 115–219.
Westphalen 2oo4 T. Westphalen, Gräben und Gruben bei Dober-
stau. In: Von Peißen nach Wiederitzsch. Archäo-logie an einer Erdgas-Trasse (Gröbers 2oo4) 78–79.
Wetzel 1979 G. Wetzel, Die Schönfelder Kultur (Berlin 1979).Wietrzichowski 2oo3 F. Wietrzichowski, Eine jungbronzezeitliche Sied-
lung in der Gemarkung Güstrow, Lkr. Güstrow. Arch. Ber. aus Mecklenburg-Vorpommern 1o, 2oo3, 48–64.
Winghart 1983 S. Winghart, Eine Siedlung der Urnenfelder- oder
Hallstattzeit von Eching. Das arch. Jahr Bayern 1983, 65–67.
Wirtz 2ooo D. Wirtz, Altliebel – Eine Siedlung der Lausitzer
Kultur im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. Arch. aktuell Freistaat Sachsen 6, 1998–99 (2ooo) 78–83.
Woithe/Rößler 2oo1 F. Woithe/H. Rößler, Bodenkundliche Untersu-
chung überdünter Wölbäcker in den Fluren von Merzdorf und Dissenchen, Tagebauvorfeld Cott-bus-Nord. Arbeitsber. Bodendenkmalpfl. Bran-denburg 8, 2oo1, 196–2o2.
Wulf/ Steinmann 1994 D. Wulf/C. Steinmann, Ost-Einflüsse. In:
H.-J. Beier/R. Einicke (Hrsg.), Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet und in der Altmark (Wil-kau-Hasslau 1994) 321–328.
Zepezauer 1993 M. A. Zepezauer, Glasperlen der vorrömischen
Eisenzeit III. Mittel- und spätlatènezeitliche Per-len (Marburg 1993).
Zich 1996 B. Zich, Studien zur regionalen und chronologi-
schen Gliederung der nördlichen Aunjetitzer Kul-tur (Berlin, New York 1996).