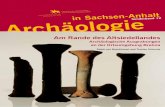160-42/2016 Datum: 9 .2. 2022 Na podlagi drugega odstavka ...
Köthen im Jahre 1111 – das älteste Datum zur Stadtgeschichte. In: Archäologie in...
Transcript of Köthen im Jahre 1111 – das älteste Datum zur Stadtgeschichte. In: Archäologie in...
in Sachsen-Anhalt
ArchäologieRichard-Wagner-Str. 906114 HalleTel. 0345 · 5247 – 30Fax. 0345 · 5247 – [email protected]
2011
Archäologie in Sachsen-A
nhalt
Band 5 / 2011Archäologie in Sachsen-Anhalt
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V.
IMPRESSUM
Herausgeber Harald Meller, Landesamt für Denkmalpflege und ArchäologieSachsen-AnhaltThomas Weber, Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V.
Erscheinungsweise jährlich, Beihefte unregelmäßig
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über http//dnb.ddb.de abrufbar.
gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier
isbn 978-3-939414-21-6
issn 161o-6148
Wissenschaftliche Redaktion Bernd W. Bahn, Susanne Kubenz, Sven Roos, Manuela Schwarz
Layout und Satz Thomas Blankenburg, Rita Borcherdt, Nora Seeländer
Gesamtredaktion Manuela Schwarz
Für den Inhalt der Arbeiten sind die Autoren eigenverantwortlich.
© by Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt –Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). Das Werk ein-schließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. JedeVerwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-gesetzes ist ohne Zustimmung des Landesamtes für Denkmal-pflege und Archäologie Sachsen-Anhalt unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlag Titelseite Magdeburg, Dom. Der Bleisarg Königin Edithas nach der Bergung und einer ersten Restaurierung(Juraj Lipták • München)
Umschlag Rückseite Befundplan der Grabungskampagnen in Goseck, Burgenlandkreis(A. Northe • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Schriften FF Celeste, BT News GothicGestaltungskonzept Carolyn Steinbeck • Berlin
Produktion Thomas Blankenburg, Rita Borcherdt, Nora Seeländer,Marion Spring, Mario Wiegmann
Druck und Bindung Messedruck Leipzig GmbH
Die Zeitschrift »Archäologie in Sachsen-Anhalt« dient den Zielen der
Satzung, die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte des Bundes-
landes zu fördern und breiten Bevölkerungskreisen zu vermitteln
sowie einen großen Mitglieder- und Interessentenkreis aufzubauen.
5/11
5
in Sachsen-Anhalt
ArchäologieRichard-Wagner-Str. 906114 HalleTel. 0345 · 5247 – 30Fax. 0345 · 5247 – [email protected]
2011
Archäologie in Sachsen-A
nhalt
Band 5 / 2011Archäologie in Sachsen-Anhalt
Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V.
IMPRESSUM
Herausgeber Harald Meller, Landesamt für Denkmalpflege und ArchäologieSachsen-AnhaltThomas Weber, Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e. V.
Erscheinungsweise jährlich, Beihefte unregelmäßig
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über http//dnb.ddb.de abrufbar.
gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier
isbn 978-3-939414-21-6
issn 161o-6148
Wissenschaftliche Redaktion Bernd W. Bahn, Susanne Kubenz, Sven Roos, Manuela Schwarz
Layout und Satz Thomas Blankenburg, Rita Borcherdt, Nora Seeländer
Gesamtredaktion Manuela Schwarz
Für den Inhalt der Arbeiten sind die Autoren eigenverantwortlich.
© by Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt –Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). Das Werk ein-schließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. JedeVerwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-gesetzes ist ohne Zustimmung des Landesamtes für Denkmal-pflege und Archäologie Sachsen-Anhalt unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlag Titelseite Magdeburg, Dom. Der Bleisarg Königin Edithas nach der Bergung und einer ersten Restaurierung(Juraj Lipták • München)
Umschlag Rückseite Befundplan der Grabungskampagnen in Goseck, Burgenlandkreis(A. Northe • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Schriften FF Celeste, BT News GothicGestaltungskonzept Carolyn Steinbeck • Berlin
Produktion Thomas Blankenburg, Rita Borcherdt, Nora Seeländer,Marion Spring, Mario Wiegmann
Druck und Bindung Messedruck Leipzig GmbH
Die Zeitschrift »Archäologie in Sachsen-Anhalt« dient den Zielen der
Satzung, die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte des Bundes-
landes zu fördern und breiten Bevölkerungskreisen zu vermitteln
sowie einen großen Mitglieder- und Interessentenkreis aufzubauen.
5/11
5
5 Harald Meller Vorwort
Aktuelle Forschungen 7 Mirko Gutjahr Von einem Goldring vom Lutherhaus in Wittenberg zu einem möglichen Selbstbildnis
von Robert Campin
13 François Bertemes und Andreas Northe Die Kreisgrabenanlage von Goseck
37 Hans-Georg Stephan Goseck im Mittelalter: Siedlungen, Schloss, Burg und Kloster Goseck
46 Rainer Kuhn und Ernst Schubert Neues zur Königin Edith
Weitere Beiträge 55 Rosemarie Müller Vorrömische Eisenzeit. Teil I: Ältere vorrömische Eisenzeit
63 Matthias Thomae Die lange Reise der Findlinge nach Sachsen-Anhalt
71 Wernfried Fieber Findlinge als Kulturdenkmale. Versuch einer kulturhistorischen Einordnung
79 Alexander Häusler Zum Stand der Diskussion über Ursprung und Ausbreitung der Indogermanen
91 Artur Kögler Sternenhimmel und Rechtsprechung
97 Heiko Breuer Ein Fuß – Überlegungen zur Entwicklung und Erforschung von Maßen und Gewichten
105 Roland R. Wiermann Von der Altmühl an die Weiße Elster – Fränkischer Plattensilex in Sachsen-Anhalt
110 Torsten Schunke Steine lesen – der Zufallsfund einer besonderen spätneolithischen Steinaxt aus dem nordöst-
lichen Harzvorland
113 Mechthild Meinike Astronomische Betrachtungen zum fünfgliedrigen Palisadenringsystem von Quenstedt –
Die »Schalkenburg«
118 Mechthild Meinike Die Trojaburg von Steigra, Saalekreis
124 Maik Evers Bronzezeitliche Funde aus Gewässern und ihrer unmittelbaren Umgebung in Sachsen-An-halt
131 Torsten Schunke Vier Funde – ein Fund: ein »alter« Hortfund der Periode III aus der Nähe des Süßen und
des Salzigen Sees im Lkr. Mansfeld-Südharz
137 Torsten Montag Halle (Saale) in der Eisenzeit
151 Monika Hellmund Holzkohle aus Brandgräbern der Römischen Kaiserzeit von Großwirschleben,
Gemeinde Plötzkau, Salzlandkreis
156 Gerhard Schmidt † Die »Eichstädter Warte« – ein mittelalterlicher Wachturm
162 Artur Kögler Noch einmal: Schleif- oder Wetzrillen
Grabungsberichte 167 Thomas Laurat, Enrico Brühl und Dovydas Jurkénas Frühe Menschen an der Geisel – die Ausgrabungen am pleistozänen Seebecken
Neumark-Nord 2 im Geiseltal, Saalekreis
184 Hans Joachim Behnke Erste Siedler der Linienbandkeramik in der Karsdorfer Feldflur.
Ergebnisse der Grabungen im Jahr 2005
200 Daniel Dübner Eine mehrperiodige Siedlung von Spören, Lkr. Anhalt-Bitterfeld
202 Andreas Schwarz Vorarbeit zu einer Grabung bei Salzfurtkapelle, Lkr. Anhalt-Bitterfeld
203 Torsten Schunke Eine datierte Siedlungsbestattung der Baalberger Kultur aus Quetzdölsdorf,
Lkr. Anhalt-Bitterfeld
209 Volkhard Hirsekorn, Jens Lühmann, Ralf-Jürgen Prilloff und Wolfgang Schwarz Eine jungbronzezeitliche Hundebestattung aus Nahrstedt, Lkr. Stendal
214 Fabian Gall Wieder ein eisenzeitliches Urnengrab in Zahna, Lkr. Wittenberg, entdeckt!
217 Brigitte Schiefer Eine slawische Burganlage des 8./9. Jh. und ein slawischer Bestattungsplatz bei Schrenz,
Lkr. Anhalt-Bitterfeld
231 Uwe Vogt Eine neue slawische Fundstelle bei Loburg, Lkr. Anhalt-Bitterfeld
234 Torsten Schunke Köthen im Jahr 1111 – die ältesten Daten zur Stadtgeschichte
InhAlt
243 Jana Esther Fries Kanalgräben und Abfallgruben – Baubegleitende Untersuchungen in Bebertal, Lkr. Börde
251 Christian Gildhoff Archäologie unterm Keller. Siedlungs- und Bestattungsspuren von der Bronzezeit bis zur
Neuzeit westlich des Breiten Weges in Magdeburg
268 Ralf-Jürgen Prilloff Kaninchen und Grünschenkel – frühneuzeitliche Tierreste aus Magdeburg
285 Doris Köther Planierte Altstadt – der Elbeuferbereich Magdeburgs im 12. Jahrhundert
293 Brigitte Dahmen Geschichte auf dem Hinterhof – Die Ausgrabung Alter Markt 7 in Magdeburg
306 Christian Froh Zur baulichen Entwicklung eines zweischiffigen Kreuzgangsflügels im Kloster Drübeck,
Lkr. Harz
316 Christian Froh Zum Aufbau des mittelalterlichen Kreuzhofes im Kloster Ilsenburg, Lkr. Harz
326 Tanja Autze Ausgrabungen im Stadtkernbereich von Seehausen in der Altmark
333 Hartmut Bock und Monika Hellmund Ein verkohlter Erbsenvorrat aus Maxdorf, Altmarkkreis Salzwedel
340 Gregor Alber, Ralf-Jürgen Prilloff und Wolfgang Schwarz Ein spätmittelalterliches Pferdeskelett in einem eisenzeitlichen Grubenhaus aus Stendal,
Fpl. Uppstall-Süd
351 Uwe Fiedler Symbolisch hingerichtet – ein bronzener Hitlerkopf vom Halberstädter Domplatz
Mitteilungen 355 Bernd W. Bahn Salz und Kupfer. Die Archäologische Gesellschaft zwischen den Jahrestagungen in
Schönebeck 2005 und Mansfeld 2006
365 Bettina Stoll-Tucker und David Tucker Archäologische Wanderung im Saaletal
367 Bodo Wemhöner Archäologische Exkursion in die westliche Dölauer Heide
369 Bernd W. Bahn Hünenburg – Heeseberg – Hoohseoburg? Exkursion der Archäologischen Gesellschaft zu
archäologischen Denkmalen bei Schöningen in Niedersachsen
380 Bernd W. Bahn und Wernfried Fieber Beiderseits der Saale nördlich von Halle.
Die Winter-Exkursionen 2006 der Archäologischen Gesellschaft
388 Mandy Poppe Die Archäologische Gesellschaft 2006 zum ersten Mal auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in
Halle vertreten
InhAlt
Museen 391 Manuela Werner und Bettina Pfaff Arche Nebra – Die Himmelsscheibe erleben. Eröffnung des neuen Besucherzentrums am
Fundort der Himmelsscheibe von Nebra
402 Ulrich Hauer Das Museum Haldensleben und die Archäologie
407 Antje Reichel Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung im Prignitz-Museum Havelberg, Lkr. Stendal
415 Antonia Beran Das Kreismuseum Jerichower Land In Genthin und seine ur- und frühgeschichtliche Aus-
stellung und Sammlung
Personalia 421 Andreas Hille Denkmalpreis 2006 des Landes Sachsen-Anhalt für Kurt Klausnitzer. Laudatio
425 Detlef W. Müller Gerhard Schmidt aus Langeneichstädt zum Gedächtnis
427 Berthold Schmidt Dem Andenken an Heribert Stahlhofen
428 Jubiläumsgeburtstage und Todesfälle ehrenamtlich Beauftragter für archäologische Denkmalpflege der Jahre 2006, 2007 und 2008
Aktuell 431 Museumsverein
431 Archäologische Gesellschaft
432 Autorenverzeichnis
InhAlt
Im Zuge der Neugestaltung der Schalaunischen Straße in Köthen, Lkr. Anhalt-Bitterfeld, wurden umfangreiche Erdarbeiten erforderlich, die eine archäologische Untersuchung notwendig mach- ten. Besonders im Bereich eines neu zu setzen- den Brunnens waren tiefe Eingriffe nötig. Die- ser Brunnen wurde auf einer kleinen platzartigen Erweiterung der Schalaunischen Straße gebaut, die – vom Buttermarkt kommend – durch einen rechtwinkligen Schwenk der Straße nach Süden und einen schmalen Durchgang zur Burgstraße dreieckig aufgespannt wird (Abb. 1a). Die geplante Baugrube für die Brunnentechnik und das Wasser- reservoir der neuen Anlage, mitten auf diesem kleinen Platz, hatte auf der Sohle eine ost-west- ausgerichtete rechteckige Form mit einer Ausdeh- nung von 5,o m x 2,25 m sowie eine Tiefe von 3,3 m. Die Grubenwände sollten im Winkel von 45° aufsteigen. Damit waren für die gesamte Bau- grube auf Höhe des heutigen Straßen niveaus Ein- griffe in einer Ausdehnung von 8 m x 1o m not- wendig. Die archäologischen Außenarbeiten
wurden – als dem eigentlichen Bauablauf vorgezo- gene Maßnahme – im Februar 2oo4 durch stud. phil. M. Kultus, Halle (Saale), und Verfasser aus-geführt1.
Zu Beginn der Grabung war das alte Betonplat- tenpflaster der Fußgängerzone bereits entfernt. Darunter erstreckten sich bis in eine Tiefe von etwa 1 m die Auffüllschichten aus der Bauzeit der Fußgängerzone (7oer Jahre des 2o. Jh.). Der gesamte Nordteil des Schnittes wurde tiefgrün- dig durch eine parallel laufende Asbestbeton-Trink- wasserleitung der 197oer Jahre gestört. Dadurch war kein archäologisch relevantes Nordprofil im Schnitt zu bekommen. Das Ostprofil zeigte schon zu Beginn des Abteufens, dass der Schnitt bei maximaler Ostausdehnung innerhalb einer sich östlich anschließenden Störung liegen würde. Des- halb wurde es etwas westlicher als die maximale Baugrubensohle angelegt. Die zu untersuchende Baugrube hatte durch diese Störungen Ausmaße von nur etwa 3,8o m x 2,oo m (Abb. 1b). Inner- halb dieses Bereiches wurde eine sehr inter essante
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011234
grabungsber ichte
Köthen im Jahr 1111 – die ältesten Daten zur StadtgeschichteTorsten Schunke, Halle (Saale)
abb. 1a Köthen, Lkr. Anhalt- Bitterfeld. Der mittelalterliche
Stadtkern (nach Giesau 1943). Der rote Punkt bezeichnet die
Stelle der archäologischen Dokumentation.
Stratigrafie mit zwei Pflasterungen – oberes und unteres Pflaster genannt – aufgedeckt. Sie sei im Folgenden in chronologischer Reihen folge von unten nach oben anhand des sehr aussagekräf- tigen Südprofils (Abb. 2) beschrieben.
Über dem anstehenden Boden lag ein prähis-torischer B-Horizont. Von diesem ausgehend wa- ren Gruben abgeteuft, von denen eine kleine Grube, evtl. eine Pfostengrube, dokumentiert werden konnte. Sie enthielt zwei kleine Scherben. Da auch in dem B-Horizont einige kleine Scherben lagen, kann belegt werden, dass dieser Bereich zu einer prähistorischen Siedlung gehörte. Eine genau ere Datierung ist nicht möglich. Diese Schicht wurde von einer sehr festen, dunkelgrauen und auffäl- lig trockenen Lehmschicht von 1o cm Stärke, die ausschließlich äußerst wenige, nicht näher da- tierbare prähistorische Scherben und Tierkno-chenfragmente enthielt, überdeckt. Die Verfesti- gung rührt wahrscheinlich von dem aufliegenden,
ebenfalls sehr festen »unteren« Pflaster her. Die Schicht wurde von zwei Pfostengruben ge-schnitten. Da diese nicht durch das darüber lie- gende untere Pflaster reichten, belegen sie, dass die Schicht in einem gewissen Zeitraum existierte, ohne dass das Pflaster schon aufgebracht war. Die Lehmschicht kann also keine intentionelle Grün- dung für das aufliegende untere Pflaster gewesen sein. Ob die Lehmschicht tatsächlich prähisto-risch ist, oder ob die Scherben vielmehr sekun-där hinein gelangten, was nach den Erfahrungen mit dem im Folgenden zu besprechenden Pflaster wahrscheinlicher ist, kann nicht mit letzter Sicher - heit entschieden werden.
Die erwähnten beiden Pfostengruben, in wel-chen sich die Pfostenstandspuren noch sehr gut erkennen ließen, waren mit auffallend lockerem Sediment verfüllt. Das spricht dafür, dass sie durch das feste, darüber liegende Pflaster in dieser Art konserviert worden sind und damit auch für ei-
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011 235
grabungsber ichte
abb. 1b Köthen, Lkr. Anhalt- Bitterfeld. Der Grabungsschnitt in der Schalaunischen Straße mit einem Ausschnitt des frei-gelegten älteren Straßenniveaus von Nordwesten.
abb. 2 Köthen, SchalaunischeStraße. Profil mit prähistori- schen Pfostengruben (unten), dem Paket aus unterem und oberem Pflaster und darüber liegenden Deckschichten. Blick nach Süden.
nen nicht zu großen zeitlichen Abstand zwischen dem Ziehen der Pfosten und dem Anlegen des unteren Pflasters.
Das untere Pflaster (Abb. 3) dürfte eine erste Straßen- oder Platzbefestigung darstellen. Es han- delte sich um eine sehr einfach angelegte Pflas-terung, bestehend aus kleinen bis mittleren Geröl- len von 1,5–5 cm Größe und hatte eine Stärke von durchschnittlich nur 2–3 cm. Größere Steine und Knochen waren tiefer eingetreten, so dass sie
eine relativ gleichmäßige Oberkante mit dem übri- gen Pflaster bildeten. Bemerkenswert war die Fes - tigkeit des Pflasters und seine (in den gesichert originalen Bereichen) ebene Ausführung. Außer- gewöhnlich waren die im Pflaster verteilten Fun-de. Im Wesentlichen waren das Tierknochen und horizontal liegende Scherben. Diese waren fest eingetreten bzw. wirkten absichtlich »ver-baut«. Es handelt sich fast durchgängig um prähis- torische, bei den datierbaren um spätlatène- bis
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011236
grabungsber ichte
abb. 3a+b Köthen, Schalau-nische Straße. a) Das untere
Pflaster mit der Senke im Vordergrund; b) Detail mit
Kieseln, Geröllen, Scherben und Tierknochen. 3a
3b
frühkaiserzeitliche Scherben (Abb. 4) sowie um mehr als 3 kg Tierknochen. Wieso derart viele dieser Scherben in das Pflaster gelangen konn-ten, ist schwer erklärbar. Vielleicht wurden sie bei der Gewinnung der kleinen Gerölle für das Pflaster mit ausgesiebt und dann ebenfalls ver-baut. Vor allem ist der Kontrast zu den wenigen vorhandenen mittelalterlichen Scherben (Abb. 5,1– 8) sehr groß. Diese Scherben weisen noch keinen sehr harten (»Blaugrau«-) Brand auf und sind zu- nächst allgemein dem 1o.–12. Jh. zuzuordnen. Un- ter dem Fundmaterial befinden sich weiterhin zwei durchlochte Tierphalangen (Abb. 6). Direkt auf dem Pflaster lagen ein Hufeisen mit Wel- lenrand (Abb. 5,9) sowie ein Koprolith.
Das Pflaster wies im Nordwestbereich des Schnittes eine Art »Senke« auf (Abb. 3a), die wohl erst im Laufe seiner Nutzungszeit entstanden ist. Während die östliche und südöstliche »Böschung« recht steil und ohne Funde waren, schien das Pflaster ganz im Westen des Schnittes von Süden her in die »Senke« hineinzulaufen. Auf der Sohle der »Senke« lagen ebenso wie im echten Pflaster Gerölle, Tierknochen und Scherben, teilweise ver- festigt und eben, teilweise aber auch weniger fest und unebener als an den anderen Stellen. Die Senke war mit stark ausdünstendem, fäkalien-haltigem Bodenmaterial angefüllt. In diesem fan- den sich noch slawische, kammwellenverzierte Scherben (Abb. 5,6–8) sowie eine Messingnadel mit Nagelkopf (Abb. 7).
In das Pflaster sind nachträglich recht dünne, angespitzte Pflöcke eingebracht worden, die sich auch erhalten haben. Eindeutig ist die Nachzei-tigkeit durch die herausgenommenen Steine zu
erkennen gewesen. Ob sie während der Nut-zungszeit des Pflasters oder erst danach einge-baut worden sind, ist ebenso wie ihre Funktion nicht zu klären.
Über allen genannten Befunden lag, diese nach oben abschließend, in etwa 1,9o m Tiefe unter dem heutigen Straßenniveau ein aufwändig ge- bautes Straßenpflaster. Es bestand aus einer Trag- schicht und dem eigentlichen Pflaster als Deck-schicht. Zusammen hatte diese Konstruktion eine Mächtigkeit von 2o cm (Abb. 2). Bemer- kenswert waren untergelegte Hölzer, die sich ein- deutig innerhalb der unteren Tragschichtlage fan- den (Abb. 8). Bei diesen Hölzern handelte es sich mehrheitlich um Eichenhölzer. Es kamen – neben den dominierenden Rundhölzern (Astholz) – auch Spalthölzer und brett- bzw. bohlenartige Hölzer vor. Keines zeigte Bearbeitungsspuren, die auf eine andersartige vorherige Nutzung schließen lassen. Deutlich war erkennbar, dass die Hölzer sämtlich nordnordwest-südsüdost-ausgerichtet waren. Einige wenige knickten im Süden nach Süd ab. Im Nordwesten des Schnittes lagen die Hölzer dicht an dicht und überdeckten dadurch die oben erwähnte, fäkalienhaltige Senke, um ein Einsinken der Steine der Tragschicht in die of- fenbar noch nicht völlig verfestigte Füllung zu verhindern. Weiter im Osten befand sich die Trag- schicht direkt über dem unteren Pflaster. In diese Richtung lagen die Hölzer bereits mit Zwischen-räumen und immer größer werdenden Abstän-den. Dort waren sie teilweise auch auf plattigen Steinen der Tragschicht gelagert.
Die Tragschicht selbst bestand aus meist kan-tigen bis leicht gerundet-quaderförmigen Bruch-
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011 237
grabungsber ichte
abb. 4 Köthen, SchalaunischeStraße. Vorgeschichtliche Funde aus und direkt über dem unte- ren Pflaster. M 1:2.
1 2 3 4
5
9
6 7 8
10 11
141312
16 17
15
18
steinen unterschiedlicher Größe (1,5–ca. 15 cm, Abb. 9c). Nach Aussage von Frau Dr. Clasen, Lan- desamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach- sen-Anhalt (LDA), handelt es sich um Kalkstein, also ortsfremdes Material, das in der Region um Bernburg ansteht. Die Steine waren sehr dicht zusammengelegt, wobei die Größen ständig wech- selten. Wahrscheinlich durch die frühere Benut-zung der Straße, aber auch durch die im Wasser gelösten und wieder ausgefällten Kalkanteile hat die Tragschicht eine erstaunliche Festigkeit er- langt. Beim Abbau der Schicht musste eine Brech- stange eingesetzt werden. In der Tragschicht ver- teilt lagen relativ viele Funde. Vorrangig fanden sich Tierknochen, aber auch Scherben. Da es sich bei den Scherben überwiegend um prähistori-sche Keramik handelt, dürften sie von dem dar-unter liegenden unteren Pflaster stammen. Tat-sächlich traten die meisten dieser Scherben im Ostteil des Schnittes auf, wo unteres und oberes Pflaster in nur geringem Abstand übereinander lagen.
Auch das auf der Tragschicht liegende obere Pflaster bestand aus meist gerundet quaderförmi-gen Geröllen unterschiedlicher Größe (1,5–ca. 15 cm, Abb. 9b) und war ebenfalls stark verfes-tigt. Allerdings enthielt es verschiedene Gesteins-
arten (u. a. Granit, Quarzit, Kalkstein). An den gut erhaltenen Stellen war zu erkennen, dass die in ihren Größen wechselnden Steine sehr sorg-fältig dicht zusammengelegt worden waren. Auf- fällig war jedoch, dass nur eine recht grobe Hori- zontierung erreicht wurde. Fahrspuren konnten nicht beobachtet werden. Das Pflaster war ins- gesamt leicht nach Süden geneigt (Abb. 1o). Di- rekt auf dem Pflaster lagen auffällig wenige Funde. Lediglich einige kleine Tierknochen fragmente wur- den geborgen. Dies kann nur mit einer bewuss-ten Sauberhaltung des Pflasters erklärt werden.
Die Konstruktion Tragschicht/Deckschicht war im Osten und im Westen stark gestört bzw. zer-stört (Abb. 2; 1o). Das rührte eindeutig von Ein-griffen her, die zur Entstehung der aufliegenden Schichten geführt haben. In diesen Schichten fan- den sich viele Kalkbruchsteine, die sicher ehe- mals zu der Pflasterung gehört hatten. Im Störungs- bereich lagen auf der Tragschicht ein Hufeisen, ein Hufnagel und eine Eisenkrampe.
Über dem Pflaster lagen schließlich mehrere, durch ihr Material gut trennbare Schichten. Sie bildeten ein fast 1 m starkes Schichtpaket, wel-ches von Ost nach West und von Süd nach Nord stark abfiel (Abb. 2). Da diese Schichten sämtlich dieselbe Neigung aufwiesen, muss das gesamte Paket in einem sehr kurzen Zeitraum entstan-den sein. Derartige Schrägen können innerhalb einer mittelalterlichen Stadt, zumal im Straßen- bereich, nicht über längere Zeit und nacheinan- der bestanden haben. Auch der fehlende typi- sche Fundniederschlag in diesen Schichten weist darauf hin. Es fanden sich nur sehr wenige spät-mittelalterliche Scherben, einige Tierknochen so- wie wenige Reste von Daubenschälchen und Le- derverschnitt. Diese Tatsache kann nur so gedeutet werden, dass das Schichtpaket während einer grö- ßeren Umstrukturierung des Bereiches, verbun-den mit einer Planierung und Erhöhung des Siedel- geländes, entstanden ist. Wann das erfolgte, da für gibt es nur wenige Hinweise. Die in geringer An-zahl vorliegenden Scherben könnten dem 14. Jh. angehören. Damit ist allerdings der Planierungs-zeitpunkt nicht mit Sicherheit bestimmt, da die Scherben umgelagert worden sein dürften. Die Planierung und damit verbunden sicher auch ein größerflächiger Umbau des Bereiches könnte da- her in einem Zeitraum ab dem 14. Jh., evtl. dem 15. Jh. oder noch geringfügig später, erfolgt sein. Die aufliegenden obersten Schichten wiesen be-reits einen deutlichen bis überwiegenden Anteil an neuzeitlicher Keramik auf. Sie zeigten wieder eine horizontale Lagerung und sind wohl mit dem Bauhorizont der teilweise jetzt noch ste-henden barocken und späteren Häuserarchitek-tur der Schalaunischen Straße zu verbinden.
Der Vergleich der beiden interessanten Pflas-terungen mit weiteren in Köthen dokumentier- ten Befunden ist aufgrund der schlechten Publi-
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011238
grabungsber ichte
abb. 5 Köthen, SchalaunischeStraße. Mittelalterliche Funde
aus und auf dem unteren Pflaster (1–5.9) sowie aus der verfüllten Senke (6–8)
(vor 1111/1112). 1–8 M. 1:4; 9 M 1:2.
abb. 6 (rechts) Köthen, Scha- launische Straße. Durchlochte
Tierphalangen aus dem unteren Pflaster (vor 1111/1112).
1
3
6 7
4
8
5
9
2
abb. 7 (unten) Köthen, Schalau-nische Straße. Messingnadel
aus dem Bereich zwischen un terem und oberem Pflaster
(vor 1111/1112). Länge 6,5 cm.
kationslage sehr schwierig. Es ist aber bemerkens- wert, dass eine der unteren Pflasterung offenbar identische Schicht auch weiter westlich, im Be-reich des Kauf- und Geschäftshauses am westlichen Rand des Holzmarktes, beobachtet werden konnte. Leider ist die dortige Baugrube damals absprache- widrig ohne archäologische Dokumentation aus- gehoben worden, so dass nur noch die Außen-profile untersucht werden konnten2. Gleich in mehreren dieser Profile verlief die Schicht in ei-ner Tiefe von über 1,7 m (ca. 79,o5 m NN). Aus den kleinen Profilausschnitten waren nur eisen zeit- liche Scherben zu bergen, was dem Befund in der Schalaunischen Straße entspricht. Der Cha- rakter der Pflasterung lässt sich, beide Befunde einbeziehend, schwer beurteilen. Wahrscheinlicher als eine Straßenbefestigung liegt hier wohl eine flächige Befestigung eines größeren Bereiches vor. Archäologisch bemerkenswert ist die Größe der Siedlung der vorrömischen Eisenzeit, insbeson-dere der Spätlatènezeit, die sich immer mehr her- auszukristallisieren scheint. Spuren aus dieser Zeit im Stadtgebiet von Köthen sind Verfasser weiterhin vom Holzmarkt, vom Marktplatz, aus dem Schlossbereich und aus der Neustadt bekannt3. Weitere dürften archiviert sein.
Das obere Pflaster in der Schalaunischen Straße scheint dagegen eine Straßenbefestigung gewesen zu sein, denn im Planum war eine grob ostsüdost-westnordwest-verlaufende, etwas dif-fuse Nordkante zu erschließen (Abb. 1o). Diese entsprach damit ungefähr der heutigen Stra- ßenführung mit ihrer neuzeitlichen Bebauung. Ein diesem oberen Pflaster entsprechender Be-fund konnte am Holzmarkt nicht mit Sicherheit beobachtet werden. Zwar war auch dort an einer Stelle eine Pflas terung dokumentiert worden, doch scheint diese, soweit das lediglich aus dem Pro-
fil heraus beur teilt werden kann, keine Tragschicht besessen zu haben und aus größeren Geröllen gebaut gewesen zu sein. Weitere Aussagen sind leider infolge des Verlustes der archäologischen Befundsituation nicht mehr zu gewinnen. Ob die be festigte Straße zwischen den im 12. Jh. aus meh- reren Ortskernen zusammenwachsenden Ort-schaften verlief (Schulze 1923, 1o–15; Hoppe 1991, 7ff.) oder bereits innerhalb des neuen grö-ßeren Ortes, wird der zukünftigen Forschung zur Klärung vorbehalten sein.
Durch die hier vorgestellte archäologische Be- treuung einer sehr kleinen Baustelle (Abb. 1b) konnten zwei nacheinander existierende Pflas-terungen in der späteren Schalaunischen Straße nachgewiesen werden. Von großer Bedeutung ist, dass die Datierung des oberen Pflasters dendro-chronologisch über die unter der Tragschicht ver- bauten Eichenhölzer gelungen ist, da eine grö- ßere Anzahl der beprobten Hölzer eine Waldkante aufwies und auch die anderen Hölzer hochgerech- net in dem entsprechenden Bereich liegen4. Fast alle verbauten Hölzer sind im Jahr 1111 geschlagen worden, ein Holz im Jahr 111o und eines 1112. Zwei Hölzer aus der Mitte des 11. Jh. waren wohl sekundär verbaut, trugen aber keine Spuren ei- ner früheren Zurichtung, sondern waren wie der Rest unbearbeitet und teilweise auch Astholz. Damit kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Arbeiten zum Bau dieser relativ aufwändigen Pflasterung mit Tragschicht und Un- terbau in den Jahren 1111/12 stattgefunden ha- ben. Eine derart solide Pflasterung mit ausgesuch tem Gesteinsmaterial war für die Frühzeit Köthens nicht zu erwarten. Aus archäologischer Sicht ist das gewonnene Datum für die eindeutig darun- ter zum Vorschein gekommenen mittelalterlichen Funde von Interesse, auch wenn diese aufgrund
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011 239
grabungsber ichte
abb. 8 Köthen, SchalaunischeStraße. Die Holzunterzüge der Tragschicht aus den Jahren 1111/1112, rechts dicht lie- gend über der verfüllten Senke. Rechts der Bildmitte ist ein stehen gelassener Block mit der Tragschicht und dem Pflaster zu erkennen.
des nur kleinen Grabungs ausschnittes zahlenmäßig gering sind. Sowohl für die so genannte spätslawi-sche Keramik mit Rand aus prägungen, die allge-mein in das 11./12. Jh. da tiert werden (Abb. 5,1–2.4; vgl. zusammenfas send Frey 2oo3, 268ff., bes. 273 Abb. 6, 274 Abb. 7), als auch für das Wel- lenrandhufeisen (Abb. 5,9), die durchlochten Pha- langen (Abb. 6) und die »Haarnadel« (Abb. 7; vgl. Krabath 2oo1, 19o–195) wird mit dem Jahr 1111 ein terminus ante quem gegeben.
Das neue dendrochronologische Datum ist auch von nicht zu unterschätzender stadtgeschichtlicher Bedeutung. Das Alter unserer mittelalterlichen Städte wird notgedrungen immer am ersten jahr- genauen Datum – meist natürlich der Ersterwäh-nung in originalen, datierten Urkunden – festge-macht, wohl wissend, dass diese Orte bereits län- gere Zeit vor ihrer Erwähnung existiert haben müssen. So auch Köthen, dessen Existenz erst-mals im Jahre 1115 bezeugt ist, als »bei einem
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011240
grabungsber ichte
abb. 9a–c Köthen, Schalau- nische Straße. a) Rest des oberen Pflasters über den
Holzunterzügen; b) Gerölle aus der Pflasterung; c) Kalk-
steine aus der Tragschicht. 9a
9b
Ort, der Kothene genannt wird« eine Schlacht statt- gefunden hatte, in deren Verlauf ein Einfall heid- nischer Slawen durch Truppen unter der Füh- rung Ottos von Ballenstedt gestoppt und endgültig zurück geschlagen worden war (Hoppe 1991, 7). Durch die archäologischen Untersuchungen sind nun die vielen im Jahre 1111 geschlagenen Ei-chenhölzer die erste jahrgenaue Urkunde über umfangreiche Bautätigkeiten in dieser Ortschaft. Auf Geheiß welcher schutzbietenden örtlichen Ge-walt diese Infrastrukturarbeiten ausgeführt wor- den sind, ist für diese frühe Zeit jedoch nicht si- cher festzustellen. Die 1111/12 angelegte, auf-wändige Straßen befestigung mit ausgesuchtem Gesteinsmaterial belegt zumindest, dass Köthen bereits damals einen gewissen städtischen Char- akter aufwies, der dann nachweislich im Verlauf des 12. Jh. immer stärker zum Tragen kam (vgl. Hoppe 1991, 7–12). Dass sie in ihren Teilen min-
destens seit dem 1o./11. Jh. bestand, wie unter anderem die nachgewie se ne sehr einfache un- tere Pflasterung in der frühe ren Schalaunischen Straße zeigt, ist auch durch viele weitere slawi- sche Funde belegt, die in den letzten Jahren bei archäologischen Dokumentationen aus dem spät- mittelalterlichen Stadtgebiet geborgen werden konnten.
So wird sich in Zukunft nicht nur für die Pro-tagonisten der anhaltischen »Karnevalshoch-burg« Köthen die Frage stellen, welches der bei- den Daten entsprechend gewürdigt werden sollte. Der erste naturwissenschaftliche, jahrgenaue Nachweis mit der karnevalistisch denkwürdigen Ziffernfolge 1111, der Bautätigkeiten im Prozess der Stadtwerdung bezeugt, oder die eher beiläufige Ersterwähnung auf einer Urkunde des Jahres 1115? Spätestens bis zur 9oo-Jahr-Feier im Jahr 2o11 oder 2o15 sollte man sich entschieden haben.
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011 241
grabungsber ichte
9c
AnmerKungen 1 Die Durchführung der archäologi- schen Dokumention lag in der Ver- antwortung des Anhaltischen Förder- vereins für Naturkunde und Ge schichte, Sitz Weißandt-Gölzau. Nach Bedarf wurden von Seiten der Stadt zwei zeitweilige (ABM-)Mitar-beiter des Bauhofes zur Unterstüt-zung der Erdarbeiten abgestellt.
2 Die Dokumentation der Profile wurde durch T. Koiki (LDA) vorge-nommen. Die folgenden Angaben be- ziehen sich auf seine im Archiv des
LDA lagernden Unterlagen. 3 Neben den erwähnten Funden vom
Holzmarkt betrifft dies die ebenso verlustig gegangenen Befunde beim Bau des neuen Arbeitsamtes in der Neustadt (Schunke 2oo6) sowie die Marktplatzgrabung 2oo2 (Grabungs-leiterin: U. Petersen).
4 Die Untersuchungen wurden durch Herrn Dr. U. Heußner, Deutsches Ar- chäologisches Institut Berlin, durch- geführt. Die Beprobungen an 16 Höl- zern (einmal Erle, fünfzehnmal
Eiche; Labor-Nr. C37584-37599) er- gab zehn aussagekräftige Werte: Be- ginn-Ende: 1o32-1o93/Fälldatum: 1113+/-1o; 1o42-11o9/111o (Sommer-waldkante); 1o33-111o/1111 (Wald-kante); 1o38-111o/1111 (Waldkante); 98o-1o81/11o1+/-1o; 1o41-1111/1112 (Sommerwaldkante); 992-111o/1111 (Sommerwaldkante); 1o63-1111/1111 (Waldkante); 972-1o46/1o51+/-1o; 977-1o54/1o55+/-1 (Waldkante).
Archäologie in Sachsen-Anhalt · 5 · 2011242
grabungsber ichte
abb. 10 Köthen, Schalaunische Straße, das obere Pflaster mit relativ geradlinigem Abschluss
rechts des Maßstabes. Aus den seitlich angeschnittenen Schich-
ten drang ständig Wasser in den Grabungsschnitt.
l i terAtur Frey 2oo3 K. Frey 2oo3, Spätslawische und spät-
mittelalterliche Standbodenkeramik in Südostdeutschland – Tradition und Neuanfänge. Jahrb. Bodendenk-malpfl. Mecklenburg 5o, 2oo2 (2oo3), 265–28o.
Giesau 1943 H. Giesau (Hrsg.), Die Kunstdenkmale
des Landes Anhalt. 2. Bd., Landkreis Dessau-Köthen; 1. Teil, Die Stadt Köthen und der Landkreis außer Wörlitz (Burg 1943).
Hoppe 1991 G. Hoppe, Köthen in der Feudalzeit
(1115 bis ca. 18oo). In: G. Hoppe u. a., Köthen/Anhalt zwischen den Jahren 1115 und 1949 – Vier Bei-träge zur Stadtgeschichte (Köthen 1991) 7–45.
Krabath 2oo1 S. Krabath, Die hoch- und spätmittel-
alterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen (Rahden 2oo1).
Schulze 1923 R. Schulze, Köthen in Anhalt (Köthen
1923). Schunke 2oo7 T. Schunke, Auf der Suche nach der
Stadtmauer der Neustadt von Köthen. Arch. Sachsen-Anhalt 4 (N. F.), 2oo6 (2oo7) 211–217.
Abb i lDungSnAchwe iS 1 nach Giesau 1943 4–5 M. Wiegmann, LDA 2–3, 6–1o Verfasser