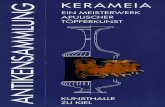Aspekte der städtebaulichen Entwicklung Apollonias (Albanien)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Aspekte der städtebaulichen Entwicklung Apollonias (Albanien)
Centre for Albanian StudiesInstitute of Archaeology
Proceedings of the INTERNATIONAL CONGRESS
OF ALBANIAN ARCHAEOLOGICAL STUDIES
65th Anniversary of Albanian Archaeology (21-22 November, Tirana 2013)
Botimet Albanologjike
Tiranë 2014
Copyright © 2014 by Centre for Albanian Studies and Institute of Archaeology.
All rights reserved. No parts of this volume may be reproduced in any form or by any means without the permission of the
Albanian Institute of Archaeology.
ISBN: 978-9928-141-28-6
editorial board:
english translation and editing: Nevila Molla
Art design: Gjergji Islami and Ana Pekmezi
Proceedings of the internAtionAl congress of AlbAniAn ArchAeologicAl studies
65th Anniversary of Albanian Archaeology (21-22 November, Tirana 2013)
Professor Luan Përzhita (Director of Institute of Archaeology),
Professor Ilir GjiPali (Head of Department of Prehistory),
Professor Gëzim hoxha
(Department of Late Antiquity and the Middle Ages),
Associate Professor Belisa Muka (Head of Department of Antiquity)
253
AsPeKte der städtebAulichen
entWicKlung APolloniAs.
die deutsch-AlbAnischen
forschungen 2006–2013
Manuel FIedleR
Apollonia, an der Straße von Otranto gegenüber der apulischen Küste Italiens gelegen, zählte zu den bedeutendsten und zudem ältesten und größten Städten der Adria. Mit dem Meer über einen Flußhafen verbunden, stellte Apollonia zugleich einen der beiden Ausgangspunkte für die wichtigste Überlandverbindung des Balkan, der ab dem 2. Jh.v.Chr. ausgebauten Via Egnatia, dar. Gegründet wurde Apollonia im Zuge eines Kolonisierungsprozesses im 7. Jh.v.Chr.: Korinth besetzte dabei – z.T. mithilfe Kerkyras – die Schlüsselpunkte der natürlichen Verkehrswege von Griechenland nach Italien, in die Adria und in den inneren Balkan, entlang der Ostküsten des Ionischen und Adriatischen Meeres. Mit Leukas beherrschte man die entscheidende Durchfahrt durch die akarnanisch-leukadische Meerenge, mit Anaktorion die Einfahrt in den Ambrakischen Golf, mit Ambrakia die Landwege in das Innere des Epirus und nach Thessalien. Kerkyra selbst kontrollierte den Seeweg durch die Meerenge zwischen der epirotischen Küste und der Insel, und mit Apollonia – am Unterlauf des Aoos (Vjosa) – und Dyrrhachion, das an einer der wenigen Buchten der südillyrischen Küste gegründet wurde, schuf man nicht nur Hafenorte für eine kurze Überfahrt zur
Apenninhalbinsel, sondern auch die Schnittstellen für die Landwege in Richtung Makedonien, durch das Tal des Genusus (Shkumbin). Der Reichtum der Städte gründete auf diesem weit gefächerten Siedlungsnetz. Von all diesen Koloniegründungen kann allein Apollonia auf eine lange, allerdings auch wechselvolle Erforschung zurückblicken. Den ersten systematischen Feldarbeiten durch die Österreicher Camillo Praschniker und Arnold Schober während des 1. Weltkrieges folgten intensive Ausgrabungen 1924 bis 1939 unter Leitung des französischen Archäologen Léon Rey. Der Italiener Pellegrino C. Sestieri führte Ausgrabungen im Jahr 1941 durch. Ein weiteres Intermezzo bildete eine sowjetisch-albanische Kooperation zwischen 1958 und 1960, und schließlich unternahmen verschiedene albanische Archäologen bis 1990 Forschungsgrabungen in und um Apollonia. Seither werden die Arbeiten in verschiedenen Kooperationen mit ausländischen Missionen fortgeführt1. Seit 2006 konzentriert sich ein deutsch-albanisches Team2 auf die Untersuchung verschiedener Bereiche des antiken Stadtgebiets, die wesentlich zum Verständnis der Siedlungsstrukturen, einzelner Monumente sowie allgemein zur
254
Manuel fIEdLER
Entwicklung des Ortes beigetragen haben. Apollonias Stadtgebiet untergliederte sich in eine ausgedehnte Oberstadt – mit zwei Akropolen und einer Agora im Sattel zwischen diesen beiden Anhöhen – sowie einer weiten Unterstadt an den Hängen und am Westfuß der Stadthügel (Abb. 1). Wie Philippe Lenhardt und François Quantin zeigen konnten, besaßen die Ober- und die Unterstadt unterschiedliche Straßenraster3. Für die Oberstadt belegten geophysikalische Messungen an der oberen Agora ein Nord-Süd/Ost-West ausgerichtetes Raster mit lang-schmalen insulae von ca. 13,40 m Breite und Gassen (stenopoi) von ca. 2,95 m Breite4. Es reicht in archaische
Abb. 1. Vorläufiger Stadtplan von Apollonia, rekonstruiert hauptsächlich auf Basis geophysikalischer Messungen (Lamboley 2012; Delouis et al. 2007; Buess – Heinzelmann – Steidle 2010; Zeichnung M. Schützenberger).
Zeit zurück. Bei den Grabungen im Umfeld des Theaters, die ebenfalls von geophysikalischen Messungen begleitet wurden, zeigte sich, daß die Terrasse oberhalb des Theaters in die Oberstadt integriert war: Es wurden Wohngebäude und Straßen der spätarchaischen, klassischen und frühhellenistischen Zeit angeschnitten (Abb. 2–3), die in ihrer Gliederung der Ausrichtung und dem Raster der Oberstadt an der Agora entsprachen: Die insulae waren bei einer Breite von ca. 13,40 m längs durch einen Mittelkanal (ambitus) geteilt, sodaß die Grundstücke beidseits des Kanals eine Tiefe von nur ca. 6,50 m besaßen. Im mittleren Bereich der Terrasse gab es einen Wechsel in der Gliederung der insulae: Hier wurde eine halb so breite insula von nur ca. 6,50 m Breite angeschnitten, die beidseits von Gassen begleitet war5. Apollonias Häuser in der Oberstadt müssen also auf ein- und zweireihigen insulae insgesamt eine ungewöhnlich geringe Grundfläche gehabt haben. Allein die qualitätvollen Dachziegel, die sich im Versturz fanden (Abb. 4a), zeigen allerdings, daß die Bewohner der Häuser einen gewissen Lebensstandard hatten, und dies bestätigen weitere Befunde und das Fundmaterial: Einer der Räume läßt sich als Vorratsraum identifizieren, in dem, wie Standspuren bezeugen, mehrere große Pithoi für die offensichtlich reichen Vorräte der Bewohner nebeneinander standen (Abb. 3). Unter der Keramik befinden sich korinthische und korinthisierende Stücke sowie attische und unteritalische Importe (Abb. 4b-d). Reliefverzierte Louteria, Webgewichte oder Spinnwirtel stellen charakteristische Haushaltsgegenstände dar (Abb. 4e-h). Zahlreich sind Hinterlassenschaften eines Koroplasten (Abb. 5), der in einem der Gebäude seine Werkstatt eingerichtet hatte. Im Kontrast zu den engen Gassen und Häusern in der Oberstadt wurde für die Unterstadt ein Straßenraster mit ungewöhnlich großen Ausmaßen der insulae gewählt (Abb. 1). Das Raster war entsprechend des Geländeverlaufes Nordost/Südwest ausgerichtet6. Die Längsachsen führten hierbei hangparallel. Geophysikalische Messungen, die Michael Heinzelmann, Manuel Buess und Stefanie Steidle im Südostquartier der Unterstadt unternahmen7, ließen insula-Breiten von 59 m und insula-Längen von 153,50 m erkennen. Ursprünglich
255
ASPEKTE dER STädTEBAULIchEN ENTwIcKLUNG APOLLONIAS. dIE dEUTSch-ALBANISchEN fORSchUNGEN 2006–2013
Abb. 2. Apollonia. Wohnbebauung auf der Terrasse oberhalb des Theaters (Blick von Osten).
Abb. 3. Apollonia. Ausgrabung eines klassischen Wohnhauses auf der Terrasse oberhalb des Theaters, Vorratsraum mit Standspuren von Pithoi.
müssen Hauseinheiten von 15 x 29,50 beidseits eines die insulae längs teilenden Mittelkanales vorgesehen gewesen sein. Mit dieser Stadterweiterung, die in klassische oder hellenistische Zeit zu datieren ist, wuchs Apollonia auf eine Größe von 130 ha an. Die obere Agora reichte in hellenistischer Zeit den Bedürfnissen nicht mehr aus, sodaß nun ein neues öffentliches Zentrum geschaffen wurde, das man etwas am Rande der Siedlung, am Südwestfuß der südlichen Akropolis, einrichtete (Abb. 1). Seine Bauten, die hauptsächlich durch die älteren französischen Grabungen bekannt sind, wurden in ihrer Orientierung nicht in die Straßenraster eingepaßt: Vielmehr prägte das Gelände die Gestalt des neuen Zentrums vor, das sich über mehrere Terrassen erstreckte (Abb. 6-7). Die Landschaft am Fuße der Akropolis wurde damit architektonisch gestaltet; Hallen und Stützmauern begrenzten die Terrassen. Charakteristisch sind Apsidenstützmauern sowie Nischen- und Apsidenrückwände der Stoen, die
zugleich Stützmauern zu den dahinterliegenden Hängen bildeten. Besonders die zweigeschossige, breite Nischenstoa „à dix-sept niche“8 muß auf eine Außenwirkung und weite Ansicht von Westen angelegt gewesen sein, denn vor ihr liegt eine nur relativ schmale Terrasse am Westhang der Stadthügel. Hinter der dorischen Apsidenstoa9, die den Hauptplatz im Süden begrenzte und die
256
Abb. 4. Apollonia. Funde aus den Häusern oberhalb des Theaters; a Firstziegel; b Randscherbe eines attisch-
schwarzfigurigen Schalenskyphos; c-d unteritalische Importe?; e Webgewicht, markiert mit Siegelring-Eindruck
(mit Darstellung einer männlichen stehenden Figur); f verzierter Spinnwirtel; g-h Fragmente reliefverzierter
Louteria.
Abb. 5. Apollonia. Links Terrakotta-Matrize aus einem Haus oberhalb des Theaters, rechts Ausformung.
Geländekante zur nächst höheren Ebene faßte, hatte L. Rey in den 1930er Jahren eine Konzentration von Transportamphoren angeschnitten. Um den Charakter dieses Gebildes im Gesamtgefüge des Stadtzentrums zu klären, wurden die seit 2003 laufenden Grabungen Bashkim Lahis 2007 und 2008 fortgeführt und mehrere Schnitte durch die Amphorenkonzentration und in ihrer Umgebung gelegt (Abb. 7–9)10. Dabei stellte sich heraus, daß die
Manuel fIEdLER
257
Abb. 6. Apollonia. Südliche Akropolis und hellenistisch-römische Agora, links im Hintergrund Agora der Oberstadt
(Blick von Westen) (Aufnahme A. Meier).
Abb. 7. Apollonia. Terrasse mit der Amphorenmauer.
Konstruktion genau mittig hinter der Stoa – mittig am Nordende der hinter der Stoa gelegenen Terrasse – erbaut war. Diese ‚Amphorenmauer‘ besaß eine
Ausdehnung von max. 21 x 9 m. Kopfüber waren die Amphoren eng aneinander gesetzt, in zwei bis drei Reihen übereinander (Abb. 10–11). Bevor sie in den Boden gestellt wurden, hatte man die Gefäße mit Lehm gefüllt. Die Packung dicht miteinander verschränkter Amphoren bildete, wie die in die Tiefe geführten Sondagen zeigten, die oberste Lage der Verfüllung für die Baugrube der Stoa: Bei Errichtung der Stoa war eine mehrere Meter breite Baugrube, deren Mächtigkeit wohl auch aus dem Geländeverlauf resultierte, angelegt worden, die mit Abschluß der Bautätigkeiten mit Lehm verfüllt wurde. Das Gelände wurde zugleich begradigt. Mit der Amphorenkonstruktion sollte offensichtlich das Erdreich gefestigt und möglicherweise Erddruck von der Stoa-Rückwand abgefangen werden. Ein Aspekt war sicherlich die Regulierung von Oberflächenwasser: Denn wie Wasserspeier in der Temenosmauer, die die Terrasse im Nordosten abschloß, belegen, wurde Regenwasser oberirisch auf die Terrasse abgeleitet. Die dickwandigen Keramikbehältnisse waren sicherlich gut geeignet, gewisse Mengen an Feuchtigkeit in den Boden zu leiten und zu speichern, womit nach Regengüssen die Laufoberfläche rasch wieder begehbar wurde.In einer Sondage südlich der Amphorensetzung wurde ein Abschnitt einer Straße mit angrenzenden Gebäudemauern angeschnitten11. Das Laufniveau der Straße lag mehrere Meter unterhalb des Laufniveaus der Terrasse, sodaß zwischen Straße und Terrasse ein Geländeabsatz bestanden haben muß. Ob er durch eine Stützmauer gefaßt war, die
ASPEKTE dER STädTEBAULIchEN ENTwIcKLUNG APOLLONIAS. dIE dEUTSch-ALBANISchEN fORSchUNGEN 2006–2013
258
Abb. 8. Apollonia. Plan der Amphorenmauer mit Grabungsschnitten.
Abb. 9. Apollonia. Apsidenstoa, dahinter Terrasse mit der Amphorenmauer; im Hintergrund Temenosmauer der
Akropolis mit Spitzbogentor (Blick von Westen).
dann den südlichen Abschluß der Terrasse markiert hätte, ließe sich nur durch neue Grabungen klären. Bei der Straße handelt sich um die Fortsetzung der sog. Straße H, einer der Hauptadern von Apollonia, die die unteren Wohngebiete über das Theater mit der Agora verband. Unseren Grabungen zufolge muß Straße H, von der Agora kommend, seitlich an der Apsidenstoa vorbeigeführt haben und schließlich Richtung Osttor verlaufen sein (Abb. 7).Die geophysikalischen Messungen, die wir in der Umgebung der Amphorenkonzentration durchgeführt haben, konnten zeigen, daß südlich der Terrasse mit der Amphorenmauer sich ein weiterer Platz befand (Abb. 12). Er grenzte südlich an diese Terrasse und ersteckte sich bis zum Osttor. Im Nordwesten lassen sich im Geomagnetikbild Anomalien eines Gebäudes erkennen, das sich als Teil der von Rey freigelegten sog. „portique meridionale“ herausstellt. Dieser ausgedehnte Gebäudekomplex, südöstlich des Bouleuterion – oder des Vorgängerbaues des sog. Agonothetenmonumentes –, richtete sich vermutlich auf diesen Platz aus; es dürfte sich um ein prägendes Monument im Gefüge der Terrassenanlagen gehandelt haben. Besonders beim Betreten der Stadt durch das Osttor muß es an der gegenüberliegenden Seite des Platzes deutlich wahrzunehmen gewesen sein.
Manuel fIEdLER
259
ASPEKTE dER STädTEBAULIchEN ENTwIcKLUNG APOLLONIAS. dIE dEUTSch-ALBANISchEN fORSchUNGEN 2006–2013
Abb. 10. Apollonia. Schnitt durch die Amphorenmauer (Blick von Westen).
Abb. 11. Apollonia. Grafische Rekonstruktion der Amphorenmauer. Aufsicht und Profil.
Apollonias öffentliches Zentrum setzte sich insgesamt also aus mehreren Plätzen und Terrassen zusammen, die sich auf verschiedenen Ebenen aneinanderreihten. Wer durch das Osttor die Stadt betrat – unterhalb des Tores verlief die Via Egnatia entlang des Kryegjata-Tales – und in Richtung der Akropolen ging, gelangte von einer Platzanlage zur nächsten, ohne Wohngebiete zu durchqueren. Der Bau gegenüber dem Osttor, das Spitzbogentor am Aufweg zur Akropolis, die Hallen und Apsidenmauern am Platz des späteren Agonothetenmonumentes, die langgestreckte Stoa „à dix-sept niche“ sowie die Tempel und Hallen an der oberen, „archaischen“ Agora schmückten diesen Weg. Die Mächtigkeit der an der oberen Agora errichteten Bauten, die derzeit von der französisch-albanischen Equipe erforscht werden, führen eine Steigerung in der repräsentativen Ausgestaltung vor Augen. Der Ausbau des Zentrums erfolgte in hellenistischer Zeit. Unsere Grabungen an der ‚Amphorenmauer‘ erbrachten für diesen Teil der Platzanlagen erstmals eine exakte Datierung12:
260
Manuel fIEdLER
Abb. 13. Apollonia. Theaterplan (Zeichnung V. Hinz + St. Franz).
Die Amphoren und die jüngste Keramik aus der Baugrube der Stoa stammen aus dem dritten Viertel des 3. Jh.v.Chr.; die stratigrafischen Zusammenhänge belegen, daß man zeitgleich mit dem Bau der Stoa-Rückwand die Amphoren in den Boden gesetzt und den gesamten Nordteil der Terrasse modelliert hatte. Mit dem Theater der Stadt wurde in diesem Zeitraum nun das größte Gebäude Apollonias errichtet. Es ist zugleich eines der größten Theatergebäude im Mittelmeergebiet und das größte Theater unter den Städten am Adriatischen Meer. Nach den älteren Grabungen unter Leitung
Abb. 12. Apollonia. Geomagnetikbild von der Amphorenmauer-Terrasse und der Terrasse am Osttor (Messungen Eastern Atlas, Berlin).
261
ASPEKTE dER STädTEBAULIchEN ENTwIcKLUNG APOLLONIAS. dIE dEUTSch-ALBANISchEN fORSchUNGEN 2006–2013
Abb. 14. Apollonia. Orchestra mit ringförmigen Verfärbungen, Gruben sowie zentralem Abflußkanal (Blick von Osten).
von Alexandra Mano und Burhan Dautaj, die weite Teile des Gebäudes freigelegt haben, blieben einige Fragen, insbesondere zum Grund- und Aufriß der Skene sowie zur Größe und Gliederung des Koilon, offen. Deshalb wurden ab 2006 weitere Ausgrabungen unternommen und erstmals die erhalten gebliebenen Bauglieder, Inschriften und Skulpturen exakt dokumentiert13.Das Theater hatte man in der Mitte der Stadt, in einer Mulde des Westhanges erbaut (Abb. 1). Das obere und das untere Straßenraster trafen hier aufeinander, so daß das Theater wie ein Scharnier in diese Systeme eingepaßt war. Die Errichtung des Theaters wirkte sich einschneidend auf die umliegenden Wohnviertel aus: Ein Teil der Wohnhäuser auf der Terrasse oberhalb des Theaters wurde abgetragen, um offenbar hinter dem Koilon genügend Bewegungsspielraum für die Theaterbesucher zu schaffen. Umfangreiche Erdarbeiten müssen zur Bauvorbereitung insbesondere im Bereich des Koilon stattgefunden haben. Das Gelände mußte hier begradigt werden. Hinzu kam, daß offensichtlich Wasser aus dem Erdreich trat – ein Problem, daß noch heute Auswirkungen auf die
Stabilität des Hanges hat14. Mittels Kiesgruben, die man oberhalb des Theaters angelegte, und Wasserkanälen, mit denen das Wasser hangparallel aus dem Koilon geleitet wurde, versuchte man dem Problem zu begegnen. Die Kanäle, die meist aus Ziegeln errichtet waren, blieben in Teilen unterhalb der (ausgeraubten) Sitz- und Treppenstufen erhalten15. Für den Hang schuf man einen Steigungswinkel von 25 bis 26°. Dies ergibt sich aus den Rekonstruktionen der wenigen erhalten gebliebenen Sitzstufen16. An der oberen Hangkante ließ sich während der Grabungen ein Abschnitt des Fundamentes für eine obere Umfassungsmauer des Koilon freilegen (Abb. 13). Aus der Krümmung dieses Abschnittes und dem Verlauf der Hangkante ergibt sich der obere Umfang des Zuschauerraumes, der ca. 145 m betrug. In der Orchestra konnten als älteste Spuren Verfärbungen im gewachsenen Boden entdeckt werden, die aus halbringförmigen und linearen, fächerförmig angeordneten Strukturen bestanden (Abb. 14). Sie dürften Hinterlassenschaften einer
262
Abb. 15. Apollonia. Orchestra-Ringkanal mit Einmündung in den zentralen Abflußkanal (Blick von Osten).
Holzkonstruktion gewesen sein, mit der vor Baubeginn die Orchestra und das Koilon angerissen wurden. In der Orchestra traten zahlreiche, große und kleine Gruben zutage. Einige dürften Pfostenlöcher sein, in denen Baugerüste verankert waren. Die meisten großen Gruben stammen aus römischer Zeit und stehen wohl mit Einbauten in Zusammenhang, die temporär während des Spielbetriebes bestanden haben müssen. Die Orchestra war in ihrer Osthälfte von einem Ringkanal umfaßt, den Mano und Dautaj bereits zu großen Teilen aufgedeckt hatten. Die neuen Grabungen konnten die Ableitung des Kanals klären (Abb. 15–16): Am östlichsten Punkt, in der Kanalmitte, fand sich ein überwölbter Einlaß in einen zentralen Kanal, der die Orchestra in Ost-Westrichtung unterquerte (Abb. 14) und im weiteren Verlauf unter dem Bühnengebäude aus dem Theaterareal herausführte. Ein tiefer Schacht, in der Mitte der Orchestra, war für Reinigungszwecke in diesen Hauptabfluß integriert. Durch Fortsetzung der älteren Grabungen am Nordende der Skene ließ sich der Grundriß des Gebäudes feststellen. Der Steinraub war teilweise so tiefgreifend, daß oft nur Raubgräben den Verlauf von Fundamenten bezeugen. Gesichert ist dadurch ein langrechteckiger Grundriß der Skene von ca. 26 x 7 m, die im Untergeschoß eine mittlere Pfeilerreihe in zwei Schiffe untergliederte (Abb. 17). Dem Bau war östlich ein Proskenion ionischer
Ordnung vorgesetzt. Im Versturz blieben zahlreiche Bauglieder der aufgehenden Architektur erhalten, die eine dorische Ordnung im Obergeschoß der Skene bezeugen und detaillierte Rekonstruktionen ermöglichen17. An der dem Theater abgewandten Seite, nach Westen, hatten bereits Mano und Dautaj weitere Fundamente freigelegt, die sie mit einer Stoa in Verbindung brachten. Unsere Grabungen konnten verifizieren, daß es sich um eine der Skene vorgeblendete Stoa dorischer Ordnung handelt, der zur Skene hin ein Trakt mit Kammern zwischengeschaltet war (Abb. 17). Die Länge dieser porticus post scaenam ist noch unbekannt. Sicher ist, daß sie an ihrer Nordseite weit über die Nordwand der Skene hinausging und damit den Zugang zur nördlichen Parodos verstellte. Dieser dürfte wohl durch die Stoa hindurch erfolgt sein. Wir haben es mit einer ungewöhnlichen Disposition von Skene, Kammertakt und porticus post scaenam zu tun, bei der von außen betrachtet die Stoa das übrige Gebäude dominierte. Verwandt sind die Theater von Dodona18 und Byllis19, die ebenfalls – unterschiedlich gestaltete – Hallen an ihren Außenseiten besaßen, doch im Unterschied zu diesen Bauten war die Stoa in Apollonia nicht nur der Skene assoziiert, sondern bildete einen breiten Riegel vor dem Theater. Die beträchtlichen Ausmaße der Stoa stehen im Gegensatz zu den relativ kleinen Dimensionen einer westlich vor dem Theater gelegenen Platzanlage, auf die sich die Stoa ausrichtete. Aus Westen muß
Manuel fIEdLER
263
Abb. 16. Apollonia. Orchestra-Ringkanal mit Einmündung in den zentralen Abflußkanal (Blick von Norden).
die Stoa von weither sichtbar gewesen sein: Es wird deutlich, daß das Gebäude mit seinem mächtigen Koilon und der vorgeblendeten Stoa Teil der nach Westen gerichteten Stadtfassade Apollonias war, die mit weiteren Bauten, wie der Stoa „à dix-sept niche“ an der hellenistischen Agora oder einem Brunnenhaus im Norden der Stadt mit seinen den
Abb. 17. Apollonia. Theaterplan mit rekonstruiertem Grundriß der Skene (Zeichnung V. Hinz + St. Franz).
Hang hinuntergeführten Zuläufen20, repräsentativ ausgestaltet war. Vom Meer her und bei Einfahrt in den Flußhafen dürfte diese Fassade eine außerordentliche Wirkung entfaltet haben. Das Theater wurde in römischer Zeit umgebaut und in eine römische Arena verwandelt. Die Spielfläche erweiterte man hierfür: In zwei Etappen wurde eine hohe Brüstung zwischen Orchestra-Arena und Koilon errichtet, um die Zuschauer vor Gefahren aus der Arena zu schützen, die Arena zu den Parodoi hin geschlossen und mit Toren versehen sowie schließlich das Proskenion abgetragen. Die Skene und die Stoa blieben erhalten. Ein Theaterspielbetrieb dürfte nicht mehr möglich gewesen sein; es ist naheliegend anzunehmen, daß die Errichtung des Odeion21 an der hellenistischen Agora mit dem Umbau des Theaters in Zusammenhang gestanden haben könnte. Die hellenistische Agora erhielt in römischer Zeit ein neues Gesicht22: Ein Ensemble aus Odeion, einem Podiumstempel, einem Bouleuterion (dem sog. Agonothetenmonument) und einem Bogenmonument am Aufweg von Straße H zum Platz vor dem Odeion prägten nun das öffentliche Zentrum. Für das Bouleuterion, das man auf Fundamenten eines älteren Gebäudes errichtete, ergaben neue Untersuchungen der Bauinschrift und der Bauornamentik eine Datierung in das frühe 2. Jh.n.Chr.23. Ob die übrigen römischen Gebäude ebenfalls aus dieser Zeit stammen, bleibt noch zu prüfen. Bekanntlich fand Apollonia sein Ende im 3./4. Jh.n.Chr. Die Theatergrabungen bestätigen dies: Wie die Analysen der Keramik und Kleinfunde zeigt24, wurde das Gebäude im Laufe der zweiten Hälfte des 3. Jh.n.Chr. nicht mehr genutzt; die Stätte diente seitdem als Steinbruch.
ANMeRKUNGeN
1 Den Forschungsstand hat erstmals übersichtlich
die französisch-albanische Mission zusammengefaßt: Atlas
d‘Apollonia 2007. 2 Die Kooperation wird geleitet von Bashkim Lahi
(Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Arkeologji-
së, Tirana) und Henner von Hesberg (Deutsches Archäol-
ogisches Institut, Abteilung Rom).
ASPEKTE dER STädTEBAULIchEN ENTwIcKLUNG APOLLONIAS. dIE dEUTSch-ALBANISchEN fORSchUNGEN 2006–2013
264
15 Döhner (in diesem Band) Fig. 3.16 Hinz, Franz 2011, p. 116-119, Abb. 89-92.17 Angelinoudi, Bäuerlein 2008; Hinz, Franz
2011, p. 92-99.18 Πλιάκου, Σμύρης 2012.19 Cabanes et al. 2008, p. 170-171; Ceka, Korkuti
1998, p. 266; p. 279-281; Abb. 177. 187-188.20 Bereti et al. 2007, p. 255-265.21 Dimo, Lamboley, Quantin 2007, p. 208-212.22 Vgl. von Hesberg, Eck 2010.23 von Hesberg, Eck 2010.24 Lahi, Shkodra, Shehi 2011, p. 120-156; Pánczél
2011, p. 156-170.
Manuel fIEdLER
LIteRAtURVeRZeICHNIs
Angelinoudi, Bäuerlein 2008 A. Angelinoudi, J. Bäuerlein, “Das Theater von Apollonia (Albanien). Ein Vorbericht”, Römische Mitteilungen 114 (2008), p. 17-29.atlas d’Apollonia 2007 V. Dimo, Ph. Lenhard, F. Quantin (eds), Apollonia d‘Illyrie I. Atlas archéologique et historique, CEFR 391, Athens/Rome 2007.Bereti et al. 2007 V. Bereti, V. Dimo, Ph. Lenhardt, F. Quantin, “La fontaine monumentale”, in Atlas d’Apollonia 2007, p. 255-265.
Buess, Heinzelmann, Steidle 2010 M. Buess, M. Heinzelmann, St. Steidle, “Geophysikalische Prospektionen in der südlichen Unterstadt von Apollonia (Albanien)”, Römische Mitteilungen 116 (2010), p. 205-211.Cabanes et al. 2008 P. Cabanes (dir.), M. Korkuti, A. Baçe, N. Ceka, Carte Archéologique de l‘Albanie, Tirana 2008. Ceka, Korkuti 1998 N. Ceka, M. Korkuti, Arkeologjia: Greqia – Roma – Iliria, Tirana 1998.Dautaj, Lenhardt, Quantin 2007 B. Dautaj, Ph. Lenhardt, F. Quantin, “L’urbanisme d’Apollonia d’Illyrie. Constats et premiers observation”, in Atlas d’Apollonia 2007, p. 339-349.Delouis et al. 2007 O. Delouis, J.-L. Lamboley, PH. Lenhardt, F. Quantin, A. Skenderaj, S. Verger, B. Rekaj, “La ville haute ’Apollonia d’Illyrie: étapes d’une recherche en cours”, in D. Berranger-Auserve (ed.), Épire, Illyrie, Macédoine... Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes, Clermont- Ferrand 2007, p. 37-53. Dimo, Lamboley, Quantin 2007 V. Dimo, J.-L. Lamboley, F. Quantin, “Le centre monumental”, in Atlas d’Apollonia 2007, p. 186-217.Fiedler et al. 2011 M. Fiedler, S. Franz, Sh. Gjongecaj, H. Von Hesberg, V. Hinz, B. Lahi, S.- P. Pánczél, F. Quantin, E. Shehi, B. Shkodra-Rrugia, “Neue Forschungen zum hellenistisch-römischen Theater von Apollonia (Albanien) ”, Römische Mitteilungen 117 (2011), p. 55-200.von Hesberg, Eck 2008 H. von Hesberg, W. Eck, “Reliefs, Skulpturen und Inschriften aus dem Theater von Apollonia (Albanien)”, Römische Mitteilungen 114 (2008), p. 31-97.von Hesberg, Eck 2010 H. von Hesberg, W. Eck, “Die Transformation des politischen Raumes. Das Bouleuterion von
3 Atlas d‘Apollonia 2007, p. 339-346.4 Delouis et al. 2007; Lamboley 2012.5 Die spätere epirotische Kleinstadt Orraon besaß
ebenfalls solche einzeiligen insulae: Hoepfner 1999, p.
384-411. 6 Dautaj, Lenhardt, Quantin 2007, p. 339-346.7 Buess, Heinzelmann, Steidle 2010.
8 Dimo, Lamboley, Quantin 2007, p. 188-196.9 Ibid, p. 198-199.10 Lahi 2007/2008; Lahi, Fiedler 2010. 11 Lahi, Fiedler 2010, p. 242-248.12 Lahi, Fiedler 2010, p. 237-242.13 Vorberichte: von Hesberg, Eck 2008; Ange-
linoudi, Bäuerlein 2008; Fiedler et al. 2011; Lahi et al. 2012; Lahi, von Hesberg 2013.14 Siehe den Bericht zur Sanierung des Theaterhan-
ges von Gregor Döhner (in diesem Band).
265
ASPEKTE dER STädTEBAULIchEN ENTwIcKLUNG APOLLONIAS. dIE dEUTSch-ALBANISchEN fORSchUNGEN 2006–2013
Apollonia (Albanien)”, Römische Mitteilungen 116 (2010), p. 257-287.Hinz, Franz 2011 V. Hinz, S. Franz, “Neue Aspekte zu Architektur und Bauphasen”, in Fiedler et al. 2011, p. 92-120.Hoepfner 1999 W. Hoepfner (ed.), Geschichte des Wohnens 1. 5000 v.Chr.-500 n.Chr. Vorgeschichte Frühgeschichte Antike, Stuttgart 1999.Lahi 2007/2008 B. Lahi, “Një grup amforash nga Apolonia. Rezultate paraprake të viteve 2003-2008”, Iliria 33, (2007/2008), p. 199-217. Lahi, Fiedler 2010 B. Lahi, M. Fiedler, “Ausgrabungen im Zentrum von Apollonia (Albanien). Vorläufige Ergebnisse zu der sog. Amphorenmauer und ihrer Umgebung”, Römische Mitteilungen 116 (2010), p. 213-255.Lahi, Shkodra, Shehi 2011 B. Lahi, B. Shkodra, E. Shehi, “Pottery evidence. Preliminary results of archaeological excavations of 2006-2008”, in Fiedler et al. 2011, p. 120-156. Lahi et al. 2012 B. Lahi, M. Fiedler, A. Lulgjuraj, B. Shodra, E. Shehi, G. Döhner, K. Sido, K. Velo, M. Grunwald, S. Pánzcél, W. Streblow, “Teatri i Apollonisë”, Iliria 36 (2012), p. 409-414.Lahi, von Hesberg 2013 B. Lahi, H. von Hesberg, “Apollonia: the theatre”, in I. Gjipali, L. Përzhita, B. Muka (eds), Recent Archaeological Discoveries in Albania, Tirana 2013, p. 84-87.Lamboley 2012 J.-L. Lamboley, “Urbanisme d‘Apollonia d‘Illyrie”, in G. De Marinis et al. (eds), I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica. BAR Intern. Ser. 2419, (2012), p. 33-46. Pánczél 2011 S.-P. Pánczél, “Kleinfunde aus Glass”, in Fiedler et al. 2011, p. 156-170.ΠλιΑκού, ΣμύρηΣ 2012 Γ. Πλιάκου, Γ. Σμύρης, “Το θέατρο, το βουλευτήριο και το στάδιο της Δωδώνης”, in Αρχαία θέατρα της Ηπείρου, Διάζωμα 6 (2012), p. 62-100.