Entwicklung der Emotionsregulation bei 2− und 3jährigen Mädchen
Entwicklung der Erreichbarkeit der Schweizer Gemeinden: 1950 bis 2000
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Entwicklung der Erreichbarkeit der Schweizer Gemeinden: 1950 bis 2000
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen
Entwicklung der Erreichbarkeitder Schweizer Gemeinden: 1950 bis 2000
Development of the AccessibilityofSwiss Municipalities: 1950 to 2000
Kurzfassung
Die Erreichbarkeit der Schweizer Gemeinden hat sich in den letzten 50 Jahren durch denStrafsennetzausbau. die Angebotsausweitung im offentlichen Verkehr und die Bevolke-rungszunahme substanziell verandert, Der Aufsatz beschaftigt sich mit den ersten beidenEinflussgrofsen und stellt die Resultate in ihrem raumlichen Kontext dar. Das Verhaltnis derErreichbarkeit im Strafsenverkehr zur Erreichbarkeit im offentlichenVerkehr hat sich in derbetrachteten Zeitperiode von 1950 bis 2000 nur wenig verandert.
AbstractThe accessibility of the Swiss municipalities has changed substantially in the last 50 yearsdue to the extension of the road network, improvements of the public transport and popula-tion growth. The paper deals with the first two variables and the resulting changes. The ratioof road-based to public transport-based accessibility has changed little over the time periodfrom 1950 to 2000 in Switzerland.
1 Einfiihrung
Verkehrsinfrastruktur wurde in erster Linie geplantund erstellt, urn die Reichweiten und Wirkungsradienvon Bevolkerung und Wirtschaft zu erweitern und denRegionen so zu okonomischer Prosperitat zu verhelfen.Diese Infrastruktur wurden in den vergangenen Iahr-zehnten weltweit im Einklang mit diesem Ansatz starkausgebaut (fur die Schweiz siehe Kesselring/ Halbherr/Maggi 1982;Widmer/Meister 2005).
Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Infra-strukturverbesserung und okonomlschem sowie de-mographischem Wachstum gehort zu den Kernfragensowohl der Regionalforschung als auch der Transport-und Verkehrsplanung. Sie wird, wenn es urn neue In-vestitionen geht, auf politischer Ebene kontrovers dis-kutiert. Auch wennVerkehrsnetze nur eine notwendigeund keine hinreiche Voraussetzung furWachstum sind,sind Zusammenhange scheinbar offensichtlich. Uberdas Ausmafs der Wechselwirkungen zwischen diesenWachstumspfaden besteht aber nach wie vor Unklar-heit. Beispielsweise ware zu klaren, ob der Ausbau derStrafsen die (demographische) Entwicklung ausloste
RuR6/2005
oder ob der Netzausbau lediglich eine Reaktion aufdiesen Wandel darstellt. Diese Thematik wird zwar inbedeutenden empirischen Arbeiten aufgegriffen (z.B.Aschauer 1989; Fernald 1998; Holtz-Eakin 1994; Mun-nell 1990; Nadiri 1998; Brocker/Kanse/Schurmann/Wegener 2002; Shirley/Winston 2004), allerdings nichtin wtinschenswerter Tiefe. Entweder sind die geogra-phischen Untersuchungseinheiten (z.B. US-Bundes-staaten, englische Counties) eher grob oder es handeltsich urn raumlich stark begrenzte Fallstudien. Zudemerstrecken sich die Untersuchungszeitraume haufigtiber nicht mehr als zehn bis zwanzig Jahre, werdendie Eisenbahnnetze in der Regel ignoriert und wird dieWirkung der Verkehrsnetze nur mit den fiir sie notigenBaukosten abgeschatzt und nicht mit den von ihnenerbrachten Dienstleistungen.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Entwicklungder Infrastruktur des offentlichen und des Individual-verkehrs moglichst fein und tiber einen langen Zeit-raum nachzuzeichnen, urn so Grundlagen fiir tiefereAnalysen der angesprochenen Wirkungszusammen-
385
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Schwerpunktmafsig beschreibt dieser Beitrag die zu-grunde liegenden Verkehrsmodelle zur Berechnungder Reisezeiten fur den motorisierten Individualver-kehr (MlV) und den offentlichen Verkehr (OV) undanalysiert die mit diesen Reisezeiten berechneten Er-reichbarkeitswerte. Dem technischen Detail wird un-gewohnlich grosser Raum eingeraumt, da manche die-ser Details Wirkungen haben, die das Gesamtergebnispragen.
Die Erreichbarkeit wird verstanden als MaB fur die An-gebotsqualitat des Verkehrsnetzes an einem bestimm-ten Punkt. DenArbeiten vonWilliams (1977), Ben-Akivaund Lerman (1985), Rietfeld und Bruinsma (1998), Ge-urs und Ritsema van Eck (2001) folgend haben wir denLog-Sum-Term eines einfachen Logit-Zielwahlmodellsverwendet, den theoretisch am besten begrundetenIndikator:
hange bereitzustellen. Ein Indikator fur die Dienstleis-tung einer neu erstellten Verkehrsinfrastruktur ist dieveranderte Erreichbarkeit der daran angeschlossenenOrte. Die Erreichbarkeit ist das Bindeglied zwischenVerkehrsinfrastruktur und Landnutzung und ein Massfur die Attraktivitat der Lage einer Region. Dabei in-teressieren folgende Fragen: Wie hat sich die Erreich-barkeit entwickelt? Wie variiert diese Entwicklung imRaum?Welches sind die dazu benotigten Berechnungs-grundlagen?
Untersuchungsraum ist die Schweiz mit ihren benach-barten Gebieten, die kleinste Untersuchungseinheit istdie Gemeinde bzw. der Stadtkreis (d. h. ein Quartiereiner grolseren Schweizer Stadt). Den Untersuchungs-zeitraum bilden die Jahrzehnte zwischen 1950 und2000. Fur diese wurden Datenreihen auf Gemeindee-bene und entsprechende Verkehrsnetze aufgebaut. DieVariablen der Raumstruktur wurden zum groBen Teilder Schweizerischen Volkszahlung, aber auch ande-ren statistischen Reihen auf Bundesebene entnommenund, fur die bessere Vergleichbarkeit tiber die Zeit, aufden Gebietsstand von 2000 transformiert (Tschopp/Keller/Axhausen 2003). Die Schweiz umfasst heute2 896 Gemeinden. Die Verkehrsmodelle wurden am In-stitut fur Verkehrsplanung und Transportsysteme - IVTder ETH Zurich erstellt (siehe Frohlich/Frey/Reubi/Schiedt 2003).
Der Log-Sum-Term eines diskreten Entscheidungs-modells beschreibt den Gesamtnutzen des vorliegen-den Alternativensatzes, hier aller Zonen des Unter-suchungsgebiets (Ben-Akiva/Lerman 1985). Williams(1977) zeigt nun zusatzlich, dass dieser Term die Kon-sumentenrente der Entscheider misst, d.h. der Wertdes Log-Sum-Terms ist ein wohlfahrtsokonomisch kor-rektes und vollstandiges MaB des Nutzens der Zonenfur die Bev61kerung. Er hat also die Einheit Nutzen undkann, wenn gewunscht und entsprechende Umrech-nungskurse vorhanden sind, zum Beispiel monetari-siert werden. Die hier implizierte Nutzenfunktion deszugrunde liegenden Zielwahlmodells ist sehr einfach,da sie nur eine Variable zur Beschreibung des Zielsverwendet - in der Regel die Wohnbevolkerung - unddie generalisierten Kosten ebenfalls nur mit einer Vari-able erfasst, hier den Reisezeiten. Wenn man sich vomNutzenkalkul lost, konnte man in dieser Konstellationvon nicht-linear reisezeitgewichteten Personen als derEinheit der Erreichbarkeit sprechen, also einem MaBder moglichen Kontakte. Es ist offensichtlich, dass die-ses Zielwahlmodell weder sehr differenziert in der Be-schreibung des Ziels noch in der Abbildung der gene-ralisierten Kosten ist. Weitere vertiefende Arbeiten sindin der Dissertation des Mitverfassers Frohlich geplant.Fur eine ausfuhrliche Diskussion moglicher andererGewichtungsfunktionen fur Erreichbarkeitsberechnun-gen jenseits der Exponentialfunktion des Logit-Modellssei auf Kwan (1998) verwiesen.
Bei der obigen Berechnung der Erreichbarkeiten wer-den sowohl die Reisezeit als auch die Anzahl der Be-wohner nicht-linear rrhteinander verknupft. Dies be-wirkt, dass die Wirkungen der beiden nicht getrenntidentifiziert werden konnen, Urn die Veranderungender Netze getrennt betrachten zu konnen, wurde zu-satzlich die mittlere Geschwindigkeit jeder Zone, ge-wichtet mit dem Beitrag jeder Zone j zur Erreichbarkeitder Zone i, gemittelt tiber alle Zonen berechnet:
v. =1... "v . X • e -jS9.j1 E. L. ij j
1
mittlere Geschwindigkeit fur Zone iErreichbarkeit Zone iStrassendistanz zwischen Zone i und jGeschwindigkeit zwischen Zone i und jaus dij und cijReisezeit zwischen Zone i und jAnzahl der Aktivitatspunkte(z.B. Bevolkerung) in Zone jGewichtungsfaktor
mit v.1
1;=In L X e -llCijVij j
Erreichbarkeit der Zone iAnzahl der Aktivitatspunkte(z. B. Bevolkerung) in Zone jGeneralisierte Kosten bzw. Reisezeitzwischen Zone i und jGewichtungsfaktor
mit
386 RuR 6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Somit erhalt man einen Indikator, der die Entwicklungdes Angebots widerspiegelt, und zwar in Abhangigkeitvon den fur die Zone wichtigen Aktivitatspunkten, AlsDistanz wurde fiir beide Verkehrssysteme die kiirzesteStrafsendistanz verwendet, da diese in verlasslichererForm vorliegen als die OV-Distanzen. Die Strafsendis-tanzen wurden verwendet, urn die mindest notwen-digen Distanzen bei der Berechnung zu beriicksichti-gen (zur Analyse der systematischen Abweichungenzwischen Luftliniendistanzen und kiirzesten Wegen inbelasteten und unbelasteten Netzen siehe Chalasani/Engebretsen/Denstadli/Axhausen, im Druck).
2 Details der Erreichbarkeitsberechnung
Die Berechnung der Erreichbarkeit verlangt die Ab-schatzung der generalisierten Kosten. In der vorliegen-den Arbeit, wie auch in den meisten anderen Studienzu diesem Thema, werden die generalisierten Kostenmit der Reisezeit zwischen den Zonen gleichgesetzt.Die Netzmodelle zur Berechnung der Wege mit denkiirzesten Reisezeiten wurden mit Hilfe der SoftwareVISUMl realisiert. Die zugehorigen Algorithmen wer-den zum Beispiel in Schnabel/Lohse (1997) oder Ortu-zar/Willumsen (2001) im Detail erlautert.
Die Reisezeit im MIV setzt sich zusammen aus den An-bindungszeiten (vom Zonenschwerpunkt zum nachst-gelegenen Knoten im Stralsennetz am Anfang undEnde der Fahrt) und aus den Streckenfahrzeiten. ImOV besteht die Reisezeit aus der Summe der Anbin-dungszeiten, der Fahrzeit und der Umsteigewartezeit.Die Beriicksichtigung des OV-Takts wurde vernachlas-sigt, da sich sonst bei schlecht erschlossenen Zonenunrealistisch hohe Reisezeiten ergeben. Die verbes-serte Koordinierung des OV-Angebots insbesondere ab1980 ist nur durch die Verbesserung der Umsteigewar-tezeiten erfasst. Die Berechnungen sollten deshalb dieweiteren Verringerungen der generalisierten Kosten imOV (Reduktion der geplanten Verfriihungen und Ver-spatungerr') unterschatzen, damit auch die Erreich-barkeitsentwicklung.
Als Teil der Netzmodellierung miissen Festlegungenftir die raumliche Auflosung und die intrazonale Rei-sezeit sowie fur die Detaillierung der MIV- wie auchOV-Netze getroffen werden. Ferner muss fur die Er-reichbarkeiten der Gewichtungsparameter der genera-lisierten Kosten festgelegt oder ermittelt werden.
Die riiumliche Auflosung
Idealerweise wiirde man die Reisezeit zwischen Haus-adressen berechnen, da so die raumliche Variation inden Reisezeiten bzw. den generalisierten Kosten voll-
RuR6/2005
standig abgebildet wiirde. Dies ist aber zurzeit fiir gro-Isere Anwendungen noch nicht moglich. Fiir aktuelleArbeiten mit diesem Ziel sei auf Raney / Cetin /Vollmy /Vritc / Axhausen / Nagel (2003) verwiesen.
Die verschiedenen Standorte werden daher zu Zonenaggregiert, die durch einen zugehorigen (bevolke-rungsgewichteten) Schwerpunkt abgebildet werden.Dieser reprasentiert aIle Aktivitatsmoglichkeiten alsPunkt und ist damit auch die Quelle bzw. das Ziel furaIle aus- und einstromenden Fahrten.
Die Schweiz bestand 2000 aus 2 896 Gemeinden mitinsgesamt 7,1 Mio. Einwohnern. Im Vergleich zu denNachbarlandern gibt es viele kleine Gemeinden, z. B.haben 148 Gemeinden weniger als 100 Einwohner. DerProzess der Gemeindezusammenlegung dauert schoneinige Zeit an und wird auch in der Zukunft fortschrei-ten. Dieser Vorgang erfordert, dass zur Konsolidierungder Daten eine vollstandige Zuordnung der Gemein-den iiber die Zeit vorliegt, wie dies fur die Schweiz vonTschopp, Keller und Axhausen (2003) fur die iiber 300betroffenen Gemeinden durchgefuhrt wurde.
Die Grosse einer Zone hat direkte Auswirkung auf denberechneten Erreichbarkeitswert (s.u.), insbesonderein Grofsstadten, Wenn eine GroBstadt als eine Zonebehandelt wird, kann die Erreichbarkeit von Nachbar-zonen uberschatzt werden, da die Reisezeit zwischenSchwerpunkt Grofsstadt und Schwerpunkt Umge-bungsgemeinde aufgrund der Lage des ersteren sehrkurz sein kann. Ein Beispiel ist Ziirich und Opfikon,da die Schwerpunkte jeweils in Bahnhofsnahe liegen.Vorliegend werden deshalb die Grofsstadte (Ziirich,Genf, Basel, Bern und Lausanne) entsprechend derpolitischen Aufteilung der Stadte in sechs bis zw61fZo-nen zergliedert und die restlichen Gemeinden als eineZone behandelt.
Die Festlegung eines Untersuchungsperimeters ist na-tiirlich immer willkiirlieh. Sie reflektiert sowohl die An-nahmen iiber die Wirkungen der Aktivitatsmoglichkei-ten aulserhalb des eigentlichen Untersuchungsgebietsauf die Resultate im Untersuchungsgebiet als auch dieKosten der Datenerhebung. In der Schweiz liegen dreigrofse Stadte entweder direkt an der Grenze (Genf undBasel) oder sehr grenznah (Lugano). Die Erreichbarkeitdieser Stadte wird somit stark von Akrivitatsmoglich-keiten aulserhalb der Schweiz beeinflusst. Daher wur-den hier die Aktivitatspunkte in den Nachbarlandernbis zu einem Abstand von 350 km ab Schweizer Gren-ze beriicksichtigt (vgl. Abbildung 1). Fiir Deutschland,Liechtenstein und Osterreich war es moglich, die Be-volkerungsdaten auf NUTS3-Niveau zu erhalten. FiirFrankreieh und Italien konnten diese Daten nur aufNUTS 2-Ebene zusammengetragen werden.
387
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Abbildung 1Untersuchungsperimeter mit dem Strafsennetz im Iahr 2000
Die dicken roten Linien stellen die Autobahnen dar; die blauen Kreise sind die europaischen Zonen.Die Stadtnamen dienen zur Orientierung.
Intrazonale Reisezeit
Der Beitrag der zoneneigenen Aktivitatsmoglichkeitenzur Gesamterreichbarkeit einer Zone ist substanzi-ell. Die intrazonale Reisezeit, also die durchschnittli-che Reisezeit zwischen zwei zufalligen Punkten in derZone, d.h. hier Gemeinde oder Stadtkreis, ist also zwin-gend zu schatzen. Wenn Informationen zum bebautenGebiet je Zone vorliegen, kann mit dem von Rietveldund Bruinsma (1998) vorgeschlagenen Ansatz gearbei-tet werden:
d = ~(0/Tt )(Tt - 1)/ Tt
Dabei wird d als durchschnittliche Distanz zwischenzwei beliebigenPunkten in einer Zone mit der bebau-
388
ten Flache 0 errechnet. Die bebauten Flache der Zo-nen (Gemeinden und Stadtkreise) wurde der Arealsta-tistik des Bundesamts fur Statistik (2002) entnommen.Urn die intrazonale Reisezeit zu erhalten, wurde ftirden MIV eine Geschwindigkeit von 15 km/h und furden OVvon 10 km/h angenommen (fur entsprechendeSchweizer Messungen siehe Hackney/ Marchal/Axhau-sen 2005; Marchal! Hackney/Axhausen, im Druck).
Detaillierung der MIV-Netze
Die Herausforderung bei der Berechnung historischerReisezeiten ist es, die fruheren Netzzustande abzubil-den. Zu entscheiden ist, mit welchem Detaillierungs-grad gearbeitet werden solI - oder anders formuliert:SolI nur die Entwicklung der Autobahnen berucksich-
RuR6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
tigt werden oder zugleich die der Hauptstrafsen odersagar aller StraBen? Die vergleichbare Frage stellt sichnatiirlich auch im Zusammenhang mit den OV-Net-zen.
Als Ausgangsbasis wurde fur das Schweizer MIV-Netzdes Jahres 2000 auf das Produkt MicroDrive der FirmaMicroGIS, St. Sulpice zurtickgegriffen. Dieses Netz um-fasst die ganze Schweiz und besteht aus rund 20 000Strecken und rund 15000 Knoten. Yom Jahr 2000 anruckwarts wurden die Anderungen (Eroffnungen, Ver-besserungen und zusatzliche Fahrstreifen) sowohl aufAutobahnen und -strafsen als auch auf Hauptstralsenim Zeitraum 1950 bis 2000 berucksichtigt, Fiir die Ent-wicklung der Autobahnen konnte auf ASTRA (2001)zurtickgegriffen werden. Die Datenerhebung zu denHauptstrafsen gestaltete sich sehr aufwandig, da kaumeine der kantonalen StraBenverwaltungen die Entwick-lung dieser Stralsen umfassend und konsistent doku-mentiert hat. Daher musste deren Entwicklung anhandvon Karten, Zeitschriften, Planen, Strafsenbaupro-grammen und -budgets rekonstruiert werden. Danachmussten die Daten in aufwandiger Weise abgestimmtund abgeglichen werden, da sich die Bezeichnungen,Beschreibungen und mafsgeblichen Eigenschaftentiber die Zeit geandert hatten.
Urn das Untersuchungsgebiet auch auf das angren-zende Ausland auszudehnen (siehe oben), wurde dasSchweizer StraBennetzmodell mit einem europaischenStralsennetz der PTVAG,Karlsruhe, kombiniert. In die-sem Netz wurde die Entwicklung der Autobahnen in ei-nem Gebiet, das von den Stadten Frankfurt, Salzburg,Genua, Lyon und Paris begrenzt wird, nachvollzogen.Tabelle 1 gibt eine Ubersicht tiber die bearbeitetenStrecken in den beiden Netzteilen.
Der Schwerpunkt einer Schweizer Zone hat Anbindun-gen an das Strafsennetz mit einer Geschwindigkeit von15 km/h, Die Schwerpunkte der Zonen aufserhalb derSchweiz sind mit einer Geschwindigkeit von 40 km/hangebunden, da diese Zonen grofser sind und das Stra-Isennetz in diesen Gebieten grober abgebildet wird.
Die Koordinaten der Schwerpunkte der Zonen wurdenvorn Bundesamt ftir Raumentwicklung bereitgestellt.Die Lange der Anbindungen ergibt sich aus der Luft-liniendistanz zwischen Schwerpunkt und den Knoten,an welchen die Anbindungen ans Stralsennetz erfol-gen.
In einem Netzmodell werden die Strecken mit ihrerLange, freien Geschwindigkeit, Kapazitat und mit Para-metern der Capacity-Restraint-Funktion beschrieben,welche die Abhangigkeit der gefahrenen Geschwindig-keit vom Auslastungsgrad abbildet. Eine vollstandigeBeschreibung war nur fur das Iahr 2000 vorhanden.Die teilweise rasanten Veranderungen der letzten 50Jahre in der Fahrzeugtechnologie, im Fahrverhaltender Fahrzeuglenker, des StraBenreglements und derStralsenqualitat machten es notwendig, fur die sechsverschiedenen Untersuchungszeitpunkte (1950, 1960,1970, 1980, 1990, 2000) die entsprechenden Strecken-attribute festzulegen.
Es sind keine historischen Nachfragematrizen vorhan-den, die zur Berechnung der Geschwindigkeiten mitHilfe einer belastungsabhangigen Umlegung verwen-det werden konnten, Daher ist es notwendig, begrun-dete Annahmen tiber die mittlere Geschwindigkeit aufjedem Streckentyp zu machen. Das verwendete Netz-modell hat eine Vielzahl an Streckentypen (25 fur denSchweizer Netzbereich, 26 ftir das umliegende Netz),die es erlauben, eine verntinftige Differenzierung vor-zunehmen.
Die angenommenen Streckeneigenschaften grundensich auf die ausfuhrliche Arbeit von Erath I Frohlich(2003), die solche Eigenschaften aufgrund von Datenund Berichten aus der Schweiz, Deutschland und denUSA abgeleitet haben. Dabei wurden Informationentiber gemessene Geschwindigkeiten, Kapazitaten undVerkehrszahlungen verwendet, urn eine konsistenteSerie fur freie Geschwindigkeiten, Capacity-Restraint-Funktionen, Kapazitaten und mittleren Geschwindig-keiten je Streckentyp und Dekade (zwischen 1950 und2000) zu erstellen. Mit diesen sowie mit Zahlwerten
Tabelle 1Anzabl der Strecken im erweiterten Stralsennetzmodell (Schweiz (CH) und Umland (U)
Jabr Modiflzierte Nicht TotalCH Modifizierte Nicht Total UStreckenCH modiflzierte Strecken U modiflzierte
StreckenCH Strecken U
1950 3'527 14'171 17'698 136 29'112 29'2481960 3'589 14'171 17'760 195 29'112 29'3071970 4'147 14'171 18'318 422 29'112 29'5341980 4'810 14'171 18'981 747 29'112 29'8591990 5'215 14'171 19'386 896 29'112 30'0082000 - - 19'700 - - 30'053
RuR6/2005 389
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW.Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Abbildung 2 . .. . ah h f A bahVerteilung der geschiitzten durchschnittlichen Streckengeschwlndlgkelten 10 der Schwelz nach J rze nt au uto nund Hauptstrafse
t•&
HauptstraBe
n=248 n=214 n=228 n=231 n=216 n=1850
1990 20001950 1960 1970 1980
90.,.-~~-~~~~~~~~~--~
70
80
60
Zweistreifige Autobahn
-r- r~t
~--6--
.5:=JQ;;C
jU
=~.iI
n=23 n=47 n=69 n=80
1970 1980 1990 2000
n=2
-
~Jl: 110.5:=J:f.5100
I! 90
t
120-r-~--~~~~~~~~I
Man beachte die unterschiedlichen Skalen der beiden Abbildungen
Quelle: Axhausen / Frohlich (2004)
von rund 350 Zahlstellen konnten dann die Geschwin-digkeitsverteilungen der wichtigsten Streckentypen jeZeitperiode errechnet werden. Abbildung 2 zeigt dieseVerteilungen fur die Streckentypen Zweistreifige Auto-bahn und Hauptstrafse. Es ist interessant zu sehen, wiedie Geschwindigkeiten auf den Hauptstrafsen bis 1970leicht ansteigen. Gleichzeig ist eine Zunahme derVari-anz zu beobachten, die eine Folge der hoheren Auslas-tung ist. Sparer hat das grofserwerdende Autobahnnetzteilweise die Hauptstralsen entlastet, und zwischen1980 und 2000 nahm die Varianz abo Gleichzeitig senk-ten die Anderungen des Geschwindigkeitsreglementsdas absolute Geschwindigkeitsniveau. Auf den Auto-bahnen ist der umgekehrte Effekt zwischen Geschwin-digkeit und ihrer Varianz zu erkennen.
Die Streckengeschwindigkeit ist abhangig von den Stre-ckeneigenschaften und der Belastung. DifferenzierteStreckenbelastungen lassen sich nur mit einer umge-legten Nachfragematrix errechnen. Wenn keine Nach-fragematrix vorhanden ist, stellt die Reisezeit auf demBestweg zwischen den Zonen unter Berucksichtigungder geschatzten mittleren Geschwindigkeit je Strecken-typ die beste Naherung dar. Dieser Ansatz musste furden Zeitraum 1950 bis 1990 verwendet werden undwurde aus Konsistenzgrunden auch fur das Jahr 2000angewendet. Urn die erhaltenen Resultate fur 2000 zuverifizieren, wurde eine Gleichgewichtsumlegung (GG)mit dem Nationalen Verkehrsmodell (inkl. Nachfra-gematrix) aus Vrtic / Frohlich / Schussler / Axhausen /Dasen / Erne / Singer / Lohse / Schiller (2004) berechnet(siehe Tab. 4 fur den Vergleich der Ergebnisse).
OV-Netzmodell
Ausgehend vorn Schienennetz fur das Iahr 2000 wur-de die Entwicklung der rund 5 500 Strecken und 2 700Knoten verfolgt (siehe auch Frohlich et al. 2003). 1mGegensatz zum Strafsenverkehr, bei dem der Konsu-ment die Infrastruktur als Angebot selbst nutzen kann,stellen im OV die Linien das Angebot fur den Nutzerdar und nicht die Inf~astruktur an sich. Fur ~~e ~echs
Untersuchungszeitpunkte wurden alle werktaghchenund ganzjahrigen in der Schweiz verkehrenden Zugesowie einige interregionale Buslinien erfasst. EinigeTouristenbahnen, die keine Gemeinden erschliefsen,wurden weggelassen. In Tabelle 2 sind die Anzahl dererfassten Kurse pro Tag sowie die bedienten Haltestel-len und Bahnhofe aufgefuhrt,
!Die Anbindungen vom Zonenschwerpunkt zur nachs-ten Haltestelle/zum nachsten Bahnhof bilden die Zeitab, die der Passagier fur diese Wegetappe benotigt. Inden letzten 50 Jahren wurden einige Schienenstrecken
TabeUe2Anzahl OV-Kurse (Zug oder Bus) pro Tag und die bedientenHaltestellen nach Iahr
Bediente HaltestellenIahr OV-Kurse pro Tag und Bahnhbfe1950 6397 19521960 7232 19321970 7317 1 7761980 9342 18321990 11473 19492000 11227 1904
390 RuR 6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW.Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Tabelle3Anbindungstypen im OV-Netz
Zonentyp Llinge der Anbindung Distanzart Geschwindigkeit
Schweizer Zonen mit eigenem Luftliniendistanz 6km/hBahnhof
Schweizer Zonen ohne eigene 0-10 km Strafsendistanz bis 1 km 6 km/h, dann linearBushaltestelle ansteigend bis 20 km bei 10 km
Schweizer Zonen ohne eigene > 10km Stralsendistanz 20 km/hBushaltestelle
Zonen in Schweizer O-lkm Strafsendistanz 6km/hGrofsstadten
Zonen in Schweizer >lkm Strafsendistanz 10 krn/hGrofsstadten
Europaische Zonen <6km Luftliniendistanz 20 min.
Europaische Zonen >6km Luftlinendistanz 40 km/h
bzw. Personenverkehre eingestellt und die zugehorigenHaltestellen/Bahnhofe geschlossen. Auch diese Ent-wicklung musste bei den Anbindungen der verschiede-nen Untersuchungszeitpunkte berucksichtigt werden.Die Anbindungen berucksichtigen den Zonentyp, dieEntfernung und ob die Zone eine eigene Haltstelle oderBahnhof hat (siehe Tab. 3). Die Geschwindigkeitsan-nahmen basieren auf Auswertungen der Fahrplane derSBB (Bodenmann 2003) und dem Mikrazensus Verkehr2000 (Bundesamt fur Raumentwicklung I Bundesamtfur Statistik 2001).
Gewichtung der Reisezeiten
Die Erreichbarkeitsberechnung erfolgt mit dem in Ab-schnitt 1 beschriebenen Ansatz. Als Aktivitatspunktewurde die Bevolkerung verwendet. Der Parameter furdie generalisierten Kosten wird mit 0,2 angenommenund tiber den gesamten Untersuchungszeitraum kon-stant gehalten. Dieser Wert wurde fur die Jahre 1960und 1970von Schilling (1973) fiir die Schweiz geschatzt.Lenz (2005) zeigt zwar fur ein analoges Modell und denZeitraum 1978-1996, dass der Parameter variiert, kannaber keinen Trend nachweisen. Es ist realistischer an-zunehmen, dass sich der Parameter tiber die Zeit hin-weg durch die Anderungen in der Standortwahl undauch Verringerung der Transportkosten im Verhaltniszum Haushaltseinkommen verandert hat. Eine Schat-zung des Parameters tiber die 50 Jahre wiirde detaillier-te Daten tiber die Zielwahl erfordern; sie liegen jedochnicht ftir den gesamten Untersuchungszeitraum vor.
RuR 6/2005
3 Erreichbarkeiten
Die Investionen in das Hochleistungsstrafsennetz unddas Bevolkerungswachstum ab 1950 haben einen be-deutenden Erreichbarkeitsanstieg bewirkt. Die Erreich-barkeitsanderungen der Gemeinden am oberen Endeder Verteilung (der Schweizer Gemeinden) sind relativklein. Die Bevolkerungsverluste der Grolsstadte wur-den hinsichtlich der Erreichbarkeit durch die hohereGeschwindigkeit auf demWeg zum dichter besiedeltenUmland ausgeglichen. Die Entwicklung der Kennzah-len ftir die Erreichbarkeit im MIV und bv sind in Ta-belle 4 zusammengefasst. Das Jahrzehnt von 1960 bis1970, in dem es zu grofsen Fortschritten in der Fahr-zeugtechnologie und zur Fertigstellung langerer Auto-bahnabschnitte kam, war im MIVdiePeriode mit demgrofsten Erreichbarkeitszuwachs (+ 4,5 % im Median).1mbv brachte die Einfuhrung des Taktfahrplans in den1980er Jahren den relativ grolsten Erreichbarkeitszu-wachs von 2,1 %.
1m unterem Teil der Tabelle 4 sind die relativ grofsereMIV-Erreichbarkeit gegentiber der bV-Erreichbarkeitsowie der Vergleich zwischen der Gleichgewichtsumle-gung des MIV-Modells (2000 GG) aus Vrtic et al. (2004)und dem MIV-Modell dargestellt. Man beachte, dass eshier praktisch keine Unterschiede gibt.
Die Berechnungen worden auch fur die Beschaftigtendes 2. und 3. Sektors statt der Bevolkerung durchge-fuhrt, die aber hoch miteinander korrelieren (Pear-son-Korrelationskoeffizient bei den Beschaftigten im2. Sektor: MIV0.945-0.972, bv 0.907-0.932; im 3. Sek-tor: MIV0.915-0.978, ov. 0.911-0.951).
391
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwieklung der Erreiehbarkeit ...
Tabelle 4Deskriptive Statistik der Erreichbarkeitswere MIV und ov
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2000GG
MIV-Erreichbarkeit
Mittelwert 8.272 8.488 8.859 8.957 9.034 9.120 9.223Median 8.409 8.617 9.006 9.111 9.200 9.302 9.387Std. Abw. 0.917 0,935 0,971 0.994 0.995 0.993 1.04325 % Perzentil 7.867 8.038 8.426 8.498 8.576 8.659 8.73374 % Perzentil 8.867 9.1020 9.513 9.653 9.710 9.798 9.932
OV-Erreichbarkeit
Mittelwert 6.446 6.516 6.611 6.665 6.775 6.849Median 6.360 6.438 6.539 6.603 6.742 6.848Std. Abw. 1.102 1.193 1.288 1.308 1.301 1.30425 % Perzentil 5.666 5.659 5.659 5.717 5.820 5.92175 % Perzentil 7.166 7.320 7.522 7.616 7.745 7.800
MIVVerhiiltnis MIV- zu OV-Erreichbarkeit 2000GG/2000
Mittelwert 1.307 1.332 1.376 1.381 1.368 1.365 1.011Median 1.277 1.299 1.335 1.334 1.324 1.324 1.007Std. Abw. 0.191 0.209 0.232 0.237 0.226 0.222 0.01925 % Perzentil 1.158 1.167 1.192 1.192 1.189 1.188 1.00175 % Perzentil 1.428 1.462 1.532 1.532 1.506 1.499 1.017
In Abbildung 3 sind die Werte nach Rang der Gemein-de dargestellt. Hier zeigt sieh deutlieh, dass sieh der Er-reiehbarkeitsvorsprung der Grolsstadte gegenuber demUmland tiber die Jahrzehnte hinweg verringert hat.
Die raumlichen Verteilungen sind 1950 und 2000 imMIV und bv ahnlich (Abb, 4): GroBen Zuwachsen inden Agglomerationsgebieten urn die Grofsstadte und inden grolsen Touristengemeinden (z. B. St. Moritz, Zer-matt) steht eine relativ schwache Entwieklung in denGrolsstadten selbst und den Randgebieten gegentiber.Die Korrelation zwischen den Jahrzehnten ist hoch,knapp 0.99, aber sie wird kleiner (min. ca. 0.93), wenndie Anzahl der dazwischen liegenden Jahrzehnte er-hoht wird.
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die Erreiehbarkeits-werte in einer 3D-Darstellung mit gleieher Skala fiirMIV und by, 1950 stachen die Grofsstadte als Gipfelhervor, tiber die Zeit heben sich aber die Werte imUmland, insbesondere im MIV, deutlieh an. Die Crofs-stadte haben seit den 50er Jahren Bevolkerung verlorenund die Umland- und Tourismusgemeinden teilweisemassiv an Einwohnern zugelegt. Die Logarithmierungwurde unterlassen, urn die Unterschiede der Erreieh-barkeitswerte besser erkennen zu konnen, was aber zueiner Uberzeichnung der Vorteile des MIVfiihrt.
392
Das Verhaltnis der MIV- zur Ov-Brreichbarkeit fiir dasIahr 2000 zeigt fiir die ganze Schweiz den grolsen At-traktivitatsvorsprung des MIV (Abb.7). Besonders starkist dieser entlang der Autobahnkorridore, neben denenkeine leistungsfahigen Bahnlinien existieren, z.B.nebendem mittleren und sudlichen Teil der A13, dem nordli-chen Teil der A4, d~rAl westlich von Bern und der A12.Auch entlang von Bahnlinien kann das Verhaltnis vonGemeinde zu Gemeinde stark variieren, je nachdem,ob eine Gemeinde einen eigenen Bahnhof hat odernieht. In den Rand- und Berggebieten ist, wenn keineAutobahn vorhanden ist, die Erreiehbarkeit mit dembv besser als im schweizerischen Durchschnitt, so z. B.im Engadin und in Teilen des Juras.
Der Vergleieh der MIV-Erreiehbarkeiten aus dem nati-onalen Verkehrsmodell mit Gleiehgewiehtsumlegung(Vrtic et al. 2004) und dem hier erstellten MIV-Modell2000 ergibt einen Median von 1.007, d. h. die Erreieh-barkeiten wurden leieht unterschatzt (Abb. 8). Diegrossten Abweiehungen zeigen sieh in den Agglome-rationsgebieten. Sie sind auf die im nationalen Modellnicht abgebildeten Fahrten innerhalb der Grolsstadtesowie auf einige Streckenumtypisierungen dort zu-ruckzufuhren, Daher sind in dies en Regionen die Ge-schwindigkeiten hoher, Es kann festgestellt werden,dass die Erreichbarkeitswerte aus dem MIV-Verkehrs-modell 2000 sehr gut mit den Werten aus dem Natio-nalen Verkehrsmodell ubereinstimrnen.
RuR 6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW.Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
QV (aile Gemeinden)Abbildung 3
Verteilung der Erreichbarkeits-werte im MIVvon 1950 bis 2000
Man beachte dieunterschiedlichen Skalen fur die
unteren beiden Abbildungen
MIV (aile Gemeinden)1000000
'2000 GG·2000·19901980
-1970'1960'1950
100
1000000
:0= 100000~ 10000.~
LU 1000o
100
'2000 GG'2000, 19901980
-1970'1960'1950
10+--~-~--~-~-~-~
o 500 1000 1500 2000 2500 3000Rangdar Gamainda
10+--~-~-~-~-~-~
o 500 1000 1500 2000 2500 3000RangdarGamainda
MIV (ersten 150 Gemeinden) QV (ersten 150 Gemeinden)
50 75 100 125 150Rangdar Gamainda
25o+--_-_-_-_-_~
o
30000
25000
~ 20000]lii 15000.~
W10000
5000
15012550 75 100Rangdar Gamainda
25
50000
25000
O+--~--~-~-~--~--
o
Abbildung4VerhliItnis Erreichbarkeit im Iahr 2000 zu 1950 fiir MIV und QV
< -0,5 Std. Dey._ -0,5 - 0.5 Std. Dey._ > 0,5 Std. Dey.
QV
MIV
Verhaltnis MIV:Min = 0.884; -0.5 Std. Abw. = 1.079; Median =1.099; ;Mittelwert = 1.103; +0.5 Std. Abw. = 1.127: Max = 1.376
Verhaltnis OV:Min = 0.682; -0.5 Std. Abw. = 1.020; Median =1.056; ;Mittelwert = 1.061; +0.5 Std. Abw. = 1.102: Max = 1.515
RuR6/2005 393
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
394
Abbildung5ErreichbarkeitgebirgeMIV 1950-2000 (ohneLogarithmierungl
Abbildung6Erreichbarkeitsgebirgeov1950-2000 (ohneLogarithmierung)
RuR6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW.Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Abbildung7Verhiiltnis MIV-zur DV-Erreichbarkeit flir 2000
Kennzahlen: Min = 0.954; -0.5 Std. Abw. = 1.254;Median =1.324; Mittelwert =1.365; +0.5 Std.Abw. =1.477: Max =2.446
Abbildung8Verhiiltnis der MIV-Erreichbarkeit des nationalenVerkehrsmodell zum Modell 2000
Kennzahlen: Min =0.969; -0.5 Std. Abw.=1.001;Median = 1.007; Mittelwert = 1.011; +0.5 Std.Abw.=1.021: Max =1.202
4 GeschwindigkeitenDie regionale Verteilung der mittleren Geschwindigkei-ten fur 2000 zeigt ein anderes Bild als das der Erreich-barkeiten, da hier die Rander der Agglomerationsraumedie hochsten Werte haben (Abb, 9). Dies ist begrundetmit den langeren Fahrtweiten zu den Aktivitatspunk-ten, die naturlich einen hohen Anteil an Autobahnbe-nutzung erlauben. In den Grofsstadten selbst ist die ge-wichtete mittlere Geschwindigkeit niedrig, da hier dieAktivitatspunkte mit langsameren Geschwindigkeitenerreicht werden. Im Verhaltnis der Geschwindigkei-ten von 2000 und 1950 zeigt sich die starke Wirkungder Autobahnbauten. Die mittlere Geschwindigkeit imOV (Abb. 10) zeigt erwartungsgemafs niedrigere Werte
RuR6/2005
in den Grolsstadten und hohere an den Randern derAgglomerationen. Auch die Bahnlinien entlang derPlusstaler, z.B. im Rhein- oder Rhonetal, sind gut zu er-kennen. Das Verhaltnis der mittleren Geschwindigkeitim MIV und im OV zeigt hohe Werte in Gebieten, wokonkurrenzfahige OV-Systeme fehlen, wie z. B. auf demPlatau zwischen Neuenburger und Genfer See oder imRheinwald (Abb. 11). Die Korrelation zwischen den Er-reichbarkeitswerten und den Geschwindigkeiten desgleichen Untersuchungszeitpunkts liegt beim MIVzwi-schen 0.026 und 0.182 sowie beim OV zwischen 0.16und 0.33 und ist signifikant auf dem Niveau von einemProzent.
395
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW.Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Abbildung9Mittlere Geschwindigkeit MIV2000 und VerhaItnis der mittleren Geschwindigkeit MIVfiir 2000 und 1950
Mittlere Geschwindigkeit MIV2000 Kennzahlen: Min = 15,50km/h: -0.5 Std. Abw. = 42,8 km/h; Median = 49.60 km/h;Mittelwert = 47.897 km/h; +0.5 Std. Abw. = 53.0 km/h; Max =72.1 km/h
Verhaltnis MIV2000 zu 1950 Kennzahlen: Min = 0.893; -0.5 Std.Abw. = 1.219; Median = 1.267; Mittelwert =1.321; +0.5 Std. Abw. =1.422; Max = 2.870
Abbildungl0Mittlere Geschwindigkeit OV2000 und VerhaItnis der mittleren Geschwindigkeit OVfiir 2000 und 1950
Mittlere Geschwindigkeit OV2000 Kennzahlen: Min = 8,5 km/h;-0.5 Std. Abw. = 10.8 km/h; Median = IUO km/h; Mittelwert =13.627 km/h; +0.5 Std. Abw. = 16.6 km/h; Max = 57.3 km/h
Abbildung 11VerhaItnis der mittleren Geschwindigkeit MIV und OV2000
396
Verhaltnis mittlere Geschwindigkeit OV2000 zu 1950Kennzahlen: Min = 0.286; -0.5 Std. Abw. = 0.990; Median = 1.079;Mittelwert = 1.028; +0.5 Std. Abw. =U68; Max = 2.827
Generallegende fur Abbildungen 9 bis II
< -0,5 Std. Dev._ -0,5 - 0,5 Std. Dev._ > 0,5 Std. Dev.
Kennzahlen: Min = 0.595; -0.5 Std. Abw. = 3.241; Median = 4.03;Mittelwert = 3.886; +0.5 Std. Abw. = 4.531; Max = 7.000
RuR6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Die hier vorgestellten Ergebnisse haben sowohl inhalt-liche wie auch methodische Aspekte, die fur die weitereArbeit wichtig sind. Auf kleinraumige Interpretationensoll hier im Folgenden aber verzichtet werden.
Methodisch kann man festhalten, dass es fiir die Be-rechnung der grofsraumigen Erreichbarkeitsverande-rungen im MIVausreicht, sich nur auf die Entwicklungdes Hochleistungsstrafsennetzs zu konzentrieren. DieVerfolgung des Zustands auf den Hauptstrafsen iiberdie Zeit ist eine aufwandige und kostenintensive Arbeit,die nur wenig zusatzliche Genauigkeit der Ergebnis-se bringt, wenn angemessen genaue Schatzungen dermittleren Geschwindigkeiten vorliegen. In diesem Fallsind gut 80% des Arbeitsaufwands in die Erfassung derHauptstrafsen geflossen - ein Aufwand, der aber nurnotwendig ist, falls die Erreichbarkeitsveranderungenim MIVkleinraumig untersucht werden sollen.
Im Fall der OV-Erreichbarkeit reicht die Modellierungder internationalen Ziige und Schnellziige nicht aus,da in den letzten Jahrzehnten ein Gutteil der Investiti-onen und laufenden Ausgaben im Bahnbereich in diebessere Koordinierung der OV-Angebote und nicht inhohere Streckengeschwindigkeiten geflossen ist. Hiermuss das Aquivalent zum untergordneten Netz miter-fasst werden.
Die mittleren Gemeindegeschwindigkeiten haben sichals eine niitzliche Mafszahl erwiesen, urn die Struktu-ren aufzeigen, die bei einer Betrachtung der Erreich-barkeiten iibersehen wiirden, hier z. B. die regionalspe-zifischen Effekte der Abwesenheit von Autobahnen aufdie relative Attraktivitat des ovInhaltlich wurde mit dieser Studie zum ersten Mal ge-zeigt, wie sich die grofsraumigen Erreichbarkeiten undGeschwindigkeitsverhaltnisse iiber die gesamte Nach-kriegszeit verandert haben. Es sind den Autoren keineStudien fiir andere vergleichbar grofse Regionen oderLander bekannt. Es wird eindriicklich klar, wie starkdie Erreichbarkeiten gewachsen sind, d. h. wie starkdie Schweiz fiir ihre Bewohner geschrumpft ist. Eswirdaber auch klar, dass die regionalpolitischen Bemiihun-gen urn die Peripherien keinen Erfolg gehabt haben.Gewinner sind die Umlandgemeinden der Grolsstadte,die Zwischenstadt im Schweizer Mittelland (Sieverts1997; Baccini/ Oswald 1998). Es zeigt sich aber auch,dass zumindest die Schweizer Grolsstadte ihre absolu-te Fiihrungsposition halten konnten. Sie sind weiterhindie Orte maximaler Erreichbarkeit und damit die pra-ferierten Standorte fiir hochwertige Dienstleistungenund Einzelhandel.
RuR6/2005
Es wird auch klar, dass der zeitgleiche Ausbau der Stra-Eennetze und Schienenangebote verhindert hat, dassder Ov zuruckfallt: aber eine relative Verbesserung warauf breiter Front nicht moglich, Im Umfeld der Stadteprofitiert der Ov von den lokal fallenden Geschwindig-keiten im MIV (siehe Abb. 2) und regionalen Ausbau-ten, aber nur dort. Im Schweizer Kontext stellt sich dieFrage, ob man diese Doppelstrategie weiter fortftihrenmochte - eine Frage, die sich in allen Landern West-europas angesichts der anderweitig belasteten staat-lichen Kassen und des erwarteten Bevolkerungsruck-gangs stellt.
Die planerische Praxis verzichtet in der Regel auf dieKartierung der Erreichbarkeiten, obwohl in der Regelalle notwendigen Daten eigentlich vorhanden sind.Dies scheint aus der Sicht dieser Ergebnisse unver-standlich, da die Erreichbarkeiten als grofsraumigesMaB den Planern eine iibersichtliche Zusammenfas-sung der geplanten Mafsnahmen zur Verfiigung stellt,insbesondere wenn man mit intermodal berechnetengeneralisierten Kosten arbeitet. Die raurnlichen Dispa-ritaten werden sofort sichtbar, aber auch erklarbar, Eszeigt als Indikator des Bodenwerts aber auch auf, woDisparitaten bestehen, die man nutzen, sichern oderabbauen miisste.
Die Arbeit, wie sie sich jetzt darstellt, ist aber erst einZwischenschritt. Die Zeitreihen zur Verkehrsinfrastruk-tur sind Grundlage fur die Bearbeitung der weiter-gehenden Fragen zu deren Auswirkungen auf Raum,Wirtschaft und Bevolkerung, Insbesondere von Inter-esse ist, wann, wo und wie stark die Zusammenhangezwischen Verkehrsinfrastruktur sowie deren Verande-rungen iiber die Zeit und den okonomischen und de-mographischen Variablen der Raumstruktur sind.
DankDie Autoren bedanken sich bei den Projektpartnern PeterKeller (jetzt Netzwerk Stadt und Landschaft, ETH Zurich),Hans-Ulrich Schiedt und Thomas Frey (ViaStoria, Bern)sowie Laurent Tissot und Serge Reubi (Institut d' Histoire,Universite de Neuchatel), fiir die fruchtbare Zusammenarbeit.Das Projekt wurde im Rahmen von COST 340 "Towardsa European Intermodal Transport Network: Lesson fromhistory" abgewickelt und vom Bundesamt fiir BiIdung undWissenschaft und Schweizerischen Nationalfond finanziert.Zusatzliche Mittel hat das Bundesamt fiir Verkehr zurVerfiigung gestellt. Dank auch den Verbesserungsvorschlagender anonymen Gutachter.
397
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Anmerkungen
0)VISUM ist ein Produkt der PTVAG, Karlsruhe (siehe www.ptv.de)
(2)Der OV-Nutzer kommt wegen seiner Bindung an den Fahrplan-takt entweder zu frtih oder zu spat ans Zie!. Eine Halbierung desFahrplantakts reduziert damit das Zeitfenster dieser Verfruhun-gen oder Verspatungen urn die Halfte. Hier liegt der eigentlicheGewinn der Taktverdichtung, da die Wartezeit beim Ersteinstiegvom informierten Nutzer frei gewahlt werden kann. Die histori-sche Abschatzung dieser Gewinne ist aber schwierig, da sich diefruheren Fahrplane an die Rhythmen der Nutzer angepasst hat-ten (Schichtzeiten, Geschaftszeiten, Ladenoffnungszeiten usw.).Es ist also nicht immer klar, ob ein Taktfahrplan hier Verbesse-rungen oder Verschlechterungen zur Folge hatte.
Literatur
Aschauer, D.: Is public expenditure productive? Iourn. of Mone-tary Economics 23 (989) 2, S. 177-200
Axhausen, K.W.; Frohlich, Ph.: Public investment and accessibil-ity change. In: Bauen, Bewirtschaften, Erneuern - Gedanken zurGestaltung der Infrastruktur. Hrsg.: H. Held; P. Marti. - Zurich2004, S. 207-224
Baccini, P.; Oswald, E (Hrsg.): Netzstadt: Transdisziplinare Me-thoden zum Umbau urbaner Systeme. - Zurich 1998
Ben-Akiva, M.E.; Lerman, S. R.: Discrete Choice Analysis: Theoryand Application to Travel Demand. - Cambridge 1985
Bodenmann, B.: Zusammenhange zwischen Raumnutzung undErreichbarkeit: Das Beispiel der Region St. Gallen zwischen 1950und 2000. - Zurich 2003 (unveroff, Diplornarbeit, IVTI ETH Zu-rich)
Brocker, J,; Kanse, A.; Schurmann, C.; Wegener, M.: Methodol-ogy for the assessment of spatial economic impacts of transportprojects and policies. - KiellDortmund 2002. =JASON Deliverab-le 2, Institute ftlr Raumplanung der Universitaten Kiel und Dort-mund2
Bundesamt fur Raumentwicklung - ARE; Bundesamt fur Statistik- BFS(Hrsg.): Mobilitat in der Schweiz. Ergebnisse des Mikrozen-sus 2000 zum Verkehrsverhalten. - Bern und Neuenburg 2001
Bundesamt fur Strassen - ASTRA (Hrsg.): Info 200I - Schweizeri-sche Nationalstrassen. - Bern 2001
Bundesamt fur Statistik - BFS:Arealstatistik Schweiz: Die Boden-nutzung in den Kantonen. - Neuchatel 2002
Chalasani, V.S., Engebretsen, 0.; Denstadli, J.M.; Axhausen, K.W.:Precision of geocoded locations and network distance estimates.Ioum, of Transportation and Statistics 8 (2005) (im Druck)
398
Erath, A.; Frohlich, Ph.: Geschwindigkeiten im PW-Verkehr undLeistungsfiihigkeiten von Strassen uber den Zeitraum von 1950-2000. - Zurich 2004. =ArbeitsberichtVerkehr- und Raumplanung(lVT/ETH), Band 183
Fernald, J.G.: Roads to prosperity? Assessing the link betweenpublic capital and productivity. American Economic Review 89(998) 3, S. 619-638
Frohlich, Ph.; Frey,T.; Reubi, S.; Schiedt, H.-U.: Entwicklung desTransitverkehrs-Systems und deren Auswirkung auf die Raum-nutzung in der Schweiz (COST 340): Verkehrsnetz-Datenbank.- Zurich 2004. =Arbeitsbericht Verkehrs- und Raumplanung(IVTI ETH), Band 208
Geurs, K. T.; Ritsema van Eck, J, R.: Accessibility measures: reviewand applications. - Bilthoven 2001. =RlVMreport (National Insti-tute of Public Health and the Environment), No. 408505006
Hackney, J.; Marchal, E; Axhausen, K.W.: Monitoring a roadsystem's level of service: The Canton Zurich floating car study2003. Vortrag beim 84th Annual Meeting of the TransportationResearch Board, Washington, D.C., Ianuar 2005
Holtz-Eakin, D. (1994) Public sector capital and the productivitypuzzle. Review of Economics and Statistics 76 (994) 1, S. 12-21
Kesselring, I-;!.; Halbherr, P.; Maggi, R.: StraEennetzausbau undraumwirtschaftliche Entwicklung. - Bern 1982
Kwan, M.: Space-time and integral measures of individual acces-sibility: A comparative analysis using a point-based framework.Geographical Analysis 30 (998) 3, S. 191-216
Lenz, M.: Auswirkungen des Ausbaus der verkehrlichen Infra-struktur auf das regionale Fernpendleraufkommen. - Stuttgart2005. =Schriftenr. Institut fur Stralsen- und Verkehrswesen, Univ.Stuttgart, Band 39
Marchal, E; Hackney, J.; Axhausen, K.W.: Efficient map-matchingof large GPS data sets - Tests on a speed monitoring experimentin Zurich. Transportation Research Record (2005, im Druck)
Munnell, A.H.: How does public infrastructure affect regionaleconomic performance? New England Econ. Review (1990) 5,S.1l-33
Nadiri, M.I.: Contributions of highway capital to output andproductivity growth in the U.S. economy and industries. Reportprepared for the Federal Highway Administration Office of PolicyDevelopment. - Washington, D.C. 1998
Ortuzar, J. de D.;Willumsen, L.G.:Modelling Transport. - Chich-ester 2001
Raney, B.; Cetin, N.;Vollmy, A.;Vritc, M.; Axhausen, K.W.; Nagel,K.:An agent-based micro simulation model of Swiss travel: Firstresults. Networks and Spatial Economics 3 (2003) 1, S. 23-42
Rietveld, P.; Bruinsma, E: Is Transport Infrastructure Effective?- Berlin 1998
RuR6/2005
Philipp Frohlich, Martin Tschopp und KayW. Axhausen: Entwicklung der Erreichbarkeit ...
Schilling, H.R.:Kalibrierung vonWiderstandsfunktionen. Studien-unterlagen Lehrstuhl fur Verkehrsingenieurwesen, ETH Zurich.- Zurich 1973
Schnabel, W.; Lohse, D.: Grundlagen der Stralsenverkehrstechnikund derVerkehrsplanung. - Berlin 1997
Shirley, C.;Winston, C.: Firm inventory behaviour and the returnsfrom highway infrastructure investments. Iourn, of Urban Econo-mics 55 (2004) 2, S. 398-415
Sieverts, T.:Zwischenstadt. - Braunschweig 1997
Tschopp, M.; Keller, P.; Axhausen, K.W: Raumnutzung in derSchweiz: Eine historische Raumstruktur-Datenbank. - Zurich2003. =Arbeitsberichte Verkehrs- und Raumplanung (IVT/ETH),Band 165
Vrtic, M.; Frohlich, P.; Schussler, N.; Axhausen, K.W; Dasen, S.;Erne, S.; Singer, B.; Lohse, D.; Schiller, C.; Institut fur Verkehrs-planung und Transportsysterne, ETH Zurich; Emch-Berger AG;TU Dresden, Lehrstuhl fur Verkehrsplanung: Erzeugung neuerQuell-Zielmatrizen im Personenverkehr, im Auftrag d. Eidgen.Departements fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation(UVEK), des Bundesamtes fur Raumentwicklung (ARE), des Bun-desamtes fiir Strassen (ASTRA) und des Bundesamtes ftirVerkehr(BAV). - Zurich und Dresden 2005
RuR6/2005
Widmer, I.-P.; Meister, K.:Ausgewahlte Schweizer Zeitreihen zurVerkehrsentwicklung. Materialien zur Vorlesung .Verkehrspla-nung", IVT/ETH Zurich. - Zurich 2005 (www.ivt.ethz.ch/educa-tion/verkehrsplanunglMaterialien002.2005.pdf)
Williams, H.C.WL.: On the formation of travel demand modelsand economic evaluation measures of user benefits. Environ-ment and Planning A 9 (1977) 2, S. 285-344
Philipp FrohlichMartin TschoppProf. KayW AxhausenInstitut fur Verkehrsplanungund TransportsystemeEidgenossische Technische HochschuleCH - 8093 ZurichE-Mail: [email protected]
[email protected]@ivt.baug.ethz.ch
399
















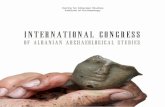




![Helvetia literarisch. Eine Anthologie der Texte Schweizer Autoren mit Aufgaben. Mit einer Einführung von Prof. Dr. Joanna Jabłkowska [Co-editor: Alina Kowalczyk]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63134b745cba183dbf0708bf/helvetia-literarisch-eine-anthologie-der-texte-schweizer-autoren-mit-aufgaben.jpg)














