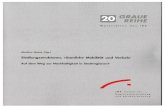Zukunft lernen und gestalten -Bildung für eine nachhaltige ...
Service Learning trifft Bildung für nachhaltige Entwicklung. Reflexionen über eine zukunftsfähige...
Transcript of Service Learning trifft Bildung für nachhaltige Entwicklung. Reflexionen über eine zukunftsfähige...
Reflexionen über eine zukunftsfähige Transformation der deutschen Hochschullandschaft
Mandy Singer-Brodowski 03.04.2014 Kiel
Bildung für Nachhaltige Entwicklung trifft Service Learning
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Gliederung
§ Nachhaltige Entwicklung
§ Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
§ Gemeinsamkeiten von BNE-Veranstaltungen und Service Learning
§ Institutionelle Konsequenzen der Verankerung von BNE/ SL
2
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Nachhaltige Entwicklung Hintergrund und Konzept
3
U Ge Wirtscha- Gesellscha- Umwelt
lokal
global
heute morgen
Quelle: Integratives Modell Nachhaltige Entwicklung, Beilag Bulletin umweltbildung.ch 1/2012, www.umweltbildung.at
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Nachhaltige Entwicklung Zielkonflikte und verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit
4
§ Zielkonflikte sind der Nachhaltigkeitsidee inhärent
§ Nachhaltige Entwicklung als gesamtgesellschaftlicher Such-, Lern- und Gestaltungsprozess
§ Erkunden von Alternativen, Innovationen und Visionen
§ Transformation „by design“ statt „by disaster“
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Gemeinsame Annäherung Speeddating
Bitte gehen Sie im Raum herum und kommen Sie mit einer unbekannten Person Ihrer Wahl ins Gespräch über die Frage:
Welche Fragen haben Sie an das Nachhaltigkeits-Konzept? Was bedeutet für Sie persönliche Nachhaltige Entwicklung? Wo begegnen Sie in Ihrem Alltag Ansätzen der Nachhaltigen Entwicklung?
5
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Nachhaltige Entwicklung Bedingungen zur Nachhaltigkeitstransformation
�=XVDPPHQIDVVXQJ�I¾U�(QWVFKHLGXQJVWU¦JHU
�
gen der Volksrepublik China, Indiens, der USA, Süd-koreas, Japans und Indonesiens treten für nachhaltige Entwicklung ein und haben dafür Strategien, Leitbil-der für „grünes Wachstum“ oder Umbaupläne für ihre Energiesektoren vorgelegt. In den letzten Jahren haben sich zudem weltweit viele emissionsarme Technologien dynamisch entwickelt. Die erneuerbaren Energien sind zu einem wichtigen Wirtschafts- und Beschäftigungs-faktor geworden. Viele Städte weltweit setzen bereits klimaverträgliche Zukunftskonzepte in die Praxis um, in großen Unternehmen sind aus kleinen Abteilungen für Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Res-ponsibility) vielfach „Innovationszentren für zukunfts-fähige Märkte“ geworden, und in der Wissenschaft sind Forschungsverbünde entstanden, die sich mit der Trans formation zur klimaverträglichen Gesellschaft be schäftigen.
Vieles gerät also in richtige Bewegung. Dennoch ist die Gefahr sehr groß, dass die Dynamik aus Wandel und Beharrungskräften in Sackgassen mündet (Abb. 2); die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft kann auch scheitern. Beispielsweise könnte die stei-gende Energieeffizienz von Fahrzeugen durch ihre schneller wachsende Zahl überkompensiert werden
(Rebound-Effekt). Oder Staaten könnten sich auf die Minderung ihres Treibhausgasausstoßes einigen, jedoch weit unter dem notwendigen Ambitionsniveau. Erneu-erbare Energien könnten an Bedeutung gewinnen, aber die weiterhin dominanten fossilen Energieträger nur ergänzen statt sie zu ersetzen. Derart halbherzig und verlangsamt umgesetzt könnte die Transformation in eine „3-4 °C-Welt“ führen, mit entsprechenden, kaum beherrschbaren Folgen für Natur und Gesellschaft. Es kommt jetzt darauf an, die Weichen so zu stellen, dass ein solches Resultat unwahrscheinlich wird.
Aus historischen Analysen lässt sich lernen, dass „Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen“ (Oster-hammel, 2009) historische Schübe und umfassende Transformationen anstoßen können. Die gesellschaft-liche Dynamik für die Transformation in Richtung Kli-maschutz muss also durch eine Kombination von Maß-nahmen auf unterschiedlichen Ebenen erzeugt werden:�! Sie ist wissensbasiert, beruht auf einer gemeinsamen
Vision und ist vom Vorsorgeprinzip geleitet.�! Sie stützt sich stark auf Pioniere des Wandels, wel-
che die Optionen für die Überwindung einer auf der Nutzung fossiler Ressourcen beruhenden Ökonomie testen und vorantreiben und so neue Leitbilder bzw.
$EELOGXQJ��Topographie der Transformation: Um vom Status quo zu einer klimaverträglichen Weltgesellschaft (vollständige Dekarbonisierung) zu gelangen, sind zunächst Hürden zu überwinden, die als ein Anstieg der gesellschaftlichen Kosten dargestellt sind. Dieser Anstieg wird derzeit durch Blockaden (rot) verstärkt: Die gesellschaftlichen Kosten des derzeitigen Zustands stellen sich geringer dar als angemessen, etwa durch Fehlanreize wie Subventionen fossiler Energieträger oder nicht einberechnete Umweltkosten. Gleichzeitig erscheinen die erforderlichen gesellschaftlichen Kosten des Umbaus höher zu sein als sie tatsächlich sind: Zwar erfordern verschiedene blockierende Faktoren hohe Anstrengungen, etwa die kostenintensive Überwindung von Pfadabhängigkeiten. Dem stehen jedoch begünstigende Faktoren gegenüber: Viele Technologien für die Transformation sind bereits vorhanden und ihr Einsatz ist finanzierbar. Mit Hilfe der begünstigenden Faktoren können die Hürden abgesenkt und so der Weg für die Transformation geebnet werden. Sind die entscheidenden Hürden einmal genommen, ist eine große Eigen dynamik in Richtung Klimaverträglichkeit zu erwarten.Quelle: WBGU
.LZLSSZJOHM[SPJOL�2VZ[LU
=VSSZ[pUKPNL�+LRHYIVUPZPLY\UN:[H[\Z�X\V
��7MHKHIOpUNPNRLP[LU��LUNL ALP[MLUZ[LY
��NSVIHSL 2VVWLYH[PVUZISVJRHKLU��YHZHU[L�<YIHUPZPLY\UN
��N�UZ[PN ]LYM�NIHYL 2VOSL]VYYp[L
)SVJRHKLU
��RSPTH]LY[YpNSPJOL�;LJOUVSVNPLLU[^PJRS\UN��-PUHUaPLY\UN T�NSPJO
��>LY[L^HUKLS a\Y 5HJOOHS[PNRLP[
��WV[LUaPLSSL�)LNSLP[U\[aLU�KLY�;YHUZMVYTH[PVU��NSVIHSL >PZZLUZUL[a^LYRL
)LN�UZ[PNLUKL -HR[VYLU
+LRHYIVUPZPLY\UNZNYHK
6
Quelle: WGBU (2011), S. 5
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Bildung für nachhaltige Entwicklung als zukunftsbezogene Allgemeinbildung
§ notwendige Transformation braucht nicht nur technologische Innovationen, sondern beflügelt gleichzeitig kulturelle Innovationen
§ Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Problemstellungen einer nicht-nachhaltigen Entwicklung steht im Mittelpunkt einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
§ BNE = „zukunftsbezogene Allgemeinbildung“ entlang von epochaltypischen Schlüsselproblemen
§ >Modernisierungsszenario< statt >Bedrohungsszenario<
§ UN Dekade BNE von 2005 bis 2014
7
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Bildung für nachhaltige Entwicklung Wissensformen zum Verstehen der großen Transformation
8
Quelle: http://wupperinst.org/unsere-forschung/forschung-fuer-den-wandel/
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Bildung für nachhaltige Entwicklung Kompetenzen der BNE
complexity, exploring future alternatives, crafting sustain-ability visions, and developing robust strategies in ways
that are scientifically credible, create shared ownership,
and are conducive for action—all of which requires stronginterpersonal competence.
Figure 2 depicts how the key competencies in sustain-
ability are linked to the integrated research and problem-solving framework.
Methods
The literature review is based on data from peer-reviewedjournal articles, grey literature (reports, white papers),
university websites, and curricula publications. However,
many university websites and curricula publications werestill largely under construction or not fully accessible when
this study was conducted. In addition, we found that grey
literature overlapped significantly with the peer-reviewedliterature (cf. Sterling and Thomas 2006; Svanstrom et al.
2008) and therefore primarily peer-reviewed journal arti-
cles and books are referenced in this article. Also includedare sources that do not identify specific competencies, yet
address the issue from a general perspective (e.g., Grun-
wald 2007). The literature search was conducted in GoogleScholar (for scholarly articles and books) and Google(for grey literature and university documents) using thefollowing keywords: ‘‘Sustainability’’ OR ‘‘Sustainable
Development’’ AND ‘‘Higher Education,’’ OR ‘‘Compe-
tencies,’’ OR ‘‘Key Competencies,’’ OR ‘‘Learning Goals,’’OR ‘‘Learning Outcomes.’’ The literature search identified
43 relevant documents with a significant focus on compe-
tencies in sustainability, namely, 28 journal articles andbooks as well as 15 reports and white papers. The key
journal articles analyzed are: Crofton 2000; Cusick 2008;de Haan 2006 (cf. Barth et al. 2007; van Dam-Mieras et al.
2008); Grunwald 2004, 2007; Jucker 2002; Kearins and
Springett 2003; Kelly 2006; Kevany 2007; Ospina 2000;Rowe 2007; Segalas et al. 2009; Shephard 2007; Sipos
et al. 2008; Steiner and Posch 2006; Sterling 1996; Sterling
and Thomas 2006; Svanstrom et al. 2008; Wals and Jic-kling 2002; Warburton 2003; Welsh and Murray 2003.
In the literature review, we first listed, for each document,
what each competence was entitled; what its definition andjustification were (if available); and how it was linked to the
other competencies (categorization or framework, if avail-
able). We subsequently cleaned the compilation by excludingelements that did not comply with the definition of compe-
tence (e.g., ‘having fun’); competencies that did not comply
with the definition of a key competence, such as criticalthinking and basic communication skills; and competencies
that appeared only once (no convergence).
We then clustered the compiled competencies accordingto conceptual similarities (across all sources) and guided by
an integrated framework of key competencies for sustain-
ability research and problem solving (see next section).Finally, we synthesized and complemented the catego-
rized competencies in short paragraphs including defini-
tion, justification, and examples. The justification wassupported by additional literature on sustainability princi-
ples and basic concepts (e.g., Gibson 2006). Throughoutthe analysis, we ensured inter-rater reliability by indepen-
dently conducting each step in part by two different raters.
Nevertheless, the analysis of the literature data was not amechanical but rather an interpretive process, guided by
conceptual reasoning and based on continuous exchange
with colleagues engaged in sustainability programs aroundthe world (Wiek et al. 2011).
Fig. 2 The five key competencies in sustainability (shaded in grey)as they are linked to a sustainability research and problem-solvingframework (see Fig. 1). The dashed arrows indicate the relevance ofindividual competencies for one or more components of the research
and problem-solving framework (e.g., normative competence isrelevant for the sustainability assessment of the current situation aswell as for the crafting of sustainability visions)
Sustain Sci
123
!
9
Quelle: Wiek u.a. (2011), S. 206
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Gemeinsamkeiten von BNE-Veranstaltungen und Service Learning Projektorientiertes Lernen im Kontext BNE
10
§ Intervention = Lernanlass für Studierende
§ Transdisziplinarität oder Nachhaltigkeit kann experimentelles Lernen fördern und Service Learning bereichern
§ Unterscheidung von Forschungsbasiertem Lernen und stärker praktisch ausgerichtetem Projektlernen
Gemeinsamkeiten: § Studierende lernen an realen Problemstellungen,
§ in kleinen Projektgruppen und
§ in einer authentischen Situation.
§ Lehrende sind Gestalter und Begleiter inspirierender Lernumgebungen.
§ Ergebnis- und Prozessreflexion erfolgt am Ende.
§ Studierende erfahren ein Gefühl der Selbstwirksamkeit!
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Murmelrunde
§ Bitte unterhalten Sie sich fünf Minuten mit ihrem Nachbarn:
Gab es in Ihren bisherigen Service-Learning Konzepten Nachhaltigkeits-Aspekte/ Ansätze von BNE? Wenn Sie sich entschließen würden in Ihren Angeboten verstärkt Nachhaltigkeitsaspekte aufzugreifen, wo könnten die integriert werden?
11
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Gemeinsamkeiten von BNE-Veranstaltungen und Service Learning Didaktische Haltung
§ basiert auf neueren Theorien des sozial-konstruktivistischen Lernens
§ Ermöglichungsdidaktik statt Erzeugungsdidaktik
§ Aufgabe der Lehrenden ist es Studierende zu ermutigen sich selbst stärker als Experten zu erleben
§ sowie Vertrauen in die Wirksamkeit ihres Handelns im erfolgreichen Umgang mit Komplexität Nachhaltiger Entwicklung zu entwickeln
§ Studierende unterstützen als change agents für den gesellschaftlichen Wandel zu agieren
§ Beispiel: Innovationsnetzwerk BNE
§ https://www.youtube.com/watch?v=GP5-cguAP24&feature=player_embedded
12
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut 13
§ Anbindung an Schlüsselkompetenzzentren/ Career Centres
§ Didaktische Weiterbildung von Lehrenden (Bsp. Lüneburg)
§ Lehr- und Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit Stadt (bspw. Stiftungsgefördert)
§ Überarbeitung der Studienordnungen (bspw. Förderung stud. Engagements durch SL-Projekte)
§ Nutzung virtueller Lernumgebungen (Virtuelle Akadamie BNE)
§ Hochschulpolitische Gremien und Berufungskommissionen
§ Kooperation mit Wissenschaftsministerien
Institutionelle Konsequenzen der Implementierung von BNE und Service Learning an den Hochschulen Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem
Laufende Diskussion unter: www.nachhaltigewissenschaft.blog.de
Seite Wuppertal Institut Wuppertal Institut
Verwendete Literatur
§ Arnold, R. (2007): Ich lerne, also bin ich. Eine systemisch-konstruktivistische Didaktik. Carl Auer Verlag: Heidelberg
§ Barth, Matthias (2007): Gestaltungskompetenz durch Neue Medien? Die Rolle des Lernens mit Neuen Medien in der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Berliner Wissenschaftsverlag: Berlin
§ BLK – Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (1998) (Hrsg.): Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – Orientierungsrahmen. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 69: Bonn
§ Brundiers, K.; Wiek, A. (2013): Do we teach what we preach? An International Comparison of Problem- and Project-based Learning Courses in Sustainability. In: Sustainability: 5, 1725-1746; doi:10.3390/su5041725
§ De Haan, Gerhard/ Harenberg; Dorothee (1999): Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Gutachten zum Programm. Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Bonn.
§ Schneidewind, Uwe; Singer-Brodowski, Mandy (2013): Transformative Wissenschaft. Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem. Metropolis: Marbung
§ Siebert, Horst (2003): Lernen ist immer selbstgesteuert- eine konstruktivistische Grundlegung. In: Udo Witthaus, Wolfgang Wittwer, Clemens Espe (Hrsg.): Selbst gesteuertes Lernen. Theoretische und praktische Zugänge. wbv: Bielefeld, S. 13-25
§ Vilsmaier, Ulli, Lang, Daniel (2014): Transdisziplinäre Forschung. In: Heinrichs, Harald; Michelsen, Gerd (Hrsg.): Nachhaltigkeitswissenschaften. Springer: Berlin/Heidelberg, S. 87-114
§ WBGU (2011), Hrsg:: Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Hauptgutachten 2011
§ Wiek, Arnim/ Withycombe, Laura/ Redman, Charles L. (2011): Key competencies in sustainability – A reference framework for academic program development. In: Sustainability Science 6,(2), S.203‐ 218
15