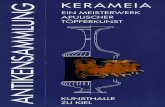Cohortes, ripae, pedaturae. Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike
-
Upload
uni-wuerzburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cohortes, ripae, pedaturae. Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike
Klassisches Altertum, Spätantike und frühes
Christentum
Adolf Lippold zum 65. Geburtstag gewidmet
Herausgegeben von
Karlheinz Dietz, Dieter Hennig und Hans Kaletsch
Würzburg 1993
KARLHEINZ DIETZ Würzburg
Cohortes, ripae, pedaturae Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike
Der Spätantike und den Donauprovinzen haben Sie, lieber Herr · Lippold, einen wesentlichen Teil Ihrer wissenschaftlichen Energie als Forscher und Hochschullehrer gewidmet, und wer bei Ihnen studieren durfte oder darf, wurde und ·wird unweigerlich und intensiv mit diesen Themenbereichen konfrontiert Speziell die Notitia Dignitatum - so klingt es aus Vorlesungen und Seminaren mahnend und ermunternd in den Ohren - eröffne dem Mutigen ein ebenso weites wie dorniges Feld für eigene Forschungen.1 Dies endlich beherzigend, wird im Folgenden eine historisch und methodisch nicht unwichtige Frage behandelt, in der Hoffnung, bei ihrer Klärung wenigstens teilweise Ihre Zustimmung finden zu können.
I
Die schrittweise Verkleinerung der römischen Truppenverbände im 4. Jahr~undert n. Chr. gehört zu den kaum bezweifelten loci communes der Forschung. Umstritten sind allerdings Zeitpunkt und Umfang dieser Reduzierungsmaßnahmen. Meist werden sie mit den sogenannten diokletianisch-konstantinischen Heeresreformen in Verbindung gebracht, womit indessen wenig gewonnen ist, weil diese ihrerseits alles andere als klar sind.2 Ja, nach jüngerer Ansicht soll sogar die Frage, ob die spätrömische Feldarmee das Werk Diokletians oder Konstantins sei, falsch gestellt
1 Eine instruktive Obersicht bietet A. Lippold, Notitia Dignitatum. In: KIP IV (1972) 166-168. Neuere Literatur zur Notitia habe ich in Auswahl zusammengestellt in: J. Bellot; W. Czysz u. G. Krahe (Hrsg.), Forschungen zur Provinzialrömischen Archäologie in BayerischSchwaben. Augsburg 198S, 97; vgl. 104 f. Weitere Literatur unten in Anm. 11 und Anm. 137.
2 Die wenigen Hinweise für Diok.letian hat W. Enßlin, in: RE VII A 2 (1948) 2461 -· 2464 besprochen. Ein knappes und zutreffendes Referat über den Gang der Forschung bietet S. Williams, Diocletian and the Roman Recovery. London 198S, 91 - 101; 246 - 248; vgl. außer· dem J.C. Mann. Duces and comites in the 4th Century. In: D.E. Johnston (Hrsg.), The Saxon Shore. 1977, 11 - 1S; M. Clauss, Heerwesen. In: RIAC XIII (1983) 1098- 1113; A. oemaildt, Die Spätantike. München 1989, 2SS - 272.
Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum. Adolf Lippold zum 6S. Geburtstag gewidmet, Würzburg 1993, 279-329.
280 Karlhein{. Dietz
sein, da sie keiner der be~reffenden Kaiser geschaffen, sondern beide sie lediglich· wie vordem etwa Trajan oder Septimius Severus - erweitert hätten.
3
Bezüglich des Grenzheeres, insbesondere des Schicksals der alten Legionen, wir· ken die Grundvorstellungen Tb. Mommsens 4 bis zum heutigen Tag nach. Nach ihm habe die ~egion der Notitia Dignitatum «immer noch einen Truppenkörper von ungefähr der früheren Stärke» gebildet (222), aber in einer «örtlichen Zer· splitter.ung» (224); Diokletian habe nämlich «auch das Legionscommando in eine Anzahl von Theilcommandos aufgelöst und die geborenen Träger dieses letzteren waren die sechs Tribune der Legion». Wiewohl es sich daher anbot, die Legion <<zu sechsteln und jedem Tribun ein Theilcommando von 1000 Mann zuzuwei· sen» (225), habe dies in der Praxis etwas anders ausgesehen. Denn «ob über die Zahl der dem wegfallenden Legionscommando substi~uirten Theilcommandos es eine feste Regel gegeben hat, steht dahin. Nach den Angaben der Notitia über die Donautruppen sind hier in einigen Ducaten Halblegionen nebst einem besonderen Flottencommando, anderswo andere Theilungen beliebt worden; sehr wohl kann ein jeder dieser Theile unter einen der Legionstribune gestellt worden sein. Eine andere Combination mag daneben auch in späterer Zeit dafür in Anwendung ge· kommen seiM (224 f.). Deutliche Spuren der Zersplitterung sehe man laut Notitia «in den Ducaten von Scythien und Moesia secunda», wo «neben dem eigentlichen Legionscommandanten, dem praefectus legionis zwei praejecti ripae (stehen), der eine für die fünf Coborten stromaufwärts vom Hauptquartier, der andere für die fünf Coborten stromabwärts, ausserdem ein weiterer praejectus ripae für die zu den beiden Legionen dieses Ducats gehörigen Schiffe. In ähnlicher Weise fin· den wir daselbst die Legionen auch in den übrigen Donauprovinzen aufge· löst>> (222 f.). Da der Text der Notitia damit nicht ganz übereinstimmte, veränder· te Mommsen durch eine ingeniöse Konjektur das an zwölf Stellen der Notitia Di· gnitatum tradierte, seines Erachtens «anstößige» quintae im Titel des praejectus legiqnis ( ... ) cohortis quintae partis ( ... ) zu quinque (223 Anm. 1).
Das so gewonnene Modell hat dank der Autorität seines Urhebers viel Beifall ge· funden.5 Es wurde seither in vielfältiger Weise differenziert, weiterentwickelt und
.angewendet,6 mit am entschiedensten von D. van Berchem, nach dem die Truppen·
3 M.P. .Speidel, The Later Roman Field Army and the Guard of the High Empire. Lato· mus 46, 1987, 375- 379 am Beispiel des Entstehens der comites d. n. aus den equites singula· res Augusti und der equites promoti d. n. aus den Prätorianern. Vgl. auch Deos., The Early protectores and their beneficiarius Lance. ArchKorrbl16, 1986, 451 - 454.
4 Gesammelte Schriften. VI. Dertin 1910, 222 - 225 (die Seitenzahlen der folgenden Zitate in Klammern).
5 Vgl. dazu beispielsweise die unten Anm. 11 genannten Titel. 6 Bedauerlicher· oder bezeichnenderweise sind viele wichtige Arbeiten nie erschienen: E.
von Nischer, Diocletian und Constantin. Die Heeresreformen Dioc:letians und Constantins und ihr Wandel bis zum Abschluß der Notitia dignitatum (zitiert in seinem Beitrag zu 1
· Kromayer u. G. Veith, Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer. München
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 281
teilung in Grenz- und Feldheer zwischen 311 und 325 erfolgt sein soll.7 Unter Ein· beziehung der übrigen ripenses (cunei equitum und auxilia) glaubte er in der Notitia «les etats succesifs d'une organisation qui n'a pas evolue partout avec Ia meme rapidite» (93) bestimmen zu können. Danach spiegle der Eintrag für Moe· sia Secunda und Scythia den ältesten Zustand wieder, der in Dacia Ripensis wei· terentwickelt und in Moesia Prima zum Abschluß gebracht sei; für Pannonien versucht er schließlich, die auf Diokletian und Konstantin zurückgehenden Phasen deutlich zu scheiden. Die Zerschlagung der alten Legionen und die Schaffung neu· er Einheiten hätten das Wesen der konstantinischen Reform ausgemacht. «L'example de Ia Scythie et de Ia Mesie inferieure montre que les Iegions ont ete partagees, d'abord, en deux contingents egaux; de lil, Ia mention d'une pars supe· rior et d'une pars itiferior, conservee par Ia Notitia, irregulierement et non sans inconsequence, puisque le nombre des prefets legionnaires indique que d'autres dedoublements ont eu lieu>> (99).
Wie tief derartige Vorstellungen wurzeln, sollen noch zwei jüngere Meinungen belegen, die wegen der Sachkompetenz ihrer Urheber aus der großen Zahl von Äußerungen der Forschungsliteratur herausgegriffen werden. Von der Analyse ge· stempelter Legionsziegeln ausgehend, glaubt T. Saritowski,8 zwei Zeitschichten in der Notitia bezüglich der Legionsorganisation im unteren Donauraum zu. erken· nen: während «für Moesia secunda und Scythia wahrscheinlich ... der Entwurf ei· nes neuen, vereinheitlichten Systems der Grenzbesatzung registriert» sei, biete
1928, 482 Anm. S); P. Brennan, The Disposition and Interrelation of Roman Military Units in Danubian and Eastern Proeinelai and Field Armies in the Late Third and Early Fourth Cent\lries A. D. Ph. D. Diss. (mascb.) Cambridge 1972; M. Dusanic, Vojnicki natpisi sa nasea limes!l (Los inscriptions militaires du Bas-Empire sur Je Iimes en Yougoslavie). Diss. (Masch.) 1973. Ungedruckt blieb auch ein Forschungsbericht von D. van Berchem für ANRW aus dem Jahr 1970 mit dem Titel: L'armee de Constantin et ses antecedents, vgl. Dens., StudC1as 24, 1986, 158 m. Anm. 16. Auch die Heidelberger Dissertation von P. Barnett, Die Entwicklung des römischen Heerwesens im 3. Jahrhundert n. Chr. (1990) kenne ich nur dem Titel nach.
7 ·D. van Berchem, L'armee de Diocletien et Ia reforme constantinienne. Pa· ris 1952, 90 - 100 (die Seitenzahlen der folgenden Zitate in Klammern). . .
8 Unentbehrlich T. Sarnowski, Die legio I ltalica und der untere Donauabschnitt !!er Notitia Dignitatum. Germania 63, 1985, 107 - 127; ohne nennenswerte Veränderungen· in polnischer Sprache wiederabgedruckt: P6znorzymskie stemple legion6w dohtodunajSkieh. Novaensia 2, 1991, 9 - 32 (die Seitenzahlen der folgenden Zitate in Klammern weisen auf die deutsche Ausgabe). Die grundlegende Untersuchung stammt von D. Tudor: Contribution i l'bistoire de I'armee de Ia Dlltia ripensis. SCIV 335- 363 (rumänisch); darauf aufbauend und Material ergänzend 0. Toropu u. C. Tälutea, Sucidava- Celei. Bukarest 1987, 99 - 109; R. lväntiv, Legionsstempel auf der Baukeramik mit der Bezeichnung der Garnison am unteren Limes. Vekove 1983 (bulgarisch) ist mir bislang leider nur durch den Hinweis bei T. lvanov, in: H. Vetters u. M. Kandler (Hrsg.), Akten des 14. Internationalen Limeskongresses in Carnuntum. Wien 1990, 922 Anm. 23 bekannt geworden. Meine ausschließlich der Literatur entnommene Materialsammlung weist vermutlich Lücken .auf; man darf allzeit mit Obti~· schungen rechnen.
282 Karlheinz Dietz
sich für Moesia Prima und Dacia Ripensis <<ein Bild der Ergebnisse der Reform» an; zeitlich gesehen wird die erste Phase mit Konstantin, die zweite mit Konstans bzw. Konstantius II. verknüpft. Allerdings sei die wohl gleichzeitig erfolgte Auf· splitterung der .meisten Legionen auch in Moesia Primll und Dacia Ripensis wahr· scheinlieh schon in der Zeit vor 324 beendet worden, während es <<in der Moesia II und in Scytbia ... wahrscheinlich nicht die gleichgünstigen Bedingungen für die Einführung des neuen Systems wie in den benachbarten Provinzen» gegeben habe (127). Anders gesagt, Sarnowski geht nicht von «der allgemeinen Gültigkeit der Zweiteilung der alten Legionen in Kontingente von fünf Kohorten aus)); ganz im Einklang mit Mommsen scheine es vielmehr, daß auch andere <<feilungsregeln in ·beschränkter Weise zur Anwendung kamen•• (115). Immerhin glaubt er aber be· deutsame Bestätigungen für die Halblegionen Mommsens in folgenden Typen von Kohortenstempeln der legio I Italica - vorwiegend 'aus Novae (Svistov) und Ia· trus (Krivina) - erkan~t zu haben:9
[1] LEPIFICORTV -le(gionis) p(rimae) I(talicae) ji(gulina) CORT V .[2] LEGIITAFICOR bzw. LEPIFICOR - leg(ionis) I Jta(licae) Ji(gulina) COR bzw. le(gionis) p(rimae) I(talicae) ji(gulina) COR.
Jeder 'TYP kommt mit Varianten vor, die aber von sekundärer Bedeutung sind. Historisch ungemein gewichtig ist indessen die aus diesen Zeugnissen gezogene Folgerung: «Das Fehlen von Ziegelstempel mit den sukzessiven Kohortennum· mern der legio I ltalica läßt vermuten, daß der Typ 1 einer Ziegelei von fUnf Ko· horten und nicht einer Ziegelei der fünften Kohorte zuzuschreiben ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir es hier mit einer Teilung der Legion in wenig· stens zwei Kontingente zu tun, von denen das eine, ohne Zweifel bedeutendere, ftinf Kohorten enthält•• (114).
Dem stimmte M.P. Speidei grundsätzlich zu, allerdings interpretierte er· die mit Majuskeln wiedergegebenen Textpartien in (1] und [2] als cohortium V (= quinque) bzw. cohortium. Dadurch finde «eine wesentliche Verbesserung der Notitia Dignitatum durch Th. Mommsen ihre Bestätigung: in einer Reihe von Do· nauprovinzen sind die Legionen zweigeteilt, es sollten also je fünf Kohorten zu· sammenliegen .... Wäre statt der fünf Kohorten nur die fünfte gemeint, dann hätte auf dem ersten Ziegelstempel (hier [2]: K. D.) die Zahl V nicht wegfallen dürfen, da sich diese Kohorte dann von einer ersten, zweiten, dritten usw. hätte unterschei·
9 AE 1987, 866. Vollständigste Sammlung jetzt bei T. Samowski, Die Ziegelstempel aus
Novae. I. Systematik und Typologie. Archeologia 34, 1983, 17 • 61. Sarnowski (Anm. 8) 109 führt fünf Typen auf, die sich aber auf zwei reduzieren lassen, wie M.P. Speidel, Spätrömi· sehe Legionskohorten in Novae. Germania 65, 1987, 240 · 242 erkannt hat, der zu Recht die Lesung des Milliiuierzeichens im zweiten Typ bei Sarnowski durch COR ersetzt. Aus dem Milliarierzeichen abgeleitete Folgerungen Sarnowskis bleiben daher unberücksichtigt.
Zur Entwicklung der Grenvegionen in der Spätantike 283
den müssen, während bei einer Zweiteilung der Legion beide Abteilungen gleicher· maßen fünf Kohorten hatten, so daß die Zahl als unwesentlich entfallen konnte. -Dasselbe gilt zweifellos auch für die anderen drei Legionen der beiden untersten Donaudukate und möglicherweise für einige Legionsstandorte an der mittleren und oberen Donau. Auch die Gegenprobe stimmt ... : in Dacia Ripensis, wo die Notitia die zwei Legionen an neun verschiedenen Orten anzeigt, nennen die Zie· gelstempel mehrfach einzelne Legionskohorten an diesen Plätzen.» 10
Die folgenden Beobachtungen wenden sich gegen diese Kanonisierung der (vorübergehenden) Existenz von Halblegionen zu Beginn der Spätantike11 und ver· suchen damit, den Ansatz Mommsens einer grundsätzlichen Überprüfung zu un· terziehen. Dabei erfordert - wie so oft - die Kritik und der damit einhergehende Neuaufbau mehr Raum und Aufwand als die Formulierung der These selbst. In diesem Sinne sind zunächst einige methodische Vorüberlegungen unumgänglich.
11
Die große Bedeutung der· meist erst in jüngerer Zeit gefundenen Stempel von Legionskohorten wird ins rechte Licht gerückt durch Th. Mommsens Kommentar zum Ziegelfragment CIL III 8067 im Bukarester Museum. Den Text LVMCORS[-] erklärte der Altmeister nämlich wie folgt:12 «Cor(nelii) S(ecundi] vel simile. Nam in tegula legionaria cohortis mentionem fieri nullo exemplo defenditur.» Dies .war
. ein nicht statthaftes argurnenturn e silentio, wie die eindrucksvolle Zahl der rund hundert Jahre später verfügbaren Exempla für entsprechende Legionsziegel be· weist: allein für die legio I ltalica erwähnt Sarnowski mehr als 380 Mauerziegel mit Kohortenmarken, und wir werden solche bald auch für andere Legionen ken· nenlernen. Dabei darf man sicher sein, daß wir nach wie vor nur Bruchteile des einst Vorhandenen sehen. Entsprechend vermessen und nach den gewonnenen Er· fahrungen unverantwortlich wäre es, unseren derzeitigen Fundbestand anders als
10 Speidei (Anm. 9) 240. 11 Aus der Masse nenne ich· nur R. Grosse, Römische Militärgeschichte von Gallienus &is
zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung. Berlin 1920, 151; E. Nischer, JRS 13, 1923, 6; 37; 41; W. Kubitschek, in: RE XII 2 (1925) 1833 f. Anm.•; R. Egger, Römische Anti· ke und frühes Christentum. I. Klagenfurt 1963, 185; Van Berchem (Anm. 7) 91; 99; W. Enß· lin, in: RE XXII 2 (1954) 1327 f.; T. Nagy, AAntHung 7, 1959, 185; L Värady, AAntHung 9, 1961, 368 f.; G. Clemente, La "Notitia Dignitatum". Cagliari 1968, 141 Anm. 43; A. Ariescu, The Army in Roman Dobrudja. Oxford 1980; 57 - 59; 67 f.; M. Zahariade, Moesia Secunda, Scythia $i Notitia Dignitatum. Bukarest 1988, 55 -77; bes. 74 f. (diese Arbeit ist im folgenden nur mit dem Verfassernamen zitiert); vgl. auch Dens., Ripa legionis XI Claudiae. In: Culturi $i civilizatie Ja Dunärea de Jos. II Cälir8$i 1986, 181 · 186 (mir nur bekannt aus C.C. Petolescu, SCIV 39, 1988, 401 Nr. 408). Anders lediglich M. Duianic, Praepositus Ripae Le· gionis u natpisima opeka Prve Mezije. (The Praepositus Ripae Legionis and Tile·Stamps from Moesia Prima). AArchSlov 25, 1974, 275- 283, bes. 278 und: Ripa legionis: pars supe-· rior. Ebd. 29, 1978, 343 • 345.
12 Vgl. 1.1. Russu, 'D"ansilvania 9, 1977, 10.
284 Karlheinz Dietz
stark lückenhaft zu behandeln und aus den Ziegelmarken eine auch nur einigermaßen adäquate und geschlossene Dokumentation zu erhoffen. Umgekehrt weist diese Erkenntnis heute noch vereinzelt erscheinenden Marken eventuell eineo Rang zu, der weit über den Erwartungshorizont hinausgeht Denn die nicht quan· tifizierbare Verzerrung infolge der Überlieferungsselektion wird erheblich verstärkt durch die in der Regel nicht mehr nachvollziehbaren Gründe, die in be· stimmten Zeiten und Regionen einerseits überhaupt zur vermehrten Stempelung von Ziegeln geführt, andererseits deren spezifische Erscheinungsformen verursacht haben.
Konkretisiert sei dieser Sachverhalt durch einen Blick auf die unterschiedliche Materialausprägung der beiden Legionen Uferdakiens. Wiewohl die Notitia Digni• tatum in diesem Dukat vier Teilverbände für die legio V Macedonica und einen mehr für die legio XIII Gemina nennt, besitzen wir für die zuletzt genannte ltuppe bis dato anscheinend keinen einzigen Kohortenstempel und Marken mit Nennung des Standorts ausschließlich für das Stammlager Ratiaria.13 Demgegen· über lassen sich die Quintani derzeit durch Ziegel tatsächlich an vier Orten fixieren (in Varinia, Valeriana, Oescus urid Utum, unten S. 315 ff.), von denen
·. stimmen aber nur zwei mit den Standortangaben der Notitia (Crebrum, Variniana · [!], Oescus, Sucidava) überein. Hinwiederum fehlt für die legio V Macedonica bis· lang jede auf die Existenz von Uferteilen (partes) hindeutende Hinterlassenschaft, wie sie bei den Tertiodecimani wenigstens für den oberen Abschnitt vorliegt.14
Selbstverständlich wird das künftige Finderglück der Archäologen auch dieses Bild an der einen und anderen Stelle verändern, insgesamt aber weist das Ziegelmateri· al der beiden uferdakischen Legionen eine derart unterschiedliche Ausprägung auf, daß man - bestärkt durch entsprechende Beobachtungen in den Nachbarprovin· zen - an der Feststellung nicht vorbeikommt, jeder Verband habe Eigenheiten der Ziegelstempelung entwickelt, deren Nichtvorhandensein bei anderen Einheiten nicht auch das Fehlen der jeweiligen Phänomene und Entwicklungsstufen bedeu· ten muß. Ergänzend und illustrierend sei in diesem Zusammenhang noch erinnert an die bei einigen Legionen, z. B. auch bei der XIII Gemina, stark ausgeprägte Gewohnheit, Herstellernamen auf ihren tegulae zu nennen,15 ferner an die in
13 Ei~e nicht einmal sehr wahrscheinliche Möglichkeit eines Kohortenstempels wird unten in Anm. 51 besprochen. LEG XIII G RAT · Desa: AE 1959, 334 = IGLR 401 = ILS 9113. · LEG XIII G R · Dierna (Or$ova): AE 1972, 493c = IGLR 415 = IDR 1111, 47. ·LXIII GRAT • Ratiaria (Arcar): CJL III14597, 4 = JLS 9113 = AE 1902, 129, 2; vgl. Thdor (Anm. 8) 345 Nr. 33. • Xlll R • Dierna (Or$ova): AE 1976, 584 d.
14 Die Belege unten Anm. 49 f.
15 Siehedie Listen 1 Szilägyi, in: RE X A (1972) 437 · 442; Mirkovic, IMS II S. 32m. Anm. 32. Für. die legio XIII Gemina etwa: CIL 1111629, 3 · 24 a add. S. 1018; 6282; 8065, 3 • 3S; 12610 - 12629; 14216, 20 · 23; vgl. die zahlreichen Belege in IDR 1111, 111 3 und 111 4; AE 197S, 719. Vereinzelt bei der legio ll/1 Flavia vorkommend: CIL 11114597 = E Ladek, A. von Premerstein u. N. Vulic, JÖAI Beibl. 4, 1901, 148 Nr. 56.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike .285
neuererZeitzahlreicher nachgewiesenen praepositi-Stempel für die Iegiones VII Claudia und I/li Flavia in Moesia I (S. 305 ff.), die allem Anschein nach nur für eine relativ kurze Zeitspanne typisch waren, oder schließlich eben an die Kohortenziegel der legio I .Itatica in Moesia II und der legio VI Herculia in Pannonia II, die bislang ihresgleichen bei der jeweiligen Schwesterlegion der Provinz nicht haben. Usw. usf.16
Trotz dieser bei Kombinierung mit der Notitia Dignitatum noch bunter erschei· nenden Vielfalt ist es a priori wenig wahrscheinlich, daß in einem sensiblen, auf Überschaubarkeil und Handhabung und - allein schon zur Aufrechterhaltung der Disziplin - weitgehend auf strukturelle Vereinheitlichung angewiesenen Bereich wie der Militärorganisation schon im frühen 4. Jahrhundert, also in der Zeit angeblicher Heeresreformen, Chaos und Willkürlichkeit geherrscht haben sollen. Solchen Tendenzen entgegenzusteuern, müßte vieltriehr - neben anderen - eine der Intentionen der Reformen gewesen sein. Tatsächlich ist denn auch der sich heute bietende Facettenreichtum anders zustande gekommen: im Falle der Notitia durch die sattsam bekannte redaktionelle Uneinheitlichkeit infolge individueller Nachlässigkeit von Staatsbeamten, im Falle der Ziegel durch die bereits für die frühe Kaiserzeit beobachtbare, tagtägliche subjektive Gestaltung eines durchaus einheitlichen, aber nicht auf rigide Gleichmacherei ausgelegten Systems; tritt bei~'es noch durc:h den Filter zufälliger Überlieferung ausgedünnt zutage, so scheint das Sy· stem selbst schnell Züge blanker Willkür zu tragen. Um solchen Irrlichtern entgegenzusteuern, ist es notwendig, hinter der Vielfalt - solange vertretbar - ein möglichst einheitliches Bild, eventuell Gemeinsames, zu suchen, bevor es an die Erklärung des Sonderfalls geht.
IIl
Ein solcher Sonderfall liegt offenkundig im Fehlen der Ordinalzahl auf Stempel [2] vor. Sofern COR nicht, wie K. Wachtel für möglich hält,17 eine noch unverstan· dene Abkürzung eines Toponyms verbirgt, ist zunächst die wohl nie mehr eindeutig zu klärende Frage nach dem Sinn unterscheidender Merkmale auf Ziegelsteinpein aufgeworfen. Ob letztere nun als Zählmarkierungen, als Besitzvermerke für 'Heeresgut', als Baunachweise oder auch als Alles zusammen zu betrachten sin~18~ nach den obigen Vorüberlegungen dürfen wir ganz sicher weder stereotype Präzision noch Konsequenz erwarten. Bedenkenlos hat man in Militärkreisen extreme Kürzungen wie XIII, XIII R oder XIII PS verwendet!9 obgleich diese nur 'Insider'
16 Ergänzende Bemerkungen zu Niedermösien bei Sarnowski (Anm. 9) 40.
17 Siebe Sarnowsld (Anm. 9) S8 mit weiteren Ergänzungsversuchen; vgl. noch Speidei
(Anm. 9) 242 Anm. 8. 18 Informativ G. Spitzlberger, SJ 2S, 1968, 81 f. 19
XIII: Biile Herculane: IGLR 420. - Dierna: IGLR 414 A = AE 1976, S84 c = IDR 111 I, Sl (a). Zu den beiden anderen Stempeln: Anm. 13 und SO.
-------------- ---
286 Kar/hein{. Diet{.
der legio XIII Gemina zuweisen konnten: epigraphische Spezialisten am Beginn unseres Jahrhunderts waren dazu jedenfalls noch . nicht in der Lage. 20 Den Auftraggebern der Stempelung genügte mitunter wohl schon die Wiedererkennung der eigenen Produkte und damit eine im gegebenen Rahmen gewährleistete Ein· deutigkeit. Selbstverständlich hing daher die Notwendigkeit von Unterscheidungs· zusätzen in hohem Maße von der räumlichen Nähe verwandter Operationseinhei· ten ab, weshalb im konkreten Fall z. B. denkbar wäre, daß man in Novae und Ia· trus auf die Kohortenziffer zu irgendeinem Zeitpunkt verzichten konnte, weil die Kohorten. mit anderen Ordinalia, aus welchen Gründen immer, überhaupt nicht mehr existierten oder nicht mehr tätig waren oder weiter entfernt arbeiteten als früher. Wäre es um exakte Unterscheidung im militärischen Sinne gegangen, hät· ten sich die cohortes quinque der pedatura superior, in Novae von den cohortes quinque der pedatura inferior in Sexagintaprista absetzen müssen. Wie hätte man da pars superior weglassen können, das doch anderenorts sehr wohl für not· wendig oder zumindest für sinnvoll gehalten wurde?
Zweifellos ließen sich für das Fehlen der Kohortenziffer in Novae und latrus noch vielerlei Gründe denken, ohne daß man im Geringsten weiter käme. Viel !Nichtiger ist die Beobachtung, daß sich der einzige epigraphische Grund, COR in (2] als Plural aufzufassen, aus der Interpretation von Stempel [1) herleitet. Da diese jedoch nicht im Rahmen der methodischen Erfordernisse aus gattungsgemäßen Analogien deduziert, sondern mit Hilfe der Notitia Dignitatum gewonnen wird, ist Einspruch zu erheben, weil 1. die Notitia kein Verzeichnis von Legionsziegeleien enthält (ein bißeben mehr als dies waren die Iegiones riparienses immer noch) und mithin nicht das geeignete Exemplum für die Texterfassung spätrömischer Ziegelstempel sein kann, und weil 2. nicht einmal der originale, sondern ein emendierter Text der Notitia zugrunde gelegt wird. Wer demgegenüber ohne die· se (unten näher zu besprechende) Konjektur zur Notitia Dignitatum im Hinterkopf stren~ nach der epigraphischen Methode an die Sache herangeht, hat zunächst wenigstens keine Veranlassung, LEPIFICORTV - le(gionis) p(rimae) l(talicae) fi(gulina) CORT V prinzipiell anders zu deuten als folgende Stempel der Nachbar· Iegion:
(3] LEGVMCV - Negativstempel - leg(ionis) V M(acedonicae) c(ohors) V - (a) Romulianum (Gamzigrad)- (b) Vraca (Musee historique).21
2° CIL 11114599 (vgl. unten Anm. SO) ist unter die "tegulae privatae" eingereiht. 21 (a) f>. Mano-Zisi, Arch. lugoslavica 2, 1956, 83 A. 3 Abb. 23 (irrtümlich auf die legio
111 Ga/lica bezogen); A. Lalovic, Epigrafski spomenik. In: D. Srejovic, D. Jankovic, A. Lalovic u. V. Jovic, Gamzigrad. Kasnoanticki carski dvorac. Belgrad 1983, 165 Nr. 339 m. 162 Abb. 127, 12; 13 f. (auf diesen beiden steht das letzte V auf dem Kopf); vgl. M. Mirkovic, Eine spätrömische befestigte Villa in der Provinz Dacia Ripcnsis. In: D. Papenfuß u. V.M.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 287
Diese Marke gehört in eine Serie von Kohortenziegeln der legio V Macedonica aus der Zeit nach 271, die unstrittig wie folgt aufzulösen ist: [ 4) LEGVMCI - leg(ionis) V M(acedonicae) c(ohors) I - Romulianum
(Gamzigrad). 22
[5] LEGVMCII - Negativstempel - leg(ionis) V M(acedonicae) c(ohors) ll -Romulianum (Gamzigrad).23
[6] LEGVMCIII - Negativstempel - leg(ionis) V M(acedonicae) c(ohors) 111 -Romulianum (Gamzigrad).24
[7] LEGVMCIIII - a und c: Negativstempel; b: Positivstempel - leg(ionis) V
M(acedonicae) c(ohors) llll - (a) Romulianum (Gamzigrad) - (b) Sucidava (Celei)- (c) Vraca (Musee historique).25
[8] LEGVMCV[--]- Negativstempel - l(egionis) V M(acedonicae) c(ohors) V[--] - Ratiaria (Arcar)?6
[9) LVMCORSIII - Negativstempel - l(egionis) V M(acedonica) co(ho)rs 111 - (a) Sucidava (Celei)- (b) vermutlich Bukarest (Museum): LVMCORS[-- ].27
[10] CORS 111- Negativstempel- co(ho)rs lll- Sucidava (Celei).28
[11] [RO)MPPCIII - Negativstempel - [Ro]m(ulus?) p(rae)p(ositus) c(ohortis) 111 -Sucidava (Celei).29
[12] ROMPPCIUI - Negativstempel - Rom(ulus?) p(rae)p(ositus) c(ohortis) IIII -Sucidava (Celei).30
[13] [LE]GVMSCROM - Negativstempel - [le]g(io) V M(acedonica) s(ub) c(ura) Rom(uli?)- Sucidava (Celei).31
Strocka (Hrsg.), Palast und Hütte. Mainz 1982, 485 - 492; hier: 491 Anm. 12 und Dies., IMS II S. 41 Anm. 62 (als unpubliziert im Museum Negotin); Sarnowski {Anm. 8) 113. - {b) S. Masov, Archeologija Sofia 17/3, 1975, 40 f. Nr. 8 Abb. 9.
22 Mirkovic, IMS II S. 41 Anm. 62 {unpubliziert, im Museum Negotin). 23 Lalovic (Anm. 21) 162 Abb. 127, 7; vgl. Mirkovic {Anm. 21) 491 Anm. 12 und Dies.,
IMS II S. 41 Anm. 62 {als unpubliziert im Museum Negotin). 24 Lalovic (Anm. 21) 165 Nr. 338 m. 162 Abb. 127, 8- 10; vgl. Mirkovic (Anm. 21) 491
Anm. 12 und Dies., IMS II S. 41 Anm. 62 (als unpubliziert im Museum Negotin). 25 (a) Lalovic (Anm. 21) 162 Abb. 127, ll; vgl. Mirkovic (Anm. 21) 491 Anm. 12 und
Dies., IMS II S. 41 Anm. 62 (als unpubliziert im Museum Negotin).- (b) IGLR 283 b; davon wohl nicht verschieden IGLR 283 a.- (c) Masov (Anm. 21) 40 f. Nr. 8 Abb. 8.
26 Z. Morfova, Archeologija Sofia 5/1, 1963, 29 Nt 12 Abb. 5. 27 (a)Ü Tudor, Dacia 5/6, 1935/36, 412 Nr. 2 Abb. 16 b; AE 1944, 66 • IGLR 280 Abb.-
(b) CIL 111 8076. 28 AE 1939, 95 • IGLR 281 Abb. · 29 1GLR 282 Abb. • AE 1976, 582 a: nicht, wie immer zu lesen, zu (LV]MPP zu ergänzen,
da PP eher einen vorangehenden Personennamen nahelegt. 30 D. Tudor, SCIV 22, 1971, 109 Nr. 3 Abb. 3, 1; D. Thdor, SCIV 32, 1981, 424 f. Nr. 2 Abb.
1, 4; Toropu u. Tätulea (Anm. 8) 103 Abb. 25, 4; vgl. C. C. Petolescu, SCIV 34, 1983, 367 f. Nr. 106 und 40, 1988, 391 Nr. 467.
31 AE 1914, 121; AE 1939, 94 • IGLR 285 Abb.; D. Tudor, Oltenia romanä. Bukarest 41978, 99. - Natürlich ist die Zugehörigkeit der Stempel (10- 12] zur fünften Matedonischen nur aufgrund des Fundortes wahrscheinlich, durch die mutmaßliche Identität der auf [11 - 13] ge·
288 Karlheinz Dietz
Diese Kohortenstempel der /egio V Macedonica stammen hauptsächlich aus den ehemals staatlichen Großbaustellen in Romulianum (Gamzigrad) [3 - 7] und in Sucidava (Celei) [7; 9 - 13]. Dank einer jüngst veröffentlichten Inschrift steht heute fest, daß das Palatium im serbischen Gamzigrad bei Zajecar als Altersruhe· sitz Romulianum für den aus Uferdakien stammenden Galerius (293 - 311) erstellt wurde und daher etwa vom Ende des 3. bis jedenfalls in die zweite Dekade des 4. ,Jahrhunderts bestand. Nach Ansicht der Ausgräber wären an diesem Objekt die Baumaßnahmen nach dem Tod des Galerius durch Licinius fortgesetzt, dann aber als Folge von dessen Niederlage gegen Konstantin (314 oder 316)
32 gänzlich einge·
stellt worden (um erst wieder seit ca. 378 aufgenommen zu werden).33
Gegenüber einem so begründeten Terminus ante quem 317 für unsere Ziegel [3- 7] ist Skepsis angebracht: Baueinstellung und Siedlungsbruch werden aus dem Mangel an Klein· funden des täglichen Lebens im Palast abgeleitet34 un'd diese Schlußfolgerung wird auf bekannte Weise mit einem historischen Großereignis verknüpft. Ist das ohne·
nannten praepositi nunmehr aber so gut wie sicher; vgl. auch C.C. Petolescu, SCIV 32, 1981, 604 f. Nr. 39. Zurecht betont im übrigen M.P. Speidel, Apulum 24, 1987, 144, daß Kohorten· angaben mit Zahl, aber ohne Name «tend to be legionary». - Eine in der Literatur auftau· chende Marke aus Sucidava mit der angeblichen Aufschrift CIIIISCVRSA - c(ohors) Illl s(ub) cur(a) Sa[bini?) (D. Tudor, SCJV 32, 1981, 423 - 425 Nr. 1 Abb. = AE 1981, 719; vgl. C.C. Petolescu, SCIV 34, 1983, 367 Nr. 105) existiert nicht. Vielmehr ist nach der Beobachtung von C.C. Petolescu, SCIV 37, 1986, 106 Nr. 2; Ders., SCIV 38, 1987, 398 Nr. 388 a zu lesen: L VII S C VRSA[C P F ARGVTIO F); dementsprechend erledigt sich auch die Schimäre QISCVS vom selben Fundort: D. Thdor, SCJV 17, 1966,600 f. Nr. 20 Abb. 2, 3, die C.C. Peto· lescu, SCJV 37, 1986, 107 Nr. 3; ders., SCJV 38, 1987, 399 Nr. 388 b zu [L) VII SC VR[SAC P F ARGVTIO F) verbessert hat. Vgl. noch die gleichfalls aus Sucidava stammenden Fragmente[·- ARG)VTIO Fund[·- AR]CVTIO F bei Toropu u. Tälutea (Anm. 8) 103 Abb. 25, 12 u. 14.
32 Zur nach wie vor unsicheren Datierung der Niederlage des Licinius R. Bratoz in
diesem Band unten S. 517 Anm. 32. 33 D. Srejovic in: Srejovic, u. a. (Anm. 21) 193- 201 (Summary); bes. 199: <dt is certain,
however, that all the building activity ceases in 314 or 316 A.D.» Vgl. M. Canak Medic, Garn· zigrad. Palais bas·antique. Communication lnst. protection mon. bist. Republique Socialiste S!!rbie. 1978; Mirkovic (Anm. 21); B. Bavant, in: Villes et peuplement dans l'lllyricum proto· byzantin. Rom 1984, 264 - 272. D. Srejovic, Felix Romuliana: Palais imperial ou ... ? Starinar NS 37, 1986, 87- 102; J.J. Wilkes, Diocletian's Palace Split. Sheffield 1986, 66- 70; N. Duval, Les progrs des fouilles de Gamzigrad, Romuliana, BM 146, 1988, 240- 244.
34 Srejovic in: Srejovic u. a. (Anm. 21) 198 (Hervorhebungen K. 0.): «fhere are reasons to
suppose that the building of this residence, too, was discontinued abruptly. The number of objects for everyday use found in the earlier and later fortifications and in the buildings asso· ciated with them is so small that it must be supposed that those for whom these edifices we· re intended never used them. This also shows that the emperor for whom Gamzigrad bad been built did not reside in it for a long period of time.)) Derartige Spekulationen sind histo· risch nicht brauchbar: Wenn Galerius angeblich kurze Zeit in Romulianum residierte (tat· sächlich wissen wir nur, daß er dort bestattet wurde: Epit. de Caes. 40, 16), lebte er da im Be· wußtsein des nahenden Endes aus dem Koffer, um der Nachwelt unnötige Spuren zu erspa· ren?
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 289
hin schon nicht sonderlich überzeugend/5 so noch weniger, weil ja Konstantin so· gar von Widersachern initiierte, nicht nur geförderte Bauten fortgeführt hat (man denke nur an die Maxentiusbasilika in Rom), weil er außerdem ein nach· weisbar großes Interesse an der Dacia Ripensis hatte36 und weil zudem gute Argu· mente für eine staatliche Weiterbenutzung des Palastes von Gamzigrad während des weiteren 4. Jahrhunderts - vielleicht als Sitz eines procurator metallorum -vorgebracht wurden. 31 Da nun in Gamzigrad sowohl Stempel der Gesamtlegion als auch der laut Stratigraphie sicher nach 308/311 verwendeten Form LEG(io) bzw. L(egio) V M(acedonica) OES(co) zutage kamen,38 wird man die typologisch ver· mutlieh dazwischen anzusiedelnden Kohortenstempel mit der gebotenen Vorsicht in die Zeit zwischen ca. 293 und ca. 330 datieren dürfen. Dabei könnten die gewiß irgendwie mit dem Bau der 2400 Meter langen, im Juli 328 von Konstantin per· sönlich eingeweihten Brücke - einem römischen Prestigeobjeke9
- zusammenhän·
35 Canak Medic (Anm. 33) 90; vgl. 174, wies auch die zweite Phase dem Galerius zu, schloß aber zu Recht konstantinische Zeit nicht aus: ebd. 90; 227; 237; 240; vgl. Mirkovic (Anm. 21) 488 m. Anm. 20; Sarnowski (Anm. 8) 116m. Anm. 36.
36 Vgl Canu Medic (Anm. 33) 240; bes. E. Demougeot, Constantin et Ia Dacie. ln: E. Frezouls, Crise et redressement dans les provinces europeennes de !'Empire du milieu du Ur siecle au milieu du 1v• siecle apr. J. C. Straßburg 1983, 91 · 112; vgl. noch R. Syme, Roman Papers. Oxford 1984, 892- 898; O.lliescu, NAC 16, 1987, 265- 292.
37 Mirkovic (Anm. 21) 488 mit m. E. realistischen Überlegungen, u. a. zu Cod. Iust. 1, 40, 14. Zustimmend Demandt (Anm. 2) 342 Anm. 24.
38 Vgl. die oben in Anm. 33 genannten Literaturstellen. LVM·Stempel der Gesamtlegion nach 271 z. B. (a) Arutela (Bivorlari): AE 1969170, SSO = IDR II 579. - (b) Barbo$i: ISM V 305. • (c) Dierna (Or$ova): IDR 1111, 51.- (d) Drobeta (Turnu Severin): CIL 1118066 a = 14216, 24 a; IDR II 98. - (e) Romulianum (Gamzigrad): Lalovic (Anm. 21) 165 Nr. 336 m. 163 Abb. 127, 2 u. 3.- (f) Hinova: Tudor (Anm. 31) 102.- (g) Ratiaria (Arcar): CIL 11114597, l. - (h) Sucidava (Celei): CIL 111 8066b = IGLR 279 Abb. - (i) Thorda: CIL 111 1630 a; c; d; vgl. 1 · Dazu Z. Morfova, Latomus 18, 1959, 642 f. und detaillierter D. Benea, Acta Mus. Napocensis 15, 1978, 235- 244 (vgl. Acta Mus. Porolissensis 1, 1977, 173- 179). Benea a.a.O. 236m. Abb. I u. 2 betont, daß Varianten vop diesen Stempeln auch in Oltenien (K. Strobel, Untersuchun· gen zu den Dakerkriegen Trajans. Bonn 1984, 90 Anm. 37) und später in Niedermösien (Ca· pidava: ISM V 54; 11-oesmis [Iglita]: ebd. 215 a - d; Horia: 240; Arrubium [Mäcin]: 254; Dino· getia [Bisericuta·Garvän]: 261; Noviodunum [lsaccea]: 284; Barbo$i: 305; Izvoarele: M. lri· mia, P!)ntica 18, 1985, 151 - 153 Nr. 4 f. Abb. 3; vgl. K. Strobel, Klio 70, 1988. 504 m. Anm. 17 f.) vorkommen, wo die Legion bis ca. 168 stand, ehe sie nach Potaissa in Dakien über· wechselte. Offenkundig verkürzte sie in der Spätphase ihres Mösienaufenthalts ihre Ziegel· stempel zu LMV, da dieser Typ sich u. a. auch in Troesmis und Barbo$i findet, dann aber in Potaissa dominiert: Benea a.aD. 236- 238 Abb. 3. Zur Einordnung von IDR II 99, 167, 178 und 522 siehe Strobel a.a.O. SOS f. m. Anm. 22. - Allgemein zur /egio V Macedonica neben E. Ritterling, in: RE XII 2 (1925) 1572 - 1586 jetzt ergänzend G. Asdrubali Pentiti, in: Diz. Epigr. V 4 (1990) 98 • 109 s. v. Macedonica (legio); zum ersten Aufenthalt der Legion in Oescus zuletzt R. lvanov, ZPE 80, 1990, 131 - 136 mit Dislokationsübersicht. Siehe noch T. lvanov (Anm. 8) 913 - 924; M. Bärbulescu, Din istoria militarä a Daciei romane. Legiunea V Macedonica $i castrul de Ia Potaissa. Cluj- Napoca 1987,15- 33.
39 Zur Brücke von Sucidava die Arbeiten von D. Tudor, Les ponts romains du Bas-Da·
290 Karlheinz Dietz
genden Zeugnisse aus Sucidava etwas jünger sein, weil die Unterabteilungen und ihre Führer gegenüber der Legion schon stärker in den Vordergrund treten [10 -
Lc>l3]~40 Verbindendes Element beider Großbaustellen sind die Zeugnisse [7], die zwar ·nicht von der seihen Kohorte herrühren müssen (unten S. 302), sich aber zeitlich
·, · nahestehen. Einer der wenigen, mir bisher bekannt gewordenen Kommentare zu den Zeug·
nissen aus Gamzigrad [3 - 7] schlägt in eine bekannte Kerbe: <dl est evident qu'il n'y a que cinq cohortes qui apparaissent. On aurait donc une situation semblable il celle presentee dans Ia Notitia: praejectus ripae legionis secundae Herculiae co· hortium quinque pedaturae superioris (Or. XXXIX, Dux Scythiae, avec Ia cor· rection ... de Mommsen ... ) comme commandant d'une moitie du secteur sous Je contröle d'une Iegion, en aval et en amont du camp principal ... >).4! Dazu ist natür· lieh sogleich anzumerken, daß die derzeit bekannte Zahl der Kohorten in Gamzi· grad sehr wohl ein Trugbild des Überlieferungszufalls sein kann. Aber sehen wir näher zu!
Wegen [4- 7] liegt in Stempel [3] eindeutig das Produkt einer cohors quinta vot; und das nämliche trifft selbstverständlich für [1] zu, da nach der epigraphischen Methode Zeugnis [3], und nicht die Konjektur Mommsens zur Notitia Dignitatum, als nächstes Exemplum für [l] zu gelten hat. Man stelle sich vor, der Zufall hätte uns [4 - 7] vorenthalten. Unweigerlich wäre wohl auch [3] zu c(ohortium) V (= quinque) aufgelöst worden.42 Daß dies keine bösartige Unterstellung ist, lehrt die Behandlungzweier fragmentierter Stempel aus Mautern,43 deren erhaltenen Text OFARVNNORI und OFARENVNNO[ --] man als OF(ficina) AR(elapensis) N(ova). V(= quinque) N(umeri) NORI(corum) gelesen hat.44 Dabei diente als epigraphische Stütze ein anderer Abdruck,45 der seinerseits als OF(ficina) AR(elapensis) N(ova) BONO P(raeposito) V (= quinque) [N(umerorum) NORI(corum)] interpretiert wurde. Da darin für den letzten Teil abermals die Mommsensche Konjektur Pate stand, ist die Gefahr des Zirkelschlusses evident, weshalb in dem auch als
nube. Brüssel 1974, 140 ff.; H. Wolfram, Die Goten. München 11990, 76 m. Anm. 68; vgl. noch P. Brennan, Chiron 10, 1980, 562 f.; 565 f., der 563 Anm. 35 wichtige Literatur zum vortetrarchischen Lager verzeichnet. Zum Beitrag der verschiedenen Truppen am Ausbau Sucidavas im 4. Jahrhundert C.C. Petolescu, RESE 18, 1980, 115 · 119; vgl. noch 0. Toropu u. C. Tätulea (Anm. 8}.
40 Unten S. 308 und die Bemerkung bei M. Mirkovic, IMS II S. 40 f. Anm. 51.
41 M. Mirkovic, IMS II S. 41 Anm. 62. Sarnowski (Anm. 8) 119 und (Anm. 9) 58 f. m.
Anm. 139 erwähnt diese Stempel; vgl. auch schon C.C. Petolescu, SCIV 32, 1981, 604 f. 42
Erneut ist es nur ein argurnenturn e silentio, wenn Sarnowski (Anm. 9) 58 für unser Zeugnis (I] die Auflösung cohortium quinque für <<wahrscheinlicher» hält, «weil wir bisher keine Stempel mit den Nummern anderer Kohorten kennen.»
43 CIL 11115209; H. Stiglitz-Thaller, JÖAI Beibl. 40, 1953, 202.
44 Egger (Anm. 11) 186; vgl. z. B. G. Forni, in: Diz. Epigr. IV (1959) 1255.
45 CIL lll11376 add. S. 2328, 43.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 291
mag(ister) bezeugten Bonus mit J. Fitz vielleicht doch besser ein späterer p(er-
fi - . .\ ('r) h . 46 ect1ss1mus1 v 1 zu se en tst. Da mithin die heute übliche Ergänzung von (1] tragbares epigraphisches Funda
ment hat, findet Mommsens Textveränderung keineswegs «ihre Bestätigung)) in den Ziegel aus Novae und latrus [1 - 2]. Wollten wir bei der methodisch unzulässi· gen Vermengung verschiedener Quellengattungen bleiben, so würde vielmehr um· gekehrt die unangreifbare Auflösung von Stempel [3] zu c(ohortis) V ( = quintae) mit der Überlieferung der Notitia glänzend übereinstimmen.47 Um jedoch selbst einem Zirkel zu entgehen, müssen wir die beiden Quellenebenen gesondert verste· hen und erst anschließend miteinander vergleichen. Folglich haben wir auch das Problem um cohortis quintae - cohortium quinque in der Notitia für sich allein zu beurteilen.
IV
Bedeutsam ist, daß die von der modernen Forschung wie ein Faktum behandelte Wendung cohortium quinque bis heute weder auf Ziegeln noch in der Notitia ein einziges Mal zweifelsfrei überliefert ist. Damit spräche zu ihren Gunsten allenfalls die von Speidei angeführte 'Gegenprobe', die da lautet: in Uferdakien, wo keine Zweiteilung der Legionen erfolgt sei, vielmehr ((die Notitia die zwei Legionen an neun verschiedenen Orten anzeigt, nennen die Ziegelstempel mehrfach einzelne Legionskohorten an diesen Plätzen)). Wäre dies richtig, so dürften sich außerhalb der Dacia Ripensis Ziegel einzelner Legionskohorten nicht finden, und schon gar nicht dort, wo die Notitia wegen des Eintrags cohortium quinque pedaturaelpartis ( ... ) eine (und sei es auch inkonsequente) Halbierung der betreffenden Legionen zumindest nahelegen sollte. Dem widerspricht aber das mir bekannte Material für pedaturaelpartes und cohortes, wobei ich an der fraglichen Stelle natürlich vom überlieferten Text der Notitia ausgehe, der ja zunächst einmal einzelne Kohorten erwähnt. Zur Abrundung des Bildes füge ich die Erwähnungen von ripae hinzu:
46 J. Fitz, L'administration des provinces pannoniennes sous Je Bas-Empire romain. Brüs· sei 1983, 58 - 60. Zum schillernden magister-Begriff in der Spätantike M. P. Speidel, TAPhA llS, 1985, 285 f. m. Anm. 11.; vgl. noch Spitztherger (Anm. 18) 80 m. Anm. 54 und Sarnows1d (Anm. 9) 28 zum magister figlinarum im Range eines gewöhnlichen Soldaten; vgl. noch unten Anm. 130.
47 Dusanic (Anm. 11) 1974, 278; 283 wollte daher quintae stehen lassen.
292 Karlheinz Dietz
Scythia: (a) pedaturaelpartes: - Not. Dign., or. 39
30: praefectus ripae legionls secundae Herculiae cohortis quintae pedatu· rae ir![erioris ( = superioris ?), Axiupoli. 31: praefectus legionis secundae Herculiae cohortis quintae pedaturae ir![e· rioris, lprosmis ( = Trosmis). 33: praefectus ripae legionis primae Ioviae cohortis quintae pedaturae su· perioris, Novioduno. 34: praefectus ripae legionis primae Ioviae cohortis quintae pedaturae inferioris, Accisso ( = Aegisso).
(b) cohortes: - Not. Dign., or. 39, 30; 31; 33; 34 und
35: praefectus ripae legionis primae Ioviae cohortis et secundae Herculiae musculorum Scythicorum et classis, lnplateypegiis.
(c) ripae: - Not. Dign., or. 39, 30; 31; 33; 34 und 35: fünf praefecti ripae legionis.
(a) pedaturae/partes: -Not. Dign., or. 40
Moesia secunda:
31: praefectus ripae legionis primae ltalicae cohortis quintae pedaturae su· . . "' ... perrorrs, novas.
32: praefectus ripae legionis primae ltalicae cohortis quintae pedaturae in· ferioris, Sexagintaprista. 34: praejectus legionis undecimae Claudiae cohortis quintae pedaturae su· perioris, Transmariscae. 35: praefectus ripae legionis undecimae Claudiae cohortis quintae pedatu· rae ir![erioris, Transmariscae ( = Durosturo?).
(b) cohortes: - Not. Dign., or. 40, 31; 32; 34; 35. - Ziegelstempel:
LE(gionis) P(rimae) l(talicae) Fl(gulinae) CO(ho)RT(is) V [1] und LE(gionis) P(rimae) l(talicae) Fl(gulinae) CO(ho)R(tis) [2] sowie Varianten - Dimum, Iatrus (Krivina), Novae (Svistov), Pliska, Vojvoda.
(c) ripae: - Not. Dign., or. 40, 31; 32; 34; 35: vier praejecti ripae legionis.
48 Es besteht keine Veranlassung, den überlieferten Akkusativ · wie unlängst geschehen • in Novis zu verändern; zum erstarrten Akkusativ von Ortsnamen nur etwa E. Norden, Alt· Germanien. Völker· und namengeschichtliche Untersuchungen. Leipzig 1934,92-95.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 293
(a) pedaturaelpartes: - Ziegelstempel:
Dacia Ripensis:
LE(gionis) bzw. LEG(ionis) XIII G(eminae) P(ars) S(uperior) - Drobeta (Thrnu Severin), Pontes (Kostol), Sucidava (Celei)49 und L(egionis) XIII G(eminae) P(ars) S(uperior) - Ad Aquas (Prahovo), Diana (Kiadova), Drobeta.50
(b) cohortes: - Ziegelstempel:
LEG(ionis) V M(acedonicae) C(ohors) I bis V mit Varianten [3 -13].s1
(c) ripae: - Ziegelstempel:
P(raefectus oder -raepositus) R(ipae) L(egionis) V M(acedoniacae) OES(co) und Varianten PRLVMVAL, PRLVMVTO, PROES, PRVAR, PPRIPVAR bzw. PRRIPVAR.52
(a) pedaturaelpartes: - Ziegelstempel:
Moesia prima:
LEG(ionis) 1111 FL(aviae) PAR(s) SVP(erior) - Singidunum (Belgrad), Sir· mium (Sremska Mitrovica).53
49 IGLR 403 • AE 1976, 583 a. - D. Benea in: Limes. Akten des 11. Internat. Limeskongres· ses. Budapest 1977, 322. - IGLR 287 • AE 1976, 582 c; dazu (mit irriger Auflösung) Benea a.a.O. 322 f. Früher las man fälschlicherweise p(ia) S(everiana) oder P(onte)s oder P(ontibu)s. Richtig aber schon A. Milosevic, Roman Brick Stamps from Sirmium. In: Sirmium. I. Bei· grad 1971, 95 - 118.; hier: 100 m. Anm. 52; Duiianic (Anm. 11) 1978, 343; 345. Der Legions· beiname scheidet aus, er lautete nämlich durchgehend nur Severiana: J. Fitz, Honorific Titles of Roman Military Units in the 3rd Century. Budapest u. Bonn 1983, 116 f. Nr. 467 -471. Nicht gesehen habe ich V. Moga, Din istoria militarä a Daciei romane. Legiunea a XIIla Gemina $i castrul de Ia Apulum. Cluj - Napoca 1985.
5° CIL lll 14599; vgl. Tudor (Anm. 8) 347 Nr. 52. - CIL H1 14215, 6. - AE 1976, 583a. -XIII PS finde ich bei Sarnowski (Anm. 8) 119.
51 C(ohors) X aus Drobeta (Turnu Severin): CIL III 14216, 28 • IDR II 109 könnte von der legio Xl/1 Gemina stammen, die natürlich auch eine Kohorte dieser Ziffer hatte; es gibt daher keinen Grund, diesen Stempel mit Petolescu (Anm. 41) 600 f. Nr. 22 nur wegen des unten Anm. 65 zitierten Zeugnisses der /egio VI Herculia zuzweisen. Da es sich aber um keinen Stempel, sondern um eine Handschrift handelt, könnte auch die Produktionsmenge eines Tages verzeichnet sein: so Sarnowski (Anm. 9) 30 Anm. 70.
52 Belege unten S. 316 Texte Nr. 40 ff. 53 M.M. Vasic, Starinar 2, 1907, 26 Abb. S a; D. Bojovic, Godisniak Muzeja grada Beogra·
da 22, 1975, 23; 27; Dusanic (Anm. ll) 1978, 343 ff.; D. Benea, Din istoria militari a Moesiei superior ~i a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia ~i legiunea a Illl-a Flavia. Cluj - Napo· ca 1983, 191 Taf. S, 19. - Milosevic (Anm. 49) 110 Nr. 9 (Abb. 9 steht auf dem Kopf); vgl. ebd. 98 f.: [LE)G IV FL PS[--).
294 Karlheinz Dietz
LEG(ionis) 1111 FL(aviae) P(ars) C(iterior) - Sirmium (Sremska Mitrovica), Vi· minacium (Kostolac).54
S(ub) C(ura) HERMOGENI P(rae)P(ositi) R(ipae) bzw. RIPE LEG(ionis) VII CL(audiae) PART(is) CIT(erioris) mit Varianten - Zmirna (Boljetin), Ad Aquas (Prahovo), Saldum (Gradac), Svinita.55
LEG(ionis) VII CL(audiae) P(ars) S(uperior) - Banatska Palanka, Pincum (Veli· ko Gradiste), Sirmium (Sremska Mitrovica), Viminacium (Kostolac).56
(b) cohortes: - Ziegelstempel:
LEG(ionis) 1111 F(laviae) F(iglinae) C(ohortis) V P(rae)P(ositus) - Cuppae (Golu· bac), Zmirna (Boljetin);57 davon vielleicht Bruchstücke (?): LEG 1111 FL(aviae) C(ohors) V und LEG 1111 FL(aviae) F(iglinae) C(ohortis) V P(raepositus?).58
LEG(ionis) 1111 F(laviae) F(iglina) C(ohortis) VII - Viminacium (Kostolac).59
LEG(ionis) VII CL(audiae) C(ohors)- Pojejena.60
54 CIL III10664a (dazu Milosevic a.a.O. 98); vgl. J. Szilligyi, A pannoniai belyeges tegllik.
Inscriptiones tegularum Pannonicarum. Budapest 1933, 41 Nr. 1 - 3 Taf. 8; Milosevic a.a.O. 110 Nr. 9; vgl. Nr. 8 und dazu auch K. Strobel, Die Donaukriege Domitians. Bonn 1989, 71 f. Anm. 11.- A. von Premerstein u. N. Vulic, JÖAI Beibl. 6, 1903, 52 Nr. 63.
ss Dazu unten Anm. 118. Unklar ist der Kontext des Fragments IMS II 155. S6 IDR 111 1, 7 (S. 38). - N. Vulic, Spomenik 75, 1935, 21 Nr. 40; vgl. M. Mirkovic, Rimski
gradovi na Dunavu u gornjoj Meziji (Römische Städte an der Donau in Obermösien). Bel· grad 1968, 102. - Milosevic (Anm. 49) 110 Nr. 16 - 23; vgl. 99 f. - CIL 111 1700, 2; Szilligyi (Anm. 54) 43 f. Nr. 5 f. Taf. 9. Vgl. Dusanic (Anm. ll) 1974, 145 Anm. 4; Benea (Anm. 53) 39; 65 f. Anm. 212 Taf. 2, 15- 21. Vgl. Ladek, Premerstein u. Vulic (Anm. 15) 149 Nr. 60 f. Der Legionsbeiname lautete durchgehend nur Severiana: Fitz (Anm. 49) ll3 Nr. 451- 457.
S? N. Vulic, JÖAI Beibl. 8, 1905, 3 Nr. 7. - Istoriia Beograda. I. Belgrad 1974, 78 = Benea (Anm. 53) Taf. 5, 17; vgl. Mirkovic (Anm. 56) 104; Benea a.a.O. 98; 193.
sa CIL III 13815 (mit Mirkovic (Anm. 56) 107 Anm. 100) und CIL 111 l3815a add. E. Swo· boda, Forschungen am Obermoesischen Limes. Wien 1939, 34 (= ILS 9110).
59 Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 1903, 52 Nr. 64: das dort gelesen CVIT könnte aber vielleicht auch von einem CVPP herstammen.
60 IDR III1, 21 Abb. 17 a; 22 Abb. 18 a = IGLR 429; 22 ä Abb. 18 b = IGLR 427. - IDR 111
1, 280 d. Siehe noch CIL 111 8071 g; 14496, 2; D. Tudor, SCIV 9, 1958, 393 Nr. 2. Vgl. Benea (Anm. 53) 98, Taf. 2, 8 · 14.- Natürlich kann man rechten, ob nicht lieber C(uppis) zu ergän· zen ist. Allein schon, weil aus Cuppae (Golubac) seit langem ein vermutlich von einer Legi· onskohorte stammender Ziegel mit der Aufschrift COH(ors) V bekannt ist (CIL 111 1702 und dazu Swoboda (Anm. 58]14; Mirkovic (Anm. 56)103) und wir ferner durch die Funde der legio I ftalica [1 - 2] belehrt werden, daß die Kohortenzahl auch ganz fehlen kann, ist die hier vorgeschlagene Lesung die weitaus wahrscheinlichere; obendrein wird das vermeintli· ehe epigraphische Exemplum LEGIIIIFFCVPP gleichfalls zwangloser und besser als Kohor· tenstempel erklärt sein, da dadurch die seit je Kopfzerbechen erzeugende Standortangabe Cuppis für die dort vielleicht einmal vorübergehend tätige, schwerlich aber je auf Dauer kampierende (so aber etwa Ritterling (Anm. 38] 1543; 1546; wieder M. MirkoviC, IMS II S. 42 m. Anm. 46; auf dem richtigen Weg, aber nicht entschieden genug Sarnowski [Arim. 8] 113 f.) oder gar eine Uferpräfektur betreibende Legion von Singidunum eliminiert ist. Swo· boda a.a.O. 16 wollte gar zwischen Ziegel mit LEGIIIIFFCVPP und LEGIIIIFlCVPP unter·
Zur Entwicklung der Grenvegionen in der Spätantike 295
(c) ripae: - Ziegelstempel:
L(egio) 1111 S(ub) C(ura) HERM P(raepositi) Rl(pae) - Viminacium ( Kostolac). 61
S(ub) C(ura) HERMOGENI P(rae)P(ositi) R(ipae) bzw. RIPE LEG(ionis) VII CL(audiae) PART(is) CIT(erioris) und Varianten.62 .
RIPA SING(idunensis)- Aureus Mons (Seona).63
RIPA VIM(inacensis) - Vinceia (Smerderevo).64
(a) pedaturaelpartes: - Not. Dign., occ. 32
Pannonia secunda et Savia:
44: praefectus legionis quintae loviae cohortis quintae partis superioris, Bononiae. 45: praejectus legionis sextae Herculeae cohortis quintae pedaturae supe· rioris, Aureo monte.
(b) cohortes: - Not. Dign., occ. 32, 44; 45. - Ziegelstempel:
L(egionis) VI H(e)R(culiae) C(ohors) X und VI H(e)R(culiae) C(ohors) X - Bano· stor, Sirmium (Sremska Mitrovica). 65
(a) pedaturae!partes: - Not. Dign., occ. 33
Valeria:
51: praejectus legionis primae Adiutricis cohortis quintae partis superio· ris, Bregetione. 52: praefectus legionis secundae Adiutricis cohortis partis superioris, Aliscae.
scheiden und nur letztere als spätantik gelten lassen, während erstere F(laviae) F(elicis) zu le· sen und damit vorhadrianisch seien. Die Möglichkeit, das zweite F zu f(igulina) aufzulösen, kannte er nicht. Zur frühen Hinterlassenschaft der legio llll Flavia siehe Strobel (Anm. 54) 13; 7l f. 61 Unten Anm. lOS.
62 Unten Anm. 118. - Im Museum von Negotin befinden sich noch folgende Fragmente, die ripae bezeugen, aber nicht mehr genau einzuordnen sind:: [--]P RIP LEG CL, [--]S RIP (M. Mirkovic, IMS II S. 42 Anm. 65) .
• _63 L. Pavlovic, Muzeji i sr;'menic~ ~ulture Smederev~. Sm~ereva 1972, 62; vgl. M. Mirko·
vtc, IMS I S. 38. Pavlovtc a.a.O.; vgl. M. Mtrkovtc, ebd. S. 39 und IMS II S. 43. 65 Cll 11110665 c. - Szilagyi (Anm. 54) 42 f. Nr. 1 - 9 Taf. 9. - Miloäevic (Anm. 49) 111
Nr. 31 f. und Nr. 30. Vgl. S. Soproni, AErt 85, 1958, 54; ferner die mir angesichts der Abbil· dungenbei Miloievic nicht nachvollziehbaren Erörterungen von Sarnowski (Anm. 8) 114.
296 Karlheinz Dietz
53: praefectus legionis secundae Adiutricis partis inferioris, Florentiae. 54: praefectus tegionis secundae Adiutricis tertiae (?) partis superioris, Acinco.
(b) cohortes: - Not. Dign., occ. 33, 51; 52.
Pannoniae prima et Noricum ripensis:
(a) pedaturae/partes: - Not. Dign., occ. 34
27: praefectus tegionis quartaedecimae geminae militum liburnariorum cohortis partis superioris, Carnunto. 38: praefectus legionis secundae ltalicae partis iiv"erioris, Lentiae. 40: praefectus legionis primae Noricorum militum liburnariorum cohor· tis quintae partis superioris, Adiuvense.
(b) cohortes: - Not. Dign., occ. 34, 27; 40.
- Ziegelstempel: LEG(ionis) X G(eminae) P(ars) S(uperior) - Sirmium (Sremska Mitrovica)?,
Vindobona (Wien).66
LEG(ionis) X COH(ors) IV - Arrabona (Gyor).67
[L]EG(ionis) Xliii GE(minae) CC/ (= CO[H]?)- Intereisa (Dunapentele).68
(a) pedaturae/partes: - Not Dign., occ. 35
Raetia prima et secunda:
17: praefectus legionis tertiae Italicae partis superroris, Castra Regina, nunc Vallato. 18: praefectus legionis tertiae ltalicae partis superioris deputatat(e) ripae primae, Submuntorio. 19: praefectus legionis tertiae /talicae pro parte media praetendent(is) a Vimania Cassiliacum usque, Cambidano ( = Camboduno).
(c) ripae: - Not. Dign., · occ. 35, 18.
66 Milosevic (Anm. 4) llO Nr. ll (Nr. 12 t .... ohl GE zu lesen); Szilagyi (Anm. 54) 50 Nr. 62; A. Neumann, Röm. Limes in Österreich 27 (1973) 55 Nr. 47 f.; 50 Tat: 15, 129; Vindobo· na-die Römer im Wiener Raum. Wien 1978, 278 Z 37.
67 CIL 111 4659, 7x b = B. Lörincz, Pannonische Ziegelstempel. 111. Limes-Strecke Ad Fle· xum - Ad Mures. Budapest 1981, 91 f. Nr. 15 der auf U. Uzsoki, Arrabona 11, 1969, 122 f. Abb. 1,'2 verweist.
61 Aus dem 4. Jahrhundert nach B. Lörincz, Pannonische Stempelziegel. II. Limes-Strecke
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 297
Die Bedeutung des in der Notitia überlieferten cohortis qtJintae weiterhin zurück· stellend, ergibt sich aufgrund dieses Materials derzeit folgende Zusammenschau (N = belegt durch die Notitia Dignitatum, Z = belegt durch Ziegelstempel):
Dukat legio cohortes parteslpedatura ripae coh. V sup. irif. sonst
Scythia: 11 Herculia N N N (praefectus) llovia N N N N (praejectus)
Moesia II: lltalica z N N N N (praefectus) XI Cloudia N N N N (praefectus)
Dacia Rip.: Xlll Gemina z V Macedonica Z Z (praepositus)
Moesia 1: 1111 Flavia z z Z (c.) Z (praepositus) V11 Cloudia z (?) Z (cit.) Z (praepositus)
Pannonia II: V lovia N N VI Herculia z N N
Valeria: I Adiutrix N N II Adiutrix z (?)69 N N N
Pannonia 1: 11 Italica N I Noricorum N N XGemina z z XIVGemina z N N
Raetia: lllltalica N N (media) N (ripa prima)
Vollends wird deutlich, welch schlechter Wegweiser die eben kein Verzeichnis bloßer Militärziegeleien bietende und unterschiedlich redigierte Notitia ist, und wie es in die Irre führen muß, wenn wir unsere epigraphischen Neufunde ihrem, noch dazu emendierten Text einzupassen versuchen. Hält man dagegen an der Überlieferung fest, so ergänzen sich beide Quellengattungen. Beispielsweise fallt auf, daß in Moesia I, wo laut D. van Derehern die späteste Entwicklung der Grenz· Iegionen in der Notitia sichtbar wird/0 die Ziegel einen offenkundig älteren Zu· stand erhellen; und dementsprechend belegen auch für die legio X Gemina die Stempel in der Notitia fehlende partes und cohortes usw. Methodisch bedeutsa· mer ist wegen ihrer zukunftsweisenden Perspektive die Gesamttendenz: Dank der vermehrten Ausgrabungst~Stigkeit in den Balkanstaaten zeichnet sich eine unerwar· tete Schließung unserer Evidenzlücken ab. Denn tatsächlich erlauben es <<die spätrömischen Stempel der Grenzlegionen ... die schon traditionelle Interpretation des unteren Donauabschnittes in den Listen der Notitia Dignitatum zu differenzie· ren)), aber keineswegs in dem Sinne, daß die Aufteilung der Legionen «schon am Beginn ... nach Diözesen und manchmal sogar auch nach Provinzen und Legionen
Vetus Salina- lntercisa. Budapest 1979, 77 Nr. 101 Taf. 7, 2; vgl. 21. Dagegen ist V in LEG(io) XIlii G(e)M(inae) V: Lörincz (Anm. 67) 15 Nr. 17; 83 Nr. 513; 5/11 f.; 88 Nr. 9/3; 93 Nr. 13/1 und 14/1 zu V(indobona) aufzulösen, siehe Lörincz ebd. 23.
69 Vgl. die Stempel COH, CHOR, CHORT, COHORTI, CHORTIS aus Aquincum: CIL 111 3758; 10669; Lit. bei A. Mocsy, in: RE Suppl. IX (1962) 631.
70 Derehern (Anm. 7) 92 f.; zustimmend Mirkovic, IMS II S. 42.
298 Karlheinz Dietz
in verschiedener Weise vorgenommen wurde».71 Vielmehr folgt aus dem neuen Befund eine Vereinheitlichung des Gesamtbildes, infolge derer wir zumindest nicht mehr um folgende Feststellungen herumkommen:
l. Geteilte Arbeitsabschnitte (pedaturaelpartes) waren in den Legionen der Donauprovinzen ein allgemein verbreitetes Phänomen. Das alleiiÜge Fehlen solcher Sektionen bei der legio V Macedonica muß ebenso überlieferungsbedingt sein wie etwa die Dominanz der partes superiores.
2. Die Stempel des Hermogenes in Moesia I zeigen, daß ripae und pedaturael partes tatsächlich gleichzeitig existierten, wie die Notitia dies für Scythia und Moesia li immer schon nahelegte.
3. Das offenbar nicht ungewöhnliche Auftreten von Einzelkohorten ist auch dort möglich, wo der Text der Notitia je eine cohors quinta verzeichnet und nach dem gängigen Modell eine Halbierung der Legion nah~zulegen scheint.
V
Tatsächlich stellt das Auftreten bauender und - natürlich auch - Baumaterial be· schaffender Legionskohorten ein bereits während der Prinzipalszeit gut bekanntes Phänomen dar. Auf den zahlreichen, gattungsmäßig den Mauerziegelstempeln noch am nächsten verwandten Legionsbausteinen ("distance slabs"), die am Hadrianswall in großen Mengen, vereinzelt aber auch sonst vorkommen, wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Abteilungen zwar in unterschiedlicher Form mit· geteilt, es fehlt aber auch nicht an Zeugnissen, deren Formular "legionis illius cohors [1, li, ... X]" (mit oder ohne fecit) dem der Ziegelstempel vollkommen ent· spricht.72 Gebaut haben in diesen Fällen die einzelnen Zenturien. Infolgedessen
7 ~ So aber Sarnowski (Anm. 8) 115. 72
Besonders die leg(io) 11 Aug(usto) ist mit fast allen Kohorten vertreten: coh(ors) I (RIB I 1964) mit fec(it) (1358); coh(ors) I/ (1342); coh(ors) lll (2054; 1156?) mit f(ecit) (1155); coh(ors) Illl (1343) mit f(ecit) (1157); coh(ors) Vlll (1360) mit jec(it) (1359); coh(ors) X (1344); vgl. auch leg(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis) coh(ors) IV (1385) und coh(prs) Vlll (1390); l(egionis) I A(diutricis) c(ohors) VI (CIL XIII 11839); c(o)ho(rs) 11 leg(ionis) XIlll G(eminae) M(artiae) V(ictricis) (CIL XIII 6929); leg(ionis) X Fre(tensis) coh(ors) /IX (AE 1984, 914 = 1985, 832). Für Britannien in jüngerer Zeit etwa D.J. Breeze u. B. Dobson, Hadrian's Wall. Harmondsworth 31987; eine Auswahl bei L.F.J. Keppie, Roman Distance Stabs from the Antonine Wall. Glasgow 1979; zuletzt J.C. Mann, Britannia 23, 1992, 236 -238; s. W.S. Hanson u. G.S. Maxwell, Rome's north·west frontier. The Antonine Wall. Edinburgh 1983, 75; 113 • 117; 122 - 131. Beispiele ferner bei E. Vorbeck, Militärinschriften aus Carnuntum. Wien 21980, 93 f. Nr. 252 - 255; 114 f. Nr. 332 - 334; M. Kandler in: V.A. Maxfie1d u. M.J. Dobson (Hrsg.), Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies. Exeter 1991, 237 f. Abb. 43, 2 f.; B. Oldenstein-Pferdehirt, JRGZM 31, 1984, 413; 416 Abb. 11; zu einem Kohortenstein vermutlich der legio XIII Gemina AE 1972, 488 = IDR 111 3, 260, siehe bei Speidei (Anm. 31) 143 f. und C.C. Petolescu, SC! V 39, 1988, 403 Nr. 415. Außerdem noch unten Anm. 88.
Zur Entwicklung der Grenvegionen in der Spätantike 299
lautete der korrekte Nachweis für den kleinsten Bauabschnitt "legionis illius co· hortis illius centuria centurionis cuiusdam", konkret also z. B. leg(ionis) XIII/ G(eminae) M(artiae) V(ictricis) coh(ortis) I (centuria) P. Murasi.73 Gelegentlich wird sogar noch der Rang des Zenturios (mit und ohne dessen Namen) hinzuge· setzt.74 Bei den reinen Kohortensteinen ("legionis illius cohors [1, II, ... X]") han· delte es sich nicht etwa um Verkürzungen dieses ausführlichen Formulars, sondern um Markierungen des von der jeweiligen Kohorte betreuten Bauabschnitts.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Legionsbausteinen und den spätrö· mischen Kohortenziegeln des Donauraumes wird sogleich deutlich: Während z. B. am Hadrianswall einzelne Legionszenturien im Verband der gesamten Legion und ihrer Kohorten, also als reguläre Einheiten unter ihren regulären Kommandanten bauten, standen die zu Großprojekten und anderen Baustellen abgestellten Kohor· ten etwa der legio V Macedonica als irreguläre Verbände unter Ad-hoc-Befehlsha· bern, die- wie üblich -als praepositi [ll; 121 oder mit sub cura [131 zeichneten,
75
d. h. es handelte sich bei diesen Bautrupps um aus Kohorten zusammengesetzte L . 'II . 76 egtonsvext attonell
Eine solche Aufstellung war ungewöhnlich, denn laut R. Saxer hatte «das Be· dürfnis nach gerechter Arbeitslastenverteilung und möglichst geringer Schwä· chung der taktischen Einheiten, also der Legionskohorten und Centurien, ... zur Folge, daß zu einer Arbeitsleistung nicht etwa eine geschlossene Einheit der Le· gion abkommandiert wurde».77 Vielmehr kamen unter dem Prinzipat gewöhnlich zwei andere Ausleseprinzipien zum 1hlgen:78 entweder stellten alle Kohorten -der Legion eine, gleichmäßig aus den sechs Zenturien gezogene etwa gleich große An· zahl von vexillarii, oder aber eine Kohorte entsandte den Hauptteil der Vexilla· tion, während die Restlast annähernd proportional auf die übrigen Kohorten uin·
73 CIL XIII 6830. Die Ähnlichkeit zur Vexillumsaufschrift der Zenturie im Feld, wie sie Veg., mil. 2, I3 schildert, ist unübersehbar; vgl. noch das vexillum unten Anm. 88.
74 Beispiele: p(rimus)p(ilusr. RIB 440; 1373; 1472; 1502; 1503; 1643; 1709; 1958; 2080; ÖL XIII 6923; H. Nesselhauf, BerRGK 40, 1959, 176 Nr. 143. - hastatus prior: RIBI 341; 2032; Vorbeck (Anm. 72) ll7 Nr. 347 Taf. 20. • hastatus posterior: RIB I 1501; 2001; CIL III 4454 = Vorbeck a.a.Q 93 Nr. 252. - princeps prior: RIB I 1391; 1571; 1971; JÖAI Beibl. 29, 1935, 301 Nr. 127; Vorheck a.a.O. 94 Nr. 253. · princeps posterior: RIB I 2023; CIL 111 14358, 16 = Vorheck a.a.O. 94 Nr. 254. Vgl. noch IDR II 325; 327 add. Petolesc11 (Anm. 41) 606 Nr. 47; ferner M.l! Speidel, Roman Army Studies. I. Amsterdam 1984, 71 m. Anm. 22 und zu den Rängen Ders. in: Epigr. Studien 13 (1983) 43- 61 und Aretos 24, 1991, 135- 137.
7s R. Saxer, Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von
Augustus bis Diokletian. Ki>ln u. Graz 1967, 122; 130 f.; R.W. Davies, Epigr. Studien 12 (1981) 183 f.; K. Dietz, Chiron 13, 1983, 518 f.; Speidei (Anm. 74) 192; Ders., EA 4, 1984, 152; A. Mastino, MEFRA 102, 1990, 265 f. Weiteres noch unten Anm. 206, vgl. Anm. 183.
76 Im Falle Gamzigrads wäre denkbar, daß Zenturien nur mit ihrer. Kohortennummer
ziegelten; vermutlich handelte es sich aber nicht nur um Ziegel-, sondern um Bautrupps. n Saxer (Anm. 75) 128. 78 Ebd. 127 f.
300 Karlheinz Dietz
gelegt wurde.79 Entsprach mithin die Detachierung kompletter Kohorten nicht der Regel, so kam sie in bestimmten Ausnahmesituationen seit hadrianischer Zeit dennoch vor.8° Für das späte 3. Jahrhundert häufen sich neuerdings Zeugnisse,s
1
die eine vierte, offenkundig in Romulianum und Sucidava zur Anwendung gekommene Möglichkeit zur Bildung von Legionsvexillationen belegen:82 die Detachments wurden aus Kohortenteilen so erstellt, daß die betroffenen Soldaten für die Zeit ihrer Abordnung nach Kohorten zusammenblieben. Sofern zahlenmäßig möglich, entstanden aus diesen abgestellten Kohorten . - einzeln oder auch paarweise -neue, zenturien-ähnliche Gebilde, die wie Zenturien eine eigene Admini· stration hatten und im Rahmen von Expeditionskorps vermutlich sogar als eigene taktische Formationen mit eigenen Befehlshabern, Standarteil und Fahnenträ-gern (signiferi) fungieren konnten. .
Gut beobachten läßt sich diese Praxis zu Beginn des 4. Jahrhunderts im Bereich des Feldheeres an jener mobilen Abteilung der legio II Italica Divitensium, die vielleicht erst 311, möglicherweise aber auch schon früher aus Noricum nach Köln-Deutz verlegt wurde und die, als sie 312 mit Konstantin nach Italien zog, entlang der Via Flaminia Angehörige ihrer cohortes VI und VII bestatten mußte.
83
Wiewohl die Existenz detachierter Kohortenpaare nicht unwahrscheinlich ist,84
müssen die Divitenses - wie sie künftig hießen - natürlich keineswegs ausschließ· lieh aus den beiden genannten Kohorten der Stammtruppe gezogen worden sein. Vielmehr ist ihre Gesamtstärke derzeit nicht zu ermitteln. Klar dürfte hingegen sein, daß man immer noch bemüht war, bei der Aufstellung von Detachements
79 So oder so wurden nicht selten Detachements gebildet, die stärkemäßig nur aus etwa 80
Mann bestanden und damit ungefähr einer Zenturie entsprachen. 10 CIL VIII 18042 (= ILS 2487): cohortem et qua[ternos) ex centuris in supplementum
comparum tertianorum (vgl. Speidei [Anm. 74) 260 f. Anm. 134); P. Mich. 466: ön &arpcitEIJaciv (JlE) ic; xoo(p]tTJV Eie; Boatpav (dazu Speidei ebd. 236); wohl auch Cass. Dio 15, 12, 4 f.; vgl. E. Birley, The Roman Army. Papers 1929 · 1986. Amsterdam 1988, 26 f.;
· Speidei a.a.O. 308. 81
CIL 111 7396; 7449 (dazu unten Anm. 136); 11221; CIL VIII 8440 (= ILS 4195 = CIMRM 148 f.); AE 1951, 194; 1972, 709 f.; 1982, 258 add. A. Scheithauer u. Wesch-K1ein, ZPE 81, 1990, 229 - 236; AE 1982, 260 (add. Weseh-Klein ebd. 234 f. Anm. 19); G. -Ch. Picard, Castellum Dimmidi. Algier u. Paris 1944, 177 f. Nr. 1; 182 Nr. 4; 197 f. Nr. 22; 203 ff. Nrr. 31 f. und 42 f.; Speidei (Anm. 74) 32 f.; M.W.C. Hassall, Britannia 16, 1985, 317 - 322 (= AE 1985, 637).
12 Siehe M.P. Speidel, Legionary Cohorts in Mauretania. The RoJe of Legionary Cohorts in the Structure of Expeditionary Armies. In: ANRW 1110,2 (1982) 850- 860 = Ders. (Anm. 74) 65 -75; 406.; ergänzend Weseh-Klein (Anm. 81) 234 f.
83 CIL XI 4085; AE 1982, 258. Zur legio II ltalica Divitensium zuletzt A. Scheithauer u.
G. Weseh-Klein (Anm. 81) 229- 236; zum Zeitpunkt der. Detachierung: ebd. 233; vgl. schon P. Brennanbei Speidei (Anm. 74) 406.
14 Aus Sitifis stammen der Grabstein eines sig(nifer) leg(ionis) Ill ltal(icae) coh(ortis) I et
II (AE 1972, 710) und die Mithrasweihung legionis II Herculiae ... c(oh)or(te)s X et VII (CIL VIII 8440), beide vermutlich aus der Zeit Maximians.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 301
das innere Gefüge der Stammtruppen möglichst wenig anzutasten und aus diesem Grund einzelne Legionskohorten nicht zu stark belastete. Da nun die Zusammen· stellung von Bau- und Arbeitsvexillationen weitgehend «nach denselben Prinzi· pien» wie bei den Kriegsvexillationen erfolgte,85 verwundert das Auftreten von ko· hortenweise gebildeten Bau- und Wachtrupps nicht länger. Tatsächlich ist dieses, u. a. in Romulianum und Sucidava sichtbare Verfahren etwa im nordafrikanischen Castellum Dirnmidi seit dem Jahr 225 inschriftlich bezeugt.86
Im übrigen bestreitet niemand, daß legio im 4. Jahrhundert nicht mehr nur ei· nen Verband von 6000 Mann bezeichnete. Obwohl es jetzt eine ganze Reihe gleichnamiger, offenbar kleinerer Legionen gab, haben die Römer den traditions· reichen Begriff unterschiedslos beibehalten. Da selbst Vegetius der Schilderung der antiqua ordinatio legionis (nicht ordinatio antiquae legionis) lediglich eine Über· sieht secundum praesentes matriculas folgen läßt,87 war es kaum eine sonderlich glückliche Entscheidung der Forschung, terminologisch zwischen (alten) Vollegio· nen und Neulegionen zu unterscheiden. Letztere stellten, sofern sie keine Neugrün· dung waren, lediglich Teile der ersteren dar. Schon im 2. Jahrhundert traten Vexil· lationen (Totum pro parte) unter dem Namen der gesamten Legion auf,88 und dies wurde offenbar immer mehr zur Gewohnheit. Erinnert sei an die Detachments der legio Xlll Gemina und der legio V Macedonica, die kurz vor 300 im Rah· men eines Expeditionskorps nach Ägypten kamen und im Unterschied zu anderen Abteilungen nie mehr auf den Balkan zurückkehrten, sondern benachbarte Stand· Iager in Babyion und Memphis bezogen.89 Ob sie zunächst gleichsam nur als Langzeitabordnungen bis zur definitiven Beseitigung einer Spannungssituation ge· dacht waren oder ob von Anfang an mit ihrem Verbleib in der Provinz Aegyptus
85 Saxer (Anm. 75) 128. 86 Die Belege oben Anm. 81. 87 Mil. 2, 7. Tatsächlich war die Sollstärke der Legionen um 300 wohl noch nicht
wesentlich geringer als 6000: Williams (Anm. 2) 247 f. Anm. 6; vgl. auch die späten Zeug· nisse bei Th. Wegeleben, Die Rangordnung der römischen Centurionen. Diss. Berlin 1913, 36 f. Sogar die Vexillationen konnten um 300 noch beachtliche Stärken erreichen: R.P. Duncan-Jones, Structure & Scale in the Roman Economy. Cambridge etc. 1990, 105- 117; 214- 221.
88 Besonders deutlich ist dies am Fehlen der Vexillationsbezeichnung in RIB I 2139 Taf. 18 und der Darstellung des vexi/lum mit dem Namen der Legion; vgl. ferner die Legions· hausteine RIB I 2184; 2189; 2193; 2203; 2204 (gegen 2173; 2185; 2194; 2196 - 2200; 2205; 2206; 2208); außerdem etwa: M. Mirkovic, AAntSiov 41, 1990, 631 - 633. Danach ist CIL 111 11244 = Vorheck (Anm. 72) 114 Nr. 331 Taf. 19 wohl p(edes) (: f(ecit) zu lesen. Siehe schon Ritterling (Anm. 38) 1305 f., der z. B. auf CIL VIII 2582 = 18090 (= ILS 1111) oder die dalmatinischen Ziegeln der legio V111 Augusta verweist (dazu Oldenstein-Pferdehirt [Anm. 72]401- 404); auch Speidei (Anm. 74) 71 Anm. 24.
89 Not. Dign., or. 28, 14 f.; vgl. D. Hoffmann, Das spätrömische Bewegungsheer llnd die
Notitia Dignitatum. Düsseldorf 1969 - 1970, l 230 f.; J. Rea, YCIS 28, 1985, 101 - 113, bes. 108 (für eine Detachierung 292/293); M.P. Speidel, Historia 36, 1987, 221 Anm. 15 (schließt 297 nicht aus).
302 Karlheinz Dietz
Herculia gerechnet wurde, läßt sich natürlich nicht mehr mit Sicherheit feststellen, jedoch ist ersteres schon deswegen wahrscheinlicher, weil die neu entstandenen Verbände nicht anders hießen als die jeweiligen Stammtruppen. Ja, selbst die ver·
mutlieh später von diesen uferdakischen Legionen ins Feldheer entsandten Abtei· Iungen hießen gleichermaßen quinta Macedonica und Tertiodecimani.
90
Nach derselben Verfahrensweise konnten sich auch die personell mehr oder minder stark reduzierten Kohorten der Vexillationen wie ihre Stammkohorten be· nennen. Die meisten der zunächst gewiß nicht auf Dauer detachierten Bauforma· tionen91 werden nach Erledigung ihrer Arbeiten wie üblich aufgelöst worden sein, andere blieben angesichts der Größe ihrer Aufgaben über Jahre bestehen und wur· den auf solche Weise langsam zur sich mehr und mehr verselbständigenden lnsti· tutionen. Eine unter den Tetrarchen nicht zuletzt auch aus militärischen Gründen
·stark forcierte Baupolitik92 brachte es mit sich, daß Vexillationen aus einzelnen oder mehreren Kohorten die numerische Struktur der Legionen veränderten und so auch einem reduzierten Kohortenbegriff den Weg ebneten: wurden die cohor· tes der Stammtruppe durch Langzeitdetachements und deren gelegentliche Um· wandlung in ständige Detachements dezimiert,93 so entsprachen die cohortes der Ablegerverbände von Anfang an nicht mehr der 'klassischen' Kohorte.94
Aufgrund dieser Überlegungen ergeben sich einige wichtige Folgerungen: 1. Bei Kohorten gleicher Ordinalzahl in Romulianum und in Sucidava (vgl. [6]
und [9- 11]; [7] und [12]) kann es sich durchaus um verschiedene Verbände in un· terschiedlichen Vexillationen gehandelt haben.
2. Aus einem alten Legionsverband waren recht viele Kohorten, theoretisch so· gar mehrfach cohortes quinque abzulösen, ohne daß sich dadurch die innere
90 Not. Dign., or. 7, 39; 8, 38. Dazu Hoffmann (Anm. 89) I 234. 91 Berchem (Anm. 7) 95. 92 Bes. Zos. 2, 34, 1; daneben Paneg. 8, 21, 2; 9, 4, 2 f.; 9, 11, 1 f. Mynors; Lact., mort.
pers.. 7, 8 - 10; Aur. Vict., Caes. 39, 45; Malal. S. 400 f.; 454 ff. Stauffenberg; H. Delehaye, Etude sur Je legendier romain. Brüssel 1936, 65 f.; und am Beispiel bestimmter Grenzzonen T. Sarnowski, Die Anfänge der spätrömischen Militärorganisation des unteren Donauraums. ln: Vetters u. Kandler (Anm. 8) 855 - 861; G. Waldherr, Kaiserliche Baupolitik in Nordafrika. Studien zu den Bauinschriften der diokletianischen Zeit und ihrer räumlichen Verteilung in den römischen Provinzen Nordafrikas. Frankfurt a. M. 1989; für den Osten vgl. nur H.-P. Kuhnen·in: Maxfield u. Dobson (Anm. 72) 300m. Anm. 14.
93 Das Modell, wonach immer nur eine Abteilung einer Legion ins Feldheer geschickt wurde, halte ich für zu einfach und für eine Zementierung des Trugbilds zufällig über· lieferter Fakten. •
94 Leider ist über die spätrömischen Legionskohorten wenig bekannt. Wie gezeigt, nennt die Notitia Dignitatum überhaupt nur fünfte Kohorten, woraus Mommsen Fünfergruppen der alten Stärke machte; andere - wie A. Müller - hatten sich Kohorten der Neulegionen in der Art der alten Manipel vorgestellt (Philologus 64, 1905, 609; 71, 1912, 125 f.), und wieder andere - wie R. Grosse (Anm. 11) 37; 147 m. Anm. 6 und Ders., ByzZ 24, 1923/24, 361) -waren davon überzeugt, daß die selbst angeblich nur einer cohors milliaria oder gar quingenaria entsprechenden Neulegionen gar keine Kohorten mehr hatten.
Zur Entwicklung der Gren{.legionen in der Spätantike 303
Struktur des Stammverbandes mehr als nur quantitativ verändert hätte.95
3. Es lag in der Logik des skizzierten Vorgangs, daß schließlich die Stammtruppe, die sich mit jeder weiteren Abkommandierung mehr den Detachements an· glich, selbst auf deren Stufe herabsank.
4. Nicht einmal mehr aus einem als richtig unterstellten cohortium quinque in der Notitia dürfte zwingend auf eine Zweiteilung der Legion geschlossen werden. Damit entfällt eine wesentliche Voraussetzung für das auf Mommsens Konjektur aufbauendem Modell von spätantiken Halblegionen.96
9s Nur auf diese Weise konnte auch ein eventuell weiter existierender praefectus legionis
der Stammtruppe noch gut und gerne fünf oder auch zehn Kohorten führen, obschon doch nach Mommsens Modell von den Halblegionen je cohortes quinque von einem praefectus ripae befehligt worden sein sollen. Geht man vom gängigen Kohortenbegriff aus (seit späte· stens 199 haben wir mit 550 Mann zu rechnen: Speidei [Anm. 74] 308), sind Schwierigkeiten unausweichlich, da das Gros der Militärverwaltung laut Notitia beim Officium des dux lag und der Legionspräfekt selbst zur Erledigung eines eventuellen 'Verwaltungsrests' immer noch wenigstens eine der zehn Kohorten benötigt hätte. Das Dilemma wohl sehend hat Mommsen eine eigenwilige Lösung vorgeschlagen: «Der Legionscommandant ist vielleicht nicht abgeschafft, sondern nur die Stelle nicht weiter besetzt worden; ein Hauptquartier, in welchem die Feldzeichen und die Acten der Legion vorzugsweise aufbewahrt wurden, muss· te bleiben, auch wenn die Commandantur als solche nicht mehr bestand.» (a.a.O. [Anm. 4] 224; vgl. R. Grosse, ByzZ 24, 1923/24, 359 f.) Schon die Abmilderung «vorzugsweise» läßt erkennen, daß es mit der Notwendigkeit, die Akten der Teilkommandos zentral aufzubewah· ren, so weit nicht her sein konnte, und tatsächlich bewegten sich die Akten der Soldaten mit diesen (vgl. Speidei a.a.O. 71 m. Anm. 25); bezüglich der Feldzeichen hat bereits R. Grosse bemerkt: «Sobald die zersplit."rte Legion kein Gesamtkommando, keinen praefectus mehr hatte, war die Feldherrnfahne überflüssig.» Dementsprechend spiele der aquilifer bei Am· mian tatsächlich keine Rolle mehr (a.a.O. 360; zum aquilifer der Kaiserzeit Speidei a.a.O. 3 ff.). Generell geriet Mommsen bezüglich des Titels praefectus /egionis, mit dem die Notitia «völlig allein» stehe, ins Gedränge, und er sah sich genötigt, ihn als einen «Ueber· rest des in vordiocletianischer Zeit bestehenden Uebergewichts des praefectus legionis Über die tribuni und praefecti der kleineren Truppenkörper>~ zu sehen (224m. Anm. 2). Dies ist angesichts von rund einem halben Hundert Bezeugungen des Titels in den unterschiedlich redigierten Partien der Notitia wenig wahrscheinlich: zurecht Enßlin (Anm. II) 1335. f?a nun aber die Notitia eine Unterordnung der praefecti ripae unter den praefectus legionis durch nichts zu erkennen gibt (niemand käme beispielsweise auf die Idee, den Abschnitts· kommandanten in Aquincum den drei Legionspräfekten in Valeria unterzuordnen), und letz· terer zudem seinen Dienstsitz immer oder fast immer mit einem der beiden Uferpräfekten teilte (Troesmis, Noviodunum, Novae und vermutlich Durostorum, da diese Konjektur in Not. Dign., or. 40, 35 wohl zurecht besteht, vgl. Zahariade (Anm. 11]58 f.), ließe sich diese räumliche Nähe von Amtsträgern ganz ähnlicher Art gemeinsam mit dem heiklen Problem, wen denn der Legionspräfekt eigentlich befehligte, auch durch die Streichung des leiztge· nannten in or. 39, 29 und 32 sowie 40, 30 und 33 aus der Welt schaffen. Wäre es doch durchaus vorstellbar, daß bei der Eintragung der praefecti ripae an der jeweils richtigen Stelle die alten Befehlshaber der Gesamtlegion infolge Nachlässigkeit oder Unkenntnis nicht getilgt wurden (in diesem Sinne schon Enßlin a.a.O. 1335 f.).
96 Gegen dieses Modell spricht im übrigen auch die simple Beobachtung, daß eine Teilung der pedaturaelpartes mit Bezug auf den alten Hauptort der Legion allenfalls die Ausnahme dargestellt hat. Die Wiedergabe von superior bzw. inferior als 'stromaufwärts' bzw. 'strom·
.. 304 Karlheinz Dietz
VI
Für die Deutung der Ziegelstempel von besonderem Interesse sind die teilweise leider fragmentierten Exemplare aus Sucidava {11 - 13). Ihr Erhaltungszustand ist aber glücklicherweise eindeutig genug, um wichtige Schlußfolgerungeil zu erlau· ben. Stempel {11) ist kaum - wie dies stets geschieht - als [LV]MPPCIII aufzufas· sen, da der Amtsbezeichnung ein Personenname vorausgegangen sein wird. In Analogie zu [12] ist höchstwahrscheinlich [RO)MPPCIII zu lesen und zu folgern, daß ein und derselbe Präpositus (wenigstens) zwei Kohorten vorstehen konnte.
97
Zudem ist im Formular des allem Anschein nach auf den nämlichen Rom(ulus?) zurückgehenden Stempels [13]: [LE)GVMSCRO[MPP?] das "missing link" zu fol· genden, hauptsächlich aus Moesia Prima stammenden Marken zu erkennen:98
abwärts vom Hauptquartier' ist bereits Interpretation (richtig gesehen bei Dusanic [Anm. 11] 1978, 344 f.). Tatsächlich lagen oberer und unterer Teil zueinander nur_ hinsichtlich des Flus· ses wie oben und unten, wobei diese Benennung weder einen weiteren Bezugspunkt ('Haupt· quartier') miteinschließt noch über die Grenze der so bestimmten beiden Teile Näheres aus· sagt. Die Realität sah denn auch ganz anders aus. Einige Beispiele: (a) Der durch den Stempel LEG 1111 FL PAR SVP bezeugte obere Abschnitt etwa kann aus geographischen Gründen nur östlich von Singidunum, also donauabwärts, gelegen haben. (b) Ähnlich erstreckte sich wohl auch die pars superior der legio VII Cloudia westlich und östlich von Viminacium und konnte daher mit vollem Recht auch als pars citerior angesprochen werden, eine Aus· drucksweise, die keineswegs im Sinne einer indirekten Bezeugung transdanuvischer Brük· kenköpfe auf einen 'diesseits der Donau gelegenen Abschnitt' hindeutet (so Duianic [Anm .
. 111 1974, 280; 283; vgl. Brennan (Anm. 39) 553- 567 zu den Brückenköpfen); da citerior und ulterior- den (vierten) Beobachtungspunkt miteinbeziehend -vielmehr 'diesseits' und 'jen· seits' im Sinne des 'näher Befindlichen' und 'Entfernteren' meinen, waren sie, von Vimi· nacium aus gesehen, mit superior und inferior weitgehend deckungsgleich. Auch der Ver· such (IMS II S. 42 f.), den Tätigkeitsbereich des praepositus ripae Hermogenes [27] mit der Verteilung seiner Stempel territorial abzugrenzen und ihm die Durchfahrtskontrolle am Ei· sernen Tor zuzuweisen, wobei ihm vielleicht die Uferstrecke östlich der Porecka Reka zuge· wiesen worden sei (während der Präfekt in Viminacium die westliche Strecke als ripa Vimi· nacensis verwaltet habe), ist schon deshalb nur spekulativ, weil einer der Stempel des Hermogenes im uferdakischen Prahovo gefunden wurde. Der Waren- oder Truppenaustausch war - darauf deuten viele Stempelfunde - offenbar viel intensiver, als wir es wahrhaben wol· Jen. Dies macht alle Folgerungen aus Verteilungskarten problematisch. (c) Laut Notitia lag Alisca (Szekszard) in der pars superior derlegio /1 Adiutrix (occ. 33, 52). (d) Auch die pars
'' · superior bei Castra Regina ( Regensburg) paßt nicht ins Bild, weshalb Seeck (zu occ. 35, 17) vorsichtig inferior erwägt. Angesichts dieser und ähnlicher Sachverhalte wäre selbst für die beiden untersten Donaudukate die von Mommsen unterstellte Rolle des alten Legionsstand· ortes als Mittelpunkt zwischen den pedDturaelpartes erst einmal zu beweisen gewesen.
97 Veg. mit. 2, 7: Reliquae cohortes, prout principi placuisset, a tribunis vel a praepasitis regebantur. Vgl. schon D. Tudor, Dacoromania 1, 1973, 157 m. Anm. 33.
98 Vgl. N. Vulic, in: Sbornik v pamet na profesor P. Nikov. Sofia 1939, 560- S62; Duianic (Anm. 11) 1974, 280; 283; M. Mirkovic, IMS 11 S. 40 f. Benea (Anm. S3) 92 - 103; 121 - 123; 190 - 197; 204 f. Mirkovic gibt Verweise auf Dusanic (Anm. 6).
Zur Entwicklung der Gren{.legionen in der Spätantike 305
[14) (a) LEG(io) 1111 FL(avia) S(ub) DINITIO P(rae)P(osito) - Viminacium (Kostolac).99
(b) LEG(io) 1111 FLA(via) SV(b) C(ura) DINIC(i) P(raepositi) - Viminacium (Kostolac).100
[15] LEG(io) 1111 FL(avia) S(ub) C(ura) ER(--)- Dierna (Orsova), Horreum Margi (Mramorac), Singidunum (Belgrad), Sirmium (Sremska Mitrovica).
101
[16] LEG(io) 1111 FL(avia) S(ub) C(ura) SER(--) P(raepositi) F(ecit?l02 MARIANVS - Viminacium (Kostolac).103
·.
[17] LEG(io) 1111 FL(avia) S(ub) C(ura) TATE P(raepositi) -, Viminacium 104 .
(Kostolac). [18] L(egio) 1111 S(ub) C(ura) HERM P(raepositi) Rl(pae) - Viminacium
(Kostolac).105
[19) (a} LEG(io) VII CL(audia) S(ub) C(ura) I ADVENTINI P(rae)P(ositi) F(ecit?) -Banatska Palanka, Viminacium (Kostolac). (b) LEG(io) VII CL(audia) S(ub) C(ura) ADVENTINI P(raepositi) R(i)P(ae) -Vr5ac. (c) LEG(io) VII CLA(audia) I S(ub) C(ura) AVENTI(ni) PIE (= PPF?) -Viminacium ( Kostolac).106
[20] (a) SU(b) C(ura) BONITI PREPOSITI L(egio) VII - Viminacium (Kostolac). (b) SV(b) C(ura) BONITI P(raepositi) L(e)G(io) VII - Viminacium (Kostolac).107
[21) S(ub) C(ura) BVBALI P(rae)P(ositi) LEG(io) VII CL(audia) MVIT(--) -Gornea.108
99Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 52 Nr. 65 (= AE 1903, 292).
100 M.M. Vasic, Starinar 2, 1907, 26 Abb. 5 c; Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 53 Nr. 66. 101
CIL 111 8276, 2; 10664 c; vgl. Milosevic (Anm. 49) 98 f.; Szilagyi (Anm. 54) 41 Nr. 6 Taf. 9. Der Schluß wurde auch IER gelesen und auf Dierna bezogen; obschon tatsächlich ein unerklärter Ortsname IER(--) auf IMS II 53, 95 a erscheint, halte ich die im T~xt gegebene Interpretation für die Richtige.
102 Vermutlich so, und nicht etwa p(rae)f(ecti) (Vulic) oder p(raefecti) f(iglinae) ist zu
lesen (vgl. Mirkovic, IMS II S. 41 Anm. 60). Zu P = praepositus unten S. 309. 103
CIL 111 14597 add. Ladek0lremerstein u. Vulic (Anm. 15) 148 Nr. 56 u. Premerstein u.
Vulic (Anm. 53) 53 Nr. 67. 1 Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 53 Nr. 68 (= AE 1903, 293). 105
Vulic (Anm. 57) 8 Nr. 22 (= AE 1905, 159); Benea (Anm. 53) 195; 204 Tat: 5, 20 .• 106
(a) IDR 111 I, 8 Abb. 7.- CIL 111 8275, 3 b.- Ladek, Premerstein u. Vulic (Anm. 15) 148 Nr. 59.- (b) N. Vulic, Spomenik 71, 1931, 40 Nr. 95.- (c) CIL 111 6235, 3 = 8275, 3 a.
107 (a) N. Vulic, JÖAI Beibl. 12, 1909, 168 Nr. 27 (auch Spomenik 47,1909, 137 Nr. 51= AE
1910, 90).- (b) Vulic ebd. 168 Nr. 28 (auch Spomenik ebd. 137 Nr. 52). 101
N. Gudea, Gornea. A$ezäri din epoca romanä $i romanä tirzie. Re$ila 1977, 88 f. Nr. 7 - 9 Abb. 67, I - 3 = IDR 111 1, 31 Abb. 26; vgl. Gudea ebd. 63 f.; 75; 94: erwägt die Möglichkeit, MVIT als ein Toponymikon aufzufassen. Es muß sich aber um den Namen des figulus handeln.
306 Karlheinz Dietz
[22] (a) LEG(io) VII CL(audia)S(ub) C(ura) EVF(--) P(raepositi) F(ecit) SILVANVSViminacium (Kostolac).109
(b) L(egio) VII CL(audia) S(ub) C(ura) EVF( --) P(raepositi) F(ecit) BESSIO -
Banatska Palanka, Viminacium (Kostolac), Vrsac.110
[23] (a) LEG(ionis) VII CLAVDIE. I S(ub) C(ura) MVCATRE P(rae)P(ositi) -Viminacium (Kostolac), Vindobona (Wien). (b) LEG(io) VII CLAVDIA S(ub) C(ura) MVCATRE P(raepositi) R(i)P(ae) -Vrsac.111
[24] (a) S(ub) C(ura) TARE P(raepositi) R(i)P(e) L(egio) VII CL(audia) - Pincum (Veliko Gradiste). (b) [--] LEG(io) VII CL(audia) TARA P(rae)P(ositus) - Pincum (Veliko Gradiste), Taliata (Veliki Gradac bei Donji Milanovac).112
[25] (a): LEG(io) VII CLA(audia) SV(b) C(ura) VICTORI(ni) P(rae)P(ositi) F(ecit?) B(italianus?) - Viminacium (Kostolac)113
(b): LEG(io) VII CL(audia) S(ub cura) VICORINI (sie!) P(rae)P(ositi) F(ecit?) VITALIANVS- Viminacium (Kostolac).114
(c): LEG(io) VII CL(audia) S(ub) C(ura) VICTORINI P(rae)P(ositi) - Lucica, Novae (Cezava), Pincum (Veliko Gradiste), Sirmium (Sremska Mitrovica), Viminacium (Kostolac).115
[26] (a) L(egio) VII S(ub) C(ura) VRSAC(i) P(raepositi) F(ecit?) ARGVTIO F(igulus?) - Sirmium (Sremska Mitrovica), Sucidava (Celei), Viminacium (Kostolac).116
109 CIL 111 8275, 6 = Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 54 Nr. 72. • ZuPF unten S. 308 f. 110 IDR 111 I, 9 Abb. 8. • CIL 111 8275, 5 = Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 53 Nr. 71. •
Vulic (Anm. 106) 40 Nr. 93. 111 (a) CIL 111 6325, 2 = 8275, 4 a; 8275 b = Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 54 Nr. 73. ·
Neumann (Anm. 66)98 Nr. 1713 c Taf. 57 (aus einer Privatsammlung!). • (b) Vulic (Anm. 106) 40 Nr. 94 = IDR 1111, S. 127.
112 (a) CIL lii 1700, 4: RIPAE bei Dusanic ist eine Rekonstruktion ([Anm. ll) 1974, 282 Anm. 48; vgl. IMS 11 S. 42 Anm. 65), es gibt aber keinen Grund, die Lesung Koehlers zu bezweifeln, da diese vom Formular her durch die viel später gefundenen Stempel [20; 21; 27] und in der Abkürzung PRP durch [19 b] und [23 b] bestätigt wird. · (b) Im Museum von Negotin: Mirkovic (Anm. 56) 108 f.; vgl. IMS 11 S. 42 Anm. 65.
113 Vulic (Anm. 57) 8 Nr. 24. Auf der Zeichnung bei Vulic liest man EB, doch dürfte der Sinn klar sein.
114 Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 54 Nr. 76 (= AE 1903, 295).- N. Vulic (Anm. 57) 9 Nr. 27 (= AE 1905, 161).
115 D. Pribakovic u. D. Piletic, Arh. Preg. 7, 1965, 105 • 108 Taf. 41; vgl. Benea (Anm. 53) 98 m. Anm. 381 Taf. 3, I. · CIL 111 1700, 3 add. S. 1024. • Milosevic (Anm. 49) llO Nr. 25 · 26. · Pn;merstein u. Vulic (Anm. 54) 54 Nr. 74 • 75 (= AE 1903, 295); Vulic (Anm. 57) 8 Nr. 25.
116 CIL 111 10687 b (vgl. Milosevic [Anm. 49]100 m. Anm. 49); Szilägyi (Anm. 54) 110 Nr. 67 a Taf. 32. • Toropu u. Tätulea (Anm. 8) 103 m. Abb. 25, 112 und oben Anm. 31. · Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 54 Nr. 77 (= AE 1903, 296).
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 307
(b) (V]II ARGVTIO F!C(ulus?)- Osijek, Sirmium (Sremska Mitrovica).117
(27] (a): S(ub) C(ura) HERMOGENI P(rae)P(ositi) R(ipae) (bzw. RIPE) I LEG(io) VII CL(audia) PART(is) . CIT(erioris) - Positivstempel - Zmirne (Boljetin),
Svinita, vermutlich Novae (Cezava). (b): SV(b) C(ura) HERMOGENI P(rae)P(ositi) I RIP(ae) LEG(io) VII CL(audia) PAR(tis) CE(terioris) - Positivstempel - Zmirne (Boljetin), Ad Aquas
(Prahovo). (c): [--] HERMOGENI P(rae)P(ositi) RIPE I[--] CL PAR(tis) CETERIOR[is]
Negativstempel - Saldum (Gradac). (d) S(ub) C(ura) HERMOGENI P(rae)P(ositi) R(ipae) LEG(io) [V]II CL(audia)
PAR(tis) CE(terioris) - Negativstempel - Zmirne (Boljetin), Svinita.118
[28] (a) S(ub) C(ura) BONIO - Svetinja; Tricornium (Ritopek). (b) TRIC(ornium) BONIO- Tricornium (Ritopek).119
[29] (S(ub) C(ura)] MVCIA P(rae)P(ositus) - Tricornium (Ritopek).120
[30) S(ub) C(ura) PROBIANI P(rae)P(ositus) VIP(--) - Sirmium (Sremska
Mitrovica).121
[31) SV(b) C(ura) PROVINTIAL[IS --]- Viminacium (Kostolac).122
[32] S(ub) C(ura) SVNDRIO P(rae)P(ositus)- Tricornium (Ritopek).123
[33) TRIC(ornium) VAL(--) P(rae)P(ositus) - Tricornium (Ritopek), Viminacium (Kostolac).124
[34) NV(--) P(rae)P(ositus) R(ipae) oder MV(--) P(rae)P(ositus) R(ipae) - Bononia (Vidin), Sucidava (Celei).125
[35] P(rae)P(ositus) LEG(ionis) VII S[--]- Museum von Negotin.126
117 M. Bulat, Osijecki Zbornik 9/10, 1965, 14 Nr. 32. - CIL 11110687 a (liest eingangs FL); Szilagyi (Anm. 54) 110 Nr. 67 b Taf. 32.
118(a) CIL IJI 13814 a b (RIPE); Dusanic (Anm. 11) 1974, 275 Nr. 1 Abb I. - N. Gudea, Tibiscus 3, 1974, 142 Nr. 2 f. Taf. 22, 1 f. Abb. 33 = IGLR 423 = IDR 1111, 33 Abb. 28 (R1[PE)); D. Benea, Tibiscus 4, 1975, 125 Nr. 1 Taf. 17 Abb. 33. - Vermutlich auch N. Vulic, Spomenik 98, 1948, 40 Nr. 89.- (b) CIL 11113814 a a; Swoboda (Anm. 58) 34 Abb. 5.- Dusanic a.a.O. 215 f. Nr. 2 Abb. 2.- (c) Duianic ebd. 276 Nr. 3 Abb. 3.- (d) Dusanic a.a.0.•276 f. Nr. 4 Abb. 4.- N. Gudea, AMN 7, 1970, 555- 559 Abb. I ab(= AE 1972, 495) = IGLR 423 = IDR 1111, 34 Abb. 29; D. Benea, Tibiscus 4, 1975, 125 f. Nr. 2 Taf.17 Abb. 34 f.
119 (a) M. Mirkovic, IMS 11 S. 32 Anm. 31. - (b) Vulic (Anm. 56) 30 Nr. 5 und 14, vgl Nr. II. 120 Vulic (Anm. 56) 30 Nr. 2. 121 CIL 11110686. 122 Vulic (Anm.107) 168 Nr. 28. 123
Vulic (Anm. 56) 30 Nr. 6, 7 und 10; vgl. N. Vulic, JÖAI Beibl. 15, 1912, 225 Nr. 23 und Spomenik 71, 1931, 49 Nr. 112.
124 Vulic (Anm. 56) 30 Nr. 3 und 13. - Premerstein u. Vulic (Anm. 54) 56 Nr. 85 ( = AE 1903, 300).
125 C.M. Danoff, JÖAI Beibl. 31, 1938, 120 Nr. 43; Tudor (Anm. 8) 345 Nr. 38; vgl. Z. Rakeva-Morfova, Archeologija Sofia 12/3, 1970, 41 Anm. 8. - IGLR 292 m. Abb. = AE 1976, 582 g; vgl. Morfova (Anm. 26) 30.
126 Benea (Anm. S3) lllf. 3, 20. Weitere Fragmente aus diesem Museum bei Mirkovic an den oben Anm. 98 genannten Stellen.
308 Karlhein{ Dietz
Folgt man der Forschung, so stammt auch diese Hinterlassenschaft zum über· wiegenden Teil (wenigstens [14- 26]) aus einem relativ kurzen Zeitraum am Ende des 3. oder Anfang des 4. Jahrhunderts. Damit wird man es im Augenblick bewen· den lassen, da alle bisherigen Versuche einer exakteren Datierung nicht ausrei· chend stratigraphisch begründet und mithin nicht sonderlich überzeugend wirken.127 Unhaltbar ist die Behauptung, die Ziegel gehörten- mit Ausnahme von [27] und eventuell [18] · wahrscheinlich noch in die Zeit vor den Reformen Kon· stantins, «car leurs estampilles ne comportent pas d'elements les mettant en rap· port avec les donnees de Ja Notitia)).128 Dies ist schon deshalb nichtig, weil in die· sen Zeugnissen wie in [10 - 12] erneut die Legion immer stärker zugunsten der Unterführer zurücktritt [20; 21; 27; 35] bis hin zu ihrer völligen Unterdrückung [28 a; 29; 30; 33; 33; 34] und bis zur Preisgabe selbst des Präpositustitels [vgl. 28 a und b mit 33]. Die Gründe für die größere Ausführlichkeit des einen oder des an· deren Amtsträgers (bes. [27]) bleiben unbekannt, sind aber gewiß im subjektiven E . I h 129 rmessensspte raum z:u suc en.
Trotz der diesbezüglichen Unklarheit in der Literatur hat als sicher zu gelten, daß es sich durchweg um Erzeugnisse von praepositi ripae handelte: in einem Fall ist der Titel sogar ausgeschrieben (20 a), ansonsten eindeutig gekürzt [14 a; 19 a; 23 a; 25 a - c; 27 a - d; 29; 30; 32; 33; 35). Wie nach PPF [25 a - b; vgl. AE 1903, 297] folgt auch nach PF ein Name im Nominativ [16; 22 a - b; 26 a; b], wo·
127 Ein abschließendes Urteil setzt natürlich die gewissenhafte Auswertung der meist in bulgarischer, rumänischer oder serbokroatischer Sprache abgefaßten Grabungs- und Fund· berichte voraus. Soweit mir ein Eindringen möglich war, ist meine Hoffnung auf exakte stratigraphische Zuordnungen bisheriger Funde eher gering. - Der Ansatz in die Zeit um 300 bei Dusanic beruht auf einer falschen Voraussetzung (vgl. Mirkovic, IMS II S. 41 Anm. 61); Ritterling (Anm. 38) 1624 (vgl. Benea [Anm. 53]105; 122; verschärfend noch Mirkovic a.a.O. S. 41) faßte die Zeit zwischen 310 und 330 ins Auge, weil er eine Identität des praepositus Bonitos [20] mit dem bei Amm. 15, 5, 33 genannten Franken Bonitus nicht ausschloß; tatsächlich war Bonitus ein seltener Name (A. Mocsy, Nomenclator. Budapest 1984, 52 verzeichnet je einen Beleg aus Dalmatien und Noricum und zwei aus Nieder· mösien), aber Ammians pro Constantini partibus in bello civili acriter contra Licinianos saepe versatus läßt ja nun reichlich viel offen. Man sollte dann konsequenterweise auch den figulus Silvanus [22 a] für den Sohn des Bonitus und den späteren Usurpator·halten.; und mit demselben Recht könnte man einen der bekannten Ursacii (einer davon war sogar seit ca. 335 arianischer Bischof von Siugidunum; zu ihnen A. Lippold, in: RE IX A 1 (1961]1054 - 1056; vgl. M. Clauss, Dermagister officiorum in der Spätantike [4. · 6. Jahrhundert). Mün· eben 1980, 196 f.) mit dem praepositus [26) identifizieren. Zu den beiden Franken etwa M. Waas, Germanen im römischen Dienst im 4. Jahrhundert nach Christus. Diss. Bonn 1965, 94; 123 · 127; R. MacMullen, Corruption and Decline of Rome. New Haven u. London 1988, 199 f.
128 Mirkovic, IMS li S. 42. 129 Aufgrund dieser Beobachtung sollte man wohl auch für CORSARI die Auflösung
co(ho)rs Ari{··) allen anderen vorziehen: (a) Sirmium (Sremska Mitrovica): CIL IIII0702; Szilagyi (Anm. 54) 109 Nr. 49 Taf. 30; Milosevic (Anm. 49) lll Nr. 34.- (b) Sucidava (Celei): (AE 1950, 75 b =) IGLR 297 = AE 1976,582 j.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 309
durch die Identität von P mit PP erwiesen ist. Die Möglichkeit, praepositus durch P zu kürzen, bestätigt zudem der Vergleich von [20 a) mit [20 b). Darüberhinaus erfährt PP in [27) bei ein und demselben Amtsträger die Spezifizierung durch den Zusatz R, RIP und RIPE, wodurch bedenkenlos auch PRI [18] und das dreimalige PRP für sonst nur PP genannte Personen [vgl. 23 b mit 23 a; 19 b mit 19 a; 24 a mit 24 b) als Bezeichnung für den Uferpräfekten aufgefaßt werden dürfen. Der Vergleich der Stempel [26 a] und [26 b] zeigt, daß die Tätigkeitsbezeichnung wie üblich einem Personennamen nachgestellt ist. Das F nach dem praepositus· Titel ist daher nicht mit FIC identisch, sondern entweder als f(igulina) oder be~ser noch als f(ecit) aufzufassen, das an dieser Stelle fakultativ auch auf den Legionsbaustei· nen erscheint und in [19 a] allein einen brauchbaren Sinn ergeben dürfte. Schließ· lieh belegt Ziegel (26 b] auch, daß es sich bei den den Präpositi beigeordneten Per· sonen [21; 22 a-b; 25 a-b; 26 a] um Beschäftigte, vermutlich die Leiter, der jigli· nae handelte.130 Dadurch ist die Brücke zu den Jiglinae-Stempe1n der Legionsko· horten von Moesia Secunda (I; 2) geschlagen131 und, da diese ihre nächsten Analo· gien in den Kohortenstempeln der legio V Macedonica haben, wiederum zu den Präpositus-Ziegeln aus Sucidava [11- 13]. Folglich steht fest, daß die Uferpräpositu· ren aus Bauvexillationen hervorgegangen sind, welche den Legionen auf Kohorten· basisentnommen wurden.132
VII
Dies führt notwendigerweise noch einmal zurück zu den Legionskohorten, die in der Notitia Dignitatum erwähnt werden. Fast regelmäßig ist die Angabe cohortis quintae mit der von parteslpedaturae verbunden und umgekehrt. Die wenigen Ausnahmen sind entweder durch die Nachlässigkeit der Abschreiber verursacht oder sie betreffen das Dukat Rätien, wo offenkundig spezielle, eigene Formulierun· gen verlangende Gegebenheiten vorlagen: zum einen, weil nur eine alte Legion zur
130 Figuli etwa nach Mirkovic, IMS II S. 32 Anm. 32; 40 Anm. 47; jictorts nach C.C.
Petolescu, SCIV 37, 1986, 106, dessen vermutlich dem Kommentar zu C1L lll 10687 entlehnter Hinweis auf EE II Nr. 938 = CIL 111 ll423 kaum zur Klärung beiträgt. Zur Organisation der Militärziegeleien zuletzt Sarnowski (Anm. 9) 28 - 31 und passim. Gemäß ebd. 33 müßte es sich um die Leiter der Officinae gehandelt haben. Vgl. noch oben Anm. 46.
131 Späte Ortsnamenstempel der legio XI Cloudia mit Hinweisen auf figlinae (CIL 111 7619 b; 12526 = ILS 9112; 12527) verzeichnen R. Zmeev, Archeologija ll/4, 1969, SI -54; R. Vasilev, in: Pliska - Preslav. Etudes et Materiaux I. Sofia 1979, 103 f. Abb. S; vgl. insgesamt C. Mu$Cteanu, M. Zahariade u. D. Elefterescu, Studii ~i materiale de muzeografie ~i istorie militarä 13, 1980, 96- 101 und zuletzt Zahariade (Anm. 11) 59· 61 Abb. 2.
132 Ziegel von Bauvexillationen unter Zenturien der Prinzipatszeit: CIL lll 14215, 4 [ = Sa· xer (Anm. 75) 92 Nr. 270 f.; Sarnowski (Anm. 9) 33 m. Anm. 87 Taf. VIII 28 Abb. 22, 15. zum historischen Kontext dieser chersonesischen Vexillationen Sarnowski (Anm. 92) 858 f.
310 Karlheinz Dietz
Disposition stand,133
zum anderen, weil diese sowohl die Verbindungslinien nach Italien aufrechtzuhalten134 als auch den Grenzeinzug nach Süden entlang der lller quasi als pars media zu überwachen hatte.135 Davon abgesehen erweist sich der Zusammenstand von cohortis quintae mit parteslpedaturae legionum als Regel· befund. Hätte nun jede pars - wie bei einer Zweiteilung der Legionen zu erwarten - automatisch aus fünf Kohorten bestanden, wäre die Phrase cohortium quinque partis!pedaturae ( ... )in ihrem letzten Teil pleonastisch. Dieser Umstand schwin· det, sobald man, die Vorstellung von Halblegionen endgültig ad acta legend, von einem im obigen Sinn (S. 302) modifizierten Kohortenbegriff ausgeht. In diesem Fall waren cohort. V und parslpedatura nicht mehr verschiedene begriffliche Umschreibungen ein und desselben Sachverhalts, weil es - zumindest theoretisch -sowohl mehrere cohortes quinque als auch cohortes quintae innerhalb eines Le· gionsabschnitts gegeben haben konnte. Da aber nun geschlossene Unterverbände in Form von cohortes quinque ihr Dasein einzig und allein einer inzwischen obsoleten Konjektur verdanken, wird man auf die überlieferte Wendung cohortis quintae zurückgeworfen. Ihre gleichsam formelhafte Verbindung mit dem parsl pedatura-Begriff in der Notitia zwänge freilich zur Annahme, daß irgendwann die Überwachung der parteslpedaturae jeweils nur Legionskohorten mit der Ordinalzahl fünf anvertraut wurden,136
- und dies ist ein so abwegiger Gedanke, daß man nach einer ganz anderen, plausibleren Lösung Ausschau halten muß.
Wie längst erkannt, resultieren die vielen Fehler, Nachlässigkeiten und Mißver· ständnisse der Notitia u. a. aus den zahlreichen Kürzungen im Archetyp, welche die Abschreiberteilweise mißdeutet haben.137 Wie schwierig solche mit 'Notae an-
133 Allgemein rechnet man (Hoffmann [Anm. 89] I 225 f. m. Anm. 156) mit einer zwei· ten, der lll Hercu/ea; leise Zweifel meinerseits in: Regensburg zur Römerzeit. Regensburg 21979, 133 f.
134 Van Berchem (Anm. 7) 101m. Anm. 6; Mommsen (Anm. 4) 223 Anm. 2. 135 Ebd. 99 zu praetendens. Dazu Speidei (Anm. 89) 219 f. 136 Der Löwenanteil der 5. Kohorte in der Bauvexillation aus Montana vom Jahr 155 (C1L
111 7449 = E. Schallmayer u. a., Der römische Weihebezirk von Osterburken. I. Corpus der griechischen und lateinischen Reneficiarier-Inschriften des Römischen Reiches. Stutt· gart 1991, 495 f. Nr. 643; ergänzend N.B. Rankov, in: A.G. Poulter [Hrsg.], Ancient Bulgaria. II. Nottingham 1983, 52- 54) kann ebensowenig Anlaß zu Spekulationen sein wie das quin· que auf CIL 111 14203, 40 add. AE 1952, 231 (dazu die Ergänzung bei Hoffmann [Anm. 89] II 28 Anm. 202; vgl. 89 Anm. 199); ganz unklar ist das V in CIL XIII 6935.
137 Z. 8. 0. Seeck in seiner Edition (Berlin 1876) S. XII; Mommsen (Anm. 4) usw. Zur handschriftlichen Überlieferung der Notitia Clemente (Anm. 11) 26- 44; außerdem beson· ders I.G. Maier, Latomus 27, 1968, 96- 141 und ebd. 28, 1969, 960- 1035; Ders., Studies in the Textual Transmission of the Notitia dignitatum. Diss. Melbourne (Microfilm) 1975 (non vidi); ferner J.J.G. Alexander, in: R. Goodburn u. P. Bartholomew (Hrsg.), Aspects of the Notitia Dignitatum. Oxford 1976, 11 · 49; P.C. Berger, The lnsignia of the Notitia Dignita· turn. New York u. London 1981, 1 - 23; R. Grigg, JRS 69, 1979, 107 - 123; ebd. 73, 1983, 132 -142 und Latomus 46, 1987,204 - 210; gegen ihn erweist jetzt M.P. Speidel, SJ 45, 1990; 69-71 die Schildinsignien als offizielle Embleme. Eine Forschungsgeschichte zur Notitia gibt zu-
Zur Entwicklung der Gren~legionen in der Spätantike 311
tiquae' durchsetzten Texte unter Umständen zu lesen waren, läßt sich etwa gut an dem, in den Details selbstredend ganz anders gelagerten, Beispiel der constitutio Iuliani de postulando studieren.138 Das wiederholte Verbot dieser Abbreviaturen seitens der Kaiser Theodosius II. und Justinian I. beweisen deren Verwirrung stif· tendes Unwesen ebenso wie ihre Zählebigkeit.139 Das Unheillag in den mitunter erheblichen Suspensionskürzungen, die ganze Worte auf die Anfangsbuchstaben reduzierten (litterae_ singulares) oder die ersten Lettern der Silben aneinanderreih· ten und ihr Kürzel durch Über- oder Durchstreichungen, folgende Punkte etc. kenntlich machten.140 Einen Eindruck vom Zustand des Originals zu gewinnen, ist kaum mehr möglich, da die in Seecks kritischem Apparat auffindbaren und er· wähnten Campendien nur die spätere handschriftliche Überlieferung beleuchten.141 Der einstigen Realität näher stehen die Stereotypen der Kodizille und Mandate wie:142 FL I INTALL I COMORD I PR (mit Überstreichungen) für F(e)l(iciter!) oder Fl(orea) int(er) all(ectos) com(es) ord(inis) pr(imi) usw. Auf teil· weise extreme Suspensionen könnte in unserem Zusammenhang z. B. das Ausfal· Jen von ripae (or. 39, 31; 40, 34) oder legionis (occ. 32, 45; 34, 37) zurückgehen.
143
Vor diesem Hintergrund verdient Beachtung die in Not. Dign., occ. 33, 54 (Prae· fectus legionis secundae Adiutricis tertiae partis superioris, Acinco) von 0. Seeck einfach eliminierte Korrupte! tertiae, die zwischen dem Legionsnamen und dem Genitiv partis an eben der Stelle des sonst üblichen cohortis quintae steht und daher - wie T. Nagy erkannt hat144
- aus dieser Phrase zu erklären ist. Folglich
Ietzt Zahariade (Anm. 11) 21 - 27; dazu ergänzend W. Seibt, MI<EG 90, 1982, 339- 346; C.l Simpson, RBPh 66, 1988, 80- 85; R. Scharf, Historia 39, 1990, 461- 474 und ZPE 89, 1991, 265 - 272; N. Hodgsoo, in: Maxfield u. Dobson (Anm. 72) 84 - 92; K.L. Noethlichs, in: RlAC XV (1991) 1111-1158; vgl. noch oben Anm. 1 und 11.
131 B. Bisehoff u. D. Nörr, Eine unbekannte Konstitution Kaiser Julians (c. luliani de po· stulando). München 1963.
139 Bischoff, in: Bisehoff u. Nörr (Anm. 138) 12 f.; allgemein auch B. 8ischoff, Paläogra· phie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. 8erlin 1979, 193 m. Anm.8.
140 Der Sachverhalt erlaubt eine blühende Konjek\Uralkritik: z. 8. R-G. 8öhm, Ge·
riön 7, 1989, 83 - 93. - Zu Suspension und Kontraktion knapp Weinberger, in: RE XI 2 (1922) 2226 f.; außerdem 8ischoff, Paläographie (Anm. 139) 132 · 135; 0. Maul, Lehrbuch der Handschriftenkunde. Wiesbaden 1986, 140 f.; vgl. auch noch U. Hälva·Nyberg, Die Kontraktionen auf den lateinischen Inschriften Roms und Afrikas. He1sinki 1988. Generell zu antiken Abbreviaturen W. Clarysse, AncSoc 21, 1990, 33 - 44.
141 Die verschiedenen Kürzungen der handschriftlichen Überlieferungen (u. a. trib. co·
hort; z. B. occ. 32, 57 ff.; 33, 59 ff.; 40, 30 ff.) besagen für das Original nichts, vgl. z. 8. Mai· er (Anm. 137) 1968, 115 - 119: simi/iter (G) - simi(/i)t(e)r (c) - s(i)m(i/i)t(e)r (1), aber sp(ectabi· lis) u(iri) (0)- spcctabilis uiri (c)- sp(ectab)il(is) uiri (1). Vgl. etwa die Kürzung von praeposi· tus als pp., prep, pptus, praep., praepos. or. 9, 1; 13, 10; occ. 11, 23 ff.; 75 ff.; 25, 22 ff.; 28, 14 ff. u. 20 ff. 142 Dazu z. 8. Berger (Anm. 137) 191 - 195.
143 Nagy (Anm. 11) 187 wollte sogar den Wechsel von pedatura (gekürzt z. 8. Not. Dign.
or. 39, 31) und pars so erklären. 144 Nagy (Anm. 11) 188 schätzte das Problem um tertiae richtig ein, nahm aber an; von
312 Karlheinz Dietz
ist eine in der Vorlage vom Kopisten offenbar regelmäßig mißdeutete Abbreviatur zu finden, die als cohortis quintae und unter bestimmten (ungünstigen) Bedingun· gen als tertiae (= 111) aufgefaßt werden konnte, die tatsächlich aber eine dritte, im gegebenen Zusammenhang sinnfällige Bedeutung hatte. Das von Mommsen ange· nommene coh. V erfüllt diese Voraussetzungen offenbar nicht ganz. Weiterfüh· rend ist die Feststellung, daß ein überstrichenes V außer einer Zahl auch die Sus· pension eines Wortes145 oder einer Silbe anzeigen konnte. Davon ausgehend er· scheint die Annahme einer unfesten Note wie CHTV für c(o)h{or)t(i)u(m) sachlich und paläographisch gleichermaßen zufriedenstellend.146 Im wesentlichen handelte es sich dabei um die syllabare Suspension CH für cohors, wie sie z. B. auf ln· schriften (neben CHO, CHOR gut) bezeugt ist,147 erweitert um den oder die An· fangsbuchstaben des jeweiligen Casus obliquus. Ein sachlich wenig bedarfter, an die regelmäßige Abfolge von eh (= cohors) und überstrichener Ordinalzahl ge· wöhnter Kopist konnte leicht in die Irre geführt werden, und war der Fehler erst einmal gemacht, unterlief er die weiteren Male wie von selbst. Mit der erklärbaren Ausnahme eben occ. 33, 54, wo offenbar CIS von Adiutricis mit einem undeutli· eben CH zur Haplographie führte und der Rest TV (mit Überstreichung am Ende) als 111 verlesen wurde. Paläographisch war dies m. E. in der Jüngeren Römischen Kursive, aber wohl auch in der Unzialschrift möglich.148
coh. V sei ((wohl nur die zweite Hasta des Buchstaben h und die etwas schräg gezogenen bei· den Linien der Zahl "fünf" zu entnehmen [gewesen]. Diese drei annähern vertikalen Linien mag der Abschreiber für die Zahl "drei" gehalten haben ... »
145 Überstrichenes V = vel (W.M. Lindsay, Notae latinae. Cambridge 1915, 311; XVI) schei· det hier natürlich aus sachlichen Gründeo aus; dasselbe gilt für die zahlreichen antiken und mittelalterlichen Abkürzungen von V: eine Obersicht bei A. Capelli, Diziooario di Abbrevia· ture latine ed italiane. ND der 6. Auflage Mailand 1967, 364 f.; 509. Danach (ebd. 509; vgl. 418) konnte überstrichenes V im Altertum quinque milia oder quintum bedeuten.
146 Weil wir die Schrift des Archetyps nicht kennen (unten Anm. 148), ist natürlich letzte Sicherheit über den ursprünglichen Text nicht mehr erreichbar; unabhängig von der paläo· grajlhischen Problematik der Lösung bleibt ihr sachlicher Gehalt zwingend. - Zu 'unfesten Noten' etwa Bischoff, Paläographie (Anm. 139) 193.
147 1LS 1111, S. 758; Inschriften wurden nicht selten nach handschriftlichen Vorlagen ange· fertigt, siehe jetzt wieder G. Alföldy, ZPE 87,1991, 168- 172.
148 R. Seider, Paläographie der lateinischen Papyri. II 2. Stuttgart 1981, Taf. X etwa zeigt, wie sehr selbst unziales V auseinanderfließen kann. Generell zu den in Frage stehenden Schriften Bischoff, Paläographie (Anm. 139) 80 - 92; Mazal (Anm. 140) 85 - 90; 266 f. - Si· eherheil über die Schrift des Archetyps gibt es nicht. Trotz der Vermutung Nagys (a.a.O. [Anm. 11) 188), er sei unzial, die ersten Abschriften semi-unzial geschrieben gewesen, hat etwa S. Soproni, Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Buda· pest 1978, 168 die ältere römische Kursive in Betracht gezogen; litterae caelestes (dazu Bi· schoff, Paläographie [Anm. 139) 83 m. Anm. 74) sind aber schwerlich anzunehmen. Außer· dem wissen wir natürlich nicht, ob der Fehler bereits im Original stand.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike · 313
VIII
Gleichsam eine Probe aufs Exempel für die Haltbarkeit der vorgetragenen Hypo· these zur Notitia Dignitatum ist die Betrachtung der (ihrerseits natürlich strittigen) Verhältnisse im Dukat Valeria: Not. Dign., occ. 33 nach Seeck: 52: Praejectus legionis secundae Adiutricis cohortis (quintae) partis
superioris, Aliscae. 53: Praejectt~s legionis secundae Adiutricis cohortis (quintae) partis
iriferioris, Florentiae. 54: Praefectus legionis secundae Adiutricis ltertiael partis superioris, Acinco. 55: Praefectus legionis secundae Adiutricis, in castello contra Tautantum.149
56: Praejectus legionis secundae Adiutricis, Cirpi. 51 P ,,r. I . . d Ad" . . L . 150 : raeJectus egronrs secun ae rutrrcrs, ussomo.
Folgte man T. Nagy, so hätte die legio ll Adiutrix in der Spätantike nur aus zwei Abteilungen bestanden, die innerhalb der wenigen Jahrzehnte von Konstantin bis Valentinian I. zweimal ihre Standorte gewechselt haben müßten.151 Gemäß die· sem - völlig vom Gedanken der Zweiteilung getragenen152
- Erklärungsversuch böte die Notitia eine Überlagerung von drei (Phase I: 54155 - Phase II: 52/53 -Phase 111: 56151) Zeitschichten. Ihm wurde von Anfang an heftig und mit guten Gründen widersprochen, und heute plädiert man in der Regel für das Vorliegen ei· ner - im späten 4. Jahrhundert gültigen - Momentaufnahme. 153 Daran ist festzu· halten, solange der Nachweis unterschiedlicher Zeitebenen nicht geglückt ist.
Wie in Moesia Secunda und Scythia haben wir in Valeria scheinbar praejecti legionis (55 - 57) neben praefecti legionis cohortis quintae (scil. cohortiu(m)) pedaturaelpartis ( ... )(52- 54). Wie so oft trügt der Schein, weil die Analogie nur
149 Soproni (Anm. 146) 171 f. plädiert auf Verschreibung von contra Constantiam; vgl. S.
Soproni, Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. München 1985, 78; ohne ldentifi· kationsversuch Brennan (Anm. 39) 558 f.
150 Nach Brennan (Anm. 39) 558 m. Anm. 19 standen wohl auch in Transaquincum (Not. Dign., occ. 33, 65: Praefectus legionis, Transiacinco) Detachments, und zwar der Öeiden Le· gionen der Valeria; anders Soproni (Anm. 146) 78, der nur eine Abteilung der legio 11 Adiu· trix annimmt. Vgl. noch E. T6th, AArchSiov 33, 1982, 68 - 78.
tst Nagy (Anm. 11) 183 - 194. Einen knappen Überblick über die Forschung bietet Forni (Anm. 44) 1256; ausführlicher die unten Anm. 153 genannte Literatur.
1s2 Nagy (Anm. 11) 185: Mommsen habe scharfsinnig zu coh(ortium) quinque aufgelöst: «Aber es entging der Aufmerksamkeit des Begründers der spätkaiserzeitlichen Militärge· schichte, dass in dem valerischen Ducalus ebenso paarweise die Eintragungen über die legio II adi. zusammengehören, wie in den Fällen von Pannonia II, Scythia und Moesia II, in denen die Notitia stellenweise noch die Militärbezirke der konstantinischen Zeit bewahrt hatte.~)
153Virady (Anm. 11) 333- 396; Soproni (Anm. 148) 156- 168, bes. 164 - 166, der für eine
einheitliche Liste plädiert; vgl. Dens., Jahrzehnte (Anm. 149) 54- 79.
314 Karlheinz Dietz
für die letztgenannten Amtsträger gilt. Daß diese wie in den beiden unter· mösischen Dukaten auch in Valeria genau genommen praefecti ripae legionis waren, dürfen wir mit großer Zuversicht der Tatsache entnehmen, daß gleichfalls nur in Scythia und Moesia secunda von praefecti ripae legionis cohortis quintae (seit. cohorti(um)) pedaturae ( ... ) die Rede ist und nur dort die Legionen in der Überschrift als riparienses gekennzeichnet sind (or. 39, 28 und 40, 29). Offenbar liegt ein anderer, präziserer Sprachgebrauch für ein und dieselbe Sache vor. Die praefecti legionis der Valeria ohne den titularen Zusatz cohortis quintae (seit. co· hortiu(m)) partis ( ... ) sind dagegen gewiß nicht mit den praefecti legionis in Moesia secunda und Scythia vergleichbar, weil es unmöglich bei einer Legion gleichzeitig drei Kommandanten gegeben haben kann und weil in Valeria die Le· gionspräfekten ihre Standorte nicht - wie es angeblich am untersten Lauf der Do· nau der Fall war (oben Anm. 95) - mit je einem der Uferpräfekten teilten. Da zu· dem der für das alte Hauptquartier Aquincum zuständige praefectus legionis ( ... ) cohortis quintae (seit. cohortiu(m)) partis ( ... ) kaum einen geringeren Rang hatte als jeder der drei "reinen" praefecti legionis, liegt deren Einträgen wohl ein noch ungenauerer Sprachgebrauch für den praejectus ripae legionis cohortium peda· ,turae ( ... ) zugrunde. Vermutlich wurden die unterdrückten Thile im Laufe der Zeit entbehrbar oder gar unverständlich. Bis zu welchem Ausmaß (auch) im Kapitel über den Dux Valeriae Vergröberungen vorliegen, veranschaulicht der lakonische Eintrag Praefectus legionis, Trans[i]acinco (occ. 33, 65), der zumindest zu legio· nis (secundae Adiutricis) oder - sofern Brennans Parallelisierung mit Transbono· nia zutrifft154
- sogar zu legionis (primae et secundae Adiutricis) zu erweitern ist. Insgesamt werden also im Dukat Valeria zu einem bestimmten Zeitpunkt (im letzten Drittel des 4. JAhrhunderts?) mindestens sechs gleichberechtigte Uferprä· fekturen existiert haben, wovon eine im alten Standlager kampierte. Mithin haben wir Not. Dign., occ. 33 zu lesen:
52: Praefectus legionis secundae Adiutricis cohortiu(m) partis superioris, Aliscae.
53: Praefectu.s legionis secundae Adiutricis cohortis (?) partis inf~rioris,
Florentiae. 54: Praejectus legionis secundae Adiutricis [cohortiu(m)J partis superioris,
Acinco. 55: Praefectus legionis secundae Adiutricis [cohortiu(m) partis superioris], in
castello contra Tautantum. 56: Praejectus legionis secundae Adiutricis [cohortiu(m) partis superioris],
Cirpi. 57: Praejectus legionis secundae Adiutricis [cohortiu(m) partis superioris],
Lussonio.
154 Oben Anm. 150.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 315
Vergleichbares zeichnet sich für die Legionen Uferdakiens ab, deren Geschichte -
wie wir gesehen haben - zumindest anfangs keineswegs exzeptionell verlief. Laut Notitia hätte es in diesem Dukat ausschließlich praefecti legionis (fünf bzw. vier) gegeben, wovon jeweils einer im alten Hauptquartier (Ratiaria bzw. Oescus) kam· pierte. Besonders erhellend wird erneut der Befund für die legio V Macedonica. Zunächst der überlieferte Eintrag von Not. Dign .• or. 42:
31 Praejectus legionis quintae Macedonicae, Varinialnal. 32 Praefectus legionis quintae Macedonicae, Cebro. 33 Praefectus legionis quintae Macedonicae, Oesco. 39 Praefectus legionis quintae Macedonicae, Sucidava.
Dies ist jetzt zu verstehen als: 31 Praejectus legionis quintae Macedonicae [cohortiu(m) partis superioris],
Varinialna!. 32 Praejectus legionis quintae Macedonicae [cohortiu(m) partis superioris],
Cebro. 33 Praefectus legionis quintae Macedonicae [cohortiu(m) partis superioris
(?)], Oesco. 39 Praejectus legionis quintae Macedonicae, [cohortiu(m) partis superioris
(?)], Sucidava.
Die Ziegelstempel bieten derzeit folgende, natürlich lückenhafte typologische Reihe an:
Phase 1:
LVM - Fundorte oben in Anm. 38.
Phase II: LEGVMCI usw. [3]- [13]- (a) Bukarest (Museum). - (b) Ratiaria (Arcar). - (c) Ro·
rriul~anum (Gamzigrad). - (d) Sucidava (Celei). - (e) Vraca (Museum).
Phase 111:
[36) LVMOES (auch LEGVMOES)- l(egio) V M(acedonica) Oes(co).- (a) Besli bei Gigen. - (b) Oescus (Gigen). - (c) Pliska. - (d) Romulianum (Gamzigrad). - (e) Sucidava (Celei).
[37] LVMVAR - l(egio) V M(acedonica) Var(inia). - (a) Orlea. - (b) Sucidava (Ce· Iei).- (c) Varinia (Leskovec).
Phase IV:
[38] PRLVM - pr(aefectus?) l(egionis) V M(acedonicae). - Oescus (Gigen). [39] PRELVM - pr(a)e(fectus?) l(egionis) V M(acedonicae). - Oescus (Gigen).
316 Karlheinz Dietz
[ 40] PRLVMOES - p(raepositus) r(ipae) l(egionis) V M(acedonicae) Oes(co). - (a) Bononia (Vidin).- (b) Oescus (Gigen).- (c) Romulianum (Gamzigrad).
[41] PRLVMVAL- p(raepositus) r(ipae) l(egionis) V M(acedonicae) Val(eriana).Oescus (Gigen).
[42] PRLVMVTO - p(raepositus) r(ipae) l(egionis) V M(acedonicae) Uto. -Oescus (Gigen).
Phase V:
[43] PROES- p(raepositus) r(ipae) Oes(co).- Oescus (Gigen). [ 44) PR VAR - p(raepositus) r(ipae) Var(inia). - Pliska.
Phase VI:
[45) PPRIPVAR bzw. PRRIPVAR- p(rae)p(ositus) rip(ae) Var(inia) bzw. pr(aepo·
situs) rip(ae) Var(inia). - (a) Golemanovo Kaie. - (b) Oescus (Gigen). - (c) Plis· ka. - (d) Romulianum (Gamzigrad).
Eine absolute zeitliche Schichtung fällt schwer, doch ist zumindest Phase III konstantinisch, während die Phasen V/VI schwerlich in die Zeit vor Valentinian I. gehören werden.155 Dabei ist ausdrücklich zu betonen, daß in den drei letzten Phasen die Legionspräpositen, die man vornehmer auch als Präfekten bezeichnen konnte, selbst als Auftraggeber genannt werden; da diese auch in der Notitia verzeichnet sind, ist jetzt ein Vergleich beider Quellengattungen mit weniger Problemen behaftet als ehedem.
Im übrigen muß man kein Prophet sein, um für Phase IV einen Stempel PRLVMVAR - p(raepositus) r(ipae) l(egionis) V M(acedonicae) Var(iana) vorher· zusagen. Zu dieser Zeit - wohl um die oder kurz vor der Mitte des 4. Jahrhun· derts - könnte neben mindestens vier Arbeits- und Wachdetachements (in Varinia, Va.Ieriana, Oescus und Utum) noch ein übergeordneter Präfekt existiert haben [38; 39), doch ist dies durchaus nicht sicher. Nimmt man den Eintrag der Notitia hin· zu, so muß es in Uferdakien irgendwann wie in Valeria mindestens sechs Ufer· kommandanten gegeben haben, d. h. wir haben für die spätantike legio V Mace· donica sogar mit acht Teilen zu rechnen.156 Freilich wissen wir nicht, ob diese wirklich alle gleichzeitig existiert haben, und es ist immerhin bemerkenswert, daß
155 Sarnowskis Datierungsversuch a.a.O. (Anm. 8) ist grundelegend und im wesentlichen überzeugend (siehe besonders die Tabelle 119), bedarf aber speziell hinsichtlich der bulgari· sehen Funde und der Ortsnamenstempel einiger Korrekturen, die ich an anderer Stelle vor· nehme (dort auch die hier aus Raumgründen entfallenden Belege). Vorläufig K. Dietz, Zum Ziegelstempel von Golemanovo Kaie. In: S. Uenze (Hrsg.), Die spätantiken Befestigungen von Sadovec (Bulgarien). (Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 43) Mün· eben 1992, 355 - 358. •
156 Mommsen (Anm. 4) 225 Anm. I rechnete noch mit sechs.
Zur Entwicklung der Gren(,legionen in der Spätantike 317
das an Ziegelstempel reich gesegnete Sucidava bis dato noch keine Marke der laut Notitia dort angesiedelten Einheit hervorgebracht hat. Das mag Zufall sein, könnte aber auch von spezifischen, mit der Zeit wechselnden Einsatzbereichen der Detachements herrühren. Nach dem momentanen Stand der Dinge hat es jedenfalls den Anschein, als wäre die Abteilung in Varinia zunehmend zur bevorzugten Bauund Ziegeltruppe geworden. Freilich ist der der-Zeitige Befund nicht über die Maßen zu strapazieren, zumal manche Stempel bislang nur in einem einzigen Ex· emplar vorliegen.157 Durchaus sicher und allg~mein bedeutsam ist indessen die Be· obachtung, daß die Notitia die Vemältnisse am unteren Donaulauf sehr lückenhaft und verderbt wiedergibt. Natürlich ist dies nicht grundsätzlich neu. Wir sehen aber die Lücken klarer, weil wir jetzt wissen, daß die lokalen Legionsziegeleien als Be· standteile und damit als Indikatoren sich etablierender oder bereits etablierter Ufer· präposituren gelten dürfen. Damit können wir solche - und sei es nur vorüberge· hend- überall dort vermuten, wo wir, wie im Falle von Valeriana und Utum, bis· lang ausschließlich ein ziegelndes Legionsdetachement nachweisen können, wie et· wa Taliata (Veliki Gradac bei Donji Milanovac) für die legio VII Claudia158 in Moesia prima oder Candidiana (Malak Preslavec) für die legio XI Claudia159 in Moesia secunda.
Aus dem bisher Gesagten folgt, daß die Zersplitterung der Grenzlegionen weitreichender gewesen sein muß als das "Staatshandbuch" suggeriert, daß diese aber kaum uno acto erfolgte, sondern als Begleiterscheinung übermäßiger Bauakti· vität prozessual vor sich ging, einerseits einheitlicher, andererseits nach anderen Prinzipien als die bisherige Forschung annahm.
157 Ein weiterer merkwürdiger Beleg dieses Verbandes findet sich bei Toropu u. Tälutea
(Anm. 8) 104 Abb. 26, 6: [--]VARVAR, was die Autoren als Var(inia) Var(inia) deuten. Dies findet in IGLR 291 (= Toropu u. Tälutea 104 Abb. 26, 7) keine Analogie, da diese Halbkursi· ve keineswegs - bei Annahme eines zweifachen Schreibrichtungswechsel • als (Var]ina I [V)arin(a), sondern linksläufig als VNI(·-] 1 NIRV[--] zu lesen ist. Eine scheinbar erwägens· werte Lesung[-- RIP]VAR VAR(inia) ist gleichfalls zu verwerfen, da es ein Adjektiv ripuari· us im antiken Latein nicht gegeben hat. A. Souter, A Glossary of Later Latin to 600 A. 0. Oxford 1949, 357 verzeichnet nur ripanus (CIL V1 2579) und ripariolus (Marcell. med. 15, 34; vermutlich auch Iord. Get 36, 191 = MGH AA V 108). Tatsächlich stammen die frühesten Benennungen für die (fränkischen) Ripuarii oder besser Ribuarii bzw. für die Ribuaria aus dem 8. Jahrhundert: E. Ewig, Spätantikes und fränkisches Gallien. I. Zürich u. München 1976, 480 ff.; bes. 491 ff.; vgl. 4SO; E. Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. München 1970, 31 f. Dabei könnte es sich um ein mit der ripa Rheni irgend· wie zusammenhängendes «merowingisches Lehnwort» handeln, das ·«urtzweifelhaft» das germanische Suffix -varii enthält (Ewig a.a.O. 482 Anm. 44) und daher auf donauländi· sehen Ziegelstempeln der Römer unwahrscheinlich ist. Ich schlage daher versuchsweise vor, unter Bezugnahme auf IGLR 289 A zu ergänzen: (DAL(matae)] VAR(inianac) VAR(inia).
l$1 LEG VII CL TA(Iiata) z. B. in Taliata (Veliki Gradac bei Donji Milanovac): CIL 111 13814.
159 LEG XI CL F CAND(idiana) z. B. CIL 111 12527 (vgl. 7619 b); Weiteres in der obe~
Anm. 131 genannten Li~eratur. Unklar ist LEG XIII GE TADI: ~uletzt IDR 111 4, 1. - Die von
318 Karlheinz Dietz
IX
Der Titel praejectus ripae legionis ( ... ) cohortiu(m) pedaturaelpartis ( ... ), wie er gemäß dem Eintrag des untersten Donaudukats vollständig lautete, wäre nach dem älteren Sprachgebrauch zweifellos als praejectus ripae legionis ( ... ) vexillationis pedaturaelpartis ( ... ) wiederzugeben gewesen, d. h. durch die Erwähnung der co· hartes (oder der cohors, denn auch dieser an mehreren Stellen der Notitia bezeugte Singular160 ist eventuell zu halten) wird der Verband als Detachement alter Art gekennzeichnet. Ist daran schon wegen der oben angesprochenen Möglichkeit synekdochischer Verwendung von cohors nichts Außergewöhnliches, so noch weniger, da doch der Begriff vexillatio seit Gallienus immer mehr zur schließlich technischen Benennung der Kavallerieeinheiten des Feldheeres wurde und unter Konstantin für die Legionsabteilungen im Grenzheer völlig außer Gebrauch kam.161 Aber ~uch sonst ist an dem Titel nichts, was größere Reformen im Sinne eines Bruches mit der bisher üblichen Praxis voraussetzen würde.
Die offenkundig synonym gebrauchten Begriffe pedatura und pars, die noch R. Egger als Substitute für vexillatio betrachtet hatte/62 kennzeichneten dynamische Teilungen, wobei der erstgenannte, vermutlich ursprünglichere, einen "nach den Fußmaßen bestimmten Raum" (Georges), im Militärbereich vor allem einen entsprechend bemessenen Bauabschnitt ansprach.163 Demgemäß wurde laut Vegetius bei der Errichtung des Standlagers den einzelnen Zenturien von ihren Vorgesetzten je eine pedatura als Bausoll zugewiesen.164 Die Inschriften bestätigen diesen Usus grundsätzlich für den Prinzipat ebenso16s wie für die Spät-
Sarnowski mit den Legionen verbundenen Ortsnamenstempel gehören m. E. in einen anderen Zusammenhang, vgl. oben Anm. 155.
160 Not. Dign.,or. 39, 35; occ. 33, 52 und 34, 26.
161 Einer der frühesten Belege für die vexillatio neuer Art: CIL XI 6168 (= ILS 9075 =
ILCV ·449); dazu jetzt M.P. Speidel, Latomus 46, 1987, 377 f. (auf comites imperatoris = Nachfolger der equites singulares Augusti bezogen). Vexillario im gewohnten Sinne aber noch 315/316 und 322/323 unter ein und demselben Präpositus: ILS 8882; AE 1900, 29 = SB 4223. Siehe noch W. Enßlin, Aegyptus 32, 1952, 164 - 167; Saxer (Anm. 75) 125; Hoffmann (Anm. 89) I 3; 231; 244; Speidei (Anm. 74) 136- 138.
162 Egger (Anm. 11) 182 f., der sogar deputatus für den alten Vexillationsbegriff einsetzt. Varady (Anm. 11) 368 spricht dagegen von der «archaic expression "pedatura"».
163 Vgl. W. Barthel, ORL B Nr. 8, 107 f. - Verwendung fand der Begriff auch im Grabrecht (z. B. CIL VI 8857 b; 10235; 13539; 15163; llt X 5, 3, 1086 und dazu : A. Garzetti, Epigraphica 35, 1973, 104 unter Hinweis auf L. Zancan, Area sepolcrale "pro indiviso" e "pedatura partita inter amicos". SG 10, 1924, 27 • 33) und im Bereich der Feldvermessung (Fron· tin., grom. I p. 16 Thulin; V. Gerasimova-Tomava, lzvestija na Narodnija Muzei Sumen 6, 1973, 219- 234 = AE 1975, 763: auf die diokletianischen Agrarreformen bezogen).
164 Mit. 3, 8: ... singulae centuriae, dividentibus campidoctoribus et principiis, accipiunt
pedaturas; Vegetius verwendet 2, 7 und 3, 18 das griechische Äquivalent podismos. • 165
CIL XIII 6548 (= ORL B Nr. 42, 18 Nr. I); 7613 (dazu D. Baatz, Germania 67, 1989, 176) u. 7613 a add. 4, S. 130 (= ILS 9183 a u. b = ORL B Nr. 8, 107 Nr. 3 a u. b); CIL VII 864;
Zur Entwicklung der Grenvegionen in der Spätantike 319
antike,166 und selbst in justinianischer Zeit hatte er noch Gültigkeit.167
Selbst· verständlich war auch der Zusammenhang von Legionsvexillalianen und pedaturae gewöhnlich.168 Allerdings hatten diese "Arbeitsstrecke(n) an einem Bau"169 mit dem pedatura-Begriff der Notitia hauptsächlich den Namen gemein.170 Denn letz· terer war räumlich und inhaltlich gewiß ungleich umfassender. Einerseits wird pe· daturalpars - wie in frühbyzantini~cher Zeit üblich - auch einen Wachabschnitt bezeichnet haben,171 andererseits war sie territoriallimitiert und selbst wieder teil·
948; 970 = RIB I 1944; 2053; 1945; vgl. 1629 und die zahlreichen möglichen Belege von den Wällen des 2. Jh.s bei R. Goodbum u. H. Waugh, RIB I. lnscriptions on Stone. Epigraphic In· dexes. Gloucester 1983, 107; dazu Saxer (Anm. 75) 66 - 68.
166 CIL XIII 4139: Pedatura (f]e/iciter 1 finit Prim[a)norum I D p(edes) und CIL XIII 4140: Pedaturfa Pri)manis fe/(iciter) (fin(it)) I qui fecerunt D [pJ. Seide Zeugnisse abgebil· det bei K.-J. Gilles, in: Trier: Kaiserresidenz und Bischofssitz. Mainz 2198,4, 288 - 291 m. Abb. 152 a u. b; dazu H. Heinen, li"ier und das Trevererland in römischer Zeit. Trier 1985, 290 • 292. - CIL XIII 5190 (abgebildet bei: G. Walser, Römische Inschriften in der Schweiz. lf. Bern 1980, 62 f. Nr. 139; Laupendorf): Pedat[ura] I Tungrec[anoJrum senio[rum) I succur(a) Au(..J I tribu[ni]. Vgl. noch Hoffmann li (Anm. 89) 152 f. Anm. 332.
167 IGLR 211 = AE 1922, 71 (vgl. u. a. zur Datierung Hoffmann (Anm. 89] I 438; 11 181 f. Anm. 75; Ulmetum): .dt Pedatura mili~um Lanciariujm iuniorum.
161 Neuerdings wird er ausdrücklich bestätigt durch eine im kyrenischen Ptolemais (Tol·
meita) gefundene Inschrift aus der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts (R.G. Goodchild u. J.M. Reynolds, PBSR 30, 1969, 39 • 41 = AE 1969/70, 639): Ped(atura) vexil(lationu; leg(ionis) I [J)JJ Aug(ustae) curante I Aur(elio) Muciano duc(e oder ·enario). Die Annahme, daß auch hier eine Zenturie am Werk war, ist wenig wahrscheinlich (Y. Le Bohec, La troisieme Iegion Auguste.'Paris 1989, 144; 46S f.); viel eher wird es sich um eine auf die bereits skizzierte Art zusammengestellte Bauvexillation gehandelt haben, deren Stärke freilich in etwa der einer centuria einer cohors quingerraria (oder einem· Vielfachen) entsprach. ln diese Richtung weist jetzt auch ein von M. Mirkovic publizierter Baustein aus Sirmium (siehe Anm. 88) im Verein mit den Altfunden aus der Stadtmauer von Salona: nach enterem baute nämlich die legio XIII Gem(ina) I p(edes) v(alli) c(entum), während in Salona 1800 Fuß (ca. 530 m) auf von einem Zenturio befehligte vexillationes leg. II Piae et lll Concordiae und die cohortes I und II milliariae Delmatarum so verteilt wurden, daß entere mitsammen 200 Fuß, letzte· re je 800 Fuß fertigstellten (zu CIL 111 1980 [= ILS 2287}; 8570 zu TextS. 1030; 1979 [= ILS 2616]; 6374 [= ILS 2617]; 8655 siebe die Literatur bei K. Dietz, Chiron 13, !983, 520 f. Anm. 125. Mirkovic a.a.O. 632 rechnet mit je 125 Arbeitern pro hundert Fuß.
169 So E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland
unter dem Prinzipal. Wien 1932, 218. 170
Daher unrichtig die Deutung bei Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinita· tis ... VI (1886) 243 im Hinblick auf die vermeintlichen cohortes quintae der Notitia: «ita ut pedatura, hoc loco sumatur pro eo podismo, qui bisce legionum cohortibus assignatus erat.» H. Mibäescu, RESE 6, 1968, 497 erklärt richtiger: «1. une mesure de pied, mesure prise avec le pas (noÖWJloc;); 2 un certain espace mesure avec le pied; 3. unite militaire de· stinee a surveiller une zone donnee.»
J7J Bei einer Belagerung Mauric., Strategikon 10, 3 (G:f. Dennis, CFHB 17. Wien 1981, 344, 32 ff.): Ei 5I öijJloc; !anv &v tfi noA.El, ö&ov KUKEivouc; OIJI.llli;w i:v tai<; toü TElXOO<; nEÖatoupcuc; mic; atpClnmtcuc;. Ähnlich Leo Taktic. 15, 56 (PG 107, 901); zu den "perime· ter guards" = o\ tiic; nEÖCltoi>pa.c; atpCln<iitw siebe Malal. 351, 8 (Bonn); Const. Porph.,
320 Kar/hein{. Diet{.
bar: Superior - inferior. In Rätien gab es mit der pars media sogar einen dritten Abschnitt: praejectus legionis tertiae ltalicae pro parte media praetendentis a Vimania Cassiliacum usque (occ. 35, 19).172 Zu einem unbekannten Zeitpunkt zer· fielen diese Unterabschnitte abermals in kleinere Einheiten, und zwar entlang der Flußgrenzen in ripae: praejectus legionis tertiae Italicae partis superioris depu· tata(e) ripae primae, Submontorio (occ. 35, 18).173
Offensichtlich ist in ripa prima und praefectus ripae der Begriff ripa nicht synonym verwendet, da er im ersten Fall für ein Teilstück des "Fiußlimes" (der natürlich nicht nur mit dem Flußbecken identisch war), im zweiten für diesen selbst steht. Dies berücksichtigend sind für das späte 3. und frühe 4. Jahrhundert wenigstens folgende Teilungsmöglichkeiten anzunehmen:
(a) ripa (z. B. Danuvii) (b) ripa provinciae illius (c) ripa = pedaturalpars legionis illius (d) pars superior (bzw. inferior etc.) pedaturaelpartis legionis illius (e) cohortes partis superioris (bzw. inferioris etc.) pedaturae/partis legio· nis illius (loco illo) = ripa prima (bzw. secunda etc.) pedaturalpartis supe· rioris (bzw. injerioris etc.) legionis illius.
Dabei stand (a) für die Reichsgrenze am Fluß, während (b) den jeweiligen An· teil einer Provinz markierte (der in der Spätantike etwa mit dem jeweiligen Duca· tus deckungsgleich war); (c) kennzeichnete den limitanen Bau- und Wachanteil ei· ner Legion, der seinerseits teilbar war (d); innerhalb der Unterabschnitte (d) gab es schließlich weitere Zuständigkeiten auf der Ebene von sich zunehmend verselb· ständigenden Detachements (e), die im engeren Sinne erneut als ripa bezeichnet werden konnten. Ihnen waren aus der Legion genommene praepositi vorgesetzt
Cer. 482, 8; 490, 4 = J.F. Haldon; Constantine Porphyrogenitus. Three Treatises on Imperial Military Expeditions (CHFB 28). Wien 1990, 122 (C 438); 133 (C 576 f.) und dazu J.F. Hai· don, Byzantine Praetorians: an Administrative, lnstitutional and Social Survey of the Opsiki· on and Tagmata, c. 580 • 900. Bonn 1984, 541 f.; vgl. Deos., Three Treatises a.a.O. 241.
172 Zurecht betont bei Mirkovic, IMS II S. 42. Inhaltlich zur Stelle J. Garbsch, in: Die Rö· mer in Schwaben. Jubiläumsausstellung 200 Jahre Augsburg. München 1985, 269.
173 Deputata(e) · überliefert ist einmütig deputata • ist auf legionis (so Seeck S. 329), und
nicht auf partis zu beziehen, wie Egger (Anm. 11) 183 Anm. 14 will. Deputatus in der Mi· litärspracbe (Not. Dign., or. 5, 67; 8, 54; 9, 49; occ. 40, 36) beim leider nicht besonders kla· ren centurio deputatus: CIL 111 7326; VI lllO; 3557; 3558 (" ILS 2669); 32415 (= ILS 4932); XI 1836 (= ILS 1332; 8. Dobson, Die Primipilares. Köln u. Bonn 1978, 306 · 308 Nr. 215); *36776; IGR 111 28 = ILS 8871 (Dobson ebd. 320 Nr. 229); vgl. Y. Le Bohec, L'armee ro· maine. Paris 1989, 46. ·Übrigens wird Ripa Prima Not. dign., occ. 35, 7 sogar wie ein Orts· name behandelt: vgl. Clemente (Anm. 11) 52.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 321
Auch darin entdeckt man mehr Tradition als Reform. Wiewohl die Zusammen· hänge von Altem und Neuern meist noch recht dunkel sind, scheint letzteres eher evolutionär entstanden zu sein. Jedenfalls sollte man sich angesichts allzu großer Überlieferungsdefizite hüten, die späteren Gegebenheiten ohne zwingenden Beweis als Ergebnis einschneidender Reformen zu betrachten. Die folgenden knappen An· deutungen sollen diesen Umstand illustrieren und zu weiterer Arbeit anregen.
Die Bezeichnung der Flußgrenze als ripa in Kontraposition zu Iimes = "Landli· mes" war schon Tacitus geläufig,174 und beide Begriffe konnten selbstverständlich das jeweils von den Römern beanspruchte Vorfeld und erst recht das Hinterland miteinbeziehen.17s In diesem Sinne hatte schon Commodus die gesamte Grenze der späteren Provinz Valeria von Aquincum bis Intereisa per omnem ripam befe·
. I 176 sttgen assen .. Auch praejecti ripae kannte die Prinzipatszeit,177 allerdings nicht im Rahmen
der Legionen; vielmehr waren diese - wie die ihnen verwandten praejecti orae maritimae118
- allesamt Angehörige des Ritterstandes und höheren Kommando·
174 G. Forni, 'Limes': nozioni e nomenc1ature. In: M. Sordi (Hrsg.), II confine ne1 mondo c1assico. Mailand 1987, 282; vgl. D.S. Potter, ZPE 88, 1991, 289 f. und auch B. lsaac, The 'Meaning of the Terms Limes and Limitanei. JRS 78, 1988, 125- 147, speziell128. Generell zur Vie1schicbtigkeit des Begriffs ripa J.F. Gilliam, Roman Army Papers. Amster· dam 1986, 31 - 33; vgl. für denZollE 0rsted, Roman Imperial Economy and Romanization. Kopenbagen 1985, 255- 274 und zur ripa Thraciae jetzt A. Lippold, Kommentar zur Vita Maximini Duo der Historia Augusta. Bonn 1991, 195 f.
17$ Die Flüsse waren (keineswegs starre) Trennlinien von Herrschaftszonen und Ein·
flußspbären wie u. a. jetzt wieder die wichtige Arbeit von E.L. Wbeeler, Rethink.ing the Up· per Euphrates Frontier: Wbere Was tbe Western Border of Armenia? ln: Maxfield u. Dob· son (Anm. 72) SOS • 511, bes. 505 m. Anm. 5 betont; außerdem U. Asche, Roms We1tberr· schaftsideeund Außenpolitik in der Spätantike im Spiegel der Panegyrici Latini. Bonn 1983, 32 f.; A. Papst, Quintus Aurelius Symmachus, Reden. Darmstadt 1989, 323 · 329; 8. lsaac, The Limits of Empire. The Roman Army in tbe East. Oxford 1990, 410 - 413. Dabei weisen die Begriffe Iimes und ripa • nicht erst seit dem 3. Jahrhundert (vgL aber Asche a.a.O. 34; 45 f. und Papst a.a.O. 324)- vorrangig auf die Grenz· und Verteidungszonen, und nur selten auf die Grenz- und Verteidigungslinien.
176 Die Belege bei Forni (Anm. 44) 1232; 1250 f.; vgl. Dietz (Anm. 168) 527 m. Anm. 167; 535.
177 Praejectus ripae Danuvii; PME A 166 add. S. 1445 f. und A. Suceveanu, AncSoc 22, 1991, 255 • 276 (vor 86); V 124 add. S. 1179 (vorflavisch); lnc. 64 (vorflavisch). • Praejectus ripae fluminis Euphratis: PME S 8 add. S. 1114 (70/92 n. Chr.). • Praefectus ripae Rheni: PME C 112 add. S. 1004 u. S. 1494 (ergänzend L. Schwinden u. 1 Krier, in: Trier. Augustus· stadtder Treverer. Mainz 21984, 251 f. Nr. 102 Abb. 102; Heinen (Anm. 166) 61 - 66); I 133 add. S. 1619 (vorflavisch). Natürlich findet man bei H. Devijver (Anm. 178) die Literatur zu diesep Ämtern gewissenhaft verzeichnet; zur Präfektur der ripa Danuvii noch K. Strobel, ZPE 71, 1988, 271 f. m. Anm. 109 und a.a.O. (Anm. 54) 17; 24; 127.
178 z. B. Praefectus orae maritimae: PME 1nc. 172 (1. Jh.). • Praefectus orae maritimae Hispaniae Citerioris: PME A 145 add. S. 1439 (Ende 1./Anfang 2. Jh.); 8 4 add. S. 1470 (~ v. Chr.); C 29 add. S. 1480 (SO/ISO n. Chr.); C 231 add. S. 1525 (Ende 1./Anfang 2. Jh.?); F 113 add. S. 1573 (70/120 n. Chr.); L 10 add. S. 1626 (flavisch); L 19 add. S. 1628 (flavisch); P 96
322 Karlheinz Dietz
stellen nachgeordnet Unmittelbar mit dem polizeilichen Schutz problembehafteter Randgebiete betraut, waren ihre Aufgaben territorial definiert und weniger örtlich fixiert als etwa die von Lagerkommandanten.179 Wie sie gleichermaßen zu Lande und Wasser tätig, aber doch ganz anders angelegt waren offenbar die seit dem frühen 3. Jahrhundert zur Überwachung des mittleren Euphratgebietes in Dura Eu· ropus stationierten duces ripae. Diese ritterlichen viri egregii unterstanden dem Legaten von Coele Syria und befehligten mittels untergeordneter Offiziere die flußauf- und -abwärts operierenden Detachements.180 Da wir ihre Kenntnis aus· schließlich den glücklichen Ausgrabungen in Dura verdanken und leider nichts über die territoriale Erstreckung ihres Wirkungsbereiches - schwerlich der ge· samte Euphrat181
- erfahren, wissen wir nicht, ob es sich bei ihnen wirklich um ei· ne singuläre Erscheinung handelte oder ob es Pendants gab. Ihre Bezeichnung im täglichen Umgang als dux, KplhtoToc; öovt; und b öovt; Titc; p&inTJ~ schließen solche jedenfalls nicht aus. Tatsächlich existierten Uferdistrikte am Euphrat offen· bar bereits erheblich früher. In das späte I. Jahrhundert datieren laut H. Seyrig drei einen gewissen Celesticus (?) betreffende Inschriften von der Agora in Palmyra, denen zufolge der Geehrte nach seinen Zenturionaten bei den Iegiones I/I Galli · ca, Illl Scythica und VI Flavia und vor seinem Kommando über die cohors I Se· bastena und eine andere Kohorte curator ripae superioris et ir!{erioris war.182
Aufgrund der exklusiv östlichen Karriere dieses Militärs wird ripa wohl zu Recht
add. S. 1692. - Praejectus orae maritimae Hispaniae Citerioris Gal/iae Narbonensis: PME P 81 add. S. 1688 f. (69 n. Chr.).- Praejectus alae item orae maritimae in Mauretania Caesari· ensi: PME lnc. 211 add. S. 1819 (um 69 n. Chr.). • Praepositus orae gentium Ponti Polemo· niani: PME V 23 add. S. 1754 (160/66 n. Chr.). - Praejectus orae Ponticae maritimae: PME G 8 add. S. 1577 (lll/ll3 n. Chr.). - Praejectus orae maritimae Amastris et classis Ponticae: PME lnc. 31 add. S. 1793 (106/ll7 n. Chr.). • Praejectus (pro legato) insularum Baliarum: PME P 78 add. S. 1688 (vorflavisch); T 25 add. S. 1740 (vorflavisch). Siehe dazu H. Devijver, The Equestdan Officers in the Roman Imperial Army. Amsterdam 1989, 29 -55; 454.
179 Jnsgesamt dazu Gilliam (Anm.174) 33; Enßlin (Anm.ll) 1335 f. 180 Gilliam (Anm. 174) 31; 208 f.; 442; 449; vgl. J.·P. Rey-Coquais, JRS 68, 1978, 69; Spei·
del (Anm.74) 308; Isaac (Anm. 175) 151 f. 181
Gilliam (Anm. 17 4) 208 f. unterhalb von Dura und oberhalb wenigstens bis zum Chabur, dessen Unterlauf vielleicht miteingeschlossen war.
182 (a) H. Seyrig, Syria 22, 1941, 236 f. = Ders., Antiquites syriennes. 111. Paris 1946, 180 f. Nr. 6 (= AE 1947, 172) = J. Starcky, lnventaire des inscriptions de Palmyre. X, Damaskus 1949, 17 f. Nr. 17 Taf. 2, 6 und 5, 3: [·· Celestico? (centurioni) /eg(ionis) lll Gall(icae),) 1111 Scy(thicae), VI Ferr(atae),l [curatori .......... , curatorJi ripae superior(is) I [et injerior(is), euro· tori ?] coh(ortis) I (S)ebastel[n]ae SVPIUVIM [ ........ ]T Hierapoli ~ Elabelus qui et Saturninus Molichi f(ilius) I h(onoris) c(ausa). Dazu der palmyrenische Text CIS II 3962: ~LM QLSTQS QTRYWN'I DY MN LGYWN' DY 'RB'T' DY 'BD I [L)H 'LHB[L -·I··). Starcky übersetzt: Statue de Celesticus le centurlon, de Ia Quatrieme Legion, que lui a faite Elahbel [··].- (b) Seyrig a.a.O. 237 - 240 = 181 · 184 Nr. 7 = Stracky a.a.O. 19 Nr. 22: [ -- Celestico ? (centurioni)J 1/eg(ionis) 111 Ga[ll(icae), 11]1/ S[cy(thicae)], VI Fer(ratae),l c[ura]ltori [ ......... ], curatori I [ripae sup]er(ioris) et injerior(is), [cu~ratari ? coh(ortis) /} Sebast(enae) et coh(ortis) ~ .. 1 ............. Jn"!l Taimi I(··].- Von den bei Seyrig genannten (von H.-G. Pflaum, Les Fastes de Ia
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 323
auf den Euphrat bezogen. Aus der interimistischen Tätigkeit des Celesticus als cu· rator folgt natürlich nicht, daß auch das von ihm vertretene Amt nur ein exzeptionc;lles und vorübergehendes war. Vielmehr scheint dieser in Palmyra angesehe· ne Zenturio geradezu ein Spezialist für den kommissarischen Einsatz gewesen zu sein, da er verf11~tlich nicht weniger als dreimal hintereinander als curator walte· te;183
UJ:lc;l, 10 wie er als Vertreter zweier Kohortenpräfekten fungierte, mag er vorübergehend zwei Uferpräfekten der Provinz Syrien am Euphrat substituiert ha· ben.184 Ist dies auch nur eine Hypothese und der genaue Kontext der Uferkuratel des Celesticus im Moment nicht zu klären/85 so ist hier ihre Existenz selbst von besonderem Interesse, weil sie deutlich vor Augen führt, daß Teilungen von Ufer· zonen einer Provinz lange vor Diokletian praktiziert wurden.
Eine Neuerung des 3. Jahrhunderts war vielleicht die Besetzung der Uferpräfekturen durch die Legionen. Neben der Notitia Dignitatum und den Ziegelstempeln ist unser einziges Zeugnis dafür möglicherweise eine problembehaftete Bau- und Weiheinschrift aus Bonn: Deo Merc[u)rio Gebrinio Aurelius 1 Perula PPL I ripe
province de Narbonnaise. Paris 1978, 214 f. übernommenen) Datierungskriterien, die in die Zeit Domitians führen, scheiRt mir allerdings nur der(mir nicht überprüfbare) Hinweis auf die palmyrenische Schriftform einleuchtend, die anderen Argumente sind entweder vage, wie der Hinweis auf die Dislokationsgeschichte der tegio llll ScythiCß und cohors I Seboste· na, oder, ,anfechtbar, wie die Datierung der praejecti ripae in die Zeit vor den Reformen Vespasians durch Domaszewski; Starcky datierte: «sans doute fin du t• siecle ap. J. -C.». Außer W.E. Brown, The Oriental Auxiliaries of the Imperial Roman Army. Diss. (microf.) 1941, 240 f. besprechen die Inschrift Rey-coquais (Anm. 180) 69; J. 'Jeixidor, Un port ro· main du desert: Palmyre. Paris 1984, 44 und lsaac (Anm. 174) 131 Anm. 32. Nicht zu· gänglich war mir D.L. Kennedy, The Auxilia and Numeri Raised in the Roman Pro· vince of Syria. Diss. (masch.) Oxford 1980. ,
183 Zu curator (zur Mehrdeutigkeit vgl. Speidei (Anm. 74) 175; 281 f.; 323 f.) für den Zen· turio als Interimskommandant von Auxiliartruppen CIL 111 6025 (• ILS 2615); AE 1974, 664; siehe die Sammlung bei E. Birley (Anm. 80) 79 - 83 bes. Nr. 7 und 25; Davies (Anm. 75) 185m. Anm. 13; Devijver (Anm. 178) 453; Ders., in: Aevum inter utrumque. Melanges offerts a G. Sanders. Den Haag 1991, 99 - 108, bes. 107 f.; auch Y. Le Bohec, Les unites auxiliares de l'armee romaine en Afrique Proconsulaire et Numidie sous Je Haut Empire. Paris 19~9, 121; 146 Anm. 70; vgl. außerdem noch SEG 30, 818; 33, 1115.
, 184 Natürlich geht es nicht an, aus dem bislang einzigen Beleg für den praejectus ripae
jturninis Euphratis auf einer flavischen Ehreninschrift der Vasienses Vocontii (CIL Xll1357 • ILS 2709; dazu vor allem Pflaum [Anm. 182) 213 - 215 Nr. 5) die Existenz mehrerer Ufer· präfekten am Euphrat auszuschließen, schon weil es sich hierbei nicht um eine korrekte Amtsbezeichnung handeln muß (vgl. das Beispiel bei K. Dietz, Chiron 19, 1989, 416). Verg~iqhsweise käme niemand auf die Idee, aus dem Titel praetor in einer kaiserzeitlichen Ehreninschrift aufdie Einstelligkeil des angesprochenen Amtes zu schließen .
. 115 lsaac den.kt wie Gilliam (vgl. die Angaben oben Anm. 174) an eine fiskalische Tätig·
keit an der ripa und verweist auf den EmJlEAtttiJv Eu{}qviac; tv t4} noAiJlcp t<i) Oap{}uc<i) tilc; ox{}'lCö toü Euwcitou (PME A 5 add. S. 1409). Auszuschließen ist dies nicht, doch er· scheint Celesticus zu Recht nicht bei F. Berard, MEFRA 96, 1984, 307 - 310 in seiner Liste der praepasiti annonae (bzw. copiarum) expeditionis; vgl. noch SEG 34, 1693.
324 Karlhein(. Diet(,
Rheni !leg(ionis) 1 Min(erviae) 1 templum [ --.186
Ihr zeitlicher Ansatz ist umstrit· ten; er reicht vom späten 2. bis zum 4. Jahrhundert. Die kryptische Buchstabenfol· ge PPL wurde mit dem gallischen Zoll in Verbindung gebracht und zu p(ublica· nus) p(ortus) L(irensis) ... , p(raeposituS) p(ortus) L(irensis) ... , p(ublici) p(ortori) l(ibertus) ... und p(rae)p(ositus) (quinquagesimae) ripe Rheni leg. l Min. aufgelöst.187 Ein weiterer Ergänzungsversuch zu p(rae)p(ositus) l(iburnariorum) ripe Rheni leg. l Min. hatte bereits die spätrömische Heeresorganisation im Vi· sier. Wahrscheinlicher noch ist mir die Deutung als p(rae)p(ositus) (quinquagena· rius) ripe Rheni leg. 1 Min., weil Gehaltsangaben nach dem Obertitel möglich waren,188 50000 Sesterzen zwischen Caracalla und Diokletian dem Jahresgehalt ei·
Z . h 189 d d . . I . . h t d" nes entunos entsprac en un er praepos1tus rrpae egwnrs am e es en te· ser Gruppe entsammte. 190
Die Existenz ständiger räumlicher Kommandobereiche ist für die prinzipats· zeitlichen Legionen nach dem derzeitigen Quellenbestand offenbar wenig wahr· scheinlich.191 Komplexe Teilungssysteme im Rahmen von pedaturae waren indes· sen ganz sicher keine spätantike Neuerung: Beim Bau des Hadrianswalles etwa wa·
186 AE 1931,26 = H. Nesselhauf, BerRGK 27, 1937,103 f. Nr.l86. 187 Die Literatur über E Vittingboff, in: RE XXII 1 (1953) 353 f.; Forni (Anm. 149) 1166;
zuletzt wieder 0rsted (Anm.l74) 276 Anm. 442. 181 Vgl. etwa nur den dux ducenarius CIL V 3329 (= ILS 544); proc. CC Alexandriae idiu
fogu CIL 111 6757 (= ILS 1413); procurator centenarius regionis, fun(c]tus etiam partibus ducenari ex sacro praecepto in eadem regione CIL Vllllll74 (= ILS 1440); weitere Zeug· nisseunschwer zu finden in der Prosopograpbie H.-G. Pflaums. Im übrigen sind unsere epi· graphischen Zeugnisse für die Spätzeit zu spärlich, um auf genauen Analogien bestehen zu können.
189 B. Dobson, AncSoc 3, 1972, 193 - 207, bes. 203; vgl. Le Bobec (Anm. 173) 226 f. Außerdem G. Alföldy, Cbiron 11, 1981, 183- 190 (• Ders., Die römische Gesellschaft. Aus· gewählte Beiträge. Stuttgart 1986, 176- 183); Devijver (Anm. 178) 408 f. m. Anm. 49.
190 Siebe oben Anm. 168. Durchaus fraglieb ist, ob wir einen Zusammenhang zum centu· rio regionarius suchen dürfen, zu diesem M.P. Speidel, ZPE 57, 1984, 185- 188; ergänzend AE 1985, 738.
191 Ein neuerer Versuch des Nachweises von Kommandobereichen der Legionslegaten am Beispiel Obergermaniens (Oidenstein-Pferdehirt [Anm. 72) 408 - 418 m. Abb. 14; vgl. die Vorstellung von Militärbezirken etwa bei Strobel [Anm. 54) 24 m. Anm. 132 usw.) wurde entschieden abgelehnt (D. Baatz, Kommandobereiche der Legionslegaten. Germania 67, 1989, 169 • 178); problematisch scheint mir, ob die- zu verneinende- Frage einer Zuordnung von Auxilien zu bestimmten Legionen ohne weiteres mit der nach der Existenz von pedatu· roe für Legionen zu verknüpfen ist. Noch so verfeinerte Kartierungen müssen scheitern, weil der Überlieferungszufall nicht nur Regelbefunde, sondern auch die im Laufe der Jahr· hunderte gewiß nicht seltenen Ausnahmen (etwa Baumaßnahmen in einer eventuellen Peda· tur der Nachbarlegion) dokumentiert hat Die Materialdecke von rund einem Dutzend Zeug· nissen für praepositi von Hilfstruppen am obergermanischen Limes (gesammelt und kom· mentiert bei Baatz a.a.O. 175- 178 mit Abb. I) ist wie üblich gering. Mit Baatz spricht also die derzeitige epigraphischen Evidenz «eher)) gegen die Existenz räumlicher Kommandobe· reiche der Legionen. Dezidiert anders aber L. Eckhart, Röm. Österreich 11/12, 1983/84, 17 -· 40. Vgl. noch die Bemerkung bei Strobel (Anm. 179) 1989, 24 m. Anm. 132.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 325
ren Blöcke von fünf milia passuum je einer Legion zugewiesen, und innerhalb dieser Blöcke wurde die Arbeit nach Kohorten und Zenturien gestückelt. Umständlicher war des gewählte Verfahren bei der Anlage der Antoninusmauer; hier wurde die gesamte Strecke mit Ausnahme der vier westlichen Meilen in größere Sektoren unterteilt, die jeweils wieder in drei Legionsblöcke von 3, 32
'3 und 4 2'3 römische Meilen zerfielen. Innerhalb eines solchen Blocks arbeiteten sich (wie wenigstens in zwei Fällen nachgewiesen) die britanni~hen Legionen in vier Grup· pen ·je von den Enden zur Mitte vor.192 Ähnliche, obschon meist einfachere Vorge· hensweisen sind auch bei der Anlage ziviler Bauten zu beobachten, z. B. im Falle der Stadtmauer von Salona, der Aureliansmauer in Rom und sogar noch von Re· präsentationsbauten in Konstantinopel;193 gleichgültig ob im Zusammenhang mit dem Straßenbau in Thralden
194 oder der Kanalisierung bei Antiochien am Oron·
tes:195 die Vergabe von Bauarbeiten in Form von Zuständigkeiten war den Römer überaus vertraut. Dabei war der Zusammenhang von Bauabschnitten und Legions· kohorten ihrem Denken so tief verwurzelt, daß Hadrian selbst die zivilen Bauleute nach dem Musterder Legionen eingeteilt hat: Namque ad specimen legionum mi· litarium fal#os perpendiculatores · archi~ecto~. genusque cunctum exstruen· dorum moenium seu decorandorum in cohortes centuriaverat.196
Doch nicht nur Flußzonen und ephemere Baubereiche, auch ständige Grenzräu· me zu Lande wurden sektoral gegliedert, wie dies aus Inschriftenfunden des letz· ten halben Jahrhunderts, speziell aus einer der Zeit zwischen Juli 244 und Au· gust 247 entstammenden Bautafel am tripolitanischen Centenarium von Gasr Duib für den afrikanischen Limes zu folgern ist: /mp(erator) Caes(ar) [M(arcus) lulius Ph]ilippusß invictu(s Aug(ustus)] I et [M(arcus) Iulius P(hilippusß Ca)esar n(oster) regionem limi(tis Ten~theitani partitcim et (eius) viam incursib(us) bar· ba(ro)rum constituto novo centenario [--1--DS prae[cl]useru[nt] Cominio Cas· siano leg(ato) Augg(ustorum) ·1 pr(o) pr(aetore) Gallican[o proc(uratore) Augg(ustorum) nn(ostrorurn)) v(iro) e(gregio) praep(osito) limitis cura I Numisii Maximi domo [--]sia trib(uno).197 Mit R. Rebuffat wird die Bewertung dieses Tex·
192 Lit. dazu in Anm. 72; ferner M. Hassall, Britannia 14, 1983, 262 · 264; zusammenfas· send D.J. Breeze, Tbc Second AugustanLegion in North Britain. Caerleon 1989, 5- 13.
193 Salona: oben Anm. 168; Konstantinopel: Pseudo-Kodinos, nciTpta Kwvaravttvovn6A.t:w~ 2, 58 (182, 7 Preger) und zur Aureliansmauer R. MacMullen, HSPh 64, 1959, 213 m. Anm. 61 f.; vgl. 221 m. Anm. 109.
194 1GR I 828 add. AE 1914, 62; dazu jetzt Tb. Pekäry, AArchHung 41, 1989, 490 · 492. 195 n Feisse1, Syria 62, 1985, 77 - 103 ~ AE 1986, 694 • SEG 35, 1481 196 Epit. de Caes. 14, 5; dazu MacMollen (Anm. 193) 215; 221; vgl. Hassall (Anm. 81) 321
Anm.J. 197 IRT 880 und dazu mit der Nennung weiterer Literatur R. Rebuffat, Le 'Limes' de Tri·
politaine. ln: DJ. Buck u. D.J. Mattingly (Hrsg.), Town and Country in Roman Tripolitania. Papers in Honour of 0. Hackett. Oxford 1985, 127 - 141, hier: 129. Vgl. J.F. Matthews in: ' Goodburn u. Bartholomew (Anm. 137) 170 f.; Forni (Anm. 174) 288; Le Bohec (Anm. 168)
326 Karlheinz Dietz
tes im Lichte der unlängst entdeckten Bauinschrift des Jahres 248 aus den princi· pia von Gholaia (Bu Njem)198 und der schon etwas länger bekannten aus Aqua Vi· va vom Jahr 303199 die spezifischen Ve.rhältnisse Nordafrikas nach der exauctora· tio der legio II/ Augusta in Betracht zu ziehen haben. Vermutlich hat das dadurch entstandene militärische Vakuum die Schaffung des übergeordneten Regionalkom· mandosdes praeposltus limitis Tripolitanae (scil. regionis) verlangt?00 Die weite· re Folgerung Rebuffats, (;rst Diokletian habe vor 303 die laut Notitia Dignitatum dem dux limitis Tripolitani bzw. dux provinciae Tripolitanae201 untergeordneten zwölf regionalen praepositi limitis ... (u. a. auch den praepositus limitis Ten· theitani)202 geschaffen, d. h. im Zuge seiner Neuorganisation seien an die Stelle regionaler tribuni (limitis) regional zuständige praepositi limitis ... und an die Stelle des präepositus limitis (Tripolitani) der dux limitis Tripolirani getreten, 203
ist indessen recht fragwürdig, nicht zuletzt deshalb, weil 1. die terminologischen Unschärfen der Inschriften meist nur unsichere Schlüsse auf die jeweilige Stellung
454 m. Anm. 29; 456; 462; der entscheideneo Passus fehlt bei Isaac (Anm. 174) 129. Vgl. noch A.E Elmayer, The Centenaria of Tripolitania. Libyan Studies 16, 1985, 77 • 84; zu Gasr Duib zuletzt G. Di Vita-Evrard, ili: Histoire et archeologie de I'Afrique du Nord. L'armee et les affaires militaires. IVe colloque international de Strasbourg. 1991 (non vidi) und D.J. Mattingly, AntAfr 27, 1991, 7S- 81, der Numisius Maximus für einen lribunen der cohors I Syrorum sagittariorum hält.
198 Rebuffat (Anm. 197): lmpp(eratoribus) dd(ominis) nn(ostris) (Philippis)J Augg(ustis) I
M(arco) Aurel(io) Cominio Cassiano /eg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore), c(larissimo) v(iro), I et Lucretio Marcello v(iro) e(gregio), proc(uratore) Augg(ustorum) nn(ostrorum), I praeposito limitis Tripolitailae, ~ C(aius) lulius Donatus dec(uriO} alae Flaviae, 1 praejectus a dd(ominis) nn(ostris) Augg(ustis), I praefuit vexillationi Go/ensi et [n(umero) co/(/ato)?) I lmpp(eratoribus) Philippo 111 et Philippo II co(n)s(ulibus). Vgl. die Restitution von Le Bo· hec (Anm. 168) 441 Anm. 443; 461 f. Anm. lOS. Diese Inschrift ist zu ergänzen bei M. Mala· volta, in: Diz. Epigr. IV (1985) 1376178.
199 AE 1942/43, 81: lmpp(eratoribus) dd(ominis) nn(ostris) Dioc/etiano et Maximiano ae·
ternis Augg(ustis) I er Constantio et Maximiano fortissimis Caesaribus, principib(us) I iu· ventutis centenarium, quod Aqua Viva appellatur, ex praecepto 1 Va/(eri) Alexandri v(iri) p(erfectissimi), agent(is) vic(es) praeff(ectorum) praet(orio), et Val(eri) Flori v(iri) p(er fectissimi), p(raesidis) p(rovinciae) N(umidiae), a solo ~ fabricatum, curante Val(erio) lnge· nuo praep(osito) limit(is). Dedicatum 1 dd(ominis) nn(ostris) Diocletiano VIII et Maximiano VII Aug(ustis) conss(ulibus). Dazu Waldherr (Anm. 92) 270 - 275.
200 Not. Dign., occ. I, 39; S, 135. 201 Not. Dign., occ. 31. 202
Not. Dign., occ. 31, 19; vgl. 31, 4. Insgesamt siehe Clemente (Anm. ll) 321 f.; A. Chastagnol, L'ltalie et I'Afrique au Bas-Empire. Scripta varia. Lilie 1987, 174 f.; Elmayer (Anm. 197) 81 f.; B. Gutmann, Studien zur römischen Außenpolitik in der Spätantike 364 • 39S n. Chr. Diss. Sonn 1991, 58 - 60; vgl. noch die Inschriften bei Le Bohec (Anm. 168) 466 Anm.l53.
203 Rebuffat (Anm. 197) 131. Demnach müßte der praepositus /imitis in Aqua Viva dem
Iimes Tubuniensis vorgestanden haben (siehe die Hinweise bei Waldherr (Anm. 92) 273). Vgl, noch Elmayer (Anm. 197) 80 f., bei dem sich auch wichtige Bemerkungen zu den Iimitanen Tribunen finden; vgl. aber Mattingly (Anm. 197).
Zur Entwicklung der Oren()egionen in der Spätantike 327
des Amtsträgers zulassen, weil 2. auf der Inschrift aus Aqua Viva der Präses Nu· midiens, und nicht der dux 'friPQlitaniens, als nächster Vorgesetzter des praeposi· tus limitis erscheint, und weil es 3. ernsthafte Argumente für das Fehlen eines dux Tripolitanae vor dem Ende des 4. Jahrhunderts gibt.204 Im lnstanzenzug205 ran· giert der praepositus limitis auf jeder der drei Inschriften unmittelbar hinter dem numidischen Statthalter. Da gerade der Text aus Gasr Duib auch nach Ansicht Re· buffats verdeutlicht, daß diesem der Zusatz Tripolitanae fehlen konnte, stellt sich die Frage, w~rum diese übergeordnete limitane Zwischeninstanz - egal ob titular als dux oder praepositus gefaßt206
- im Jahr 303 fehlt und sich die ihm nachge· ordnete LimitanpräPQsitur nicht regional definiert hat?
204 G.H. Donaldson, The Praesides Provinciae Tripolitanae - Civil Administraton and Military Commanders. ln: Buck u. Mattingly (Anm. 197) 165- 177.
205 244/7 n. Chr.: leg. Augg. pr. pr. (prov. Numidiae) - procurator Augg. nn. v. e., prae· positus limitis - cura: tribunus.
248 n. Chr.: leg. Augg. pr. pr. (prov. Numidiae) - v. e., procurator Augg. nn., praeposito limitis Tripolitanae - (cura): dec(urio) alae Flaviae, praejectus (= praepositu~ vexiltationi Golensi ....
303 n. Chr.: v. p. agens vic(es) praeff. praet(orio) - v. p. praeses provinciae Numidiae -cura: praepositus limitis. Da die cura von Amtsträgern unterschiedlicher Ranghöhe reklamiert werden konnte, wie u. a. CIL Vlll2572 (•ILS 5786; vgl. Waldherr [Anm. 92] 220 f.) lehrt, verhilft sie nicht zur unpfähren Gleichstellung des praepositus Jimitis von 303 mit den tribunus von 244/7 oder decurio alae von 248.
206 Die Entwicklung dieser beiden Titel im 3. Jahrhundert ist noch zu erhellen. Natürlich kennzeichnete die Bezeichnung praepositus vielfach nicht einen militärischen Grad, son· dern schlicht die Vorgesetztenposition (vgl. die oben Anm. 15 genannte Literatur und fürs 4. Jahrhundert HOffmann [Anm. 89] II 26 f. Anm. 190), die bei größeren militärischen Aufga· ben auch durch praefectus oder dux zum Ausdruck gebracht werden konnte (so auch G. Al· földy, Römische Heeresgeschichte. Amsterdam 1987, 449). Öe~entsprechend scheinen die Begriffe teilweise äquivalent zu sein (Gilliam {Anm. 174] 29 f.), und es war im späten 3. Jahr· hundert durchaus möglich, gleichzeitig dux er praepositus derselben Legion zu sein: CIL 111 4855 = ILS 2772; dazu beispielsweise Dobson (Anm. 173) 305 f. Nr. 214m. weiterer Lit.; er· gänzend Speidei (Anm. 74) 68; vgl. Mommsen (Anm. 4) 204 f.; Le Bohec (Anm. 168) 144 m. Anm. 195 f; und den Stempel bei M. Mirkovic, IMS II S. 39 m. Anm. 38. - Technisch war der praepositus den Untersuchungen von R. E. Smith zufolge (Dux, praepositus. ZPE 36, 1979, 263 - 278) seit Septimius Severus der Kommandant eines Truppenverbandes, welcher als Teil einer größeren Einheit eine eigene Garnison und eine eigene Aufgabenstellung be· saß. Nach Art und Umfang seiner Vollmachten einem Legionslegaten ähnelnd war der prae· positus einem legatus Augusti pro praetore bzw. einem dux weisungsgebunden, erfreute sich also lediglich eines eingeschränkten Initiativrechts und war nicht zu unabhängiger Akti· on befähigt. Hingegen war der dux seither in technischer Verwendung der Führer eines der Autorität des Kaisers direkt unterstellten, ansonsten unabhängigen Militärkommandos. Er befehligte also eine Armee oder eine Heeresgruppe und war innerhalb der fest umschriebe· nen Grenzen seines Auftrages mit dem Recht zur Eigeninitiative ausgestattet. Das Ende der. Legionslegation (dazu nur M. Christol, Essai sur l'evolution des carrieressenatonales dans Ia 2" moitie du ur s. ap. J.·C. Paris 1986, 39; 44 f.), der Bedarf an ritterlichen praefecti legio·
328 Karlheinz Dietz
Bleiben somit leider auch in diesem Bereich die genaueren Umstände der Eta· blierung von regionalen Limitanpräposituren durchaus unklar, so läßt sich die un· ter den Philippi in Gasr Duib bezeugte Wendung regio limi[tis Ten)theitani parti· ta mittels komplexer Überlegungen überzeugend deuten als «the part of Regio (Tripolitana) depending (for its protection) on the Limes Tentheitanus» (G. di VitaEvrard). Auch wenn wir im Moment die administrativen Zuständigkeiten nicht überschauen, zeigt der unausweichliche Schluß auf die Existenz von regiones partitae207 in Abhängigkeit von Teilungen des Iimes (regionis) Tripolitanae nach Art des Iimes Tentheitanus erneut klar, daß Teilungen von Grenzdistrikten schon vor Diokletian vorkamen und je nach Notwendigkeiten erfolgten.
Es ist daher gänzlich unsicher, und wohl nicht einmal sonderlich wahrschein· lieh, daß die Einrichtung von ständigen Iegionaren Zuständigkeiten (pedaturael partes) in den Donauprovinzen erst das Werk reformerischer Maßnahmen Diokle· tians war. Die zahlreichen militärischen Katastrophen, Rückschläge und Usurpa· tionen, die Rom entlang der Donaugrenze im 3. Jahrhundert hatte hinnehmen müssen, bedrohten den Bestand des Reiches ungleich stärker als die Unbotmäßig· keit nordafrikanischer Stämme/08 und boten genügend Anlässe zu Umstrukturie· rungen. Solche läßt unsere weniger als magere Überlieferung gerade noch für die höheren Kommandoebenen schattenhaft erkennen oder besser gesagt erahnen,209
für die unteren Bereiche fällt sie so gut wie völlig aus. Die Segmentierung der Je· gionaren Einflußbereiche, die sehr wohl zur Konzeption überschaubarer Verwal· tungsräume der ersten Tetrarchie passen könnte, war nicht mit einer Zweiteilung der Grenzlegionen zu je fünf Kohorten identisch. Eine solche hat wohl nie stattge· funden, vielmehr zerfielen die Legionen gleichsam nach und nach, nicht zuletzt infolge der fortifikatorischen Anstrengungen in tetrarchischer und konstantini· scher Zeit. Aus Kohorten zusammengestellte Vexillationen verselbständigten sich mit der Dauer und Größe ihrer Aufgaben. Förderlich haben dazu auch zeitspezifi· sehe Umstände in der Kommandostruktur beigetragen. Durch den Wegfall der se· natorischen Legaten seit Gallienus und den notorischen Mangel der sie ersetzen·
num (J.F. Oisier, The Emergence of Third-Century Equestrian Military Commanders. Lato· mus 36, 1977, 674- 687) und die Notwendigkeit militärischer Großkommaoden (vgl. Dietz [Anm. 184] 443- 447 in Ergänzung zu F. Hartmann, Herrscherwechsel und Reichskrise. (Jn' tersuchungen zu den Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Ro· manum der Soldatenkaiserzeit (3. Jahrhundert n. Chr.J. Frankfurt a. M. u. Bern 1982, 137 f.) müssen sich auf die Struktur dieser Ämter ausgewirkt haben. Vgl. noch Gilliam (Anm. 174) 255- 261; 443 und L. de Blois, The Policy of the Emperor Gallienus. Leiden 1976, 37- 47.
207 G. di Vita-Evrard, Regio Tripolitana. A Reappraisal. In: Buck u. Mattingly (Anm. 197)
143- 163; bes. 152 f. m. Abb. 9, I. 208
Zuletzt A. Gutsfeld, Römische Herrschaft und einheimischer Widerstand in Nord· afrika. Militärische Auseinandersetungen Roms mit den Nomaden. Stuttgart 1989.
209 Hartmann (Anm. 206) 131 - 140; zu den duces /imitis in der Historia Augusta Forni (Anm. 174) 291 f.; Zahariade (Anm. 11) 40 - 49; Le Bohec (Anm. 168) 144; 466 m. Anm. 152; Sarnowski (Anm. 92) 857 f.; vgl. Lippold (Anm. 174) 366 f.
Zur Entwicklung der Grenzlegionen in der Spätantike 329
den ritterlichen praejecti legionum waren die Legionen in ihren Zentren zumin· dest zeitweilig geschwächt, was nachgeordneten Teilkommaoden hinsichtlich ihres Handlungsspielraum und ihrer Dauer zugute kommen mußte. Die sukzessive Ein· setzung regionaler duces als Befehlshaber seit den späten 90er Jahren des 3. Jahr· bunderts raubte den Legionen endgültig ihre Spitze, indem sie die praefecti legio· nis zu faktisch überflüssigen Zwischeninstanzen degradierte. Im Verein mit der schon angesprochenen Tendenz zur Verkleinerung gab es jetzt, wo die Legionen ihren .Oberbefehlshaber mit den alten Auxilien teilten, immer weniger Anlaß, Ve· xillationen in die Großverbände zurückzuführen. Vielmehr beließ man die Oe· tachements, die man, da der Begriff vexil/atio zunehmend für die Reiter des Feld· heeres reserviert wurde, nach ihren Bestandteilen einfach als legionis cohortes be· zeichnete, in den jeweiligen Abschnitten der pedaturae und wies ihnen die Über· wachung und Instandsetzung von einzelnen Uferstrecken (ripae) zu. Existierten anfangs neben den "Uferpräfekten der Legionskohorten des ( ... ) Abschnitts in ( ... )" möglicherweise noch die Legionspräfekten im alten Hauptquartier, so sanken sie sehr bald selbst auf den Rang der Uferpräfekturen herab.
Somit gilt auch für die Entwicklung der Grenzlegionen, was unlängst für die spätantike Heeresreform allgemein trefflich formuliert wurde: «Diese Reform, die von der Antike teils heftige Kritik, von der Moderne bis vor kurzem eine aus· schließlich positive Beurteilung erfuhr, erweist sich bei näherem Zusehen eher als Produkt einer langen Entwicklung denn als absolutes Novum, und die beiden Mo· delle: disloziertes Heer - zentralisiertes Heer zeigen sieb eher als Modifikationen denn als Antithesen.»210
210 Papst (Anm. 175) 324 mit wichtiger weiterer Literatur; zu ergänzen wären etwa die oben Anm. 3 genannten Arbeiten M.P. Speidels. - Meine Mitherausgeber, Dieter Hennig und Hans lf:aletsch, haben mich vor manchem Versehen bewahrt, wofür ich ihnen auch auf dieseni Wege herzlich danke.