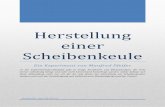Der Hausbau Freibergs am Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit, 2008
Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim: Schicksal einer Kleinfestung in Spätantike und frühem...
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim: Schicksal einer Kleinfestung in Spätantike und frühem...
Frankfurter Archäologische Schriften
herausgegeben vonHans-Markus von Kaenel, Rüdiger Krause, Jan-Waalke Meyer und Wulf Raeck
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH · Bonn 2012
21
Siedlungsform, Architektur und Gesellschaft inprähistorischen und antiken Kulturen
herausgegeben von
Wulf Raeck und Dirk Steuernagel
Das Gebaute und das Gedachte
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH · Bonn 2012
© 2012 by Dr. Rudolf Habelt GmbH, BonnDas Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung,
Mikroverfilmung und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Satz: Susanne Biegert (Bonn)Druck: Beltz Bad Langensalza GmbH
ISBN 978-3-7749-3816-8
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Umschlag nach: W. Sackur, Vituv – Technik und Literatur (Berlin 1925) Titelbild.
Vorwort der Herausgeber
Dieser Band enthält die unterschiedlich ausführlich bearbeiteten Fassungen von zwölf Vorträgen, die am 11. und 12. Dezember 2009 im Rahmen einer Tagung des Instituts für Archäologische Wissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt a. M. gehalten wurden. Zwei weitere Vorträge (von Barbara Borg, Räumliche Indikatoren sozialer Distinktion in römischen Gräbern, und Jens-Arne Dickmann, Das römische Wohnhaus als sozialer Raum) werden an anderer Stelle publiziert.
Der Anstoß zu diesem Vorhaben ergab sich aus dem Mikrokosmos des genannten Instituts. Dieses hatte sich fünf Jahre zuvor durch die Vereinigung dreier bislang getrennt existierender Betriebseinheiten bzw. Teilbetriebseinheiten konstituiert, die im „neuen“ Institut als Abteilungen fortbestehen: Die Abteilung I Vorderasiatische und Klassische Archäologie, die Abteilung II Archäologie und Geschichte der römischen Pro-vinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde, schließlich die Abteilung III Vor- und Frühgeschichte. Sie befassen sich jeweils mit eigenen Themenbereichen, und im Alltag des Universitätsbetriebes könnte es manchmal scheinen, als seien sie wissenschaftlich durch kaum mehr als das Wort „Archäologie“ miteinan-der verbunden. Dass dies nicht zutrifft, zeigen gemeinsame Veranstaltungen und Projekte ebenso wie der kontinuierliche persönliche Austausch. Alle Beteiligten sind sich aber darüber einig, dass dieser intensiviert werden muss, wenn das wissenschaftliche Potential des Miteinanders der Disziplinen wirklich genutzt werden soll. Das Verbindende liegt – neben zeitlichen oder regionalen Berührungspunkten und Überschneidungen der Forschungsgebiete – vor allem in den Methoden, die zur Lösung gleichartiger oder ähnlicher Fragen angewendet werden (oder eben auch nicht). Hierüber sich nicht nur gegenseitig zu informieren, sondern darüber hinaus ins Gespräch zu kommen sowie dadurch nach Möglichkeit einen Zugewinn an Reflexion über die jeweils eigene Forschungsarbeit zu erreichen, war das Hauptziel der Veranstaltung. Ein thematischer Rahmen, in dem alle Abteilungen sich mit Teilen ihrer Forschungsarbeit wiederfinden konnten, war schnell gefunden. Die Veranstalter sahen ihn in der ständig neuen Herausforderung der Verbindung von materiellem archäologischen Befund – hier vor allem ergrabene Architekturreste –, und immateriellem „Gedachten“. Das Gedachte kann dabei im Zeithorizont der jeweiligen archäologischen Befunde liegen, als auch in den Gedan-kengebäuden der Ausgräber und Bearbeiter, die diese Befunde zu interpretieren versuchen. Dies schien allen Beteiligten nicht nur lokales Interesse zu verdienen, weshalb sie es – nicht zuletzt durch den erfolgreichen Verlauf der anregenden Tagung beflügelt – gewagt haben, eine Sammelpublikation aller Beiträge vorzulegen.
Um die in Frankfurt bearbeiteten Projekte in ihrem jeweiligen Kontext besser verständlich machen zu können, wurden externe Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die über verwandte Themen und Arbei-ten berichten. Das Programm folgt dabei bewusst nicht oder nicht ausschließlich den Fächer- oder Abtei-lungsgrenzen, sondern versucht, Vorträge aus verschiedenen archäologischen Teilgebieten unter gemeinsamen Gesichtspunkten zu gruppieren.
Die insgesamt fünfzehn Vorträge deckten einen geographisch wie chronologisch denkbar weiten Rahmen ab. Das Spektrum reichte von bandkeramischen Dörfern Mitteleuropas über frühe Stadtanlagen Syriens, Siedlungsstrukturen im Tschadbecken, antike Poleis Kleinasiens bis hin zu spät- und nachantiken Baudenkmälern an Rhein und Main. Stärker auf bestimmte Architekturformen oder einzelne Baudenkmäler fokussierte Beiträge und solche, die Strukturen von Siedlungen und Siedlungsräumen behandelten, hielten sich in etwa die Waage.
Zum Auftakt fragte Peter Breunig, ob das „Gebaute“ und das von uns „Gedachte“ in der Vorgeschichte Afrikas tatsächlich übereinstimmen. Er spricht damit sogleich grundsätzliche Probleme an, wie sie aus Ana-logie- und Modellbildungen resultieren können. So teilt man die Vorgeschichte Afrikas gemäß dem Drei-periodensystem der Stein- und Metallzeiten ein, das nach dem Muster der vorderasiatisch-europäischen Entwicklung konstruiert ist. Dort zeitlich zusammen fallende Entwicklungsschritte differieren jedoch im Falle Afrikas manchmal um Jahrtausende.
Ebenfalls mit übergreifenden Theorien zur geschichtlichen Entwicklung, namentlich mit Urbanisie-rungskonzepten bei Karl Marx und Max Weber, setzt sich Roberto Risch in seinem Beitrag zur sog. El Argar-Kultur im frühbronzezeitlichen Südostspanien auseinander. Höhensiedlungen, in denen neben kom-plexer Architektur eine Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften nachweisbar ist, heben sich ab von Flachlandsiedlungen, die vorwiegend als Lieferanten für Subsistenzgüter gedient zu haben schei-nen. Zusätzlich scheint es räumlich-funktionale Differenzierung, beispielsweise separierte Zonen für Han-dwerk oder Bestattung, auch innerhalb der Höhensiedlungen gegeben zu haben. Sind dies Indikatoren für Machtstrukturen, die einer Elite die Verfügungsgewalt über natürliche Ressourcen und Technologien sicherten?
Das Verhältnis unterschiedlicher Siedlungsformen zueinander – und daran möglicherweise ablesbare Hie-rarchien – behandelt Rüdiger Krause mit Blick auf das Nördlinger Ries während der der älteren Eisenzeit. Drei Typen von Siedlungen sind im archäologischen Befund greifbar: offene Flachlandsiedlungen, umwehrte Rechteckhöfe und befestigte Höhensiedlungen. In den beiden letzten haben, nach Ausweis von monumenta-len Bauten, Großgräbern und mediterranen Importen, Angehörige der sozialen Elite gelebt. In der Gesamtheit der Siedlungen konstituiert sich jedoch, nach Krause, das Kernterritorium für den „Fürstensitz“ bzw. das „komplexe Zentrum“ (E. Gringmuth-Dallmer).
Mit den Formen und Binnenstrukturen städtischer Zentren im Syrien des 4. und 3. Jts. v. Chr. befassen sich Jan-Waalke Meyer und Michel al-Maqdissi. Meyer betont dabei, dass die Urbanisierung in Nordwest-syrien sich als unabhängige, nicht durch südmesopotamische Einflüsse initiierte Entwicklung darstelle. Die Ausgrabungen von Mari und Tell Chuera zeigen, dass die Stadtentwicklung dort wesentlich früher als bisher angenommen, nämlich bereits vor der Wende zum 3. Jt., einsetzte und sich durch die charakteristische sog. Kranzhügelstruktur, mit einem Platz im Zentrum eines radialen Straßensystems, auszeichnete. Um die Mitte des 3. Jts. kommen ähnliche Siedlungsstrukturen auch in Zentralsyrien vor, wie Michel al-Maqdissi erläutert. Allerdings ist hier im Laufe der Bronzezeit ein bemerkenswerter Wandel zu verzeichnen: So wurden die run-den Anlagen von Tell Mishrifeh (Qatna) und Tell Rawda später durch rechteckige Befestigungen eingefasst. Man könnte von einer „refoundation“ Qatnas zu Beginn des 2. Jts. sprechen, deren historischer Hintergrund (Einwanderung der Ammoriter?) freilich unklar bleibt. Endogener oder von außen angestoßener Prozess? Die Frage stellt sich an diesem Punkte erneut.
Geschichte und interne Gliederung von Siedlungen auf ihre Aussagekraft für soziale Ordnungen zu befra-gen, nehmen sich in unterschiedlicher Weise Jens Lüning und Svend Hansen vor. Hansen widmet sich dabei der Frage, ob Siedlungsstruktur und Beigabendifferenzierung in den südrumänischen Gräbern für das 5. Jt. v. Chr. eher eine hierarchisch organisierte oder egalitär-segmentierte Gesellschaft erschließen ließen. Damit verbunden ist die Frage, ob Ortskonstanz und Baufolge im Bereich des kupferzeitlichen Tell bei Pietrele an der unteren Donau als Traditionsbewusstsein gedeutet werden kann, das Kontinuität der sozialen Organisation gewährleisten sollte. Lüning hebt bei seiner Rekonstruktion der Chronologie von Bauten an drei benachbar-ten Hofplätzen der ältestbandkeramischen Siedlung Schwanfeld in Unterfranken auf die Bedeutung der Ahnen ab. So zeige die Nachnutzung eines längst aufgelassenen Hauses aus der Frühzeit des Siedlungsplatzes (mittleres 6. Jt. v. Chr.) als Bestattungsplatz, Jahrhunderte später, dass die soziale Gruppe an die Gründerge-neration anzuknüpfen suchte, im Sinne einer „Mythisierung“ nicht unähnlich der griechischer Heroenkulte.
Ob und wie politische oder religiöse Vorstellungen planmäßig in gebaute Strukturen übersetzt wurden, fragen Wulf Raeck und Susanne Sievers an Hand griechischer Stadtanlagen „hippodamischen“ Typs bzw. des spätkeltischen Oppidums von Manching. Sievers macht deutlich, dass es innerhalb des Oppidums von Man-ching vielfältige Hinweise auf exakt bemessene Baustrukturen gebe. Bislang nicht zu ergründen ist allerdings, welche Motive dazu führten, dass Tore nicht nur in identischem Abstand von einem zentralen Heiligtum angelegt worden seien, sondern zudem in einer Verteilung, die auf abstrakten geometrischen Mustern zu beruhen scheint. Abstrakte Ordnungsprinzipien unterliegen auch der Urbanistik der sog. hippodamischen Städte der griechisch-hellenistischen Welt. Derartige, auf einem orthogonalen Straßenraster basierte An-lagen hat man in Teilen der archäologischen Forschung als Ausdruck und praktische Umsetzung von de-mokratischen Gleichheitsidealen gedeutet (W. Hoepfner). Raeck kritisiert dies als unreflektierte Übertragung moderner Vorstellungen. Politische Aussagekraft habe ein solches System freilich in dem Sinne, dass es die Existenz einer durchsetzungsfähigen Institution voraussetze, die in der Lage war, den Stadtbewohnern und ihren im Einzelnen sicher divergierenden Interessen ein allumfassendes (ästhetisches) Konzept zu verordnen.
Eine Auseinandersetzung zwischen Bürgergemeinschaft und zentraler Autorität erkennt Dirk Steuernagel in der Baugeschichte des Athenaheiligtums von Pergamon zwischen dem 4. und 1. Jh. v. Chr. Den Tempel ließ noch vor der Errichtung monarchischer Herrschaft die Polis bauen. Mit Erweiterung und neuer Orientierung des umgebenden Heiligtumsbezirks vereinnahmten jedoch in der Folgezeit die attalidischen Herrscher den Kultplatz und wiesen der Stadtgöttin Athena, z. B. durch Verleihung zusätzlicher Kultnamen (Nikephoros), die Rolle einer Schutzpatronin des pergamenischen Reiches und seiner Könige zu.
Funktionalen Wandel in Zeiten historischer Umbrüche exemplifiziert Alexander Heising am spätantiken Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim im hessischen Ried. Die Diskussion bezieht sich dabei auf drei ver-schiedene Zeitebenen: auf die Intentionen der römischen Bauherren, auf die Umfunktionierung durch ein merowingisches Fürstengeschlecht, schließlich auf die Erforschung durch die moderne Archäologie. Heising zeigt eindrucksvoll, wie die drei Ebenen ineinander verwoben sind, insofern literarische Beschreibungen, also spätantike Interpretationen, die archäologische Rekonstruktion leiten, die sich aber ebenso auf den durch die nachantiken Phasen entscheidend geprägten Grabungsbefund stützt. Interpretatorische Überformung und sogar handgreifliche Umformung der gebauten historischen Substanz thematisiert Hans-Markus von Kaenel an Hand einer aktuellen Debatte, deren Gegenstand ein turmähnlicher Bau auf dem Campus Westend der Frankfurter Universität ist: Eiskeller des 19. Jhs. oder Wartturm aus der Zeit um 1400? Ob und wie die Antwort auf diese Frage den denkmalpflegerischen Umgang bestimmt, ist ein letztes treffendes Beispiel für den unauflösbaren Zusammenhang von „Gedachtem“ und „Gebautem“.
Die Reihenfolge der Beiträge in dieser kurzen Übersicht entspricht übrigens nicht der zeitlichen Abfolge beim Kolloquium, sondern einer Ordnung, die als mögliche erst in der Rückschau sich herausgestellt hat. Das ist ein weiterer Beleg für den Facettenreichtum des Themas. So kann Gebautes eine modellhafte Selbst-beschreibung der Gesellschaft enthalten; es kann aber auch, ohne eine solche Intention bewusst zu verfolgen, soziale Strukturen und Ideologien reflektieren, und da wiederum vergangene ebenso wie heutige. Nun ist es in jedem Fall der moderne Betrachter, der sich „etwas denkt“ und die gebauten auf andere Strukturen abbildet. Man macht sich ein Bild: dass dies hilfreich, aber auch problematisch sein kann, wurde während der Tagung immer wieder mit Blick auf suggestive Bilder des digitalen Zeitalters diskutiert. Es ergab sich daraus gewissermaßen ein unterschwelliges Thema, das vielleicht auch einmal Gegenstand eines zukünftigen Kolloquiums sein könnte.
Dieser Band wäre nicht zustande gekommen ohne das beharrliche Engagement sowie die Umsicht, Er-fahrung und die fachliche ebenso wie die redaktionelle Kompetenz von Frau Dr. Heike Richter. Ihr gilt unser herzlicher Dank ebenso wie Frau Dr. Susanne Biegert vom Habelt Verlag für ihr gewohnt effizientes und kooperatives Wirken.
Den Autoren danken wir für die bereitwillige Fertigstellung und Lieferung ihrer Manuskripte trotz al-lenthalben hoher Arbeitsbelastung sowie allen, die zum Gelingen des Kolloquiums beigetragen und so eine Atmosphäre leichtsinniger Heiterkeit erzeugt haben, in der den Vortragenden die Zusagen für ihre Beiträge leicht zu entlocken waren.
Frankfurt a. M. und Regensburg im Oktober 2012
Wulf Raeck Dirk Steuernagel
Vorwort
Peter Breunig (Frankfurt a. M) Bedeutsam oder peripher? Gedanken zur Periodisierung der Vorgeschichte Afrikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roberto Risch (Barcelona)Die Architektur der Arbeits- und Gesellschaftsteilung in den Höhensiedlungen der frühen Bronzezeit Südostspaniens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rüdiger Krause (Frankfurt a. M.)Landsiedlungen, Rechteckhöfe und Höhenburgen. Siedlungsstrukturen und Siedlungshierarchien der älteren Eisenzeit im Nördlinger Ries (Baden-Württemberg, Bayern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan-Waalke Meyer (Frankfurt a. M.)Zur Frage der Entstehung der „Runden Städte“ und der Anfang der geplanten Siedlungsweisein Nordostsyrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michel al-Maqdissi (Damaskus)Materialen für die Stadtentwicklung in Syrien (zweiter Teil). Stadtplanung während der Zweiten Urbanen Revolution in Westsyrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svend Hansen, Meda Toderaş, Jürgen Wunderlich (Berlin/Bukarest/Frankfurt a. M.)Pietrele, Măgura Gorgana: Eine kupferzeitliche Siedlung an der Unteren Donau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jens Lüning (Köln)Zwei Gründergräber in der ältestbandkeramischen Siedlung Schwanfeld, Ldkr. Schweinfurt, Unterfranken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Susanne Sievers (Frankfurt a. M.)Manching – ein Oppidum nach Plan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wulf Raeck (Frankfurt a. M.)Plan und Überbau. Griechische Planstädte und ihre politische Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirk Steuernagel (Regensburg)Das Athenaheiligtum von Pergamon und das Verhältnis von Königtum und Polis im Hellenismus . . . . . . . . .
Alexander Heising (Freiburg i. Br.)Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim: Schicksal einer Kleinfestung in Spätantike und frühem Mittelalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans-Markus von Kaenel, Thomas Maurer, Albrecht Schlierer (Frankfurt a. M.)Wie das Gedachte das Gebaute verändert. Zur Umdeutung des Eiskellers der ehemaligen „Anstalt für Irre und Epileptische“ auf dem Areal des Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt a. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farbtafeln 1–25
Inhalt
V
1
21
41
61
71
85
99
115
125
139
151
167
151Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
Themenstellung
Der Obertitel der Tagung „Das Gebaute und das Gedachte“ lässt im speziellen Fall der spätrömischen Kleinfe-stung von Trebur-Astheim mehrere Abstraktionsebenen zu, die sich zu verfolgen lohnen1. Es sollen zwei The-menfelder näher untersucht werden:
1. die materielle Ebene, d. h. der archäologische Architekturbefund und die Annäherung an seine Rekon-struktion mittels literarischer Quellen und Parallelbefunde, an die sich das Problem der Wirkmächtigkeit heutiger Rekonstruktionen antiker Bauten anschließt, sowie
2. die Ebene der Transformation, also das Nachleben des römischen Baus im frühen Mittelalter bis zu seinem Abbruch in karolingischer Zeit, oder, etwas griffiger formuliert: Was dachten die fränkischen Siedler über das römische Gebaute?
Topographie und Baubefund
Bei der Kleinfestung von Trebur-Astheim, Kreis Groß-Gerau handelt es sich um eine der jüngsten römischen Anlagen auf hessischem Boden. Gelegen im nördlichen Hessischen Ried, wurde sie im Rahmen eines landschafts-archäologischen Forschungsprojektes der Abteilung „Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen“ der Goethe-Universität Frankfurt a. M. durch Begehungen, geophysikalische Prospektionen und gezielte Grabungs-sondagen erkundet. Entdeckt wurde die Fundstelle 1978 durch Lesefunde spätrömischer und frühmittelalterli-cher Scherben, ihre wahre Bedeutung als Befestigung gab sich jedoch erst durch geophysikalische Untersuchun-gen in den Jahren 1999/2000 zu erkennen. Eine Testgrabung im Jahr 2003 erbrachte dann weitere überraschende Einblicke in die Geschichte der Anlage, vor allem zu ihrem Nachleben im frühen Mittelalter2.
Der Fundplatz liegt nur wenige Kilometer südöstlich von Mogontiacum/Mainz, dem Hauptort der spätrömi-schen Provinz Germania Prima (Abb. 1)3. Die Festung von Astheim gehörte zum spätantiken Rheinlimes, und zwar zu jenen Vorposten auf der germanischen Flussseite, deren Lage der Autor Ammianus Marcellinus wie folgt beschreibt: „... nonnumquam etiam ultra flumen aedificiis positis subradens barbaros fines – Zuweilen wurden auch Gebäude jenseits des Stroms angelegt, wo er das Land der Barbaren berührt“4.
Die Festung wurde nicht an beliebiger Stelle errichtet, sondern an einem halb verlandeten Seitenarm des Rheins, knapp unterhalb der Mündung des römischen Landgrabens und des Schwarzbachs in eben diesen Seiten-arm (Abb. 2). Mit der Festung wurde also letztlich der Zufluss zweier rechtsrheinischer Gewässer in den Rhein kontrolliert. Damit sollte eine beliebte Taktik der Germanen an Rhein und Donau unterbunden werden – denn
1 Der nachfolgende Text entspricht dem nur geringfügig veränderten und mit Anmerkung versehenen Vortrag.2 Literaturauswahl zur Fundstelle: Fundber. Hessen 26, 1986, 446 s. v. Trebur-Astheim (E. Schenkel). – von Kaenel/Helfert/Maurer 2001,
160 f. Abb. 4. – Heising 2004a. – Heising 2004b. – Heising 2006. – Göldner/Heising 2006. – Maurer 2011, 202-204 (AST 2).3 Mainz in der Spätantike: Jung/Kappesser 2007.4 Amm. Marc. 28, 2, 2. – Übersetzung Seyfarth 1971, 113.
Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim:Schicksal einer Kleinfestung in Spätantike und frühem Mittelalter
Alexander Heising
152 Alexander Heising
Abb. 1. Spätantike Befestigungen im Umfeld von Mogontiacum/Mainz. Unten links: Darstellung der Stadtmauer von Mogontiacum und der Brückenkopffestung Castellum auf dem „Lyoner Bleimedaillon“ (um 300 n. Chr.?).
Abb. 2. Trebur-Astheim, spätantiker Schiffslände-Burgus. Lagerekonstruktion an einem Altrheinarm, in den Schwarzbach und Landgraben münden.
153Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
um auf römisches Gebiet übersetzen zu können, stiegen diese öfters am Oberlauf eines solchen Nebenflusses in kleine Boote (z. T. sogar Einbäume) und überquerten damit schnell und unbemerkt die durch zahlreiche Seitenarme und eine üppige Vegetation unübersichtliche Flussaue5.
Für die Kontrolle einer Flussgrenze waren solche an taktisch günstigen Plätzen gelegenen Festungen wie Ast-heim also unverzichtbar. Durch die vorgeschobene Position konnten derartige Anlagen nur von der Flussseite aus versorgt werden, so dass sie eine Art Hafen voraussetzten, in dem die Versorgungsschiffe einigermaßen sicher anzulanden waren. Dieser kombinierten Funktion – Festung und geschützte Anlegestelle – entsprechen auch die Grundrisse der meisten derartigen Anlagen an Rhein und Donau, die üblicherweise als Schiffslände-Burgi des Typs Engers/Veröce bezeichnet werden6.
5 Amm. Marc. 17, 13, 27; 31, 5, 3 (Donau). – Eine Taktik, die umgekehrt auch die römische Armee bei nächtlichen Flussfahrten anwandte, um den Rhein heimlich zu überqueren: Amm. Marc. 18, 2, 12. Vgl. Höckmann 1986, 402 f.
6 Höckmann 1986, 399-403. – Oldenstein 1992/2009, 322-325. – Brulet 2006, 164 f. – Nuber 2007, 339 f.
Abb. 3. Trebur-Astheim, spätantiker Schiffslände-Burgus. Graustufenbild der geoelektrischen Prospektion.
154 Alexander Heising
Das Bild der geoelektrischen Prospektion in Trebur-Astheim zeigt nun einen geradezu idealen Grundriss dieser Kleinfestungen (Abb. 3): Direkt am rechten Flussufer positioniert, stand im Zentrum der Festung ein turmartiges, 27 × 18 m großes Kernwerk (burgus) mit 3 m dicken Mauern. An dessen Schmalseiten setzten etwas weniger massive Flügelmauern an, die nach jeweils 7 m rechtwinklig abknickten. Die Ecken scheinen nicht eigens durch Türme gesichert worden zu sein, wie dies die meisten Parallelen nahe legen. Von hier aus führten die Flügelmauern bis in den Fluss hinein und schirmten so einen rund 45 m breiten Uferabschnitt als Hafenbecken ab. In einer Entfernung von ungefähr 20 m zum Kernwerk umgab ein 5 m breiter, flacher Sohl-graben die gesamte Anlage.
Während der Grabung 2003 zeigte sich, dass die römischen Befunde sehr stark erodiert waren. Die römische Oberfläche dürfte ungefähr 80 cm höher gelegen haben als heute, so dass keine antiken Nutzungshorizonte mehr anzutreffen waren. Die einzigen römerzeitlichen Schichten fanden sich in der unteren Verfüllung des Umfassungsgrabens, der aufgrund des sandigen Untergrundes nur als flacher, muldenförmiger Sohlgraben mit gestuften Wänden ausgeführt war. Das gleichzeitige Vorkommen von Land- und Süßwasserschnecken auf seiner Sohle deutet auf ein zeitweise feuchtes Milieu im Graben. Zumindest bei Hochwasser handelte es sich daher eher um einen Wassergraben als um einen trockenen Wehrgraben.
Vom originalen Mauerwerk der Festung war nichts mehr erhalten. In nachrömischer Zeit hatte man die Fundamente der Festung in mehreren Etappen bis auf den letzten Krümel ausgebrochen und das Steinmaterial in dem von Natur aus steinfreien Gebiet des Hessischen Rieds wieder verwendet. Stratigraphie und Funde legen nahe, den Ausbruch in drei Phasen anzunehmen: Im 8./9. Jh. wurden die lageweise vermörtelten, eingestampften Steinschichten der Fundamente systematisch ausgebrochen, wobei nur Kalk- und Sandsteine ab Handquader-größe aussortiert wurden. Kleinere Steine und sämtliche Mörtelbrocken blieben zurück. Im 12./13. Jh. erfolgte eine Nachlese, die vor allem auf die festen Steine, unabhängig von ihrer Größe zielte. Zuletzt wurden im 18. Jh. auch größere Mörtelbrocken und die noch letzten verbliebenen Steine ausgelesen. Wie üblich, war man bei den Ausbruchsarbeiten sehr ökonomisch vorgegangen; die Ausbruchsgruben spiegeln die ehemaligen Fundamente recht genau wider. Nur deshalb waren auch noch Details der Fassadengliederung des Burguskernwerks erhalten, wie ein Vorsprung an den Ecken der wasserseitigen Turmfront um ungefähr 40 cm.
Die Gussmauerfundamente des Kernwerks standen auf einem Rost eingerammter Holzpfähle, von dem sich allerdings nur noch schwache Verfärbungen im anstehenden Sandboden erhalten hatten. Zwei symmetrisch angelegte und nicht allzu tief fundamentierte Innenstützen belegen, dass das Kernwerk mehrgeschossig war, ein Detail, das aus dem Geophysikbild nicht hervorging. Nach der Zusammensetzung des Ausbruchschutts zu urteilen, bestanden die beiden Pfeiler weitgehend aus vermörteltem Ziegelbruch.
Die nördliche der beiden Flügelmauern saß an der untersuchten Stelle direkt auf einem „Rheinweiß“-Hori-zont auf, einer durch gleich bleibenden Grundwasserpegel natürlich entstandenen Schicht von Kalkausfällungen meist in plattigen Bänken, so dass hier ein unterstützender Pfahlrost nicht notwendig war bzw. zu aufwändig gewesen wäre. Die erhaltenen Reste der Flügelmauern reichten noch bis zum zwei Meter tief abfallenden Steilufer des heutigen Schwarzbachs, der dem römischen Altrheinarm entspricht. Die ursprünglich in den Fluss ragenden Mauerpartien sind abgeschwemmt, so dass deren Gestalt unklar bleibt. Aufgrund von Parallelen an der Donau geht man aber üblicherweise von turmartigen Erweiterungen dieser Mauerköpfe aus7.
Von den regelmäßigen Begehungen der 1980er und 1990er Jahre liegen erstaunlich viele Lesefunde vor, insbesondere Keramik ist gut vertreten. Während der Grabung fanden sich dagegen nur wenige Reste von Bau-material. Ziegelbruch von tegulae, imbrices und Hypokaustplatten mit Mörtelspuren auf den Bruchflächen sowie Kalkstein-Handquader mit primären Mörtelanhaftungen, die sich vom eher hellgrauen, spätantiken Mörtel unterschieden, beweisen, dass die Masse des Baumaterials aus Spolien bestanden haben dürfte. Offenbar hat man für den Bau der Festung auf die Ruinenstellen einer oder mehrerer mittelkaiserzeitlicher villae rusticae in der Umgebung zurückgegriffen, falls die Spolien nicht sogar vom gegenseitigen, linksrheinischen Ufer heran-gebracht wurden8.
Die relativ genaue Anfangsdatierung der Festung ist einem glücklichen Zufall zu verdanken: Denn aus der Ausbruchsgrube des Kernwerks stammt eine Münze, an deren Rückseite noch spätrömischer Mörtel klebte. Das
7 Soproni 1985, 69 (Szentendre-Dera patak). – Visy 2003, 169 f. (Nógrádveröce); 179 f. (Dunafalva/Contra Florentiam).8 Die Baumaterialien des Ländeburgus von Mannheim-Neckarau stammen mehrheitlich wohl von der linken Rheinseite: Wieczorek
1995, 45.
155Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
Stück kann also nur während der Bauarbeiten verloren worden sein, noch bevor der Mörtel abbinden konnte. Die fast prägefrische Münze des Valens wurde 364/375 n. Chr. in Lyon emittiert und gibt damit einen guten Terminus post quem für den Bau des Kernwerks9.
Ein Festungsbauprogramm unter Kaiser Valentinian I.
Die Astheimer Festung gehört also zu jenem von Ammianus Marcellinus für die Jahre ab 369 n. Chr. überlieferten Festungsbauprogramm des Kaisers Valentinian I., mit dem er die Rheingrenze befestigen ließ: „Valentinianus aber schmiedete bedeutende und nutzbringende Pläne. Den ganzen Rhein, angefangen von Rätien bis zur Meerenge des Ozeans, versah er mit großen Befestigungsanlagen: Militärlager und Kastelle ließ er hoch emporziehen, fer-ner in dichten Abständen an geeigneten Stellen Türme errichten, soweit sich die gallischen Länder erstreckten.“ Der nächste Satz, bereits oben zitiert, dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach direkt auf die Festungsklasse der Schiffslände-Burgi beziehen: „Zuweilen wurden auch Gebäude jenseits des Stroms angelegt, wo er das Land der Barbaren berührt“10.
9 Cen Valens 364/375 OF [ ]LVG[ ] Lugdunum RIC 12/21a (Bestimmung D. Wigg-Wolf, Frankfurt a. M.).10 Amm. Marc. 28, 2. 1–2. – Übersetzung Seyfarth 1971, 113.
Abb. 4. Grundrisse der verschiedenen Typen valentinianischer Festungsbauten.
156 Alexander Heising
Mit einem im Codex Theodosianus vom 19. Juni 364 überlieferten Gesetzestext liegt auch eine zeitgenös-sische Quelle vor, wie man sich die kaiserliche Initiative eines solchen Bauprogramms, in diesem Fall an der Donau-Flussgrenze, vorstellen muss:
„Valentinian und Valens an Tautomedes, Dux von Dacia Ripensis. Entlang der Grenze, die Eurer Gewalt anvertraut ist, sollt Ihr, während der Zeit Eurer Amtsgewalt, jährlich Türme an geeigneten Orten errichten, zusätzlich zu den Türmen, die instandgesetzt werden müssen, sollte dies nötig sein. Solltet Ihr die Autorität dieser Anordnung missachten, sollt Ihr, wenn Eure Amtszeit geendet hat, an die Grenze zurückgerufen und gezwungen werden, auf Eure eigenen Kosten die Bauwerke zu errichten, die Ihr in Eurer Amtszeit hättet errichten sollen mit der Hilfe der Soldaten und auf öffentliche Kosten. Erlassen am 13. Tag vor den Kalenden des Juli in Mailand und Konsulatsjahr im des geheiligten Jovian und des Varronianus“11.
Die örtliche Ausführungsgewalt lag also bei den duces, während das kaiserliche officium zumindest eine Idee des Endzustandes der Grenzbefestigungen gehabt haben dürfte.
Nach der gängigen Forschungsmeinung lässt sich das entsprechende Bauprogramm des Valentinianus I. entlang der Rheinzone archäologisch gut nachweisen. Die Anlagen reichen von kleinen Wachttürmen direkt am Rheinufer bis zu mehreren Hektar großen Kastellen der beweglichen Reitertruppen im Hinterland (Abb. 4)12. Neben dem bereits zitierten Gesetzestext sprechen auch die Wiederholung und die Originalität einzelner
11 Cod. Theodosianus 15, 3, 13. – Übersetzung Jung 2000/2001, Quellenanhang Nr. 8.12 Nuber 2007. – Heising 2008, 192 Anm. 807.
Abb. 5. Karte der rechtsrheinischen Schiffslände-Burgi um 370 n. Chr. am mittleren Rheinabschnitt.
157Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
Abb. 6. Grundrisse der Schiffslände-Burgi am Rhein. 1 Trebur-Astheim (Geoelektrik). – 2 Biblis-Zullestein. – 3 Neuwied-Engers. – 4 Ladenburg. – 5 Mannheim-Neckarau.
158 Alexander Heising
Festungsgrundrisse, wie z. B. die der Uferbefestigungen Mumpf und Aegerten am schweizerischen Hochrhein, für ein übergeordnet geplantes und innerhalb von nur wenigen Jahren ausgeführtes Bauprogramm.
Die Befestigungsklasse der Schiffslände-Burgi, wie sie durch das Astheimer Beispiel vertreten wird, ist am Rhein bisher fünfmal nachgewiesen, bei weiteren drei Fundstellen wird vermutet, dass es sich um vergleichbare Anlagen handelt (Abb. 5)13. Auffälligerweise liegen alle Anlagen im Amtsbezirk des Mainzer Dux, während sie in den südlich und nördlich anschließenden Bereichen fehlen. Es ist unklar, ob sich hier tatsächlich antike Verhältnisse widerspiegeln oder ob für dieses Bild der Forschungsstand verantwortlich zu machen ist.
Die Grundrisse der fünf bekannten Schiffslände-Burgi sind sich sehr ähnlich, auch wenn sie in Details nicht immer übereinstimmen (Abb. 6). Den besten Vergleich zu Astheim bietet der benachbarte Burgus von Biblis-Zullestein14. Abgesehen von den Ecktürmen der Flügelmauern, die in Astheim zu fehlen scheinen, sind die beiden Anlagen praktisch identisch, was für einen übergeordneten Bauplan sprechen könnte.
Funktion und Besatzung
Die Schiffslände-Burgi waren als vorgeschobene Posten Teil eines auf die Flotte ausgerichteten Verteidigungskon-zeptes der ripae rheni. Eine ihrer Hauptfunktionen dürfte in der bereits geschilderten Überwachung und Blocka-de von rechtsrheinischen Nebenflüssen als natürlichen Einfallpforten bestanden haben. Dabei hatte die Burgus-besatzung nicht die kämpferische Abwehr der feindlichen Kräfte zur Aufgabe, sondern zuallererst die frühzeitige Sichtung und Meldung der drohenden Gefahr15. Zusätzlich konnten von hier aus Aufklärer oder Spähtrupps zur Vorfeldsicherung agieren, wie vielleicht die Verlegung einer Einheit von berittenen Bogenschützen (equites sagittarii) nach Contra Florentiam zeigen mag, einem in der Not. Dign. Occ. genannten Festungsplatz an der Donau, den Soproni mit einem Schiffsländeburgus in Dunafalva identifizieren will16. Mit den rechtsrheinischen Burgi hatte man also sozusagen den Fuß in der Tür, mit ihnen „sollte der römische Einfluss in der Pufferzone wirksam aufrechterhalten werden“, wie Baatz treffend formulierte17. Für die dauerhafte Aufnahme von Reiter-truppen sind die Schiffslände-Burgi allerdings denkbar ungeeignet, weil viel zu klein. Schätzungen der dauerhaf-ten Besatzungsstärke gehen von ungefähr 16 (für den mit Astheim vergleichbaren Burgus von Neuwied-Engers) bis maximal 30-45 Mann Limitantruppen (für Ladenburg) aus18. Der Fund einer möglichen Ballistenkugel aus Sandstein im Burgus Ladenburg könnte andeuten, dass die Türme mit Katapulten bewehrt waren19.
Die Burgusbesatzungen werden vor allem vom Schiff aus versorgt worden sein. Die Kleinfestungen waren damit regelmäßige Anlaufstationen für Patrouillenschiffe der spätrömischen Rheinflotte, deren Schiffstyp der Lusoria auch kleinere Gewässer und Rheinarme befahren konnte20. Aus taktischen und nautischen Gründen müssen die operativen Basen der Burgusbesatzungen jeweils stromaufwärts gelegen haben. Dieser linksrheinische Gegenpart fehlt noch für Trebur-Astheim. Der nächstgelegene, in der Notitia Dignitatum genannte Garnisonsort ist Borgetomagi/Vangionis – Worms. Näher läge der noch nicht sicher lokalisierte antike Ort Bonconica/Bouconica zwischen Worms und Mainz, für den vor allem Nierstein oder Oppenheim in Frage kommen. Allerdings ist Bouconica nicht in der Notitia und damit auch nicht als Militärstandort verzeichnet21.
Die wenigen überlieferten Befunde aus dem Inneren der Burgi dienten überwiegend der Versorgung der Burgusbesatzung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser. In Veröce lagen im Turminneren eine Vorratsgrube, eine
13 Lit.-Verweise zu den einzelnen Anlagen vgl. Heising 2008, 192 Anm. 807. Ein weiterer Schiffslände-Burgus wird bei Haupt 2006, 75 Abb. 1 im Bereich der NW-Siedlung von Mainz (sogen. Dimesser Ort) kartiert. In der entsprechenden Monographie Jung 2009, 241-248 findet sich jedoch kein Hinweis auf eine entsprechende Anlage.
14 Herrmann 1989. – Schwarz 2009.15 Bockius 2006, 212 f.16 Not. Dig. Occ. XXXIII 44 (um 380 n. Chr.?). – Soproni 1985, 79.17 Baatz 1989, 505.18 Heukemes 1981, 466. – Grunwald 2000, 39.19 Heukemes 1981, 466.20 Höckmann 1986. – Bockius 2006, 208-215 mit weiterer Lit. – Konen 2006.21 Scharf 2005, 45-48.
159Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
Handmühle und ein Brunnen22. Auch das Ladenburger Kernwerk wies einen innen liegenden Brunnen auf23. Allein die Befunde vom Zullestein und in Neuwied-Engers mögen Speicherkapazitäten andeuten, die über die Selbstversorgung der Besatzungen hinausgehen könnten, vorausgesetzt, die Schiffsländen wurden regelmäßig angefahren und mit Proviant versorgt. So fanden sich im Burgus Zullestein schwer interpretierbare Reste eines unterlüfteten Bodens (für Getreidelagerung?)24. Und in Neuwied-Engers konnte während der Ausgrabung von 1819/20 eine „sehr grosse Masse verbrannten Getreides, welches in Schichten von 3 bis 9 Zoll Dicke, an einigen Stellen sogar mehrere Fuß hoch lag“, aufgedeckt werden. Es handelte sich dabei „um Roggen, Gerste, meistens aber Weizen“25. Insbesondere der Fund von Engers wird gelegentlich mit einem literarisch überlieferten Baupro-gramm des Caesars Iulianus II. (Apostata) im Jahr 359 n. Chr. verknüpft26. Damals ließ Julian bei der Besetzung des zuvor durch die Germanen verwüsteten Rheinlands entlang des Flusses „längst zerstörte Städte aufsuchen, und soweit sie zurückgewonnen waren, neu befestigen, auch Getreidespeicher anstelle der verbrannten anlegen, in denen man das Getreide einlagern konnte, das gewöhnlich von den britannischen Inseln angeliefert wurde“27. Der Getreidetransport sollte dabei über Flussschiffe als Massentransporter abgewickelt werden28. M. E. ist eine Verknüpfung der rheinischen Schiffslände-Burgi mit dem iulianischen Wiederaufbauprogramm allerdings sehr problematisch. Warum sollten Speicher für die Versorgung der gallischen Stadtbevölkerung ausgerechnet auf der germanischen Flussseite angelegt werden? In den Quellen werden dementsprechend auch nur rechtsrheinische Plätze genannt, die wiederbesetzt wurden. Eine zwingende Frühdatierung der Schiffslände-Burgi in die Zeit vor Valentinian ergibt sich daraus jedenfalls nicht. Wenn man wirklich von der Funktion der Burgi als Getreidespei-cher ausgehen will, dann bietet sich unter Umständen eine weitere Interpretation an, die in der Zukunft allerdings kritisch zu prüfen sein wird: Die Burgi könnten auch eingesammeltes Korn aus den germanischen Gebieten aufgenommen haben, das die grenznahen Stämme entweder lieferten oder abzugeben hatten. Dass die Burgi möglicherweise auch wirtschaftliche Funktionen hatten, wird seit der These von Jorns, der den Zullestein mit dem spätrömischen Granitabbau am Felsberg und dem benachbarten Marmorabbau bei Auerbach im Odenwald in Verbindung brachte, jedenfalls vielfach in Erwähnung gezogen29. Kuhnen hielt die Schiffslände-Burgi deshalb nicht zuletzt für Anlagen, mit denen „die rechtsrheinischen Nebenflüsse wirtschaftlich erschlossen“ worden seien30. Allerdings stehen die konstantinische Datierung der Steinbruchtätigkeiten und das sicher valentiniani-sche Baudatum des Burgus Zullestein in einem gewissen Widerspruch zueinander, der nur über eine sorgfältige Befundanalyse der Grabungen am Trierer Dom zu lösen sein wird31.
Rekonstruktion der Schiffslände-Burgi
Den Ausgangspunkt für mögliche Rekonstruktionen (Abb. 7; Taf. 19, 1) bilden Quellentexte, Inschriften und die archäologischen Befunde. Einen besonderen Stellenwert für die Visualisierung nehmen zwei Literaturstellen ein, die zeigen, dass gerade die Festungsklasse der Schiffslände-Burgi für die kaiserliche Propaganda von großer Bedeutung war. Schleiermacher nahm deshalb an, dass dieser Festungstyp gar eine Erfindung Valentinians oder seines engsten Beraterstabes gewesen sein könnte32. Soweit würde ich nicht gehen wollen, aber es schon auffäl-lig, dass die virtus des Kaisers gerade am Beispiel dieser doch auf den ersten Blick eher kleinen, unauffälligen Festungen beschworen wird. Die rhetorische Überhöhung der geschilderten Monumente durch Ammianus Marcellinus und Symmachus mag mit der exponierten Lage der Festungen im Barbarenland und der damit
22 Soproni 1978, 78. – Schleiermacher 1942, 192 geht irrtümlich von zwei Vorratsgruben aus.23 Heukemes 1981, 441.24 Jorns 1973, 78. – Jorns 1974, 430 f. – Jorns 1979, 117.25 Dorow 1826, 24.26 Jung 2000/20001, 16 f.27 Amm. Marc. 18, 2, 3. – Sinngemäße Übersetzung nach Seyfarth 1968, 9.28 Lib. Or. 18, 82 f.29 Erstmals Jorns 1974, 428; vgl. auch Jorns in: Fahlbusch u. a. 1985, 68-71; Wagner 1990, 100-102 mit weiterer Lit.30 Kuhnen 2007, 542. – Eine Prüfung dieser Interpretation kann hier nicht erfolgen; dazu sind u. a. umfangreichere Kapazitätsberechnungen
der maximal aufzunehmenden Getreidemengen notwendig.31 Weber in: Goethert/Weber 2010, 181-199, bes. 185 f.32 Schleiermacher 1942, 195.
160 Alexander Heising
verbundenen Propaganda-Wirkung nicht nur auf die germanische Seite zusammenhängen. Sie waren gleichsam steingewordener Ausdruck des römischen Einflusses auf eine Pufferzone jenseits des Flusses und damit auch innenpolitisch bedeutsam.
Der erste Text findet sich bei Ammianus Marcellinus zum Jahr 36933. Hier wird wortreich eine Episode geschildert, in der es nur den energischen Bemühungen des Kaisers zu verdanken war, dass eine bis in den Neckar hineinreichende Schutzbefestigung trotz aller Gefahren durch die Strömung fertig gestellt werden konnte: „Schließlich kamen ihm [Valentinian I.] Bedenken, daß eine hochragende und feste Burg, die er selbst vom ersten Anfang an gegründet hatte, von dem vorüberfließenden Neckar allmählich durch übermäßigen Wellenschlag un-tergraben werden könnte. Darum plante er, den Flusslauf zu verlegen, zog erfahrende Wasserbausachverständige hinzu und nahm mit einer hinreichenden Abteilung von Soldaten das schwierige Werk in Angriff. Viele Tage lang wurden Kästen aus Eichenstämmen zusammengefügt und ins Flussbett geschafft. Aber obwohl man sie mehrmals immer wieder durch riesige Pfähle befestigte, wurden sie durch die ansteigenden Wassermassen überflutet und gingen, durch die Gewalt der Strömung losgerissen, verloren. Doch trugen die energischen Bemühungen des Kaisers und der Soldaten, die während der Arbeit oft bis zum Kinn im Wasser standen, den Sieg davon. Endlich wurde, nicht ohne Lebensgefahr für einige Leute, die Schutzbefestigung von dem Druck des wild strömenden Wassers befreit und ist jetzt gesichert.“ Bei dem Bauwerk könnte es sich um eine der Schiffsländen von Ladenburg oder Mannheim-Neckarau gehandelt haben.
Die zweite Stelle ist eine Passage aus einer Lobrede des Symmachus auf Valentinian, datiert ins Jahr 370 n. Chr.34. Hier schildert Symmachus das Aussehen einer Schiffslände am Rhein so anschaulich, dass wir uns wirklich ein Bild vom Gebauten machen können; als erster hat Wilhelm Schleiermacher 1942 den Text in eine Systemzeichnung übertragen (Abb. 7, 1): „In welche Gefahr geriet meine Rede! Die schöne Gestalt der Stadt, die Du gründetest, wage ich weder zu beschreiben noch zu verschweigen. Ich werde jedoch der Pflichttreue dienen, die zur Kühnheit rät. Zuerst fällt dem Betrachter das Geschenk der Natur ins Auge, eine Geländeerhebung, an der zwei Flüsse sanft vorbeiströmen. Hierauf befestigte eine kunstfertige Hand diese (natürliche) Einrichtung der Zwillingsuferböschung mit in das Wasser gesenkten Holz- und Steinsubstruktionen. Dann steigen u-förmig die Kastellmauern empor, die nur auf der Seite abschüssig geneigt sind, wo die Fluten die Ränder der Türme berühren. Denn der Rhein wird durch Flügelmauern, die ihn von zwei Seiten umfassen, dazu gedrängt, daß er zu verschiedenen Zwecken einen gesicherten Nachschub gewährt. Wie diese selbst, die von Schutzwehren im Vorfeld umgeben sind, durch ihre Fortifikationen hinreichend gerüstet sind, so eröffnet die durch häufige Lücken unterbrochene Mauer, die sie verbindet, heimlichen Pfeilschüssen einen Ausgang. In der Mitte ragt golden der erhabene Hauptbau hervor, gekrönt von einem Dach anstelle eines Siegesmals, das von einem Panzer aus glatten Bleiplatten überspannt ist, die in nach vorne abschüssigen Reihen verlegt sind ...“
Die Schilderung ist so genau, dass Symmachus tatsächlich einen solchen Schiffsländen-Burgus mit eigenen Augen gesehen haben dürfte. Dafür spricht auch, dass einige der im Text erwähnten Details am konkreten archäo-logischen Befund nachzuweisen sind. Der „goldene“ Hauptbau bei Symmachus geht vielleicht darauf zurück, dass die Burgi innen und außen strahlend weiß verputzt gewesen sind; entsprechende Verputzreste haben sich am Zullestein erhalten35. Die stets nachgewiesenen Innenstützen und die noch 6,3 m hoch erhaltenen Mauerreste von Ladenburg deuten auf eine Mehrgeschossigkeit der zentralen Kernwerke36. Von den erwähnten Bleidächern kennt man Blechreste aus Ladenburg und Neuwied-Engers37. Auch in Astheim fanden wir geringe Mengen verschmolzenen Bleis. Zwei aus valentinianischen Burgi am Schweizer Hochrhein bekannte schießschartenar-tige Fensterlaibungen erinnern stark an die von Symmachus erwähnten, für heimliche Pfeilschüsse geeigneten Mauerschlitze38.
33 Amm. Marc. 28, 2, 2-4. – Übersetzung nach Seyfarth 1971, 113.34 Symmachus orat. 2, 20. – Übersetzung nach Pabst 1989, 81.35 Zullestein: Jorns 1979, 117.36 Heukemes 1981, 443.37 Ladenburg: Heukemes 1981, 454 Abb. 9, 60; 462; 466. – Neuwied-Engers: Dorow 1826, 24: „Die Menge großer Stücke tropfsteinartig
geschmolzenen Bleies, die sich in dem Getreide vorfanden, könnten zu der Vermutung fuhren, der Turm sei mit Bleiplatten gedeckt gewesen.“
38 Stehlin/von Gonzenbach 1957, 16 Abb. 8 (Muttenz BL „Au-Hard“); 56; Taf. 9, 2 (Wallbach AG „Stelli“).
161Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
Abb. 7. Rekonstruktionsbilder rheinischer Schiffslände-Burgi. 1 Mannheim-Neckarau 1942. – 2 Neuwied-Engers 1990. –3 Mannheim-Neckarau 1995. – 4 Zullestein 1981.
162 Alexander Heising
Die Wirkmächtigkeit der Rekonstruktionsbilder
Während das „Urbild“ von 1942 in der Übertragung des Symmachus-Textes durch Wilhelm Schleiermacher nur die Kubatur wiedergibt, werden spätere Rekonstruktionen wesentlich detaillierter ausgeführt (Abb. 7). Einige bestimmende Elemente kommen immer wieder vor: das allseits verputzte Mauerwerk, die schießschartenartigen Fenster in den unteren Stockwerken des Kernwerks, die größeren Wandöffnungen unter dem Dach sowie die Form des Zeltdachs für die Türme. Das sind alles Elemente, wie wir uns mehr oder weniger unbewusst „das Römische“ vorstellen, wobei uns visuelle Erfahrungen geprägt haben. Durch die zahllosen Rekonstruktionsdar-stellungen, die auf wenige „Urbilder“ zurückgeführt werden können (in der mittleren Kaiserzeit z. B. die Reliefs der Traians- und Marcussäule), sowie durch die zunehmenden Reenactment-Events mit den immer gleichen Komponenten haben sich aufgrund der stetigen Wiederholung feste Muster von Vorstellungsbildern eingeschlif-fen, welche (Bild-)Elemente als „römisch“ gelten können und welche nicht. Man könnte die oben vorgestellten Zeichnungen daher auch als „gefühlte Rekonstruktion“ bezeichnen. Was damit gemeint ist, wird deutlich, wenn man gegen diese Rekonstruktionen der Schiffslände-Burgi durch provinzialrömische Archäologen die Rekonstruktion aus der Hand eines Urgeschichts-Wissenschaftlers setzt (Taf. 19, 2). Der Burgus Zullestein wirkt hier mit seinem niedrigen Kernwerk, dem Satteldach und den kannelierten Doppelbogenfenstern (trotz der von Limestürmen der Odenwaldlinie übernommenen Fenstersäulen) eher wie eine romanische Kapelle als eine spätrömische Festung. Dabei kann diese Rekonstruktion objektiv gesehen genauso falsch oder richtig sein wie die provinzialrömische „Bildtradition“. Das Beispiel zeigt deutlich, wie sehr unsere eigenen Erfahrungen jenes Bild prägen, dass wir uns von antiken Bauten machen – selbst wenn wir über eine relativ genaue antike Schilderung des Gebauten verfügen. Insofern können unsere gedachten Rekonstruktionen immer nur mehr oder weniger zutreffende Annäherungen an das Gebaute sein.
Nun ist auch der Burgus von Astheim in der Bildtradition von Schleiermacher rekonstruiert worden, und zwar durch Raphael Kahlenberg, damals ein archäologiebegeisterter Schüler, heute Student der Vor- und Frühge-schichte in Heidelberg (Taf. 20). Er hat seine computergestütze Rekonstruktion erstmals 2004 ins Internet ge-stellt und dann in mehreren Stufen verbessert. Als kritischer Geist hat er dann jedoch 2007 alle Bilder gelöscht, weil er sich der Gefahren, die eine solch perfekte, fast fotorealistische Darstellung in sich birgt, bewusst wurde39. Allerdings muss ich gestehen, die Bilder sind so wirkmächtig, dass ich mir zumindest den Burgus von Astheim kaum noch anders vorstellen kann …
Das Nachleben der römischen Befestigung
Dank einiger Befunde lässt sich die ungefähre Nutzungsdauer des Festungsareals abschätzen, wenn auch die Art und die Intensität dieser Nutzung mit zunehmender Zeit immer schwieriger zu bestimmen sind. Aufgrund der zahlreichen spätrömischen Keramiklesefunde vom Burgusareal ist mit einer kontinuierlichen Nutzung der Festung von 370 n. Chr. bis mindestens 430/450 n. Chr. zu rechnen, so dass ein Ende der regulären Besatzung durch römisch-germanische Truppenverbände um die Mitte des 5. Jhs. wahrscheinlich ist. Soweit bekannt, enden auch die anderen rheinischen Schiffslände-Burgi zu dieser Zeit, mit Ausnahme der Ladenburger Befestigung, die schon um 400 aufgegeben wurde40.
Aus der zweiten Hälfte des 5. Jhs. liegen in Trebur-Astheim nur zwei Scherben von Rillenbechern vor, die wohl mit der Anwesenheit von Germanen (Alamannen) zu verbinden sind und auf eine wie auch immer geartete Weiternutzung des Platzes hinweisen41. Konkreter wird die Nutzung des Burgusareals erst wieder ab ca. 500 n. Chr., als der Bereich um Astheim fränkisch wird. Denn bereits kurz danach wird im Bermenbereich zwischen dem Kernwerk und dem Umfassungsgraben ein Gräberfeld angelegt, das mindestens bis zur Mitte des 8. Jhs. belegt wurde. Die genaue Ausdehnung des Friedhofs und die Anzahl der Gräber sind noch unbekannt. In den
39 Eine ausführliche Begründung für sein Vorgehen findet sich auf: http://www.tribur.de/blog/?p=704 [02.04.2011].40 Neuwied-Engers: Grunwald 1997, 312; Grunwald 2000, 40 (Ende wohl in den 460er Jahren). – Mannheim-Neckarau: Wieczorek
1995, 63. 90 (Nutzung bis 1. Hälfte 5. Jahrhundert). – Ladenburg: Heukemes 1981, 470 (Ende um 400 n. Chr.).41 Parallelen u. a.: Möller 1987, Taf. 103, 9 (Trebur, Grab von 1899).
163Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
wenigen geöffneten Schnitten lagen die Gräber aber so dicht, dass von einem regelrechten Reihengräberfriedhof auszugehen ist. Mindestens im Osten ging das Gräberfeld auch über den vom Graben abgegrenzten ehemali-gen Festungsbezirk hinaus. Hier sind auf der Landseite der Festung in der Geomagnetik drei Kreisgräben von Grabhügeln zu erkennen, die ganz offensichtlich bewusst auf den ehemaligen Festungskomplex ausgerichtet waren (Taf. 21).
In Hinblick auf das Schicksal der römischen Befestigung sind die Verfüllungen der Grabgruben von entschei-dender Bedeutung, weil mit ihrer Hilfe der ungefähre Zeitpunkt und das Ausmaß der Zerstörung bestimmt werden können. Die Gräber der ersten Generation, darunter auch ein Kindergrab, sind vor allem an freige-formten Töpfen kenntlich, deren Dekor mit flüchtig eingeritzten Haken sehr einheitlich ist42. Die Verfüllung dieser ersten Gräbergeneration zwischen 500-530/540 n. Chr. ist noch völlig frei von Bauschutt, der auf einen gezielten Abbruch der spätrömischen Festung hindeuten könnte. Im späten 6. Jh. dürfte der Bau dann langsam zur Ruine zerfallen sein. Spätestens im frühen 7. Jh. belegen dann Ziegelreste und einzelne Mörtelspuren in den Grabgruben, dass erste Teile des Burgus vermutlich gezielt zur Beschaffung von Baumaterial ruiniert wurden; so wurde z. B. der Boden einer allerdings nur randlich angeschnittenen Grabgrube mit einzelnen Handquadern aus der ehemaligen Festung ausgelegt. Ab dem späten 7. Jh. finden sich dann auch Gräber innerhalb des durch die Zangenmauern abgeschirmten Hafenbereichs, so dass spätestens von diesem Zeitpunkt an auch die geschützte Anlegestelle ihre Funktion wohl weitgehend verloren hatte.
Andererseits zeigen die Kreisgräben, die sich an der römischen Befestigung orientieren, dass der Burgus wenigstens als imposante Ruine noch bis in das beginnende 8. Jh. eine klare Landmarke gebildet haben muss. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist auch die reichste Bestattung zu sehen, die während der Grabung 2003 aufgedeckt wurde (Taf. 22, 1). Unter dem südlichen Grabhügel wurde um 700/720 n. Chr. oder kurz danach ein älterer Mann mit voller Waffenausstattung (Spatha, Sax, Schild und Lanze) in einer hölzernen Kammer bestattet. Sporen wiesen ihn als Reiter aus. Die mit Silberdraht und –blech verzierten Waffen deuten auf einen hochrangigen Toten. Insbesondere die Spatha gehört mit ihrem aufwändigen Dekor aus Niello und Silberein-lagearbeiten zu den hochwertigsten Waffen, die wir aus dieser Zeit im späten Frankenreich kennen (Taf. 22, 2).
Vielleicht kann der zu seiner Zeit prominente Tote mit der Familie jenes Ascmund43 in Verbindung gebracht werden, der wohl namengebend für die im Lorscher Reichsurbar 764/765 erwähnte Ortschaft Askemundestein war. Der Frankfurter Sprachwissenschaftler Rainer Metzner vermutet – in Analogie zum Schiffsländeburgus Zullestein an der Weschnitzmündung – in diesem heute abgegangenen Askemundestein einen hafenähnlichen, befestigten Platz in der Nähe des heutigen Astheim, so dass es zumindest naheläge, diese Örtlichkeit mit den 2003 gegrabenen Schiffslände-Burgus zu identifizieren44. Metzners These zweier unterschiedlicher Orte – Askmun-tesheim als heutiges Astheim und Askemundestein als abgegangener Hafenplatz innerhalb der gleichen Gemarkung – ist unter Sprachwissenschaftlern zwar umstritten45, sollte die auffällige etymologische Parallele zum Zullestein aber nicht nur auf einen Abschreibefehler zurückgehen, so wäre ein guter Grund für den offensichtlichen Lage-bezug der Grabhügel zu der langsam zerfallenen antiken Ruine gefunden: Hier hat ein spätfränkischer Patron bewusst die Nähe zu den römischen Resten gesucht, die wahrscheinlich nicht nur eine klare Landmarke bildeten, sondern auch ideologisch aufgeladen waren, möglicherweise als Herrenhof, als Handelsplatz mit Hafen, als Ei-genkirche, als Sondergrablege oder als monumentaler Ausdruck rechtlicher Kontinuität von Besitzansprüchen.
Ab dem späten 8. oder frühen 9. Jh. spielte die ehemalige Befestigung der Römer aber keine Rolle mehr. In der Verfüllung der jüngsten, bereits beigabenlosen Gräber finden sich massive Abbruchspuren in Form von Ziegeln, Steinsplitt und Mörtelresten. Der Komplettabbruch des Burgus dürfte mit dem Bau der nahe gelegenen Königspfalz von Trebur in Zusammenhang stehen, die erstmals im Jahr 829 urkundlich erwähnt wird46. Da die Pfalz nur wenige Kilometer den Schwarzbach aufwärts lag, war es ein Leichtes, das am Burgus gewonnene Baumaterial den Bach hinaufzutreideln. Dieser Abbruch eines bis dahin im Bewusstsein der örtlichen Gemein-schaft fest verankerten Monuments macht nicht nur den allgemeinen Übergang von kleinen Grundherrschaften der Merowingerzeit in karolingisches Königsgut auch materiell bewusst, ein Prozess, der auch durch das bereits
42 Vergleichbare Beispiele aus dem südmainischen Hessen: Möller 1987, Taf. 53, 7 (Groß-Umstadt); 81, 2 (Roedermark-Urberach).43 Förstemann 1968, Sp. 148.44 Metzner 2001, 128 f.45 K. Andriessen, Liste urkundlicher Ersterwähnungen hessischer Ortsnamen, s. v. Astheim. Internet-Resource: http://www.andriessen.
de/Hess_SN/Ortsnamen/Ortsnamen.html [09.03.2011].46 Gockel 1979. – Busch 2006.
164 Alexander Heising
erwähnte Lorscher Reichsurbar fassbar wird. Der Abbruch des antiken Baus dürfte dazu auch einem neuen Zeitgeist entsprochen haben. Denn spätestens ab dem 9. Jh. „kommt in gebildeten Kreisen ein weit verbreitetes Bewusstsein zum Ausdruck, dass man sich nicht mehr wie zuvor der römischen Epoche zugehörig fühlte“. Die Antike wird jetzt als abgeschlossene Geschichte angesehen47.
Damit fassen wir auch mentalitätsgeschichtlich den endgültigen Bruch, die Trennung zwischen Antike und Mittelalter. Insofern verkörperte der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim geradezu die ausgehende Antike, die – nachdem man sich noch Jahrhunderte lang in ihrer Tradition gesehen hatte – nun einem neuen Zeitalter weichen musste.
47 Clemens 2003, 429.
47 Clemens 2003, 429.
Literatur
Baatz 1989: D. Baatz, Zullestein. In: D. Baatz/F.-R. Herrmann (Hrsg.), Die Römer in Hessen² (Stuttgart 1989) 504-506.
Bockius 2006: R. Bockius, Die spätrömischen Schiffswracks aus Mainz. Schiffsarchäologisch-technikgeschichtliche Untersuchung spätantiker Schiffsfunde vom nördlichen Oberrhein. Monogr. Röm.-Germ. Zentralmus. 67 (Mainz 2006).
Brulet 2006: R. Brulet, L’architecture militaire romaine en Gaule pendant l’Antiquité tardive. In: M. Reddé, R. Brulet, R. Fellmann, J. K. Haalebos, S. von Schnurbein (Hrsg.), Les fortifications militaires. L’architecture de la Gaule romaine. Doc. Arch. Française 100 (Bordeaux 2006) 155-179.
Busch 2006: J. W. Busch, Trebur 829: Ein Königshof am Mittelrhein. – Die Pfalz Trebur unter König Heinrich IV. vom Schauplatz großer Politik zum gemiedenen Ort. Privatdruck der Gesellschaft Heimat und Geschichte e. V. Trebur (Trebur 2006).
Dorow 1826: W. Dorow, Römische Alterthümer in und um Neuwied am Rhein, mit Grundrissen, Aufrissen und Durchschnitten des daselbst ausgegrabenen Kastells, und Darstellungen der darin gefundenen Gegenstände (Berlin 1826). Online-Ressource unter http://www.archive.org/details/rmischealterth00doro [07.03.2011].
Fahlbusch u. a. 1985: K. Fahlbusch/W. Jorns/G. Loewe/J. Röder, Der Felsberg im Odenwald. Mit geologischen und archäologischen Beiträgen über die Entstehung der Felsenmeere und die Technik der römischen Granitindustrie. Führer hessische Vor- u. Frühgesch. 3 (Stuttgart 1985).
Förstemann 1968: E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch 1: Personennamen. ²(Bonn 1900). Ergänzungsband H. Kaufmann (München/Hildesheim 1968).
Gockel 1979: M. Gockel, Die Bedeutung Treburs als Pfalzort. In: J. Fleckenstein (Hrsg.), Deutsche Königspfalzen 3. Ver-öffent lichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11, 3 (Göttingen 1979) 86-110.
Goethert/Weber 2010: K.-P. Goethert/W. Weber, Römerbauten in Trier. Edition Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz Führungsheft 20 ²(Regensburg 2010).
Göldner/Heising 2006: H. Göldner/A. Heising, Kleinkastell und Schiffslände. Untersuchungen an römischen Militäranlagen im hessischen Ried. Der Odenwald. Zeitschrift des Breuberg-Bundes 53, 2006, 131-148.
Gropengießer 1937: H. Gropengießer, Spätrömischer Burgus bei Mannheim-Neckarau. Bad. Fundber. 13, 1937, 117-118.
Grunwald 1997: L. Grunwald, Das Moselmündungsgebiet zwischen Spätantike und Frühmittelalter. In: Ber. Arch. Mittelrhein u. Mosel 5. Beih. Trierer Zeitschr. 23 (Trier 1997) 309-331.
Grunwald 2000: L. Grunwald, Von Valentinian I. bis Karl dem Großen. Spätantike und frühmittelalterliche Spuren im Stadtgebiet von Neuwied-Engers. Heimat-Jahrbuch Landkreis Neuwied 2000, 37-46.
Haupt 2006: P. Haupt, Die Rolle des Kastells Alzey in der valentinia-nischen Grenzverteidigung. In: P. Haupt/P. Jung, Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Geschichte der Stadt 3 (Alzey 2006) 74-78.
Heising 2004a: A. Heising, „Sensationsfund im Kartoffelacker“ – spätrömische Kleinfestung und frühmittelalterliche Gräber bei Trebur-Astheim. Hessen Archäologie 2003 (Stuttgart 2004) 119-123.
Heising 2004b: A. Heising, Dem ersten Jahrtausend auf der Spur. Grabungen in Trebur-Astheim, Kreis Groß-Gerau. Aktuelles aus der Landesarchäologie. Archäologie in Deutschland Heft 2, 2004, 40 f.
Heising 2006: A. Heising, Landschaftsarchäologie im nördlichen Hessischen Ried. Zur Geschichte des 1. Jahrtausends im Vorfeld von Mainz. Ber. Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 8, 2004/2005 (2006), 163-175.
Heising 2008: A. Heising, Die römische Stadtmauer von Mogontiacum – Mainz. Archäologische, historische und numismatische Aspekte zum 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. (Bonn 2008).
Herrmann 1989: F.-R. Herrmann, Der Zullenstein an der Wesch-nitz mündung. Führungsblatt zu dem spätrömischen Burgus, dem karo lingischen Königshof und der Veste Stein bei Biblis-Nordheim, Kreis Bergstrasse. Archäologische Denkmäler in Hessen 82 (Wies-baden 1989).
165Der Schiffslände-Burgus von Trebur-Astheim
Höckmann 1986: O. Höckmann, Römische Schiffsverbände auf dem Ober- und Mittelrhein und die Verteidigung der Rheingrenze in der Spätantike. Jahrb. Röm.-Germ. Zentralmus. 33, 1986, 369-416.
Jorns 1973: W. Jorns, Der spätrömische Burgus mit Schiffslände und die karolingische Villa Zullestein. Archäologisches Korrespondenzblatt 3, 1973, 75–80.
Jorns 1974: W. Jorns, Der spätrömische Burgus „Zullestein“ mit Schiffslände, nördlich von Worms. In: D. M. Pippidi (Hrsg.), Actes de IXe Congrès international d’Études sur les Frontières romaines Mamaïa, 6 – 13 septembre 1972 (Köln, Wien 1974) 427-432.
Jorns 1979: W. Jorns, Der Zullestein. Ein Beitrag zur Kontinuität von Bauwerken. In: J. Fleckenstein (Hrsg.), Deutsche Königspfalzen 3. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11, 3 (Göttingen 1979) 111-135.
Jung 2000/2001: P. Jung, Die Küstenwachtürme in Nordengland, die Ländeburgi und Wachtürme an Rhein und Donau – Zeugnisse des „großen valentinianischen Festungsbauprogramms“? Seminarhausarbeit Mainz WS 2000/2001. Online-Ressource unter http://www.grin.com/e-book/26068/die-kuestenwachtuerme-in-nordengland-die-laendeburgi-und-wachtuerme-an [07.03.2011].
Jung 2009: P. Jung, Die römische Nordwestsiedlung („Dimesser Ort“) von Mainz. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte von Mainz. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 175 (Bonn 2009).
Jung/Kappesser 2007: P. Jung/I. Kappesser, Die Bearbeitung raumbezogener Informationen mit den tabulae MoGontIacenseS (MoGIS) und das römische Mainz in der Spätantike. Mainzer Zeitschrift 102, 2007, 33-51.
Von Kaenel/Helfert/Maurer 2001: H.-M. von Kaenel/M. Helfert/Th. Maurer, Das nördliche Hessische Ried in römischer Zeit. Vorbericht über ein landschaftsarchäologisches Projekt. Ber. Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 6, 2000/2001 (2001) 153-166.
Konen 2006: H. Konen, Spätantike Schiffsverbände auf dem Ober- und Niederrhein. In: P. Haupt/P. Jung, Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Geschichte der Stadt 3 (Alzey 2006) 127-135.
Kuhnen 2007: H.-P. Kuhnen, Schauplätze der spätrömischen Landschafts- und Umweltgeschichte am Oberrhein. Fundber. Baden-Württemberg 29, 2007, 533-558.
Maurer 2011: Th. Maurer, Das nördliche Hessische Ried in römischer Zeit. Untersuchungen zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im rechtsrheinischen Vorfeld von Mainz vom 1. bis 5. Jahrhundert n. Chr. Frankfurter Archäol. Schriften 14 (Bonn 2011).
Metzner 2001: E. Metzner, Das älteste Nauheim und seine rhein-mainische Nachbarschaft von der Heidenzeit bis zum hohen Mittelalter: mehr als ein Jahrtausend heimische Vor-Vergangenheit zum Vorschein und Vorfahren-Sprache zum Sprechen gebracht. In: H. Hock (Hrsg.), Aus der Nauheimer Chronik I. Dokumentationen zur Dorfgeschichte, erschienen anlässlich der 1150-Jahrfeier von Nauheim im Jahre 2001 (Groß-Gerau 2001) 113-170.
Möller 1987: J. Möller, Katalog der Grabfunde aus Völker-wanderungs- und Merowingerzeit im südmainischen Hessen (Starkenburg). Germ. Denkm. Völkerwanderungszeit B 11 (Stuttgart 1987).
Nuber 2005: H. U. Nuber, Das römische Reich (260–476 n. Chr.). In: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.), Imperium Romanum. Römer, Christen, Alamannen – Die Spätantike am Oberrhein (Stuttgart 2005) 12-25.
Nuber 2007: H. U. Nuber, Valentinianischer Festungsbau. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde² 35 (Berlin/New York 2007) 337-341.
Oldenstein 1992/2009: J. Oldenstein, Kastell Alzey. Archäologische Untersuchungen im spätrömischen Lager und Studien zur Grenzverteidigung im Mainzer Dukat. Habilitationsschrift (Mainz 1992). Online-Ressource 2009: http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2009/2070/ [10.03.2011]
Pabst 1989: A. Pabst, Quintus Aurelius Symmachus. Reden. Texte zur Forschung 53 (Darmstadt 1989).
Scharf 2005: R. Scharf, Der Dux Mogontiacensis und die Notitia Dignitatum. Eine Studie zur spätantiken Grenzverteidigung. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 50 (Berlin/New York 2005).
Schleiermacher 1942: W. Schleiermacher, Befestigte Schiffsländen Valentinians. Germania 26, 1942, 191-195.
Schwarz 2009: K. Schwarz, Die römische Schiffslände Zullestein. Aspekte zur spätrömischen Grenzverteidigung in den Nordwestprovinzen unter besonderer Berücksichtigung der Ländeburgi. Unpubl. Dissertation (Mainz 2009).
Seyfahrt 1968: W. Seyfarth, Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte 2. Schr. u. Quellen Alten Welt 21, 2 (Berlin 1968).
Seyfahrt 1971: W. Seyfarth, Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte 4. Schr. u. Quellen Alten Welt 21, 4 (Berlin 1971).
Soproni 1978: S. Soproni, Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre: das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert (Budapest 1978).
Soproni 1985: S. Soproni, Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. Münchner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichte 38 (München 1985).
Stehlin/von Gonzenbach 1957: K. Stehlin†/Bearb. V. von Gonzenbach, Die spätrömischen Wachttürme am Rhein von Basel bis zum Bodensee. 1. Untere Strecke: von Basel bis Zurzach (Basel 1957).
Visy 2003: Z. Visy (Hrsg.), The roman Army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica (Pécs 2003).
Wagner 1990: P. Wagner, Die Holzbrücken bei Riedstadt-Goddelau, Kreis Groß-Gerau. Mat. Vor- u. Frühgesch. Hessen 5 (Wiesbaden 1990).
166 Alexander Heising
Wegner 1990: H.-H. Wegner, Neuwied-Engers NR. In: H. Cüp-pers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-Pfalz (Stuttgart 1990) 499-500.
Wieczorek 1995: A. Wieczorek, Zu den spätrömischen Befesti-gungs anlagen des Neckarmündungsgebietes. Mannheimer Ge-schicht sbl. N. F. 2, 1995, 9-90.
Wilhelmi 1983: K. Wilhelmi, Archäologische Sicherungs maß-nahmen am spätrömischen Burgus in Neuwied-Engers. Arch. Korrbl. 13, 1983, 367-373.
AbbildungsnachweisTaf. 19, 1: Kurpfälzisches Museum Heidelberg (E. Kemmet)Taf. 19, 2: Herrmann 1989, Abb. o. Nr.Taf. 20: Raphael Kahlenberg, Groß-GerauTaf. 21, 1: Autor; Plangrundlage: Posselt&Zickgraf Prospektionen GbR
Taf. 21, 2: Markus Helfert, Johann-Wolfgang von Goethe-Uni ver-sität Frankfurt a. M., Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. II: Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der AltertumskundeTaf. 22, 1: AutorTaf. 22, 2: Detlev Bach, Winterbach. Restaurierungsbericht vom 16.08.2007, Abb. S. 1Abb. 1: Autor; Kartengrundlage: Höckmann 1986, 370 Abb. 1Lyoner Bleimedaillon: Nach ORL B 30 (1912) 1 Abb. 1Abb. 2: Autor; Kartengrundlage: U. Kannengießer, Frankfurt a. M.Abb. 3: Posselt&Zickgraf Prospektionen GbRAbb. 4: Nuber 2005, 22 Abb. o. Nr.Abb. 5: Autor; Kartengrundlage: Geologische Übersichtskarte des Oberrheingrabens (Christian Röhr 2006). Internet-Ressource: http://www.oberrheingraben.de/Graben/Geologische_Karte.htm; Rheinverlauf nach Höckmann 1986, Beilage 12Abb. 6, 1: Posselt&Zickgraf Prospektionen GbR ; Abb. 6, 2: Jorns 1979, Abb. 2 mit Veränderungen; Abb. 6, 3: Wilhelmi 1983, 367 Abb. 1 mit Veränderungen; Abb. 6, 4: Heukemes 1981, 440 Abb. 3 mit Veränderungen; Abb. 6, 5: Gropengießer 1937, 117 Abb.Abb. 7, 1: Schleiermacher 1942 Taf. 24, 1; Abb. 7, 2: Wegner 1990, 500 Abb. 416 unten; Abb. 7, 3: Wieczorek 1995, 66 Abb. 15; Abb. 7, 4: Heukemes 1981, 442 Abb. 4
Tafel 19
1
2
Beitrag Heising
1 Modell des Ladenburger Burgus im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. – 2 Rekonstruktion des Schiffslände-Burgus Biblis-Zullestein durch Werner Jorns 1979.
Tafel 20 Beitrag Heising
Trebur-Astheim, spätantiker Schiffslände-Burgus. Virtuelle Rekonstruktionen durch Raphael Kahlenberg 2004 (unten) und 2006 (oben).
Tafel 21Beitrag Heising
Trebur-Astheim. 1 Spätantiker Schiffslände-Burgus und frühmittelalterliches Gräberfeld. Gesamtplan 2003 der Befunde und Grabungsschnitte auf Grundlage der kombinierten Geomagnetik- und Geoelektrikbilder. Rot: Spätrömische Festung; grün: frühmittelalterliche Gräber. – 2 Oberflächenmodell mit Interpretation der geophysikalischen Befunde. Ohne Maßstab.
1
2