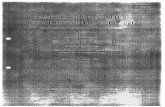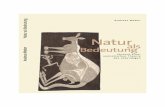Herstellung einer Scheibenkeule
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Herstellung einer Scheibenkeule
Herstellung einer
Scheibenkeule Ein Experiment von Manfred Pfeifer
In der Experimentalarchäologie gibt es einige Annahmen und Behauptungen, die nicht
immer vollständig belegt sind oder nicht hinreichend hinterfragt werden. Daher befasst sich
diese Abhandlung nicht nur mit der Art und Weise der Herstellung von Scheibenkeulen,
sondern auch mit der Hinterfragung und vielleicht auch Wiederlegung mancher Thesen.
Neustadt, den 02.03.14
Manfred Pfeifer
Auf den nachfolgenden Seiten werde ich im Detail die Herstellung einer Scheibenkeule in
den entsprechenden Arbeitsschritten durch eigene Fotodokumentation erläutern. Dabei
wurden ausschließlich steinzeitliche Techniken und Materialien verwendet.
Das Hauptaugenmerk soll dabei auf den nachfolgenden Punkten liegen:
1. Welche Bearbeitungsspuren entstehen bei einem mit Feuerstein gepickten
Schäftungsloch?
2. Ist es möglich mit der Picktechnik einen Lochdurchmesser von unter 20mm zu
erreichen?
3. Kann in einem sanduhrförmigen Schäftungsloch eine hölzerne Schäftung fest fixiert
werden, ohne dass zusätzliche Fixierungshilfen nötig sind?
Gesteinsmaterial und Herkunft
Das verwendete Gesteinsmaterial für die Keule ist ein rötlicher, sehr feinkristalliner
Sandstein von der Ostseeküste.
Er wurde mit Sicherheit von dem Eiszeitgeschiebe von Schweden an die ostholsteinische
Küste transportiert.
Manfred Pfeifer
Die so durch den Gletscher natürlich geschaffene fast runde Grundform, mit einer Dicke von
26mm, erschien mir geeignet für mein Vorhaben. Auch die Flintsteine für die
Werkzeugherstellung stammen von der Küste und wurden entsprechend in Form gebracht.
Die seitliche Bearbeitung der Scheibe
Das aus einem Flintabschlag hergestellte Werkzeug li. oben im Bild wurde als Pickstein
gebraucht. Die seitliche Bearbeitung für die „Rundung“ wurde nur mit diesem Stein
ausgeführt. Die steinerne Keule wurde beim Bearbeiten hochkant gehalten und dann
senkrecht mit dem Flintpickstein bearbeitet, diese Pickschläge wurden leicht streifend
ausgeführt. Durch diese Technik wird in kurzer Zeit sehr viel Material abgetragen. Werden
diese streifenden Schläge sorgfältig und mit dosierter Kraft ausgeführt, ähneln sie einer
geschliffenen Arbeit und lassen kaum an eine gepickte Fläche denken.
li. der Flintstein für die seitliche Bearbeitung re. der Keulenkopfrohling
Der ungebrauchte Pickstein für die randliche Bearbeitung mit seinen noch „scharfen“ Kanten
Manfred Pfeifer
hier die Verrundungen und Aussplitterungen an dem genutzten Pickstein
li. Foto fertige randliche Bearbeitung durch Picken re. Foto deutliche Pickspuren
Manfred Pfeifer
Recht einfach können durch Veränderung des Schlagwinkels beim Picken die Formungen an
diesem flachen Stein geschaffen werden. Ein Schleifen für diese Formgestaltung würde
deutlich länger dauern. Die gestrichelte Linie auf dem unteren Foto deutet die schon
abgetragene Gesteinsoberfläche an, die Nase zeigt es sehr deutlich.
stehengelassene „Nase“ mit deutlichen Pickspuren
li.oben im Bild streifend gepickt (glatt) re. lotrecht gepickte Fläche (rau)
durch Schlagwinkelveränderung entstandene Formen vom Scheibenrand
Manfred Pfeifer
Die randliche Bearbeitung mit den Pickschlägen bis zur fast runden Scheibenform hat
insgesamt 3,5h gedauert. Der Durchmesser der Scheibe beträgt nun nach der ausgeführten
Pickarbeit 98,5mm x 96,5mm, ursprünglich waren es 111,2mm x 110,4mm. Nun hat die nur
durch Picken entstandene Gesteinsoberfläche ein Aussehen, als sei sie auf mittelgroben
Sandstein geschliffen worden. Es ist aber ein eindeutiges Ergebnis von streifend
ausgeführten Pickschlägen.
Das Einpicken des Schäftungsloches
Um nun das Schäftungsloch einzupicken wurde ein kräftiger und länglicher Flintabschlag
hergestellt. Dieser Flintpickstein wird punktgenau auf der Mittelachse von der Steinscheibe
pickend eingesetzt. Hierbei wird der Pickstein lotrecht immer auf die gleiche Stelle
geschlagen, die ausgeführten Pickschläge sollten mit einer dem Material angepassten
Energie ausgeführt werden. Zu starke Pickhiebe lassen den Pickstein sehr schnell
unbrauchbar werden oder lässt sogar das Werkstück zerbrechen. Versuchsweise habe ich
auch mit hammerähnlich geschäfteten Picksteinen gearbeitet, dieses aber sofort wieder
verworfen da die Holzschäftung kein feinfühliges Arbeiten zulässt. Nur mit den Fingern
gehalten ist der Pickstein ein Werkzeug mit dem sehr feine Arbeiten ausgeführt werden
können. Wenn die Mulde etwa ¼ tief in die Steinscheibe eingearbeitet wurde sollte beim
weiteren Picken das Werkstück ständig gedreht werden, denn nur durch dieses Drehen kann
ein exakt rundes Loch entstehen. Unterbleibt diese Drehung beim Pickvorgang entsteht eine
punktuelle Picknarbe und der Pickstein „frisst“ sich im Innern fest und verkantet dabei.
Hierbei wird dann auch kein kreisrundes Loch entstehen können. Das Werkstück sollte
keinesfalls frei in der Hand liegend bearbeitet werden, es würde bei den Pickschlägen
unweigerlich zerbersten. Sitzend arbeitend eignet sich der Oberschenkel als Unterlage sehr
gut, die Schläge werden abgedämpft. Auf einer festen und harten Unterlage ist wie bei dem
freihändig gehaltenen Arbeitsgang ein Bruch garantiert. Der zu durchlochende Stein wird
von einer Seite etwa bis zur Hälfte eingepickt und muss dann gewendet werden. Nun wird
auf dieser Seite wie vorher auf der begonnenen Seite fortgefahren. Wird die Pickmulde nur
von einer Seite zu tief eingearbeitet, könnte der Stein bersten. Es wirkt dann wie ein
Durchschlagen der restlichen Gesteinsschicht und ergibt ein unbrauchbares und
ausgesplittertes Austrittsloch. Als sehr großer Vorteil bei fortgeschrittener Lochtiefe hat sich
ein Austausch der Picksteine erwiesen. Da sich die Aufschlagsfläche von dem Pickstein von
der Form der geschaffenen Aushöhlung anpasst wird bei weiteren Schlägen nur noch sehr
wenig Material abgetragen. Ein ausgewechselter Pickstein mit einer anderen Form der
Aufschlagsfläche trägt dann wieder mehr Material ab. Wird dieser Wechsel mit drei
verschiedenen Picksteinen durchgeführt, ist der Materialabtrag am erfolgreichsten.
Größtenteils schärfen sich die Aufschlagflächen der Picksteine von selbst, indem feine
Arbeitsretuschen beim Pickvorgang absplittern. Es kommt dabei auch auf die Härte von dem
zu durchlochenden Stein an.
Manfred Pfeifer
Begonnene Durchlochung mit dazugehörigem Pickstein, der re. Flint diente für die seitliche
Bearbeitung der Steinscheibe
a.) diverse Flintpicksteine für die Lochherstellung
Manfred Pfeifer
Einfache Ermittlung für den Ansatzpunkt für den rückwärtigen Pickvorgang an
der Steinscheibe
Um nun den genauen Mittelpunkt von der Rückseite der Steinscheibe zu erhalten wurde der
Stein hochkant in ein Wassergefäß eingetaucht. Dieses Eintauchen bis zur Mitte der schon
vorhandenen Mulde lässt eine gerade „Wasserstands Linie“ entstehen. Von dieser Linie
braucht nur noch der Mittelpunkt ermittelt werden. Die Genauigkeit von dem exakten
Gegenüber liegen der beiden Pickmulden ist für die Schaffung einer brauchbaren
Schäftungsöffnung sehr wichtig.
c.) die gebrauchten Picksteinspitzen
b.) diverse Flintpicksteine für die Lochherstellung
Die Spitzen dieser Picksteine haben eine starke Ähnlichkeit von kräftigen Flintbohrern. In vielen
Ausstellungen werden diese „Picksteine“ als Bohrer bezeichnet!
Manfred Pfeifer
Ansicht von oben Ansicht von unten
Felltopf mit Wasser gefüllt Ermittlung der Mittellinie
Der Durchbruch ist geschafft und liegt punktgenau an der vorgesehenen Stelle
Manfred Pfeifer
Der Pickvorgang nach dem ersten Durchbruch
Die Rückseite der Steinscheibe zeigt keine Ausbrüche an der kleinen Durchbruchstelle da die
rückseitige Pickung exakt übereinander liegt.
Der deutlich abgegrenzte Muldenrand lässt die ungeahnten Möglichkeiten einer sauber
ausgeführten „Pickarbeit“ erkennen. Die durchgeführte Lochherstellung bis zu diesem
kleinen Lochdurchbruch hat bisher 5 Stunden gedauert.
Die kleine Durchbruchsöffnung ist nur 2,5 mm groß.
Manfred Pfeifer
Durch weiteres Picken, abwechselnd von beiden Seiten, vergrößert sich die kleine Öffnung.
Der nun gebrauchte Pickstein sollte etwas weniger Durchmesser aufweisen wie der
Vorherige, auch muss die drehende Bewegung von dem Werkstück beibehalten werden.
Das Aufdrehen von der Schäftungsöffnung
Das Vergrößern der Schäftungsöffnung wurde im Wechsel von Drehen und Picken
durchgeführt. Das Drehen mit einem Bohrer ähnlichen Flintstein schabt die aufgeraute
Pickfläche an der Innenwandung glatt und kann dann so bei der nachfolgenden Pickung
wieder mehr Material abtragen. Dieser Wechsel wird bis zur endgültigen Lochweite
beibehalten. Das Aufdrehen ist in meinen Augen kein Bohren, denn das Loch besteht ja
schon und wird nur noch vom Durchmesser her verändert. Die durch das „Aufdrehen“
entstandenen Spuren im Innern der Schäftungsöffnung können dem Aussehen nach auch an
von einem Bohrer entstandene Spuren denken lassen.
Hier die schon deutlich größer gepickte Öffnung
Vermischte Spuren vom Picken und Aufdrehen
Manfred Pfeifer
Das Flintgerät für das Aufdrehen hat die Form von einem Abschlagbohrer. Der vergrößerte
Griffteil an diesem Werkzeug ist sehr hilfreich bei der Kraftübertragung.
Das li. und re. drehen in der Aushöhlung bewirkt einen raschen Materialabrieb, so das sich
der Durchmesser schnell vergrößert. Sehr harte Gesteinssorten lassen das Werkzeug schnell
unbrauchbar werden, daher sollten immer einige Werkzeuge auf Vorrat gehalten werden.
Ein Nachschärfen durch Retuschieren ist in diesem Falle nicht möglich da der Durchmesser
sich zwangsläufig verkleinern würde und für diese Arbeit dann nicht mehr brauchbar wäre.
Durch die Drehbewegungen wird die Innenwandung von der Schäftungsöffnung sehr glatt
und entfernt die typischen Pickspuren. Diese so hergestellte glatte Fläche läßt sich
anschließend sehr schnell wieder durch die folgenden Pickschläge verändern. Da beide
Arbeitsschritte in Folge immer im Wechsel wiederholt werden trägt diese Technik sehr viel
und schnell das Material ab
Werkzeug zum Aufdrehen
Manfred Pfeifer
Das Aufdrehen und Picken ist beendet, die Sanduhrform ist fast verschwunden.
Der Schliff
Zum Schleifen habe ich die Keule auf einen Haselstab gesteckt um den Schleifvorgang in
drehender Bewegung durchführen zu könnrn. Ein Gefäß ist mit kleinsten Flintsplittern gefüllt
und wurde mit Wasser vermischt, denn trocken wirbeln die Flintsplitter aus dem Gefäß.
Der rotierende Schleifvorgang hatte einen großen Vorteil gegenüber dem gebräuchlichen
Längsschleifen. Durch die Drehungen beim Schleifen können keine Facetten entstehen und
so bleibt die rundliche und gewölbte Fläche erhalten. Der Schliff dauerte 40 Minuten.
Hier ein Link von einem Schleifvorgang einer Scheibenkeule auf einer Schleifplatte.
http://steinharteknochenarbeit.magix.net/website#Scheibenkeule%20Schleifen
Leicht angedeutet sind die Rillen vom „Aufdrehen“ noch zu erkennen
Manfred Pfeifer
Die Schäftung
Die Schäftung, ein Weißdornspross mit einer eingewachsenen Waldrebenspur, wurde von
unten in die Öffnung eingeschoben. Der passgenau zugearbeitete Holzschaft wurde dann mit
einem runden Knochenkeil verdrehsicher eingeschlagen. Eine herkömmliche Keilform würde
das Holz nur nach zwei Seiten aufpressen, dieser hier runde Keil dagegen presst das Holz
nach allen Seiten auf. So sitzt der Schaft sehr fest und sicher in diesem noch leicht V-
förmigen Schäftungsloch. Die hölzerne Schäftung ist 47 cm lang.
mittig im Markkanal wird der Keil eingeschlagen
pilzkopfförmig ist der Holzstab aufgequollen
Manfred Pfeifer
Die untere Ansicht von der geschäfteten Scheibenkeule zeigt die passgenauigkeit von dem
eingesteckten Holz und den scharf abgegrenzten Picklochrand.
Glanzspuren im Schäftungsloch
Der Wechsel von der ersten Schäftung zum Schleifen und das mehrmalige Einstecken zum
Anpassen der letzten Schäftung haben erstaunlicherweise diesen auf dem Foto gezeigten
Glanz entstehen lassen.
scharf abgegrenzter Picklochrand
Schäftungsglanz
Manfred Pfeifer
Zusammenfassung der Fragen 1 – 3
1. Welche Spuren entstehen in einem mit Feuerstein gepickten Schäftungsloch?
Bei der Arbeit nur mit dem Pickstein sind diese Pickspuren sehr klar und eindeutig an der
Innenwandung von dem Schäftungsloch zu erkennen. Das notwendige „Aufdrehen“ nach
dem erfolgten Durchbruch im Wechsel mit den Pickschlägen verfälscht dann das sichtbare
Bild. Es deutet mit den durch das „Aufdrehen“ entstandenen Rillen und Riefen eine durch
Bohren entstandene Schäftungsöffnung an.
2. Besteht die Möglichkeit ein Schäftungsloch mit einem Flintpickstein unter 20 mm
Durchmesser herzustellen?
Mit entsprechender Erfahrung und perfekt zugerichteten Flintwerkzeugen ist es möglich ein
Lochdurchmesser unter 20 mm in einem Felsgestein herzustellen.
Der spitz längliche Flintpickstein sollte möglichst aus einem Kern bestehen und darf nur
exakt lotrecht genutzt werden. Äußerste Vorsicht ist bei tieferen Pickschlägen in dem Loch
zu beachten, denn der schlanke Pickstein soll und darf nur senkrecht geschlagen werden. Die
Schläge dürfen nicht die Innenwandungen von dem Loch Treffen sondern sollten nur den
Grund in der Mulde treffen. Geschieht es trotzdem, wird sich der Innendurchmesser von
dem Loch ungewollt vergrößern und der Lochrand sehr breit abgerundet auslaufen.
3. Ist es möglich eine hölzerne Schäftung in einem leicht sanduhrförmigen Loch fest zu
fixieren ohne dass eine zusätzliche Bindung nötig ist.
Auch hier kann ich mit ja antworten, denn der rund zugearbeitete Knochen drückt beim
Einschlagen nach allen Seiten, also kreisförmig, das Schäftungsholz auseinander. Dabei wird
das Holz in die Hohlräume von der Sanduhrform (oben und unten) gepresst.
Ein herkömmlicher „Keil“ spaltet/keilt das Holz nur nach zwei Seiten auf.
Durch diese hier beschriebene Schäftungsfixierung sitzt der Keulenkopf sehr fest, dass runde
aufkeilen von dem Holz lässt ein Drehen oder Ablösen der Scheibe vom Schaft nicht zu.
Die Herstellung dieser Scheibenkeule mit Schäftung hat zusammen 11h gedauert
Text, Graphik & Foto Manfred Ffeifer
Manfred Pfeifer
Literatur:
Biermann 2009: E. Biermann, Sogenannte Dell- und Geröllkeulen – Halbfabrikate und
Fertigprodukte oder verschiedene Artefaktgruppen? Archäologische Informationen 32, 2009,
83-89.
Biermann 2011a: E. Biermann (2011) Steinerne Keulenköpfe – Die Mesolithische Revolution
in der Bandkeramik. In: H.J. Beier, R. Einicke & E. Biermann 2011 (Hrsg.) Dechsel, Axt Beil &
Co – Werkzeug, Waffe, Kultgegenstand? Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas
63. Varia Neolithica VII (Langenweissbach 2011), 9-27.
Biermann 2011b: E. Biermann (2011) Steinerne Keulenköpfe des Mesolithikums, Alt- und
Mittelneolithikums. Untersuchungen zur Funktion, Technologie, Typologie, Chronologie
sowie zu geographischen und sozioökonomischen Bezügen. (unpubl. Dissertation Halle).
Biermann 2012: E. Biermann (2012) Krieg in der Vorgeschichte: Die Interpretation
archäologischer Funde und Befunde im interkulturellen Vergleich am Beispiel steinerner
Keulenköpfe des Mesolithikums bis Mittelneolithikums. In: R. Gleser & V. Becker (Hrsg.)
(2012) Mitteleuropa im 5. Jahrtausend. Beiträge zur Internationalen Konferenz in Münster
2010 (Berlin 2012), 331-358.
Blackwood 1950: B. Blackwood (1950) The Technology of a Modern Stone Age People in
New Guinea (Oxford 1950).
Broadbent 1978: N. Broadbent (1978) Perforated Stones, Antlers and Stone Picks – Evidence
for the use of the Digging Stick in Scandinavia and Finland. Tor XVII, 1975-77 (1978), 63-106.
Brozio 2013: J.P. Brozio (2013) Neue Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu neolithischen
Siedlungsstrukturen in Oldenburg-Dannau, Kreis Ostholstein. Archäologische Nachrichten
aus Schleswig-Holstein 2012 (2013).
Manfred Pfeifer
Ember 1978: C.R. Ember (1978) Myths about Hunter-Gatherers. Ethnology 17/4, 1978, 439-
448.
Ember & Ember 2001: C.R. Ember & M. Ember (2001), Making the World more Peaceful:
Policy Implications of Cross-Cultural Research. In: M. Martinez (Hrsg.), Prevention and
control of aggression and the impact on its victims (New York 2001) 331-338.
Farruggia 1992: J.P. Farruggia (1992) Les outils et les armes en pierre dans le rituel funéraire
du Néolithique Danubien. BAR International Series 581, 1992.
Feest 1966: Chr. Feest (1966) Tomahawk und Keule im östlichen Nordamerika. Archiv für
Völkerkunde 19, 1966, 39-84.
Feustel 1973: R. Feustel (1973) Technik der Steinzeit, Veröffentlichungen Mus. Ur- und
Frühgeschichte Thüringens 4 (Weimar 1973).
Gramsch 1987: B. Gramsch (1987) Ausgrabungen auf dem mesolithischen Fundplatz
Friesack, Bezirk Potsdam. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte
Potsdam 21 (Berlin 1987) 75-100.
Gramsch 2009: B. Gramsch (2009) A Mesolithic stone macehead with drilled shaft-hole from
the Friesack-4-site in northern Germany. In: J.M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek & K.
Szymczak. Understanding the Past. Festschrift für S.K. Kozlowski. (Warsaw/Warschau 2009)
131-136.
Hahn 1991: J. Hahn (1991) Erkennen und Bestimmen von Stein- und Knochenartefakten.
Einführung in die Artefaktmorphologie. Archaeologica Venatoria 10 (Tübingen 1991)
Hirschberg & Janata 1986: W. Hirschberg & A. Janata (1986) Technologie und Ergologie in
der Völkerkunde. Bd. 1 (3. Auflage, Berlin 1986).
Manfred Pfeifer
Hoof 1970: D. Hoof (1970) Die Steinbeile und Streitäxte im Gebiet des Niederrheins und der
Maas. Antiquitas 9 (Bonn 1970).
Jacob-Friesen 1939: K.H. Jacob-Friesen (1939) Einführung in Niedersachsen Urgeschichte (3.
Auflage Hildesheim / Leipzig 1939).
Jeunesse 1983 : Chr. Jeunesse (1983) A propos ď une Tombe neolithique decouverte a
Rouffach en 1938. Cahiers Alsaciens ďArchéologie ďArt et ďHistoire XXVI, Strasbourg 1983,
5-30.
Keeley 1996: L.H. Keeley (1996) War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage
(Oxford 1996).
Krull 1983/84: R. Krull (1983/84) Eine Geröllkeule, ein Geröllkeulen- und ein
Spitzhauenfragment aus dem südlichen Hannover. Die Kunde, N.F. 34/35, 201-206.
Lindig 1987: W. Lindig (1987) Nordamerika. In: W. Lindig & M. Münzel (Hrsg.) Die Indianer,
Band 1 (4. erweiterte Auflage, München 1987).
Müller-Karpe 1976: H. Müller-Karpe (1976) Geschichte der Steinzeit (2. ergänzte Auflage
München 1976).
Oldeberg 1952: A. Oldeberg (1952) Studien über die schwedische Bootaxtkultur (Stockholm
1952).
Otterbein 2000: K.F. Otterbein (2000) A History of Research on Warfare in Anthropology.
American Antiquity 101/4, 2000, 794-805.
Rieth 1958: A. Rieth (1958) Zur Technik des Steinbohrens im Neolithikum. Zeitschrift für
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 18, 1958, 101-109.
Manfred Pfeifer
Roksandic 2010: M. Roksandic (2010) Commentary on “Warfare in Levantine Early Neolithic.
A Hypothesis to be Considered”. NEO-LITHICS 1/10, 2010, 59-61.
Schroeter 1989: W. Schroeter (1989) Die Jagd- und Kriegswaffen der Indianer Nordamerikas
(Braunschweig 1989).
Struve 1955: K. Struve (1955) Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre
kontinentalen Beziehungen (Neumünster 1955).
Tackenberg 1970: K. Tackenberg (1970) Neue Geröllkeulen aus Nordwestdeutschland.
Quartär 21, 1970, 81-92.
Weiner 1996: J. Weiner (1996) Zur Technologie bandkeramischer Dechselklingen aus
Felsgestein und Knochen. Ein Beitrag zur Forschungsgeschichte. Archaeologia Austriaca 80
(Wien 1996) 115-156.
Kontakt:
Manfred Pfeifer
E-Mail: [email protected]