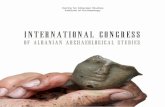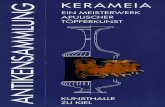Die Auswirkungen Des Pflege-Versicherungsgesetzes Auf Die Entwicklung Der Heimentgelte
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Auswirkungen Des Pflege-Versicherungsgesetzes Auf Die Entwicklung Der Heimentgelte
Gtinter Roth und Heinz Rothgang
Die Auswirkungen des Pflege-Versicherungs- gesetzes auf die Entwicklung der Heiment- gelte The Effects of the Long-Term Care Insurance Act on Nursing Home Rates
Mit der Einfiihrung der 2. Stufe der Pflegeversicherung zum 1.7.1996 wurde die Ver- giitung von Pflegeeinrichtungen neu geregelt, womit insbesondere ein Beitrag zum Stop der seit Anfang der 70er Jahre beklagten ,, Preiswalze " geleistet werden sollte. Neben der Umstellung von einer retrospektiven Kostenerstattung auf prospektiv ver- einbarte Heimentgelte, der Vorgabe von H6chststeigerungsraten und der Einfiihrung von Wirtschaftlichkeitspriifungen wurde auch eine Standardisierung der Heiment- gelte angestrebt. Die theoretische Betrachtung zeigt, daft eine Kostenbegrenzung nur gelingen kann, wenn die Vergiitung nicht mehr nach den individueUen, sondern nach den Durchschnittskosten vergleichbarer Einrichtungen festgelegt wird und Preis- bzw. Kostenabsprachen der Einrichtungstrgiger verhindert werden k6nnen. Die Analyse yon Daten aller rheinltindischen Pflegeheime zeigt, daft die Preisstei- gerungen zwischen 1995 und 1998 gegeniiber friiheren Zeitriiumen geringer, jedoch immer noch beachtlich ausfielen und iiber dem gesetzlichen Rahmen lagen. Gleich- zeitig hat aber eine Angleichung der Entgelte stattgefunden, die die M6glichkeit fiir zukiinftige Kostenbegrenzungen verbessert. Schliisselw6rter: Pflege, Pflegeversicherung, Gesundheits6konomie, Vergiitungsre- gelungen, Pflegeheime, Pflegesatzverhandlungen
The current articles examines whether the newly introduced long-term care insu- rance leads to more price control in nursing home care. On a theoretical level it is argued that only a shift from individual pricing to pricing on the basis o f average costs can serve this purpose - given binding agreements among providers to keep cost high can be prevented. Based on data from all rhenish nursing homes the em- pirical analysis reveals between 1995 and 1998 a still considerable increase in and a decreasing deviation among nursing home rates. Though the former result is dis- appointing the latter bears potential for more successful future price control, since more equal prices are a prerequisite for pricing on an average cost basis. Keywords: Long-Term Care, Long-Term Care Insurance, Health Economics, pric- ing, Nursing Homes, bargaining on remuneration
1. Problemstellung*
Als die Debatte um die Neuordnung der finanziellen Folgen des Pflegerisi- kos vom Bremer Senatsrat Galperin 1973 6ffentlichkeitswirksam angestofSen wurde, geschah dies mit dem Hinweis auf die Diskrepanz von moderaten
* Ftir hilfreiche Kommentare danken wir Prof. Dr. Winfried Schm~ihl, Dr. Uwe Wag- schal sowie zwei anonymen Gutachtern.
306 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Steigerungen der Alterseinkommen und einer ,,Preiswalze" der sozialen Dien- ste, insbesondere der vollstationaren Pflege, die immer mehr pflegebedtirf- tige alte Menschen zu Sozialhilfeempf~ngern mache (vgl. Galperin 1973). Auch das Gutachten des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA 1974), das vielfach als Ausl/Sser der Debatte angesehen wird, stellte auf diese als pro- blematisch angesehene Schere zwischen Einkommensentwicklung und Preisentwicklung ftir Pflegeleistungen ab. Anders als in der Gesundheitspo- litik, die seit Mitte der 70er Jahre vom Kampf gegen die ,,Kostenexplosion" gekennzeichnet war, wurde im Pflegebereich jedoch nicht die Preisent- wicklung als Ursache ftir die sozialpolitische Problemlage thematisiert. Die als eines modernen Sozialstaats unwtirdige ,,pflegebedingte Sozialhilfeab- h~ingigkeit" wurde vielmehr tiber zwei Jahrzehnte hinweg als Hauptargument far die Forderung einer grol3en Koalition von Kommunen und L~.ndem (als Sozialhilfetr~iger) sowie WohlfahrtsverNinden (als Heimtr~iger) nach einem neuen Kostentrgiger bei Pflegebedtirftigkeit angeftihrt. Ironischerweise ftihrt nun jedoch ausgerechnet die EinfiJhrung einer Pflegesozialversicherung, mit der die lang gehegte Forderung nach einer Neuordnung und Verbesserung der Finanzierung yon Pflege realisiert wird, dazu, dab verst~trkt versucht wird, bremsend auf die Preisentwicklung ftir Pflegeleistungen einzuwirken.
Um die Zustimmung der Skeptiker zur Einfiihrung einer Pflegesozialversi- cherung zu erlangen, mul3ten deren Befarworter n~nlich zugestehen, alles zu unternehmen, um eine ,,Ausgabenexplosion" zu vermeiden. Dieses Ziel wird in der Pflegeversicherung auf der leistungsrechtlichen und der vergti- tungsrechtlichen Ebene angestrebt: Zum einen sind die Leistungen der zu- standigen Pflegekasse pro Pflegefall - abweichend vom in der Sozialhilfe geltenden ,Bedarfsdeckungsprinzip" - nach oben begrenzt und in Form yon DM-Betr/igen vorgeschrieben (vgl. Rothgang 1994a und 1996). Zum ande- ren wird durch Ver~inderungen im Vergtimngsrecht, vor allem durch eine St~- kung der Verhandlungsposition der Kostentrager und eine weitreichende Stan- dardisierung von Leistungen und Leistungsentgelten, ein Stop tier ,,Preis- walze" angestrebt.
Letzteres ist Ausgangspunkt fiar diesen Beitrag, in dem auf der Basis von Pflegesatzen ftir das Rheinland untersucht werden soll, inwieweit neue Ver- gtitungsregeln zu einer Angleichung der Pfleges~itze in der vollstationRren Pflege geftihrt haben und ob es dadurch zu einer Begrenzung der Preis- entwicklung in der Heimpflege kommt. Dazu wird in den beiden folgen- den Abschnitten zun~chst das alte Vergtitungsrecht mit den darin enthal- tenen Fehlanreizen dargestellt (Abschnitt 2) und das neue Vergtitungsrecht mit seinen erh.offten Verbesserungen beschrieben (Abschnitt 3). Dabei wird auch auf die Ubergangsregelung nach Art. 49a des Pflege-Versicherungs- gesetzes (PflegeVG) und die Debatte fiber das Standard-Pflegesatzmodell eingegangen. Nach diesen Vorarbeiten wird in Abschnitt 4 anhand yon Lage- und StreuungsmaBen sowie yon Korrelationsanalysen, Varianzana- lysen und statistischen Tests empirisch geprtift, wie sich die Pfleges~itze seit Inkrafttreten der gesetzlichen Pflegeversicherung (GPV) entwickelt ha- ben und welche Determinanten ftir eine Ver~inderung der jeweiligen Heim- entgelte identifiziert werden k~Snnen. Im Fazit (Abschnitt 5) wird dann re- stimiert, inwieweit die neuen Vergtitungsregelungen ihr angestrebtes Ziel erreicht haben.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 307
2. Das Vergiitungsrecht vor Einfiihrung der Pflegeversicherung
Die Einnahmen eines Pflegeheimes werden zum einen dutch die nach Pile- gesture differenzierten Pflegesfitze und zum anderen dutch die Einstufung der Bewohner in diese Pflegestufen bestimmt. Ausschlaggebend ftir die Ein- stufung waren bis zum Inkrafttreten des PflegeVG auf Landesebene festge- legte Defizitkataloge (vgl. Hirnschtitzer 1988a: 102ft.). Dabei hattenjedoch die Tr~ger der Pflegeeinrichtungen einen erheblichen Einflul3 auf die fest- gestellten Pflegestufen, so dab diese tiber ein Instrument verftigten, um ihre Einnahmen zu steuern (vgl. BMA 1998: 23).
Die Pflegesiitze wurden in Pflegesatzkommissionen ausgehandelt, die pa- rit~itisch von Heimtr~igem und Kostentr~igern, d.h. in erster Linie Sozialhil- fetr~gern, besetzt waren. Grundlage der Vereinbarung war dabei das Selbst- kostendeckungsprinzip. Dieses sieht eine Pflegesatzgestaltung in Abh~in- gigkeit von den betriebsindividuellen Kosten vor, wobei die Festsetzung der Pflegesfitze retrospektiv ftir den jeweils abgelaufenen Budgetzeitraum er- folgte (vgl. Hirnschtitzer 1988a: 60; Prinz 1995:31). I
Eine solche Kostendeckungsgarantie birgt ftir den Leistungsanbieter keinen Anreiz, effizient zu wirtschaften. Im Gegenteil: Jede Produktivitfitssteige- rung fiJhrt zur Senkung der Selbstkosten und damit auch des eigenen Budgets, wfihrend Unwirtschaftlichkeit durch Budgetsteigerung belohnt wird. Wirtschaftlichkeitsanreize kOnnen in einem solchen System deshalb nut dann entstehen, wenn die Kostendeckungsgarantie auf die bei wirt- schaftlicher Betriebsftihrung notwendigen Kosten beschrfinkt und dies von der Kostentr~igerseite kontrolliert und sanktioniert wird. 2
Die dazu nOtigen Kontrollmechanismen waren im Pflegebereich aber al- lenfalls rudiment~ir vorhanden (vgl. Rothgang 1997: 44ff.). So waren we- der Wirtschaftlichkeitsprtifungen noch Betriebsvergleiche vorgesehen. Es gab keine Kosten- und Leistungsrechnung oder kaufm~innische Buch- ftihrung, sondern lediglich Personalanhaltszahlen ftir die Personalbeset- zung. Angesichts dieser Defizite war eine effektive Kontrolle der Kosten- entwicklung durch die Kostentrfigerseite kaum m6glich. Statt dessen wur- den die Sozialhilfetrfiger nach eigenem Bekunden yon der Entwicklung der Pfleges~itze ,,immer wieder unliebsam tiberrascht" (Bundesarbeitsgemein- schaft der tiber6rtlichen Tr~iger der Sozialhilfe 1980). 3 Wie ein Vergleich
1 BereitsvorInkrafttretendesPflege-Versicherungsgesetzeseffolgtezum 1.7.1994im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms (SKWPG) die Umstellung aufeine prospektive Budgetierung.
2 Allerdings kann eine striktes Kontrollregime zu einer Btirokratisiemng und Ver- krustung im Betriebsablauf f-iihren, die jegliche flexible Anpassung an sich ~in- dernde Rahmenbedingungen verhindert und damit selbst wieder Ineffizienzen pro- duziert (vgl. Rothgang 1994b: 366-372).
3 Angesichts des Fehlens einer einheitlichen Definition verschiedener Stufen yon Pflegebedtirftigkeit, ist es praktisch unm6glich, giiltige und verl~il31iche Steige- rungsraten ftir die Pflegesatzentwicklung in den siebziger und achtziger Jahren anzugeben. Sch~ttzungen auf der Basis der Pro-Kopf-Sozialhilfeausgaben ftir Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ergeben allerdings dramatische Preissteigerungen (vgl. Prinz 1995: 43).
308 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
zweier repr~isentativer Studien zeigt, waren die Pflegesatzsteigerungen selbst zu Beginn der 90er Jahre noch sehr ausgepr~igt. So ermittelten Krug/Reh (1992) in einer repr~isentativen Erhebung (alte Bundesl~inder) fiJr das Jahr 1989 durchschnittliche Pfleges~itze yon 66,25 DM pro Tag (Stufe ,Betreuung'), 81,55 (Stufe ,erht~hte Pflege') und 100,18 DM (Stufe ,schwere Pflege'). Unter Berticksichtigung der Besetzung der Pflegeklas- sen ergibt dies einen gewogenen Mittelwert von 94,42 pro Tag, d.h. 2.871 DM pro Monat. FUr das Jahr 1994, also ungef'~ihr fiinf Jahre sp~ter, kamen Schneekloth/Miiller (1995) zu einem Durchschnittsbetrag fiir die alten L~in- der yon DM 4.154 DM pro Monat, was einer Erh/3hung auf das fast 1,5- fache (Steigerungsrate: 45%) des von Krug/Reh ermittelten Ausgangs- wertes entspricht (vgl. Rothgang 1997: 48). FUr Nordrhein-Westfalen lie- gen sowohl die Absolutwerte als auch die Steigerungsrate jeweils deutlich oberhalb des Bundesdurchschnitts. Das yon Krug/Reh (1992: 53,224) er- mittelte gewogene Mittel von 2.933 DM pro Monat ist dabei bis 1994 auf monatlich 4.400 DM gestiegen (Schneekloth 1997: 90), was einer Erh/3hung um 50% gegeniiber dem von Krug/Reh (1992) errnittelten Ausgangswert von 1989 entspricht.
Um derartige Entw!cklungen ftir die Zukunft zu vermeiden, wurden im Pile- geVG wesentliche Anderungen des Vergtitungsrechts, und zwar im Hinblick auf die Einstufung und die Ermittlung von Pfleges~itzen vorgenommen.
3. Das Vergi i tungsrecht nach E in f i ih rung der Pf legevers ieherung
Vor Einftihrung der Pflegeversicherung war die Feststellung der Schwere der Pflegebedtirftigkeit und die darauffolgende Einstufung der Bewohner von Pflegeeinrichtungen weitgehend Sache der Einrichtungen selbst (Igl 1998: 8; BMA 1998: 23). Dies f(ihrte dazu, dab die Mehrzahl der Pflegebedtirfti- gen in die h/Schste Pflegestufe mit dem zugehtirigen hOchsten Pflegesatz ein- gestuft wurde. Demgegentiber tritt nun ein dem Anspruch nach objektiver ,Gut- achter', der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) auf, der die Pflegebedtirftigkeit und die Pflegestufe unter Beachtung mehrmals ge~aa- derter Richtlinien und der fachlichen Einsch~itzung der Einrichtungen ermit- telt. s Dieses Gutachten dient den Pflegekassen wiederum als Grundlage ftir die Feststellung der PflegebediJrftigkeit und Leistungsgewahrung. Damit ist den Pflegeinrichtungen die Einstufung ihrer Bewohner weitgehend entzogen. 6
4 Insgesamt lebten in den rheinliindischen Heimen nach Angaben des Landschafts- verbandes Rheinland zum Stichtag 42.784 Personen. Informationen fiber die Ein- stufung zum 30.6.1996 liegen dagegen nur ffir 32.339 Personen vor, die daher die Grundgesamtheit der Tabelle bilden.
5 w 14 SGB XI regelt den Begriffder Pflegebedtirftigkeit, w 15 die Stufen der Pile- gebedfirftigkeit und w 18 das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedfirftigkeit. w 17 enthalt die Rechtsgrundlagen ffir die Richtlinien der Pflegekassen und w 16 eine an das Arbeitsministerium gerichtete Verordnungsermittlung.
6 Entsprechend vehement war die Kritik in der Praxis auf diese Neuerung (siehe Nakielski 1996; Jonas 1996; vgl. auch Cronj~iger/Oberdieck 1996 sowie aus Sicht des MDK Pick 1996). Dabei richtete sich die Kritik sowohl gegen regional un- terschiedliche Ergebnisse, einzelne zu gering erachtete Einstufungen, als auch ge- gen die gesetzlichen Grundlagen mit der mehrfach ge~nderten Richtlinie (vgl. hierzu auch Fuchs 1997).
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 309
Wie Tabelle 1 zeigt, ftihrte die Neueinstufung der Bewohner zu einer deutli- chen Ver'anderung der Bewohnerstruktur. Waren vorher mehr als 70% der Pfle- gebediirftigen in der h/Schsten Stufe C bzw. in der Sonderstufe Geronto-Psy- chiatrie, so war der Anteil der Bewohner in der h/Schsten Stufe IlI (einschlieB- lich H/s nach Einftihrung der Pflegeversicherung nur noch halb so grol3. Spiegelbildlich stand ein Anteil von 4,2% der Pflegebedtirftigen in der nied- rigsten Stufe A einem Prozentwert von 31 in ,,Stufe 0" und Stufe I gegentiber.
Tabelle 1: Veranderungen in der Einstufung von Heimbewohnern
Einstufung von Heimbewohnern am 30.6.19964
Stufe A Stufe B Stufe C bzw. Insgesamt ;eronto-psych.
abs. in % abs. I in % abs. in % abs. in % L
1.353 4,2 8.123 25,1 22.8639 70,7 32.339 100,0
Neue Einstufung der ,,Altf'alle" (=Heimbewohnern am 30.6.1996)
,,Stufe 0" Stufe I Stufe II Stufe IlI (inkl.HLrtefalle) Ins- gesamt
abs. in % abs. in % abs. ] in % abs. in % abs. in % D
3.478 10,8 6.548 20,2 11.009 34,0 11.304 35,0 32.339 100,0
Quelle: Angaben des Landschaftsverbandes Rheinland; eigene Berechnungen.
Um den Heimen - angesichts dieser sich im ersten Halbjahr 1996 abzeich- nenden Verschiebung in der Einstufungsstruktur- das wirtschaftliche Ober- leben zu sichern, wurde im Ersten SGB XI-Anderungsgesetz (1. SGB XI- ,~ndG) in Art. 49a PflegeVG eine Obergangsregelung eingefiJhrt, die den Heimen vom 1.7.1996 bis zum 31.12.1997 zun~ichst ihr Budget sichem sollte. Diese ()bergangsregelung beinhaltete zwei verschiedene Vergtitungsvarian- ten. W~_l"end bei der ersten Variante die jeweiligen Pfleges~itze weiter gal- ten und neue Bewohner anhand ihrer Pflegestufe auf der Basis des Zuord- nungsschemas des w 2 Abs. 2 Art. 49a PflegeVG einer VergiJtung.sklasse zu- geordnet wurden, orientierte sich die kompliziertere alternative Ubergangs- regelung am.. gesamten weiterhin geltenden Heimbudget, das unter Heran- ziehen von ,Aquivalenzziffern' und entsprechend der neuen Einstufung durch den MDK - mit der daraus resultierenden Verteilung in die Pflegestufen - auf die in Teilentgelte zedegten Pfleges~itze (s.u.) umgelegt wurde. Diese Regelung ftihrte dazu, dab die Pfleges~tze der neuen Stufen I, II und III in aller Regel deutlich htJher lagen als die der Stufen A, B und C, so dab den- jenigen Bewohnern, die von Stufe A nach Stufe I, von Stufe B nach Stufe II oder von Stufe C der Stufe III zugeordnet wurden - bei gleichem Budget der Heime - ein h/Sherer Pflegesatz in Rechnung gestellt wurde (vgl. zur kom- plizierten Berechnungsmethode und den Effekten fiir die Heimbewohner z.B. Btise 1996; Moldenhauer 1996; Naumann/Schwedeck 1996a und 1996b, Brand/Z/Jrkler 1997 sowie Rothgang/Vogler 1998 ftir die Ergebnisse einer empirischen Erhebung). Mit der Berechnung auf der Basis von Teilentgel- ten wurde mit der zweiten Variante bereits der fJbergang zum Vergtitungs- recht der w167 84ff. SGB XI vollzogen.
310 Z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Die Entscheidung dartiber, welche Variante zum Zuge kam, oblag den.Pile- geheimen, die ihre Vergiitung vom 30.6.1996 bis zum 1.1.1997 (Uber- gangszeitraum) umstellen konnten, dann aber an diese Entscheidung bis zum Inkrafttreten einer erstmals nach den Regeln des 8. Kapitels des SGB XI aus- gehandelten Vergiitung gebunden blieben (w 5 Art. 49a PflegeVG). Nach An- gaben des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen haben 63% der insgesamt 23 i0 in der Datenbasis enthaltenen vollstation~en Einrich- tungen vonder M/Sglichkeit Gebrauch gemacht, die erste l.)bergangsvariante zu w~.hlen, w~.rend 36% die zweite Variante wLlalten (Gerste/Rehbein 1998). Im Rheinland haben nach Angaben des Landschaftsverbands Rheinland rund 60% der Heime auf die zweite Alternative umgestellt. Nach dem 1.1.1998 ausgehandelte Entgelte sind vonde r Obergangsregelung nicht mehr betrof- fen. Sie wurden erstmals nach den Regelungen der w167 84ff. verhandelt und nicht mehr lediglich auf der Basis alter Entgelte umgerechnet.
Nach diesen neuen Regelungen werden die Pfleges~itze nach wie vor ausge- handelt, wobei auf Seiten der Kostentr~iger allerdings neben dem zust~indi- gen Sozialhilfetr~iger rlunmehr auch die Pflegekassen an den Pflegesatzver- handlungen beteiligt sind (w 85 SGB XI). 7 Bei der Finanzierung der Pflege- einrichtungen ist eine Aufteilung in drei Kostenarten vorgesehen (w 82 SGB XI): s Pflegekosten, Kosten fiir Unterkunft und Verpflegung ( 'Hotelkosten') und Investitionskosten. Dabei werden nur die Pflegekosten (inklusive sozialer Betreuung und - zun~ichst befristet ftir den Zeitraum vom 1.7.1996 bis zum 31.12.1999 - medizinischer Behandlungspflege) 9 in begrenzter H6he von den Pflegekassen bestritten. Die Investitionskosten sollen von den Landern
7 Voraussetzung fiJr die Beteiligung an den Pflegesatzverhandlungen ist, dab auf den jeweiligen Kostentr~iger mehr als 5% der Berechnungstage des Pflegeheims entfallen (w 85 Abs. 2 SGB XI).
8 Bereits im sogenannten ,Dreiteilungsvorschlag' der Arbeiterwohlfahrt von 1976 wurde fiir die stationare Pflege ein solches Kostensplitting gefordert (vgl. Haug/Rothgang 1994). Neben den genannten B1/Scken ktinnen von den Einrich- tungen mit Selbstzahlern weitere Zusatzleistungen nach w 88 SGB XI abgerech- net werden. In Pflegeheimen erbrachte ~Lrztliche Leistungen werden von den Kran- kenkassen gem~il3 den Regelungen des SGB V finanziert.
9 Mit dem 1. SGB XI-AndG wurde w 43 SGB XI dahingehend modifiziert, dab die Leistungen der Pflegekassen sich auch auf soziale Betreuung und - fiir einen zun~ichst begrenzten Zeitraum - medizinische Behandlungspflege erstrecken. Die in w 43 genannten Obergrenze (2.800 DM pro Fall und Monat) und der ebenfalls als Obergrenze ausgewiesene Durchschnittsbetrag von 30.000 DM pro Fall und Jahr (jeweils mit Ausnahme der H~tef'alle) blieben yon dieser Ausweitung des Gegenstandes allerdings unberiihrt. Der gleichfalls im Rahmen des 1. SGB XI- AndG verabschiedete w 1 Art. 49a PflegeVG sieht fur den Ubergangszeitraum eine Pauschalierung der Pflegekassenleistungen vor. Allerdings bleibt der als Ober- grenze fungierende Durchschnittsbetrag von 30.000 DM hiervon ebenso unbertihrt (w 1 Abs. 3 Satz I Art. 49a PflegeVG) wie der H/Schstbetrag von 2.800 DM, der als Pauschale nunmehr ausschlieBlich den Heimbewohnern in Stufe III vorbehal- ten ist. Anders als der vergiatungsrechtliche wurde der leistungsrechtliche Teil der (Jbergangsregelung im 3. SGB XI-Anderungsgesetz verl~ingert. Nach dem neu ein- gefiigten w 43 Abs. 5 SGB XI werden die Pflegekassenleistungen nunmehr bis zum 31.12.1999 pauschal gewiihrt.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 31 1
- unter Heranziehung der Einsparungen bei der Sozialhilfe - gefb.'rdert wer- den (w 9 SGB XI), einer rechtlich verbindlichen Verpflichtung zur Ubernahme der vollstS_ndigen Investitionskosten unterliegen die L~inder nicht (vgl. Jac- obs 1995: 247ff.; Rothgang 1995: 19ft. sowie Rothgang 1997: 32). l~ Nicht gedeckte Investitions- und pflegebedingte Kosten sind somit - ebenso wie die ,Hotelkosten' - nach wie vor von den Pflegebedtirftigen selbst oder den zust~indigen Sozialhilfetr~igem zu bestreiten.
Diese Verteilung der Finanzierungskompetenz birgt erhebliche Anreizprobleme in sich. So tibersteigen ungedeckte Pflege- und Investitionskosten und Hotel- kosten - insbesondere - in den Pflegestufen II und I I I - immer noch die Ein- kommen der meisten Pflegebedtirftigen. t~ Sind diese dann auf Sozialhilfe- zahlungen angewiesen, verringert sich ihr Interesse daran, ein m6glichst gtin- stiges Pflegeheim auszuw~hlen. MaBnahmen zur F6rderung des Preiswettbe- werbs zwischen station~en Pflegeeinrichtungen wie die Ausgaben von Preis- vergleichslisten durch die Pflegekassen nach w 72 Abs. 5 SGB XI laufen f~ir die Hilfeempf~_nger daher in diesem Fall weitgehend leer, so dab den Kollek- tivverhandlungen der Pfleges~itze nach wie vor groBe Bedeutung zukommt.
Aber auch die an den Preisverhandlungen auf Seiten der Kostentr~iger betei- ligten Pflegekassen haben kein genuines Eigeninteresse an einer Begrenzung der Pfleges~itze. Niedrige Pfleges~itze sind ftir die Pflegekassen n~nlich grunds~itzlich wirtschaftlich nur dann interessant, wenn die Leistungen der Pile- gekassen iiber den Pfleges~itzen liegen, so dab dann die Leistungen der Pile- gekassen nicht bis zur H6chstgrenze ausgesch6pft wtirden und Einsparungen entsttinden (vgl. Rothgang 1997: 56). Da die Pfleges~itze jedoch - zumindest in den Pflegestufen II und III - in der Regel deutlich oberhalb der Pflegekas- senleistungen liegen, greift als Instrument der Kostend~npfung in der GPV voflhufig also pr im~ die Vorgabe von HOchstgrenzen im Leistungsrecht. Erst eine gravierende Verminderung der Pfleges~itze wtirde Einsparungen fiir die Pflegekassen nach sich ziehen. Selbst dies ist nicht der Fall, solange die Lei- stungen der Pflegekassen - wie derzei t - pauschal auch dann gew~hrt werden, wenn sie h6her liegen als der in Rechnung gestellte pflegebedingte Aufwand.
Lediglich die Sozialhilfetrtiger werden bei einer Begrenzung oder gar Ver- minderung der Pfleges/itze entlastet. Um zu vermeiden, dab sich Pflegekas- sen und Pflegeeinrichtungen tiber die KOpfe der Sozialhilfetr~iger hinweg und zu deren Lasten einigen, wurde dem zust~ndigen Sozialhilfetr~iger im 1. SGB XI-Anderungsgesetz eine Veto-Position eingerhumt. War zuvor eine Mehr-
I0 Tats~ichlich haben sich die L~inder der Finanzierungsverpflichtung fiir Investiti- onskosten bereits bestehender Einrichtungen in ihren Landespflegegesetzen zur Ausfiihrung des Pflege-Versicherungsgesetzes auch weitgehend entzogen. Le- diglich in den L~indern, die eine umfassende Pflegewohngeldregelung vorgese- hen haben, wird die ,,Altlast" zumindest fiir die Empf~nger von Hilfe zur Pflege bzw. den Personen, die ansonsten zu Empf'~agem yon Hilfe zur Pflege in Ein- richtungen wtirden, iibemommen (vgl. Eifert/Rothgang 1998; Eifert et al. 1999).
11 Eine Vollerhebung aller Empfanger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen in Bre- men ergab, dab mehr als vier Fiinftel der bisherigen Hilfeempf'anger auch wei- terhin auf Sozialhilfezahlungen angewiesen sind (Rothgang/Vogler 1998). Ver- gleichbare Werte werden auch aus anderen Bundesl~indem berichtet.
312 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
heit der Kostentr/iger ausreichend, um eine Vereinbarung durchzusetzen, kann der Sozialhilfetr/iger nunmehr allein durch seinen Widerspruch ein Schieds- stellenverfahren nach w 76 SGB XI erzwingen und dabei sogar im voraus ver- langen, dab nur der Vorsitzende der Schiedsstelle allein entscheidet, um so zu verhindern, dab er im Schiedsverfahren erneut von den iibrigen Vertretern der Kostentr~iger iiberstimmt wird (neu gefabter w 85 Abs. 5 SGB XI). ~2
Ist somit zumindest ein Akteur an Kostenbegrenzung interessiert, stellt sich die Frage, welche M6glichkeiten dazu bestehen.
Der Kostenbegrenzung soUen folgende Regelungen im neuen Verg~itungs- recht dienen: �9 der bereits zum 1.7.1994 - sozusagen im Vorgriff auf das Pf legeVG - im
Rahmen Zweiten Gesetzes zur Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms (SKWPG) vollzogene Ubergang auf die prospek- tive Vergtitung,
�9 der Ubergang vom Selbstkostendeckungsprinzip zur ,,leistungsgerechten Vergiitung",
�9 Vorschriften ftir eine differenzierte Kosten- und Leistungsrechnung, in der auch dem Splitting in der Kostentr~igerschaft Rechnung getragen wird, t3
�9 Einftihrung von Wirtschaftlichkeitsprtifungen sowie �9 die fiir die Jahre 1996 bis 1998 geltende Begrenzung der j~hhrlichen Stei-
gerung der Heimentgelte auf 1% (Art. 49b PflegeVG) und �9 die in w 70 Abs. 2 SGB XI normierte , ,Notbremse", nach der ,,Vereinba-
rungen fiber die H6he der Vergtitungen, die dem Grundsatz der Beitrags- satzstabilit~it widersprechen .. . . unwirksam" sind.
Allerdings ist zu fragen, inwieweit diese Mabnahmen ihr Ziel erreichen.
Zun~ichst ist zu konstatieren, dab auch bei einer prospektiven Verhandlung und Festsetzung von Pflegesatzen (w 85 Abs. 3 SGB XX) 14 als Kalkulations-
12 Die Schiedsstelle ist parit~itisch aus Vertretern der Kostentrtiger und der Ein- richtungstr~iger sowie einem unparteiischen Vorsitzenden zusammengesetzt (w 76 Abs. 1 SGB XI). Ist die Kostentr/igerseite gespalten, kann es fiir den Sozial- hilfetr~iger daher sinnvoll sein, die - wenn auch ungebundenen - Vertreter der Pflegekassen nicht an der Entscheidung zu beteiligen.
13 Zur in der Praxis schwierigen Abgrenzung der Kostenarten ist die Verordnung tiber die Rechnungs- und Buchftihrungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pile- gebuchfiihrungsverordnung) erlassen worden, w~hrend die Verordnung fiber die Abgrenzung der in der Pflegevergtitung und in den Entgelten ffir Unterkunft und Verpflegung nicht zu berficksichtigenden Investitionsaufwendungen von den ver- gtimngsf~ahigen Aufwendungen ftir Verbrauchsgfiter (Pflege-Abgrenzungsver- ordnung, Pflege-AbgV) bisher noch aussteht (BMA 1998: 65). Einschl~igige Re- gelungen zu diesem Komplex sind auch in den Rahmenvereinbarungen nach w 75 SGB XI enthalten (vgl. hierzu Allemeyer 1996).
14 Obwohl die Pflegesatzvereinbarung gem~iB w 85 Abs. 3 SGB XI ,,im voraus, vor Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode des Pflegeheims ftir einen zukiinfti- gen Zeitraum (Pflegesatzzeitraum) zu treffen" ist, lagen Mitte April 1998 erst Vereinbarungen ftir 428 von ca. 800 Heimen vor. Entsprechende Praktiken sind auch aus dem Krankenhausbereich bekannt, in dem bereits seit 1985 prospektiv verhandelt werden soil. Es ist daher davon auszugehen, dab die Verz6gerungen im AbschluB der Verhandlungen fur die Pflegeheime nicht allein Einftihrungs- problemen geschuldet sind.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 3 13
grundlage immer auf die Kosten/Preisfestsetzungen der vergangenen Peri- ode zurtickgegriffen wird und sich damit wenig andert. Auch die damit ein- hergehende Einr~iumung von Gewinn- und Verlustchancen bietet den Heim- tr~igem wenig Anreize zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, da Gewinne in den Vorperioden rege lm~ig zu einer Ktirzung der Entgelte in der aktuellen Periode ftihren diJrften und die Gewinne damit mittel- und langfristig im- mer von den Kostentr~igern abgesch/Spft werden. Letzlich wird durch die Ein- ftihrung der Prospektivit~t lediglich das Belegungsrisiko auf die Einrich- tungen verlagert, was im Pflegebereich ~5 von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. Prinz 1995; Rothgang 1997: 49-52).
Auch der postulierte Obergang vom Kostendeckungsprinzip zur Finanzie- rung ,, leistungsgerechter" Pflegesiitze dtirfte keine gravierenden Ver~inde- rungen mit sich bringen. Nach w 84 Abs. 2 SGB XI mtissen es die ,,lei- stungsgerechten" Pfleges~itze einem Pflegeheim n~imlich nach wie vor er- m6glichen, bei wirtschaftlicher Betriebsfiihrung seinen Versorgungsvertrag zu erftillen. Insbesondere- so die Gesetzesbegrtindung zu w 84Abs. 5 - kann ,,kein Pflegeheim ... gezwungen werden, seine Leistungen unterhalb seiner ,Gestehungskosten' anzubieten" (BT-Drucksache 12/5262: 144). Damit wird der Kostendeckungsgrundsatz durch die Hintertiir wieder eingefiihrt. Gelingt es den Einrichtungen - auch im Rahmen der neu eingefiihrten Wirt- schaftlichkeitspriffungen nach w 79 Abs. 1 SGB XI - nachzuweisen, dab die angefallenen Kosten betriebsnotwendig waxen, k6nnen sie eine KosteniJber- nahme unter Hinweis auf die genannten Normen einfordem. Die angeftihr- ten Regelungen zur Finanzierung von Pflegeheimen fiihren insofern weni- ger zu einer Abschaffung als vielmehr zu einer Modernisierung des Ko- stendeckungsgrundsatzes, bei dem die Kostenerstattung explizit auf die not- wendigen Kosten beschrankt wird t6 und die Kontrollm/Sglichkeiten der Ko- stentr~iger durch die Einfiihrung von Wirtschaftlichkeitspriifungen und die Verpflichtung der Einrichtung zu einer kaufm~nnischen Buchfiihrung ver- bessert werden.
Allein vom Obergang zur prospektiven Finanzierung leistungsgerechter Ent- gelte kann somit kein entscheidender Beitrag zur nachhaltigen Begrenzung der Preisdynamik im Pflegebereich ausgehen. Auch der Grundsatz der Bei- tragssatzstabilitiit (w 70 SGB XI) ist mangels Vollziehbarkeit diesbez~iglich
15 Bei Krankenh~iusern kann unterstellt werden, dab sie insbesondere durch ihr Entlassungsverhalten EinfluB auf die Belegung nehmen k0nnen. Insofern war die Einftihrung der Prospektivit~it in diesem Bereich von gr0Berer Be- deutung.
16 Diese Beschr~inkung war von Anfang an Bestandteil des Kostendeckungsprin- zips in der Krankenhausfinanzierung, wS.hrend der Passus, dab die ,,Vereinba- rungen und die Kosteniibernahmen ... den Grunds~itzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsf'ahigkeit Rechnung tragen'" miassen, im Pflegebereich erst im Rahrnen des Haushaltsbegleitgesetzes von 1984 in das fiar die Finanzie- rung der Pflegeheime ausschlaggebende BSHG integriert wurde (Rothgang 1997: 44-48).
314 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
wenig vielversprechend.17 Entscheidend hierftir ist vielmehr - unabh~ingig davon, ob prospektive oder retrospektive Pflegesatzverhandlungen geftihrt werden - , dal3 die H/3he der Vergtitung nicht mehr von individuellen Kos- ten der Einrichtung, sondern von den Durchschnittskosten aller Einrich- tungen einer geeignet definierten Versorgungsregion abhLngig gemacht wird. TM
Solange individuelle Kosten ausschlaggebend ftir die H/3he der Entgelte sind, werden die Einrichtungen ihre Energie eher darauf verwenden, die Not- wendigkeit der Kosten in Preisverhandlungen nachzuweisen, als diese dutch betriebsinterne Rationalisiemngsmagnahmen zu senken. Verst~kte Ko- stenkontrollen k/Snnen zwar Auswtichse verhindern, bieten aber - ganz ab- gesehen v o n d e r Gefahr der btirokratischen Erstarrung - keine immanen- ten Anreize ftir die Einrichtungen, selbst M6glichkeiten der Kostenreduk- tion zu suchen. Solche Anreize entstehen jedoch dann, wenn die Entgelte far - qualitativ und quantitativ - wohldefinierte Leistungen auf der Basis yon Durchschnittskosten festgesetzt werden. Zun~ichst dtirfte dies zwar nur zu einer Angleichung in Richtung Mittelwert ftihren, bei der die Preissen- kungen im oberen Segment den Preiserh6hungen im unteren Preissegment gegentibergestellt werden miissen. Mittel- und langfristig bieten einheitli- che Vergtitungshtihen in einer Region aber erstmals wirkliche Gewinn- m6glichkeiten, da individuelle Kostensenkungen bei einer hinreichend grogen Zahl von berticksichtigten Einrichtungen kaum Eingang in die Durchschnittsbildung finden und die resultierenden Gewinne deshalb beim Einrichtungstr~iger verbleiben (vgl. hierzu auch Prinz 1995). Da bei einem derartigen Regime jedoch alle Einrichtungen Anstrengungen zur individu- ellen Kostensenkung unternehmen diJrften, ist bei dynamischer Betrachtung mit einer Abw~rtsspirale bzw. mit einer Verlangsamung des Anstiegs bei den Kosten zu rechnen.
Aus Sicht der Heimtr~iger handelt es sich bei einem solchen Vergtitungsre- gime n~imlich um ein n-Personen-Gefangenendilemma: Unabh~ingig davon, ob die anderen Heime rationalisieren, sind entsprechende Anstrengung ftir
17 Die Entwicklung des zum Budgetausgleich in der gesetzlichen Pflegeversicherung notwendigen Beitragssatzes hiingt yon vielen Faktoren anf der Einnahme- und Aus- gabenseite ab (vgl. Rothgang 1997: 269-76). Vor Begirm des Budgetzeitraums ist daher kanm absehbar, welche Entgelth6hen bei konstantem Beitragssatz und aus- geglichenem Budget finanzierbar sind. Eine nachtr~igliche Anpassung der Ent- gelth6hen dtirfte dagegen rechtstaatlichen Grunds~itzen zuwider laufen. Zudem haben die Eim-ichtungen Anspruch auf leistungsgerechte Entgelte - unabhangig yon der Finanzentwicldung der Pflegeversicherung. Schulin (1994:444) h~lt den ,,Abs. 1 des w 70 SGB XI ... daher mangels Vollziehbarkeit und Abs. 2 wegen Ver- stoges gegen elementare Gmndsatze der Rechtsstaatlichkeit [ftir] nichtig."
18 Die einheitliche Vergiitungshtihe mug nicht notwendigerweise mit dem (gewo- genen) arithmetischen Mittelwert im Status quo ante zusammenfallen. Der Vor- teil einer solchen Festlegung besteht aber darin, dab die Umstellung ftir die Ko- stentrfiger kostenneutral ist und diese Setzung leichter vermittelbar ist. Je st~ir- ker die einheitlichen Vergiitungss~itze den Mittelwert unterschreiten, desto gr613er wird das Risiko, dab Einrichtungen mit hohen Kosten abrupt aus dem Markt ausscheiden mtissen.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 315
das eigene Heim sinnvoll. In der Sprache der Spieltheorie ist die Kosten- senkung eine ,dominante Strategie'. Im Ergebnis komrnt es dadurch aber zur einer Abwartsspirale bei den Entgelten, so dab sich die Einrichtungen letzt- lich besser stellen wtirden, wenn sie alle auf Rationalisierungsmabnahmen verzichteten. Das Auseinanderklaffen von individueller und koUektiver Ra- tionalit/it, das charakteristisch ftir das Gefangenendilemma ist, fiJhrt hier - hinter dem Rticken der Akteure - zu einem unter dem Aspekt der Kosten- begrenzung wtinschenswerten Ergebnis.
Allerdings setzt dies voraus, dab die Heimtr/iger keine bindenden Abspra- chen treffen, bei denen sie sich wechselseitig dazu verpflichten, auf wei- tere Anstrengungen zur Kostensenkung zu verzichten. Wie aus der Theorie der Spiele bekannt ist, w/ichst die Wahrscheinlichkeit ftir solch kooperative Strategien, wenn es sich um sogenannte ,iterierte Spiele' handelt (Taylor 1987), also um Situationen, in denen sich die selben Akteure immer wie- der im selben institutionellen Rahmen begegnen - wie dies bei vollsta- tion~iren Pflegeeinrichtungen gegeben ist. Die Gefahr yon Preis- bzw. Ko- stenabsprachen besteht im Heimsektor umso mehr, als trotz der allgemein mit dem PflegeVG erwarteten Aufl6sung etablierter korporatistischer Strukturen administrativer Interessenvermittlung eher deren Konsolidierung eingetreten ist (Roth 1999). So wurden auch beim sogenannten ,,baden-wtirt- tembergischen Weg", der durch die Festlegung einheitlicher Entgeltkorri- dore gekennzeichnet ist, zun/ichst tiber dem Durchschnitt liegende Werte verwendet. Zwar k6nnen solche ausgabensteigernden Einftihrungseffekte durch die Abw~xtsspirale, die einer Vergtitung nach Durchschnittsentgelten in dynamischer Sicht innewohnt, kompensiert werden, jedoch nur, wenn Ab- sprachen - etwa mit den Mitteln des Kartellrechts - effektiv verhindert wer- den k6nnen.
w 86 Abs. 2 SGB XI sieht grunds/itzlich die M6glichkeit vor, ftir Pflegeheime, die in derselben kreisfreien Gemeinde oder in demselben Landkreis liegen einheitliche Pflegesiitze ftir gleiche Leistungen zu vereinbaren. Allerdings ist hierftir die Zustimmung der Heimtr~iger erforderlich, die sicherlich nur schwer zu erlangen ist. Zudem wurde diese Norm durch das 1. SGB XI-AndG gegentiber der ursprtinglichen Fassung dahingehend abgeschw~cht, dab nun- mehr lediglich regional und nicht mehr bundesweit einheitliche Pfleges/itze vorgesehen sind und dies auch nur ftir gleiche Leistungen. Insofem ist kaum mit einer durchschlagenden Wirkung dieser Norm zu rechnen.
Mit der Vorlage des Standard-Pflegesatz-Modells (SPM), das auf die Durch- setzung bundeseinheitlicher Preise ftir vergleichbare Leistungen abzielt, ha- ben die Pflegekassen daher einen Versuch gestartet, trotz individueller Ver- handlungen eine Vereinheitlichung der Entgelte und damit ein Abriicken von der Berticksichtigung individueller Kosten zu erreichen. Wie erwartet, stieB das Modell und damit der Versuch, die Pfleges~itze zu standardisieren, auf den erbitterten Widerstand vor allem der Vertreter der freien Wohlfahrtspflege, die traditionell als Sozialanw~ilte der Betroffenen und der Beschaftigten, nicht dagegen als ,Untemehmer' auftreten (vgl. Pabst 1996). Insbesondere - so die Argumentation - h/itten die ,Betroffenen', aber auch die Besch~iftigten unter den im SPM vorgesehenen Entgelten (ohne Investitionsaufwendungen) von monatlich 2.522 DM (Stufe I), 3.054 DM (Stufe II) und 4.220 DM (Stufe
316 z . f . Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
III) (Moldenhauer 1997: 35) sowie den daraus resultierenden Leistungsein- schr~inkungen zu leiden. Welter - so die Einrichtungsvertreter - treffe der Vorwurf der Verschwendung nur einzelne Einrichtungen und sei nicht die Regel, sondern die Ausnahme. SchliefSlich seien die Preise dann hoch, wenn auch die Leistungen hoch seien. Eine Standardisierung, so war auch zu h6ren, widerspreche sogar dem Kartellrecht und den Grunds~itzen der Marktwirt- schaft, mit der nun einmal differenzierte Leistungen und Preise verbunden seien. 19 Offiziell wurde das SPM aufgrund des Protestes von Einrichtungs- verb~inden und unter politischer Vermittlung zurtickgenommen. Allerdings sei es nach Bekunden von Einrichtungstr~igem ftir die Kostentr~igerseite nach wie vor handlungsleitend.
Ob es im Zuge der Inkraftsetzung der 2. Stufe der Pflegeversicherung zu ei- ner Standardisierung und Begrenzung der Heimentgelte gekommen ist, und wenn ja, auf welchem Niveau, ist letztlich eine nur empirisch zu kl~irende Frage. Bei dem nachfolgenden Versuch, empirisch zu priifen, wie sich die Pfleges~itze seit Inkrafttreten der 2. Stufe der Pflegeversicherung entwickelt haben und welche Determinanten unterschiedlicher Entwicklung erkennbar sind, wird auch danach gefragt, ob die Begrenzung der Steigerung der Heim- entgelte aufj~ihrlich 1% nach Art. 49b PflegeVG eingehalten wurde.
4. Die Entwicklung der Heimkosten seit Inkrafttreten der gesetz- lichen Pflegeversicherung
Die Untersuchung der Entwicklung der Heimkosten im Zeitraum der Um- setzung des PflegeVG bringt methodische Probleme mit sich. Deshalb wird zunfichst auf die hier verwendeten Daten und das darauf aufbauende Vorge- hen eingegangen (4.1.). In Abschnitt 4.2 wird dann die Ver~inderung der Heim- entgelte seit Inkrafttreten der zweiten Stufe der Pflegeversicherung zum 1.7.1996 betrachtet, wahrend Abschnitt 4.3 eine differenzierte Betrachtung ffir die einzelnen Teilentgelte enth~ilt. AbschliefSend wird in Abschnitt 4.4 geprtift, inwieweit divergierende Entwicklungen durch den Einflul3 yon Heimgr~13e und Tr~igerschaft erklart werden k6nnen.
4.1 Datenlage und Untersuchungsmethode
Grundlage der folgenden Auswertungen sind Angaben ffir alle (800) Pile- geheime im Rheinland, die den Autoren vom Landschaftsverband Rheinland freundlicherweise zur Verffigung gestellt wurden. Dabei beschr~inkt sich die bier dargestellte Untersuchung auf die ,,neuen" Entgelte, das heil3t, auf die nach Teilentgelten differenzierten Entgelte der 2. Pflegesatzvariante und die Neuabschltisse ffir 1998. 2o Hierbei ist jedoch zu beachten, dal3 nicht fiir alle Einrichtungen derartige Angaben fiir den gesamten Beobachtungszeitraum
19 Ftir Nordrhein-Westfalen, das laut SPM vergleichsweise hohe Pfleges~itze auf- weist, wurden bis zu 30% Leistungsminderung durch das SPM beftirchtet. Vgl. dazu z.B. Berner 1997 und Hein 1997.
20 An anderer Stelle (vgl. Roth/Rothgang 1999) wurde auch eine ausfiihrliche Dar- stellung der Analyse des Zeitraums vom 1.1.1995 bis zur Umstellung am 30.6.1996 vorgenommen.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 317
vorliegen. Dies ist zum einen auf,,nattidiche" Fluktuation (Marktzutritt und Ausscheiden aus dem Markt) zurtickzufiihren, zum anderen aber der Uber- gangsregelung des Art. 49a PflegeVG mit ihren beiden Vergtitungsvarianten sowle der unvollst/indigen Umsetzung der Prospektivit/it der Verhandlungen nach neuem Recht geschuldet. Tabelle 2 gibt an, fiir wie viele Einrichtun- gen zu den einzelnen Beobachtungszeitpunkten Informationen vorliegen.
Tabelle 2: Uberblick tiber die vorliegenden Angaben nach Zeitpunkten
Angaben vorhanden
nur f~ir 1996 fiar 1996 und 1998 nur fiJr 1998
n~ = 49 n2 = 438 n 3 = 313
Quelle: Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rheinland.
Werden nun statistische Mal3zahlen (z.B. Mittelwerte) gebildet, so sind zwei Vorgehensweisen m6glich:
1. die Mal3zahlen beziehen sich auf alle Einrichtungen, ftir die zum Be- trachtungszeitpunkt Informationen vorliegen
oder 2. die MaBzahlen beziehen sich jeweils nur auf die Einrichtungen, ftir die zu
beiden Beobachtungszeitpunkten Informationen vorliegen.
Grunds~itzlich ergeben sich nur aus der ersten Vorgehensweise korrekte An- gaben fiJr die jeweiligen Querschnitte. Soil also das Pflegesatzniveau zu ei- nem bestimmten Zeitpunkt angegeben werden, so ist diese Vorgehensweise vorzuziehen. Geht es dagegen nicht um das Niveau, sondern prim/ir um die Entwicklung der Entgelte, ist die zweite Variante vorzuziehen, da etwa das Ausscheiden eines Pflegeheims mit niedrigem Heimentgelt und der gleich- zeitige Marktzutritt eines Heimes mit hohem Entgelt nicht als Entgeltsteige- rung interpretiert werden kann. Da sich der vorliegende Beitrag mit der Dy- namik der Entgelth6hen besch~iftigt, wird im folgenden der zweiten Variante gefolgt.
Allerdings birgt auch diese Vorgehensweise methodische Probleme, wenn nicht nur Zu- und Abg~inge, sondern auch eine systematische Auswahl un- terstellt werden mug. Bei den 49 Einrichtungen, die zwar 1996 auf die zweite Pflegesatzvariante umgestellt haben, fiir die aber keine Angaben ftir die Ent- gelte des Jahres 1998 vorliegen, diJrfte es sich vor allem um in dieser Hin- sicht unproblematische Marktaustritte handeln. Nicht ausgeschlossen wer- den kann, dab in dieser Gruppe auch einige Einrichtungen enthalten sind, deren Entgelte in der Schiedsstelle verhandelt werden und die sich mOgli- cherweise hinsichtlich ihrer Entgelte von den anderen Einrichtungen unter- scheiden. Allerdings ist ihre Zahl zu gering, um durchschlagende Verwer- fungen hervorzurufen. Kritisch ist dagegen die Behandlung der 313 Ein- richtungen, ftir die zwar Entgelte fiir 1998, aber keine ,,neuen" Entgelte ftir 1996 vorliegen. Diese Gruppe enth/~lt zum einen die Marktzutritte dieses Zeit- raums, zum anderen aber ,,Alteinrichtungen", die nicht auf die 2. Pflege- satzvariante umgestellt haben. Ftir immerhin 287 Einrichtungen, ohne neue
318 z.f . Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Entgelte im Jahr 1996 liegen in den vorliegenden Daten Angaben fur 1995 oder zum 30.6.1996 vor. Hierbei handelt es sich also nicht um Neugriin- dungen, sondern um Heime, die sich fiir die 1. Pflegesatzvariante entschie- den haben. Neugriindungen k6nnen dagegen bei den 26 Einrichtungen un- terstellt werden, ftir die ausschliel]lich Angaben ftir 1998 und keine Werte fiir 1995 oder 1996 vorliegen. Da vermutet werden kann, dab die Entschei- dung ftir oder gegen die 2. Pflegesatzvariante auch vonde r H6he der beste- henden Entgelte beeinflul3t wurde, kann eine ausschlieBliche Betrachtung der Einrichtungen, ftir die zu beiden Zeitpunkten Angaben vorliegen, zu Ver- zerrungen fiihren. Im folgenden wird daher zun~ichst gepriift, inwieweit sich die 438 in die Analyse eingeschlossenen Einrichtungen von den 287 Ein- richtungen, die nicht auf die 2. Pflegesatzvariante umgestellt haben, im Hin- blick auf die Entgelte zum 30.6.1996 und fiir das Jahr 1998 unterscheiden (TabeUe 3)31
Tabelle 3: M6gliche Verzerrungen durch fehlende Angaben
Durch- schnittliche Heimentgelte (DM/Tag)
zum Entgelte 30.6.96
Stufe A Stufe B Stufe C
ffir1998
Stufe I Stufe II Stufe III
,,Stufe 0"
Berticksichtigte Heime, die nicht auf Differenz Heime die 2. Variante umge-
stellt haben (nicht berticksichtigt)
Entgelte N
93,72 129,76 161,38
127,03 151,96 195,24 102,23
N
408 424 427
438 438 438 438
95,91 208 131,48 248 163,44 259
131,53 155,32 196,13 107,94
- Die Mittelwerte sind verschieden bei einer mehr als 10%.
* Die Mittelwerte sind verschieden bei einer h6chstens 5%.
** Die Mittelwerte sind verschieden bei einer h6chstens 1%.
*** Die Mittelwerte sind verschieden bei einer h6chstens 0,1%.
in DM Signifikanz
2,19 1 , 8 2
2 , 0 6
287 4,50 ** 287 3,36 - 287 0,89 287 5,71 ***
Irrtumswahrscheinlichkeit von
Irrtumswahrscheinlichkeit von
Imumswahrscheinlichkeit von
Irrtumswahrscheinlichkeit von
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Pflegesatzdaten des Landschaftsver- bandes Rheinland.
21 Ohne einen gleichzeitigen Vergleich der Belegungsstruktur sind die ,,alten" Heim- entgelte nur eingeschr~inkt aussagekr~iftig. Belegungszahlen liegen aber nur fiir die Einrichtungen vor, die auf die 2. Variante umgestellt haben, so dab der Ver- gleich auf die blogen Heimentgelte beschr~inkt bleiben mug.
Z. f. Gestmdheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 319
Wie die Tabelle zeigt, sind die Entgelte der Einrichtungen, die nicht auf die zweite Variante umgestellt haben, durchg~ingig hiSher als die der bertick- sichtigten Heime. Allerdings sind diese Unterschiede- wie der t-Test ftir un- abhS.ngige Stichproben zeigt - nur ftir die sogenannten ,,Stufe 0" und die Stufe I im Jahr 1998 signifikant. Da die Unterschiede zudem ftir 1998 h6her sind als ftir 1996, wtirde eine Berticksichtigung der Heime, die nicht auf die 2. Variante umgestellt haben, bei der Ermittlung der Entgeltsteigerung ten- denziell zu htiheren Werten ftihren. Die im folgenden gewahlte Vorgehens- weise untersch~itzt die Entgeltsteigerung somit sogar noch.
4.2 Entwicklung der Heimentgelte im Rheinland vom 2. Halbjahr 1996 bis 1998
Die Entwicklung der neuen Heimentgelte seit ihrer Einftihrung im 2. Halb- jahr 1996 bis zum Abschluf3 der Entgeltvereinbarungen ftir 1998 sei zun~ichst graphisch anhand des Box-and-Whiskers-Plots veranschau- licht (Abbildung 1). Gut erkennbar ist bereits hierbei die erhebliche Sprei- zung der Heimentgelte entsprechend der Pflegestufen. Weiterhin erkenn- bar ist auch ein Anstieg des Medians sowie des ersten und dritten Quar- tils in den Pflegestufen I bis III und ein RiJckgang des Quartilsabstandes (Hi3he des Kastens). Das AusmaB der Steigerung der Durchschnittsent- gelte und des gleichzeitigen Rtickgangs der Streuung ist Tabelle 4 zu ent- nehmen.
Abbildung 1 : Boxplot der Heimentgelte rheinltindischer Pflegeheime im 2. Halbjahr 1996 und in 1998
300'
250 .I- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---.,---- . . . . .,X. . . . .
200 1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r . . . . . [- 150
100
_.L_ x
50 HENTG. S1-01.7.96 " HENTG St'l 1.7.96 " HENTG. SL'II 1.7.96 " HENTG. St~lll 1.7.9
HENTG, St. 0 1998 HENTG. St. 11998 HENTG. St. II 1996 HENTG. St. III 1998
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von Pflegesatzdaten des Landschafts- verbandes Rheinland.
320 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Von der Umstellung der Heimentgelte auf die zweite Variante der Uber- gangsregelung bis zum AbschluB der Vereinbarungen fiir 1998, also in einem Zeitraum von l~ingstens eineinhalb Jahren, 22 stiegen die durchschnittlichen Heimentgelte (pflegebedingte Kosten, Kosten ftir Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten) in den Pflegestufen I bis I I I u m 2,7% (Stufe I) bis 4,0% (Tabelle 4). 23 Damit lagen die umgerechneten jS_hrlichen Steigerungsraten - insbesondere in den h6heren Stufen - deutlich fiber der 1%-Marge, die Art. 49b PflegeVG als HSchstgrenze fiir jahrliche Steigerungen vorsieht. 24
Tabelle 4: Lage- und StreuungsmaBe der Heimentgelte rheinlEndischer Pflegeheime im 2. Halbjahr 1996 und fiir 1998
Zahl Mittel- Mini- Maxi- Spann- Quar- Stan- Varia- der gill- wert mum mum weite tilsab- dardab- tions-
tigen stand wei- koeffi- F~lle (N) chung zient
Stufe h 1996 (DM/Tag) 436 123,70 75,93 170,57 94,64 22,27 16,04 0,13 1998 (DM/Tag) 436 127,03 82,80 194,93 112,13 19,41 14,77 0,12
Stufe Ih 1996 (DM/Tag) 436 146,98 92,88 198,24 105,36 25,27 18,25 0,12 1998 (DM/Tag) 436 151,96 102,60 201,00 98,40 22,72 16,49 0,11
Stufe IIh 1996 (DM/Tag) 436 187,78 122,53 249,09 126,56 30,89 22,48 0,12 1998 (DM/Tag) 436 195,24 134,75 253,55 118,80 27,57 19,92 0,10
,,Stufe 0": 106,22 63,22 1996 (DM/Tag) 436 149,82 86,60 20,78 14,55 0,14 1998(DM/Tag) ~-:,,-~436 ~ 102,23 [ 62,46 188,86 126,40 17,36 13,52 0,13
. . . . . . . . . . . . . . . .
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis yon Pflegesatzdaten des Landschafts- verbandes Rheinland
22 Die Umstellung auf die 2. Variante der Obergangsregelung konnte zujedem Zeit- punkt vom 1.7.1996 bis zum 1.1.1997 erfolgen. Unabh~ngig vom Zeitpunkt der Umstellung werden diese Entgelte in allen Auswertungen mit dem 2. Halbjahr 1996 indiziert. Die Entgelte fiir 1998 gelten fiir dieses Kalenderjahr - unabh~in- gig vom Zeitpunkt der Vereinbarung. Zwischen dem Inkraftreten der Entgelte der 2. Variante bis zum Inkrafttreten der neuen Entgelte liegt somit ein Zeitraum von l~agstens eineinhalb Jahren.
23 Wird nicht die Steigerung der Mittelwerte, sondern der Mittelwert der Steige- rung errechnet, ergeben sich sogar noch deutlich h6here Prozentwerte von 3,1 (Stufe I), 3,8 (Stufe II) und 4,4 (Stufe III).
24 Zum Vergleich: Zwischen 1995 und 1996 sind die durchschnittlichen Heimko- sten im Rheinland um 4 bis fast 5% gestiegen, wobei die Raten in den drei beriick- sichtigten Stufen A, B und C in etwa gleich hoch waren. Dabei nahm auch die Streuung geringfiJgig ab (vgl. Roth/Rothgang 1999).
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 321
Allerdings sind die Durchschnittsentgelte in der ,,Pflegestufe 0" um 3,4% gesunken. Da sich das Heimentgelt als mit den jeweiligen Bewohnerantei- len gewogener Mittelwert aus den Heimentgelten der einzelnen Stufen er- gibt und die verfiigbaren Daten keine Angaben zur Ver~indemng der Be- wohnerstruktur enthalten, kann die Entwicklung des Heimbudgets aus den vorliegenden Daten nicht rekonstruiert werden. Nach Aussagen des Land- schaftsverbandes Rheinland wurde bei den Pflegesatzverhandlungen auch lediglich darauf geachtet, daf3 jeweils das gesamte Heimbudget unterhalb der gesetzlichen Steigerungsrate von 1% p.a. blieb, so dab ,Spielr~iume' ent- standen, in den einzelnen Stufen S~itze zu vereinbaren, die fiber der gesetz- lichen Steigerungsrate lagen. Allerdings stellt Art. 49b PflegeVG expressis verbis nicht auf das Heimbudget, sondem ausdrficklich auf Heimentgelte, also die Summe der Vergfitungen flit einen Pflegefall ab. Die Erklarung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) kann daher nicht entkr~iften, dab die gesetzliche Vorgabe des Art. 49b PflegeVG im Rheinland nicht umgesetzt wurde.
Die Streuung der Heimentgelte hat sich im Beobachtungszeitraum deut- lich verringert. In allen drei Pflegestufen geht der Variationskoeffizient um mehr als 10% seines Ausgangswertes zurfick 25 und verringert sich der Quar- tilsabstand ebenfalls um einen zweistelligen Prozentwert. 26 Dies deutet dar- auf hin, dal3 die Reduktion der Streuung in diesem Zeitraum nicht auf den ,,Kernbereich" der Entgelte in der N~ihe des Mittelwertes beschr~inkt ge- blieben ist, sondern auch die R~inder mit einbezogen hat. N~ihere Auf- schliJsse gibt Tabelle 5 mit den Dezilwerten der Heimentgelte und deren Ver~inderung.
In Tabelle 5 ist ein eindeutiges Muster zu erkennen: die Wachstumsrate nimmt vom i. zum 9. Dezil in allen Pflegestufen kontinuierlich ab, 27 h6here De- zilswerte steigen durchg~ingig weniger als niedrigere. Zu beobachten ist so- mit eine ,,Angleichung nach oben ", bei der durch einen verst~irkten Entgelt- anstieg bei den zuvor billigsten Einrichtungen gleichzeitig die Streuung re- duziert und der Mittelwert erh6ht wird.
25 Auch in der ,,Pflegestufe 0" ist der Variationskoeffizient rfickl~iufig, wenn auch nicht in gleichem MaBe wie in den ,,echten" Pflegestufen.
26 W~hrend die Spannweite in den Pflegestufen I und II ebenfalls rfickl~iufig ist, steigt sie in Pflegestufe I an. Dies ist auf die Entwicklung in einer Hildener Ein- richtung zurfickzufiihren, deren Heimentgelt fiir Pflegestufe I im Betrachtungs- zeitraum von 147,94 DM auf 194,93 DM angestiegen ist. Das Heimentgelt der n~ichst teuersten Einrichtung liegt mit 166,22 DM schon unter dem Maximum ffir 1996, so dab sich bei Ausschlul3 der Hildener Einrichtung auch ffir die Heim- entgelte der Stufe I eine riackl~iufige Spannweite ergibt. Dies zeigt, wie anfiillig die Spannweite fiir einzelne ,,Ausreil3er" ist.
27 Diese Tendenz gilt auch fur die ,,Pflegestufe 0", wobei hier aber zu berticksich- tigen ist, dab die Entgelte rfickl~ufig sind.
322 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Tabelle 5: Dezile der Heimentgelte und deren Ver~inderung
N Perzentile
Giiltig I0 20 30 40 50 60
Stufe I: 1996(DM/Tag) 436 101,63 109,75 114,73 119,69 124,27 128,84 1998(DM/Tag) 436 107,97 114,49 119,37 122,13 127,27 131,13
Stufe II: 1996(DM/Tag) 436 121,74 131,46 137,51 142,74 147,06! 152,18 1998(DM/Tag) 436 !130,12 137,52 143,89 147,55 151,61 156,29
Stufe III: 1996(DM/Tag) 436 156,43 167,90 176,39 182,88 188,42 194,35 1998(DM/Tag) 436 169,00 177,80 185,14 190,57 195,72 200,06
?N@N@m@N ,,Stufe 0": 1996(DM/Tag) 436 87,08 93,21 98,13 102,19 106,51 110,35 1998(DM/Tag) 436 85,73 91,08 94,77 97,85 101,99 106,00
70 80 90
132,47 137,10 144,39 134,52 139,30 145,58
157,62 162,80 169,77 160,34 166,67 172,91
200,20 207,58 216,13 206,09 212,00 220,62
IImN 113,88 119,00 124,91 108,35 113,96 118,98
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Pflegesatzdaten des Landschaftsverbands Rheinland.
Diesen negativen Zusammenhang zwischen dem Entgelt zum Umstellungs- zeitpunkt und der Entgeltsteigerung f'tir das Jahr 1998 best~itigt auch die Kor- relationsanalyse (Tabelle 6). Sowohl die absoluten als auch die relativen Ver- ~inderungen der Heimentgelte sind in allen Pflegestufen - signifikant - ne- gativ mit dem Ausgangswert korrelliert. Der Zusammenhang ist dabei stO- ker, wenn auf die prozentuale und nicht auf die absolute Ver~inderung der Entgelte abgestellt wird. Mit Ausnahme der ,,Stufe 0", die - wie auch schon in einigen der vorstehenden A n a l y s e n - eine Sonderstellung einnimmt, steigt der (negative) Zusammenhang zwischen Ausgangswert und Ver~inderungs- rate mit den Pflegestufen. Der AngleichungsprozeB schreitet somit in Stufe III am schnellsten voran.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 323
Tabelle 6: Zusammenhang zwischen Ausgangsstand und Veranderungen der Heim- entgelte von 1996 bis 1998
Heimentgelte 1996 absolute Ver'~inderung der Heimentgelte von
1996 bis 1998 (in DM/Tag)
relative Ver~inderung der Heimentgelte von 1996 bis 1998
(in % des Ausgangswertes)
(N = 4 3 6 ) Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson (r)
Stufe I -0,399 -0,448 Stufe II -0,430 -0,482 Stufe III -0,461 -0,525 ,,Stufe 0" -0,395 -0,345
Alle Korrelationen sind auf dem Irrtumsniveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Pflegesatzdaten des Landschaftsver- bandes Rheinland.
Zusammenfassend l~il3t sich somit feststellen, dab die Entgeltvereinbarun- gen fur 1998 zu einer Steigerung der Heimentgelte geffihrt haben, die deut- lich fiber der gesetzlich vorgegebenen H/Schstgrenze von 1% per annum liegt. Dabei ist ein negativer Zusammenhang zwischen dem Ausgangswert und der Entgeltsteigerung zu erkennen. Dadurch dab die Entgelte der bislang rela- tiv billigeren Einrichtungen stoker steigern als die der relativ teureren, sinkt die Streuung und es kommt zu einer Angleichung der Entgelte nach oben.
4.3 Entwicklung der Teilentgelte
Bereits mit der Umstellung auf die 2. Variante der (0bergangsregelung nach Art. 49a PflegeVG wurde eine Aufteilung der Heimentgelte in Teilentgelte vorgenommen. Somit besteht die Chance ffir die Einrichtungen, die ihre Ver- gfitung auf die 2. Pflegesatzvariante umgestellt haben, zu prfifen, wie sich die Entwicklung der Vergiitung differenziert nach Teilentgelten darstellt.
Die in Tabelle 7 angegebenen Lage- und StreuungsmaBe der pflegebeding- ten Aufwendungen zeigen zwischen 1996 und 1998 ein im Vergleich zu den gesamten Heimkosten stark iiberproportionales durchschnittliches Wachs- tum: Dieses lag in den Stufen I-III bei ca. 8%. Allerdings sanken die Pfle- ges~tze in der ,,Stufe 0" um durchschnittlich 6,5%. Die Streuung ist - aus- weislich des Variationskoeffizienten und des Quartilsabstands - rfickl~iufig, wobei dieser Rfickgang mit steigender Pflegestufe um so stoker ausgepr~gt ist. Dieser positive Zusammenhang zwischen Pflegestufe und Rfickgang der Streuung ist bei den pflegebedingten Kosten wesentlich starker als bei den Gesamtheimentgelten (vgl. Tabelle 4).
Wie die in Tabelle 8 enthaltenen ZusammenhangsmaBe zeigen, besteht die negative Korrelation zwischen Ausgangswert und Ver~inderung der Entgelte auch ftir die pflegebedingten Aufwendungen. Die St/irke des Zusammenhangs entspricht dabei in etwa den Werten, die sich auch ffir die gesamten Heim- entgelte ergaben.
324 z . f . Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Tabelle 7: Lage- und StreuungsmaBe der pflegebedingten Aufwendungen rheinlan- discher Pflegeheime im 2. Halbjahr 1996 und in 1998
n=436 Mittel- Mini- Maxi- Spann- Quar- Stan- Varia-i Perzentile wert mum mum weite tilsab- dard- tions-
stand abwei- koeffi- I
chung zient 25 50 [ I
75
Stufe I: 1996(DM/Tag) 58,26 40,86 81,63 40,77 10,32 7,24 0,12 52,94 58,18 63,26 1998(DM/Tag) 62,74 42,58 121,32 78,74 8,52 7,32 0,12 58,30 62,61 66,82
Stufe II: 1996(DM/Tag) 81,54 57,21 114,28 57,07 14,27 10,12 0,12! 74,11 81,46 88,38 1998 (DM/Tag) 87,67 59,61 127,39 67,78 12,12 9,47 0,11 81,62 87,62 93,74
Stufe III: 1996(DM/Tag) 122,34 85,81 171,42 85,61 21,68 15,20 0,12 111,16 122,18 132,84 1998 (DM/Tag) 130,95 89,42 / 183,27 93,85 17,74 13,74 0,10 122,24 130,86 139,98
,,Stufe 0": 1996(DM/Tag) 40,78 28,61 57,14 28,53 7,23 5,07 0,12 37,05 40,73 44,28 1998(DM/Tag) 37,94 25,55 115,25 89,70 5,34 6,00 0,16 35,03 37,62 40,37
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rheinland.
Tabelle 8: Zusammenhang zwischen Ausgangsstand und Ver~inderungen der pile- gebedingen Aufwendungen von 1996 bis 1998
Pflegebedingte Aufwendungen 1996
absolute Veranderung der pflegebedingten Aufwendungen
von 1996 bis 1998 (in DM/Tag)
relative Ver'anderung der pflegebedingten Aufwendungen von
1996 bis 1998 (in % des Ausgangswertes)
(N = 4 3 6 ) Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson (r)
Stufe I -0,368 -0,438 Stufe II -0,420 -0,497 Stufe III -0,453 -0,530 ,,Stufe 0" -0,356 -0,288
Alle Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seifig) signifikant.
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rheinland.
Sind die Pfleges~itze seit 1996 im Verh~iltnis zu den gesamten Heimentgel - ten besonders stark gestiegen, dann mtissen andere Teilentgelte entsprechend weniger gestiegen oder sogar gesunken sein. Tats~ichlich zeigen die ent- sprechenden Lage- und StreuungsmaBe, dab die Investitionskosten ein ge- ringeres Wachs tum aufweisen als die pf legebedingten Aufwendungen und
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 325
dab die Aufwendungen fur Unterkunft und Verpflegung sogar gesunken sind (vgl. Tabelle 9).
Tabelle 9: Lage- und Streuungsmal3e der Aufwendungen ftir Unterkunft und Ver- pflegung rheinlandischer Pflegeheime 1996 und 1998
n=436 Mittel- Mini- Maxi- Spann- Quar- Stan- Varia- Perzentile wert mum mum weite tilsab- dard- tions-
stand abwei- koeffi- chung zient 25 t 50 [ 75
Aufwendungen fiir Unterkunft and Verpflegung 1996 (DM/'rag) 46,22 26,64 74,58 47,94 5,99 5,24 0,11 43,58 46,35 49,57 1998(DM/Tag) 44,48 24,96 50,36 25,40 4,66 3,92 0,09 42,61 45,07 47,27
. . . . . . . . . , , s l . . . . . . . . . . . : , :
Investitionsaufwendungen
1996 (DM/Tag) 19,23 2,59 48,46 45,87 15,32 9,42 0,49 11,14 18,75 26,46 1998 (DM/Tag) 19,82 3,00 48,00 46,00 15,41 9,52 0,48 11,67 19,80 27,08
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rheinland.
Dieser Befund deutet darauf hin, dal3 bei der Neuaushandlung der Heim- entgelte eine Verschiebung zwischen Teilentgelten fiar pflegebedingte Auf- wendungen und Aufwendungen ftir Unterkunft und Verpflegung stattgefun- den hat. Da die Differenzierung der Teilentgelte bei der Umstellung auf das PflegeVG Schwierigkeiten bereitete, e in ig teman sich zun~ichst auf die Re- gelung, dal3 die alten Pfleges~itze (abziiglich der Investit ionsaufwendungen) pauschal in 65% pflegebedingte Aufwendungen und 35% Aufwendungen fiir Unterkunft und Verpflegung aufgeteilt werden. Diese Aufteilung wurde bei den Neufestsetzungen offensichtlich systematisch zugunsten der pile- gebedingten Aufwendungen korrigiert.
Tabelle 10: Zusammenhang zwischen den Entgelten ftir pflegebedingte Aufwen- dungen 1996 und den Ver~inderungen der Entgelte fiir Unterkunft und Verpflegung von 1996 bis 1998
Pflegedingte Auf- wendungen 1996
absolute Ver~inderung der Kosten ftir Unterkunft
und Verpflegung von 1996 bis 1998 (in DM/Tag)
relative Ver~inderung der Kosten fiir Unter-
kunft und Verpfle- gung von 1996 bis 1998
(in % des Ausgangswertes)
(N = 436) Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson (r)
Stufe I -0,262 -0,244 Stufe II -0,266 -0,247 Stufe III -0,262 -0,244 ,,Stufe 0" -0,262 -0,244
Alle Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rhein- land.
326 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Entsprechende Korrelationsanalysen zeigen, dal3 die Reduktion der Teilent- gelte ftir Unterkunft und Verpflegung umso gr/513er war, je h/3her der ent- sprechende Ausgangswert war (r = -0,668; r 2 = 0,497). Tabelle 10 zeigt zu- dem einen signifikanten - aber ~iul3erst schwachen - negativen Zusammen- hang zwischen den pflegebedingtgen Aufwendungen zum Zeitpunkt der Um- stellung auf die 2. Pflegesatzvariante und der Anpassung der ,,Hotelkosten". Anscheinend wurden die Korrekturen der Entgelte ftir Unterkunft und Ver- pflegung in den Verhandlungen auch als Puffer benutzt, um die Preissteige- rungen bei teureren Einrichtungen zu begrenzen.
4.4 Einflufl der HeimgriSfle und Tr~igerschaft auf die Entwicklung der Heimentgelte
Abschliel3end soil nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit auch die restliche Streuung der Heimentgelte durch weitere im Datensatz vorhandene Variablen erkl~irt werden kann. Als m~3gliche im Datensatz vorhandene Va- riablen kommen die Heimgr/36e und die Tr~igerschaft in Frage.
Als Indikator ftir die HeimgriJfle wird die Zahl der Bewohner zum 30.6.1996 verwendet, die wegen ihrer Bedeutung fur die Berechnung der Teilentgelte fiir alle die Einrichtungen, die auf die zweite Pflegesatzvariante umgestellt haben, in den Daten enthalten ist. Die Korrelationsanalyse zeigt, dab die mit- tels dieses Indikators bestimmte Heimgr/3fSe positiv mit den Heimentgelten ftir das 2. Halbjahr 1996, fiir 1998 und fiir die Ver~indemng der Heiment- gelte korreliert ist. 28 Bezogen auf die Teilentgelte sind die Zusammenh~inge insbesondere ftir die Investitionsaufwendungen (1996 und 1998) (hoch)- signifikant. ~9 Der Zusammenhang zwischen Heimgr/513e und allen anderen Teilentgelten bzw. deren ,~nderungen ist dagegen nicht signifikant (p > 0,1). ,,Economies of scale", also gtinstigere Produktionsbedingungen ftir Grol3einrichtungen, - soviel l~iBt sich sagen - lassen sich anhand der vereinbarten Entgelte nicht nachweisen, es ist sogar eher das Gegenteil der Fall.
Geprtift werden kann weiterhin der Einflul3 des kategorialen Merkmale Trii- gerschaft. 3~ Nach ersten Auswertungen des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen weisen Tr~iger der gemeinntitzigen Wohlfahrtspflege in Westdeutschland bis zu 4,1% h/Shere Pfleges~itze auf als private Trager, w~hrend es in Ostdeutschland genau umgekehrt ist: hier liegen private Tr~i- ger bis zu 12,3% tiber dem Durchschnitt (Gerste/Rehbein 1998: 56). 31
28 Zum 30.6.1996 liegen auf einem Signifikanzniveau von 0,1% signifikante, al- lerdings schwache Korrelationen zwischen Heimgr/3Be und Heimentgelten in den Stufen A (r=0,164), B (r=0,159) und C (r=0,135), nicht jedoch in der Stufe Ge- rontopsychiatrie, vor.
29 Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt hier bei weniger als 0,1%. 30 Da die unabh~ingige Variable nur nominal skaliert ist, werden im folgenden keine
Regressionsanalysen, sondern Mittelwertvergleiche ftir die Teilpopulationen durchgeftihrt.
31 Ein - teilweise behaupteter - positiver Zusammenhang zwischen dem Heim- entgelt und der Fachkraftquote lieB sich dabei nicht nachweisen.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 327
Tabelle 11 zeigt ffir das Rheinland, dab die Einr ichtungen der Wohlfahrts- verbiinde sowohl unmit telbar nach Umste l lung auf die zweite Pflegesatzva- riante in der 2. Jahreshalfte 1996 als auch im Jahre 1998 ftir alle Pflegestu- fen iiberdurchschnittliche Entgelte ffir pf legebedingte Aufwendungen und zwar in allen Pflegestufen (einschlieBlich der Stufe ,,0") sowie h6here Ent- gelte ffir Unterkunft und Verpflegung aushandeln konnten. Ledigl ich bei den Invest i t ionsaufwendungen weisen sie niedrigere Werte als kommuna le und private Tr~iger aus, was darauf zurfickzuffihren sein dfirfte, dab sie in der Ver- gangertheit eine h6here Invest i t ionsf6rderung in Anspruch nehmen konnten. Umgekehr t liegen die Entgelte der privaten Triiger ffir pflegebedingte Auf- wendungen und ffir Unterkunff und Verpflegung zu beiden Zeitpunkten un- terhalb des Durchschnit ts aller Tr~iger. Das Teilentgelt ffir Investit ionsauf- wendungen ist dagegen fiberdurchschnittl ich. 1996 lagen die Entgelte ffir kommuna le Einr ichtungen (ffir Pflegeleis tungen und fiir Unterkunft und Ver- pf legung) sogar noch geringftigig fiber denen der Wohlfahrtsverbiinde, 1998 lagen sie dagegen darunter, aber noch fiber den Entgelten ffir private Triiger.
Tabelle 11: Durchschnittliche Heimentgelte nach Triigerschaft der Einrichtung in der 2. Jahresh/ilfte 1996 und im Jahr 1998
Wohlfahrt kommunal privat Insgesamt (n=380) (n=19) (n=37) (n=436)
Pflegekosten Stufe I
Stufe II Stufe III
,,Stufe 0"
58,53 81,92
122,29 40,97
59,03 82,64
123,96 41,32
2. Jahresh~ffe 1996
Unterkunft und Vet- 46,28 47,14 pflegung
Investitions- 18,74 19,47 kosten
Pflegekosten Stufe I 63,17 61,53
Stufe II 88,35 86,03 Stufe III 132,01 128,78
,,Stufe 0" 38,15 37,14
Unterkunft und Ver- 44,66 44,15 pflegung
Investitions- 19,41 19,47 kosten
55,03 58,27 77,04 81,54
115,55 122,34 38,52 40,78
45,15 46,22
24,00 19,23
1998
58,98 62,74 81,72 87,67
121,41 130,94 36,25 37,94
42,81 44,48
23,97 19,81
Signifikanzniveau des Unter- schieds (p < ...) zwischen
den drei Privaten und Tr~igem Sonstigen
0,017 * 0,004 ** 0,017 * 0,005 ** 0,017 * 0,004 ** 0,017 * 0,004 **
0,337 0,194
0,004 ** 0,001 ***
0,003 ** 0,001 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,149 0,069
0,019 * 0,006 **
0,019 * 0,005 **
* Die Mittelwerte sind verschieden bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von h6chstens 5%. ** Die Mittelwerte sind verschieden bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von h6chstens 1%. *** Die Mittelwerte sind verschieden bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit yon h6chstens 0,1%.
Quelle: Eigene Berechnungen aufBasis der Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rheinland.
328 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Nach der Varianzanalyse sind die Unterschiede zwischen den pflegebedingten Aufwendungen der drei Tr~igem 1996 in allen Pflegestufen und bei den Investi- tionskosten signifikant. 1998 sind zudem auch die Entgelte fiir Unterkunft und Verpflegung signifikant verschieden, nicht mehr allerdings die pflegebedingten Aufwendungen ftir die ,,Stufe 0". Werden die Einrichtungen der Wohlfahrts- verb~de und die Heime in kommunaler Tr/igerschaft zusammengefaBt und den privaten T~gem gegentibergestellt, verschSa'fen sich die Unterschiede sogar noch, was zu einer Erh6hung des Signifikanzniveaus fiZhrt (Tabelle 11). 32
Tabelle 12: Ver/inderung der durchschnittl ichen Heimentgelte von 1996 bis 1998 nach Trtigerschaft der Einrichtung
Wohlfahrt kommunal (n=380) (n=19)
Pflegekosten Stufe I 4,64
Stufe II 6,43 Stufe III 9,09
,,Stufe 0" -2,83
Unterkunft ! und Ver- -1,62 pflegung
Investitions- 0,67 kosten
Pflegekosten Stufe I 8,46
Stufe II 8,38 Stufe III 7,95
,,Stufe 0" -6,47
Unterkunft und Ver- -2,86 pflegung
Investitions- 9,25 kosten
privat Insgesamt (n=37) (n=436)
absolut (in DM/Monat)
2,50 3,87 4,48 3,39 4,54 6,13 4,82 5,61 8,61
-4,18 -2,30 -2,84
-2,99 -2,34 - 1,74
0,00 0,00 0,58
relativ (in % des 1996er Wertes)
4,98 7,65 8,24 4,80 6,35 8,05 4,51 5,16 7,56
-9,28 -5,11 -6,48
-6,31 -4,71 -3,17
0,00 0,00 8,03
Signifikanzniveau des Unter- schieds (p < ...) zwischen
den drei Pfivaten und Tr~igem Sonstigen
0,209 0,448 0,047 * 0,127 0,018 * 0,041 * 0,480 0,536
0,202 0,327
0,438 0,297
0,319 0,7134 0,095 0,209 0,030 * 0,056 0,555 0,523
0,107 0,241
0,549 0,380
* Die Mittelwerte sind verschieden bei einer Imumswahrscheinlichkeit von h6chstens 5%. ** Die Mittelwerte sind verschieden bei einer Imumswahrscheinlichkeit von h6chstens 1%. *** Die Mittelwerte sind verschieden bei einer lmumswahrscheinlichkeit yon h6chstens 0,1%.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Pflegesatzdaten des Landschaftsverbandes Rheinland.
32 Die Varianzanalyse setzt Normalverteilung voraus, die ab einer Sfichprobengr6Be von n >t 40 approximativ unterstelk werden kann. Da im Datensatz jedoch nut Informa- tionen ftir 37 Einrichtungen in privater Tr~igerschaft vorliegen, ist die Annahme der Normalverteilung kritisch. Die Anwendung nicht-parametrischer (= verteilungsfreier) Testverfahren besN'tigt aber die obigen Ergebnisse. Die Imumswahrscheinlichkeit ftir die Hypothese unterschiedlicher Mittelwerte sinkt bei Anwendung des Mann-Whit- ney-U-Tests ftir 2 unabhangige Stichproben sowie des Mediantests und des Kruskall- Wallis-Tests ftir den Vergleich der drei Tr~gergruppen sogar noch deutlich.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 329
Tr/~gerspezifische Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich der Veriinde- rung der Heimentgelte zwischen 1996 und 1998 (vgl. Tabelle 12). 33 So wei- sen die Einrichtungen der Wohlfahrtsverb/inde nicht nur h6here Entgelte ftir 1996, sondem auch bei allen Teilentgelten eine (absolut und relativ) iiber- durchschnittliche Steigerung (bzw. einen unterdurchschnittlichen Rtickgang beim Entgelt fiir Unterkunft und Verpflegung) auf, w~lrend die Entgelte fiir Einrichtungen privater Tr~iger (mit Ausnahme der pflegebedingten Aufwen- dungen in der,,Stufe 0") unterdurchschnittlich wachsen. Allerdings sind diese Unterschiede nur teilweise signifikant. 34
5. Fazit
Wie die vorstehende Datenanalyse gezeigt hat, steigen die Heimentgelte ftir Pflegebedtirftige auch nach Einftihrung der 2. Stufe der Pflegeversicherung weiter an. Mit durchschnittlichen Steigerungsraten yon rund 7-8% (pflege- bedingte Aufwendungen) und 3-4% (Gesamtheimentgelte) for einen Zeit- raum von maximal eineinhalb Jahren liegen diese Steigerungsraten deutlich tiber der in Art. 49b PflegeVG normierten H6chstgrenze von 1 % pro Jahr (in Westdeutschland). Diese Regelung ist offenbar ohne die beabsichtigte Wirkung geblieben. Dennoch sind Effekte der neuen Vergtitungsregelungen unverkennbar. So liegen die genannten Steigerungen deutlich unter den j/~hr- lichen Wachstumsraten von j~JJarlich fast 8% (Gesamtentgelt), die sich durch den Vergleich der Studien von Krug/Reh (1992) und Schneekloth/Mtiller (1995) ftir den Ftinfjahreszeitraum von Ende 1989 bis Ende 1994 ergeben, und auch noch merklich unter der Steigerung von insgesamt knapp 5%, die sich fur die Ver~inderung von Januar 1995 bis Ende Juni 1996 ergibt (vgl. Roth/Rothgang 1999).
Gr6Bere Erfolge zeigen sich beim Versuch, die Streuung der Pfleges~itze durch Standardisierung einzugrenzen. Kommt es durch die Umstellung auf die 2. Variante der Vergtitungsregelung zun~ichst laut Variationskoeffizienten zu ei- n e r - durch die abweichende Einstufung der Pflegebedtirftigen und die Um- rechnungsmethode bedingten - Erh6hung der Streuung, so geht diese von
33 Anders als in einigen vorstehenden Tabellen enth/ilt diese Tabelle nicht die Ver- ~inderung der Durchschnitte, sondern die Durchschnittswerte der Ver/inderung, denn nur der Riickgriff auf die individuellen Ver/inderungsraten der einzelnen Einrichtungen erlaubt es, die Signifikanz der Unterschiede zwischen den ver- schiedenen Tr/igem zu ermitteln.
34 Das Signifikanzniveau sinkt, wenn die kommunalen Tr~iger mit den Tr/igem der freien Wohlfahrt den privaten Anbietern gegentibergestellt werden. Dies ist dar- auf zurtickzuftihren, dab die Entgelte der kommunalen Tr~iger noch weniger stei- gen als die der privaten. Nicht-parametrische Testverfahren (Kruskall-Wallis- Test, Mediantest) weisen dagegen die Unterschiede der drei Tr~igertypen bei den pflegebedingten Aufwendungen far alle Pflegestufen als signifikant auf dem 5 %- Niveau aus, der Mediantest ergibt teilweise sogar eine Irrtumswahrscheinlich- keit yon weniger als 1%. Auch bei der Gegentiberstellung von privaten und son- stigen Tr/igem ergibt der Mann-Whitney U-Test auf dem 5-%-Niveau signifi- kante tr~igerbezogene Unterschiede for die absoluten Ver/inderungen der Heim- entgelte der ,,echten" Pflegestufen I-III.
330 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
1996 bis 1998 deutlich zuriick (vgl. Tabelle 1 und 4). 35 Dieser Rtickgang wird zun~ichst durch Anpassung der Extremwerte erzielt, was sich an der Verktir- zung von Spannweite und Quartilsabstand ablesen l~iBt. Wie die Betrachtung der Dezile zeigt, erfolgt die Angleichung der Pfleges~itze derart, dab die Wachstumsraten der pflegebedingten Kosten umso h6her sind, je niedriger das urprtingliche Entgelt lag. Diesen Zusammenhang belegt auch die Kor- relationsanalyse, die eine signifikante (negative) Korrelation von altem Heim- entgelt (2. Halbjahr 1996) und Wachstumsrate des Heimentgeltes ergibt. Ins- gesamt kommt es somit zu einer ,,Angleichung nach oben"
Bereits der ,,alte" Pflegesatz im 2. Halbjahr 1996 kann somit einen be- tr~ichtlichen Anteil der Varianz der Ver~inderung zwischen 1996 und 1998 er- kl~en. Ein weiterer Erklarungsfaktor liegt in der Tr~igerschaft der Einrich- tungen. Wiesen die Einrichtungen derfreien Wohlfahrtspflege bereits 1996 signifikant h6here Pfleger als die privaten Einrichtungen auf, so haben sie von 1996 bis 1998 zudem (signifikant) starker zugelegt als die Einrich- tungen anderer Tr~iger. Die tr~gerspezifischen Unterschiede gewinnen im Zeitverlauf somit sogar noch an Bedeutung.
Mit der Standardisierung m6glicherweise verbundenen Hoffnungen auf eine st~kere Kostenbegrenzung werden damit nur sehr bedingt erftillt. Die em- pirische Analyse deutet vielmehr darauf hin, dab Standardisierung und Ver- ringerung der Preisunterschiede fur sich genommen keine hinreichenden Be- dingungen sind, um im Rahmen von Budgetverhandlungen eine st~kere Preisdisziplin zu erzwingen. Allerdings zeigt die theoretische Betrachtung, dab eine notwendige Bedingung ftir stgrkere Kostenkontrolle darin besteht, bei der Ermittlung von Entgelten fur wohldefinierte Leistungen nicht yon den individuellen Kosten, sondern yon Durchschnittswerten auszugehen. Dies ist aber nur m6glich, wenn die Preisunterschiede zwischen den Ein- richtungen nicht so groB sind, dab die Hochpreisheime bei einem Ubergang der Vergiitung auf Durchschnittss~itze unmittelbar aus dem Markt ausschei- den mtissen. M6glicherweise schafft die beobachtbare ,,Angleichung nach oben" mittel- und langfristig.daher Optionen ftir eine st~kere Kostenbe- grenzung, die allerdings den Ubergang zur Vergtitung nach Durchschnitts- werten und die Verhinderung von Kartellabsprachen der Einrichtungen vor- aussetzt. Inwieweit dies gelingt, kann jedoch nur die Zukunft zeigen.
Anzumerken bleibt zum Schlul3, dab im vorliegenden Beitrag lediglich eine quantitative Analyse der Heimentgelte von Pflegeeinrichtungen vorgenom- men wurde. Bewertende Aussagen zur Wtinschbarkeit der Begrenzung der Heimentgelte und solche zur hier v611ig ausgeblendeten Frage der mit den Preisen verbundenen Qualit~it sind damit nicht intendiert.
35 Bei deutlich abweichendem Mittelwert ist lediglich der Variationskoeffizient zum Vergleich der Streuung geeignet. Dieser liegt ffir das 2. Halbjahr 1996 erkenn- bar fiber den Werten ffir den 30.6.1996.
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 331
Literatur
Allemeyer, JiJrgen (1996): Monetik und Ethik- Die Kosten- und Leistungsrechnung in Alten- und Pflegeheimen, in: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 7/96: 9-14.
Berner, Martin (1997): Ein realit~tsfemes Konzept: Kritik am S tandard-Pflegesatz- Modell, in: Altenheim Nr. 7/97, S. 18-20.
BMA (= Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung) 1998: Erster Bericht des BMA gemal3 w 10 Abs. 4 SGB XI vom Januar 1998. BT-Drucks. 13/9528.
Brandt, Franz / Z6rkler, Mafia (1997): Erste Erfahrungen mit der zweiten Stufe, in: Bundesarbeitsblatt, Heft 1 / 1997, S. 11-13.
Bundesarbeitsgemeinschaft der tiber6rtlichen Tr~iger der Sozialhilfe (1980): Stel- lungnahme zur Pflegekostenneuregelung. Bonn, Manuskript.
Btise, Friedhelm, (1996): Jetzt muB gerechnet werden, in: Altenheim 7/96:508-521. Cronj~iger, Anke / Oberdieck, Veit (1996): Begutachtungspraxis des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung in der vollstationaren Pflege. Empirische Ana- lyse fur die alten Bundesl~ader, in: NDV 9/1996: 294-296.
Eifert, Barbara / Rothgang, Heinz (1998): Die Pflegegesetze der L~inder zwischen planerisch-gestaltender und ausffihrungsorientierter Konzeption. In: Bundesverband Ambulante Dienste e.V. (Hg.): Fachjoumal Background, Vol. 3, Heft 4: 5-10.
Eifert, Barbara / Krfimer, Katrin / Roth, Giinter / Rothgang Heinz, (1999): Die Um- setzung der Pflegeversicherung in den L~.ndem im Vergleich, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins ffir tiffentliche und private Ffirsorge 8/99, S. 259-266.
Fachinger, Uwe / Rothgang, Heinz (1995) (Hg.): Die Wirkungen des Pflege-Versi- cherungsgesetzes. Berlin: Duncker & Humblot.
Fuchs, Harry (1997): Die Wohltaten der Pflegekasse - Satt, sauber, still - ProzeB- qualit~it im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, in: Soziale Sicherheit Heft 10/1997 (46): 321-331.
Galperin, Peter (1973): Empfiehlt es sich, in das System der sozialen S icherung eine ,,soziale Heimversicherung" einzuffthren?, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins f~ir 6ffentliche und private Ftirsorge 53, 145-148.
Gerste, Bettina / Rehbein, Isabel (1998): Der Pflegemarkt in Deutschland. Ein sta- tistischer Oberblick. Hrsg. vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO), Bonn: Selbstverlag.
Hein, Reinhard (1997): Widerstand gegen die Standardisierung, in: Altenheim, Heft 5: 16-23.
Hirnschfitzer, Ursula (1988a): Pfleges~itze in stationaren Einrichtungen der Alten- hilfe. Band I: Ergebnisse der Bestandsaufnahme, 2. unver~inderte Auflage. Ber- lin: Deutsches Zentrum fiJr Altersfragen.
Hirnschtitzer, Ursula (1988b): Pfleges~itze in station~ren Einrichtungen der Alten- hilfe. Band II: Pflegesatzvereinbarungen der Bundesl~nder, 2. unver~nderte Auf- lage. Bedim Deutsches Zentrum fiir Altersfragen.
Igl, Gerhard (1998): Neue Steuerungen im Spektrum der Gesundheits- und Pflege- dienste fiir alte Menschen aus rechtlicher Sicht, in: Schmidt, Roland / Braun, Hel- mut / Giercke, Klaus Ingo / Klie, Thomas / Kohnert, Monika (Hg.): Neue Steue- rungen in der Pflege- und sozialen Altenarbeit. Beitr~ige zur sozialen Gerontolo- gie, Sozialpolitik und Versorgungsforschung. Bd. 6. Regensburg: Transfer-Ver- lag: 5-24.
Jacobs, Klaus (1995): Zur Koh~enz von gesetzlicher Pflegeversicherung und an- deren Zweigen der Sozialversicherung, in: Fachinger/Rothgang 1995: 245-262.
Jonas, Ines (1996): Gesetzliche und private Pflegeversicherung: Grol3e Unterschiede bei den Einstufungen, in: Pro Alter 29:11.
KDA (=Kuratorium Deutsche Altershilfe) (1974): Gutachten fiber die station~e Be- handlung von Krankheiten im Alter und fiber die Kosteniibemahme durch die ge- setzlichen Krankenkassen, K61n: Eigenverlag.
332 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4
Krug, Walter/Reh, Gerd (1992): Pflegebedtirftige in Heimen. Statistische Erhe- bungen und Ergebnisse. Studie im Auftrag des Bundesministeriums ftir Familie und Senioren. Band 4 der Schriftenreihe des Bundesministeriums fur Familie und Senioren. Stuttgart, Berlin, Krln: W. Kohlhammer.
Moldenhauer, Meinolf (1996): Pflegeversicherung - Vertragsrechtliche Perspekti- ven zur Umsetzung des Sicherstellungsaufrages in der vollstation/iren Pflege, in: Die Betriebskrankenkasse, Heft 8 / 1996, S. 387-393.
Moldenhauer, Meinolf (1997): Die Finanzierung der vollstationaren Pflege- Sturm- lauf der Pflegeheime gegen den Abschied vom Selbstkostendeckungsprinzip, in: Arbeit und Sozialpolitik, Heft 7/8: 32-40.
Nakielski, Hans (1996): Viele Einstufungen sind weiterhin zu niedrig: Behand- lungspflege und Sozialbetreuung nicht erfagt, in: Pro Alter 2/96: 10.
Naumann, Ralf/Schwedeck, Hans-Joachim (1996a): Von den Pflegekosten zum Entgelt: Bemerkungen zur Umsetzung der Pflegeversicherung, in: Altenheim 9/96: 660-662.
Naumann, Ralf / Schwedeck, Hans-Joachim (1996b): Modellrechnung fiir die Ober- gangsregelung, in: Altenheim 9/96: 664-676.
Pabst, Stefan (1996): Sozialanw~ilte. Augsburg: Maro. Pick, Peter, (1996): Erfahrungen aus der Begutachtungspraxis des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen in der station/iren Pflege, in: NDV 9/1996, S. 296- 298.
Prinz, Aloys (1995): Die Auswirkungen des Gesetzes fiber die Pflegeversicherung auf das Angebot von Pflegeleistungen, in: Fachinger/Rothgang (1995): 27-53.
Roth, Gfinter, (1999): Auflrsung oder Konsolidierung korporatistischer Strukturen durch die Pflegeversicherung? In: Zeitschrift ftir Sozialreform Nr. 5/1999, S. 418- 446.
Roth, G/inter / Rothgang, Heinz (1999): Stop der ,,Preiswalze"? Ffihrt das Pflege- Versicherungsgesetz zu einer Angleichung und Begrenzung der Heimentgelte? ZeS-Arbeitspapier Nr. 11/1999. Bremen: Zentrum fiJr Sozialpolitik.
Rothgang, Heinz (1994a): Die Einffihrung der Pflegeversicherung - Ist das S ozial- versicherungsprinzip am Ende?, in: Riedmi.iller, Barbara / Olk, Thomas (Hg.): Grenzen des Sozialversicherungsstaates. (Leviathan-Sonderheft 14), Opladen, Westdeutscher Verlag: 164-187.
Rothgang, Heinz (1994b): Der Einflug der Finanzierungssysteme und Entschei- dungsregeln auf Besch~iftigungsstrukturen und -volumina deutscher und englischer Krankenh/iuser. Dissertation. Krln.
Rothgang, Heinz (1996): Vom Bedarfs- zum Budgetprinzip? Die EinfiJhrung der Pfle- geversicherung und ihre Rfickwirkung auf die Gesetzliche Krankenversicherung, in: Clausen, Lars (Hg.): Gesellschaften im Umbruch. Beitr~ige des 27. KongreB der Deutschen Gesellschaft ffir Soziologie. Band I. Frankfurt: Campus: 928-944.
Rothgang, Heinz (1997): Ziele und Wirkungen der Pflegeversicherung. Eine 6ko- nomische Analyse, Frankfurt/M., New York 1997.
Rothgang, Heinz / Vogler, Anke (1998): Pflegeversicherung und Sozialhilfe: Die Auswirkungen der 2. Stufe der Pflegeversicherung auf die Hilfe zur Pflege in Ein- richtungen. - Eine empirische Untersuchung im Land Bremen -. (Beitr/ige zur so- zialen Gerontologie, Sozialpolitik und Versorgungsforschung, Band 7 - Schrif- tenreihe des Deutschen Zentrums ffir Altersfragen.) Augsburg: transfer Verlag.
Schneekloth, Ulrich (1997): ZukiJnftige Sozialhilfeabhangigkeit von Pflegebediirf- tigen in Alteneinrichtungen in Nordrhein-Westfalen (Modellrechnung), in: Rei- chert, Monika / Naegele, Gerhard (Hg.), Alterssicherung in Nordrhein-Westfalen: Daten und Fakten (Dortmunder Beitr/ige zur Sozial- und Gesellschaftspolitik), LIT, Mfinster: 80-98.
Schneekloth, Ulrich / Mtiller, Udo (1995): Hilfe- und Pflegebedtirftige in Heimen. Schnellbericht zur Repr~isentativerhebung im Rahmen des Forschungsprojekts ,,Mrglichkeiten und Grenzen selbst~indiger Lebensfiihrung in Einrichtungen" im
Z. f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4 333
Auftrag des Bundesministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mtin- chen: Infratest.
Taylor, Michael (1987): The Possibility of Cooperation. Cambridge: Cambridge Uni- versity Press.
Dr. Giinter Roth, Institut fur Gerontologie an der Universitat Dortmund, Evinger Platz 13, 44339 Dortmund, Tel.: 0231 / 72 84 88 - 22, [email protected] Dr. Heinz Rothgang, Zentrum fi.ir Sozialpolitik, Universit~it Bremen, Parkallee 39, 28209 Bremen, Tel: 0421 / 218 - 4132, email: [email protected]
334 z.f. Gesundheitswiss., 7. Jg. 1999, H. 4