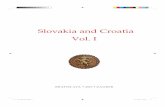Pflege am Limit - Die Ökonomisierung der stationären Alterspflege und ihre Auswirkungen auf die...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pflege am Limit - Die Ökonomisierung der stationären Alterspflege und ihre Auswirkungen auf die...
Pflege am Limit
Die Ökonomisierung der stationären Alterspflege und ihre Auswirkungen auf die Pflegekräfte
Universität Bern
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Institut für Soziologie
Prof. Dr. Christian Joppke
Masterarbeit von:
Adrian Durtschi
Effingerstrasse 93
3008 Bern
05-100-748
6. Semester Master Soziologie
Bern, 31. August 2015
Korrigierte Fassung vom 18.09.2015
Seite 2
Danksagung
Zuerst möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, welche mich beim
Schreiben dieser Masterarbeit unterstützt haben. Viel Motivation, Unterstützung sowie
wissenschaftliche Tipps und Tricks erhielt ich von Nadja und Elisabeth. Harte
Kleinstarbeit leisteten Katja und Samuel beim Lektorat. Ebenfalls zu erwähnen ist
Dominik, ohne dessen Hilfe ich an der Transkription verzweifelt wäre. Ein Dank gehört
auch meinem Arbeitgeber und Udo, welche dafür gesorgt haben, dass ich die nötige
Zeit erhielt um die Masterarbeit fertigstellen zu können. Ein besonderer Dank gilt
ebenfalls meinem Betreuer der Masterarbeit Prof. Dr. Christian Joppke. Ohne seine
Offenheit und seinen liberalen Geist hätte ich weder mein Masterstudium, noch diese
Masterarbeit erfolgreich abschliessen können. Abschliessend möchte ich noch meinen
Eltern danken. Ohne ihre Unterstützung wäre es mir nie möglich gewesen als erstes
Familienmitglied ein Studium an einer Universität zu absolvieren.
Seite 3
Abstract
In der stationären Alterspflege der Schweiz findet ein Ökonomisierungsschub statt.
Diese Arbeit geht der Frage nach, welche Auswirkungen diese Ökonomisierung auf die
Arbeitswelt der Pflegekräfte hat, welche Widersprüche dadurch entstehen und wie
Pflegekräfte darauf reagieren. Basierend auf der Grounded Theory wurden eine
Literaturstudie, zehn qualitative Interviews mit Pflegekräften sowie fünf mit Expertinnen
und Experten plus drei teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Das Ergebnis: In
der Pflege vollzieht sich eine neue kapitalistische Landnahme. Vom Neoliberalismus
getrieben werden aus der industriellen Güterproduktion stammende tayloristische
Methoden zur Produktivitätssteigerung und Kostensenkung eingesetzt. In der Folge
verändert sich die Arbeitswelt der Pflegekräfte. Diese berichten von zu wenig Zeit für
die Bewohnenden sowie für Emotions-, Gefühls- und Beziehungsarbeit, stattdessen
strikte Arbeitsteilung, zunehmende Prekarisierung der Arbeitsbedingungen sowie
gesteigerter Dokumentations- und Kontrollaufwand. Dadurch nimmt die Qualität der
Pflege ab. Für die Pflegekräfte entsteht ein Widerspruch zwischen ihrem Berufsethos,
welches das Wohl der Bewohnenden über alles stellt, und den Anforderungen durch
die Ökonomisierung. Darauf lassen sich fünf idealtypische Reaktion ausmachen:
Anpassung, Resignation, Selbstaufopferung, kleine Tricksereien und offener
Widerstand. Insgesamt findet eine Entfremdung statt, die Arbeits- respektive
Lebensqualität der Pflegenden und Gepflegten verschlechtert sich. Das ist
problematisch: Letztendlich wünschen wir uns alle nicht eine kostensparende und
profitable, sondern die bestmögliche Pflege.
Seite 4
Inhaltsverzeichnis
Danksagung .................................................................................................................. 2
Abstract ......................................................................................................................... 3
Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................... 4
1. Einleitung ............................................................................................................... 6
1.1 Forschungsstand und -relevanz ...................................................................... 7
1.2 Leitfrage und Untersuchungsgegenstand ..................................................... 10
1.3 Aufbau und Struktur der Masterarbeit ........................................................... 12
2. Literaturstand und theoretische Grundlagen ......................................................... 14
2.1 Soziologie der Pflege .................................................................................... 14
2.2 Kapitalistische Landnahme ........................................................................... 19
2.3 Care-Ökonomie – Die Logik des Feldes ....................................................... 25
2.4 Berufssoziologie und Ethos der Pflegekräfte ................................................. 29
3. Stationäre Alterspflege und ihre Finanzierung in der Schweiz .............................. 36
3.1 Finanzierungssystem seit dem 1. Januar 2011 ............................................. 37
3.2 Situation des Personals in der stationären Alterspflege ................................ 39
3.3 Ökonomisierung und Herausforderungen ..................................................... 41
4. Theoretische Einordnung und Diskussion der schweizerischen stationären
Alterspflege .......................................................................................................... 43
5. Methodisches Vorgehen ....................................................................................... 46
5.1 Datenerhebungen ......................................................................................... 47
5.2 Datenauswertung ......................................................................................... 51
5.3 Selbstreflexion .............................................................................................. 51
6. Ergebnisse der empirischen Forschung ................................................................ 53
6.1 Auswirkungen auf die Arbeitswelt ................................................................. 53
6.2 Widersprüche zwischen Berufsethos und ökonomisierter Arbeitsweise ........ 62
6.3 Reaktionen der Pflegekräfte auf die Ökonomisierung ................................... 65
7. Diskussion der Ergebnisse ................................................................................... 73
7.1 Ökonomisierung und Auswirkungen auf die Arbeitswelt ................................ 73
7.2 Ökonomisierung und Widersprüche .............................................................. 77
7.3 Ökonomisierung und Reaktionen .................................................................. 78
7.4 Ökonomisierung und Entfremdung der Pflegekräfte ...................................... 80
7.5 Ökonomisierung und Zukunft ........................................................................ 81
Seite 5
8. Fazit ..................................................................................................................... 83
8.1 Beantwortung der Leitfragestellung .............................................................. 84
8.2 Bewertung und Ausblick ............................................................................... 86
9. Literaturverzeichnis .............................................................................................. 88
10. Abbildungsverzeichnis ........................................................................................ 100
11. Tabellenverzeichnis ............................................................................................ 100
Seite 6
1. Einleitung
„Private Alters- und Pflegeheime betrügen und tricksen, wo es nur geht. Sie haben
mehr Betten und weniger Personal als erlaubt – und sie stufen Betagte in einer zu
hohen Pflegestufe ein, um mehr Geld zu ergaunern“, schrieb die „Sonntagszeitung“ am
28. September 2014 (Balmer et al. 2014a; paraphrasiert durch Initiativkomitee
Altersheim-Initiative 2015) über die stationäre Alterspflege in der Schweiz. Die Pflege
von betagten Menschen ist – zumindest teilweise – ein lukratives Geschäft geworden.
Internationale Ketten und Hedgefonds treten in einen neuen Markt ein, der bis vor
einigen Jahren noch fernab der kapitalistischen Marktlogik organisiert war (Brügger
2015; Rickenbach 2014; Balmer 2012). In der Schweiz war die Pflege und Betreuung
betagter Menschen lange Familien- resp. Frauensache. Durch den gesellschaftlichen
und sozioökonomischen Wandel wird diese Aufgabe immer mehr von
professionalisierten Institutionen übernommen, welche professionelle stationäre oder
ambulante Pflege anbieten (Heintze 2015: 3-12). Gleichzeitig nehmen die
Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien stetig zu. Gemeinden und Kantone
sparen, unter anderem auch bei den Alters- und Pflegeheimen. Zudem werden die
Schweizerinnen und Schweizer immer älter. Dadurch wächst die Nachfrage nach
Plätzen in stationären Alters- und Pflegeheimen und die Kosten nehmen weiter zu. Es
herrscht ein Fachkräftemangel in der Pflege, der immer schlimmer wird (Dolder und
Grünig 2009: 47-59). Inzwischen arbeiten schweizweit alleine in der stationären
Alterspflege über 120‘000 Menschen (BfS 2015: 17). Damit sind Alters- und
Pflegeheime volkswirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich relevant.
Seit 1996 wird die stationäre Alterspflege für alle Betagten von den gesetzlich
obligatorischen Krankenkassen (mit)finanziert (Ryter und Barben 2015: 15). 2011
wurde in der Schweiz letztmals eine neue Pflegefinanzierung eingeführt. Dies geschah
mit dem Ziel, die Kosten neu zu verteilen, die Krankenkassen zu entlasten und
gleichzeitig den Wettbewerb unter den Anbietern zu intensivieren (Zogg 2011: 100-
104).
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten nach Minuten abgestimmte, standardisierte
medizinische Pflege. Industrielle Planungs- und Arbeitsinstrumente halten immer mehr
Einzug in Alters- und Pflegeheimen (Durtschi et al. 2015: 1). Es findet eine schrittweise
Ökonomisierung eines bisher davon nicht betroffenen Bereiches statt. Diese
Entwicklung bringt einen potenziellen Widerspruch mit sich und damit eine enorme
Sprengkraft für die rund 120‘000 Beschäftigten in Alters- und Pflegeheimen, die
Seite 7
Politikerinnen und Politiker, die Heimleitungen, die Bewohnerinnen und Bewohner und
deren Angehörige.
1.1 Forschungsstand und -relevanz
Doch was sagt uns die wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema? Die (Arbeits-)
Situation der Pflegekräfte der stationären Alterspflege und insbesondere die
Auswirkungen der Ökonomisierung auf diese sind bisher wenig erforscht. Ein Grossteil
der Literatur zur stationären Alterspflege befasst sich aus einer medizinischen und/oder
pflegewissenschaftlichen Perspektive mit dem Untersuchungsgegenstand. Spezifisch
für die Schweiz gibt es noch weniger Literatur, welche kurz vorgestellt wird: Corinne
Schwaller (2013) untersucht in ihrer Masterarbeit am Beispiel der Spitex Bern die
Ökonomisierung der ambulanten Alterspflege. Sie zeigt dabei den zunehmenden Druck
und Stress auf, welcher auf die ambulanten Pflegekräfte wirkt und wie jene damit
umgehen. Hierbei findet Schwaller eine stark aufopfernde Haltung der Pflegekräfte
zum Wohle der Spitexpatientinnen und -patienten. Claudio Zogg (2011) erläutert die
Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung auf die Alters- und Pflegeheime,
Bewohnende und die Geldgeber. Das Personal hat er nicht miteinbezogen.
Insbesondere für die Bewohnenden und die Sozialversicherungen lässt sich gemäss
Zogg ein grösserer Kostenaufwand erwarten. Die Ökonomin Mascha Madörin (2014a;
2014b; 2014c) analysiert die Ökonomisierung der Pflege, auch die der stationären
Alterspflege, aus volkswirtschaftlicher Sicht. Gleichzeitig stellt sie dar, weshalb
innerhalb der personenbezogenen Dienstleistungen eine andere Produktions- und
Verwertungslogik gilt als in der Industrie. Madörin erläutert die Wirkung der
Taylorisierung als Ausdruck der Ökonomisierung. Susy Greuter (2015; 2013) zeigt auf,
wie im Gesundheitswesen die soziale Beziehung zwischen Pflegefachkräften und
Pflegeempfangenden unter Druck geraten und sowohl die Pflegefachkräfte wie auch
die Pflegeempfangenden darunter leiden. Zudem weist sie nach, wie es in der
ambulanten Alterspflege zu einer Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse kommt. 2014
veröffentlichte das Institut für Pflegewissenschaften der Universität Basel eine
Erhebung zu den Bedingungen für Pflegekräfte in Alters- und Pflegeheimen (Zùñiga et
al. 2013). Daraus wird ersichtlich, dass zwar eine grosse Zufriedenheit mit dem Beruf
vorherrscht, aber Stress, gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen und die
emotionale Belastung grosse Probleme sind. Die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften befragte 1200 Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in der
Pflege, welche vor kurzem die höhere Fachschule oder Fachhochschule
abgeschlossen hatten (Schaffert et al. 2015). Es zeigte sich, dass der Berufseinstieg
eine Herausforderung darstellt und die Berufseinsteigenden einen hohen Berufsstolz
Seite 8
haben. Die Arbeitsbedingungen müssen aber verbessert werden, um einen
langfristigen Berufsverbleib sicherzustellen. Elisabeth Ryter und Marie-Louise Barben
(2015) analysieren in einer Studie über die Care-Arbeit die aktuellen
Herausforderungen für die Alterspflege in der Schweiz. Sie bemängeln darin die
Trennung von Pflege und Betreuung gemäss der neuen Pflegefinanzierung. Ihnen zu
folge führt dies zu negativen Auswirkungen bei der Pflegequalität, besonders für
Demenzkranke. Deshalb braucht es mehr Zeit für die einzelnen Bewohnenden,
respektive einzelnen Patientinnen und Patienten. Ebenfalls beobachten sie eine
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und einen Fachkräftemangel.
Die Ökonomisierung der Pflege und deren Auswirkungen auf die Pflegekräfte betreffen
mindestens vier sozialwissenschaftliche Bereiche und bilden dort ein relevantes
Thema. Diese Bereiche sind Soziologie der Pflege, Care-Ökonomie, Kapitalismus-
analyse und -kritik sowie Berufs- und Arbeitssoziologie.
Soziologie der Pflege: In der Soziologie der Pflege (Schroeter und Rosenthal 2005)
befasst man sich mit dem Einfluss der Gesellschaft auf die Pflege und dem Einfluss
der Pflege auf die Gesellschaft. Eine Erforschung der Auswirkungen der
Ökonomisierung der Pflege auf die Pflegekräfte und die Pflegearbeit spricht
insbesondere den ersten Teil, nämlich den gesellschaftlichen Einfluss auf die Pflege,
an. Ebenfalls kann die Pflege aufgrund ihrer permanenten sozialen Interaktionen
untersucht werden. Zur Analyse können verschiedene Klassiker genutzt werden, etwa
Norbert Elias, Niklas Luhmann, Talcott Parson oder Pierre Bourdieu.
Care-Ökonomie: Die aus der feministischen Ökonomie stammende Care-Ökonomie,
also die Ökonomie des (Ver-)Sorgens und Pflegens, legt ihren Fokus auf die bezahlte
und unbezahlte Reproduktionsarbeit, zu welcher auch die stationäre Altenpflege
gerechnet wird (Buddlender 2004). Auch die Bedeutung der Emotionen und Gefühle
sowie der sozialen Beziehungen sind in der Care-Ökonomie und ihrer Sicht auf die
Pflege wichtig (Bischoff-Wanner 2002). Sowohl die meisten Pflegekräfte, ob bezahlt
oder unbezahlt, als auch die Mehrheit der Bewohnenden in den Alters- und
Pflegeheimen sind nach wie vor Frauen, was zu spezifischen Ungleichheitssituationen
führt.
Kapitalismusanalyse und -kritik: Dieser Bereich befasst sich mit der Entwicklung und
der Kritik am kapitalistischen System (Altvater 2005). Besonders die Vertreter und
Vertreterinnen der Theorie der kapitalistischen Landnahme und der Ausbreitung des
Neoliberalismus sehen in der Ökonomisierung der Pflege ein Musterbeispiel für die
Expansion des kapitalistischen Systems. Wichtige Vertreterinnen und Vertreter dieser
Seite 9
Theorien sind u.a. Klaus Dörre, David Harvey, Luc Boltanski, Eva Chiapello, Pierre
Bourdieu und Karl Marx.
Berufssoziologie: Die Berufssoziologie befasst sich mit den Fragen nach
gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen und Entwicklungsdeterminanten von
verschiedenen Berufen (vgl. Kurtz 2002). Wolfgang Voges (2002) widmete dem Beruf
der Altenpflege in Deutschland eine eigene Monographie. Eine Ökonomisierung der
Pflege hat direkte Konsequenzen auf die Pflegeberufe und wirkt sich auf
verschiedenste Bereiche wie Berufsmoral, Ausbildungen, Berufsverständnis und
Berufswahl aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pflegekräfte in der stationären
Alterspflege eine wenig erforschte Gruppe sind, es aber viele Anknüpfungspunkte gibt.
Es bestehen Forschungslücken bezüglich der Frage der Ökonomisierung der
stationären Alterspflege in der Schweiz und ihrer Auswirkungen auf das Personal. Hier
knüpft diese Arbeit an und will helfen, Teile dieser Lücke zu schliessen. Forschungen
zur Ökonomisierung der stationären Alterspflege und ihrer Auswirkung sind äusserst
aktuell. In Kanada, den USA aber auch den skandinavischen Ländern wird zurzeit
intensiv dazu gearbeitet (Anttonen und Meagher 2013: 18-20).
Das Thema Ökonomisierung der Pflege bietet sich aus drei Gründen für eine
Forschung an: Erstens weil die Pflege von betagten Menschen gesellschaftlich eine
wichtige Aufgabe ist. Die Menschen werden immer älter und werden mehrheitlich auf
irgendeine Art auf Pflege und Betreuung angewiesen sein. Besonders der Bereich der
stationären Alterspflege ist ausserhalb des medizinischen Bereiches relativ wenig
erforscht. Deshalb ist es unerlässlich, dass diese Lücke vertieft aus soziologischer
Perspektive untersuchtwird, um so die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Einflussfaktoren besser zu verstehen.
Zweitens lassen sich anhand der Pflege und deren Ökonomisierung die Entwicklung
und Auswirkungen des kapitalistischen Systems beobachten und analysieren. Da die
Pflege von der kapitalistischen und damit der betriebswirtschaftlichen Marktlogik lange
nicht erfasst war, lassen sich nun die Einführung dieser Logik und damit auch die
positiven und negativen Ergebnisse erforschen und darstellen. Des Weiteren kann die
Analyse der Ökonomisierung der stationären Alterspflege zu einem besseren und
tieferen Verständnis unseres Wirtschaftssystems führen. Auch kann man beobachten,
wie die Logik der kapitalistischen industriellen Güterproduktion und -verwertung bei
personenbezogenen Dienstleistungen wie der stationären Alterspflege wirkt.
Seite 10
Drittens wächst die Gruppe der bezahlten Pflegekräfte rasch an. Ohne diese
Pflegekräfte gibt es keine professionelle Alterspflege. Ihnen obliegt damit eine grosse
strukturelle Macht bei noch tiefer Organisationsmacht (Arbeitskreis Strategic Unionism
2013: 347-351). Seit 2011 nimmt der gewerkschaftliche Organisationsgrad aber zu
(Rieger et al. 2012: 131). Die Streiks deutscher Erzieherinnen und Erzieher in
Kindertagesstätten vom Sommer 2015 zeigen, wie gross die gesellschaftlichen und
politischen Auswirkungen bei Streiks in artverwandten Berufen sind. Das
gesellschaftliche und politische Sprengpotenzial bei einem Streik der Pflegekräfte ist
ebenfalls riesig. Somit ist die Reaktion der Pflegekräfte auf die Ökonomisierung von
grosser Bedeutung.
1.2 Leitfrage und Untersuchungsgegenstand
Da das ganze beschriebene Themenfeld den Rahmen einer Masterarbeit bei weitem
sprengen würde, werden in dieser Arbeit nur die wichtigsten Aspekte davon
aufgegriffen. Als Grundlage der Masterarbeit dient die folgende Leitfrage:
Wie wirkt sich in der deutschsprachigen Schweiz die zunehmende Ökonomisierung der
stationären Alterspflege seit dem 1. Januar 2011 a) auf die Arbeitswelt der Pflegekräfte
aus, b) was für allfällige Widersprüche bestehen zwischen ihrem Berufsethos und den
Anforderungen durch die Ökonomisierung und c) wie reagieren die Pflegekräfte auf die
Folgen der Ökonomisierung?
Der Untersuchungsgegenstand wird folgendermassen definiert: Untersucht werden
Alltag, Handeln und subjektive Erfahrungen von Pflegekräften aus der stationären
Alterspflege. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, wie sich die zunehmende
Ökonomisierung ihres Berufes und der Alters- und Pflegeheimen seit dem
1. Januar 2011 auf diese Berufsgruppe auswirkt und deren Arbeitswelt und -handeln
verändert. Des Weiteren wird untersucht, wie die Pflegekräfte mit den daraus
resultierenden Folgen umgehen. Damit liegt der Blickwinkel der vorliegenden Arbeit bei
den Pflegekräften und ihren Erfahrungen aus ihrer persönlichen Arbeitswelt. Für diese
Arbeit wurden Pflegekräfte sowie Expertinnen und Experten aus der
deutschsprachigen Schweiz befragt. Die Auswahl erfolgte aus
forschungsökonomischen Überlegungen und wird im Methodenteil ausgeführt.
Um das Verständnis der Fragestellung zu erleichtern, sind einige Definitionen
unerlässlich. Unter Ökonomisierung wird die Einführung der betriebswirtschaftlichen
Marktlogik (Kosten-Nutzenkalkulation der Arbeitgeber) und von tayloristischen
Instrumenten und Messverfahren verstanden. Als stationäre Alterspflege, auch bekannt
Seite 11
als stationäre Langzeitpflege, werden nicht nur die von der Krankenkasse als Pflege
definierten Handlungen betrachtet, sondern die ganze Zeit, während der eine betagte
Person innerhalb eines Alters- oder Pflegeheimes gepflegt und betreut wird.
Schliesslich wird Arbeitswelt in Verbindung mit dem Lebenswelt-Begriff verstanden:
„Als Lebenswelt gilt die subjektive Wirklichkeitskonstruktion eines Menschen (welche
dieser unter den Bedingungen seiner Lebenslage bildet)“ (Kraus 2013: 153).
Arbeitswelt bezieht sich in dieser Arbeit auf alles, was die Lohnarbeit betrifft und sich
auf diese auswirkt.
Die Wahl des Untersuchungsgegenstandes erfolgte aus mehreren Gründen. Einerseits
gibt es wenig Literatur und Studien zu Pflegekräften in Alters- und Pflegeheimen. Dabei
gehören diese einer stark wachsenden Personengruppe an, welche sowohl
zahlenmässig als auch wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hinzu kommt,
dass die Pflege von betagten Menschen in stationären Alters- und Pflegeheimen ein
sich rasant entwickelnder Markt zu sein scheint. Der 1. Januar 2011 wurde als Datum
gewählt, weil seither in der Schweiz ein neues Pflegefinanzierungssystem in Kraft ist,
welches die Ökonomisierung nochmals verstärkt hat. Aus Sicht der Pflegekräfte soll
nachverfolgt werden, wie sich die neue Ökonomisierung in der stationären Altenpflege
vollzieht und wie sie diese erleben. Auch sollen damit Widersprüche, Abwehrkämpfe
und Handlungen der betroffenen Akteure zum Vorschein gebracht werden. Ebenfalls
erlaubt der Untersuchungsgegenstand die Beschreibung, inwiefern und wie sich die
Pflege- und die Kapitallogik aneinander anpassen. Pflege steht somit stellvertretend für
die personenbezogenen Dienstleistungen, welche bisher teilweise von der
kapitalistischen Logik ausgenommen waren. Als Frauenberufe wurden diese oft
unbezahlt geleistet und waren damit weder im Fokus der Wissenschaft noch der
Wirtschaft.
Nicht behandelt werden in dieser Arbeit die weiteren Gesundheitsbereiche, also weder
die ambulante Alterspflege, die akute Pflege in Krankenhäusern, noch neue
Wohnformen für betagte Menschen etc. Es kann nicht geklärt werden, ob Kosten
gespart wurden. Die subjektiven Arbeitswelten der Pflegefachkräfte werden auch nicht
auf ihre „Richtigkeit“ geprüft, sondern als subjektive Wahrheiten wiedergegeben.
Ebenfalls bleiben bei dieser Arbeit die nicht-pflegerischen Berufsgruppen und die
gesamte in diesem Bereich geleistete unbezahlte Arbeit aussen vor. Da das
Pflegewesen in der Schweiz stark föderalistisch geprägt ist, wird hier rein die
Deutschschweiz betrachtet, alles andere würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit nicht statistisch
repräsentativ sein sollen, sondern explorativen Charakter haben.
Seite 12
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, dass sie nicht nur von Personen am
soziologischen Institut der Universität Bern gelesen wird. Sie richtet sich auch als
public sociology an Pflegefachkräfte und weitere mit der stationären Alterspflege
verbundenen Personengruppen (Burawoy 2005). Es soll ferner ein Beitrag zur
Diskussion über die Ökonomisierung und ihre Auswirkungen geleistet werden. Die
Arbeit ist ergebnisoffen und richtet sich nach den gängigen wissenschaftlichen
Standards der qualitativen empirischen Methoden (Tedlock 2005).
1.3 Aufbau und Struktur der Masterarbeit
Um die Leitfrage zu beantworten, wird die Arbeit wie folgt aufgebaut: Zuerst werden in
einem Theorie- und Literaturkapitel die wichtigsten sozialwissenschaftlichen Theorien
für die Leitfrage besprochen und dargestellt. Dazu soll entlang der vier vorgestellten
Theorienblöcke vorgegangen werden. Das Kapitel beginnt mit einer Zusammenstellung
der wichtigsten Metatheorien der Soziologie der Pflege, wobei ein Schwerpunkt bei der
Theorie der Pflege als soziales Feld, wie sie Bourdieu beschreibt, liegt. Der zweite
Theorieblock erklärt, wie sich der Kapitalismus auf neue Bereiche wie die stationäre
Alterspflege ausweitet. Es wird dabei gezeigt, wie in den letzten Jahren eine neue
kapitalistische Landnahme gemäss Dörre und Harvey in ehemals staatlichen
Dienstleistungsbereichen, wie der Pflege von statten geht. Dies geht einher mit der
Erklärung, wie sich der kapitalistische Geist in den letzten Jahren verändert hat, der
Neoliberalismus die Ökonomisierung des Sozialen fördert und welche Auswirkungen
dies hat. Im dritten Theorieblock soll der Aspekt der kapitalistischen Logik in der Pflege
insbesondere aus der Sicht der Care-Ökonomie betrachtet werden. Hier liegt ein
Schwerpunkt auf der von der Güterproduktion verschiedenen Produktions- und
Verwertungsweise von personenbezogenen Dienstleistungsberufen. Ebenfalls soll die
Wirkung von tayloristischen Methoden in diesem Bereich kurz vorgestellt werden. Dies
erlaubt es dann, die Auswirkungen auf die Pflegekräfte zu betrachten. Der vierte und
letzte Theorieblock widmet sich der Frage der Berufs- und Arbeitssoziologie. Hier wird
ein besonderes Augenmerk auf das Berufsethos, die Emotions-, Gefühls-, und
Betreuungsarbeit gelegt und die Frage diskutiert, wie sich die Ökonomisierung auf
diese Berufskonstruktionen auswirken und ob es dadurch zu Widersprüchen kommt.
Im darauf folgenden Kapitel wird das aktuelle System der stationären Altenpflege in der
Schweiz kurz beschrieben. Dem folgt eine Erklärung des aktuellen Finanzierungs-
systems für die Alters- und Pflegeheime sowie eine Darstellung der Lage des
Pflegepersonals und einer Situierung dessen innerhalb des aktuellen Systems. Dem
schliesst sich eine Erklärung zur gegenwärtigen Situation der Ökonomisierung der
stationären Alterspflege in der Schweiz an. Darauf folgt ein erstes Analysekapitel, in
Seite 13
dem das vorgestellte schweizerische System unter die Lupe genommen wird. Es wird
dazu mit den zuvor aus der Literatur und Theorie erarbeiteten Konzepten theoretisch
eingeordnet, bewertet und diskutiert.
Dem folgt das Methodenkapitel inklusive einer Selbstreflektion. Um die Leitfrage zu
beantworten, werden qualitative Methoden genutzt. Dies, da diese es erlauben, die für
die Fragestellung nötige subjektive Lebenswelt und damit die Arbeitswelt der
Pflegekräfte zu erfassen. Bei der Datenerhebung wird auf eine Methodentriangulation
gesetzt. Herzstück sind zehn semistrukturierte Interviews mit Pflegekräften. Dazu
kommen Interviews mit Expertinnen und Experten aus für die Pflegekräfte relevanten
Bereichen. Als Expertinnen und Experten werden je eine Person aus den Bereichen
Arbeitgeber, Beschwerdestelle für Bewohnende, Gewerkschaft, Ausbildungsstätte und
Politik gewählt. Schliesslich wird die Datenerhebung um drei teilnehmende
Beobachtungen ergänzt, namentlich zwei Tagungen von Pflegekräften der
Gewerkschaft Unia und einer Fachtagung der SP Frauen des Kantons Bern. Die
erhobenen Daten werden nach dem Kodierungsverfahren der Grounded Theory in drei
Schritten ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse werden entlang der Leitfrage
dargestellt. Schliesslich werden die Ergebnisse diskutiert und kritisch beleuchtet. Den
Schluss der Arbeit bildet das Fazit, in welchem die Leitfrage beantwortet wird. Dazu
kommen eine Einschätzung der Ergebnisse, der Stärken und Grenzen der Arbeit,
sowie ein Ausblick auf weitere Forschungsfelder in diesem Bereich.
Seite 14
2. Literaturstand und theoretische Grundlagen
Ziel dieses Kapitels ist es, die verschiedenen relevanten Theorien und die Forschungs-
literatur über die Auswirkungen der Ökonomisierung der stationären Alterspflege auf
die Pflegekräfte darzustellen und damit einen Analyserahmen zu bilden. Dies beginnt
mit einigen Überlegungen aus der Soziologie der Pflege, welche in Kapitel 2.1
aufzeigen sollen, wie die Pflege als eigenes System oder soziales Feld analysiert
werden kann. In Kapitel 2.2 werden das Konzept der kapitalistischen Landnahme und
des Neoliberalismus eingeführt und aufgezeigt, wie sich der Kapitalismus in bisher
nicht-kapitalistischen Bereichen ausbreitet. Ein weiterer Aspekt ist, wie diese
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung inkorporiert wird, bis neoliberale Denk- und
Handlungsweisen hegemonial sind. Mit der Care-Ökonomie werden dann in Kapitel 2.3
die besondere Verwertungslogik der personenbezogenen Dienstleistung stationärer
Alterspflege erklärt und Entwicklungen aufgezeigt, welche tayloristische Methoden für
die Pflegekräfte haben. In Kapitel 2.4 erhalten verschiedene berufs- und
arbeitssoziologische Betrachtungen Platz, welche sich um die Entwicklung des
Berufes, die Arbeitsteilung und auch die Emotions- und Gefühlsarbeit drehen.
2.1 Soziologie der Pflege
Die Pflege und damit auch der Teilbereich stationäre Alterspflege kann aus
soziologischer Sicht entweder als soziales System gemäss Luhmann (Bauch 2005;
Fenchel 2008: 164-173) oder als figuratives Feld (Schroeter 2005) oder als konflikt-
und austauschtheoretischer Perspektive (Amrhein 2005) gesehen werden. In diesem
Unterkapitel sollen die einzelnen Theorien vorgestellt und auf ihre Nützlichkeit für die
Beantwortung der Fragestellung überprüft werden. Damit werden erste Erklärungen für
die Dynamiken im sozialen System (Kapitel 2.1.1) oder im sozialen figurativen Feld der
Pflege (2.1.2) aus einer konflikttheoretischer Perspektive (2.1.3) gegeben.
2.1.1 Soziales (Teil-) System Pflege
Aus Sicht von Luhmann (Rasch 2013) bestehen Gesellschaften aus verschiedenen
sozialen Systemen, wobei sich die Systeme durch Prozesse der Kommunikation
strukturieren. Systeme entstehen gemäss Luhmann (1986: 269)
„[...] wenn immer ein autopoietischer Kommunikationszusammenhang entsteht und sich durch Einschränkung der geeigneten Kommunikation gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen, auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen.“
Stabile Systeme können durch ihre Umwelt gestört werden – zum Beispiel beeinflusst
ein neues Finanzierungssystem die Pflege – oder mit anderen sozialen Systemen
gekoppelt werden. Dies führt in der Regel zu Veränderungen und damit einer Irritation
Seite 15
des bisher stabilen Systems. Sind diese Änderungen wichtig, werden sie verarbeitet,
um den Erhalt des Systems zu sichern. Daraus startet der Prozess der Restabilisierung
(Horster 2013: 5). Wenn nun ein allfälliges System der Pflege mit dem System der
Ökonomie und damit der Frage nach wirtschaftlicher Pflegearbeit gekoppelt wird, führt
dies zu Änderungen und Irritation in diesem System. Dies startet einen Prozess, der zu
systemrelevanten Änderungen führt.
Es gilt nun zu prüfen, ob sich Pflege als eigenes soziales System qualifiziert. Dies wird
anhand dreier Kriterien Luhmanns überprüft: Erstens der Autonomie des
Funktionssystemes, zweitens der privilegierten Funktionserfüllung und drittens der
codegeprägten Kommunikationsform (Bauch 2005: 71). Ein System ist autonom, wenn
es seine eigenen Entscheidungen im System treffen und umsetzten kann. Nun ist die
Pflege nach wie vor abhängig von den Entscheiden der Medizin und somit nicht in allen
Bereichen autonom (Schroeter 2006: 30). Es kann aber ein Bestreben nach
Unabhängigkeit festgestellt werden, was Teil der neuen Systemkonstitution ist. Dies
zeigt sich durch die Professionalisierung und Akademisierung im Pflegebereich (Bauch
2005: 73). Zum zweiten Punkt, der Funktionserfüllung, lassen sich nicht sämtliche
Funktionen eindeutig nur der Pflege zuordnen. So ist Behandlungspflege – Tätigkeiten
wie die Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten und Spritzen, das
Einführen von Sonden oder Kathetern etc. (vgl. EDI 2015: Art. 7b) – auch Teil des
Medizinsystems. Grundpflege – diese umfasst Tätigkeiten wie das Einbinden von
Beinen, das Anlegen von Kompressionsstrümpfen, das Betten und Lagern, die Hilfe bei
der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden und beim Essen und Trinken
(vgl. ebd.: Art. 7c) – ist Teil des Alltagshandelns und Gefühlsarbeit und kann
verschiedenen Systemen zugeordnet werden (Bauch 2005: 74f). Doch auch hier
können Bestrebungen festgestellt werden, die Differenzierung zwischen Medizin und
Pflege auszuweiten und zu professionalisieren (Schroeter 2006: 31). Zum dritten
Punkt: Das Codier-System erlaubt die Unterscheidung zwischen Zugehörigkeit und
Nicht-Zugehörigkeit zum System. Die binären Codes sind die leitende Differenz, an der
sich die Operationen im System orientieren. Nun ist es beim Codier-System bei der
Pflege im Moment nicht möglich, einen binären Code (z. B. pflegefähig/unfähig) zu
erstellen, welcher nicht an die Umwelt oder ein anderes System, wie beispielsweise
der Gefühlsarbeit, gebunden ist (Bauch 2005: 77). Pflege ist also kein eigenes soziales
System, aber gemäss der Systemtheorie im Konstituierungsprozess (Schroeter 2006:
35). Es finden sich Abgrenzungsprobleme hinsichtlich der Medizin und der
Gefühlsarbeit, welche beide Teile anderer Felder sind (Bauch 2005: 79-82). Pflege ist
Seite 16
ein Sub-System des Gesundheitssystems oder ein semi-ausdifferenziertes Feld mit
vielen Schnittmengen zu anderen Feldern (ebd.: 71).
2.1.2 Das Feld der Pflege
Schroeter (2005; 2006) beschreibt die Pflege als „soziales Feld“ (Fuchs-Heinritz und
König 2005: 139-157) in der Tradition von Bourdieu mit Figurationen im Sinne von
Elias (2004). Das soziale Feld der Pflege ist, wie jedes andere Feld, ein Ergebnis der
gesellschaftlichen strukturellen Differenzierung (z. B. Mann und Frau) und funktionalen
Differenzierung (z. B. Arbeitsteilung). Die sozialen Felder dürfen dabei nicht als
räumliche Begrenzungen verstanden werden, sondern sie sind immer relationale
Handlungsfelder mit Strukturen, Verflechtungen und Abhängigkeiten (Schroeter 2006:
35f). Deshalb ist das soziale Feld der Pflege ein figuratives Feld (Schroeter 2005: 86).
Unter Figuration werden die wechselseitige Abhängigkeit und das Machtgefüge der
Akteurinnen und Akteure untereinander in der Gesellschaft verstanden. Diese
Figurationen können sich durch Interdependenzen und gesellschaftliche Entwicklungen
verändern und anpassen (Treibel 2008: 23 und 46). Eine Einschränkung der
Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union würde die
Anzahl der verfügbaren Pflegekräfte massiv reduzieren. Damit würde zwischen den
schweizerischen Pflegekräften und den Alters- und Pflegeheime eine neue Figuration
entstehen. Jedes soziale Feld hat eine eigene Logik und eigene feldspezifische
Spielregeln. Sie sind nicht losgelöst von den anderen sozialen Feldern sondern mit
ihnen verwoben. Dies entspricht einer stärkeren Verbindung als eine Koppelung in der
Systemtheorie. Schroeter (2005: 36) definiert das figurative soziale Feld der Pflege
folgendermassen:
„Mit dem sozialen Feld der Pflege wird ein in sich in differenzierter (und in eine Vielzahl von Subfeldern untergliederter) gesellschaftlicher Teilbereich im Gesundheitssystem mit spezifischen und spezialisierten Akteuren umrissen, der über eigene materielle und soziale Ressourcen verfügt und nach eigenen Regeln und Logiken funktioniert.“
Das Feld der Pflege ist ein Strukturrahmen. Es lässt sich als in konzentrisch
verschachtelten Arrangements von verschiedenen Subfeldern betrachten, wie zum
Beispiel Krankenpflege oder stationäre Alterspflege (Schroeter 2005: 91f). Das
bedeutet, für unsere Betrachtung ist die stationäre Alterspflege ein Subfeld des Feldes
der Pflege. Dieses Subfeld lässt sich in mindestens vier Ebenen unterteilen: In die
personale Ebene, die interpersonale Ebene, die organisatorische Ebene und die
gesellschaftliche Ebene. Zwischen den Ebenen existieren direkte und indirekte
Verwebungen und sie sind in Verbindung miteinander. Damit gibt es immer wieder
komplementär verknüpfte Beziehungen mit differenzierten Machtverteilungen
(Schroeter 2006: 37f.). Ziel- und Interessenskonflikte entstehen regelmässig zwischen
Seite 17
den Ebenen. So gibt es beispielsweise das persönliche Ziel der Pflegekraft, eine
möglichst gute Pflege anzubieten. Das steht dem gesellschaftlich-ökonomischen Ziel
von Kostenersparnissen bei der Pflege entgegen. Es können aber nicht nur zwischen,
sondern auch innerhalb der Ebenen des Feldes konflikthafte Auseinandersetzungen
stattfinden (Schroeter 2005: 94f).
Die verschiedenen sozialen Felder können ebenfalls aufeinander einwirken (Bourdieu
1998). Ein solches Einwirken ist der Einfluss des ökonomischen Feldes auf das Feld
der Pflege und seine Subfelder. Die betroffenen Felder werden dadurch verändert.
Das Feld der Pflege ist neben dem Struktur-, immer auch ein Handlungsrahmen. Die
Handlungen finden entlang der gegebenen Struktur statt (Schroeter 2006: 40).
Innerhalb des Feldes der Pflege entsteht ein spezifisches Pflegekapital, welches
seinen spezifischen Wert nur in seinem Feld entfaltet. Hierzu lohnt sich ein Blick in die
Kapitaltheorie von Bourdieu (1987; Fuchs-Heinritz und König 2005: 157-170). Bourdieu
unterscheidet zwischen ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem
Kapital. Als ökonomisches Kapital versteht er materiellen Besitz und verfügbares
Eigentum, welches in Geld umgewandelt werden kann. Das kulturelle Kapital tritt in
drei Formen in Erscheinung. In der objektiven Form besteht kulturelles Kapital aus
Büchern, Kunstwerken, etc. Das inkorporierte Kulturkapital besteht aus kulturellen
Fähigkeiten, Kenntnissen, Wissen etc. Man verinnerlicht es aufgrund der
gesellschaftlichen Erwartungen, ihrer geschlechtlichen Sozialisation und beim Erlernen
und beim Ausüben des Berufs. Institutionalisiertes kulturelles Kapital besteht aus
Bildungstiteln und Abschlüssen. Das soziale Kapital besteht aus den Möglichkeiten,
andere um Hilfe, Rat oder Informationen zu bitten, sowie die Chance durch
Gruppenzugehörigkeit sich gegen andere Menschen durchzusetzen. Als letztes Kapital
nennt Bourdieu das symbolische Kapital. Dieses besteht aus den Chancen, soziale
Anerkennung und soziales Prestige zu gewinnen. Das symbolische Kapital tritt in der
Regel mit anderen Kapitalsorten gemeinsam auf und macht jene bedeutsam. Im Feld
der Pflege lässt sich als spezifisches kulturelles Kapital pflegerisches Fachwissen von
Pflegekräften oder als ökonomisches Kapital finanzielle Mittel der Arbeitgeber für die
Anstellung von Pflegekräften sehen. Stellung, Macht und Einfluss der Akteurinnen und
Akteure ist von der Akkumulation von Kapitalien abhängig (Bourdieu 1987: 727-755).
Durch die Akkumulation der verschiedenen Kapitalien entsteht das spezifische
Pflegekapital. Daraus ergeben sich neben der Stellung auch die möglichen Handlungs-
und Dispositionsspielräume im Feld. Diese sind wiederum abhängig von den
spezifischen Logiken sowie den Feldregeln und -strukturen (Schroeter 2005: 95-97).
Seite 18
„Zur Konstruktion des figurativen Feldes der Pflege bedarf es jedoch nicht nur der
Bestimmung der wirksamen Formen des spezifischen Kapitals, sondern auch
Kenntnisse der spezifischen Feldlogik“ (Schroeter 2006: 41). Somit ist das soziale
Subfeld der Alterspflege immer ein Deutungsrahmen für die Akteurinnen und Akteure.
Im Feld selbst laufen verschiedene Diskurse zusammen. Die herrschende soziale
Ordnung und Regeln des Feldes werden als Doxa angenommen und als
selbstverständlich hingenommen (Fuchs-Heinritz und König 2005: 201-203).
2.1.3 Macht und Konflikte im Feld der Pflege
Das Konzept der Pflege als figuratives soziales Feld erlaubt die Untersuchung der
verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Wettstreit miteinander. Dabei ringen sie in
einer Figuration um Macht, Hegemonie der Diskurse und Kapitalien (Schroeter 2005:
100).
„[Das Pflegepersonal, A.D.] agiert auf verschiedenen, direkt oder indirekt miteinander verknüpften Feldern (Arbeitswelt, Politik, Rechtssystem, Wissenschafts- und Bildungssystem, Öffentlichkeit), wo es um Anerkennung und Einfluss kämpft, um soziale Rechte und Gerechtigkeit, um Gehör und Mitspracherechte, um materielle und immaterielle Zuwendungen und Einbringungen – um soziale Partizipation.“ (ebd.: 101)
Es zeigt sich, dass die Analyse von Konflikt- und Machtbeziehungen innerhalb der
Pflege und insbesondere der stationären Alterspflege mit Hilfe von Bourdieu und Elias
zu spannenden Ergebnissen führt. Gerade das Pflegepersonal in der stationären
Alterspflege ist Bestandteil von vielen sozialen Konflikten und Machtkämpfen (Amrhein
2005: 107). Als soziale Konflikte werden solche Spannungssituationen verstanden „in
denen zwei oder mehrere Parteien, die voneinander abhängig sind, mit Nachdruck
versuchen, scheinbar oder tatsächlich unvereinbare Handlungspläne zu verwirklichen
und sich dabei ihrer Gegnerschaft bewusst sind“ (Glasl 1994: 14). Als Definition von
Macht wird die Definition Max Webers (1980: 28) verwendet: Macht ist „jede Chance,
innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben
durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ Die Chancen auf Macht im
sozialen Feld der Pflege beruht bei den Akteurinnen und Akteure auf unterschiedlicher
Akkumulation des feldspezifischen Kapitals. Innerhalb eines Alters- und Pflegeheims
kann gemäss Amrhein (2005: 118-121) von einer klaren Machthierarchie zwischen den
drei Akteuren Heimträger, Pflegepersonal und Bewohnenden ausgegangen werden:
Am schlechtesten gestellt sind die Bewohnenden, aufgrund ihrer schlechten
körperlichen und geistigen Verfassung (abnehmendes kulturelles Kapital) und dem
dünner werdenden sozialen Netzwerk (soziales Kapital). Für sie ist ein Heimwechsel
oft nicht mehr möglich. Pflegekräfte haben ein spezifisches Wissen über die zu
verrichtende Pflegearbeit und Ausbildungsabschlüsse, die dies belegen (kulturelles
Kapital). Aber sie sind in der Wahl ihrer Mittel zur Interessensdurchsetzung – wie Streik
Seite 19
– eingeschränkt, da sie moralisch stark an ihre zu Pflegenden gebunden sind
(inkorporiertes kulturelles Kapital) und schlecht gewerkschaftlich organisiert sind
(soziales Kapital). Am besten stehen gemäss Schroeter (2006: 211-214) die
Heimträger da, welche über beträchtliche Spielräume in den organisatorischen
Strukturen verfügen und deren Aktivitäten nur sehr schwach vom Staat kontrolliert
werden. Auch können sie beispielsweise Pflegekräfte entlassen oder die finanziellen
Ressourcen verteilen (ökonomische Macht).
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Betrachtung der Pflege als soziales
figuratives Feld mehr Vorteile bietet, als die Betrachtung als soziales System. Der
Fokus dieser Arbeit liegt bei den Pflegekräften. Die Systemtheorie analysiert keine
Akteurinnen und Akteure, sondern Kommunikation. Hinzu kommt, dass nicht von
einem eigenständigen System der Pflege ausgegangen werden kann. Drei Punkte
sollten aber für weitere Überlegungen von den sozialen Systemen mitgenommen
werden: 1. Die Gesellschaft besteht aus mehreren Bereichen (soziale Systeme oder
Felder), die aufeinander einwirken können. 2. Die Pflege ist nicht unabhängig von
anderen Bereichen wie der Ökonomie oder Gefühlen. 3. Die Koppelung eines
Bereiches mit einem anderen, wie beispielsweise Pflege mit der Wirtschaft, führt zu
Irritationen und zu einer Neuordnung zwecks Stabilisierung. Soziale Felder erlauben
es, diese Gedanken mitzunehmen und zusätzlich eine direkte Betrachtung der
Akteurinnen und Akteure. Innerhalb der Felder streiten die verschiedenen Akteurinnen
und Akteure um Macht und Einfluss innerhalb einer spezifischen Figuration. Jedes Feld
verfügt über seine eigenen Spielregeln und Logiken. Die Akteurinnen und Akteure
verfügen über materielle und soziale Ressourcen. Der Einfluss und die Macht werden
von der Akkumulation des spezifischen Pflegekapitals bestimmt. Dies setzt sich
zusammen aus ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital.
Gerade die Alters- und Pflegeheimbetreibenden zeigen sich als starke Akteure. Am
schwächsten sind die Bewohnenden. Aber auch die Pflegekräfte sind innerhalb des
Feldes den Heimträgern untergeordnet, aber besser positioniert als die Bewohnenden.
2.2 Kapitalistische Landnahme
Um zu verstehen, wie es zu einer Ökonomisierung des Subfeldes der stationären
Alterspflege gekommen ist, muss ein Blick auf die Wirtschaft und die dort
vorherrschende Form, den Kapitalismus, geworfen werden. Dazu werden sowohl der
Kapitalismus als solcher wie auch der Dienstleistungsbereich näher betrachtet. Als
Grundlage dazu dienen die Werke von Theoretikerinnen und Theoretiker aus dem
Bereich der Kapitalismuskritik. In Kapitel 2.2.1 wird erklärt, wie die ursprüngliche
Seite 20
Landnahme des Kapitalismus von statten ging. Diese Betrachtung soll ermöglichen,
Rückschlüsse auf heute zu ziehen. Danach folgt in Kapitel 2.2.2 die Darstellung der
heutigen kapitalistischen Landnahme und einige ihrer Auswirkungen. Schliesslich folgt
in Kapitel 2.2.3 eine Analyse des Neoliberalismus als heute vorherrschender
kapitalistischer Geist und wie sich dieses Denken in der Politik, der Wissenschaft und
der Bevölkerung festsetzt.
Folgende Definition des Systems Kapitalismus wird in dieser Arbeit verwendet: Ein
System, welches „unbegrenzte Kapitalakkumulation durch den Einsatz von formell
friedlichen Mittel“ zum Ziel hat (Boltanski und Chiapello 2006: 39) und die Gesellschaft
und Wirtschaft so organisiert, dass „das 'Streben nach Profit, nach immer erneutem
Profit'“ möglich ist (Weber, zit. nach Swedberg 2009: 88). Die heutige gängige Form
beruht auf Marktwirtschaft mit Privateigentum an Produktionsmitteln (Mankiw und
Taylor 2004: 255). Stetiges Wirtschaftswachstum, höhere Gewinne und neue
Anlagemöglichkeiten sind für die permanente Kapitalakkumulation im Kapitalismus ein
Muss. Dazu brauche es stetig mehr Produktivität, argumentiert Nicholas Gregory
Mankiw (2004: 540f.). Das heisst, eine Person muss bei gleichbleibender oder
besserer Qualität in der gleichen Zeit mehr Güter herstellen oder Dienstleistungen
anbieten, als sie es bisher konnte.
Obwohl gemäss Bornewasser (2014: 1-8) der Dienstleistungsbereich seit Jahren
grösser ist als der industrielle Sektor, hinkt seine Produktivität massiv hinterher. Pro
investierten Franken lässt sich demnach mit industriellen Gütern mehr neuer Ertrag
erzielen als mit Dienstleistungen. Einzige Ausnahme bildet hierbei der Finanzsektor,
doch macht dieser beschäftigungsmässig nur einen kleinen Teil des
Dienstleistungsbereiches aus. Insbesondere der Gesundheitsbereich legte in den
letzten Jahren aber volkswirtschaftlich und personell massiv zu, argumentiert
Bornewasser weiter. Und er wird aus verschiedenen Gründen (technische Entwicklung,
Alterung der Bevölkerung etc.) in den nächsten Jahren noch weiter wachsen.
Der Gesundheitsbereich und somit die stationäre Alterspflege waren lange fernab der
kapitalistischen Profit- und Marktlogik organisiert. Ein Grossteil der Arbeit wurde (und
wird) unbezahlt geleistet oder als staatliche Aufgabe der Bevölkerung angeboten
(Bischoff-Wanner 2014; Bischoff 1992). Kapitalakkumulation, Gewinne und
Kostenoptimierung standen nicht im Vordergrund. In den letzten Jahren jedoch kam es
hier zu Veränderungen: Auch in der Schweiz setzte die Ökonomisierung des
Gesundheitswesens ein. Da grosse Teile der Budgets von der öffentlichen Hand
bezahlt wurden, kam der Impuls zu mehr Wirtschaftlichkeit vom Staat. Privatisierungen,
Seite 21
New Public Management, Rationalisierungen und die Einführung von
betriebswirtschaftlichen Instrumenten und Logiken hielten Einzug (Pelizzari 2001: 21 -
44).
2.2.1 Ausweitung des Kapitalismus – Kapitalistische Landnahme
Die Ausweitung des kapitalistischen Systems auf neue Bereiche oder die
„Herausbildung einer kapitalistischen Produktionsweise in einer nicht-kapitalistischen
Umwelt“ (Dörre 2009: 36) wird kapitalistische Landnahme genannt. Dieses Phänomen
ist nicht neu, es lässt sich seit dem Ursprung des Kapitalismus beobachten. Das
Theorem der kapitalistischen Landnahme beschäftigt sowohl Autorinnen der
Feministischen Ökonomie (vgl. Federici 2012; 2013), wie auch Kapitalismuskritiker
(vgl. Dörre 2014a; 2012, Harvey 2005; 2007), unter anderem im Zusammenhang mit
dem Gesundheitswesen. Die Theorie hat ihre Wurzeln bei Karl Marx (1972) und seiner
Beschreibung der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Marx zeigte auf, wie der
Kapitalismus bei der englischen Gesellschaft ab dem 16. Jahrhundert schrittweise
Einzug hielt. Für die neue Wirtschaftsform brauchte es im doppelten Sinne eine freie
Arbeiterschaft, welche bereit war, in der kapitalistischen Logik zu arbeiten: Die
Arbeiterschaft musste einerseits frei sein von Knechtschaft und anderseits frei von
anderen Produktionsmitteln, also nichts anderes besitzen als ihre Arbeitskraft. Ihnen
blieb somit nichts anderes übrig, als ihre Arbeitskraft an Fabrikbesitzer (Kapitalisten) zu
verkaufen (Kössler 2013: 22-33). Diese Freisetzung der Arbeiterschaft erfolgte durch
Gewalt, Befreiung aus der Knechtschaft, Enteignung und staatlichen Zwang. Die
Verlagerung von gebunden Arbeitskräften auf dem Land hin zu den städtischen
Manufakturen und Fabriken war politisch gewollt und wurde vom Staat durchgesetzt.
Mit der Zeit verinnerlichte die Arbeiterschaft diese Art der Produktion und führte sie
freiwillig, ohne Druck von aussen weiter (Dörre 2014b: 1f). „Im Fortgang der
kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung,
Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als selbst-
verständliche Naturgesetze anerkennt“ (Marx und Engels: 1968: 765f). Durch die
fortlaufende Arbeitsteilung und die Produktion von Gütern für andere und nicht für sich
selbst entfremden sich die Arbeiter von ihrer neuen Tätigkeit. Folgen davon waren
weitere Ausbeutung und die Entmenschlichung der Arbeiter (Oppolzer 1974).
Die Theorie der ursprünglichen Akkumulation wurde von Rosa Luxemburg (1975)
weiterentwickelt. Die ursprüngliche Akkumulation war nicht das Ende der Ausweitung
des Kapitalismus. Vielmehr musste sich der Kapitalismus, um wachsen und somit
weiterbestehen zu können, räumlich immer weiter ausbreiten und nicht-kapitalistische
Seite 22
Bereiche einnehmen. Ausbeutung fand gemäss Luxemburg in äusseren Bereichen wie
Kolonien statt, welche als innere Bereiche im Kapitalismus weiterbestehen und Schritt
für Schritt eingenommen wurden von der kapitalistischen Logik:
„Der Kapitalismus bringt in seinem Innern laufend selber nichtkapitalistische Inseln hervor, die er später an Land nehmen kann, und zwar in Form einer Subsistenzproduktion, die sich gerade wegen der kapitalistischen Produktionsweise laufend erweitert.“ (Feministische AutorInnengruppe 2013: 107)
Unter diesem Gesichtspunkt nutzten verschiedene Feministinnen in den 1980er Jahren
die Theorie Luxemburgs für die Analyse unbezahlter Hausarbeit im kapitalistischen
System. Sie beschreiben dabei die Ausbeutung der Hausfrau als neue Form der
kapitalistischen Landnahme. Prozesse der fortlaufenden kapitalistischen Akkumulation
führen dabei häufig zu Transformationen der Klassen- und Geschlechterverhältnisse
und rufen am Anfang meistens Widerstände der betroffenen Gruppierungen hervor
(Kalmring 2013: 104-107). Federici (2012) ergänzte das Theorem der kapitalistischen
Landnahme um verschiedene feministische Betrachtungsweisen. So sei die neue
Landnahme insbesondere ein weltweiter Angriff auf die soziale Reproduktion, mit dem
Ziel, diese neu zu strukturieren (Federici 2013: 42f). Durch die zunehmende
Lohntätigkeit der Frauen müssen die Reproduktionsarbeiten (z.B. Zubereitung von
Nahrung, Pflege, Kinderbetreuung) neu auf dem Markt eingekauft werden, was den
Boom der Dienstleistungsberufe noch einmal beschleunigte (Federici 2012: 71-86).
2.2.2 Neue kapitalistische Landnahme im 21. Jahrhundert
Dörre (2014a; 2014b; 2013; 2012) und Harvey (2005; 2007) erweiterten diese Theorie
der neuen kapitalistischen Landnahme um ein weiteres Argument. Der Kapitalismus
weite sich noch heute auf nicht-kapitalistische Bereiche innerhalb des heutigen
kapitalistischen Systems, wie die Pflege, das Trinkwasser oder den Wohlfahrtstaat aus.
Zentraler Treiber hinter solchen Landnahmen seien „Kapitalüberschuss-
Absorbationsprobleme“ (Dörre 2014a: 33). Landnahmen geschehen als Reaktion auf
(Wirtschafts-)Krisen, wenn das Wachstum (zusätzliche Kapitalakkumulation) nicht
mehr möglich ist, da das Kapital nicht mehr gewinnbringend genug investiert werden
kann (Dörre 2013: 114-117). „Kapitalistische Entwicklung vollzieht sich als komplexe
Innen-Aussenbewegung. Stets beinhaltet sie die Internalisierung von Externen, die
Okkupation eines nicht oder nicht vollständig kommodifizierten Anderen“ (Dörre 2014a:
30). Bisher nicht verwertetes Land wird kommodifiziert und somit als etwas
Auswärtiges, Nichtkapitalistisches internalisiert und in die kapitalistische
Produktionsform hineingenommen, um die Kapitalakkumulation zu steigern (Dörre
2013: 114). Harvey (2005: 145) argumentiert, dass die heutige Akkumulation vor allem
mit Enteignungen geschehe, zum Beispiel durch Privatisierungen:
Seite 23
„Als heutige Beispiele solcher Landnahmen [...] nennt Harvey: Fusionen, Schuldknechtschaft, Plünderung von Rentenfonds, Biopiraterie, Kommodifizierung der Natur und die Privatisierung öffentlicher Güter wie Trinkwasser, Energie, Kommunikations- und Transportwege, Kollektivland sowie sozialer Einrichtungen.“ (Feministische AutorInnengruppe 2013: 102)
Neues Wachstum beruht demnach auf der Durchsetzung von neuen
Strukturparametern (Dörre 2014: 31). Als Beispiel kann hier der Wandel der Pflege in
verschiedenen europäischen Ländern herangezogen werden. Durch eine neue
Marktorientierung, Privatisierungen und betriebswirtschaftliche Mitteln wie
Zeitrationierung wird die Pflege ökonomisiert und trägt zur Kapitalakkumulation bei
(Aulenbacher et al. 2014). Die neue kapitalistische Landnahme geht einher mit einer
Prekarisierung und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der materiellen
Lage der betroffenen Arbeiterschaft (Harvey 2007: 208-213; Dörre 2014a 33-41).
Massive Flexibilisierungen bei den Arbeitszeiten, tiefe Löhne, kaum Lohnerhöhungen,
Zunahme von atypischen Arbeitszeitverhältnissen und eine schleichende Erosion des
Mittelstandes sind die Folgen (Wahl 2011: 126-158; Dörre 2014b: 8f).
2.2.3 Der neue kapitalistische Geist und die Ökonomisierung des Sozialen
Doch nicht nur in der Produktion und der Arbeitswelt kommt es zu Veränderungen.
Dörre (2013: 120-128) argumentiert weiter, dass die Landnahmen in Europa
finanzkapitalistisch getrieben sind und es zu einer „Ökonomisierung des Sozialen“
kommt. Nur so sei es überhaupt möglich, die nötigen Arbeitskräfte zu finden und den
Umbau des Staates in Angriff zu nehmen. Um dies zu ermöglichen, muss der
„kapitalistische Geist“ (Boltanski und Chiapello 2006) so angepasst werden, dass er mit
dem Finanzmarktkapitalismus, den neuen Landnahmen und dem Akkumulationsregime
übereinstimmt (Dörre 2014a: 31). Allen Menschen, wohnt zur Aufrechterhaltung des
kapitalistischen Systems ein „kapitalistischer Geist“ inne. Dieser Geist ist die
Verinnerlichung von kapitalistischen Normen, Werten und Weltanschauung. Er
ermöglicht, dass das kapitalistische System trotz Ungleichheiten ohne offene Gewalt
aufrechterhalten bleibt. Der Geist des Kapitalismus bezeichnet auch die aktuelle
Ideologie, von welchem der Kapitalismus getragen wird (Boltanski und Chiapello 2006:
42-53). Durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Wirtschaftskrisen
oder Kapitalismuskritik passt sich der kapitalistische Geist soweit an, dass der
Kapitalismus weiterhin erhalten bleibt. Auch passt sich der Kapitalismus diesen
Veränderungen an. Als Gesellschaftsmodell, welches den heutigen Zustand am besten
beschreibt ist, der Neoliberalismus zu nennen (Schranz 2005). Ideologische
Grundlagen des Neoliberalismus sind das ökonomische Nutzenkalkül, der Marktglaube
und das Bild des Homo oeconomicus, also dass sich Menschen stets nutzen-
maximierend verhalten. Der eigentliche Kern bildet damit die Ökonomisierung des
Seite 24
Sozialen, also dass auch im sozialen Bereich ökonomisch gedacht wird (Maiolino
2014: 225-295). Dies geht einher mit dem Übergreifen der neoliberalen Denkweise aus
der Volks- und Betriebswirtschaft in benachbarte Wissenschaftsbereiche (vgl. Burren
2007). Vier Grundzüge stehen der Kapitalakkumulation im Neoliberalismus zu Grunde:
1. Privatisierungen von staatlichen Dienstleistungen und Kommodifizierung, also dem
zur Ware machen von ehemals nicht kapitalistischen Gütern; 2. Wachsende Rolle des
Finanzsektors gegenüber der Realwirtschaft; 3. Krisenmanagement mit dem Zweck,
neoliberale Reformen umzusetzen und 4. Einschränkung der staatlichen Um-
verteilungspolitik und Sozialwerke (Harvey 2007: 198-205).
Bourdieu (1988; 2009) und Wacquant (2009) skizzieren den Neoliberalismus als
politische Idee und beschreiben, wie sich dieser auf andere, nicht-ökonomische
Bereiche und soziale Felder ausbreitet. Die Politik übernimmt die Umsetzung des
neoliberalen Denkens durch Veränderungen des Sozialstaates, Privatisierungen und
Bestrafungen durch das Strafrecht. Das Eindringen des neoliberalen Denkens in die
Gesellschaft und in soziale Felder nennt Bourdieu „Intrusion“ (1998: 112ff.). Dies
geschieht auch beim Feld der Pflege und dem Subfeld der stationären Alterspflege.
Harvey (2007: 52-82) stellt fest, dass anfänglich die Durchsetzung der neoliberalen
Politik in Chile und Argentinien durch Militärputschs geschah. Seither würden formell
friedlichere Massnahmen verwendet werden: Eine Elite von Unternehmern, Medien
und Think Tanks woben die Ideen des Neoliberalismus als „Freiheitversprechen“ in die
politischen Debatten ein. Schritt für Schritt übernahmen, überzeugten und
beeinflussten sie Intellektuelle, Schulen, Universitäten, Medien und Parteien. Sie alle
wirkten mit ihren neoliberalen Ideen in die Gesellschaft hinein, bis ihr Diskurs
hegemonial wurde. Dort, wo Neoliberale die Macht im Staat hatten, nutzten sie diese
zur Durchsetzung ihrer Ideologie und die staatlichen Institutionen zur Inkorporierung
des Neoliberalismus in der Bevölkerung. Die Ökonomisierung durch die kapitalistische
Landnahme und den Neoliberalismus findet als embedded competition in vielen
Bereichen statt und ist nicht ein plötzliches Erscheinen, sondern hält als Prozess
schrittweise Einzug. Dabei nimmt die Ökonomisierung nicht immer dieselbe Form an
(Manzei und Schmiede 2014: 18-24).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den letzten Jahren eine kapitalistische
Landnahme in nicht-kapitalistischen Bereichen wie der stationären Alterspflege
stattgefunden hat. Dabei wirkte der Staat unterstützend und übernahm bei der
Einführung die Aufgabe des Treibers. Dies basiert auf dem kapitalistischen Prozess,
dass neue Anlagefelder zur Kapitalakkumulation erschlossen werden müssen. Dies ist
ein Einwirken des Feldes der Ökonomie auf das Feld der Pflege, was wiederum zu
Seite 25
Irritationen und einer Neuordnung im Feld führt. Für die Umstellung sind daher äussere
Druckmittel nötig, wie beispielsweise eine neue Finanzierungsregelung. Diese
Druckmittel stossen zu Beginn oft auf Widerstand, werden aber über die Zeit von den
betroffenen Personen übernommen und verinnerlicht, bis sie das neue System kritiklos
selber vertreten. Die Landnahme und Ökonomisierung entspricht dem neuen Geist des
Kapitalismus, der die aktuelle Ideologie, von welcher der Kapitalismus getragen wird
entspricht. Im Moment ist dies der Neoliberalismus. Er geht davon aus, dass
profitorientierte marktförmige Lösungen effizienter sind als bisherige, nicht-
kapitalistische Lösungen. Daher führt er für zu Sparmassnahmen, Privatisierungen,
Ökonomisierungen und weniger Einfluss des Staates.
2.3 Care-Ökonomie – Die Logik des Feldes
Jedem sozialen Feld sind seine eigenen Regeln und Logiken inhärent. Deshalb gilt es
zu prüfen, welche Verwertungs- und Produktionslogiken bei der stationären Alters-
pflege zu tragen kommen, wenn die kapitalistische Landnahme erfolgt und der Neo-
liberalismus zum herrschenden Diskurs wird. In diesem Kapitel sollen daher die
ökonomischen und sozialen Eigentümlichkeiten der personenbezogenen Dienst-
leistungen, wie der stationären Alterspflege, mit Hilfe der Care-Ökonomie erläutert
werden. In Kapitel 2.3.1 wird dazu das Grunddilemma, die Kostenfalle der Dienst-
leistungsberufe erläutert. Dieser zeigt auf, dass der Pflege ein anderer ökonomischer
Verwertungs- und Produktionsprozess zu Grunde liegt als der Industrie. In Kapitel 2.3.2
wird beschreiben, was passiert, wenn tayloristische Methoden zur Rationalisierung und
Produktivitätssteigerung aus der industriellen Güterproduktion auf personenbezogene
Dienstleistungen angewendet werden.
Es gibt innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft mehrere Wirtschaftssektoren mit
ihren eigenen ökonomischen und sozialen Regeln (Madörin 2014a: 182f). Deshalb sind
nicht alle wirtschaftlichen Tätigkeiten und sozialen Felder gleich zu analysieren. Es
muss mindestens zwischen der marktwirtschaftlichen industriellen Güterproduktion und
der Anderen Wirtschaft unterschieden werden. Die Andere Wirtschaft wird als
„Produktion und Erhaltung von Menschen“ angesehen und beinhaltet
personenbezogene Dienstleistungen (Donath 2014: 168f). So folgt beispielsweise die
Pflege von betagten Menschen einer eigenen Logik (Folbre 2006: 350-353). Um die
Logik des Subfeldes der stationären Alterspflege zu begreifen, empfiehlt sich daher ein
Blick in die Theorie der Care-Ökonomie, auch Sorgeökonomie genannt. Gemäss Ulrike
Knobloch (2013: 10f) untersucht die Care-Ökonomie:
Seite 26
„[...] in welchem Umfang Sorgearbeit in einer Gesellschaft geleistet wird, wie die Bereitstellung [...] individuell und gesellschaftlich organisiert ist, wer konkret Sorgearbeit leistet [...] und untersucht das Angebot und die Nachfrage nach Sorgearbeit ebenso wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen Sorgeleistungen erbracht werden.“
Im Folgenden wird Care-Arbeit synonym zu Sorgearbeit verwendet. Als Care-Arbeit
werden sämtliche bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten und alltäglichen Aufgaben
betrachtet, welche sich um die Gesundheit, Betreuung und das Wohlbefinden von
Menschen drehen und von den Empfängerinnen und Empfängern nicht alleine für sich
selbst erbracht werden können (Wolkowitz 2006: 148). Diese Care-Arbeit wird immer in
einem gesellschaftlichen und politischen Rahmen, einem so genannten Care-Regime,
erbracht, welches dynamisch ist und sich verändert (Knobloch 2013: 12). Dieses Care-
Regime verändert sich nun aufgrund der kapitalistischen Landnahme. Und damit
ändern sich auch die Verhältnisse für die Pflegekräfte.
2.3.1 Kostenkrankheit der personenbezogenen Dienstleistungen
Nun machen gemäss Susan Donath (2014: 168) viele Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler den Fehler, das ökonomische Standardmodell auch auf die Care-
Arbeit ausdehnen zu wollen. Dabei übersehen sie die Eigenheiten der Care-Arbeit und
kommen zu inadäquaten Schlussfolgerungen. Gegenwärtig findet gemäss Madörin
(2013: 136f) eine massive Taylorisierung der Arbeitsprozesse und entsprechend eine
zunehmende Arbeitsteilung im Bereich der Care-Arbeit statt: „Zweck dieser
Arbeitsteilung ist, dass dadurch eine Lohnhierarchie eingeführt werden kann, und wie
in der Industrie die Arbeitsabläufe standardisiert und damit kontrolliert werden können.“
Im Taylorismus werden gemäss Rabinbach (2001: 277-283) die Industrieunternehmen
rationalisiert, um die Produktivität zu erhöhen. Dies geschieht durch die Aufteilung der
Güterproduktion in einzelne Arbeitsschritte. Diese werden standardisiert, kontrolliert,
möglichst effizient gestaltet und auf die verschiedenen Beschäftigten verteilt, wenn
möglich durch Maschinen übernommen und neu angeordnet. Die
Industriearbeiterschaft wurde, so Rabinbach weiter, an den gewonnen Mehrerträgen
durch die Produktivität beteiligt (höherer Lohn und mehr Freizeit). Gleichzeitig wurden
die Güter durch die Rationalisierungen günstiger und konnten von einer breiteren
Masse konsumiert werden.
Dass nun die gleichen Rationalisierungsmethoden in der stationären Alterspflege
automatisch zu einem grösseren Angebot an Pflegedienstleistungen und zur Erhöhung
des Lebensstandards für die Beschäftigten der Branche führen werden, scheint fraglich
(Madörin 2013: 136). Eine Care-Tätigkeit, oder generell personenbezogene Dienst-
leistung wie die stationäre Altenpflege, unterscheiden sich in vielen Punkten
(Personenbezogenheit, Abhängigkeit, Angewiesenheit, Asymmetrie und Zeitbedarf)
Seite 27
von der klassischen Güterproduktion der Industrie (Knobloch 2013: 13). Die Pflege
folgt deshalb einem anderen Verwertungs- und Produktionsprozess, als dies bei der
industriellen Güterproduktion der Fall ist (Madörin 2013: 129). Donath (2014: 170) geht
davon aus, dass eines der wesentlichen Merkmale der Care-Arbeit und damit der
Pflege ist, „dass nur wenig oder kein Produktivitätszuwachs möglich ist.“ Dieses
Phänomen wird von den Ökonomen William Baumol und Alan Blinder (1985: 546) als
Kostenkrankheit bezeichnet. Sie beschreiben das Phänomen wie folgt:
„Weil Produktivitätssteigerungen für die meisten Dienstleistungen sehr schwierig sind, ist zu erwarten, dass ihre Kosten jahrein, jahraus schneller steigen als die Kosten von Industriegütern. Über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten kann sich dieser Unterschied in der Wachstumsrate aufsummieren, so dass Dienstleistungen im Vergleich mit Industriegütern enorm teurer werden.“
Dieser Logik folgend, ist ein Auseinanderdriften der Produktivität zwischen den
personenbezogenen Dienstleistungen und der industriellen Güterproduktion zu
erwarten (Madörin 2011: 142).
Im Gegensatz zur Subjekt-Objekt-Beziehung in der Güterproduktion setzt die Pflege
eine zwischenmenschliche Beziehung, also eine Subjekt-Subjekt-Beziehung, voraus.
In jeder solchen Beziehung sind die Beziehungskompetenz, die Kommunikation, aber
auch die gegenseitigen Gefühle und Emotionen bedeutungsvoll (Madörin 2007: 154).
Die Arbeit kann nur persönlich von Individuen erbracht und nicht durch Maschinen
ersetzt werden. Dadurch ist bezahlte Pflegearbeit immer ortsgebunden, auf Menschen
angewiesen, mit einem hohen Arbeitsaufwand und Lohnkosten verbunden
(Feministische AutorInnengruppe 2013: 108 und Donath 2014: 172). Des Weiteren ist
die Reaktion eines Subjektes auf einen Input nicht immer dieselbe, wie es bei der
Produktion eines Gutes der Fall ist. Ein Mensch kann nicht in dem Masse
vereinheitlicht und normiert werden wie ein Industrieprodukt. So schwankt der
tatsächliche Pflegebedarf sehr stark und entzieht sich der vollständigen Kontrolle und
der Standardisierbarkeit. Schliesslich gilt es zu bedenken, dass durch die Pflege von
Menschen kein neues Produkt entsteht, welches in die Warenzirkulation übergeht. Die
Arbeit manifestiert sich vielmehr im Körper des gepflegten Menschen und in seinem
Wohlergehen (Madörin 2013: 134-143). Die Qualität der Pflege lässt sich deshalb auch
nicht einfach messen. Sie ist im höchsten Masse personen- und kontextabhängig
(Folbre 2006: 352).
2.3.2 Auswirkungen der Taylorisierung auf die Pflege
Produktivitätsgewinne lassen sich in der stationären Alterspflege durch
Standardisierung, Rationalisierung und Prekarisierung erzielen (Feministische Autor-
Innengruppe: 2013 110f). Es wird versucht, die Behandlungen als standardisierte Vor-
Seite 28
gehensweise im Sinne einer möglichst erfolgreichen und günstigen Methode
durchzuführen und mit einem Zeitbudget zu versehen (Madörin 2007: 159). Für den
Toilettengang werden beispielsweise 15 Minuten festgelegt, für das Anziehen von
Stützstrümpfen neun Minuten oder für komplizierte Verbände 20 Minuten. Diese
verrechenbare Zeit ist dann die produktive Zeit, der Rest wird als nicht-produktiv und
damit nicht-verrechenbar kategorisiert (Baumann und Ringger 2013: 140f). Damit wird
die Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Pflegekraft und zu Pflegenden objektiviert
und es findet eine neue Art der Entfremdung statt (ebd.: 154). Der nicht
standardisierbare und nicht messbare Teil der Care-Arbeit, die Betreuung, die
Gefühlsarbeit und das Zwischenmenschliche, werden schrittweise wegrationalisiert und
finden im Alltag der Pflegekräfte immer weniger Platz (Greuter 2015). Pflege, wie sie
die Pflegekräfte verstehen, ist kaum noch möglich (Greuter 2013: 150). Wichtige
Fähigkeiten und Tätigkeiten, welche die Kompetenzen und den Reiz des Berufes
ausmachen, werden so Schritt für Schritt abgeschafft (Madörin 2013: 140). Auch
werden dadurch falsche Anreize gesetzt. So ist es für ein Alters- und Pflegeheim unter
Umständen finanziell besser, wenn Bewohnende, die nicht mehr autonom aufstehen
und gehen können und deshalb das Zeitbudget der einzelnen Pflegekräfte sprengen,
im Rollstuhl transportiert werden (Durtschi et al. 2015: 2). Die verstärkten Kontrollen
der Krankenkassen führen zu einem administrativem Mehraufwand, welche dem
Pflegepersonal Zeit für die Pflegearbeit entzieht und zusätzliche Kosten verursachen
(Baumann und Ringger 2013: 147f). Die Hierarchisierung und Unterschichtung durch
günstigere und schlechter ausgebildete Personen, Stellenabbau und zu wenig Zeit für
gute Pflege durch knappe Zeitbudgets und Kostenvorgaben gehören mit der
Taylorisierung zum Alltag (Feministische AutorInnengruppe 2013: 112f). Es scheint
also in der Pflege nicht möglich, bei gleichbleibenden Arbeitsbedingungen einen
Gewinn zu erzielen, ohne dass sich der Charakter der Pflege oder die Qualität ändert
(Haller und Chorus 2013: 68).
Ein weiteres, spezifisches Problem der Care-Arbeit liegt in der Finanzierbarkeit. Dies
wird auch in der Pflege sichtbar. Bei einer totalen privatwirtschaftlichen und rein
marktförmigen Organisation der der stationären Alterspflege würde die hohen Kosten
einem grossen Teil der Bevölkerung den Zugang zu professioneller Pflege
verunmöglichen (Winker 2013: 125). Dies führt dazu, dass es staatliche Regulierungen
und Umverteilungen braucht, damit sich nicht nur einkommensstarke Personen
Alterspflege leisten können (Haller und Chorus 2013: 68). Hohe Profite sind dort zu
erwarten, wo Pflegedienstleistungen als Fliessbandarbeit professionell abgewickelt
Seite 29
werden können oder ein gut betuchtes Feld von Bewohnerinnen oder Bewohnern
angesprochen wird, welches bereit ist mehr zu bezahlen (Winker 2013: 124f).
Es konnte gezeigt werden, dass das Feld der Pflege nicht derselben Logik wie die
bisherige industrielle Güterproduktion folgt. Bei den personenbezogenen Dienst-
leistungen, wie eben der Pflege, kann die Produktivität nicht im gleichen Masse erhöht
werden wie bei den industriellen Gütern. Dadurch steckt die Pflege in einer Kostenfalle.
Trotzdem werden tayloristische Methoden zur Produktivitätssteigerung und
Kostensenkung eingesetzt. Die Pflege wird in einzelne Arbeitsschritte zerlegt und für
diese Arbeitsschritte Zeitbudgets aufgestellt. Wichtige Teile der Pflege und Betreuung
geht dabei verloren. Durch die kapitalistische Verwertungs- und Produktionslogik des
Feldes der Pflege, führt nun die Taylorisierung, also das Zerstückeln der
Arbeitsschritte, entweder zu Qualitätsverlust für die Bewohnerinnen und Bewohner
und/oder schlechteren Bedingungen für das Personal. Dies steht im Gegensatz zur
Taylorisierung bei der Industrie, welche zu mehr, günstigeren und besseren Produkten
und besseren Bedingungen für das Personal geführt hat.
2.4 Berufssoziologie und Ethos der Pflegekräfte
Dieses Kapitel beschäftigt sich in einem ersten Schritt berufs- und arbeitssoziologisch
mit den Pflegekräften, ihrem Beruf und der Ökonomisierung. Es beginnt mit einer
historischen Betrachtung, wie sich der Beruf der (Alten-)Pflegekräfte entwickelte. In
Kapitel 2.4.1 wird die weitere Entwicklung des Berufes Richtung Profession erläutert.
Dem folgt in Kapitel 2.4.2 eine Darstellung des entstanden Berufsethos der
Pflegekräfte und die Motivation und Gründe für die Berufswahl. Danach wird in Kapitel
2.4.3 die Emotions- und Gefühlsarbeit in der Altenpflege behandelt sowie die
Problematik, dass diese wegen der Ökonomisierung weniger Beachtung findet.
Schliesslich wird in Kapitel 2.4.4 ein Blick auf die Arbeitsbedingungen, Probleme und
Herausforderungen der Pflegekräfte geworfen, insbesondere auf jene, die von der
Ökonomisierung betroffen sind.
Die Konstruktion und der Zuschnitt von Berufen ist ein andauernder und dynamischer
Prozess. Dieser Prozess ist abhängig von der jeweiligen gesellschaftlich-historischen
Situation und der Interessensdurchsetzung von verschiedenen Interessensgruppen
(Voges 2002: 13). Der Beruf der professionellen und damit bezahlten Pflegekräfte in
der stationären Altenpflege ist noch jung. Das Berufsbild entstand aus der Lücke in der
beruflichen Versorgung (Winter 2005: 280). Wenn in der Berufssoziologie von Alten-
pflege, zu welcher auch die stationäre Alterspflege gehört, gesprochen wird, dient
folgende Definition von Voges (2002: 23) als Grundlage:
Seite 30
„Berufliche Altenpflege umfasst zunächst alle unmittelbar personenbezogenen Dienstleistungen zur Versorgung Älterer und Hochbetagter. Wenn [...] von Pflegearbeit gesprochen wird, handelt es dabei zunächst um `körpernahe` Arbeitstätigkeiten, die sich gleichermassen auf die physischen, psychischen, sozialen und mentalen Aspekte der Betreuung und Versorgung Pflegebedürftiger beziehen. [...] Pflege in diesem Sinne bezieht sich somit grundsätzlich sowohl auf medizinisch-pflegerische als auch sozial-pflegerische Arbeitsanteile.“
Ursprünglich wurde die Pflegearbeit primär von Familienangehörigen wahrgenommen
und sekundär von Ordensschwestern, welche diese Arbeit als göttliche Aufgabe sahen.
Es lassen sich im deutschsprachigen Raum drei teilweise parallel verlaufende
Entwicklungen zur Professionalisierung des Pflegeberufes feststellen. Die erste Linie
folgt der industriellen Entwicklung resp. der „Sozialen Frage“ im 19. Jahrhundert. Das
Bevölkerungswachstum erreichte eine neue Höchstquote und Arbeitersiedlungen
entstanden. Parallel dazu kam es zu einer Verelendung eines Teils der Arbeiterschaft
in den Städten. Zudem entstanden, um eine schnellstmögliche Genesung der Arbeits-
kräfte zu gewährleisten, die ersten Krankenhäuser. Ein erhöhter Bedarf an Personen,
welche die Pflege übernehmen konnten, war die Folge. Als zweite Linie lässt sich die
medizinische Entwicklung im 19. Jahrhundert nennen. Zur Unterstützung der Ärzte
brauchte es mehr qualitativ gut gebildetes und speziell geschultes Personal. Die dritte
Linie besteht im bürgerlichen Frauenbild des 19. Jahrhunderts: Personenorientierte
Fähigkeiten und Eigenschaften galten als typisch weiblich und die Pflege daher als
idealen Frauenberuf (Bischoff-Wanner 2014: 20-26).
Die Pflege wuchs im 20. Jahrhundert weiter zu einem Beruf mit einem eigenständigen
Anforderungsprofil, eigener Fachlichkeit und einer materiellen Vergütung (Witterstätter
1996: 89f). In der Schweiz etablierte sich im Gesundheitswesen ein familienbasiert-
subsidiäres System. Das heisst, in der Pflege blieb die Familie der zentrale Ort und
öffentliche Dienstleistungen kamen nur subsidiär zum Einsatz (Heintze 2015: 6). Die
Fachlichkeit, also die Berufsinhalte der Pflegearbeit, war lange beschränkt auf
unterstützende Tätigkeiten für die Ärzte. Trotz diesen ersten Schritten der
Verberuflichung, war es noch immer nicht zu einer Professionalisierung gekommen.
2.4.1 Verberuflichung und Professionalisierung
Die einzelnen Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen begannen sich zu
spezialisieren, Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Psychiatrien usw. entstanden.
Dem entlang veränderten sich ebenfalls der Beruf und die Qualifikationen der
Pflegekräfte. Durch steigendes Arbeitsaufkommen, technologische Entwicklungen und
neuen Arbeitsinhalten wird der Beruf immer komplexer und muss neu zugeschnitten
werden. Der Beruf Pflegekraft blieb ein weiblicher Beruf, die grosse Mehrheit der
Beschäftigten sind bis heute Frauen (Barben und Ryter 2015: 3) Immer noch gilt der
Beruf Pflegekraft als komplementärer Part zur männerdominerten und als
Seite 31
naturwissenschaftlich geltenden Medizin (Voges 2002: 30f). Er ist wie viele
Frauenberufe im Verhältnis zum Anspruchsniveau und der tatsächlichen Bedeutung
gesellschaftlich eher tief bewertet (ebd. 55). Durch eine Professionalisierung soll dies
verbessert werden. Ebenfalls wird angestrebt, Pflege als wissenschaftliche Disziplin im
tertiären Bereich des Bildungssystems (Universitäten, Fachhochschulen) zu verankern
(ebd. 138). Dies kann in der Schweiz an den verschiedenen neuen Studiengängen an
den Hochschulen und den Ausbildungen an Höheren Fachschulen beobachtet werden
(Ludwig und Schäfer 2011: 30-34). Die wissenschaftliche Handlungsweise fernab von
reinem Erfahrungswissen wird für die Pflegewissenschaften heute im Evidence-based
Nursing erforscht (Behrens 2014). Auch entstanden mit den verschiedenen,
anspruchsvoller werdenden Berufsbildern verschiedene Stufen in der Pflege. Auch aus
wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und des Staates kam so schrittweise eine
Arbeitsteilung innerhalb des Pflegeberufes (Voges 2002: 27-29). Ein Beispiel dafür ist
die Unterteilung der stationären Alterspflege in drei Ausbildungs- und Funktionsebenen
in der Schweiz (siehe dazu Kapitel 3.2; Ludwig und Schäfer 2011: 30-32). Teilweise
wird die Arbeitsteilung in den Betrieben zwecks Kostenoptimierung der Arbeitseinsätze
stark ausdifferenziert. So ist beispielsweise eine Mitarbeiterin A zuständig für die
Spritzen, Mitarbeiterin B für Verbände, Mitarbeiterin C für das Waschen, Mitarbeiterin D
für das Aufnehmen und Mitarbeiterin E für die Aktivierung (Feministische
AutorInnengruppe 2013: 113). Medizinaltechnische Handlungen werden hierbei von
diplomierten Pflegekräften erledigt, während betreuende Tätigkeiten von schlechter
bezahlten und nur angelernten Personen ausgeführt werden.
2.4.2 We Care – Berufsethos und Berufswahl der Pflegekräfte
Parallel zum eigenständigen Beruf entwickelte sich das Berufsethos, welches auch als
Teil des spezifischen (inkorporierten) kulturellen Kapitals der Pflegekräfte angesehen
werden kann. Die wichtigsten internationalen ethischen Prinzipien der Pflege lassen
sich in vier Punkten zusammenfassen: Der erste sagt aus, dass die Autonomie und
Selbstbestimmung der Pflegeempfangenden immer zu respektieren und zu
berücksichtigen ist. Punkt zwei beinhaltet, dass eine Pflegekraft keinen Schaden
zufügen darf. Punkt drei ist das Prinzip, dass den Pflegeempfangenden Gutes getan
werden soll mit der Pflegearbeit. Der vierte und letzte Punkt dreht sich generell um die
Gerechtigkeit im Handeln der Pflegekräfte, zu welchem sie verpflichtet sind
(Beauchamp und Childress 2009). Im Mittelpunkt der Ethik steht somit das
Wohlbefinden der zu Pflegenden. Leitvorstellung ist, dass die Pflegenden vor allem für
die Pflegeempfangenden und nicht für sich selbst da sind. Der Beruf wird oft aus dem
Wunsch gewählt, mit anderen Menschen zu arbeiten und ihnen helfen zu wollen
Seite 32
(Dunkel 2005: 227-233). Der eigene Anspruch ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner
in Pflegeheimen sich wohl fühlen. Dieses Wohlergehen ist direkt mit dem Wohlbefinden
der Pflegekräfte verbunden (Koch-Straube 2003: 133-139). Eine gute Beziehung zu
Patientinnen und Patienten wurde im Sommer 2002 in einer Erhebung der Universität
Nürnberg-Erlangen von 96 % der befragten Pflegekräften von ambulanten Diensten als
wichtiger Einzelaspekt der Tätigkeit bewertet und wurde als zentraler Einflussfaktor für
die Arbeitszufriedenheit ermittelt. Diese beziehungsorientierte Grundhaltung der
Pflegekräfte rückt die Pflegeempfangenden in den Mittelpunkt des beruflichen
Selbstverständnisses (Blüher und Stosberg 2005: 183f). Wer den Beruf in der Pflege
nicht als Berufung sieht, sondern als einfache Tätigkeit in der Arbeitswelt, dem wird
eine berufsfeindliche Betrachtung vorgeworfen (Voges 2002: 23). Die von den
Ordensschwestern vorgelebte Selbstaufopferung haben auch die heutigen Pflegekräfte
tief verinnerlicht (Bischoff-Wanner 2014: 30).
Doch wieso wählen Menschen diesen Beruf, der immer noch Selbstaufopferung be-
inhaltet? Eine Möglichkeit bietet die Betrachtung nach intrinsischen (Arbeitsinhalte) und
extrinsischen (ökonomischen) Motiven. Gerade die intrinsischen, immateriellen Motive
lassen sich bei der Wahl des Berufes in der Pflege häufig finden. Beim Arbeitsinhalt im
Mittelpunkt stehen die soziale Anerkennung und Würdigung, die Nächstenliebe, Pflicht-
bewusstsein gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Wunsch, an-
deren Menschen zu helfen. Ökonomische Motive zählen, unter anderem wegen den zu
erwartenden relativ tiefen Einkommen, nicht zu den Hauptmotiven. Daneben können
die Motive auch in Push- und Pull-Faktoren unterteilt werden. Ein wichtiger Push-
Faktor ist beispielsweise die tiefe Eintrittsschwelle für diesen Beruf. Ein wichtiger Pull-
Faktor ist die Attraktivität von personenbezogenen Arbeiten (Voges 2002: 149-157).
Doch genau dieser wichtige Pull-Faktor, also die Arbeit mit den Menschen, gerät
zunehmend unter Druck.
2.4.3 Pflegekräfte und Bewohnende: Emotions- und Gefühlsarbeit
Unter der knapp bemessen Zeiten für die Pflege und der dadurch erzwungenen
Arbeitsteilung leiden am meisten die „psychosozialen Anteile“, die Emotions-, Gefühls-
und Beziehungsarbeit, welche faktisch wegrationalisiert werden (Greuter 2013: 149-
151). Da Emotionen und Gefühle nicht gemessen und standardisiert werden können,
kommen sie in den wirtschaftlichen Überlegungen und der Pflegefinanzierung gar nicht
vor. Dabei erfordert eine gute und ganzheitliche Pflegearbeit immer Empathie und eine
direkte Verbundenheit zu den Bewohnerinnen und Bewohnern und lässt sich nicht
wegrationalisieren (Bauch 2005: 81). Eine so zu leistende Pflege entfernt sich immer
Seite 33
stärker vom Idealbild einer guten Pflege, denn ohne genug Zeit für die Bewohnenden
muss bei den weichen Faktoren, der Emotions-, Gefühls- und Beziehungsarbeit ge-
spart werden (Unger 2014: 312). Sowohl Emotions-, wie auch Gefühl- und Beziehungs-
arbeit gehören aber zum Arbeitsalltag der Pflegekräfte. Emotionsarbeit beschreibt da-
bei die Beeinflussung der eigenen Gefühle und die Gefühlsarbeit die des Gegenübers
(ebd.: 301). Entscheidend dabei ist die Beziehung zwischen zu Pflegenden und der
Pflegeperson sowie die gegenseitige Empathie:
„Empathie spielt [...] in der Pflegeperson-Patient-Beziehung eine wichtige Rolle, denn nicht nur erwarten Patienten eine einfühlsame Pflege und Einfühlungsvermögen von Pflegenden, Empathie ist auch eine Voraussetzung von Gefühlsarbeit und vermittelt Nähe zum und Erkenntnisse über den Patienten“ (Bischoff-Wanner 2002: 97).
Das Sparen bei der Emotions- und Gefühlsarbeit und damit bei der Pflegeperson-
Bewohnenden-Beziehung hat auf mehreren Ebenen negative Auswirkungen. Weniger
Zeit bedeutet für die Pflegekräfte, dass sie weniger gut wissen, wie es den ihnen
anvertrauten Personen geht und was deren Bedürfnisse sind (Madörin 2013: 137).
Gute Emotions- und Gefühlsarbeit verringert gemäss verschiedenen Studien die Heil-
dauer bei Erkrankungen und Operationen und hat grundsätzlich einen positiven Ein-
fluss auf die zu Pflegenden (Unger 2014: 309; Greuter 2015: 17). Damit stellt sich die
Frage, ob das Sparen hier nicht zu höheren Folgekosten führt. Auch auf die Pflege-
kräfte selbst hat es Einfluss. Sie sind in einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaft-
lichkeit und Emotionalität. Die Beziehung sowie die Emotions- und Gefühlsarbeit mit
den Bewohnerinnen und Bewohner, ist ein entscheidender Faktor in ihrem Beruf und
kann zunehmend nur noch unter Stress und mit einem schlechten Gewissen erbracht
werden. Gleichzeitig bleiben beim Fehlen der Beziehungs-, Emotions- und Gefühls-
arbeit die positiven emotionalen und immateriellen Entschädigungen der Bewohnenden
gegenüber den Pflegekräften, also dankbare Worte und Gesten, aus (Unger 2014:
310). Bei der Emotionsarbeit wird des Weiteren zwischen Oberflächenhandeln
(Gefühlsausdruck gegenüber zu Pflegenden, unabhängig von den eigenen Gefühlen)
und Tiefenhandeln (das Zeigen der eigenen Gefühle) unterschieden. Gerade die Dis-
sonanz zwischen erlebten und dargestellten Gefühlen beim Oberflächenhandeln kann
unter anderem zu Burnouts1 führen (Nerdinger 2012: 17).
1 „Burnout ist eine arbeitsassoziierte Stressreaktion, die zu einem anhaltenden negativem Gefühlszustand
bei normalen Individuen führt. Primär ist Burnout charakterisiert durch Erschöpfung, die begleitet ist von chronischem Stress, reduzierter Effizienz und Motivation und der Entwicklung von gestörter Einstellung und Verhalten am Arbeitsplatz“ (Albrecht 2015: 8).
Seite 34
2.4.4 Arbeitsbedingungen – Personalmangel, Stress und Beeinträchtigungen
Verschiedene Autorinnen und Autoren zeigen, dass die Pflegearbeit mit gesund-
heitlichen Risiken verbunden ist. Die grösste körperliche Belastung liegt beim Heben
und Tragen von älteren Menschen. Gerade die Erkrankung der Lendenwirbelsäule
zählt zu den typischen Berufskrankheiten. Bis zu 87 % der Pflegekräfte leiden gemäss
der Freiburger Wirbelsäulenstudie unter Rückenschmerzen (Hofmann et al. 1998). Die
Krankheitstage generell und die Krankheitstage wegen Rückenproblemen im spezi-
fischen sind massiv höher als in den anderen Berufen (Grabbe et al. 2005: 123). Das
Risiko für Bandscheibenvorfälle liegt über demjenigen von Bau- und Industriearbeitern
(Hofmann et al. 1998).
Schliesslich gibt es gemäss Martina Michaelis (2005 263-269) eine grosse psychische
Belastung im Arbeitsalltag der Pflegekräfte. Dazu gehören Stress durch Zeitknappheit,
ständig wechselnde Arbeitsanforderungen, Enttäuschung über fehlende Anerkennung
und schlechte Arbeitsorganisation. Als belastend werden gemäss Michaelis ausserdem
der Anstieg der Überstunden, Wochenend- und Abendarbeit sowie eine zunehmende
Unvereinbarkeit von Privat- und Berufsleben wahrgenommen.
Die Ökonomisierung der Pflege führt gemäss Blüher und Stosberg (2005: 184f) zu
einem Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis (Ethos) und den vorgegebenen
Anforderungen, welche sie als „Dichotomie Markt oder Menschlichkeit“ beschreiben.
Gerade Berufsneueinsteigende können gemäss Wolfgang Dunkel (2005: 233f) nicht so
pflegen, wie sie es gelernt haben und es möchten. Dies hat Konsequenzen: Am
Anfang versuchen die Pflegekräfte diese Diskrepanz durch grosses Engagement
wegzumachen. Falls die verbundenen Pflegeziele dadurch nicht erreicht werden und
die Anerkennung ausbleibt, ist zunehmende Erschöpfung und Desillusionierung die
Folge, so Dunkel weiter. Hinzu kommt, dass die stationäre Alterspflege einen beson-
deren Arbeitsstil verlangt. Mit ihrem persönlichen Einsatz versuchen einige Pflege-
kräfte, die Lücke zwischen der Arbeitsanforderung und dem Arbeitskrafteinsatz zu
schliessen. Damit sollen die strukturellen Mängel (Zeitmangel, Personalmangel)
aufgefangen werden (Voges 2002: 174f). Auf ihnen lastet ein persönlicher und gesell-
schaftlicher Druck, die Situation zu verbessern (Koch-Straube 2005: 222).
Gemäss Voges (2002: 165) finden sich die persönlichen ethischen Hauptprobleme der
Pflegenden im Arbeitsalltag und nicht in Krisensituationen. Sie stehen oft vor dem
Dilemma, eine Pflegeaufgabe nur zu Lasten einer anderen erfüllen zu können oder
eben nicht. Mit diesem Problem sind sie jeden Tag konfrontiert, bei jedem
Bewohnenden. Ihnen fehlt die Zeit, sich ausreichend und so, wie sie es sich wünschen,
Seite 35
um ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu kümmern. Viele Pflegekräfte geben dies
auch als einen der Hauptgründe für das Verlassen ihres Berufes an (Dunkel 2005:
233f). Eine Studie von 1998 und 1999 unter mehreren tausend Pflegekräften aus
Krankenhäusern, deren Patientinnen und Patienten und 168 Krankenhäusern hat
ergeben, dass eine Senkung des Personalbestandes negative Auswirkungen für das
Personal und die Patientinnen und Patienten hat. Weniger Personal führt zu einer
höheren Mortalität der Patientinnen und Patienten nach der Behandlung und einer
höheren Burnout-Wahrscheinlichkeit und Jobunzufriedenheit bei den Pflegekräften
(Aiken et al. 2002). International vergleichende Studien haben die gleichen
Zusammenhänge ergeben (vgl. Schwendimann et al. 2014).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der Beruf der Pflegekraft im steten
Wandel befindet. Im Feld der Pflege herrscht ein Konkurrenzkampf zwischen den
verschiedenen Interessensgruppen, welche alle bei der Ausgestaltung des Berufes
Einfluss nehmen oder nehmen möchten. Ursprünglich waren die Pflegekräfte
Ordensschwestern, fernab der Lohnarbeit, welche ihre Berufung als göttliche Aufgabe
wahrnahmen und voller Hingabe und Selbstaufopferung erfüllen. Bei der
professionellen beruflichen stationären Alterspflege steht aus Sicht des Personals nach
wie vor das Wohl der gepflegten Bewohnerinnen und Bewohner über allem anderen,
was den wichtigsten Teil des Berufsethos ausmacht (inkorporiertes kulturelles Kapital).
Helfen wollen und Selbstaufopferung gehören bis heute zu diesem Berufsethos. Dies
steht im Gegensatz zur kapitalistischen Landnahme und der stattfindenden
Taylorisierung. Diese führt zu mehr Stress für das Pflegepersonal, da sie nicht mehr
genug Zeit für eine ihren Erwartungen entsprechende Pflegeleistung haben. Die für die
Pflegearbeit wichtige Emotions-, Gefühls- und Beziehungsarbeit mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern wird wegrationalisiert. So verliert der Beruf einen
wichtigen Teil seines Reizes. Gleichzeitig ist eine immer stärkere Arbeitsteilung
feststellbar. Die Pflegekräfte befinden sich in einem Spannungsverhältnis zwischen
guter Pflege (Berufsethos) und der Wirtschaftlichkeit im Sinne des Neoliberalismus und
dem daraus folgendem Taylorismus.
Seite 36
3. Stationäre Alterspflege und ihre Finanzierung in der
Schweiz
Die stationäre Alterspflege in der Schweiz ist ein grosser und komplexer Bereich, mit
vielen Bewohnenden, Pflegekräften und einem eigenen Finanzierungssystem. Nur
wenn wir dieses komplexe System mitbeachten und kennen, ist eine Beantwortung der
Fragestellung in Kombination mit den bisher vorgestellten Theorien möglich. In diesem
Kapitel soll deshalb ein Überblick über den Status-Quo, wichtige Kennzahlen und das
System der professionellen stationären Alterspflege in der Schweiz präsentiert werden.
Davon ausgehend folgt eine Einführung in das Finanzierungssystem für die Alters- und
Pflegeheime (Kapitel 3.1). Dem folgt ein Bericht über die aktuelle Lage, Zufriedenheit
und Probleme des Personals in der stationären Alterspflege in der Schweiz (3.2). Die
Ökonomisierung dieses Bereiches und den ersten Folgen davon, wie z.B. das knappe
Zeitbudget der Pflegekräfte, werden im darauffolgenden Kapitel präsentiert (3.3).
Die meisten Menschen würden gerne bis an das Ende ihres Lebens selbstbestimmt in
ihren eigenen vier Wänden wohnen (Höpflinger 2004: 9-13). Nur für eine Minderheit
der betagten Menschen kommt ein freiwilliger Umzug in ein Alters- oder Pflegeheim in
Frage. Dies wird erst dann Thema, wenn sie mit familiärer und/oder ambulanter Pflege
nicht mehr selbständig zu Hause leben können, sei es beispielsweise aus
gesundheitlichen Gründen oder Angst vor sozialer Vereinsamung (Sowinski und
Ivanova 2014: 531; Strohmeier 2012: 76f). In ihrem neuen und oft letzten Zuhause
werden sie und andere Menschen in der gleichen Lage bis zu ihrem Tod professionell
gepflegt. Professionelle Pflege bedeutet in der Schweiz:
„[...] die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften sowie Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen (Settings). Pflege umfasst die Förderung der Gesundheit, die Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind die Wahrnehmung der Interessen und Bedürfnisse (Advocacy) [...]“ (SBK 2007: 7).
In der stationären Alterspflege ist der emotionale, soziale und betreuerische Teil bei
der professionellen Pflege ausgebauter und wichtiger als beispielsweise in der akuten
Pflege in den Krankenhäusern (Garms-Homolovà 2014: 422). Die professionelle
stationäre Alterspflege wird in der Schweiz in 1580 Alters- und Pflegeheimen geleistet,
davon sind 1112 privatrechtlich und 468 öffentlich-rechtlich organisiert (BfS 2015: 9).
Insgesamt leben in der Schweiz über 145’000 Personen in einer Institution der statio-
nären Alterspflege. Dies sind rund 2 % der Wohnbevölkerung. Die Bewohnenden sind
mehrheitlich schwer pflegebedürftig und über 80 Jahre alt bei den Männern, respektive
85 Jahre bei den Frauen. Die Mehrheit der Bewohnenden sind Frauen (ebd.: 25).
Seite 37
Aufgrund der weiteren Alterung der Gesellschaft, wird bis 2030 von bis zu über
220‘000 Personen ausgegangen, welche eine professionelle Pflege in einem Heim
brauchen werden (Höpflinger et al. 2011: 21-60). Bis 2040 werden im Extremfall sogar
über 300‘000 Personen in Alters- und Pflegeheimen leben (Christen et al. 2015: 21).
Bereits heute kostet die stationäre Alterspflege über 9,2 Milliarden Franken (BfS 2015:
31). Auch hier ist in den nächsten Jahren eine massive Kostenzunahme zu erwarten.
Grösster Kostenpunkt ist das Personal mit rund zwei Drittel (Widmer 2012b: 12) bis
drei Viertel (Christen et al. 2015: 27) der Kosten. Damit sind die Alters- und
Pflegeheime auch ein wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor. Ihr Anteil am
Bruttoinlandprodukt (BIP) ist stark zunehmend und wie im gesamten
Gesundheitssektor werden auch in Zukunft steigende Wachstumsraten erwartet
(Madörin 2014b: 7-13).
Steuerung und Kompetenzverteilung sind föderalistisch organisiert (Allgäuer 2009:
23.). Der Bund gibt Rahmenbedingungen zur Finanzierung vor und ist für die
allgemeine Steuerung zuständig. Die weiteren Kompetenzen obliegen dann den
Kantonen, wobei diese einzelne Steuerungsmechanismen, Kompetenzen und Kosten
auch an die Gemeinden weitergeben können (Zogg 2011: 96; Jäggi und Künzi 2015:
16). So findet sich in jedem Kanton ein anderer Grad an Regulationen. Beispielsweise
sind die Kontrollen der Qualität der Pflege und Heime in jedem Kanton unterschiedlich
geregelt (Balmer et al. 2014a). Gleich verhält es sich bei den Personalschlüsseln, also
den Vorgaben, wie viel Personal mit welchem Skill- und Grade-Mix in einer Institution
angestellt werden muss. Einige Kantone kennen keine, andere sehr rigorose Vorgaben
und Kontrollen (Kassensturz und Espresso 2013). Die Grundzüge der Finanzierung
sind im Krankenversicherungsgesetz seit 1996 mehrheitlich klar geregelt. Da die
Kosten für die Versicherungen und damit die Krankenkassenprämien im
Gesundheitswesen stetig gestiegen, sowie die verschiedenen Sozialversicherungen
nicht aufeinander abgestimmt waren, kam es 2009 zu einer Revision. Hauptziel war die
Kostenentlastung für die Krankenkassen. Diese neue Pflegefinanzierung wird seit 2011
angewandt (Ryter und Barben 2015: 13-18).
3.1 Finanzierungssystem seit dem 1. Januar 2011
Beim schweizerischen System der Pflegefinanzierung kann von einer
wettbewerbsneutralen Subjektfinanzierung gesprochen werden. Dabei werden alle
Anbieter von stationären Pflegeleistungen gleich behandelt, sobald sie von einem
Kanton auf die Pflegebettliste gesetzt werden (Nicolai 2009; Klie 2014: 68). Somit gibt
es keine direkte Subventionierung der Alters- und Pflegeheime mehr. Ausnahmen sind
Seite 38
einige wenige Kantone, die noch einen kleinen Teil der Investitionen decken (Christen
et al. 2015: 10). In der Finanzierung wird zwischen Pflege und Betreuung
unterschieden. In der Krankenpflege-Leistungsverordnung (EDI 2015) wurden neue
versicherungsrechtliche Kategorien geschaffen. Diese Definieren die Pflegeleistungen
der Behandlungspflege, der Grundpflege und der Akut- und Übergangspflege. Alles
was nicht innerhalb dieser Kategorien als Leistungen definiert ist, gilt als Betreuung
und wird nicht durch die Krankenkassen finanziert. Geld für die definierten
pflegerischen Leistungen erhalten Bewohnende nach einer Bedarfsabklärung, einem
so genannten Assessment. Ein solches dauert 14 Tage und findet einmal pro Halbjahr
statt oder bei einer akuten Verschlechterung des Zustandes. Aufgrund der
Bedarfsabklärung wird eine Person danach in eine der zwölf Pflegestufen eingeteilt.
Eine Pflegestufe entspricht 20 Minuten bezahlter Pflegezeit. Das bedeutet, dass die
erste Pflegestufe 20 Minuten bezahlte Pflege, Pflegestufe zwei 21-40 Minuten
beinhalten usw. Pflegestufe 12 beinhaltet das Maximum mit 201-220 Minuten bezahlte
Pflege am Tag (Zogg 2011: 93-95; Jäggi und Künzi 2015: 13f). Die Entgeltung erfolgt
nach zeitbasierten, medizinisch-technische Handlungen umfassenden Einzel-
leistungen, welche auf die Minute genau heruntergebrochen werden können (Durtschi
et al. 2015: 1). Damit dies nach einheitlichen und überprüfbaren Kriterien passiert, gibt
es in der Deutschschweiz zwei Abrechnungssysteme: RAI und BESA (Ryter und
Barben 2015: 35). Um Abrechnung zu kontrollieren, ist ein umfassendes
Dokumentationssystem nötig. Dieses führt zu einem erhöhten Aufwand für die
Pflegekräfte in diesem Bereich (Widmer 2012a).
Die Pflege wird dann von insgesamt drei Akteuren bezahlt, namentlich den Kranken-
kassen, der öffentlichen Hand und den Bewohnenden. Die Kantone setzen pro Pflege-
stufe normierte Pflegekosten fest. Die Krankenkassen beteiligen sich an diesen Pflege-
kosten mit einem definierten Beitrag bis maximal 220 Franken. 20 % des maximalen
Krankenkassenbeitrages können die Kantone von den Bewohnenden als Selbstbehalt
fordern. Die Differenz muss am Schluss die öffentliche Hand übernehmen (Bundes-
versammlung 2015).
Die Betreuungskosten inklusive der Hotelleriekosten, also alles, was in der
Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) nicht als Pflege definiert ist, müssen voll-
umfänglich von den Bewohnenden selbst bezahlt werden. Hierbei gibt es keine Kosten-
begrenzung. Falls sich Bewohnende die Betreuungskosten nicht selbst leisten können,
erhalten sie Ergänzungsleistungen. Dafür können die Kantone Höchstgrenzen vor-
sehen (Zogg 2011: 93 und 97f). Die Pflege- und Betreuungskosten machen insgesamt
mehrere tausend Franken im Monat aus. Dabei bezahlen die öffentliche Hand 10 %,
Seite 39
die Krankenkassen 20 % und Privatpersonen, respektive wenn nötig die Sozialver-
sicherungen, 70 % der Kosten (Jäggi und Künzi 2015: 15-22).
3.2 Situation des Personals in der stationären Alterspflege
Die professionelle Pflege in Alters- und Pflegeheimen wird heute von über 80‘000
Personen wahrgenommen. Werden das technische und rein betreuende Personal
(Abwarte, Hauswirtschaftsangestellte, Gastronominnen, Fachpersonen Aktivierung
etc.) hinzugerechnet, wären es über 120‘000 Personen (BfS 2015: 17-21). Die
benötigte Anzahl Pflegekräfte wird bis 2040 um das 1,8- bis 2,2-fache zunehmen
(Christen et al. 2015: 27). Momentan findet das Wachstum vor allem bei privaten
Alters- und Pflegeheimen statt (Lampart 2015).
Die Pflegekräfte werden in drei Stufen eingeteilt. Die erste Stufe sind Personen mit
einem tertiären Berufsbildungsabschluss, also einem Bachelor oder Master einer Uni-
versität, Fachhochschule oder einem Abschluss an einer Höheren Fachschule (HF).
Mit diesen Abschlüssen bringen diese Personen die Voraussetzung mit, selbständig
sämtliche Grundpflege- und Behandlungspflegeleistungen zu erbringen und anzuleiten.
In Alters- und Pflegeheimen sind dies meist Pflegefachpersonen HF. In der zweiten
Kategorie sind Personen mit einem sekundären Berufsabschluss. Das sind Berufs-
tätige mit einem Berufsabschluss Fachangestellte Gesundheit EFZ (FaGe) oder Fach-
angestellten Betreuung EFZ, also einer Berufslehre. Sie können selbst alle Standard-
situationen der stationären Altenpflege, der Grundpflege und fast alle Behandlungs-
pflegeleistungen erbringen, teilweise aber unter Aufsicht einer Person mit tertiärem
Abschluss. Die dritte Kategorie umfasst das Assistenzpersonal. Dieses hat als primäre
Stufe oft eine kurze Ausbildung beim Schweizerischen Roten Kreuz besucht oder
maximal eine zweijährige Attestausbildung. Diese Personen können unter Aufsicht der
höheren Stufen Aufgaben der Grundpflege und Betreuung ausführen (Ludwig und
Schäfer 2011 30-34; ALBA 2013: 31). Insbesondere der Anteil der Personen mit einem
primären Abschluss hat zugenommen (Zùñiga et al. 2013: 12f).
Eine grosse Mehrheit der Personen arbeitet Teilzeit. Auf allen Stufen sind fast nur
Frauen tätig (Prey et al. 2004: 36-42). Immer mehr Personen haben einen
Migrationshintergrund (Ryter und Barben 2015: 30f). Bereits heute ist die Lage auf dem
Arbeitsmarkt für Alters- und Pflegeheime angespannt. Bis 2030 wird ein
Personalmangel von mehreren 10‘000 Personen in der stationären Alterspflege
befürchtet (Rüegger und Widmer 2010: 7). Als weiteres Problem kommt hinzu, dass
viele ausgebildete Pflegekräfte ihren Beruf im Laufe ihrer Karriere wechseln. Jede
achte Person in der stationären Alterspflege überlegt sich, ihre Stelle zu künden,
Seite 40
respektive den Beruf ganz zu verlassen (Zùñiga et al. 2013: 36). Zusätzlich werden
altersbedingt etwa ein Drittel aller Pflegekräfte in den nächsten 10 bis 15 Jahren
pensioniert und aus dem Berufsleben ausscheiden (Rüegger und Widmer 2010: 7).
Die Arbeitsbedingungen in der stationären Altersbetreuung sind nicht einheitlich
geregelt. Die meisten Angestellten sind privatrechtlich angestellt. Für sie gelten keine
Mindestarbeitsbestimmungen. Dies, weil sie keinem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen
und gesetzliche Regulierungen fehlen (vgl. Unia 2015). Insbesondere Personen mit
einer tiefen Berufsbildung geraten deshalb zunehmend unter Druck.
Obwohl die Mehrheit (88 %) mit ihrer Arbeit und Arbeitsstelle zufrieden ist (Zùñiga et al.
2013: 38), gibt es in der stationären Alterspflege ein „traditionell tiefes Einkommen für
pflegerische Leistungen“ (Madörin 2014a: 84-87), also oft tiefe Löhne. Als besonders
positiv wird die Chance der beruflichen Weiterentwicklung angegeben (Curaviva und
Qualis 2011: 17f). Die Partizipation wird grossmehrheitlich als positiv bewertet, jedoch
gibt es hier zwischen den Betrieben eine grosse Varianz (Zùñiga et al. 2013: 7). Grund-
sätzlich werden die Arbeitsbedingungen als fair bewertet, in verschiedenen Bereichen
wird aber Kritik laut. Neben dem zu tiefen Entlöhnungsniveau muss oft kurzfristig für
krankes und beurlaubtes Personal eingesprungen werden, um den Betrieb aufrecht zu
erhalten (Prey et al. 2004: 145). Eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaft kommt zum Schluss, dass für eine längere Verweildauer der Pflegekräfte
mehr Lohn, bessere Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nötig
wären (Schaffert 2015: 8).
Weitere oft von Pflegekräften bemängelte Punkte sind der Stress, die emotionale
Erschöpfung und gesundheitliche Schäden. In einer Studie der Universität Basel
(Zùñiga et al. 2013: 3 und 33f) geben Pflegekräfte der stationären Alterspflege aus der
ganzen Schweiz oft an, dass sie während der Pflege unter Stress stehen und für die
Bewohnerinnen und Bewohner zu wenig Zeit haben. So können sich 35 % zu wenig
über die Bewohnerinnen und Bewohner informieren, ein 30 % der Befragten gaben an,
dass sie die BewohnerInnen oft warten lassen müssen, 20 % können in wichtigen
Momenten keinen Beistand leisten und 25 % fehlt die Zeit für aktivierende und
erhaltende Arbeit an und Therapien mit den Bewohnenden. Im Kanton Bern wurde
festgestellt, dass ein Drittel der Pflegekräfte resigniert haben und ein Sechstel zudem
aktiv unzufrieden ist (Künzi und Schär Moser 2002: 29). Viele Pflegekräfte leiden
gemäss Zùñiga et al. (2013: 3 und 33f) unter Rückenschmerzen (71 %) und/oder
Gelenk- oder Gliederschmerzen (51 %). Bei 66 % treten häufig am Ende des Tages
Zustände der Energielosigkeit und Ermüdungserscheinungen auf. Depressionen sind
Seite 41
bei Pflegekräften im stationären Altersbereich häufiger festzustellen als in der
sonstigen Bevölkerung (Prey et al. 2004: 80-83). Die Fluktuationsrate in Alters- und
Pflegeheimen ist hoch: Sie lag beispielsweise in Bern 2002 bei 22 % (Künzi und Schär
Moser 2002: 63). Ebenfalls ist festzustellen, dass die emotionale Belastung und der
emotionale Stress zunehmen und zu massiv mehr Burnouts und ähnlich gelagerten
Ausfällen führen (Zùñiga et al. 2013: 3 und 28-32).
3.3 Ökonomisierung und Herausforderungen
Wirtschaftlichkeit und Effizienz sind als wichtige Grundsätze im
Krankenversicherungsgesetz (KVG), welchem die Pflege zu folgen hat, verankert. Das
Sparen ist heute ein hegemonialer Diskurs in der Pflege. Ihm hat sich alles
unterzuordnen und ist somit ein entscheidender Faktor für die Ökonomisierung der
Pflege (Madörin 2014a: 35-45). Pelizzari (2001) bezeichnet als Ökonomisierung die
Neuordnung ehemals nicht nach Marktlogiken organisierter Gesellschafts-, Geschäfts-
und Staatsbereiche durch interne Rationalisierung und der Übernahme von Kosten-
Ertrags-Kalkülen. Ökonomisierungsstrategien lehnen sich dabei am Funktionieren von
privatwirtschaftlichen Firmen und tayloristische Prinzipien aus der industriellen
Güterproduktion an. Viele Privatisierungen wurden seit 2011 damit begründet, dass
sich Aktiengesellschaften dem Markt einfacher anpassen könnten und flexibler seien
als andere Rechtsformen (Nicolai 2009: 16).
Um Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten, werden die betriebswirtschaftliche
Marktlogik sowie ihre Instrumente und Messverfahren Schritt für Schritt in der
stationären Alterspflege eingeführt:
„Die [...] Pflegeheime sind gehalten, ihre Leistungen möglichst kostengünstig zu erbringen. Dabei sollen sie sich an betriebswirtschaftlichen Managementmethoden und Effizienzkriterien orientieren, die oft im Kontext der Güterproduktion entwickelt worden sind und auf care-spezifische Anforderungen wenig Rücksicht nehmen“ (Ryter und Barben 2015: 35).
Heimleitungen sind heute eher Manager und müssen, wenn überhaupt, oft nur über
wenig pflegerisches Wissen verfügen (vgl. Rosenthal 2005; ALBA 2013: 25). Die
Menge an Literatur zum Pflegemanagement nimmt gleichzeitig massiv zu und
fokussiert zumeist auf Themen wie Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisation und viele
betriebswirtschaftliche Instrumente (vgl. Müller 2011; Loffing und Geise 2010; Rosen-
thal 2005 und Buchinger 2012).
In seiner Publikation wirbt der Hotellerie Verband dafür, Hotels in Pflegeheime
umzuwandeln. Die Gewinnspanne beträgt dabei 5-10 % und bringt mehr Rendite
(Schlenczek 2011). Gleichzeitig gibt es immer mehr private, gewinnorientierte Ketten in
der Schweiz. Senevita ist beispielsweise Teil des multinationalen Pflegekonzerns
Seite 42
ORPEA. Die Ketten Tertianum und Seniocare werden von Investmentgesellschaften,
sogenannten Private Equity Fonds oder Hedgefonds, finanziert (Balmer und Haederli
2014b). Diese investieren nicht nur in gewinnorientierte Unternehmungen, sondern
auch in gemeinnützige oder gar öffentliche Alters- und Pflegeheime. Private Equity
Fonds, welche in Pflegeheime investieren, versprechen teilweise eine Rendite von 8-
18 % (Klie 2013: 75f).
Madörin (2014a: 22-34; 2014ba: 20) weist in ihrer Studie zur Ökonomisierung des
schweizerischen Gesundheitswesen darauf hin, dass die Pflege unterfinanziert und
überreguliert ist. Durch die enge Definition der Pflege im Gesetz werde vieles nicht
finanziert und über Betreuungskosten oder unbezahlte Arbeit von Familienangehörigen
quersubventioniert. Alters- und Pflegeheime und Pflegekräfte geraten dadurch unter
Druck. Rationalisierungen der Arbeits- und Pflegeprozesse sind deshalb heute nach
wie vor an der Tagesordnung. Die durch die Pflegestufe festgelegten Zeiteinheiten
reichen oft nicht aus für eine individuelle, gesamtheitlich, gute Pflege.
Seite 43
4. Theoretische Einordnung und Diskussion der schweizerischen stationären Alterspflege
Ziel ist es nun, die schweizerische Situation in der stationären Alterspflege in einen
Kontext mit den sozialwissenschaftlichen Theorien zu bringen und zu diskutieren.
Diese Betrachtung beginnt bei den Akteurinnen und Akteure, der Verteilung der Macht
und der Figuration im Feld der Pflege. Es zeigt sich, dass neben den Heimträgern als
Arbeitgeber zwei weitere Akteure den Alltag der Pflegekräfte, aber auch der
Bewohnenden, massgeblich bestimmen. Das ökonomische Kapital für die medizinische
Pflege, dessen Regulierung und Bedarf, sowie die Definitionsmacht, was Pflege ist,
liegt grösstenteils in den Händen eines Triumvirates von Staat (Bund, Kantone und
Gemeinden), Krankenkassen und Arbeitgebern. Die Pflegekräfte erhalten oft wenig
ökonomisches Kapital (tiefer Lohn etc.). Die Pflegekräfte sind durch ihr Berufsethos an
das Wohl ihrer Bewohnerinnen und Bewohner gebunden (kulturelles Kapital) und über
verfügen wenig Organisationsmacht (soziales Kapital).
Gleichzeitig ist eine starke Ökonomisierung des Feldes der Pflege festzustellen. Eine
kapitalistische Landnahme hat stattgefunden. Der Neoliberalismus ist heute die
hegemoniale Denkrichtung. Er bildet damit die neue Doxa im Feld der Pflege und
entspricht dem aktuellen Geist des Kapitalismus. Kostensparen beim Staat und der
Pflege, Rationalisierungen, Produktivitätssteigerungen und die Trennung von
produktiven und nicht-produktiven Tätigkeiten sind das neue Credo. Die
wettbewerbsneutrale Subjektfinanzierung und der hohe Grad an Selbstfinanzierung
durch die Bewohnerinnen und Bewohner wirken als starke Markttreiber. Es gibt aber
eine wichtige Einschränkung: Es wird nicht alles dem freien Markt überlassen, trotz
einer starken Zunahme marktförmiger Organisation und der Profitmöglichkeiten für
gewinnorientierte Anbieter. Gleichzeitig aber reguliert das System von Staat,
Versicherungen und Pflegeheimen verschiedene Aspekte der Pflege und ihrer
Finanzierung. Dieser Teil erinnert eher an die chinesische Variante des Kapitalismus
(ten Brink 2010: 40f), als an die reine neoliberale. Durch diese Durchmischung ist für
alle Menschen in der Schweiz unabhängig des Einkommens eine minimale Pflege
möglich. Die Variante kann auch als Teil des Geistes des Kapitalismus von allen
getragen werden, als Mix zwischen einem angelsächsischen Neoliberalismus und
einem chinesischen Staatsregimekapitalismus. Gleichzeitig bildet sie aber eine neue
Möglichkeit für die zusätzliche Kapitalakkumulation. Staat, Krankenkassen und Heime
führen dazu die nötige Produktionsweise ein. Mit dem in der Schweiz bestehenden
kapitalistischen Regime der stationären Alterspflege können profitable Teile, wie die
Hotellerie und die Betreuung wohlhabender Klientinnen und Klienten, marktförmig
Seite 44
angeboten werden und bilden interessante Anlageflächen. Durch Kostensenkungen
lassen sich Gewinne erzielen. Um die Rendite zu erhöhen, gibt es auf der Ertragsseite
zwei weitere Massnahmen: Mehreinnahmen durch Betreuungsbeiträge, da diese nicht
festgelegt sind, oder die Selektion von Bewohnerinnen und Bewohnern mit rentablen
Pflegestufen. Auf der Aufwandsseite gibt es unter dem Credo Rationalisierung und
Produktivitätssteigerung mehr Möglichkeiten. Dazu muss entweder beim Personal oder
der Qualität der Hebel angesetzt werden. Beim Personal kann auf verschiedene Arten
gespart werden. Weniger Personal anstellen, die Arbeitsbedingungen verschlechtern,
billigere Arbeitskräfte anstellen, mehr Freiwilligenarbeit oder mit der gleichen Anzahl
Personal mehr Personen pflegen und betreuen. Möglich ist auch eine Einsparung bei
Material- und Sachkosten oder die Senkung der pflegerischen und betreuerischen
Qualität. Die Investitionen von Private Equity Fonds in ausgewählte Pflegeheime sind
eine Folge dieser neuen Möglichkeiten. Durch die vollführte kapitalistische Landnahme
werden alle Einrichtungen der stationären Alterspflege marktförmiger organisiert. Alle
müssen sich an dieselben Kostenvorgaben bei der Pflege halten und stehen im
Wettbewerb untereinander, unterliegen den gleichen Rationalisierungszwängen und
dem gleichen neoliberalen Denken.
Die Ökonomisierung und Rationalisierungen in der Arbeitswelt erfolgt auch in der
Schweiz durch tayloristische Methoden der industriellen Güterproduktion. Dies trotz der
Kostenkrankheit bei personenbezogenen Dienstleistungen und weiterer Inkompatibi-
litäten, von welchen Care-Ökonominnen und Care-Ökonomen warnen, weil bei der sta-
tionären Alterspflege eine andere Verwertungslogik vorliegt. Die Pflege wird
vermessen, quantifiziert und mit einem Kosten- und Zeitregime zwecks Produktivitäts-
steigerung versehen. Dies führt zu Verschlechterungen für das Personal oder der
Pflegequalität. Als Pflege zählen nur noch medizinaltechnische Begriffe aus der KLV,
welche auch messbar sind. Für diese gibt es jeweils ein Zeitbudget, in welchem die
normierten Handlungen an Menschen vollführt werden müssen. Dies wird durch ein
ausgebautes Dokumentationswesen kontrolliert. Das Kostenkorsett wirkt auf alle. Die
Betreuung, also Beziehungs-, Emotions- und Gefühlsarbeit, wird wegrationalisiert, da
für eine ganzheitliche Pflege das Geld fehlt. Somit werden die Pflege und die Pflege-
beziehungen Schritt für Schritt objektiviert. Dadurch findet eine neue Art der Entfremd-
ung zwischen den Pflegekräften und den Bewohnerinnen und Bewohnern statt.
Die Ökonomisierung hat verschiedene Auswirkungen auf die Arbeitswelt der Pflege-
kräfte. Das Berufsbild befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit
und Menschlichkeit. Verschiedene Interessensgruppen versuchen den Zuschnitt des
Berufes der Pflegekräfte in der stationären Alterspflege nach ihren Wünschen anzu-
Seite 45
passen. Mit der Tertiärisierung des Berufes soll die Professionalisierung vollendet
werden. Mit der Ökonomisierung und den Professionalisierungsbestrebungen erfolgt
eine Arbeitsteilung im tayloristischen Sinne. Dies zeigt sich an den drei Ausbildungs-
und Funktionsstufen und führt zu Positionierungskämpfen der Pflegekräfte innerhalb
des Feldes. Der zunehmende Stress, die Zeitnot und die Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen sind typische Anzeichen für die Rationalisierungen durch das taylorist-
ische und kostensparende Denken. Die Pflegekräfte scheinen in einem Widerspruch
zwischen der Ökonomisierung und der eigenen Vorstellung von guter Pflege und des
eigenen Ethos zu stecken. Damit lassen sich auch die hohe Fluktuations- und Burnout-
Raten erklären. Die Auflösung dieses Widerspruchs scheint zumindest theoretisch in
der Schweiz noch nicht greifbar und der Prozess der Ökonomisierung geht in der
Arbeitswelt, aber auch bei den Pflegekräften, weiter.
Seite 46
5. Methodisches Vorgehen
Um die Leitfragen empirisch zu untersuchen, sind qualitative Methoden am ziel-
führendsten. Sie ermöglichen einen Zugang zur Lebenswelt der Pflegekräfte, welcher
mit einer quantitativen Herangehensweise nicht zu erfassen ist. Eine qualitative
Analyse erlaubt das Erleben des Arbeitsalltags, die subjektiven Deutungen und inter-
pretativen Prozesse der Pflegekräfte explorativ zu erkunden (vgl. Flick 2011). Im
Gegensatz zu standardisierten quantitativen Methoden ist es mittels qualitativen
Methoden möglich, das persönliche Erfahrungswissen der Menschen zu erschliessen
und dieses auch individuell zu deuten (Bohnsack 1999: 17-25). Dies ist wichtig, da die
Ökonomisierung als embedded competition unterschiedliche Erscheinungsformen hat
(Manzei und Schmiede 2014: 18-24). Gerade deshalb ist ein Forschungsansatz,
welcher die Ökonomisierung aus der subjektiven Welt der Pflegekräfte herleitet und
ihre erlebten Auswirkungen im Alltag beschreibt statt vorher zu generalisieren, am
erfolgversprechendsten (Hug und Poscheschnik 2010: 88-90).
Um die Leitfrage beantworten zu können, wurden Daten zu verschiedene Themen-
kreisen wie Pflege, Ethos und Beruf erhoben. Inspiriert wurden dieser Fragenkomplex
durch Corinne Schwallers (2013: 2) Analyse zur Ökonomisierung der Spitex. Als Erstes
braucht es eine Positionierung der Pflegekräfte zu ihrer Arbeit, ihrem Pflegeverständnis
und ihrer Motivation:
- Wie sieht der Arbeitsalltag von Pflegekräften in der stationären Altenpflege aus?
- Was verstehen Pflegekräfte unter qualitativ guter Pflege?
- Wieso üben Pflegekräfte in der Altenpflege ihren Beruf aus, was ist ihre Motivation?
- Was ist das berufliche Selbstbild der Pflegekräfte?
Nach dieser Positionierung konnte auf das Vorhandensein von Widersprüchen und
allfällige Konsequenzen der Ökonomisierung in folgenden Themenkreisen ein-
gegangen werden:
- Welche Veränderungen stellen die Pflegekräfte in den letzten Jahren fest?
- Wie nehmen die Pflegekräfte die Ökonomisierung ihrer Arbeitswelt und die Pflege
im Alltag durch die Pflegekräfte wahr?
- Wie gehen die Pflegekräfte mit allfälligen Widersprüchen zwischen Pflege und
Ökonomie um und wie reagieren sie darauf?
Seite 47
5.1 Datenerhebungen
Bei der Datenerhebung zu den genannten Themenkreisen empfahl sich aufgrund des
nicht einfach fassbaren Untersuchungsgegenstands eine Kombination verschiedener
Methoden, um genügend Daten von verschiedenen Sichtpunkten sammeln zu können.
Hierzu wurde eine Methodentriangulation (between-methods) gemäss Flick (2008: 15f)
ausgeführt. Verschiedenen Methoden ergänzen sich und ermöglichen Erkenntnisse,
die eine Methode alleine nicht könnte (Garz und Kraimer 1991: 19). Ziel war es, durch
diesen Methodenmix bei der Datenerhebung systematisch verschiedene Blickwinkel
auf den Untersuchungsgegenstand einnehmen zu können. Die verschiedenen
Perspektiven wurden durch betroffene Pflegekräfte, verschiedene Expertinnen und
Experten sowie Tagungsdiskussionen eingefangen.
5.1.1 Semistrukturierte Leitfadeninterviews mit Pflegekräften
Das erste und wichtigste Erhebungsinstrument für diese Arbeit waren zehn semi-
strukturierte, qualitative Interviews mit Pflegekräften aus der stationären Alterspflege.
Diese Interviews ermöglichen es, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen der
Pflegekräfte zu erheben (Moser 2008: 89). Dabei wurde darauf geachtet, dass die
Interviews semistrukturiert geführt wurden. Das heisst, im Fokus stand nicht eine
beliebige Narration der Interviewten, sondern ihre Aussagen zu den vorher theoretisch
erarbeiteten und hergeleiteten Themen- und Fragekomplexen. Dies ermöglichte das
subjektive Verstehen (Flick 2011: 203-214). Dazu wurde ein Leitfaden erstellt und bei
allen Interviews verwendet.
Bei der Konstruktion des Leitfadens wurde mit der Methode SPSS (S: Sammeln, P:
Prüfen, S: Sortieren, S: Subsumieren) von Helfferich (2011: 178-189) entlang der oben
genannten Themenblöcke gearbeitet. Es wurde dem Grundsatz gefolgt, immer vom
Allgemeinen zum Spezifischen zu gehen. Jedes Interview startete mit offenen Fragen
zur Vorgeschichte, um dann konkreter zu werden. Analog wurde bei den Themen- und
Fragekomplexen umgegangen – immer zuerst offene Fragen und dann gegen Ende
des Komplexes spezifische Fragen.
Bei der Stichprobenziehung für die semistrukturierten Interviews wurde die Methode
des theoretischen, respektive gezielten, Samplings angewandt (Kruse 2015: 237-249).
Bei den zehn interviewten Pflegekräften bedeutete dies, dass jede Hierarchiestufe,
namentlich primäre Stufe (pflegerisches Assistenz- und Hilfspersonal), die sekundäre
Stufe (meistens FaGe) und die tertiäre Stufe (Abschlüsse von Höheren Fachschulen,
Fachhochschulen oder Universitäten, hier meistens Pflegefachpersonen HF)
angemessen vertreten sein mussten. Des Weiteren wurde bei den Pflegekräften auf
Seite 48
eine gewisse Varianz bezüglich Kanton, Betriebsgrössen und Nationalitäten geachtet.
Ferner wurde in der Frauendomäne auch ein Mann interviewt. Alle Pflegekräfte die
ausgewählt wurden, mussten sowohl vor, wie auch nach dem 1. Januar 2011 in der
stationären Alterspflege gearbeitet haben. Alle Personen arbeiteten in privaten Alters-
und Pflegeheime, wobei einige gewinnorientiert waren und andere nicht. Die
Stichprobenziehung erfolgte nach dem Schneeballprinzip. Dies bedeutet, dass zuerst
Pflegende aus dem beruflichen und privaten Umfeld angefragt wurden und diese
darum gebeten wurden, weitere, den Kriterien entsprechende Pflegekräfte zu
empfehlen (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014). Dies führte zu folgenden interviewten
Personen, welche alle sofort nach der Anfrage zusagten und sehr offen und direkt
antworteten:
Sämtliche Personen wurden anonymisiert und deshalb in der Tabelle 1 die Kategorien
so weit geöffnet, dass die Anonymität der Interviewten gewahrt werden kann
Name Stufe Kanton Nationalität Geschlecht Betriebsgrösse
in Anzahl
Angestellten
Orientierung
des Betriebes
Tamara
Wüthrich*
Primär BE CH W 50 Gewinn
Jasmin
Müller*
Tertiär BE CH W 100 Nicht-
Gewinn
Nadja
Engel*
Sekundär (in
Tertiär
Ausbildung)
SG/ ZH/
BE
CH W Unterschiedlich Beides
Luca
Michel*
Sekundär (in
Tertiär
Ausbildung)
BE CH M Unterschiedlich Beides
Tanja
Birnstiel*
Tertiär BS Nicht CH W 30 Gewinn
Dagmar
Polzin*
Tertiär AG Nicht CH W 75 Gewinn
Isabelle
Fuhrmann*
Sekundär BE CH W 100-200 Nicht-
Gewinn
Elisabeth
Jung*
Sekundär BE CH W 100-200 Nicht-
Gewinn
Maria
Tschanz*
Sekundär SO Nicht CH W 75 Nicht-
Gewinn
Sabine
Kurz*
Primär BE CH W 50 Nicht-
Gewinn
Tabelle 1: Interviewte Pflegekräfte, * sämtliche Namen sind frei erfunden
Seite 49
(Christians 2005: 145). Dies ist nötig, da in den Interviews offen gesprochen wurde und
einigen Interviewte dadurch negative Konsequenzen drohen könnten. Die Interviews
wurden digital aufgezeichnet und von Schweizerdeutsch möglichst nahe am Original
auf Hochdeutsch transkribiert (Dresing und Peh 2011).
5.1.2 Expertinnen- und Experteninterviews
Um die Perspektive der Pflegefachkräfte zu ergänzen, wurden für diese Arbeit
Expertinnen- und Experteninterviews durchgeführt. Als Expertinnen und Experten
gelten hier Personengruppen, welche für das Forschungsthema eine spezifische
Fachkenntnis oder Kompetenz ausdrücken können (Hug und Poscheschnik 2015:
104). Bei den Expertinnen und Experten interessiert nicht die Person als Individuum
und ihr subjektives Erfahrungswissen, sondern das Expertenwissen dieser Person in
einem spezifischen Feld, welches sich rund um das Thema Ökonomisierung der Pflege
und Auswirkungen auf das Personal gruppiert (Flick 2011: 214f). Dazu wurde je eine
Vertreterin oder Vertreter eines Arbeitgebers, der Politik, einer Gewerkschaft, einer
Beschwerdestelle für Bewohnende sowie der Berufsbildung interviewt:
Name Funktion Akteur Rolle im Feld
Christine Fitze* Nationalrätin, ehemals
Gemeinde- und Grossrätin
Politik Reguliert die gesetzlichen
Rahmenbedingungen mit
Lorenz Eggenschwiler* Rektor einer Höheren
Fachschule
Ausbildung Bildet Pflegkräfte aus
Magdalena Christen* Dipl. Heimleiterin Arbeitgeber Stellt Pflegekräfte ein
Christoph Uetz* Fachspezialist der einer
Beschwerdestelle
Bewohnerinnen
und Bewohner-
organisation
Vertritt bei individuellen
Beschwerden die
Bewohnenden
Andreas Stern* Leitungsperson der
Gewerkschaft Unia im Bereich
Pflege
Gewerkschaft Vertritt die kollektiven
Interessen der Pflegekräfte
Tabelle 2: Interviewte Expertinnen und Experten, * sämtliche Namen sind frei erfunden
Auch diese Personen wurden anonymisiert. Christoph Uetz wurde nach Anfrage für
einen Experten von der Geschäftsstelle der Unabhängigen Beschwerdestelle für das
Alter vermittelt. Die restlichen vier Expertinnen und Experten wurden gezielt
ausgewählt. Es sind Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, welche als Akteure
im Feld der Pflege eine wichtige Rolle spielen. Alle angefragten Personen waren offen
und gaben gerne Auskunft. Sie waren über den Arbeitstitel der Forschung informiert.
Die Interviews wurden als explorative Interviews zur Erweiterung der Wissens-
dimensionen geführt. Das bedeutet, es wurden entlang der oben bestehenden
Themenblöcke Fragen gestellt. Damit konnten die Expertinnen und Experten Kontext-
Seite 50
bedingungen und -wissen für den Prozess der Ökonomisierung und das Handeln und
Verstehen der eigentlichen Zielgruppe, der Pflegefachkräfte, beitragen (Meuser und
Nagel 1991: 446). Die Interviews erlaubten eine vertiefte Analyse der Fragestellung
und des gesellschaftlichen Rahmens rund um die Ökonomisierung der Pflege. Die
Interviews wurden wie die semistrukturierten Leitfadeninterviews geführt und
transkribiert.
5.1.3 Teilnehmende Beobachtung
Als letzter Teil der Datenerhebung innerhalb der Methodentriangulation wurde an zwei
Tagungen, welche thematisch alle mit der Leitfragestellung verwandt waren,
teilnehmende Beobachtung durchgeführt. Kennzeichen der teilnehmenden
Beobachtung ist das Eintauchen des Forschers in das Feld als aktiver Teilnehmender
(Flick 2011: 287). Bei der Datenerhebung lag der Fokus nicht nur auf den
gesprochenen Aussagen, sondern auch den Verhaltensweisen, Emotionen und
Interaktionen zwischen den Menschen aus den verschiedenen Feldern (Hug und
Poscheschnik 2015: 108-110). Gegenüber einigen Teilnehmenden wurde in Vor-
gesprächen erwähnt, dass Notizen gemacht und für diese Masterarbeit gebraucht
werden. Ansonsten stand die Teilnehmerrolle im Vordergrund (Spöhring 1989: 140).
Die erste Beobachtung fand an der nationalen Branchenkonferenz Langzeitpflege und
Betreuung der Gewerkschaft Unia statt. Über 30 Delegierte (alles Pflege- und
Betreuungskräfte) diskutierten über die aktuellen Probleme ihrer Branchen sowie über
mögliche Lösungen und Kampagnen. Ebenfalls wurde eine erste Diskussion zum
Manifest „Gute Pflege und Betreuung“ (Unia 2015) geführt. Die zweite teilnehmende
Beobachtung konnte an einer Tagung für das erwähnte Manifest durchgeführt werden,
wo neun Pflegefachleute und drei Gewerkschaftssekretäre das Manifest fertig aus-
arbeiteten. Die letzte teilnehmende Beobachtung erfolgte an einer Tagung der SP
Frauen Kanton Bern zum Thema „Mit Springseil und Rollator in die Zukunft – Heraus-
forderungen und Chancen einer Gesellschaft im demographischen Wandel.“ Hier
wurden unter anderem die Entwicklungen und mögliche politische Handlungsfelder
diskutiert. Teilnehmende waren Politikerinnen und Politiker, Pflegekräfte, Arbeitgeber-
innen und Behördenvertretungen, wobei einige Personen gleich mehrere Rollen in sich
vereinigten. Zugänge zu den ersten beiden Anlässen erfolgten durch die Funktion des
Verfassers als Gewerkschaftssekretär. Zur SP-Tagung erfolgte der Zugang über die
Einladung durch eine Pflegekraft. Die teilnehmende Beobachtung wurde in Feldnotizen
(Moser 2008: 74-76) und Fotoprotokollen festgehalten.
Seite 51
5.2 Datenauswertung
Als Methode für die Auswertung wurde die Grounded Theory verwendet (Strübing
2004). Diese wurden jedoch nicht als eigenes Forschungsproramm oder zur
Theoriegewinnung genutzt (Strauss und Corbin 1996). Die Anwendung der Grounded
Theory beginnt beim spiralförmigen Prozess zwischen Datenerhebung, Auswertung
und Strukturieren der Ergebnisse (Krotz 2005: 167-179). Wie bei diesem nicht-lineare
Vorgehen üblich, traten während der Analyse noch zusätzliche Kategorien, neue Ideen
oder Phänomene auf und es mussten Anpassungen bei der Erhebung und Auswertung
gemacht werden (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 9). Dies führte dazu, dass der
Leitfaden entsprechend angepasst wurde und statt der ursprünglich geplanten neun
Pflegekräfte zehn, und statt vier, fünf Expertinnen und Experten interviewt wurden.
Herzstück der Auswertung ist das dreistufige Kodierverfahren. Zuerst wurden die
erhobenen Daten offen kodiert. Das heisst, es wurden beim Text kurze und ohne
irgendwelche Einschränkungen Codes verteilt. Diese Codes beschrieben die
entsprechenden Textstellen, fassten sie zusammen und zeichneten sie aus. Darauf
folgte das axiale Kodieren. Dazu wurden die Codes des offenen Kodierens
systematisch angeordnet und zueinander in Beziehung gesetzt. Dadurch entstanden
neue Codes. Beim letzten Schritt, dem selektiven Kodieren, wurden
Schlüsselkategorien gebildet und in Verbindung zueinander gebracht (Breuer 2010: 80-
93). Die für die Leitfrage wichtigen Kategorien werden mit den Verbindungen
untereinander als Ergebnisse dargestellt (Flick 2011: 532-536).
5.3 Selbstreflexion
Neben dem bereits dargelegten Forschungsinteresse ist das Thema dieser Arbeit auch
für mich persönlich von Bedeutung. Einerseits weil verschiedene weibliche Mitglieder
meiner Familie (Schwester, Mutter, Grossmutter) in Pflegeheimen gearbeitet haben,
andererseits arbeite ich beruflich als Gewerkschaftssekretär mit Pflegekräften aus der
Langzeitpflege zusammen und vertrete als solcher ihre kollektiven Interessen.
Aufgrund meiner Vorgeschichte habe ich also bereits ein Vorwissen zum behandelten
Thema und eine spezifische Interessenslage. Ich hoffe, mit dieser Forschung
Diskussionen anzuregen. Meine Arbeit richtet sich bewusst an eine breitere
Öffentlichkeit, Pflegekräften und Verantwortliche (public sociology), in der Hoffnung,
dass die Ergebnisse wahr- und aufgenommen werden. Es ist mir wichtig, darauf
hinzuweisen, dass trotz sämtlichen Versuchen, neutral und objektiv zu sein, mein Ich
als Person und meine Einstellungen immer mitschwingen – sei es bei der Erhebung,
Auswertung oder Interpretation. Dies wäre auch der Fall bei quantitativen Methoden
Seite 52
oder einer reinen Theoriearbeit. Die ganze Arbeit war durch Selbstreflexion begleitet,
vom Schreiben des Exposés bis zur Abgabe. Dadurch kann ich auch sagen, dass
Vieles nicht so gekommen ist, wie ich am Anfang vermutet habe und die Arbeit nicht
mein Vorwissen und Haltung wiedergibt, sondern das bestmögliche wissenschaftliche
Ergebnis.
Seite 53
6. Ergebnisse der empirischen Forschung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Auswertung der Interviews mit den
Pflegekräften, den Expertinnen und Experten sowie der teilnehmenden Beobachtungen
präsentiert. Dazu werden die Ergebnisse entlang der Fragestellung geordnet. Dies
bedeutet, dass die Folgen der Ökonomisierung auf die Arbeitswelt der Pflegekräfte in
Kapitel 6.1 aufgezeigt werden. Allfällige Widersprüche zwischen dem Berufsethos und
den Anforderungen durch die Ökonomisierung werden in Kapitel 6.2 dargestellt und
Reaktionen der Pflegekräfte auf die Folgen der Ökonomisierung in Kapitel 6.3
aufgeführt. Die vorgestellten Ergebnisse stellen die gefundenen Kategorien der
Datenauswertung und Kodierung durch die Grounded Theory dar. Die Ergebnisse
werden durch besonders passende und prägnante Zitate der interviewten Pflegekräfte
sowie Expertinnen und Experten unterlegt. Die teilnehmenden Beobachtungen wurden
bei der Auswertung mitbearbeitet, werden aber nicht zwecks Zitierung herangezogen.
6.1 Auswirkungen auf die Arbeitswelt
Es zeigt sich bei allen interviewten Personen, dass die Arbeit, die Arbeitswelt und der
Beruf in den letzten Jahren einem starken Wandel unterliegen und nicht mehr
dieselben sind wie davor. Insbesondere das Verhältnis zu den Bewohnenden ist durch
den Wandel stark in Mitleidenschaft gezogen worden:
„Es hat sich gewandelt. Zurzeit, sollte ich sagen, in den letzten zehn bis 15 Jahren, wo ich einfach sagen muss, es ist nicht mehr der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, es ist das Geld, das im Mittelpunkt steht. Und vorher hat man das noch gehabt. Vorher hast du die Zeit noch gehabt“ (Jasmin Müller
2).
Durch die Verschiebung des Fokus von den Bewohnenden hin zu ökonomischen
Kriterien verändert sich der Arbeitsalltag der Pflegekräfte. Ein permanenter Spardruck
beschleunigt die Veränderungen zusätzlich:
„Also jetzt, ich als Teamleitung, oder ja, in der Betriebssitzung tun sie dir das ganz klar sagen. In der PeKo [Personalkommission, A.D.] sowieso noch. Du weisst immer [...] man sollte noch sparen, und man sollte... Personalkosten sind immer drüber und so“ (Elisabeth Jung).
Die Pflegekräfte erleben diesen Wandel in der Arbeitswelt als eine klare Priorisierung
der Wirtschaftlichkeit innerhalb ihrer Arbeit. So beschreibt die erfahrene Pflegefachfrau
Dagmar Polzin diesen Wandel: „Es geht nur noch um Zahlen. Es geht nicht mehr um
den Menschen an sich.“ Dieser Wandel liegt gemäss dem Gewerkschafter Andreas
Stern in der neuen Pflegefinanzierung begründet. Diese führt als wichtige
Rahmenbedingung zu einem klaren Kosten- und Ökonomisierungsdruck: „Was ich
beobachte, ist, wie gesagt, durch die politischen Rahmenbedingungen, im Fall der
2 Die Quellenangaben zu den Zitaten der interviewten Pflegekräfte sowie Expertinnen und Experten erfolgt
aufgrund der anonymisierten Tabellen 1 und 2 aus Kapitel 5.1.
Seite 54
Pflegefinanzierung, ist es klar, dass es in erster Linie darum geht, Kosten zu
reduzieren“ (Andreas Stern). Diese Logik der Pflegefinanzierung wird an die Pflege-
kräfte und Bewohnende weitergegeben:
„Wenn ein Bewohner neu kommt, tust du 14 Tage lang eine so genannte Beobachtungsphase machen. Das heisst, in diesen 14 Tagen musst du alles einschreiben in die Pflegedok, was du bei den Bewohnern machst. [...] Das gibst du dann in den Computer ein. Und anhand von dem, was du eingegeben hast, wird dir eine Pflegestufe errechnet.“ (Elisabeth Jung).
Diese Stufe ist dann entscheidend für Anzahl Minuten, die pro Tag für die Pflege eines
Bewohners, respektive einer Bewohnerin aufgewendet werden: „Das heisst, unter dem
Strich, pro Stufe hast du zwanzig Minuten. Davon sind zehn Minuten direkte Pflege und
zehn Minuten indirekte Pflege. Das heisst, zehn Minuten bist du am Bett und zehn
Minuten am Schreiben“, erklärt Isabelle Fuhrmann, welche seit Jahren als Teamleiterin
arbeitet. Der Rest wird nicht als Pflege vergütet, sondern als Betreuung von den
Bewohnenden selbst bezahlt. Die durch das Gesetz eingeführte Trennung von Pflege
und Betreuung ist den Pflegekräften deutlich bewusst und wird von ihnen schrittweise
verinnerlicht, wie sich am Beispiel von Nadja Engel, welche zur Zeit in Ausbildung zur
Pflegefachfrau HF ist, zeigt:
„Unterdessen ist für mich Pflege fast nur noch der Körperpflegeteil, auch der Medizinaltechnische. Während Betreuung für mich halt alles andere ist. Eben, Gespräche führen oder mal spazieren gehen oder von mir aus, muss ja kein Spaziergang sein, von mir aus kann man die Leute einfach mal nach draussen setzen, und wir kommen euch dann wieder abholen“.
Der Wandel der Arbeitswelt ist weit vorangeschritten und der Beruf der Pflegekräfte
ändert sich. Viele der Veränderungen werden von den Pflegekräften als problematisch
empfunden.
6.1.1 Zeitdruck, zu wenig Personal und Sparen
Als prägende Veränderung in der neuen Arbeitswelt wird oft angegeben, „dass wir [die
Pflegekräfte] zu wenig Zeit haben für die Leute“ (Elisabeth Jung). Die Zeiten, welche
durch die Pflegefinanzierung definiert werden, sind zu knapp bemessen:
„Das Problem ist, es geht einfach nicht auf. Es liegt zeitlich nicht drin, wenn ich um Sieben mit den Medis anfange, bin ich, wenn es gut kommt, um zwanzig nach Sieben fertig, und dann gehe ich davon aus, dass kein einziger Patient noch ein Wort mit mir wechseln will, oder irgendetwas. Wo ich einfach die Tabletten hinstellen kann und ‚Adieu‘“ (Nadja Engel).
Das beschriebene enge Zeitkorsett bedeutet für viele Pflegekräfte einen grossen
Druck. Wenn sie das Zeitbudget nicht einhalten, werden sie nicht selten kritisiert. Die
Pflegefachfrau Tanja Birnstiel beschreibt:
„Das heisst dann einfach [...] ich bin zu langsam. Und wenn ich irgendwie um Zehn am Morgen, also nach drei Stunden, drei... nein, vier Bewohner gewaschen und angezogen und aufs WC begleitet und Zähne geputzt und sie zum Frühstück gebracht habe und so, und vielleicht noch einen Moment mit ihnen geschwatzt und vielleicht noch zwei, drei andere, die im Gang so prekär gelaufen sind, geschaut habe, dass die nicht umfallen, dann war das einfach zu wenig. Und die haben gefunden, das ist langsam.“
Seite 55
Privatisierungen und Personalabbau als Teil der durchdringenden Ökonomisierung der
stationären Alterspflege manifestieren sich für die Pflegekräfte im erlebten Zeitdruck.
Diese Privatisierungen sind mit Personalabbau und zusätzlichem Stress verbunden,
wie beispielsweise Luca Michel berichtet:
„Als unser Heim privatisiert worden ist. Also wo es von der Stadt privatisiert worden ist. Vorher haben wir noch viel mehr Personal zur Verfügung gehabt und auch noch viel mehr Zeit gehabt mit den Leuten. Also da haben wir noch Zeit gehabt, am Sonntag spazieren zu gehen und so. Und als das dann geändert hat, ist ein sehr grosser Umbruch gekommen.“
Dieses Sparen beim Personal veranschaulicht die Pflegehelferin Tamara Wüthrich mit
einem Beispiel aus eigener Erfahrung:
„Also 18 Bewohner, und wir sind fünf Leute gewesen, die zu denen geschaut haben. Und dann, nach einem halben Jahr, hat sich das Pflegegesetz geändert, und dann sind zwei Abteilungen zusammengeschlossen worden. Dann sind dann plötzlich statt 18 Leute 33 oder 34 Bewohner gewesen und immer noch fünf Angestellte. [...] Und immer noch gleich viel Zeit. Das hat man dann wirklich extrem gemerkt.“
Auch während den Nachtschichten ist immer weniger Personal für laufend mehr
Bewohnende zuständig. Das führt dazu, das Bewohnenden vertröstet werden müssen:
„Und dann müssen wir einfach sagen, nein, gute Frau oder guter Mann, aber erstens
sind wir nur zwei Personen in der Nacht, es sind 87 Bewohner“ (Maria Tschanz).
Aufgrund von Personal- und Zeitmangel fehlt oftmals die Möglichkeit für betreuerische
und aktivierende Tätigkeiten, welche früher vorhanden war, führt Jasmin Müller aus,
welche seit über 40 Jahren als Pflegefachfrau arbeitet:
„Ich mag mich mal erinnern, ich bin mal auf einer Abteilung gewesen, mit 12 oder 13 Heimbewohnern, und wir sind auf jeder Schicht vier Leute gewesen. Und wir haben dort auch nicht nur Schwerstpflegefälle gehabt. Dort haben wir wirklich noch Zeit gehabt für im weitesten Sinne Ergotherapie, Aktivierung usw. mit den Bewohnern zu machen. Das ist unvorstellbar, undenkbar heutzutage“.
Sparen ist heute ein omnipräsentes Thema in vielen Alters- und Pflegeheimen.
Gespart wird überall, nicht nur beim Pflegepersonal:
„Einfach schon beim Materialverbrauch fängt das an. Zum Beispiel fängt es an bei den Einlagen. Unsere Pflegedienstleitungs-Stellvertretung ist für das Inkontinenzmaterial zuständig. Und es ist ja klar aufgeschrieben, welche Bewohner haben welches Inkontinenzmaterial. Und dann wird das auch genau ausgerechnet, wieviel Einlagen darf sie am Tag und in der Nacht verbrauchen. [...] Jetzt muss aber nur mal irgendetwas sein, dass vielleicht eine Bewohnerin eine Blasenentzündung hat, und das läuft ständig. Dann brauchst du mehr Einlagen. Plötzlich hast du keine Einlagen mehr, oder nicht mehr die Grösse“ (Maria Tschanz).
Oder es gibt Einsparungen beim Essen für die Bewohnenden:
„Das ist von... dass man schaut, dass man möglichst billige Produkte einkauft. Dass man... [...] vom Essen her sicher nicht mehr, das denke ich, ist keine ausgewogene Ernährung, die die Leute bekommen in einem Alters- und Pflegeheim. Sondern billige Ernährung“ (Jasmin Müller).
Von manchen Pflegekräften wird die neue Arbeitswelt mit den engen Zeitbudgets
respektive Zeitkorsetts als eine Art der Fabrikarbeit wahrgenommen:
„Ich habe mal temporär drei Monate in der Nahrungsmittelindustrie gearbeitet. Und dann stehst du wirklich am Fliessband, tust die Käsestückchen sortieren [...]. Irgendwann habe ich angefangen, auf die Uhr zu
Seite 56
schauen, wie viele kommen in fünf Minuten, dann habe ich angefangen, zu rechnen, wie viele kommen in einer Stunde. Und manchmal, eben auf der Pflege, wenn du wirklich so viele Leute zu machen hast und so [...] hat es ein bisschen etwas wie Fliessbandarbeit, oder. Bist beim einen, tägg bumm schnell hopp, gehst zum Nächsten, tägg bumm schnell hopp“ (Tamara Wüthrich).
Die Arbeit wird gemäss Christine Fitze „aufgestückelt“. Dies wird von Gewerkschafter
Stern bestätigt:
„[Es werden] arbeitszählige Schritte ein geführt, die zeitbasiert sind, die eigentlich den Menschen an und für sich nur noch zu einem Produkt verkommen lassen, wo man so schnell als möglich einen Schritt vollziehen muss, damit man diesen Schritt schlussendlich in einem Kästchen erfassen kann, das relevant wird für [...] die, die das Geld geben“.
Passend zu dieser Entwicklung ist ein Wandel in der höchsten Führungsebene in den
Alters- und Pflegeheimen. Die Heimleitungen sind heute eher Manager oder
Betriebswirte und keine Pflegefachleute mehr, wie die langjährige und aus der Pflege
kommende Magdalena Christen erklärt:
„Nein, nicht aus der Pflege. Sei es KV, sei es Betriebswirtschaft. Das ist heute ein Management. Weil ich bin eidgenössisch-diplomierter Heimleiterin. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt heute Betriebsleiter, oder Geschäftsleiter, oder fragt mich doch nicht, ich weiss nicht, wie man denen allen noch sagt.“
Die neuen Manager werden als Heimleiter genau wie der Spardruck und die knappen
Zeitbudgets als befremdlich und nicht zur stationären Alterspflege gehörend
wahrgenommen und prägen den Alltag der Pflegekräfte.
6.1.2 Administration, Dokumentation und Kontrolle
Während die Zeit mit den Bewohnenden für Pflege und Betreuung abnimmt, nimmt die
Zeit, welche die Pflegekräfte im Büro für administrative Tätigkeiten, Dokumentationen
und Kontrollen brauchen, zu. Dies geht einher mit dem Gefühl kontrolliert zu werden.
Maria Tschanz beschreibt diese Zunahme der Dokumentationsaufgaben wie folgt:
„Das Aufschreiben nimmt eben leider sehr viel Zeit in Anspruch. Ich weiss, es ist wichtig. Aber wenn ich es so vergleiche mit früher, hat man halt schon mehr Zeit gehabt für die Bewohnerinnen und Bewohner, Patienten. Was ich jetzt eben heutzutage bedauere, dass man nicht mehr so Zeit hat für die Bewohner.“
Heimleiterin Christen spricht von einem eigentlichen „Dokumentationswahn“, der
massiv zunimmt. Isabelle Fuhrmann, welche in der Funktion einer FaGe in
Tagesverantwortung arbeitet, gibt das Verhältnis Administration und direkte Pflege wie
folgt an: „Auf einen Tag würde ich sagen, [...] viel mehr Schreibarbeiten als am Bett
oder beim Bewohner zu sein, sicher [...] 70:30.“ Auch Pflegeassistenzen und -hilfen
verbringen mehr Zeit mit der Dokumentation ihrer Arbeit:
„Und dann hat jeder Bewohner einen Massnahmenkatalog. Das heisst, Massnahmen, das ist eine sehr lange Liste, die man abhaken kann. Auf dieser Liste sind zum Beispiel, schon nur vom Morgen, sind drauf [...] Zeit, Datum nennen; Massnahmen der Tagesverfassung anpassen; Auf die Toilette setzen; von der Toilette wieder wegnehmen; Gebiss reinigen; Mund spülen; Ganzkörperpflege; Intimpflege; Einlagen wechseln. Es ist wirklich eigentlich jeder Handgriff, den man machen muss bei dem Bewohner, ist dort drauf und muss dokumentiert werden“ (Tamara Wüthrich).
Seite 57
Die Dokumentation und Administration wird vor allem für die Krankenkassen gemacht,
welche regelmässig Kontrollen durchführen:
„Lustigerweise gehen sie ja meistens nicht zum Bewohner. Was noch schade ist. Die schauen einfach anhand der Einträge, der Dokumentationen, ob das übereinstimmen könnte mit der Pflegestufe. Und stellen dann auch solche Fragen“ (Elisabeth Jung).
Ebenso müssen Teamleitungen und tagesverantwortliche Pflegekräfte zusätzliche
Aufgaben in der Kontrolle übernehmen:
„Und ich, ich habe mich auch, oder fühle mich auch heute nicht so wohl in dieser Rolle, als Kontrolleur oder so. Ich habe nie Polizist werden wollen, und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, sei ich. Und das ist nicht so mein.“ (Nadja Engel).
Schliesslich nimmt auch die Kontrolle der Mitarbeitenden untereinander zu, zum
Beispiel ob andere Pflegekräfte das Zeitbudget einhalten: „Also die Mitarbeiter selber
sind ja noch ein gutes Instrument [zur Kontrolle. ...] Also es ist eigentlich ein recht
deftig gewesenes Kontrollinstrument“ (Tanja Birnstiel). Diese gegenseitige Kontrolle
wird, wie der zunehmende administrative Aufwand für die Dokumentationen, als grosse
Last wahrgenommen.
6.1.3 Digitalisierung
Ein grosser Wandel in der Arbeitswelt entstand durch den gesteigerten
Dokumentations- und Kontrollaufwand auch hinsichtlich der technischen Hilfsmittel. Es
findet eine starke Digitalisierung statt. In immer weniger Alters- und Pflegeheimen
werden die Pflegedokumentationen und Bewohnendendossiers noch handschriftlich
geführt. Vielmehr wird heute der Computer eingesetzt, da es kaum mehr anders geht:
„Weil [...] das ist einfach ein Krieg. [...] Heute, wo man für alles irgendeinen Beleg braucht oder ein Rezept und jedes Pflaster abrechnen muss, hast du so viele Dokumente, du kannst das fast nicht mehr alles in einer handgeschriebenen Pflegedokumentation unterbringen“ (Nadja Engel).
In der Mehrheit der Alters- und Pflegeheime müssen Pflegekräfte sämtliche
Tätigkeiten, Vorkommnisse, Belege etc. digital erfassen oder es in naher Zukunft tun.
Diese digitale Erfassung kann mit einem PC, Laptop oder über ein tragbares Gerät
geschehen:
„Der Computer kommt jetzt dann, wir bekommen dann ein Gerät, das wir quasi auf uns tragen, wie im Service, wo man sieht, was man bestellen kann. Und dann tut man dann einfach beim Heimbewohner, Zimmer sowieso, tut man abrechnen, was man gemacht hat oder eben nicht gemacht hat aus dem Betrieb“ (Jasmin Müller).
Selbst ältere Pflegeassistentinnen müssen sich heute mit dem Computer arrangieren:
„Also Computer hat mich mehr gestresst. Es sind vielleicht zwei Laptops, und dort sollte jede einschreiben, oder, und das ist ein bisschen mühsam. [...] Oder aber jetzt wollen sie es umstellen, sie haben das Gefühl, es werde einfacher und besser. Für mich jetzt nicht, ich bin halt nicht ein Computerfreak, ich bin auch nicht mit dem aufgewachsen“ (Sabine Kurz).
Seite 58
Die Computerprogramme dienen nicht nur der Dokumentation. Sie berechnen
beispielsweise nach einem Assessment die Pflegestufe des Patienten und damit die
Zeit, welche die Pflegekräfte bei diesem verbringen dürfen: „Und das machst du 14
Tage lang, und das gibst du dann in ein Computer ein. Und der spuckt dir dann so eine
Pflegestufe aus.“ (Isabelle Fuhrmann). Einige Programme übernehmen heute für die
Pflegekräfte anhand der gemachten Eingaben bereits die Pflegeplanung: „Wenn du
etwas eingibst, zum Beispiel, ja, was dem Patienten fehlt, dann stellt es eigentlich
gleich, gibt der Computer gleich so Pflegeprobleme und -lösungen“ (Tanja Birnstiel).
Und die Digitalisierung geht weiter. So arbeiten die ersten Heime bereits mit
Strichcodes zur Dokumentation der Leistungen, wie man es beispielsweise aus dem
Detailhandel kennt:
„Und dann gibt es noch die Heime, das ist noch ‚ganz verreckt‘, die haben pro Bewohner einen Strichcode. Und das Zimmer hat auch den Strichcode. Und jedes Mal, wenn Sie in das Zimmer gehen, tun sie abcoden, wie in der Migros, und dann hat es darunter noch Leistungen, die Sie auch gleich erfassen. Dann haben Sie die Leistung erfasst plus die Zeit“ (Magdalena Christen).
Der Pflegeberuf wird damit Schritt für Schritt von der Digitalisierung in Beschlag
genommen. Die Computer bestimmen, wenn auch in unterschiedlichen Umfang, den
Alltag der Pflegekräfte. Das Bedienen dieser Geräte ist eine neue Fähigkeit, die zum
Beruf gehört.
6.1.4 Arbeitsteilung und Hierarchie
Was sich ebenfalls stark verändert hat in den letzten Jahren, ist die Arbeitsteilung der
Pflegekräfte untereinander. In den 1990er Jahren wurde teilweise sogar noch die
Hauswirtschaft von den Pflegekräften erledigt: „Und als ich angefangen habe, haben
wir alle alles gemacht. Das heisst, ich habe nie gekocht. Aber sonst haben wir alle alles
gemacht. Also wir sind alle in die Küche helfen, wir sind alle in die Waschküche helfen,
im Hausdienst“ (Magdalena Christen). Heute gibt es hingegen nicht nur eine klare
Arbeitsteilung zwischen den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft, sondern auch
zwischen den Pflegekräften untereinander:
„Früher hat es, also die Hierarchiestufen hat es auch gegeben, das ist klar, aber das ist kein Problem gewesen. [...] Weil die Teilung ist mittlerweile ganz krass. Also pflegen tut heute in der Regel die Pflegehelferin und Pflegeassistentin. Und die anderen, die rennen einfach mit Medikamenten herum und mit Spritzen und mit Verordnungen und mit Bestellungen und mit Arztvisiten und Telefon und hier und da und dort. Ja. Das ist das. Du stehst nicht mehr häufig am Bett, als Pflegefachfrau“ (Jasmin Müller).
Die Betreuung und Grundpflege wird heute mehrheitlich von den Pflegeassistenzen
und -hilfen erbracht. Bei der Betreuung bedeutet dies:
„Also normalerweise sind das Aufgabe, die von den Pflegeassistenten und Pflegehelfern und auch Lernenden übernommen werden. Spaziergänge. Beschäftigen mit den Bewohnern. So etwas halt. Oder einfach nur mit dem Bewohner in die Cafeteria mal runter gehen. Bei schönem Wetter draussen auf der Terrasse sitzen. Einen Kaffee nehmen“ (Dagmar Polzin).
Seite 59
FaGe und Pflegefachfrauen HF machen hingegen Behandlungspflege, Führung und
Dokumentation und verbringen damit viel weniger Zeit mit den Bewohnenden:
„Also es ist so, dass die Hauptlast der Grundpflege von Pflegegehilfen gemacht wird, also angelerntem Personal [...] das eine Schnellbleiche gemacht hat, vom Roten Kreuz, oder zum Teil FaGe noch. Und die wirklich gut ausgebildeten Fachleute, die sind in der Kaderposition, die tun Pflegeplanung machen, die tun, ja, die Assessments machen, die geriatrischen Assessments, die Fragebögen ausfüllen. Und die teilen ein und sagen den Leuten, was sie machen müssen. Und machen die Behandlungspflege, komplizierte Sachen, Verbände, komplizierte Medikamentenabgabe usw. Aber das heisst, mehr und mehr, also die Hauptlast der Grundpflege wird von nicht sehr gut ausgebildeten Leuten, also angelernten Leuten, gemacht“ (Christoph Uetz).
Zwischen den FaGe und den HF ist in der stationären Alterspflege noch ein Prozess
zur endgültigen Arbeitsteilung im Gange. Oftmals übernahmen seit 2011 die sekun-
dären FaGe vollständig die Aufgaben von Personen mit einem tertiären Berufs-
abschluss in einem Pflegeberuf:
„Es gibt Orte, wo die FaGe als Zweitklassenpflegende behandelt werden. Und prinzipiell ist das Nonsens. Weil in den meisten Bereichen der Langzeitpflege Fachangestellte Gesundheit sind genauso gut wie die hoch ausgebildeten Bachelor of Nursing oder Master of Nursing. [...] Aber die braucht es für Studienleitungen, für kompliziertere Sachen und für höhere Kaderfunktionen. Und ich denke, dass die FaGe idealerweise, wir haben ganze Abteilungen gebildet nur mit FaGe. Und wo alles von den FaGe gemacht wird“ (Christoph Uetz).
Die unklaren Profile für FaGe und Pflegefachpersonen HF führen zu einem steten
Spannungsfeld, wie beispielsweise der Rektor einer Höheren Fachschule, Lorenz
Eggenschwiler, anfügt:
„Es gibt auch verschiedene Modelle, wobei, was ich ganz sicher auch sage, dort gibt es Klärungsbedarf. In der Tradition hat man ja zum Teil sogar Diplomierte und FaGe einfach genau gleich eingesetzt. Und das finde ich geht auch nicht. Du musst wirklich ein differenziertes Einsatzprofil haben, für die HF und für die FaGe. Und du musst auch interessantere Aufgabe haben können, wenn du als Arbeitgeber attraktiv sein willst für eine Diplomierte. Du musst der auch aufzeigen können, was sie da für Aufgaben, anders als eine FaGe, wahrnehmen können“ (Lorenz Eggenschwiler).
Nadja Engel, welche als FaGe die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF macht, reflektiert
über ihren erlernten Beruf:
„FaGe ist eine relativ praktische Erfindung gewesen, gerade für die Langzeitinstitutionen. Weil man einerseits immer ein wenig Mühe gehabt hat, um überhaupt diplomiertes Personal zu finden, andererseits kostet aber die FaGe auch wesentlich weniger. Also FaGe kostet etwa einen Tausender weniger als die Diplomierte. Und für die FaGe ist halt gewesen, da sie im Spital nicht wahnsinnig viel zu sagen hat, arbeitet sie nur als Hilfspersonal. In den Langzeitinstitutionen kann sie volle Verantwortung übernehmen.“
Rektor Eggenschwiler sieht in der zunehmenden Differenzierung starke
„Arbeitgeberinteressen“, welche sich auch in der Ausbildung niederschlagen und zu
einer stärkeren Spezialisierung der Personen auf der tertiären Stufe wie den
Pflegefachpersonen HF führt. Diese Entwicklung ist genauso wie die Arbeitsteilung
zwischen den einzelnen Stufen ein neues Element der Ökonomisierung der
Arbeitswelt. Die Arbeitsteilung führt zu neuen Berufsinhalten, verschiebt andere und
wird von den Pflegekräften kritisch beäugt.
Seite 60
6.1.5 Arbeitsbedingungen
Bei den Arbeitsbedingungen lässt sich insbesondere in den Bereichen Arbeitszeiten
und Einsätze eine starke Flexibilisierung feststellen. Geteilte Dienste, also
unzusammenhängende Arbeitseinsätze am selben Tag, nahmen in den letzten Jahren
massiv zu:
„[...] dann finden sie einfach, die Leute müssen halbe Dienste machen. Und jetzt, wenn ich gekommen bin, hat es geheissen, ja, die Hälfte der Dienste müssen etwa halbe Dienste sein. Und schlussendlich habe ich einfach nur halbe Dienste gehabt. Und das heisst einfach, [...] du bist an gleich vielen Tagen anwesend wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Und entweder so, dann halbe Dienste, oder geteilte Dienste, [...] der Dienst ist einfach immer dann, wenn die meiste Arbeit anfällt“ (Tanja Birnstiel).
Gleichzeitig wird von den Verantwortlichen in den Alters- und Pflegeheimen oft mit zu
wenig Personal kalkuliert. Das führt dazu, dass viele Pflegekräfte nicht selten kurzfristig
einspringen müssen und die Pläne auch unterhalb der gesetzlichen Frist von zwei
Wochen erneut geändert werden:
„Also wir bekommen [...] Montag ist der Plan, vielleicht zwei Tage, bevor er anfängt, bekommen wir den ausgehändigt. Er wird auch einfach umgeändert, also man kommt her, schaust schnell drauf, ah, eigentlich hätte ich morgen frei gehabt, jetzt habe ich nicht frei, ja gut, fragen wäre eine Idee, aber das finden sie nicht nötig. Es wird einfach über einen verfügt“ (Tamara Wüthrich).
Gleichzeitig wird die Teilzeitanstellung zum Normalfall. Wegen dem zunehmenden
Druck und Stress des Pflegeberufes einerseits und der Attraktivität der geteilten
Dienste für die Arbeitgeber andererseits, werden 100 %-Stellen immer seltener:
„Ja, es gibt noch so vereinzelte. Aber die, die sind natürlich... fallen von einem Burnout zum anderen. Haben regelmässig ihre Kranktage. Sie haben null Nerven mehr für die Heimbewohner. Und klar, das ist... das merkt man gut. Dort ist, gerade bei den Hochprozentigen, habe ich das Gefühl und den Eindruck, und auch, wie sie reden, der ist einfach für die nur noch lästig“ (Jasmin Müller).
Neben der Zunahme von Burnouts fallen auch der Anstieg von Fluktuationsraten und
Berufsaussteigerinnen in der stationären Alterspflege ins Auge:
„Also de facto, auf Betriebsebene, wenn man die Zahlen anschaut, haben wir relativ viele Leute, die den Job wechseln. Die nicht umgehen können, auf die Länge, mit dieser Dissonanz. Man hat eine nicht allzu lange Verweildauer. Das wiederum führt natürlich dazu, dass man auch Personalmangel hat. Das andere ist, man merkt so, und es sind grösstenteils Frauen, die in diesen Jobs arbeiten, dass sie nach ihrer Familienpause gar nicht mehr einsteigen“ (Andreas Stern).
All dies führt zu negativen Auswirkungen auf das Privatleben der Pflegekräfte:
„Es ist halt schon so, seine Hobbies, wenn man ein Hobby hat, geht das halt schon ein bisschen in den Hintergrund. Man kann nicht mehr jeden Dienstag in einen Turnverein. Weil dann hat man Spätdienst, man hat Nachtwache. Oder ich bin noch im Samariterverein und mache noch, bin Kursleiterin und technische Leiterin. Gebe Kurse, gebe Übungen, und da muss ich manchmal fast ein wenig darum kämpfen, dass ich frei bekomme dafür. Es wird nicht so Rücksicht genommen darauf“ (Maria Tschanz).
Ebenfalls sind viele Personen „total erschöpft“ und „ausgelaugt nach der Arbeit“ und
haben kaum mehr Kraft für soziale Kontakte (Dagmar Polzin). Auf der monetären
Ebene gibt es Kritik an der ungenügenden Lohnentwicklung. Die Löhne sind in den
letzten Jahren kaum angestiegen. Die Löhne des Assistenz- und Hilfspersonal stehen
Seite 61
sogar unter Druck nach unten. So stellt sich beispielsweise die Pflegefachkraft Tanja
Birnstiel in der Lohnfrage das ideale Lohngefüge vor:
„Ich würde sicher allen genug Lohn zahlen... Also ich würde sicher schauen, dass die Unterschiede in den verschiedenen Berufsgruppen nicht so gross sind. Also zwischen den verschiedenen Ausbildungen, sage ich einmal. Es ist ja gerade in den Altersheimen arbeiten ja viele mit einem SRK-Kurs. Das ist ja eigentlich so eine dreimonatige Ausbildung. Und die arbeiten meistens zum Mindestlohn. Also für 4'000 Franken“.
Verglichen mit der Zunahme der Kosten im Gesundheitswesen hätten die Löhne bei
einer parallelen Entwicklung stark ansteigen müssen. Dies würde auch die Attraktivität
des Berufes steigern, merken mehrere Personen an: „Und es braucht auf der Ebene
der Zuschläge und der Löhne eine massive Bewegung“ (Andreas Stern). Grundsätzlich
gilt festzuhalten, dass die Arbeitsbedingungen durch die Ökonomisierung eher prekärer
geworden sind.
6.1.6 Spielraum vorhanden?
Für die Interviewten war klar, dass es einen relativen Gestaltungsspielraum für die
Alters- und Pflegeheime gibt. Wie gross der ist, darüber ist man sich uneinig. Isabelle
Fuhrmann denkt dazu, „dass trotz allem was passiert, was heute ist mit dem ganzen
Krankenkassenabrechnungssystem und so, dass es sicher gute Arbeitsorte gibt.“
Pflegefachfrau Müller widerspricht dem: „Gut, ich muss gleich ehrlich sagen, ich kenne
viele Heime, ich habe einen grossen Bekanntenkreis in der Pflege. Was ich mir jetzt als
gut vorstellen würde, hab ich schon seit Langem nicht mehr gehört, dass es das noch
gibt.“ Rektor Eggenschwiler hingegen weist darauf hin, dass für einige Unternehmen
die stationäre Alterspflege ein gutes Geschäft ist: „Also die verdienen Geld. Also das
heisst, es kann nicht so sein, dass das Geld nicht reichen würde. Also wenn man einen
Gewinn herausnehmen kann, dann kann man das ja offenbar mit diesen
Rahmenbedingungen eigentlich recht gut geschäften.“ Die erfahrene
Gesundheitspolitikerin Fitze kann aufzeigen, dass es Alters- und Pflegeheime gibt,
welche bessere Arbeitsbedingungen anbieten als die öffentliche Hand, und: „Es gibt
sehr viele Best Practices und Ideen, die man verwirklichen kann.“ Auch
Gewerkschafter Stern meint, dass es Arbeitgeber gibt:
„die sich in den Rahmenbedingungen probieren, so zu verhalten und auch zu handeln, dass es für die Menschen, die dort arbeiten, so angenehm wie möglich ist. Das gibt es sicher. Klar, da gibt es Arbeitgeber, die probieren, innerhalb dieses Rahmens, ihr Möglichstes zu machen, und einigermassen menschenwürdige Arbeitsbedingungen anzubieten.“
Trotz des angetönten Spielraumes sind die Veränderungen der Arbeitswelt durch die
Ökonomisierung für die Pflegekräfte deutlich sichtbar. Sie treten in unterschiedlichen
Intensitäten und Umfang auf. Die Zerstückelung der Pflege in einzelne
medizinaltechnische Schritte mit Zeitbudgets ohne psychosozialen und betreuerischen
Anteil und der andauernde Spardruck sind überall feststellbar. Dadurch haben die
Seite 62
Pflegekräfte viel weniger Zeit, welche sie mit Pflege der Bewohnenden verbringen.
Gleichzeitig nimmt der zeitliche Aufwand für administrative Arbeiten, Kontrollen und
Dokumentationen zu Handen der Krankenkassen zu. Zu diesem Zweck halten nach
und nach digitale Dokumentations- und Kontrollprogramme Einzug in die Alters- und
Pflegeheime. Massiv gestiegen ist auch die Arbeitsteilung unter den Pflegekräften
entlang der Stufen ihrer Ausbildung. Schliesslich sind die Arbeitsbedingungen von
Prekarisierung bedroht. Kein Wunder, dass einige Pflegekräfte ihren Beruf infolge der
Ökonomisierung kaum mehr wiedererkennen.
6.2 Widersprüche zwischen Berufsethos und ökonomisierter Arbeitsweise
Um das Ethos der Pflegekräfte zu verstehen, ist es wichtig nachzuvollziehen, was gute
Pflege für Pflegekräfte in der stationären Alterspflege bedeutet. Elisabeth Jung bringt
dies auf den Punkt:
„Gute Pflege... Für mich wäre das wirklich, wenn ich Zeit hätte für die Bewohner. Wenn ich mir Zeit nehmen könnte, wenn ich wüsste, es sind noch fünf andere am Pflegen, und ich kann mir hier für den Bewohner Zeit nehmen. Die Frau, wo ich jetzt das Gefühl habe, die will nicht duschen heute, sondern die will über ihre Vergangenheit reden, dann könntest du vielleicht zuerst eine halbe Stunde mit ihr über die Vergangenheit reden, und dann doch noch duschen, weil sie nach einer halben Stunde doch noch das Gefühl hat, sie möchte duschen.“
Gute Pflege hat, das haben alle Interviews mit Pflegekräften sowie die teilnehmenden
Beobachtungen gezeigt, mit genug Zeit und der Individualität und dem Wohlergehen
der Bewohnenden zu tun. Die Bewohnenden sollen glücklich sein und im Mittelpunkt
stehen. Pflege wird dabei nicht nur medizinaltechnisch verstanden, sondern
gesamtheitlich. Betreuung, Emotions- und Gefühlsarbeit spielt dabei eine wichtige
Rolle. Diese fehlt heute für viele Pflegekräfte, um von einer guten Pflege sprechen zu
können. So meinte beispielsweise Isabelle Fuhrmann in Bezug darauf was gute Pflege
brauche: „Das ist für mich mehr Betreuung, und das findet nicht statt. Also die Leute
sind eigentlich auf der Ebene, auf der psychosozialen Ebene, sind sie einfach sich
selbst überlassen.“ Tanja Birnstiel geht bei ihrer Definition noch stärker auf das
Wohlbefinden der Bewohnenden ein:
„Pflege an und für sich ist [...], wie soll ich jetzt sagen, [...] es ist so die Vermittlung des Wohlbefindens, wenn sich das jemand selber nicht mehr kann. Einfach dort in denen Bereichen halt unterstützen, wo es mangelt. Dass jemand leben kann und sich wohl fühlt.“
Gute Pflege ist nicht nur etwas Kurzfristiges, sondern auf eine längerfristige Beziehung
zwischen der Pflegekraft und den Bewohnenden angelegt:
„Man baut ja eine Beziehung auf, in der Langzeitpflege vor allem, man lernt einander kennen. Und das ist eben wirklich, also, es gibt auch viel wirklich gute Gespräche mit den Bewohnern, und ja, irgendwie, wie soll ich sagen, sie wachsen einem ans Herz. Und das ist dann eben auch das Schöne. Und man will ihnen etwas Gutes tun. Ich will, dass es den Bewohnern gut geht und ich tue wirklich auch mein möglichstes, was ich kann, dass es ihnen gut geht, oder“ (Tamara Wüthrich).
Seite 63
Eng verbunden bleiben die Pflegekräfte nach wie vor mit der Idee des Helfens:
„[...V]iele Pflegende haben eigentlich das Gefühl, sie wollen helfen, und dann kannst
du doch nicht einfach die [Bewohnenden] im Stich lassen. [...] Vielleicht habe ich ein
Helfersyndrom (lacht)“ (Sabine Kurz). Einige Interviewten versuchten auch, ihr
Berufsethos selbst zu definieren. Nadja Engel zitiert dazu die internationalen ethischen
Grundsätze des Pflegeberufes: „Aber wir arbeiten eigentlich schon mit den Tugenden
[...]. Nicht schaden, Gutes tun... Gerechtigkeit und nochmal irgendwas... sie haben
noch mal einen... Autonomie [...].“ Oder kurz auf den Punkt gebracht von Dagmar
Polzin: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass das Erbringen von einer gesamtheitlichen, qualitativ guten Pflege im
Mittelpunkt des Berufsethos steht und die Pflegekraft sich dazu dem Wohlergehen der
Bewohnenden unterordnet.
Wieso üben aber die Pflegekräfte ihren Beruf aus? Der Beruf in der stationären
Alterspflege wird gemäss den interviewten Personen wegen der Beziehungen und
Emotionen rund um die Arbeit mit den Bewohnenden gewählt:
„Weil sehr viel zurückkommt. Wenn ich herkomme, und es heisst, [...] ich habe 14 Tage Ferien gehabt, oh schön, sind Sie wieder da, und jetzt geht die Sonne auf, wenn Sie ins Zimmer kommen. Das ist das, was mich... oh nein, das ist doch schön, oder! [...] Ich sage immer, wenn ich ins Zimmer komme, und der im Bett oder die im Bett sagt, ‚Jetzt kommt noch die‘, dann höre ich auf, dann ist etwas nicht mehr gut für mich. Dann geht es nicht mehr. Klar sind die nicht immer gut aufgelegt, und so. Aber es geht ihnen vielleicht schlecht. Und wenn ich drin war, und ich herausgehe, möchte ich, dass es ihnen wenigstens ein bisschen besser geht. Also sie sind nicht gesund, ich habe nicht Illusionen. Aber wenigstens fühlt er sich besser, vielleicht tut ihm der Rücken nicht mehr weh, vielleicht tut ihm das Bein nicht mehr weh... Vielleicht habe ich ihm ein Kaffee bringen können, irgendetwas habe ich tun können“ (Sabine Kurz).
Die direkte Interaktion mit den Bewohnenden ist bei der Arbeit für die Pflegekräfte
wichtig:
„Einfach die Bewohner, die mir, wie gesagt, viel geben. Und wir nehmen uns manchmal auch in die Arme. Es gibt Bewohner, die mich umarmen. Ich habe auch schon mal einen Kuss auf die Wange bekommen. [...] Man erlebt auch lustige Sachen, über die man lachen kann, auch mit den Bewohnern, wo man wirklich herzhaft mit ihnen lachen kann. Und das ist doch das Schöne“ (Maria Tschanz).
Beziehungen müssen dabei aufgebaut und gepflegt werden. Dabei geben die
Pflegenden auch einen Teil ihrer selbst zum Wohl der Bewohnenden:
„Ich kann immer noch ein Stück von mir geben. Und sie so ein Stück weit glücklich machen und zufrieden machen. Und für mich ist einfach immer noch so ein Stück ganz ganz ganz ganz doll, toll, wenn sie zu mir sagen: ‚Dagmar, schön sind Sie da. Wenn Sie da sind, weiss ich, es funktioniert. ‘ Und ich fühle mich nicht alleine. Und das lässt mich eigentlich immer wieder aufstehen“ (Dagmar Polzin).
Den Bewohnenden kommt die höchste Bedeutung zu, sie sollen im Mittelpunkt stehen
und qualitativ gute Pflege erhalten. Das ist ein zentraler Bestandteil ihres Berufsethos.
Für viele Interviewte steht dies jedoch im Widerspruch mit der Ökonomisierung:
„Also ganz pauschal hätte ich gerne den Ökonomisierungsgedanken wieder weg von der Pflege. Ich wünschte mir, dass ich die Zeit hätte, am Tag, [...] auf jeden Patienten oder jeden Bewohner so einzugehen, wie er halt einfach ist. Und er individuell, und [...] nicht die zehn anderen, oder so. Ich glaube,
Seite 64
das wäre mein grösster Wunsch. Alles andere ist mir gleich. [...] Dass ich könnte, eigentlich, wenn es geht, jeden Abend heimgehen und das Gefühl haben, heute habe ich meine Arbeit gut gemacht. Und nicht, wie in 99 % der Fälle, hm, ist wieder nicht so toll gewesen heute“ (Nadja Engel).
Der zunehmende Stress, das fehlende Personal und die fehlende Zeit werden als
Verlust der Pflegequalität wahrgenommen: „Ich denke, wenn sie Personal sparen,
sparen sie bei der Qualität ein. Ganz automatisch. Ist sonst gar nicht möglich“
(Magdalena Christen). Dies bestätigt auch Luca Michel, der in Ausbildung zum
Pflegefachmann HF ist:
„Weil ich denke, schlussendlich, wenn man immer im Stress ist, irgendwann schraubt man so weit zurück, dass man einfach durch mag. Und dann leidet die Qualität, weil man eben so kleine Sachen, die auch gut tun würden, einfach ausblendet.“
Genauso werden die Normierung der einzelnen Arbeitsschritte und die Zeitbudgets als
Widerspruch zum eigenen Berufsethos wahrgenommen: „Eben, ich bin keine
Maschine. Ich kann nicht sagen, bei dem Bewohner habe ich jetzt zehn Minuten. Es
kommt ja immer auf seine Verfassung an“ (Maria Tschanz). Das Finanzierungssystem
wird von vielen Pflegekräften negativ gesehen. So schafft es falsche Anreize: „Wenn
eine Person im Rollstuhl sitzen würde statt selbst zu laufen. Dann würde mehr bezahlt
werden“ (Tanja Birnstiel). Solche Fehlanreize, wie Bewohnende im Rollstuhl zu pflegen
statt ihnen zu helfen selbstständig zu sein, widersprechen klar dem eigenen
Berufsethos. Oder wie Jasmin Müller es beschreibt:
„Also man nimmt sich nicht mehr Zeit, beim Duschen des Heimbewohners zum Beispiel, den zu aktivieren, zu motivieren, dass er sich selber wäscht. Weil ich bin viermal schneller, wenn ich es mache. Und wundere mich dann, nach drei Wochen, dass er sich gar nicht mehr das Gesicht waschen kann. [...] Man hat keine Zeit mehr für die Heimbewohner, ist ganz klar.“
Immer weniger erinnert an den ursprünglich gelernten Beruf, was zu inneren Konflikten
führen kann:
„Die eigentlich den Job auch gelernt haben und gemacht haben, weil sie für die Menschen etwas machen wollen, und so aber immer mehr zu Leuten verkommen, die Teil der Arbeitsteilung werden, so wie man das früher hatte in der Anfangszeiten der Industrie, oder jetzt teilweise immer noch hat. Und dass es natürlich einen riesengrossen Unterschied gibt zwischen Menschen, mit denen man zu tun hat, und Produkten“ (Andreas Stern).
Die Pflegekräfte sowie die Expertinnen und Experten sehen einen klaren Widerspruch
zwischen der Ökonomisierung und ihrem Pflegeethos und der Idee, wie gepflegt
werden sollte:
„Ich glaube einfach nicht, dass es funktionieren kann. Ich glaube nicht, dass irgendetwas mit Menschen, und insbesondere noch mit schwer kranken Menschen, das böse gesagt nur noch auf das Sterben hin gepflegt werden, dass das kann oder soll rentabel sein. [...] Das kann nicht funktionieren. Und sonst macht man Fliessbandarbeit, aber dann ist es nicht mehr... dann ist es nicht mehr patientenzentriert oder so. [...] Ich glaube, das ist ein Widerspruch als Ganzes. Es kann nicht rentabel sein“ (Nadja Engel).
Auch wird auf den Widerspruch des knappen Zeitkorsetts und der nötigen Emotions-
und Gefühlsarbeit hingewiesen. „Auf der einen Seite solltest du einfühlsam sein,
geduldig sein, alles. Und auf der anderen Seite verlangen sie speditives Arbeiten, Zeit
Seite 65
einhalten. Dort bin ich im Clinch“ (Maria Tschanz). Die Widersprüche werden als so
gross wahrgenommen, dass Pflegekräfte vor der Aufgabe stehen, inkompatible Dinge
miteinander zu vereinen:
„Weil es nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiss gar nicht, wie ich das erklären soll. Da fehlen mir die Worte. [...] Ich finde einfach, wir sollten nicht zu allem Ja und Amen sagen. Wir sollten... [...] was nicht geht wird gehend gemacht, sage ich immer“ (Dagmar Polzin).
Die Ökonomisierung und ihre Begleiterscheinungen führen dazu, dass sich der Beruf
verändert. Dadurch entspricht der Beruf nicht mehr der ursprünglichen Motivation:
„Ja, das ist ein Widerspruch. Weil ich denke noch heute, wenn man den Pflegeberuf lernt, hast du eigentlich immer noch die Vorstellung, [...] ich habe noch Kontakt. Ich kann jemandem im weitesten Sinne helfen. Ich kann für jemanden da sein. Ich helfe dann, ich mache, ich schaffe mit dem Patienten zusammen, Heimbewohner. [...]. Wenn sie wirklich Büro machen wollen, da machen sie eine KV-Ausbildung usw. Und ich kenne jetzt auch sehr viele, die den Beruf lernen, aber nicht drauf arbeiten. Eine HF-Ausbildung machen, aber nicht da drauf arbeiten“ (Jasmin Müller).
Der Widerspruch äussert sich auch bei der Ausbildung und der erlebten Pflegepraxis.
„Was haben wir gelernt... Das ist eben schon noch anders gewesen“ (Sabine Kurz).
Auch der Rektor der Höheren Fachschule sieht einen Widerspruch zwischen
Professions- und Arbeitgeberinteressen:
„Es hat so ein wenig, also auf einer übergeordneten Ebene würde ich noch ein wenig anders antworten. Es gibt Arbeitgeberinteressen und es gibt Professionsinteressen. Professionsinteressen im Sinne von Best Practice, was sind die Standards in der Pflege, was weiss man aus Evidence Based Nursing, was ist eigentlich... Was wäre eigentlich das Richtige, das zu tun wäre. Und die Arbeitgeberinteressen, die möglichst kostengünstig, möglichst effizient, wirklich nur gerade das, das wirklich nötig ist, und sicher nicht mehr – das sind so zwei Pole“ (Lorenz Eggenschwiler).
Die Politikerin Christine Fitze versucht die Widersprüche politisch zu verorten und sie
sieht sie nicht als Teil des Links-Rechts-Schemas sondern tiefer liegend: „Ich würde
nicht einmal sagen, es ist ein Links-Rechts-Graben, sondern es ist ein Kapital-
Menschen-Graben“. Die Widersprüche ziehen sich von der Ausbildung, zum
Berufseinstieg über das ganze Arbeitsleben hinweg. Alles in allem erleben damit die
Pflegekräfte bewusst einen grossen Widerspruch zwischen ihrem Berufsethos und der
Ökonomisierung. Pflege hat sich für sie am Wohl der Bewohnenden zu orientieren.
Dies ist durch die Ökonomisierung in manchen Bereichen nicht mehr der Fall und steht
im Widerspruch zum Berufsethos.
6.3 Reaktionen der Pflegekräfte auf die Ökonomisierung
Es zeigen sich unterschiedliche Arten von Reaktionen der Pflegekräfte auf die
Ökonomisierung der stationären Alterspflege. Nachfolgend werden die wichtigsten
aufgezeigt. Diese Reaktionen der Pflegekräfte können sowohl einzeln, als auch in
verschiedenen Kombinationen in Erscheinung treten.
Seite 66
6.3.1 Übernahme eines neuen Arbeitsstiles
Eine mögliche Reaktion ist die Übernahme eines neuen, der Ökonomisierung
angepassten Arbeitsstiles. Dieser beruht auf dem Einhalten der Zeitbudgets durch
schnelleres Arbeiten und dem Inkaufnehmen einer tieferen Pflegequalität:
„Wir sind zwangsläufig schneller, und auf der Strecke bleibt der Heimbewohner. [...] Jetzt geht man einfach durch, weiss genau, der hat dieses, jenes. Ein Bad, eine Toilette, Verband wechseln usw. Und das heisst einfach, dass die Arbeit ganz sicher flüchtiger gemacht wird. Schneller“ (Jasmin Müller).
Die pflegerischen Aufgaben werden gemäss den Vorgaben erfüllt, doch es zeigt sich,
dass es unterschiedliche Qualitäten gibt. Eine dem Zeitregime entsprechende
Ausführung wirkt zwar nach aussen gut, doch ist sie für die Pflegekräfte und die
Bewohnenden nicht befriedigend:
„Und ich habe nicht die Zeit, um ihnen diese Zeit zu geben, die sie brauchen. Das heisst, anstatt dass sie sich das Gesicht selbst waschen, weil es einfach zu lange geht, nehme ich den Lappen und muss das machen. [...] Das reicht einfach meistens, reicht das nicht um eine richtige Mundpflege zu machen. Es ist quasi... Die Leute müssen einfach, wie soll ich sagen. Von aussen muss es gut aussehen. Aber was dann wirklich gemacht ist, ist eigentlich egal...“ (Tamara Wüthrich).
Zudem gehört zum neuen Arbeitsstil ein klares Setzen von Prioritäten. Das kann
einerseits heissen, dass Bewohnende zeitlich vertröstet werden müssen, anderseits,
dass nicht alle gleich gut behandelt werden:
„Ja, ich setze schon ein wenig Prioritäten. Und eben, manchmal, ich muss einfach auch lernen, dass ich zwischendurch auch aus dem Zimmer gehe und beim nächsten Bewohner anfangen gehe. Einfach so „switchen“, hin und her „switchen.“ Ich muss einfach, eben manchmal muss ich auch dem Bewohner sagen, so jetzt muss ich wieder gehen“ (Maria Tschanz).
Die Ökonomisierung macht es nötig, dass die Pflegekräfte schneller und mit anderen
Prioritäten arbeiten als bis anhin. Nicht die grösstmögliche Pflegequalität steht dabei im
Mittelpunkt, sondern die Einhaltung der Vorgaben.
6.3.2 Übernahme der Denkweise und Kontrollfunktion
Eine weitere Reaktion neben dem angepassten Arbeitsstil ist die vermehrte
Übernahme des ökonomischen Denkens. Für die Pflegekräfte ist der Beruf des
Pflegens dadurch nichts Spezielles mehr: „Das ist ein Job wie jeder andere. Es ist halt
auch der einfachste Weg. Am wenigsten Widerstand“ (Tanja Birnstiel). Dies kann auch
Karrieren innerhalb des Berufes ermöglichen. Beobachtbar sind dabei auch eine
stärkere Faszination an dem medizinischen Teil des Berufs und eine Abkehr von
Emotionen, Gefühlen und Betreuung:
„Es sind nicht alle so, aber die gibt es eben auch, die dann irgendwie einfach die Möglichkeit ergriffen haben, aufzusteigen in der Hierarchie. Und wo du einfach merkst, dort ist mehr das Funktionelle. [...] Die orientieren sich durch Verbände, Medikamente sind wichtig und so, und der Mensch ist irgendwie wie zweitrangig. [...] Denen ist irgendwie alles scheissegal, kommen einfach arbeiten damit man das Geld daheim hat. [...] Aber es gibt so die mit dem Herzen und die, denen das Medizinische, wichtiger ist als der Mensch“ (Isabelle Fuhrmann).
Seite 67
Mit der Übernahme des ökonomischen Denkens einher geht eine Abkehr vom
bisherigen Berufsethos und damit von der guten Pflege:
„Aber vollumfängliche, gute Pflege... das würde ich heutzutage ehrlich gesagt etwa 50 % der Pflegenden fast absprechen. Das ist mein Erlebnis aus der Praxis. Dass ich bei 50 % oder mehr der Leute das Gefühl habe [...] ja, der Patient ist völlig unwichtig oder der Bewohner. Es muss einfach, es muss laufen, es muss funktionieren...“ (Nadja Engel).
Die Übernahme des ökomischen Denken und Handelns der Pflegekräfte hat auch zur
Folge, dass solche Pflegekräfte Druck auf Personen ausüben, welche sich nicht an das
Zeitbudget und die neuen Vorgaben halten, wie ein Beispiel von Tamara Wüthrich
zeigt:
„Also wir haben eine gehabt in unserem Heim, wirklich ganz jemand Tolles. [...] Die ist meistens nicht fertig geworden zurzeit mit ihren Leuten. Ihr hat man immer noch helfen gehen müssen, weil sie es gut gemacht hat, ist dadurch natürlich, hat immer ein bisschen aufs Dach bekommen von oben, sie sei zu langsam. Ist dann wirklich, ist eine Arme gewesen, ist viel geplagt worden.“
So kontrollieren gewisse Pflegekräfte andere Pflegekräfte und geben diesen zu spüren,
wenn sie zu langsam sind. Dies findet ohne Auftrag der Leitung statt:
„Und dann bin ich in meinem Ego gerührt, irgendwie, dass sie das gesagt hat, und dann bin ich wieder vorgelaufen zu den anderen zweien, und die sind mega wütend gewesen, beide. Und dann, also schlussendlich haben sie nichts gesagt, aber sie sind eigentlich wütend gewesen, weil sie gefunden haben, ich bin viel zu lange bei der gewesen“ (Tanja Birnstiel).
Der neue Arbeitsstil wird damit nicht nur äusserlich vollführt, sondern von einigen auch
innerlich für richtig befunden und mitgetragen. Pflegekräfte welche sich nicht daran
halten, werden deshalb aus Überzeugung geschnitten und bestraft.
6.3.3 Resignation und innerer Widerwille
Eine weitere Reaktion ist die Übernahme des neuen Arbeitsstils, jedoch verbunden mit
einem inneren Widerwillen. Die Pflegekräfte machen zwar, was von ihnen erwartet
wird, entfernen sich aber innerlich von ihrem Beruf und resignieren:
„Ja, ich denke, wenn ich das Umfeld anschaue, in dem ich arbeite, die sind wahrscheinlich genau gleich weit wie ich. Die sind auch irgendwo resigniert, die müssen jetzt einfach noch arbeiten, die spulen jetzt einfach ihre Arbeit dort ab, ohne [...] Herzblut, ist sowieso der falsche Ausdruck, aber die sind zunehmend abgelöscht. Und die, die es sich erlauben und leisten können, die gehen“ (Jasmin Müller).
Die Pflegekräfte fügen sich den Umständen und verlieren Energie und Elan: „Oder
andere, die sich halt fügen. Und eben, dann pflegen sie halt die Leute, aber eben, wie
sie gepflegt sind“ (Maria Tschanz). Auch Gewerkschafter Stern stellt eine starke
Resignation fest. Er bringt sie mit der hohen Fluktuation und Burnout-Rate des Berufes
in Verbindung:
„Viele Pflegekräfte sind aber, denke ich, teilweise auch sehr resignativ unterwegs. Ich würde sagen... Äussert sich aber auch, und da gibt es auch wieder Zahlen, äussert sich relativ stark mit einer hohen Absenzenrate in der Branche, hohe Burnout-Rate.“
Seite 68
Die fehlende Motivation, mangelnde Freude am Beruf, fehlende Wertschätzung und die
als Fabrikarbeit organisierte Pflege führen, kombiniert mit der knappen Zeit für die
Bewohnenden, zur Resignation und Abstumpfung:
„Mich treibt im Moment gar nichts mehr an. [...] Das ist für mich, also das habe ich abgeschlossen. Weil die Wertschätzung kommt in keiner Art und Weise. [...] Das ist null Motivation mehr. Und das kann man irgendwann mal, nicht mal mehr so weit, wie soll ich sagen, einfach so sich weit aufrappeln und sagen, ich mache es dem Heimbewohner zuliebe. Irgendwann geht das auch nicht mehr“ (Jasmin Müller).
Resignation ist eine Folge der Enttäuschung über die nur unzulänglich ausgeführte
Pflegearbeit. Innerlich besteht das alte Berufsethos weiter, welches den neuen
Arbeitsstil nicht gutheissen kann.
6.3.4 Aufopferung für die Bewohnenden
Eine stark verbreitete Reaktion auf die Ökonomisierung und die daraus resultierenden
neuen Anforderungen ist die Selbstaufopferung der Pflegekräfte. Damit es den
Bewohnenden trotz fehlender Zeit gut geht, werden beispielsweise verschiedene
Tätigkeiten unbezahlt verrichtet:
„Zuerst haben die Bewohner Vorrang. Und ich schaue, dass ich zum Einschreiben komme, aber wenn ich halt mal nicht kann, entweder mache ich Überzeit, was man ja auch nicht sollte, weil das wird auch nicht unbedingt bezahlt, oder mache es aus Goodwill noch. [...] Oder dass ich halt dann wirklich Sachen mache an den Randzeiten. Dann, wenn ich eigentlich Feierabend hätte“ (Maria Tschanz).
Trotz des Drucks wird versucht, so gut wie möglich für die Bewohnenden individuell da
zu sein und sich für ihr Wohlbefinden einzusetzen:
„Ich probiere eigentlich wirklich, meine Sache so zu machen, dass den Bewohnern wirklich wohl ist. Ich nehme mir halt hier ein bisschen mehr Zeit für jemanden, der es gerade braucht, [...] bleibe halt dann trotzdem die halbe Stunde länger. [...] Ich schaue einfach, nach Möglichkeit, dass ich dahinterstehen kann mit dem, was ich mache“ (Dagmar Polzin).
Dieses Zusatzengagement geschieht nicht für den Arbeitgeber, sondern zum Wohl der
Bewohnenden. Beispielsweise, wenn unbezahlte Arbeit zu Hause verrichtet wird, weil
im Pflegeheim während der bezahlten Arbeitszeit keine Zeit dazu war: „Es ist vielleicht
nicht unbedingt im Namen der Institution, aber eigentlich jedes Mal wenn ich
irgendetwas nachschauen wollte, habe ich das in der Freizeit gemacht.“ (Nadja Engel).
Auch ist es den Pflegekräften wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass es ein
Muss sei, sondern dass eben die Bewohnenden im Zentrum stehen:
„Weil ich ihr das versprochen hatte, weil ich genug Zeit haben wollte. Ich habe einfach, solange sie mochte, habe ich mit ihr unterwegs sein wollen. Das ist der Grund, wieso ich in der Freizeit gegangen bin. Weil ich einfach einen angenehmen, ruhigen Tag... Und sie hat auch nicht das Gefühl haben sollen, das sei vom Heim aus. Das ist mein Grund, dass ich das in meiner Freizeit gemacht habe.“ (Luca Michel)
Oft wird auf Pausen verzichtet oder diese werden nicht richtig bezogen, wie Isabelle
Fuhrmann erläutert: „Ein Teil macht gar nie Pause, weil sie keine Zeit haben. Eben,
zum Beispiel, der mit den Pausen. Der geht nicht auf, immer [...].“ Fuhrmann führte
Seite 69
auch weitere Probleme auf. So würden oft die gesetzlichen Ruhezeiten missachtet
oder man kommt unbezahlt früher zur Arbeit um fertig zu werden:
„Mit den Ruhezeiten. Der geht nicht auf. Spät, Frühdienst ist immer noch... einfach so Sachen. [...] Dass die meisten Mitarbeitenden in der Abteilung früher kommen, damit sie fertig werden mit den Sachen, oder später gehen. Also ich würde sagen, von zehn machen das acht“ (Isabelle Fuhrmann).
Diese Selbstaufopferung wird von einigen Pflegekräften selbstkritisch gesehen, weil sie
dabei bis an die Grenze der Belastbarkeit und darüber hinausgehen:
„Weil wir einfach [...] es ist viel zu viel, zu viel Selbstverständliches. Weisst du, wir sind immer noch so ein bisschen in einer Aufopferungsrolle... Wir machen viel zu viel eben... packen wir noch oben drauf, das gar nicht mehr drin liegen würde. Oder eben, macht es neben der Zeit. Ob das wirklich zeitgemäss ist, weiss ich nicht“ (Maria Tschanz).
Viele Pflegekräfte, welche nach diesem Muster auf die neuen Herausforderungen der
Ökonomisierung reagieren, sind anfälliger für Krankheiten und Burnouts: „Das hat
einfach auch damit zu tun, oder, also, das kann es ja auch nicht sein, dass die Leute
dann so auf dem Zahnfleisch laufen, bis es nicht mehr geht“ (Tamara Wüthrich).
Selbstaufopferung als Ausweg aus der Ökonomisierung führt kurz- und mittelfristig zu
einer besseren Pflege. Langfristig macht es die Pflegekräfte aber krank, da sie ihre
körperlichen und psychischen Grenzen überschreiten.
6.3.5 Kleine legale und illegale Tricks
Eine weitere Reaktion der Pflegekräfte ist die Anwendung von vielen kleinen legalen
und illegalen Tricks, um das Leben der Bewohnenden angenehmer zu machen. Sei
dies, um mehr Zeit für die Pflege zu haben oder für kleine Gefälligkeiten für die
Bewohnenden. Weit verbreitet ist der Widerstand gegen – aus der Sicht der
Pflegekräfte – unnütze und nicht pflegerelevante Aufgaben:
„Ja sicher, die Tricks, die werden... Ja, ganz klar. Das ist... ich probiere diesbezüglich... Also mein Trick, also das ist kein Trick, ich putze schon lange nicht mehr. Nein. Ich habe schon lange, eine Ewigkeit nicht mehr geputzt. Und sage auch meinen Kolleginnen, geht besser mit den Leuten reden“ (Jasmin Müller).
Auch das auslassen von gewissen administrativen Leerläufen ist beliebt. „Das wäre ja
auch nicht gestattet. Aber wie ich halt bin, lieb und gutmütig, tue ich halt meine Zeit mal
für einen Bewohner freihalten“ (Maria Tschanz). Eine kleine Gefälligkeit, welche
eigentlich nicht erlaubt wäre, ist beispielsweise das Einkaufen für die Bewohnenden.
Dies geschieht in der Freizeit der Pflegekräfte:
„Weisst du, für irgendwie... obwohl, gut, das kommt vielleicht noch dazu, Besorgungen machen für die Bewohner... Ja, ich gehe ja eh einkaufen, bringe ich noch mit – dass du in der Freizeit irgendwie etwas kaufen gehst. Aber das sind irgendwie, Gefälligkeiten“ (Isabelle Fuhrmann).
Diese Kleinigkeiten fernab der ökonomischen Logik sind wichtig für die Psychohygiene
der Pflegekräfte, wie Nadja Engel in einem Beispiel zeigt:
Seite 70
„Die Bewohner, wenn sie ‘posten’ gehen wollten, haben sie zahlen müssen, wenn du mitgegangen bist. Und zwar 60 Franken in der Stunde. Und wir haben eine Bewohnerin gehabt, die hat wirklich einfach kein Geld gehabt, und die hat irgendwie schon längstens Mal Unterhosen kaufen gehen müssen. Und das ist bei uns in der Institution wirklich verboten worden. Du hast nicht dürfen ohne es zu verrechnen. Und dann bin ich halt mal um zwanzig nach Vier habe ich gerade Feierabend gehabt, dann bin ich halt da gegangen mit ihr. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen traurig, dass es notwendig ist. [...] Ich mache viel lieber so etwas und gehe dann nach Hause und bin halt eine Stunde länger geblieben, als nach meinen Standards achteinhalb Stunden. Weil nach denen finde ich es manchmal furchtbar, nach Hause zu kommen. Und dann halt mal eine gute Tat und dafür ist der Abend danach gerettet.“ (Nadja Engel)
Auch Tricks im Auftrag der Leitungen um mehr Geld und so mehr Zeit zu erhalten,
gehören zu den nicht immer freiwilligen Reaktionen der Pflegekräfte:
„Also ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, dass Leute, gerade beim RAI ist es so, wenn Leute eine Wunde haben, dann steigen sie in der Stufe. Also es heisst, sie müssen mehr zahlen. Da werden einfach, obwohl die Wunden trocken sind und zu sind, da werden einfach Wundverbände weiterhin täglich gemacht, damit die Leute in der Stufe nicht abgestuft werden“ (Dagmar Polzin).
Obwohl höhere Stufen mehr Zeit bedeuten, sind solche Tricksereien aber umstritten:
„Klar hat man es gern gehabt, wenn die Stufe ein bisschen höher war. [...] Wiederum finde ich es dann auch hart, wenn man es zusammen ausreizen muss, ich sage jetzt, nicht bescheissen, aber wirklich Sachen, die vielleicht zwei, drei, viermal vorgekommen sind, reinnehmen muss, damit dann die Stufe hochgeht. [...] Und das finde ich wiederum so, ja, auch nicht ganz korrekt“ (Luca Michel).
Manchmal muss auf Druck der Leitung die Dokumentation angepasst werden, damit es
mehr Geld gibt: „Einfach das, was ich gemacht habe. Dann hat es geheissen, nein,
nein, ich müsse nochmal gehen, ich müsse alles abklicken. Und dann habe ich quasi
eigentlich im Auftrag betrogen“ (Tamara Wüthrich). Solche kleinen Tricksereien sind
zum festen Alltag der Pflegekräfte geworden.
6.3.6 Weiter wie bisher, Angst und fehlende Kraft
Obwohl sich durch die Ökonomisierung die Arbeitswelt für die Pflegekräfte stark
verändert und dies häufig negativ bewertet wird, sieht man wenige Pflegekräfte, welche
sich wehren, um wie früher weiterarbeiten zu können. Viele Pflegekräfte begründen
dies mit Angst vor Jobverlust:
„Das ist Angst. Das ist Angst der einzelnen Mitarbeiter, denke ich. Sind ganz viele Abhängigkeitsverhältnisse, die es gibt. Es sind viele Ausländer, die auf den Job angewiesen sind, weil sie sonst vielleicht das Land verlassen müssen, wenn sie keinen Job mehr haben. Und selber noch Familie vielleicht im Hintergrund haben. Ich selber bin alleinerziehende Mutti mit zwei Kindern“ (Dagmar Polzin).
Viele Arbeitgeber würden die Situationen der Pflegekräfte schamlos ausnutzen:
„Da werden einfach die Situationen, wo die Leute drin stecken, zum Teil schamlos ausgenutzt. Oder, Trennung vom Mann, und musst unbedingt eine Stelle haben, als Ungelernte, denke ich, die sind eher gefährdet, obwohl wir [Pflegefachfrauen; A.D.] auch“ (Jasmin Müller).
Auch die Arbeitszeiten schränken ein stärkeres Engagement für eine Veränderung der
Arbeitsbedingungen und für die Bewohnenden ein. Gerade durch die geteilten Dienste
sind Pflegekräfte oft den ganzen Tag absorbiert:
„Aber manchmal fehlt dir auch der Elan dazu, [...] gehen wir im besten Fall davon aus, ich schaffe im Altersheim, fange am Morgen um Sieben an, bin mit Pause am Abend um Acht wieder daheim. Vielleicht,
Seite 71
vielleicht habe ich auch ein bisschen Sozialleben oder irgendein Hobby oder irgendetwas. Und wo soll ich dann noch die Energie oder die Zeit hernehmen? [...] Ich wüsste nicht wie“ (Nadja Engel).
Durch die Arbeit sind die Pflegekräfte ausgelaugt und hätten keine Kraft mehr: „Ich
denke, [...] was vielfach das jetzt ausmacht, warum dass wir als Pflegende uns nicht so
wehren, weil es auch eine Kraftfrage ist“ (Isabelle Fuhrmann). Das Pflegeethos scheint
ein weiterer Grund zu sein, weshalb die Pflegekräfte nicht vermehrt für sich selber
kämpfen. Das Wohl der Bewohnenden zählt mehr als das eigene:
„Für mich ist es berufsgruppentypisch. [...] Ich denke, es hat fest damit zu tun, dass man... dass Pflegende zuerst einmal für die Leute schauen, die sie pflegen, und weniger für sich selber. Und darum auch nicht um die eigenen Arbeitsbedingungen kämpfen“ (Christine Fitze).
Die erfahrene Abteilungsleiterin Elisabeth Jung führt als weiteren Grund an, dass die
Pflegekräfte in der Schweiz keine Tradition in Arbeitskämpfen hätten und sie deshalb
alles mit sich machen lassen:
„Ich habe einfach das Gefühl, das ist einfach, weil es nicht so Tradition hat, tust du das weniger. Also du hörst ja immer, von den Bauarbeitern, die machen das seit Jahren. Ich denke, im Ausland ist es auch eher noch, dass du dich organisierst oder dass du auf die Strasse gehst. Auch in den Pflegeberufen.“
Es zeigt sich bei den Interviews aber auch, dass es Pflegekräfte gibt die sich trotz
allem wehren und ihren alten Arbeitsstil weiter fortsetzten: „Also eben, ich habe mich
eben nicht so stressen lassen. Ich habe mir die Zeit selbst genommen [...]“ (Tanja
Birnstiel). Ausserdem ist es möglich, durch persönlichen und kollektiven Einsatz die
Bedingungen zu verbessern. So gelang es beispielsweise Elisabeth Jung in ihrem
Betrieb, gesetzeskonforme Pausenregelungen durchzusetzen, ohne dass es zu
Verschlechterungen für die Bewohnenden gekommen wäre:
„Da ich ja bei der Personalkommission bin und jetzt... Also dort, ich glaube, sie haben mich noch nie so gerne gehabt, aber jetzt haben sie mich noch weniger gerne. Ich bin dort ganz penetrant und eklig, dass wir das wirklich arbeitsgerecht oder gesetzlich durchziehen können. Doch, ich habe das Gefühl, jetzt machen wir die Pausen bei uns richtig.“
Auch andere Pflegende erzählen von kleinen, aber erfolgreichen Interventionen. Es
zeigt sich also, dass Pflegekräfte welche genug Kraft haben, durchaus erfolgreich
gegen einzelne Aspekte der Ökonomisierung bestehen können. Damit können sie
weiter arbeiten wie früher, ohne einen neuen Arbeitsstil übernehmen zu müssen oder
sonst auszuweichen. Doch bilden sie eine Minderheit.
Es kann gesagt werden, dass es fünf Typen von Reaktionen der Pflegekräfte gibt.
Diese Typen treten in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung auf. Der erste Typus
übernimmt einen neuen, angepassten Arbeitsstil und die neue ökonomische
Denkweise. Der zweite Typus übernimmt ebenfalls den neuen Arbeitsstil, bleibt
allerdings mit ihm im Konflikt, weil für ihn weiterhin das bisherige Berufsethos gilt. Der
dritte Typus versucht durch Selbstaufopferung wie unbezahlte Mehrarbeit, den neuen
Seite 72
Arbeitsstil nicht zu übernehmen und wie bisher für die Bewohnenden da zu sein. Der
vierte Typus versucht, durch kleinere legale und illegale Tricks mehr Zeit für die
Bewohnenden zu erhalten. Der fünfte Typus schliesslich, geht in den offenen
Widerstand gegen die Leitung. Er bleibt dabei beim alten Arbeitsstil und nimmt sich
Zeit für die Bewohnenden.
Seite 73
7. Diskussion der Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschung interpretiert,
diskutiert und mit der Theorie verknüpft. Dies geschieht entlang der Forschungs-
fragestellung. Es zeigt sich, dass das Eindringen der Ökonomie in das soziale Feld der
Pflege und damit das Subfeld der stationären Alterspflege zu grossen Veränderungen,
Irritationen und Kämpfen unter den Akteurinnen und Akteuren im Feld führt. In Kapitel
7.1 werden dazu die Ökonomisierung und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt der
Pflegekräfte betrachtet und theoretisch verortet. Kapitel 7.2 beschäftigt sich mit den
hervorgetretenen Widersprüchen zwischen Ökonomisierung und Berufsethos, dem
sinnstiftenden Kern der Arbeit der interviewten und beobachteten Pflegekräfte. Die
verschiedenen Arten und Idealtypen von Reaktionen der Pflegekräfte auf die
Ökonomisierung stehen im Mittelpunkt von Kapitel 7.3. In Kapitel 7.4 wird die
Entfremdung der Pflegekräfte aufgrund der Ökonomisierung als gemeinsame
Verbindung zwischen den Unterfragen der Leitfragestellung vorgestellt und
interpretiert. Schliesslich wirft Kapitel 7.5 einen Blick auf die weitere Entwicklung der
stationären Alterspflege durch die fortschreitende Ökonomisierung.
7.1 Ökonomisierung und Auswirkungen auf die Arbeitswelt
Die kapitalistische Landnahme ist weit vorangeschritten. Es lässt sich innerhalb des
Feldes der Pflege eine starke Strukturverschiebung hin zu einem Primat der Ökonomie
betrachten. Der neoliberale kapitalistische Geist, entspricht zu grossen Teilen der
neuen Doxa und damit den Spielregeln im sozialen Feld der Pflege und dem Subfeld
der stationären Alterspflege. Daraus ergeben sich zahlreiche Änderungen in der
Arbeitswelt der Pflegekräfte. Da sowohl die Pflegekräfte, wie auch die Bewohnenden,
gegenüber den Alters- und Pflegeheimen im Feld eine schwache soziale Stellung
innehaben, werden viele negative Veränderungen in der neuen Arbeitswelt auf sie
überwälzt. Die neue Doxa erleben die Pflegekräfte als den direkten und indirekten
Spardruck, der immer und überall präsent und zu spüren ist. Pflege muss heute
rentieren. Zahlen und die Wirtschaftlichkeit werden als vorgegebene Ziele deshalb von
den Pflegekräften als wichtiger wahrgenommen als das Wohlbefinden der
Bewohnenden. Da die Regeln des Feldes neu sind, müssen sich der Beruf, die
Handlungen und der Arbeitsstil der Pflegekräfte anpassen. Deshalb erkennen viele
Pflegekräfte ihren Beruf und ihre Arbeitswelt nicht wieder.
Um zu sparen und die Produktivität zu erhöhen, werden verschiedene Instrumente des
Taylorismus auf die stationäre Alterspflege übertragen. Der letzte Schub geschah nach
der Einführung der neuen Pflegefinanzierung per 1. Januar 2011. In tayloristischer
Seite 74
Manier wird die Pflege messbar und rationalisierbar gemacht. Die Bewohnenden
werden aufgrund ihres Zustandes normiert, bewertet und in Pflegestufen eingeteilt.
Jede Pflegestufe entspricht einer bestimmten Anzahl Pflegeminuten. Gleichzeitig wird
die Pflege aufgesplittert in medizinische Pflege und nicht-medizinische Betreuung, was
früher eine Einheit bildete. Die einzelnen Handlungen sind neu in Einzelschritte zerlegt
und mit einem normierten Zeitbudget belegt. Damit hat ein Minütelen begonnen: Für
jeden Bewohnenden gibt es ein klar definiertes Zeitbudget für die medizinische Pflege,
die Betreuung, Beziehungs-, Gefühls- und Emotionsarbeit bleibt aussen vor. So
entsteht für manche Pflegekraft das Gefühl, eher industrielle Fabrikarbeit zu leisten,
nämlich getaktete Einzelschritte an Bewohnenden zu vollführen, statt mit den
Bewohnenden individuell zu arbeiten. Dies erstaunt nicht, kommt doch der Taylorismus
aus der industriellen Güterproduktion.
Diese Berechnung der Pflegezeit stellt die Arbeitswelt der Pflegekräfte auf den Kopf.
Man kann nur noch die vordefinierte Zeit bei den Bewohnenden verbringen. Dadurch
verringert sich die Zeit, die man insgesamt für die Bewohnenden zur Verfügung hat.
Oftmals reicht die Zeit nicht einmal aus, um die ganze vorgesehene Arbeit richtig zu
erledigen. Menschen lassen sich nicht wie Güter vorhersagen und berechnen, wie wir
aus der Care-Ökonomie wissen. Die Zeitbudgets sind knapp berechnet, wodurch
Stress entsteht. Es können nur noch die medizinischen Einzelleistungen erbracht wer-
den, für aktivierende Arbeit oder Beziehungs-, Gefühls- und Emotionsarbeit bleibt gar
keine Zeit mehr. Damit verlieren die Pflegekräfte einen wichtigen Teil ihres Berufes.
Die Qualität der vollbrachten Pflegeleistungen lässt sich nicht objektiv messen.
Gewaschen ist eine Person schnell. Erfasst und bezahlt sind nur Wasser, Lappen und
die Verrichtung „Waschen“ als Zeiteinheit und nicht die Qualität und der Zeitpunkt des
Waschens. Einher geht das Sparen und Berechnen der Pflegezeit mit einem
Stellenabbau, das heisst, weniger Pflegekräfte müssen mehr Bewohnende pflegen.
Wirtschaftlich gesprochen: Die Produktivität steigt. Ebenfalls dem Neoliberalismus
entsprechend werden die Pflegekräfte mit Privatisierungen von Alters- und
Pflegeheimen konfrontiert.
Einher geht dies mit einer tayloristischen Arbeitsteilung und -hierarchie. So wie die
einzelnen Handlungen aufgebrochen wurden, müssen zwecks Kostenoptimierung oder
Renditesteigerung die Aufgaben verteilt werden. Die kostengünstigen Pflegehilfen und
-assistenzen übernehmen deshalb die direkte Pflegearbeit mit den Bewohnenden, die
Grundpflege und Betreuung, also den pflegeintensiven aber nicht immer messbaren
Teil der Arbeit. Die Fachangestellten Gesundheit und die Pflegefachkräfte HF über-
nehmen vor allem Tätigkeiten der Behandlungspflege, Pflegeplanung, Administration
Seite 75
und Führung. Während die Pflegehilfen und -assistenzen noch etwas Zeit mit den
Bewohnenden verbringen können, sehen die Höherqualifizierten die Bewohnenden
immer weniger. So gaben in den Interviews mehrere Personen an, inzwischen 70 %
ihrer Arbeit fernab der Bewohnenden zu verrichten. Dies ist ein massiver Wandel für
Personen, welche den Beruf gewählt haben, um direkt mit Menschen zu arbeiten.
Gleichzeitig zeigt sich, dass zwischen FaGe und Pflegefachkräfte HF nach wie vor ein
Wandlungs- und Ausdifferenzierungsprozesses stattfindet. Zwischen diesen Gruppen
findet ein eigentlicher Positionskampf um Arbeitsinhalt und Kompetenzen statt. Auch
dieser Vorgang ist theoretisch begründet und geschieht jeweils, wenn Berufe auf neue
gesellschaftliche Gegebenheiten stossen. Die Arbeitgeber haben ein Interesse an
Sparen und Rendite. Dieses Interesse widerspiegelt auch den momentanen
kapitalistischen Geist unserer Gesellschaft. Daher versuchen verschiedene
Interessensgruppen möglichst viele Kompetenzen in der stationären Alterspflege den
FaGe zu geben, da sie billiger sind als tertiäre Pflegefachkräfte.
Weitere Neuheiten der Arbeitswelt sind der „Dokumentationswahn“ und die
zunehmenden Kontrollen im Berufsalltag. Jeder Handgriff, der vollführt wird, muss
irgendwo festgehalten werden. Das führt für die Pflegekräfte zu einem massiven
administrativen Mehraufwand. Die Dokumentation dient der Kontrolle, ob wirklich alles
gemacht und ob nicht zu viel verrechnet wurde. Die Dokumentationspflicht ist damit
gleichzeitig Kontroll- und Disziplinierungsinstrument der Krankenkassen, Arbeitgeber
und öffentlicher Hand. Wer sich nicht daran hält wird bestraft. Dies kann durch
Abmahnungen durch den Arbeitgeber geschehen oder durch die Krankenkassen und
die öffentliche Hand, welche Gelder streichen. Parallel dazu wird im Alltag häufiger
kontrolliert, ob sich die Pflegekräfte an die Regeln halten. Dies geschieht einerseits
durch die Vorgesetzten, anderseits immer mehr auch durch andere Pflegekräfte,
welche die neuen Regeln bereits verinnerlicht haben. Dieses Kontrollieren und Strafen
ist eine Auswirkung der kapitalistischen Landnahme. Die Pflegekräfte werden mit
Druck in die neuen Arbeitsweisen hineingedrängt, bis sie diese schliesslich selbst
übernehmen und weitergeben.
Um die Kontrollen und die geforderten Dokumentationen vollbringen zu können,
werden vermehrt digitalisierte Hilfsmittel eingesetzt. Die Digitalisierung zeigt sich in der
vermehrten Nutzung von Computern und Computerprogrammen. Tragbare digitale
Geräte erlauben es, die Dokumentationspflicht schneller, genauer und kostengünstig
wahrzunehmen. Von Hand geschriebene Pflegedokumentationen sind heute aufgrund
der zahlreichen Vorgaben immer seltener möglich. Damit müssen sämtliche
Pflegefachkräfte die Computer und die Programme beherrschen, was einer grossen
Seite 76
Neuerung entspricht. Dies ist ein typisches Beispiel, wie neue gesellschaftliche
Voraussetzungen und technische Hilfsmittel den Inhalt eines Berufes von aussen her
verändern.
Wie in der Theorie vermutet, führen die verschiedenen tayloristischen Massnahmen in
der Pflege, im Gegensatz zur industriellen Güterproduktion, nicht zu besseren
Arbeitsbedingungen. Das Credo des Sparens und der Produktivitätssteigerungen führt
für die Pflegekräfte oftmals zu schlechteren Bedingungen. Ein wichtiger Punkt ist
hierbei die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Durch geteilte Dienste, die stetige
Änderungen der Arbeitspläne und die ständige Abrufbarkeit der Pflegekräfte können
die Alters- und Pflegeheime Kosten sparen. Dadurch arbeiten die Personen trotz
Teilzeitanstellung an gleich vielen Tagen wie bei einer Vollzeitanstellung, aber die
Arbeitgeber müssen weniger bezahlen. Gleichzeitig ist durch die geforderte
Produktivitätssteigerung der Job so anstrengend, dass eine 100 %-Anstellung oft gar
nicht mehr möglich ist oder überproportional zu Überbelastung und Krankheiten führt.
Dies geht einher mit der These, dass es bei einer neuen kapitalistischen Landnahme
zwecks der Gewinnsteigerung zur Prekarisierung der Arbeitsbedingungen kommt. Die
Löhne, gerade der tiefer qualifizierten Pflegekräfte, geraten unter Druck.
Nur am Rande erwähnt wurde der Fakt, dass der Anteil von Pflegekräften mit
Migrationshintergrund zunimmt. Da der Anteil bereits früher hoch war, wird die jetzige
Zunahme nicht als Wandel wahrgenommen. Gleiches scheint für die körperlichen
Beschwerden infolge der Arbeit zu gelten. Auch wenn diese immer noch da sind und
teilweise auch zunehmen, werden vor allem die Burnouts und das Ausgelaugt-Sein
erwähnt. Dies lässt sich damit erklären, dass es bei diesen Symptomen eine stärkere
Zunahme gibt.
Ebenfalls zeigt sich, dass der Wandel der Arbeitswelt in den einzelnen Alters- und
Pflegeheimen unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Einige Alters- und Pflegeheime
können sich bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Pflegezeit erlauben als andere.
Grund dafür können beispielsweise Zusatzeinnahmen bei der Betreuung oder
Hotellerie sein. Möglich ist auch eine vorteilhafte Kostenstruktur, weil die Bewohn-
enden gesamthaft weniger Zeit benötigen, als die normierten Kosten vorgeben; also
eine für das Heim positive Zusammensetzung der Pflegestufen der Bewohnenden.
Natürlich muss ein Alters- und Pflegeheim in einer solchen Situation das Geld dann
auch in die Pflege investieren wollen. Jedes Heim muss aber so oder so aufgrund des
heutigen Systems seine Kosten optimieren. Viele Heimleiter machen dies aber mehr
als nötig und nach betriebswirtschaftlichen neoliberalen Logiken. Es zeigte sich, dass
Seite 77
trotz aller Zwänge auch alternative Wege möglich sind, wenn beispielsweise die
Heimleitungen einen anderen Kurs verfolgen oder sich Politikerinnen und Politiker für
innovative Lösungen einsetzen. Das Zeitkorsett bleibt natürlich auch hier bestehen.
Wie dieses jedoch angewandt wird, kann variiert werden. Einige Alters- und
Pflegeheime schreiben grosse Gewinne, was ebenfalls eine Neuerung in der
Arbeitswelt der Pflegekräfte ist. Stationäre Alterspflege kann also durchaus auch
gewinnbringend erbracht werden. Die Frage ist dann nur, wo gespart wird. Am
einfachsten ist dies bei den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte und der Qualität der
Pflege. Ein solches Vorgehen entspricht dem inkorporierten kapitalistischen Geist
mancher Heimleiter oder Politikerinnen und Politiker und wird deshalb unreflektiert
übernommen. Aber ein gewisser Handlungsspielraum ist, je nach Akkumulation der
Kapitalien der einzelnen Arbeitgeber und Politkern, trotzdem gegeben. Oder sie
können bei Konflikten von anderen Akteuren wie Pflegekräften, Angehörigen oder
Bewohnenden dazu gebracht werden. Nichtsdestotrotz sind alle Akteurinnen und
Akteure mit einem ökonomisierten Feld der Pflege konfrontiert und müssen sich an
neue Spielregeln und Gegebenheiten gewöhnen.
7.2 Ökonomisierung und Widersprüche
Das Berufsethos der Pflegekräfte ist Teil des (inkorporierten) kulturellen Kapitals dieser
Berufsgruppe. Es orientiert sich am Wohl der Bewohnenden. Das eigene Wohlbefinden
wird jenem der Bewohnenden untergeordnet. Um das Wohl der Bewohnenden zu
garantieren, ist eine ganzheitliche und individuelle gute Pflege nötig, welche sowohl
aus Pflege im medizinischen Sinn, als auch aus betreuerischen und psychosozialen
Inhalten besteht. Noch stärker als angenommen wird dabei der betreuerische Teil und
die Individualität der Bewohnenden betont. Wie die Theorie vermuten lässt, ist für die
Pflegekräfte die Arbeit mit den Bewohnenden, insbesondere die Gefühls- und
Beziehungsarbeit, für ihre Berufswahl entscheidend. Positive Rückmeldungen von den
Bewohnenden für das pflegerische Handeln sind sehr wichtig für die Pflegekräfte. Die
Pflegekräfte und die Bewohnenden bilden in diesem Berufsethos eine untrennbare
Einheit. Ebenso gehören in der Vorstellung der Pflegekräfte Pflege und Betreuung
immer zusammen. Zwischen dem Berufsethos und der laufenden Ökonomisierung als
neue, quasi hegemoniale Doxa lassen sich nun zahlreiche Widersprüche finden. Die
aufgezeigten Veränderungen in der Arbeitswelt, insbesondere die tayloristische
Arbeitsteilung und die Zeitkorsetts für das Verrichten von medizinischen
Einzelleistungen an den Bewohnenden, werden von den Pflegekräften eindeutig als
Konflikt und Widerspruch mit dem eigenen Berufsethos wahrgenommen. Normierte,
auf die Minute getaktete, rein medizinische Pflegeschritte laufen dem Bild der
Seite 78
Pflegekräfte von individueller Pflege zuwider. Sowohl Bewohnende als auch
Pflegekräfte können nicht einfach normiert und standardisiert werden. Als besonders
eklatant wird im Alltag die Trennung von Pflege und Betreuung wahrgenommen. Das
Fehlen von genügend Zeit für – oder je nach Stufe überhaupt das Fehlen von –
Emotions-, Gefühls-, und Beziehungsarbeit verhindert es, Beziehungen zu den
Bewohnenden aufzubauen. Durch die Ökonomisierung wird den Pflegekräften der
persönliche, sinnstiftende Kern der Pflegearbeit weggenommen und verhindert damit
gute Pflege. Gleichzeitig wird der grundsätzliche Gedanke der Ökonomisierung der
stationären Alterspflege kritisiert. Angetrieben vom eigenen Ethos wird Pflege als
etwas gesehen, worauf alle Menschen ein Anrecht haben, unabhängig von ihren
finanziellen Mitteln. Pflege soll nicht etwas sein, das rentabel ist. Die falschen Anreize
des Finanzierungssystems werden kritisch gesehen und als Widerspruch aufgefasst.
Als Hauptwiderspruch zum Berufsethos lässt sich zusammenfassend ausmachen,
dass die Ökonomisierung und die neue tayloristische Arbeitswelt zu einer
Verschlechterung der Pflege und damit des Wohlbefindens der Bewohnenden führen.
Dieser Widerspruch ist allen Pflegekräften meist explizit bewusst. Damit ist im Subfeld
der stationären Alterspflege aus dem theoretischen Zielkonflikt zwischen der
persönlichen Ebene (Ziele der Pflegekräfte) und der gesellschaftlichen Ebene (Sparen
und Ökonomisierung) ein reeller Widerspruch geworden.
7.3 Ökonomisierung und Reaktionen
Es gibt verschiedene Formen von Reaktionen auf die Ökonomisierung. Diese sind bei
den Pflegekräften einzeln oder kombiniert zu beobachten. Bestimmend für die
Reaktionen und damit die Handlungen ist einerseits das Berufsethos der Pflegenden
als kulturelles Kapital. Anderseits, und fast noch stärker, wirken im Feld der Pflege die
neuen, neoliberalen Regeln. Diese Regeln (Doxa) und Figurationen haben sich durch
die Ökonomisierung angepasst und die Handlungen sind nun Reaktionen auf die
vorgefundenen neuen Realitäten im Feld der Pflege. Die einzelnen Typen von
Reaktionen sollen nun idealtypisch betrachtet werden:
- Der erste Typus übernimmt den neuen Arbeitsstil der tayloristischen Arbeitsteilung
bei gleichzeitiger Ablehnung des bisherigen Berufsethos. Die kapitalistische
Landnahme war hier erfolgreich sowohl bei der Art, wie gearbeitet wird, als auch bei
der inneren Einstellung. Mit Bewohnenden wird hier keine Beziehung mehr
eingegangen. Die Pflege wird rein medizinisch und standardisiert gesehen und das
Wohlbefinden der Bewohnenden hat einen funktionalen Wert. Die Pflegekräfte sind
nunmehr bessere „Pflegeroboter.“ Ein neues Arbeitsethos entsteht für diese
Seite 79
Pflegekräfte. Das neue Ethos entspricht dem aktuellen neoliberalen kapitalistischen
Geist im Feld der Pflege.
- Der zweite Typus hält sich ebenfalls an die neuen Regeln und den Arbeitsstil. Er
gehorcht damit der Doxa des Feldes. Diese Personen haben jedoch ihr Berufsethos
noch nicht aufgegeben und stehen in einem permanenten Konflikt zwischen der
eigenen inneren Erwartung und der vollbrachten Arbeit. Ihr Beruf entspricht nicht
mehr ihren Erwartungen und widerspricht dem inkorporierten kulturellen Kapital. Die
(Beziehungs-)Arbeit mit und die Reaktionen der Bewohnenden fehlen ihnen, werden
ihnen gar fremd. Wie aber aufgezeigt wurde, gehört diese Beziehungsarbeit immer zu
guter Pflege. Viele Pflegekräfte dieses Typus sind daher resigniert und verlieren ihren
Antrieb, innerlich haben sie gekündigt. Folgen sind u.a. Burnouts und Berufswechsel.
- Der dritte Typus behält sowohl seinen Arbeitsstil als auch sein Berufsethos bei.
Genauer gesagt wächst aus dem Berufsethos ein selbstaufopfernder Arbeitsstil. In
der Tradition der Ordensschwestern und der unbezahlten Frauenarbeit opfern sich
die Pflegekräfte auf. Wie im Theorieteil vermutet, sollen dadurch die strukturellen
Mängel wie Zeit- und Personalmangel zu Gunsten der Bewohnenden auf eigene
Kosten kompensiert werden. Das Wohlbefinden der Bewohnenden ist wichtiger als
das eigene. Das heisst, Pflegekräfte machen beispielsweise ihre Pausen nicht oder
verbringen sie mit den Bewohnenden. Die Pflegekräfte leisten vor und nach ihren
Schichten unbezahlte Mehrarbeit, arbeiten in ihrer Freizeit und zu Hause. Oder die
Pflegekräfte arbeiten über ihre Leistungsgrenzen hinaus. Diese Selbstaufopferung
findet sich im Berufsethos und damit dem kulturellen Kapital der Pflegenden. Dieser
Typus leidet ebenfalls oft an Burnouts und Krankheiten.
- Der vierte Typus versucht durch kleine legale und illegale Tricks mehr Zeit und damit
eine höhere Pflegequalität für die Bewohnenden zu erreichen – gleichzeitig aber den
alten Arbeitsstil und auch das Ethos zu behalten. Hierbei versuchen die Pflegekräfte,
angetrieben von ihrem Berufsethos, kleine Handlungen zu vollziehen, welche ihnen
ermöglichen, ihrem Ideal der guten Pflege eher zu entsprechen. Dies erfolgt
beispielsweise durch das Auslassen von gewissen, als weniger relevant erachteten
Tätigkeiten, abgekürzten Dokumentationen oder höhere Einstufungen von
Bewohnenden. Letzteres erfolgt oft auch auf Druck und Anweisung der Arbeitgeber.
Diese Tricks können von Vorgesetzten respektive den Kontrollbehörden oder
Krankenkassen bestraft werden und erfolgen deshalb meist im Versteckten.
- Der fünfte Typus arbeitet genau gleich weiter wie bisher. Einerseits ist dies möglich,
wenn das Heim die Ökonomisierung nicht so hart umsetzt, oder anderseits, wenn die
Seite 80
Pflegekräfte in den offenen Konflikt mit ihren Vorgesetzten und Heimleitungen gehen
und sich durchsetzen können. Dieser Typus tauchte in der empirischen Untersuchung
bei den Pflegekräften am wenigstens auf. Oft wurde zwar berichtet, dass dies früher
teilweise gemacht wurde, jedoch zu negativen Konsequenzen führte. Durch
zunehmende Kontrolltätigkeit der Leitungen und Vorgesetzten, aber auch von
Kolleginnen und Kollegen des ersten Typus, wird der fünfte Typus immer seltener.
Die Kontrollen, der Druck und somit die kapitalistische Landnahme zeigen hier ihre
Wirkung. Zudem verhindern die schwache Stellung und damit die spezifische
Figuration der Pflegekräfte im Feld gegenüber den Arbeitgebern, dass mehr
Pflegekräfte in den offenen Konflikt gehen.
Es zeigte sich ebenfalls, dass sich kein kollektiver Widerstand gegen die
Ökonomisierung formiert hat. Dies wird mit der engen Bindung der Pflegekräfte an die
Bewohnenden erklärt. Eine weitere Erklärung besteht darin, dass die Arbeit in der stati-
onären Alterspflege sehr anstrengend ist und die Pflegekräfte durch die geteilten Dien-
ste nur wenig Freizeit haben. Hinzu kommt, dass viele Pflegekräfte wenig ökono-
misches Kapital besitzen und daher auf den Job angewiesen sind. Es zeigt sich
jedoch, dass sich die Pflegekräfte, welche sich individuell wehrten, oft durchsetzen
konnten. Ebenfalls wurde deutlich, dass die einzelnen Reaktionen nicht immer gleich
stark zum Vorschein treten. Früher oder später treten sie als Reaktion auf die Ökono-
misierung aber auf. Manchmal reichen kleine Reaktionen aus, um beispielsweise durch
kleine Selbstaufopferungen die Pflegequalität für die Bewohnenden zu verbessern und
genügend Zeit mit den Bewohnenden zu verbringen. Je nachdem wie stark die Ökono-
misierung fortgeschritten ist und wie sich die Leitungen der Alters- und Pflegeheime
verhalten, kommen die Reaktionen und ihre Folgen stärker oder schwächer vor.
7.4 Ökonomisierung und Entfremdung der Pflegekräfte
Als verbindendes Element zwischen den drei Unterfragestellungen der Leitfrage lässt
sich eine neue Art der Entfremdung bei den Pflegekräften feststellen. Dem zu Grunde
liegt die Veränderungen des Berufes und der Arbeit durch die Ökonomisierung. Die
fehlende Zeit und die tayloristische Funktionsweise der Pflegeerbringung mit dem
Minütelen als Umsetzung des Zeitbudgets führen dazu, dass sich die Pflegekräfte
schrittweise von den Bewohnenden entfremden. Die wichtige Emotions-, Gefühls- und
Beziehungsarbeit kann nicht mehr erbracht werden. Die Rückmeldungen der
Bewohnenden bleiben aus. Die Subjekt-Subjekt-Beziehung, welche der stationären
Alterspflege zu Grunde liegt und sie ausmacht, wird durch die Ökonomisierung
schrittweise zu einer Subjekt-Objekt-Beziehung, wie bei der industriellen
Seite 81
Güterproduktion. Die eigentlich untrennbare Einheit zwischen Pflegekräften und
Bewohnenden wird damit durchbrochen. Auch die Motive der Alters- und
Pflegeheimbetreiber verschieben sich in Richtung Sparen. Einige stellen gar das
Renditedenken in den Vordergrund. Deshalb tragen die Pflegekräfte in sich einen
Konflikt aus. Dieser basiert wie aufgezeigt auf den vielen Widersprüchen zwischen
dem Berufsethos (kulturelles Kapital) der Pflegekräfte und der tatsächlichen Arbeit,
welche durch die Spielregeln des sozialen Feldes der Pflege und ihrer Doxa bestimmt
ist. Der sinnstiftende Kern, welcher dem Berufsethos der Pflegekräfte entspringt, die
direkte Pflege- und vor allem Betreuungsarbeit für die Bewohnenden und deren
Wohlbefinden, stehen durch die Ökonomisierung somit unter Druck. Das Streben nach
Wirtschaftlichkeit der Alters- und Pflegeheime wird von den Pflegekräften als
Bedrohung des eigentlichen Wesens des Pflegeberufes gesehen. Deshalb empfinden
viele Pflegekräfte, welche länger in der stationären Alterspflege arbeiten, ihren Beruf
inzwischen als einen anderen. Sämtliche Reaktionen, welche bei den Pflegekräften
aufgrund der Ökonomisierung ausgemacht werden konnten, lassen sich als
Reaktionen auf die Entfremdung oder den Prozess der Entfremdung ihrer Arbeit
deuten. Der neue Arbeitsstil, welcher auf Schnelligkeit beruht und die Qualität der
Pflege ausser Acht lässt, ist Ausdruck der Entfremdung. Pflegekräfte können sich nun
von ihrem alten Berufsethos trennen und als „Pflegeroboter“ weiterarbeiten. Hierzu
wird ein neues Ethos aufgebaut. Oder Pflegekräfte resignieren und verlassen ihren
Beruf, da der Beruf nicht mehr ihren Vorstellungen entspricht und sie sich von ihm
entfremdet haben. Die anderen Reaktionen, also der individuelle Widerstand, die
kleinen Tricks und die Selbstaufopferung, sind persönliche Abwehrkämpfe der
drohenden Entfremdung dieser Pflegekräfte. Auch sie stoppen die Ökonomisierung
und die kapitalistische Landnahme nicht. Durch die zunehmenden Kontrollen,
insbesondere von anderen Pflegekräften, und die grösser werdende Belastung in der
Arbeitswelt, steigt der Druck, den neuen Arbeitsstil und das neue Ethos zu
übernehmen. Die Entfremdung nimmt damit zu.
7.5 Ökonomisierung und Zukunft
Es lässt sich feststellen, dass die Ökonomisierung vielfältige Wirkungen auf die Pflege-
kräfte hat. Sie verändert die Pflegekräfte aber auch die Regeln und Figurationen des
Feldes der Pflege schrittweise. Dies geschieht nicht immer ohne Konflikte und Pro-
bleme – oder gar im Einklang mit dem Willen und den Wünschen der Pflegekräfte. Da
die Ökonomisierung der Pflege voranschreitet, kann angenommen werden, dass die
vorgefundenen Ergebnisse künftig noch stärker im Alltag der Pflegekräfte Einzug
halten werden. Trennung von Pflege und Betreuung, tayloristische Methoden, Zeit-
Seite 82
korsetts, zunehmende Kontroll- und Dokumentationspflichten und damit schliesslich die
Entfremdung der Pflegekräfte von ihrer Arbeit sind Teil der fortschreitenden kapitalis-
tischen Landnahme. Damit werden die Regeln des Feldes der Pflege und ihrer
Subfelder wie der stationären Alterspflege für die einzelnen Akteurinnen und Akteure
nachhaltig verändert. Unter dem Druck, den neuen Arbeitsstil zu übernehmen, schreitet
die Taylorisierung und Ökonomisierung weiter voran. Pflegekräfte, welche nicht Schritt
halten können oder wollen, verlassen den Beruf. Wenn diese Entwicklung so weiter-
geht, werden sich der Kapitalismus und damit die Kapitalakkumulation in der Pflege
weiter ausbreiten. Die Gewinne der Unternehmen werden weiter steigen. Das neue
Berufsethos der Pflegekräfte entspräche Schritt für Schritt dem neoliberalen kapitalis-
tischen Geist. Ob dies allerdings langfristig möglich ist, sei es wegen dem grossen Per-
sonalbedarf, der zu hohen Personalfluktuation oder der dadurch abnehmenden Pflege-
qualität, lässt sich nicht beantworten. Es kann allerdings angenommen werden, dass
zwei Momente die Entwicklung ändern könnten. Es zeigt sich, dass tayloristische
Methoden nicht zu besseren Bedingungen für die Pflegekräfte und die Bewohnenden
führen. Qualitativ gute Pflege für alle kann nicht alleine vom freien Markt erbracht wer-
den. Da fast alle Menschen alt werden, einmal Pflege und Betreuung brauchen werden
und auch die Anzahl der Angehörigen zunimmt, könnte ein gesellschaftlicher und poli-
tischer Druck zu einer Umkehr der Ökonomisierung führen. Oder die Pflegekräfte ver-
ändern ihre Stellung im Feld der Pflege durch die Stärkung ihres sozialen Kapitals,
sprich indem sie sich kollektiv organisieren. Wie es sich bei den interviewten Pflege-
kräften zeigt, sind sich die Pflegekräfte des Widerspruchs zwischen Ökonomisierung
und guter Pflege und ihrem Berufsethos durchwegs bewusst. Und ihr Berufsethos will,
dass sie sich für die Bewohnenden einsetzen. Dies könnte ein erster Schritt sein in
Richtung eines kollektiven Bewusstseins und der Organisierung, hin zu einer Stärkung
des sozialen Kapitals der Pflegekräfte und damit ihrer Stellung im Feld. So könnten sie
sich einerseits für sich als Pflegekräfte, anderseits für die Bewohnenden einsetzen und
die Regeln verändern. Doch was würde dann geschehen? Ein neuer kapitalistischer
Geist könnte sich dieser Kritik und Systemfehler annehmen und Lösungen herausbrin-
gen, welche sowohl Wachstum und Gewinn ermöglichen als auch eine gute stationäre
Alterspflege. Oder es entsteht ein neuer Konsens, welcher ermöglicht, dass stationäre
Alterspflege ausserhalb der kapitalistischen Sphäre angeboten und ausgeführt wird.
Was genau geschieht und in welche Richtung es gehen wird, ist unklar. Auch ob
überhaupt eine der herausgearbeiteten Varianten Wirklichkeit werden wird, kann
aufgrund der vorhanden Daten und Theorien nicht gesagt werden. Fest steht jedoch,
dass die Ökonomisierung der Pflege sowohl für die Pflegekräfte, wie auch für die
Gesellschaft weiterhin ein wichtiges und aktuelles Thema bleiben wird.
Seite 83
8. Fazit
Diese Arbeit schliesst einen Teil der Forschungslücke zum Thema Ökonomisierung der
stationären Alterspflege sowie ihre Auswirkungen auf die Pflegekräfte. Für die Schweiz
lässt sich feststellen, dass die stationäre Alterspflege zunehmend marktförmig organi-
siert wird. Als zusätzliche Markttreiber wirken die wettbewerbsneutrale Subjektfinanzie-
rung und die hohe Kostenbeteiligung der Bewohnenden. Gleichzeitig reguliert ein
Triumvirat von Staat, Versicherungen und Heimträgern einzelne Aspekte der statio-
nären Alterspflegepflege wie etwa ihre Finanzierung. Dies entspricht eher der staats-
kapitalistischen chinesischen und nicht der rein neoliberalen Logik. Die Mischung der
beiden kapitalistischen Systeme erlaubt die momentan bestmögliche Kapitalakkumu-
lation in diesem Bereich. Staat, Krankenkassen und Heimträger führen dazu die nötige
kapitalistische Produktionsweise ein. Damit findet eine Ökonomisierung mit mannig-
faltigen Auswirkungen statt.
Um die Ökonomisierung und ihre Auswirkungen theoretisch analysieren zu können,
empfiehlt es sich, die stationäre Alterspflege in der Schweiz als ein figuratives soziales
Subfeld der Pflege zu betrachten. In diesem streiten verschiedene Akteurinnen und
Akteure wie Pflegekräfte oder Heimbetreiber um Macht und Einfluss. Jedes Feld und
Subfeld verfügt über seine eigenen Spielregeln (Doxa). Die Macht der Akteurinnen und
Akteure wird von der Akkumulation des spezifischen (ökonomischen, kulturellen,
sozialen und symbolischen) Pflegekapitals bestimmt.
Die Pflege war in der Schweiz lange ausserhalb der kapitalistischen Ordnung
organisiert. In den letzten Jahren fand eine kapitalistische Landnahme von ihr statt.
Dies führt zu Irritationen und ermöglicht eine Neuordnung im Feld. Um die Umstellung
in ihrem Sinne durchzusetzen setzen die Wirtschaft und Politik Druckmittel ein. Dies ist
beispielsweise die neue Pflegefinanzierung in der Schweiz. Denn am Anfang werden
solche Neuerungen meist abgelehnt. Mit der Zeit übernehmen die betroffenen
Personen diese jedoch, zuerst zwangsweise und dann wie von selbst. Sie
verinnerlichen diese schliesslich. Die Landnahme entspricht dem neuen Geist des
Kapitalismus. Im Moment ist dies der Neoliberalismus. Er bildet die neue Doxa des
Feldes der Pflege. Doch die neue kapitalistische Logik stösst in der Pflege auf ein
Problem. Die Produktivität kann dort nicht in dem Masse erhöht werden wie bei der
Produktion industrieller Güter. Die Pflege leidet an einer Kostenkrankheit und wird so
zu immer höheren Kosten führen. Trotzdem werden vermehrt tayloristische Methoden
und andere betriebswirtschaftliche Mittel zur angestrebten Produktivitätssteigerung und
Kostensenkung eingesetzt. Die Pflege wird dazu in einzelne Arbeitsschritte zerlegt. Zur
Seite 84
Erledigung jedes Schrittes werden knappe Zeitbudgets aufgestellt (Minütelen). Die
Pflege ist damit in engen und messbaren Zeitkorsetts gefangen. Was nicht messbar ist
wird wegrationalisiert. Damit entfällt ein zentraler Teil des Berufes. Eine Lohnhierarchie
soll eingeführt werden. Mit diesen tayloristischen Arbeitsmethoden wird versucht die
Produktivität zu steigern. Diese Entwicklung geht einher mit der Professionalisierung
des Berufes der Pflegekräfte, welcher ursprünglich unentgeltlich von Ordens-
schwestern als göttliche Aufgabe erledigt wurde. Durch die Ökonomisierung wird der
Beruf neu zugeschnitten und ist Spielball von verschiedenen Interessensgruppen.
8.1 Beantwortung der Leitfragestellung
Wie lässt sich nun die eingangs gestellte Fragestellung: „Wie wirkt sich in der
deutschsprachigen Schweiz die zunehmende Ökonomisierung der stationären
Alterspflege seit dem 1. Januar 2011 a) auf die Arbeitswelt der Pflegekräfte aus, b) was
für allfällige Widersprüche bestehen zwischen ihrem Berufsethos und den
Anforderungen durch die Ökonomisierung und c) wie reagieren die Pflegekräfte auf die
Folgen der Ökonomisierung?“, empirisch beantworten?
Ihr Arbeitsalltag ist aus Sicht der Pflegekräfte wegen der Ökonomisierung einem
starken Wandel unterworfen. Kostensparen und Renditedenken sind neu stets Teil
ihrer Arbeitswelt. Die tayloristischen Arbeitsinstrumente haben sich durchgesetzt. Neu
haben die Pflegekräfte pro Bewohnenden vordefinierte Zeiten zur Verfügung. Diese
beruhen auf normierten Zahlen. Die Zeitkorsetts sind eng bemessen und führen immer
öfters bereits bei den vorgesehenen medizinischen Handlungen zu Zeitnot. Damit
bleiben nicht messbare Handlungen wie Emotions-, Gefühls-, Beziehungs- und
psychosoziale Arbeit auf der Strecke. Jede Pflegekraft muss immer mehr Bewohnende
pflegen. Die Pflege kann dabei nicht mehr nach den qualitativen Massstäben der
Pflegekräfte erbracht werden. Deshalb fühlen sich verschiedene Pflegekräfte heute bei
ihrer Arbeit vermehrt an Fabrikarbeit erinnert. Gleichzeitig nimmt die Arbeitsteilung
immer mehr zu. FaGe und Pflegefachpersonen HF sehen die Bewohnenden immer
seltener und können so nicht mehr direkt mit ihnen arbeiten. Dafür erledigen sie
Aufgaben in der Planung, Leitung, Administration und Dokumentation, was bis zu 70 %
ihrer Arbeitszeit ausmacht. Die Arbeit mit den Bewohnenden übernimmt zu grossen
Teilen das Hilfs- und Assistenzpersonal. Der Dokumentationsteil der Arbeit hat stark
zugenommen. In gewissen Alters- und Pflegeheimen muss jedes einzelne verwendete
Heftpflaster belegt werden. Um die geforderten Dokumentationen zu bewältigen, ist
eine verstärkte Digitalisierung unumgänglich. Schritt für Schritt halten (portable)
Computer, Pflegeprogramme oder auch Strichcodes Einzug. Im Gegensatz zur
Seite 85
industriellen Produktion führen die tayloristischen Massnahmen aber nicht zu einer
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Arbeitszeiten werden immer flexibler,
geteilte Dienste gehören zur Tagesordnung, kurzfristiges Einspringen wird erwartet und
die Arbeitspläne ändern immer wieder. Hohe Fluktuationsraten, Berufsausstiege und
Burnouts sind inzwischen die Norm.
Diese neue Arbeitswelt steht für die Pflegekräfte explizit und implizit im Widerspruch zu
ihrem Berufsethos, welches das Wohlbefinden der Bewohnenden über alles andere
setzt. Dafür ist eine ganzheitliche, individuelle und gute Pflege nötig, welche sowohl
Pflege im medizinischen Sinn wie auch betreuerische, Gefühls-, Emotions- und
Beziehungspflege beinhaltet. Die Ökonomisierung führt aber zu einer Verschlechterung
der Pflegequalität und damit des Wohlbefindens der Bewohnenden.
Die neue Arbeitswelt und der Widerspruch führen bei den Pflegekräften zu verschie-
denen Reaktionen, welche hier idealtypisch dargestellt werden. Diese Typen können in
der Realität auch gemischt und in unterschiedlichen Intensitäten vorkommen. Der erste
Reaktionstyp ist die Übernahme eines neuen, den Anforderungen des Taylorismus und
der Ökonomisierung entsprechenden Arbeitsstils inklusive Reduktion der Pflege-
qualität. Gleichzeitig trennen sich diese Personen vom bisherigen Berufsethos und
entwickeln ein neues, das den veränderten Umständen entspricht und nicht mehr die
Bewohnenden im Zentrum hat. Auch beim zweiten Typus werden die Arbeiten gemäss
der neuen Anforderungen erledigt. Das Berufsethos bleibt jedoch das alte. Der innere
Konflikt dieser Pflegekräfte führt zu Resignation, Antriebslosigkeit und inneren Kündi-
gungen. Beim dritten Typus opfern sich die Pflegekräfte für das Wohlbefinden der
Bewohnenden selbst auf, etwa indem sie die Pausen nicht beziehen oder in ihrer
Freizeit unbezahlt arbeite. Dadurch haben diese Pflegekräfte mehr Zeit für die Bewoh-
nenden. Gleichzeitig bewegen sie sich jedoch an ihrem Leistungslimit. Der vierte Typus
versucht durch kleine legale und/oder illegale Tricks mehr Zeit für die Pflege zu erlan-
gen. Damit sollen die eigenen Ansprüche für gute Pflege und das Wohl der Bewoh-
nenden trotz der Ökonomisierung aufrechterhalten werden. Dies kann beispielsweise
durch das Auslassen von gewissen Arbeiten oder Tricksereien bei den Pflege-
einstufungen erfolgen. Der fünfte Typus will wie früher weiter arbeiten und geht offen in
den Konflikt. Solche Pflegekräfte laufen Gefahr, von Leitungen und Krankenkassen
bestraft zu werden. Gleichzeitig müssen sie auch mit negativen Konsequenzen seitens
anderer Pflegekräfte rechnen, welche das neue Ethos bereits inkorporiert haben.
Als verbindendes, gemeinsames Element lässt sich eine Entfremdung der Pflegekräfte
von ihrem Beruf und den Bewohnenden feststellen. Pflegekräfte üben diesen Beruf
Seite 86
aus, um Beziehungs-, Gefühls-, und Emotionsarbeit auszuüben, für die Bewohnenden
da zu sein und mit ihnen zu arbeiten. Dieser wichtige Teil sowie die Reaktion und
Interaktion mit den Bewohnenden fehlen den Pflegekräften. Die Ökonomisierung
verwandelt die ehemalige Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Pflegekräften und
Bewohnenden in ein Subjekt-Objekt-Verhältnis. Die Einheit zwischen beiden Seiten
wird aufgebrochen. Die Pflegekräfte entfremden sich dadurch von ihrer Arbeit und den
Bewohnenden. Die Entwicklungen der Arbeitswelt sowie der erlebte Widerspruch der
Pflegekräfte drücken dies aus. Die Reaktionen sind Folgen dieser Entfremdung oder
Versuche sie zu verhindern.
8.2 Bewertung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit und die Ergebnisse bieten insgesamt einen guten Einblick in
das Themengebiet der Ökonomisierung der Pflege und der Auswirkungen auf die
Pflegekräfte. Die empirischen und theoretischen Ergebnisse erscheinen umfassend,
realistisch und passen zueinander. Die ganze Arbeit hat einen explorativen Charakter
und erhellt diesen bisher wenig erforschten Bereich. Gerade deshalb erlauben die
Ergebnisse und Erkenntnisse auch Anschlussforschungen. Die Ergebnisse wurden
nach den gängigen Standards der qualitativen Sozialforschung ermittelt. Nichts
destotrotz gibt es einige Punkte, welche bei dieser Arbeit kritisch betrachtet werden
müssen. Die Ergebnisse bringen die subjektive Sicht der beteiligten Pflegekräfte zum
Ausdruck und keine universell geltenden Wahrheiten. In vielen Punkten wurden die
Antworten idealtypisch dargestellt, wie beispielsweise bei den Reaktionen der Pflege-
kräfte. In der Realität wird die Intensität der vorgefunden Ergebnisse von Kanton zu
Kanton und von Heim zu Heim unterschiedlich sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Stellung des Verfassers als Gewerkschaftssekretär, welcher, wie in der Selbstreflexion
ausgeführt, beruflich eine grosse Nähe zum Untersuchungsgegenstand aufweist. Dies
kann zum Beispiel das Verhalten der befragten Personen beeinflusst haben, eher die
Aussagen gemacht zu haben, von denen sie denken, dass sie der Erwartung des
Forschenden entsprechen. Ebenfalls kann die Auswahl der untersuchten Personen
kritisiert werden. Gerade das Schneeballsystem kann dazu führen, dass Pflegekräfte
empfohlen wurden, welche ähnlich denken wie die direkt angefragten Personen. Des
Weiteren erwies es sich bei der Literaturanalyse als schwierig, zwischen stationärer
Alterspflege und Pflege im Generellen zu unterscheiden. Das liegt daran, dass die
stationäre Alterspflege bisher in den Theorien und der Literatur oft stiefmütterlich
behandelt und einfach mitgemeint wurde.
Seite 87
Abschliessend stellt sich die Frage, welche Anschlussforschungen gemacht werden
könnten, um das Themengebiet weiter zu ergründen. Eine Möglichkeit ist, die hier
angewandte empirische Forschung mit einem anderen Sampling zu wiederholen,
sprich die Pflegekräfte nach einer anderen Methode auszuwählen oder die Anzahl der
Interviews zu erhöhen. Ebenfalls wäre die Ausweitung des Untersuchungsgegen-
standes auf die ganze Schweiz und auf andere Pflegebereiche, wie die Akutpflege
oder die ambulante (Alters-)Pflege, wünschenswert. Ein Wechsel der Methoden könnte
ebenfalls neue Ergebnisse liefern. So wären teilnehmende Beobachtungen innerhalb
von Alters- und Pflegeheimen sicher sehr erkenntnisbringend. Spannend wären
zusätzlich quantitative Methoden oder Mixed-Method-Untersuchungen. Diese würden
es beispielsweise erlauben, die Ergebnisse dieser Arbeit zu überprüfen. Gewinn-
bringend wäre auch die Vertiefung einzelner Aspekte. So wäre beispielsweise die
Lebensführung von Pflegekräften ein spannender Punkt. Oder man könnte die
Perspektive wechseln und die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die
Bewohnenden oder die Heimbetreiber erforscht werden. Ein in dieser Arbeit kaum
beachtetes Thema ist die Migration. Diese ist aber für die Gesellschaft, die Pflege und
im Bereich der Ökonomisierung ein wichtiges Forschungsfeld. Interessant wären
Forschungen zu den migrantischen Pflegekräften, den Auswirkungen der Migration auf
das Feld der Pflege, der Pflegemigration auf die Gesellschaft und die politischen
Regulationen. Ebenfalls würde sich eine international vergleichende Forschung zur
Ökonomisierung im Bereich der Pflege anbieten. Jeder Nationalstaat reagiert mit
unterschiedlichen Politiken auf den vermehrten Bedarf an Pflege und Pflegekräften.
Zudem findet die Ökonomisierung unterschiedlich statt und damit sind die
Auswirkungen auf die Pflegekräfte nicht immer dieselben.
Es zeigt sich: Zum Thema Ökonomisierung und Pflege kann noch viel geforscht
werden. Dies ist auch wichtig, denn nur die Forschung erlaubt uns Erkenntnisgewinne
für einen Bereich, welcher uns alle etwas angeht. Wir alle werden älter oder werden
einmal krank. Wir alle brauchen einmal Pflege. Und dann wünschen wir uns nicht nur
eine gute, sondern die beste Pflege und Betreuung.
Seite 88
9. Literaturverzeichnis
Aiken, Linda H., Sean P. Clarke, Sloane M. Douglas, Julie Sochalski und Jeffrey H.
Silber. 2002. Patient Mortality, Nurse Burnout and Job Dissatisfaction. Journal of
the American Medical Association. 288(16): 1987-1993.
ALBA, Alters- und Behindertenamt Abteilung Alter. 2013. Grundlagen zur
Betriebsbewilligung im Bereich der stationären Alterspflege. Bern: Gesundheits-
und Fürsorgedirektion des Kantons Bern.
Albrecht, Simone. 2015. Burnout – ein Leitfaden des ifa. Institut für Arbeitsrecht.
Webdokument.
http://www.arbeitsmedizin.ch/fileadmin/public/Dokumente/Burnout/Burnout__Leitfa
den_03_2015_1.pdf (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Allgäuer, Michael. 2009. Zukünftige Herausforderungen in der Langzeitpflege: Wie
sehen die Strategien aus? Wer steuert? Mit welchen Instrumenten wird gesteuert?
Ein Vergleich der staatlichen Strategien und Steuerungsinstrumente in Basel, Bern
und Zürich. Masterarbeit eingereicht an der Universität Bern im Rahmen des
Executive Master of Public Administration (MPA), 15. Oktober 2009. Bern:
Kompetenzzentrum für Public Management. Universität Bern.
Altvater, Elmar. 2005. Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale
Kapitalismuskritik. Münster: Westfälisches Dampfboot.
Amrhein, Ludwig. 2005. Pflege in konflikt- und austauschtheoretischer Perspektive. S.
107-124. In Soziologie der Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und
Perspektiven, herausgegeben von K. Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim:
Juventa.
Anttonen, Anneli und Gabrielle Meagher. 2013. Mapping Marketisation: Concepts and
Goals. S. 13-22. In Marketisation in Nordic Eldercare: A Research Report on
Legislation, Oversight, Extent and Consequences, herausgegeben von G.
Meagher und M. Szebehely. Stockholm: Stockholm University.
Arbeitskreis Strategic Unionism. 2013. Jenaer Machtressourcenansatz 2.0. S. 345-375.
In Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen. Innovative Praktiken,
internationale Perspektiven, herausgegeben von S. Schmalz und K. Dörre.
Frankfurt a. M.: Campus.
Aulenbacher, Brigitte, Kristina Binner und Maria Dammayr. 2014. Gute Arbeit und
soziale Teilhabe. Wie marktgerecht darf es denn sein? Leitbilder in Wissenschaft
und Pflege in Grossbritannien, Österreich und Schweden. S. 339-352. In Arbeit in
Europa. Marktfundamentalismus als Zerreisprobe, herausgegeben von K. Dörre,
K. Jürgens und I. Matuscheck. Frankfurt a.M.: Campus.
Seite 89
Balmer, Dominik, Catherine Boss und Alexandre Haederli. 2014a. Millionengewinne
auf Kosten der Betagten In Sonntagszeitung vom 28. September 2014.
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_28_09_2014/nachrichten/Millionengewinne
-auf-Kosten-der-Betagten-16074 (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Balmer, Dominik und Alexandre Haederli. 2014b. Die grossen drei der Branche. In
Sonntagszeitung vom 28. September 2014.
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_28_09_2014/nachrichten/Die-grossen-drei-
der-Branche-16077 (zuletzt besucht am 01. Juni 2015).
Balmer, Dominik. 2012. Milliardengeschäft mit Altersheimen boomt. In Berner Zeitung
vom 20. Juli 2012. http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-
konjunktur/Milliardengeschaeft-mit-Altersheimen-----boomt/story/17273545 (zuletzt
besucht am 01. Juni 2015).
Bauch, Jost. 2005. Pflege als soziales System. S. 71-84. In Soziologie der Pflege.
Grundlagen, Wissensbestände und Perspektiven, herausgegeben von K.
Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim: Juventa.
Baumann, Hans und Beat Ringger. 2013. Care, Produktivität, Emanzipation: Der Care-
Imperativ. S. 134-176. In Care statt Crash. Sorgeökonomie und die Überwindung
des Kapitalismus, herausgegeben von H. Baumann, I. Bischel, M. Gemperle, U.
Knobloch, B. Ringger und H. Schatz. Zürich: Edition 8.
Baumol, William und Alan Blinder. 1985. Economics. Principles and Policy. San Diego:
Harcourt Brace Jovanovich.
Beauchamp, Tom L. und James F. Childress. 2009. Principles of Biomedical Ethics.
Oxford: Oxford University Press.
Behrens, Johann. 2014. Evidence based Nursing. S. 151-164. In Handbuch
Pflegewissenschaft. Studienausgabe, herausgegeben von D. Schaeffer und K.
Wingfeld. Weinheim: Beltz Juventa.
BfS, Bundesamt für Statistik. 2015. Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2013
– Standardtabellen. Definitive Resultate. Neuchâtel: BfS.
Bischoff-Wanner, Claudia. 2014. Pflege im historischen Vergleich. S. 19 – 36. In
Handbuch Pflegewissenschaft. Studienausgabe, herausgegeben von D. Schaeffer
und K. Wingfeld. Weinheim: Beltz Juventa.
Bischoff-Wanner, Claudia. 2002. Empathie in der Pflege. Bern: Hans Huber.
Bischoff, Claudia. 1992. Frauen in der Krankenpflege. Zur Entwicklung von Frauenrolle
und Frauenberufstätigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M.: Campus.
Seite 90
Blüher, Stefan und Manfred Stosberg. 2005. Pflege im Wandel veränderter
Versorgungsstrukturen: Pflegeversicherung und ihre gesellschaftlichen
Konsequenzen. S. 177-192. In Handbuch Pflegewissenschaft. Studienausgabe,
herausgegeben von D. Schaeffer und K. Wingfeld. Weinheim: Beltz Juventa.
Bohnsack, Ralf. 1999. Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in Methodologie
und Praxis qualitativer Forschung. Wiesbaden: Springer.
Boltanski, Luc und Chiapello Eve. 2006. Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz:
UVK.
Bornewasser, Manfred. 2014. Dienstleistungen im Gesundheitssektor. S. 1-26. In
Dienstleistungen im Gesundheitssektor. Produktivität, Arbeit und Management,
herausgegeben von M. Bornewasser, B. Kriegesmann und J. Zülch. Wiesbaden:
Springer.
Bourdieu, Pierre. 2009. Das Elend der Welt. Konstanz: UVK.
Bourdieu, Pierre. 1998. Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Strategie
des wissenschaftlichen Feldes. Konstanz. UVK.
Bourdieu, Pierre. 1988. Gegenfeuer. Konstanz. UVK.
Bourdieu, Pierre. 1987. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen
Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
Breuer, Franz. 2010. Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die
Forschungspraxis. Wiesbaden: VS.
Brügger, Helen. 2015. Betagte in Windeln für die Rendite. In WOZ Die Wochenzeitung
Nr. 05/2015 vom 29. Januar 2015. http://www.woz.ch/1505/langzeitpflege/betagte-
in-windeln-fuer-die-rendite (Besucht am 1. Juni 2015).
Buchinger, Sascha. 2012. Personalmarketing in der stationären Altenhilfe. Fachkräfte
gewinnen und halten. Stuttgart: Kohlhammer.
Budlender, Debbie. 2004. Why Should We Care about UNPAID CARE WORK?
Harare: UNIFEM.
Bundesversammlung, Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
2015. Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994
Webdokument. https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19940073/index.html (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Burawoy, Michael. 2005. 2004 Presidential Address. For Public Sociology. American
Sociological Review. 56(2): 259-294.
Seite 91
Burren, Susanne. 2007. Massenstudienfach, epistemische Fragmentierung und
politische Legitimität. S. 317-336. In Konkurrierende Deutungen des Sozialen.
Geschichts-, Sozial-, und Wirtschaftswissenschaften im Spannungsfeld von Politik
und Wissenschaft, herausgegeben von C. Honegger, H-U. Jost, S. Burren und P.
Jurt. Zürich: Chronos.
Christen, Andreas, Fabian Hürzeler, Sascha Jucker und Emanuel Roos. 2015.
Gesundheitswesen Schweiz 2015. Swiss Issues Branchen. Die Zukunft des
Pflegeheimmarkts. Pfäffikon: Schellenberg.
Christians, Clifford. 2005. Ethics and Politics in Qualitativ Research. S. 139- 164. In
The Sage Handbook Qualitative Research, herausgegeben von N. Denzin und Y.
Lincoln. Thousand Oaks: Sage.
Curaviva und Qualis. 2011. Bedingungen und Einflussfaktoren für einen attraktiven
Arbeitsplatz in Institutionen der Langzeitpflege. Zürich: Curaviva.
Dolder, Peter und Anette Grünig. 2009. Nationaler Versorgungsbericht für die
Gesundheitsberufe 2009. Personalbedarf und Massnahmen zur
Personalsicherung auf nationaler Ebene. Bern: GDK und OdASanté.
Donath, Susan. 2014. Die andere Wirtschaft. Vorschlag für eine eigenständige
feministische Ökonomie. S. 167-177. In Kritik des kritischen Denkens,
herausgegeben von I. Bichsel, U. Knobloch, B. Ringger und H. Schatz. Zürich:
Edition 8.
Dörre, Klaus. 2014a. Sozialkapitalismus und Krise: Von der inneren Landnahme zu
äusserer Dominanz. S. 25-50. In Arbeit in Europa. Marktfundamentalismus als
Zerreisprobe, herausgegeben von K. Dörre, K. Jürgens und I. Matuscheck.
Frankfurt a.M.: Campus.
Dörre, Klaus. 2014b. Prekarität – Zentrum der sozialen Frage im 21. Jahrhundert. Auf
die Plätze, Arbeit (s) los! 23. September 2014. Bremen: Arbeitnehmerkammer.
Dörre, Klaus. 2013. Landnahme. Triebkräfte, Wirkung und Grenzen kapitalistischer
Wachstumsdynamik. S. 112-140. In Die globale Einhegung – Krise, Ursprüngliche
Akkumulation und Landnahmen im Kapitalismus, herausgegeben von M.
Backhouse, O. Gerlach, S. Kalmring und A. Nowak. Münster: Westfälisches
Dampfboot.
Dörre, Klaus. 2012. Die neue Landnahme. Dynamiken und Grenzen des
Finanzmarktkapitalismus. In Soziologie – Kapitalismus – Kritik. Eine Debatte.
herausgegeben von K. Dörre, S. Lessenich und H. Rosa. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.
Seite 92
Dörre, Klaus. 2009. Prekarität im Finanzmarktkapitalismus. S. 35-64. In Prekarität,
Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts,
herausgegeben von R. Castel und K. Dörre. Frankfurt a.M.: Campus.
Dresing, Thorsten und Thorsten Pehl. 2011. Praxisbuch Transkription. Regelsysteme,
Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen. Marburg: VS.
Dunkel, Wolfgang. 2005. Zur Lebensführung von Pflegekräften. S. 227-246. In
Soziologie der Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und Perspektiven,
herausgegeben von K. Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim: Juventa.
Durtschi, Adrian, Barbara Gysi, Silvia Marti, Katharina Prelicz-Huber, Beat Ringger,
Sarah Schilliger, Theresia Storz, Hans Sturm, Susanne Ulrich und Christina
Werder. 2015. Das Denknetzpflegemodell. Eine Skizze. Denknetz Fachgruppe
Langzeitpflege und -betreuung. Zürich: Denknetz.
EDI, Eidgenössisches Departement des Inneren. 2015. Verordnung des EDI über
Leistungen in der obligatorischen Krankenversicherung (Krankenpflege-
Leistungsverordnung, KLV) vom 29. September 1995 (Stand am 1. Juni 2015).
Webdokument: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19950275/index.html (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Elias, Norbert. 2004. Was ist Soziologie? Weinheim: Juventa.
Federici, Silvia. 2013. Ursprüngliche Akkumulation, Globalisierung und Reproduktion.
S. 40 – 52. In Die globale Einhegung – Krise, Ursprüngliche Akkumulation und
Landnahmen im Kapitalismus, herausgegeben von M. Backhouse, O. Gerlach, S.
Kalmring und A. Nowak. Münster: Westfälisches Dampfboot.
Federici, Silvia. 2012. Aufstand aus der Küche. Reproduktionsarbeit im globalen
Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution Reihe: Kittchen
Politics, Band 1. Münster: Edition Assemblage.
Feministische AutorInnengruppe. 2013. Das Theorem der Neuen Landnahme: Eine
feministische Rückeroberung. S. 99-118. In Care statt Crash Sorgeökonomie und
die Überwindung des Kapitalismus, herausgegeben von H. Baumann, I. Bischel,
M. Gemperle, U. Knobloch, B. Ringger und H. Schatz. Zürich: Edition 8.
Fenchel, Volker. 2008. Sozialwissenschaftliche Theorieansätze und ihre Bedeutung für
die Pflege. S. 143-176. In Pflegewissenschaft 1. Lehr- und Arbeitsbuch zur
Einführung in das wissenschaftliche Denken in der Pflege, herausgegeben von H.
Brandenburg und S. Dorschner. Bern: Hans Huber.
Flick, Uwe. 2011. Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt.
Flick, Uwe. 2008. Triangulation. Eine Einführung. Wiesbaden: VS.
Seite 93
Folbre, Nancy. 2006. Nursebots to the Rescue? Immigration, Automation and Care.
Globalizations. 3(3): 349-360.
Fuchs-Heinritz, Werner und Alexandra König. 2005. Pierre Bourdieu. Konstanz: UVK.
Garms-Homolovâ, Vjenka. 2014. Pflege im Alter. S. 405- 428. In Handbuch
Pflegewissenschaft. Studienausgabe, herausgegeben von D. Schaeffer und K.
Wingfeld. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
Garz, Deltlef und Klaus Kraimer. 1991. Qualitativ-empirische Sozialforschung im
Aufbruch. S. 1-34. In Qualitativ-Empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden,
Analysen, herausgegeben von D. Garz und K. Kraimer. Opladen: Westdeutscher
Verlag.
Glasl, Friedrich. 1994. Konfliktmanagement. Ein Handbuch zur Diagnose und
Behandlung von Konflikten für Organisationen und Berater. Bern: Paul Haupt.
Grabbe, Yvonne, Hans-Dieter Nolting und Stefan Loos. 2005. DAK-BWG.
Gesundheitsreport 2005. Stationäre Krankenpflege. Arbeitsbedingungen und
Gesundheit von Pflegenden in Einrichtungen der stationären Krankenpflege in
Deutschland vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Gesundheitssystems.
Berlin: Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH.
Greuter, Susy. 2015. Care in der Pflege – ein Auslaufmodell. In Krankenpflege 5/2015,
Mai 2015: 14-17.
Greuter, Susy. 2013. Rationalisiert, rationiert und prekarisiert: Die Situation der Care-
Arbeiterinnen in der Spitex. In Arbeit ohne Knechtschaft. Bestandsaufnahmen und
Forderungen rund ums Thema Arbeit, herausgegeben von R. Gurny und U.
Teklenburg. Zürich: Edition 8.
Haller, Lisa Y. und Chorus Silke. 2013. Care, Wert und Wohlfahrtsstaat. Plädoyer für
die Berücksichtigung des Staates als zentraler Akteur der politischen Ökonomie.
S. 64-73. In Care statt Crash. Sorgeökonomie und die Überwindung des
Kapitalismus, herausgegeben von H. Baumann, I. Bischel, M. Gemperle, U.
Knobloch, B. Ringger und H. Schatz. Zürich: Edition 8.
Harvey, David, 2007. Kleine Geschichte des Neoliberalismus. Zürich: Rotpunktverlag.
Harvey, David. 2005. The new imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Heintze, Cornelia. 2015. Skandinavien macht es vor: Eine gute Langzeitpflege und –
betreuung ist gut für alle. VPOD-Verbandskonferenz, Januar 2015. Zürich:
Denknetz und VPOD.
Helfferich, Cornelia. 2011. Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung
qualitativer Interviews. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Seite 94
Hofmann, Friedrich, Martina Michaelis, Matthias Nübling und Ulrich Stössel. 1998.
Bandscheibenerkrankungen und Wirbelsäulenbeschwerden im Pflegeberuf. Die
internationale Freiburger Wirbelsäulenstudie. S. 235-251. In Berufsbedingte
Erkrankungen der Lendenwirbelsäule, herausgegeben von D. Wolter und H.
Seide. Berlin: Springer.
Höpflinger, Francois, Lucy Bayer-Oglesby und Andrea Zumbrunn. 2011.
Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien für die
Schweiz. Bern: Hans Huber.
Höpflinger, Francois. 2004. Age Report 2004. Traditionelles und neues Wohnen im
Alter. Zürich: Seismo.
Horster, Detlef. 2013. Paradigmenwechsel in der Systemtheorie. (Einführung). S. 1-8.
In Soziale Systeme, herausgegeben von D. Horster. Berlin: Akademie.
Hug, Thomas und Gerald Poscheschnik. 2015. Empirisch forschen. Die Planung und
Umsetzung von Projekten im Studium. Konstanz: UVK.
Initiativkomitee Thuner-Altersheiminitiative. 2015. Die Initiative. Webdokument.
http://www.altersheimeretten.ch/?page_id=180 (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Jäggi, Jolanda und Kilian Künzi. 2015. Unterstützung für Hilfe- und Pflegebedarf im
Alter – Ein Systemvergleich zwischen Deutschland, Japan und der Schweiz. Bern:
Büro BASS.
Kalmring, Stefan. 2013. Die Krise als Labor gesellschaftlicher Entwicklungen.
Fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation und die grossen Krisen der
Kapitalakkumulation. S. 72-111. In Die globale Einhegung – Krise, Ursprüngliche
Akkumulation und Landnahmen im Kapitalismus, herausgegeben von M.
Backhouse, O. Gerlach, S. Kalmring und A. Nowak. Münster: Westfälisches
Dampfboot.
Kassensturz und Espresso. 2013. Personal-Qualifikation in Pflegeheimen.
Webdokument.
http://www.srf.ch/konsum/content/download/1615162/14247454/version/1/file/c412
ed147cd10a78d0720deb5e0cca0a.pdf (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Klie, Thomas. 2014. Wen kümmern die Alten? Auf dem Weg in eine sorgenden
Gesellschaft. München: Pattloch.
Knobloch, Ulrike. 2013. Sorgenökonomie als kritische Wirtschaftstheorie des Sorgens.
S. 9-23. In Care statt Crash. Sorgeökonomie und die Überwindung des
Kapitalismus, herausgegeben von H. Baumann, I. Bischel, M. Gemperle, U.
Knobloch, B. Ringger und H. Schatz. Zürich: Edition 8.
Seite 95
Koch-Straube, Ursula. 2005. Lebenswelt Pflegeheim. S.222-227. In Soziologie der
Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und Perspektiven, herausgegeben von K.
Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim und München: Juventa.
Koch-Straube, Ursula. 2003. Fremde Welt Pflegeheim. Eine ethnologische Studie.
Bern: Hans Huber.
Kössler, Reinhart. 2013. Prozesse der Trennung. Gewalt im Ursprung und
fortgesetztes Prozessieren des Kapitals. S. 20 – 39. In Die globale Einhegung –
Krise, Ursprüngliche Akkumulation und Landnahmen im Kapitalismus,
herausgegeben von M. Backhouse, O. Gerlach, S. Kalmring und A. Nowak.
Münster: Westfälisches Dampfboot.
Kraus, Björn: 2013. Erkennen und Entscheiden. Grundlagen und Konsequenzen eines
erkenntnistheoretischen Konstruktivismus für die Soziale Arbeit. Weinheim: Beltz
Juventa.
Krotz, Friederich. 2005. Neue Theorien entwickeln. Eine Einführung in die Grounded
Theory, die Heuristische Sozialforschung und die Ethnographie anhand von
Beispielen aus der Kommunikationsforschung. Köln: Herbert von Halem.
Kruse, Jan. 2015. Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. Weinheim:
Beltz Juventa.
Künzi, Kilian und Marianne Schär Moser. 2002. Die Arbeitssituation im Pflegebereich
im Kanton Bern. Untersuchung im Rahmen des Projekts „Verbesserung der
Arbeitssituation im Pflegebereich (VAP)“ Synthesebericht. Bern: Büro BASS, Büro
a&o.
Kurtz, Thomas. 2002. Berufssoziologie. Bielefeld: Transcript.
Lampart, Daniel. 2015. Falsche Vorwürfe von Arbeitgebern und Economiesuisse:
Beschäftigungswachstum im Gesundheits- und Sozialwesen bei den privaten
Firmen, nicht beim Staat. Webdokument: http://www.sgb.ch/aktuell/blog-daniel-
lampart/entry/falsche-vorwuerfe-von-arbeitgebern-und-economiesuisse-
beschaeftigungswachstum-im-gesundheits-und-s/year/2015/month/03/day/30/
(zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Loffing, Christian und Stephanie Geise. 2010. Managment und Betriebswirtschaft in der
ambulanten und stationären Altenpflege. Lehrbuch für Führungskräfte,
Weiterbildungsteilnehmende und Studenten. Bern: Hans Huber.
Ludwig, Iris und Monika Schäfer. 2011. Die Differenzierung beruflicher Funktionen in
der Pflege als Herausforderung und Chance. S. 24-41. In Pflegewissenschaft in
der Praxis. Eine kritische Reflexion, herausgegeben von S. Käppeli. Bern. Hans
Huber.
Luhmann, Niklas. 1986. Ökologische Kommunikation. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Seite 96
Luxemburg, Rosa. 1975. Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen
Erklärung. In Gesammelte Werke Band 5 – Ökonomische Schriften. Berlin: Dietz.
Madörin, Mascha. 2014a. Ökonomisierung des Gesundheitswesens − Erkundungen
aus der Sicht der Pflege. Winterthur: Departement Gesundheit. Institut für Pflege.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft.
Madörin, Mascha. 2014b. Ökonomisierung des Gesundheitswesens – Erkundungen
aus der Sicht der Pflege Teil 1: Der Kostendruck auf das Gesundheitswesen und
auf die Pflege. Winterthur: Departement Gesundheit. Institut für Pflege. Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaft.
Madörin, Mascha. 2014c. Kommentar zu Donaths Artikel aus Sicht einer feministischen
Politökonomin. S. 178-187. In Kritik des kritischen Denkens, herausgegeben von I.
Bichsel, U. Knobloch, B. Ringger und H. Schatz. Zürich: Edition 8.
Madörin, Mascha. 2013. Die Logik der Care Arbeit. Annäherung einer Ökonomin. S.
128 – 145. In Arbeit ohne Knechtschaft. Bestandsaufnahmen und Forderungen
rund ums Thema Arbeit, herausgegeben von R. Gurny und U. Teklenburg. Zürich:
Edition 8.
Madörin, Mascha. 2011. Das Auseinanderdriften der Arbeitsproduktivität: Eine
feministische Sicht. S. 56-70. In Gesellschaftliche Produktivität jenseits der
Warenform, herausgegeben von H. Baumann, B. Ringger, H. Schatz, W. Schöni
und B. Walpen. Zürich: Edition 8.
Madörin, Mascha. 2007. Neoliberalismus und die Reorganisation der Care-Ökonomie.
Eine Forschungsskizze. S. 141-162. In Zur politischen Ökonomie der Schweiz.
Eine Annäherung, herausgegeben von H. Baumann, B. Ringger, H. Schatz, W.
Schöni und B. Walpen. Zürich: Edition 8.
Maiolino, Angelo. 2014. Politische Kultur in Zeiten des Neoliberalismus. Eine
Hegemonieanalyse. Bielefeld. Transkript.
Mankiw, Nicholas Gregory und Markus Taylor: 2004. Grundzüge der
Volkswirtschaftslehre. Stuttgart: Schäffer-Pöschel.
Mankiw, Nicholas Gregory. 2004. Principles of Economics. Mason, Ohio: Thomson
South-Western.
Manzei, Alexandra und Rudi Schmiede. 2014. 20 Jahre Wettbewerb im
Gesundheitswesen. Theoretische und empirische Analysen zur Ökonomisierung
von Medizin und Pflege. Wiesbaden: Springer.
Marx, Karl. 1972. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Dietz.
Seite 97
Marx, Karl und Friedrich Engels. 1968. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. S.
741-791. In Das Kapital herausgegeben von K. Marx und F. Engels - Werke, Band
23, Bd. I, Siebenter Abschnitt. Berlin: Dietz Verlag.
Meuser, Michael und Ulrike Nagel. 1991. ExpertInneninterviews. Vielfach erprobt,
wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. S. 441 – 467. In
Qualitativ-Empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden, Analysen,
herausgegeben von D. Garz und K. Kraimer. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Michaelis, Martina. 2005. Pflege als extreme Verausgabung. Arbeitssoziologische
Aspekte. S. 211-226. In Soziologie der Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und
Perspektiven, herausgegeben von K. Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim:
Juventa.
Moser, Heinz. 2008. Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung.
Zürich: Pestalozzianum und Lambertus.
Müller, Herbert. 2011. Arbeitsorganisation in der Altenpflege. Ein Beitrag zur
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Hannover: Schlütersche.
Nerdinger, Friedmann W. 2012. Emotionsarbeit im Dienstleistungsbereich. Report
Psychologie. 37(1): 8-18.
Nicolai, Peider. 2009. Systemwechsel Objekt-/Subjektfinanzierung. Neue
Herausforderungen für öffentliche Alters- und Pflegeinstitutionen. Bern: Senevita.
Oppolzer, Alfred. 1974. Entfremdung und Industriearbeit: die Kategorie der
Entfremdung bei Karl Marx. Köln: Pahl-Rugenstein.
Pelizzari, Alessandro. 2001. Die Ökonomisierung des Politischen. Konstanz: UVK.
Prey, Hedwig, Martin Schmid, Marco Storni und Sybille Mühleisen. 2004. Zur Situation
des Personals in der schweizerischen Langzeitpflege. Zürich: Rüegger.
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr. 2014. Qualitative Sozialforschung. Ein
Arbeitsbuch. München: Oldenbourg.
Rabinbach, Anson. 2001. Motor Mensch. Kraft, Ermüdung, und die Ursprünge der
Moderne. Wien: Turia und Kant.
Rasch, Wilhelm. 2013. Soziale Systeme. (Kapitel 1). S. 9-22. In Soziale Systeme,
herausgegeben von D. Horster. Berlin: Akademie.
Rickenbach, Rainer. 2014. Private Investoren erobern Altersheime. In Neue Luzerner
Zeitung Nr. 59 vom 12. März 2014, S. 3.
Rieger, Andreas, Vania Alleva und Pascal Pfister. 2012. Verkannte Arbeit
Dienstleistungsangestellte in der Schweiz. Zürich: Rotpunktverlag.
Seite 98
Rosenthal, Thomas. 2005. Pflege und Managment: ein Spannungsfeld. Konzepte –
Kontroversen – Konsequenzen. S. 299-322. In Soziologie der Pflege. Grundlagen,
Wissensbestände und Perspektiven, herausgegeben von K. Schroeter und T.
Rosenthal. Weinheim: Juventa.
Rüegger, Heinz und Werner Widmer. 2010. Personalnotstand in der Langzeitpflege.
Eine Sekundäranalyse vorliegender Texte. Zollikerberg: Institut Neumünster.
Ryter, Elisabeth und Marie-Louise Barben. 2015. Care Arbeit unter Druck. Ein gutes
Leben für Hochalterige braucht Raum. Manifestgruppe der GrossmütterRevolution.
Bern: GrossmütterRevolution.
SBK, Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. 2007.
Professionelle Pflege Schweiz. Bern: SBK.
Schaffert, René, Dominik Robin, Romy Mahrer Imhof und Peter Rüesch. 2015.
Berufslaufbahnen und Berufsrollen in der Pflege aus der Sicht von
Berufseinsteigenden. Winterthur: Departement Gesundheit. Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaft.
Schlenczek, Gudrun. 2011. Umnutzung: Vom Hotel zum Heim. In htr -hotel revue vom
20. Oktober 2011. ttp://www.htr.ch/fokus/umnutzung-vom-hotel-zum-heim-
28704.html (zuletzt besucht am 1. Juni 2015).
Schranz, Mario. 2005. Die Problematisierung des Service Public in der Schweiz – Der
Anfang vom Ende des neoliberalen Gesellschaftsmodells? S. 74-89. In Triumpf
und Elend des Neoliberalismus, herausgegeben von K. Imhof und T.S. Eberle.
Zürich: Seismo.
Schroeter, Klaus. 2006. Das soziale Feld der Pflege. Eine Einführung in Strukturen,
Deutungen und Handlungen. Weinheim: Juventa.
Schroeter, Klaus. 2005. Pflege als figuratives Feld. S. 85 – 106. In Soziologie der
Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und Perspektiven, herausgegeben von K.
Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim: Juventa.
Schroeter, Klaus und Thomas Rosenthal. 2005. Soziologie der Pflege. Grundlagen,
Wissensbestände und Perspektiven. Weinheim: Juventa.
Schwaller, Corinne. 2013. Die Ökonomisierung der ambulanten Pflege. Erfahrungen
und Einschätzungen von Pflegenden aus einer Arbeitswelt im Umbruch.
Arbeitsblatt Nr. 58. Bern: Institut für Sozialanthropologie.
Schwendimann, René, Marcel Widmer, Dietmar Ausserhofer und Sabina De Geest.
2014. Das Pflegefachpersonal in Schweizer Spitälern im europäischen Vergleich.
Obsan Bulletin 3/2014. Neuenburg: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
Seite 99
Sowinski, Christine und Gergana Ivanova. 2014. Stationäre Langzeitpflege. S. 531-
542. In Handbuch Pflegewissenschaft. Studienausgabe, herausgegeben von D.
Schaeffer und K. Wingfeld. Weinheim: Beltz Juventa.
Spöhring, Walter. 1989. Qualitative Sozialforschung. Wiesbaden: Springer.
Strauss, Anselm und Juliet Corbin. 1996. Grounded Theory. Auszüge. Grundlagen
qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Strohmeier Navarro Smith, Rahel. 2012. Alterspflege in der Schweiz. Ein föderal
geprägtes Politikfeld im europäischen Vergleich. Bern: Peter Lang.
Strübing, Jörg. 2004. Grounded Theory. Wiesbaden: VS.
Swedberg, Richard. 2009. Grundlagen der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS.
Tedlock, Barbara. 2005. The observation of participation and the emergence of public
ethnography. S. 467-481. In The Sage Handbook Qualitative Research,
herausgegeben von N. Denzin und Y. Lincoln. Thousand Oaks: Sage.
Ten Brink, Tobias. 2010. Strukturmerkmale des chinesischen Kapitalismus. In MPIfG
Discussion Paper 10 /1. Februar 2010. Köln: Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung.
Treibel, Annette. 2008. Die Soziologie von Norbert Elias. Eine Einführung in ihre
Geschichte, Systematik und Perspektiven. Wiesbaden: VS.
Unger, Antonia. 2014. Professionelle Pflegedienstleistung im Spannungsfeld von
Emotionen, Emotionsarbeit und Effizienz. S. 297-325. In Dienstleistungen im
Gesundheitssektor. Produktivität, Arbeit und Managment, herausgegeben von M.
Bornewasser, B. Kriegesmann und J. Zülch. Wiesbaden: Springer.
Unia. 2015. Manifest für gute Pflege und Betreuung. Bern: Unia.
Voges, Wolfgang. 2002. Pflege alter Menschen als Beruf. Soziologie eines
Tätigkeitfeldes. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Wacquant, Loïc. 2009. Bestrafen der Armen: Zur neoliberalen Regierung der sozialen
Unsicherheit. Opladen: Budrich.
Wahl, Asbjorn. 2011. The Rise and Fall of the Welfare State. London: Pluto.
Weber, Max. 1980. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrisse der verstehenden
Soziologie. Tübingen: Mohr.
Widmer, Richard. 2012a. Zunahme der administrativen Aufgaben in den Alters- und
Pflegeheimen. Bestandsaufnahme sowie Massnahmen und Forderungen. Bern:
Curaviva.
Seite 100
Widmer, Richard. 2012b. Die Volkswirtschaftliche Bedeutung der Alters- und
Pflegeinstitutionen in der Schweiz. Erhebung der Leistungen, der Arbeits- und
Ausbildungsplätze sowie der Wertschöpfung 2010. Bern: Curaviva.
Winker, Gabriele. 2013. Zur Krise sozialer Reproduktion. S. 119-133. In Care statt
Crash. Sorgeökonomie und die Überwindung des Kapitalismus, herausgegeben
von H. Baumann, I. Bischel, M. Gemperle, U. Knobloch, B. Ringger und H. Schatz.
Zürich: Edition 8.
Winter, Maik. 2005. Pflege in prekärer Sonderstellung. Berufssoziologische Aspekte. S.
279-298. In Soziologie der Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und
Perspektiven, herausgegeben von K. Schroeter und T. Rosenthal. Weinheim:
Juventa.
Witterstätter, Kurt. 1996. Grundwissen Soziologie für die Pflege. Pflege in der
Lebenswelt. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Wolkowitz, Carol. 2006. Bodies at work. London: Sage.
Zogg, Claudio. 2011. Wer zahlt die Pflege? Die neue Pflegefinanzierung. S. 87-107. In
Sozialalmanach 2011. Schwerpunkt: Das vierte Lebensalter. Das Caritas-Jahrbuch
zur sozialen Lage in der Schweiz. Trends, Analysen, Zahlen, herausgegeben von
I. Meyer. Luzern: Caritas.
Zùñiga, Franziska, Dietmar Ausserhofer, Christine Serdaly, Catherine Bassal, Sabina
de Geest und René Schwendimann. 2013. SHURP. Swiss Nursing Homes Human
Resources Project. Schlussbericht zur Befragung des Pflege- und
Betreuungspersonales in Alters- und Pflegeinstitutionen der Schweiz. Oktober
2013. Basel: Institut für Pflegewissenschaft. Universität Basel.
10. Abbildungsverzeichnis
Titelbild: Schmid, Roger. 2007. Ambulanter Pflegedienst. Webdokument:
http://www.karikatur-cartoon.de/medizin/ambulanter_pflegedienst.htm (zuletzt
besucht am 1. Juni 2015).
11. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Interviewte Pflegekräfte. Quelle: Eigene Darstellung.
Tabelle 2: Interviewte Expertinnen und Experten. Quelle. Eigene Darstellung.