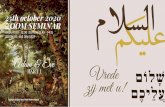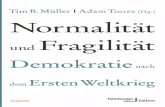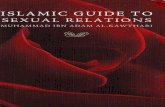Adam Smiths Problem. Die Wirkungsgeschichte der philosophischen Theorie und ökonomischen Lehre von...
-
Upload
uni-heidelberg -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Adam Smiths Problem. Die Wirkungsgeschichte der philosophischen Theorie und ökonomischen Lehre von...
!!!!!!Adam Smiths Problem
Die Wirkungsgeschichte der philosophischen Theorie und ökonomischen Lehre von Adam Smith und ihre Probleme
!!!!
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Theologisches Seminar
!Bachelorarbeit
Betreuer: Prof. Dr. Klaus Tanner
Fachbereich: Systematische Theologie
!Student: Jonas Bedford-Strohm 1
Matrikelnummer: 3122527
Abschluss: Bachelor of Arts
1. Hauptfach: Christentum und Kultur
2. Hauptfach: Philosophie
!
Anschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 15, 69117 Heidelberg, Email: [email protected]
!!!!
»Ich bin ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will und stets das Gute schafft.« 2
Mephistopheles
!!
»Von einer unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung
der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre,
wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre; und so
fördern sie, ohne es zu beabsichtigen, ja ohne es zu wissen, das Interesse der Gesellschaft
und gewähren die Mittel zur Vermehrung der Gattung.« 3
Adam Smith
!!
!!
VON GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Werke - Hamburger Ausgabe, Band III, Dramatische Dichtungen I, Faust I, 2
München 1982, S. 47.
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010, S. 296f.3
Abstrakt:
Diese Arbeit widmet sich dem sogenannten Adam-Smith-Problem, das der Autor als
„Adam Smiths Problem” versteht und in einer postulierten Differenz von „Theory of
Moral Sentiments” und „Wealth of Nations” nicht erschöpfend behandelt sieht. Die
Arbeit formuliert deshalb Gedanken auf dem Weg zu einem integrierten Verständnis der
Hauptwerke Smiths und stellt die Sympathie als Prinzip sittlicher Richtigkeit von
Handlungen als Grundlage der Moralphilosophie Adam Smiths dar. Sie wendet
multikontextuelles Denken auf das Adam-Smith-Problem an und entwickelt aus der
Smithschen Anthropologie Ansätze für einen relationalen Rationalitätsbegriff. Die Arbeit
plausibilisiert Kants Begriff des moralischen Geschmacks im Kontrast zum moralischen Gefühl
bei Smith, dem moralischen Sinn bei Hume und dem Common Sense von Reid und Arendt
und zeigt, dass Gemeinwohl und Eigennutz keineswegs als sich gegenüberstehende
Entitäten in Smiths Werken zu finden sind. Die Arbeit spürt der Entstehungs- und
Rezeptionsgeschichte, anthropologischen Grundpfeilern, sowie erkenntnistheoretischen
und religiösen Grundlagen in Smiths Hauptwerken nach. Abschließend gewinnt sie aus
den Überlegungen zur empiristischen und deistischen Prägung Smiths einige
Schlussfolgerungen für aktuelle Debatten zu Modus und Orientierung der modernen
Ökonomik.
!
!3
I. Einführung und Kontext 6
A. Motivation und Methodik der Arbeit 6
B. Entstehung und Aufnahme der Smithschen Hauptwerke 9
II. Grundzüge der Moralphilosophie 13
A. Sympathie als Prinzip sittlicher Richtigkeit der Handlungen 13
B. Der unparteiische Zuschauer 16
C. Harmonie der Einzelinteressen 18
III. Das „Adam-Smith-Problem” 24
A. Verhältnisbestimmung von Theory und Wealth 24
B. Moral Hazard und die Rationalitätenfalle 30
C. Die funktionalistische Anonymität des Marktes 33
D. Der Markt als System der sozialen Kommunikation 35
E. Relationale Rationalität und detranszendentalisierte Vernunft 41
F. Die Kontextualität menschlicher Existenz 43
IV. „Inquiry into the Nature” - Smiths Rhetorik der Natur 46
A. Der deistische Naturbegriff 46
B. Der natürliche Preis und die Gravitationsmetapher 50
C. Das System der natürlichen Freiheit 54
D. Vergesellschaftung durch Kommerzialisierung 56
V. Erkenntnistheoretische Grundlagen 58
A. Grundgedanken des angelsächsischen Empirismus 58
B. Moderne Wirkungsgeschichte des Empirismus 60
C. Der Wissenschaftsbegriff: Popper, Kant, Smith 64
D. Common Sense statt Moral Sense 66
VI. Schlussfolgerungen für die Politische Ökonomik 67
A. Die Autonomie der Wirtschaftswissenschaft 67
B. Der neue Protest gegen die neoklassische Lehre 73
C. Abschließende Überlegungen zu Smiths Anthropologie 75
!4
D. Zusammenfassende Thesen 77
VII. Literaturverzeichnis 80
A. Werkausgaben 80
B. Sekundärliteratur zu Adam Smith: Monographien 80
C. Sekundärliteratur zu Adam Smith: Aufsätze und Artikel 81
D. Ergänzende Primärliteratur 82
E. Ergänzende Sekundärliteratur 84
F. Lexikonartikel 86
G. Links 87
VIII. Erklärung 88
!5
I. Einführung und Kontext
A. Motivation und Methodik der Arbeit
„It is terrific to contemplate the abysmal gulf of incomprehension that has
opened itself between us and the classical economists. Only one century
separates us from them: ...I say a century; but even a century after, in 1870, they
did not understand it.... The classical economists said things which were
perfectly true, even according to our standards of truth: they expressed
them very clearly, in terse and unambiguous language, as is proved by the
fact that they perfectly understood each other. We don’t understand a word
of what they said: has their language been lost? Obviously not, as the
English of Adam Smith is what people talk today in this country. What has
happened then?” 4
Mit diesem Zitat von Piero Sraffa eröffnet Tony Aspromourgos seine Untersuchung der
ökonomischen Lehre Adam Smiths und der Konstruktion der Politischen Ökonomik als
eigenständiger Disziplin. Sraffa drückt darin 1927 eine grundlegende Herausforderung
der ökonomischen und wirtschaftsgeschichtlichen Wissenschaft seiner Zeit aus. Er trifft
damit auch heute noch den berühmten Nagel auf den Kopf. Diese Arbeit soll deshalb
der Wirkungsgeschichte der ökonomischen Lehre und philosophischen Theorie Adam
Smiths nachspüren und ihren Fehlentwicklungen und Zerrbildern durch eine
Rekonstruktion anthropologischer Grundkonstanten und theoretischer Grundlagen in
Smiths Werk entgegenwirken. Denn auch für Smith gilt, was Jürgen Habermas nüchtern
feststellt: „die Wirkungsgeschichte unsrer Texte weht, wohin sie will.” 5
Das Thema „Adam Smiths Problem. Die Wirkungsgeschichte der philosophischen
Theorie und ökonomischen Lehre von Adam Smith und ihre Probleme” habe ich
gewählt vor dem Hintergrund der schleichenden „Immunisierung gegen die Erfahrung
als Tendenz der Neoklassik”, wie sie Hans Albert schon 1963 in seinem Aufsatz „Modell-
Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer
!6
PASINETTI, LUIGI L.: Continuity and Change in Sraffa’s Thought: an Archival Excursus, in: COZZI, TERENZIO; 4
MARCHIONATTI, ROBERTO: (HRSG.): Piero Sraffa’s Political Economy: a Centenary Estimate, London 2001. S.153.
FUNKEN, MICHAEL (HRSG.): Über Habermas. Gespräche mit Zeitgenossen, Darmstadt 2008. S. 189.5
Beleuchtung” beschreibt, war doch Adam Smith als der Gründervater der 6
Nationalökonomie selbst stark durch den schottischen Empirismus seiner Zeit geprägt. 7
Dieses Paradox weist uns auf eine provokante Zeitdiagnose: Die Volkswirtschaftslehre
hat sich heute nicht nur immunisiert gegen weite Teile der menschlichen Erfahrung, sie
hat vor allem ihren disziplinimmanenten Reflexionsrahmen für die Grundbegriffe der
eigenen Wissenschaft weitgehend abgeschafft bzw. in die Philosophie abgedrängt. Diesen
Rahmen versuchen nun Initiativen rund um die Welt wiederherzustellen und wählen
dafür zunehmend den Modus des interdisziplinären Gesprächs. Wie die Philosophie darf
sich auch die Theologie diesem Thema nicht entziehen, denn: Ökonomische Theorie
prägt wie nur wenig andere theoretische Voraussetzungen unserer Gesellschaftsordnung
unser aller täglich Leben.
Nun kann die Theologie dieses Thema also nicht einfach von sich weisen und den
Ökonomen allein, oder im Verbund mit den empirischen Sozialwissenschaften das Feld
überlassen, betrifft doch alles, was zum Thema diskutiert wird, die christliche Kirche, die
Theologie und Milliarden Gläubige rund um den Globus in einer Art und Weise, die
keine Ignoranz erlaubt, wenn die gesellschaftlichen Grundimpulse der christlichen Idee
Wirkung erfahren sollen. So kann die Theologie in den anthropologischen Diskussionen
um das Menschenbild des homo oeconomicus liefern, indem sie Kon- und Divergenzen zum
Menschenbild der Bibel herausarbeitet wie es auch die Rechtswissenschaft im Verhältnis
zum Menschenbild des Grundgesetzes unternommen hat. 8
Die Theologie kann ferner helfen, die quasireligiösen Elemente und theologischen
Grundlagen ökonomischer Sozialtheorien zu verstehen und dazu beitragen, die idolatrous
elements der herrschenden Glaubenssysteme zu identifizieren. Diese Elemente in den
nichtreligiösen Glaubenssystemen der verschiedenen Wirtschaftstheoretiker können ein
außerordentlich gesellschaftsschädigendes Moment entwickeln. Was Paul Tillich für den
!7
ALBERT, HANS: Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer Beleuchtung. 6
in: KARRENBERG, FRIEDRICH; ALBERT, HANS (HRSG.): Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard Weisser, Berlin 1963. S. 51.
Smith wird oft auch (gemeinsam mit François Quesnay) als Gründervater der Politischen Ökonomik bezeichnet. 7
Für eine ausführliche Geschichte der Entstehung der Politischen Ökonomik vgl. HUTCHISON, TERENCE WILMOT: Before Adam Smith: the Emergence of Political Economy, 1662–1776, Oxford 1988. Und: TROELTSCH, ERNST: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 345f.
Vgl. GRÖSCHNER, ROLF: Der homo oeconomicus und das Menschenbild des Grundgesetzes. in: ENGEL, 8
CHRISTOPH; MORLOK, MARTIN (HRSG.): Öffentliches Recht als ein Gegenstand ökonomischer Forschung, Tübingen 1998.
religiösen Glauben formuliert, gilt selbstverständlich auch für säkulare Glaubenssysteme:
„Idolatrous faith has more disintegrating power than indifference, just because it is faith
and produces a transitory integration. This is the extreme danger of misguided,
idolatrous faith, and the reason why the prophetic Spirit is above all the Spirit which
fights agains the idolatrous distortion of faith.” Qualifizierte Kritik kann auf diesem 9
Gebiet vor allem von Religionsphilosophie und Theologie geübt werden. Insofern ist die
Beteiligung an den laufenden Diskursen der Wirtschaftstheorie notwendigerweise ein
Diskurs, an dem sich Religionsphilosophie und Theologie zu beteiligen haben.
Für die fruchtbare Beteiligung am interdisziplinären Gespräch ist es für die Theologie
notwendig, die Ursprünge der Diskurse kennenzulernen und die philosophischen
Entscheidungen nachzuvollziehen, die das heutige Bild der Ökonomie und unseres
Verständnisses von Wirtschaft und ihrer Wissenschaft prägen. Deshalb habe ich mich
bemüht, nicht nur isoliert den Denker Adam Smith darzustellen, sondern immer wieder
knappe Verbindungslinien in die griechische Antike, die frühe Neuzeit, das schottische
Umfeld Smiths und die Korrespondenz zur aufklärerischen Philosophie auf dem
Festland bis hin zu Anknüpfungspunkten und Gegenreaktionen im 20. Jahrhundert zu
ziehen. Durch eingestreute Referenzen auf aktuelle Diskurse habe ich mich bemüht,
beispielhaft die unmittelbare Relevanz der historischen Aufarbeitung philosophischer
Theorien für das Verständnis unserer Welt heute zu zeigen.
Bei einem solch weit gespannten Spektrum an Literatur droht die Unübersichtlichkeit
und Beliebigkeit, deshalb habe ich mich bemüht, die weiterführenden Hinweise sorgfältig
auszuwählen. Das ausführliche Studium der Fußnoten wird auf einen reichen Schatz an
Literatur zum Thema und seinem Kontext verweisen, den ich selbst beim Schreiben
dieser Zeilen in seiner Fülle und Tiefe nicht voll zu erschließen imstande war. Insofern
sind diese Hinweise nicht nur als Referenzen, sondern auch als Auftrag zu verstehen, den
in seiner aktuellen Form noch jungen Diskurs weiter zu stimulieren und in Verbindung
zu vergangenen Debatten zum Thema zu setzen.
Diese Arbeit wird von der traditionellen Form des generischen Maskulinums als
grammatisch inklusiver Form Gebrauch machen. Ich werde aus Gründen der flüssigen
Lesbarkeit außerdem die kursiv gedruckten Schlüsselwörter Theory und Wealth statt der
gängigen Abkürzungen TMS und WN als Kurzform für die „Theory of Moral
!8
TILLICH, PAUL: Dynamics of Faith, New York 1957. S. 110. 9
Sentiments” und die „Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”
verwenden.
Als Textgrundlage dienen vor allem die „Theorie der ethischen Gefühle” im von Walther
Eckstein übersetzten Text der sechsten Originalauflage, der „Wohlstand der Nationen” 10
in der Übersetzung von Horst Recktenwald, sowie die „Essays on Philosophical 11
Subjects” in der von Ross, Bryce und Wightman besorgten Ausgabe der Glasgow
Edition. 12
B. Entstehung und Aufnahme der Smithschen Hauptwerke
Adam Smith, 1732 in Kirkcaldy geboren und 1790 in Edinburgh gestorben, gilt im
öffentlichen Bewusstsein heute vor allem als Gründervater der modernen
Nationalökonomie. Begründet liegt das in seiner umfangreichen und leicht 13
verständlichen Formulierung und Weiterentwicklung des marktwirtschaftlichen Denkens
seiner Zeit in seinem ökonomischen Hauptwerk „An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations”. Smith selbst verstand sich allerdings nicht explizit als
Ökonom, sondern vor allem als Moralphilosoph. Die Profession des Ökonomen ist kein
zeitgenössischer Begriff, sondern wurde erst im Lauf der Rezeptionsgeschichte der
klassischen Ökonomen zu einem eigenständigen Berufsbild. Deswegen lohnt die
Betrachtung von Smiths Werken nicht nur unter rein wirtschaftstheoretischen, sondern
auch philosophischen bzw. philosophiegeschichtlichen Gesichtspunkten. Diese Arbeit
widmet sich deshalb in ihren Hauptteilen den Grundzügen der Smithschen
Moralphilosophie (II), dem integrierten Verständnis von Smiths Gesamtwerk (III), sowie
einem rhetorisch-analytischen Teil (IV), der am Beispiel von Smiths Newton-Rezeption
und seiner Verwendung des Naturbegriffs einige Problemanzeigen für die kritische
Lektüre Adam Smiths formuliert. Aus dem philosophiegeschichtlichen Teil (V) heraus,
der Smith ins Denken seiner Zeit einordnet und Diskussionslinien in die heutige Zeit
nachzeichnet, skizziert die Arbeit einige Schlussfolgerungen für die Politische Ökonomik
und den öffentlichen ökonomischen Diskurs heute (VI). Die Arbeit schließt ab mit einer
!9
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010.10
RECKTENWALD, HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978.11
WIGHTMAN, W.P.D.; BRYCE, J.C.; ROSS, I.S. (HRSG.): Adam Smith. Essays on Philosophical Subjects (Glasgow 12
Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 3), Oxford 1980.
DIE ZEIT: Auf der Suche nach Adam Smith. 14. August 2013, Nr. 34.13
Abschlussreflexion zu Smiths Anthropologie und fasst die Ergebnisse der Arbeit
thesenartig zusammen.
Adam Smith gilt als einer der prägendsten Denker der Neuzeit und das mit Recht. Und
doch begegnet dem geneigten Leser und Hörer eine erstaunliche Oberflächlichkeit, mit
der Smiths Gesamtwerk abgehandelt und bisweilen reduziert wird. Landläufig wird der
Wealth of Nations, der die Politische Ökonomie als eigenständigen Gegenstandsbereich
der Wissenschaft begründet hat, als Smiths Hauptwerk rezipiert. Der für den Wealth
grundlegende Text, die Theory of Moral Sentiments, ist im öffentlichen Bewusstsein deutlich
an den Rand gedrängt worden, und das nicht erst in der Hochphase des
Wirtschaftsliberalismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den Neunziger
Jahren des 20. Jahrhunderts. Schon 1926 schreibt Walther Eckstein im Vorwort seiner
Ausgabe der Theory über die schwierige Rezeptionsgeschichte des Smithschen
Gesamtwerks. Bei näherem Hinsehen wird jedoch schnell ersichtlich, dass Smiths
ökonomische Theorie nie ohne seine Moralphilosophie zu verstehen ist. Die Theory
erschien von 1759 bis 1790 in sechs Auflagen aus Smiths eigener Feder. Vor dem
Hintergrund dieser enormen Akribie und Arbeitsleistung erscheint der über ein Jahrzehnt
später als Erstausgabe erschienene Wealth of Nations beinahe wie ein ökonomisches
Addendum zur grundlegenden Arbeit der Theory. Und doch hat der Wealth wohl den
größeren Einfluss auf die sozio-ökonomische Entwicklung des Okzidents gehabt.
Adam Smith war 1752 zum Professor für Moralphilosophie an der Universität Glasgow
ernannt worden und hatte eine Überblicksvorlesung über alle Bereiche der Ethik zu
halten. Dieser Vorlesungskurs bestand aus den Teilen Natürliche Theologie, Ethik,
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft. Während der vierte Teil sich auf Fragen der
Zweckmäßigkeit staatlicher Maßnahmen konzentrierte und damit die Basis für den 24
Jahre später veröffentlichten Wealth lieferte, behandelte der zweite Teil mit der Ethik im
engeren Sinn das, was Smith im Jahr 1759 als Theory publizieren sollte. Ihre
Entstehungsgeschichte als Ethikvorlesung könnte die wenig systematische Anordnung
des Buches erklären und ebenso „die große Lebendigkeit der Darstellung, die Fülle von
Beispielen und Zitaten, die in ihrer Anschaulichkeit und Mannigfaltigkeit einen der
Hauptvorzüge des Buches ausmachen.” 14
!10
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 14
2010. S. XVI.
Walther Eckstein sieht schon im Titel der Theory den klaren Ausdruck der Smithschen
Definition von Moralphilosophie, deren Aufgabe „die deskriptive Darstellung der
ethischen Gefühle und zugleich [der] Versuch einer Zurückführung dieser Phänomene
auf gewisse Prinzipien” ist. Diese Prinzipien sind allerdings nicht nur als Grundsätze zu 15
verstehen, sondern auch Grundkräfte und -triebe. Smith beschreibt die Theory selbst als
Untersuchung, die nicht eine Frage des Sollens betrifft, sondern eine Frage nach
Tatsachen. Überhaupt zeigt Smith neben seinen feinfühligen, fantasievollen 16
Beobachtungen immer wieder ein pragmatisch-faktisches Verständnis der Welt. Schon für
Smith scheint zu gelten, was Wittgenstein deutlich später formuliert: Die Welt ist die
Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Das Bestehen und Nichtbestehen von
Sachverhalten, also der Verbindung von Dingen, ist die Wirklichkeit. 17
Die Aufnahme der Theory war von Erscheinen an überaus positiv, oft beeindruckt,
bisweilen euphorisch. Eckstein zitiert einen Brief David Humes, der mit Smith eng
befreundet war, der eine rege Nachfrage erlebt und dafür das Interesse mehrerer
Bischöfe, Herzöge, sowie einen Verleger und den späteren Staatskanzler Charles
Townshend anführt. Eine Rezension vom Juli 1759 im Monthly Review stimmt eine 18
regelrechte Lobeshymne auf den Autor an: „Das ganze Werk zeigt ein Maß von
Feinfühligkeit und Verstandesschärfe, wie man es selten findet; und was noch besonders
erwähnt zu werden verdient: in dem ganzen Buch wird die strengste Rücksicht auf die
Prinzipien der Religion gewahrt, so dass ein ernster Leser nichts finden wird, woran er
mit gutem Grund Anstoß nehmen könnte. Mit einem Wort - ohne Parteilichkeit
gegenüber dem Autor - er ist einer der elegantesten und anziehendsten Schriftsteller auf
dem Gebiete der Ethik, die wir kennen.” Ähnliche Reaktionen sind in der Rezeption 19
von Smiths ökonomischem Hauptwerk zu finden. Auch in Frankreich und Deutschland
wurde die Theory wohlwollend aufgenommen. Eckstein erwähnt in diesem
!11
Ebd.15
Zitiert nach: ebd., S. XVIII.16
Vgl. WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus Logico-philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt 17
am Main 2003.
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 18
2010. S. XVIIIf.
Zitiert nach: Ebd., S. XIXf.19
Zusammenhang Lessing, Rautenberg, Garve und auch Immanuel Kant. Dieser hat
sowohl Wealth als auch die Theory rezipiert und geschätzt. 20
Eine Notiz zur Übersetzung des Titels der Theory of Moral Sentiments ist noch zu machen:
Die seit der Studienausgabe Walther Ecksteins von 1926 gängige Übersetzung der moral
sentiments als „ethische Gefühle” ist unzulänglich. Eine adäquatere Übersetzung ist
„moralische Gefühle” oder „moralisches Empfinden”. So verwundert es auch nicht, dass
alle drei Übersetzer einen je unterschiedlichen Titel gewählt haben. Neben Ecksteins
„Theorie der ethischen Gefühle” wählt Rautenberg den Titel „Theorie der moralischen
Empfindungen” und Kosegarten „Theorie der sittlichen Gefühle”. Wenn man davon 21 22
ausgeht, dass Moral im Individuum und Gruppen fest verankert ist, dann behandelt der
Begriff der Moral, wie Karl Graf Ballestrem schreibt, ein „psychisches und soziales
Faktum, das entweder beschrieben und erklärt [...] oder zum Ausgangspunkt normativer
Überlegungen gemacht werden kann”. Wenn also Ethik eine normative Theorie der Moral 23
meine, so sei es sinnlos, von einer „Theorie der ethischen Gefühle” zu sprechen, weil die
Ethik eine Theorie und kein Gefühl ist, so Ballestrem. Vor dem Hintergrund unserer 24
!12
Ebd., S. XXII.20
Vgl. RAUTENBERG, CHRISTIAN GÜNTHER (HRSG.): Adam Smith. Theorie der moralischen Empfindungen, 21
Braunschweig 1770. Dass gerade Rautenberg das Projekt der Übersetzung gewagt hat, ist kein Zufall. Er interessierte sich wie Smith für eine aufgeklärte, christlich geprägte Vernunftreligion. Rautenberg war Prediger an der Braunschweiger Martinikirche und bemüht um die Verteidigung der Vernunft der Religion, wie eine Predigt für Herzog Ferdinand von Braunschweig und Lüneburg vom 1. November 1768 zeigt. Smiths 3. Auflage der Theory, an der sich Rautenberg orientiert, war 1767 herausgekommen. Es ist also zu vermuten, dass Rautenberg zum Zeitpunkt der Predigt also schon im Begriff war, die Übersetzungsarbeiten zu beginnen, oder schon begonnen hat. Die Predigt trägt den Titel „Von dem vernünftigen Glauben des Christen” und ist - wie im Vorwort anklingt - gedacht, um die Zweifel dan der Vereinbarkeit von Vernunft und Glauben zu zerstreuen: „ich weiß wol, daß die Betrachtungen, die sie enthält, nicht neu und mir nicht eigentümlich sind; da sie aber nur zerstreut in manchen Büchern angetroffen werden, die viele nicht lesen und wegen ihrer Weitläufigkeit nicht zu lesen Lust haben, so habe ich geglaubt, daß es sie unter einem Gesichtspunkte in der Kürze gesammelt darstellete, und vielleicht kann schon das bey denen, die Vernunft und Glauben einander entgegen setzen, einen heilsamen Eindruck machen, wenn sie sehen, daß selbst ein Prediger des Glaubens den richtigen Gebrach der Vernunft ernstlich einschärffet.” Zitiert nach: RAUTENBERG, CHRISTIAN GÜNTHER: Predigt über den Vernünftigen Glauben des Christen, Braunschweig 1768. Abrufbar im digitalen Archiv der TU Braunschweig unter: http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00040336 (Stand: 17. Juli 2014, 19.40 Uhr)
Vgl. KOSEGARTEN, LUDWIG GOTTHARD (HRSG.): Adam Smith. Theorie der sittlichen Gefühle, Leipzig 1791. 22
Interessanterweise war auch Kosegarten evangelischer Pfarrer. Er wurde 1792 ordiniert und Pfarrer der evangelischen Pfarrkirche zu Altenkirchen auf Rügen. 1793 wurde Kosegarten an der Universität Rostock zum Dr. theol. promoviert und war während der Übersetzungsarbeiten zur Theory nicht nur beschäftigt mit der Arbeit an der Promotion, sondern auch mit der Abfassung seines Romans „Ewalds Rosenmonde”, der ebenfalls 1791 veröffentlicht wurde. Später wurde Kosegarten als Professor für Theologie an die Universität Greifswald berufen und Rektor der Universität.
BALLESTREM, KARL GRAF: Adam Smith, München 2001. S. 59.23
Ebd.24
begrifflichen Verwendung von Ethik und Moral heute erscheint der Titel „Theorie der
moralischen Gefühle” als die idiomatisch sinnvollste Option.
II. Grundzüge der Moralphilosophie
A. Sympathie als Prinzip sittlicher Richtigkeit der Handlungen
In dem Begriff der Sympathie sieht Smith nicht nur das, was die Begriffe Mitleid und
Erbarmen erfassen, nämlich das Mitgefühl mit dem Kummer oder verwandten negativ
erlebten Affekten. Der Begriff der Sympathie, so Smith, umfasst vielmehr das Mitgefühl
mit jeder Art von Affekten, also auch solche, die als tendenziell neutral oder positiv erlebt
werden. Sympathie bei Smith kann keinesfalls, wie beispielsweise Gide und Zeyß 25
postulieren, als altruistisches Gefühl verstanden werden. Die Sympathie beschreibt das 26
Prinzip des Urteilens, nicht das Ergebnis des Urteilens. Smith schreibt im ersten Satz
seiner Theorie der moralischen Gefühle: „Mag man den Menschen für noch so egoistisch
halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu
bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die
Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil
daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein.” 27
Smith hält für selbstverständlich, dass Mitgefühl tief in der menschlichen Natur verankert
ist. „Dass wir oft darum Kummer empfinden, weil andere Menschen von Kummer erfüllt
sind, das ist eine Tatsache, die zu augenfällig ist, als dass es irgendwelcher Beispiele
bedürfte, um sie zu beweisen; denn diese Empfindung ist wie alle anderen ursprünglichen
Affekte des Menschen keineswegs auf die Tugendhaften und human Empfindenden
beschränkt, obgleich diese sie vielleicht mit der höchsten Feinfühligkeit erleben mögen,
sondern selbst der ärgste Rohling, der verhärtetste Verächter der Gemeinschaftsgesetze
ist nicht vollständig dieses Gefühles bar.” Gleichsam ist es uns unmöglich, in derselben 28
Intensität zu fühlen, was der andere fühlt, selbst wenn uns dieser andere noch so nah
stehen mag. Unsere Sinne „konnten und können uns nie über die Schranken unserer
!13
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 8.25
Vgl. ZEYß, RICHARD: Adam Smith und der Eigennutz, Tübingen 1889. Vgl. auch: GIDE, CHARLES: Geschichte 26
der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, Jena 1913.
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 5.27
Ebd.28
eigenen Person hinaustragen und nur in der Phantasie können wir uns einen Begriff von
der Art seiner Empfindungen machen.” 29
Einer, der seine Imaginationskraft nicht ausgebildet hat oder - sei es bewusst, sei es
unbewusst - wählt, von ihr nur eingeschränkt Gebrauch zu machen, wird
dementsprechend weniger intensiv an den Gründen des Leidens und Freuens seiner
Mitmenschen teilhaben können und aufgrund dessen Unverständnis und letztendlich ein
Gefühl des Verurteilens empfinden. Einer, der seine Imaginationskraft stärker ausgebildet
hat, von ihr Gebrauch macht und so die Ursache-Wirkung-Dynamik hinter dem
beobachteten Affekt des anderen nachvollziehen kann, wird eine größere
Identifikationserfahrung machen und so eher zu einem positiven ethischen Gefühl
gelangen. „Vermöge der Einbildungskraft versetzen wir uns in seine Lage, mit ihrer Hilfe
stellen wir uns vor, dass wir selbst die gleichen Martern erlitten wie er, in unserer
Phantasie treten wir gleichsam in seinen Körper ein und werden gewissermaßen eine
Person mit ihm”. 30
Als Quelle des Mitgefühls identifiziert Smith das Vermögen, kraft der Imagination die
Affekte des anderen (zu einem gewissen Grade) selbst zu erleben. Von „diesem
Standpunkt aus bilden wir uns eine Vorstellung von seinen Empfindungen und erleben
sogar selbst gewisse Gefühle, die zwar dem Grade nach schwächer, der Art nach aber den
seinigen nicht ganz unähnlich sind.” Wenn der eine des anderen Motive und Affekte 31
durch das Mitgefühl nachvollzogen hat, wird er fragen, was der unparteiische Zuschauer
davon halten mag. Hier mag dann vielleicht eine persönliche Identifikationserfahrung
vorliegen und der eine des anderen Motive und Affekte gut nachvollziehen können, das
ethische Gefühl wird deswegen aber keineswegs immer positiv ausfallen. Walther
Eckstein stellt hier fest, dass es genau so wie es von den Umständen und insbesondere
dem Gegenstand des sympathetischen Mitfühlens abhängt, ob das auf Sympathie
beruhende Gefühl angenehm oder unangenehm ist, auf die Verhältnisse und
insbesondere den Charakter des Handelnden ankommt, ob das sympathetische Gefühl
egoistische oder altruistische Willensakte hervorruft. Nur diese volitiven Phänomene 32
!14
Ebd., S. 6.29
Ebd.30
Ebd.31
Vgl. ebd., S. 66-76.32
könne man im eigentlichen Sinn egoistisch oder altruistisch nennen. Das Mitgefühl ist 33
dagegen mit Max Scheler gesprochen prinzipiell wertblind. 34
Friedrich Jodl sieht im Mitgefühl „die Fähigkeit der Nachbildung fremder Gefühle
überhaupt”. Das Prinzip der Sympathie ist für Jodl „der psychologische Mechanismus, 35
durch welchen ethische Beurteilung überhaupt zustande kommt, nämlich Umsetzung der
Gefühle anderer in eigene Gefühle.” Es sei nicht identisch mit dem Altruismus, das heißt
einem „allgemeinen Grundtrieb des Wohlwollens oder der Menschenliebe”. Das 36
Prinzip der Sympathie fasst also zusammen den Prozess der Sinneswahrnehmung der
Gefühle anderer Menschen, deren Übersetzung in eigene Gefühle durch die
Einbildungskraft, den Vergleich der eigenen Gefühle mit denen des anderen und dem
daraus folgenden positiven oder negativen Urteil über die Gefühle des anderen. 37
Das Ergebnis des Prozesses ist die Erfahrung von Identifikation oder Diskrepanz.
Ersteres, das Erlebnis der Harmonie des vorgestellten eigenen Affekts (und der
resultierenden erfahrenen Emotion) mit dem beobachteten Affekt (und der daraus
abgeleiteten Emotion des anderen) erleben wir als ein im Einklang Sein. Die Differenz von
eigenem Affekt und beobachtetem Affekt beim Anderen erleben wir hingegen als
Entfremdung. Die Beschreibung dieses Prozesses setzt erstens eine existente und
zumindest teilweise intakte Imaginationskraft und zweitens die Fähigkeit zur Reflexion
der eigenen Affekte oder zumindest eine einigermaßen ausgeprägte Fähigkeit zur
ungestörten Wahrnehmung der Affekte voraus. Was zunächst selbstverständlich klingt,
entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ganz und gar nicht selbstverständlich, man
denke an die große Herausforderung posttraumatischer Belastungsstörungen nach
Missbrauchs- oder Kriegserfahrungen. Nicht umsonst bezeichnet der Volksmund einen
geistig Erkrankten als gestört, wenn er zur Wahrnehmung seiner eigenen Affekte nicht
!15
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 33
2010. S. LI.
SCHELER, MAX: Wesen und Formen der Sympathie, Frankfurt am Main 1948. S. 2.34
JODL, FRIEDRICH: Lehrbuch der Psychologie, Band II, Stuttgart/Berlin 1903. S. 346f.35
JODL, FRIEDRICH: Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, Stuttgart/Berlin 1930. S. 379.36
Smiths Theorie der moralischen Gefühle ist nicht nur für die Philosophie, sondern besonders auch für die 37
Psychologie interessant. Für Überlegungen zur Schnittstelle zwischen Philosophie und Psychologie in Smiths Werk vgl. SOLOMON, ROBERT C.: Sympathie für Adam Smith. Einige aktuelle philosophische und psychologische Überlegungen. in: FRICKE, CHRISTEL; SCHÜTT, HANS-PETER (HRSG.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 251-276.
imstande ist oder diese zumindest nicht in der Lage ist, so zu kommunizieren, dass sie
von der Mehrheit der nicht oder wenig Erkrankten als solche wahrgenommen und
verstanden werden. Die praktische, sinnlich-rezeptive Erkenntnis der empirischen
Anschauung und die theoretisch-rationale Erkenntnis des reinen Denkens sind bei Smith
also wie in Kants Kritiken nicht als voneinander getrennte Entitäten, sondern als
verschränkte Dimensionen der Urteilskraft zu verstehen. 38
B. Der unparteiische Zuschauer
Die Sympathie ist bei Smith also keineswegs gleichbedeutend mit Wohlwollen und
Altruismus, sondern das Prinzip der Feststellung sittlicher Richtigkeit und Unrichtigkeit
von Handlungen. Je intensiver die Erfahrung von Einheit durch Konvergenz des eigenen
erfahrenen Affekts mit dem beobachteten Affekt der anderen Person ist, desto mehr
ähnelt das Prinzip des Urteilens über die Affekte der Menschen nun dem Prinzip der
Selbstbilligung oder Selbstmissbilligung. In Smiths Worten: „Das Prinzip, nach welchem
wir unser eigenes Verhalten natürlicherweise billigen oder missbilligen, scheint ganz
dasselbe zu sein, wie dasjenige, nach dem wir die gleichen Urteile über das Betragen
anderer Leute fällen.” Wir billigen oder missbilligen, so Smith, das Verhalten anderer
Menschen, indem wir uns in ihre Lage hineindenken und unser Gefühl darauf prüfen, ob
wir mit den Empfindungen und Beweggründen, die es leiten, sympathisieren können
oder nicht. In gleicher Weise billigen oder missbilligen wir unser eigenes Verhalten, indem
wir uns in die Lage des Anderen versetzen und gleichsam mit seinen Augen betrachten.
Von dieser Perspektive aus beurteilen wir, ob wir an den beobachteten Empfindungen
und Beweggründen, die das Verhalten antreiben, Anteil nehmen, mit ihnen
sympathisieren könnten oder eben nicht. Das Urteil über das eigene Verhalten ist folglich
maßgeblich geprägt vom Urteil anderer und umgekehrt und insofern bestimmt durch
unser moralisches Bewusstsein. „Niemals können wir unsere Empfindungen und 39
Beweggründe überblicken, niemals können wir irgendein Urteil über sie fällen, wofern
!16
Zum Begriff der ästhetischen Urteilskraft vgl. KANT, IMMANUEL: Kritik der Urteilskraft, Hamburg 2009. S. 47 - 226. 38
Zu Kants Differenzierung des Begriffs der Anschauung vgl. unter anderem KANT, IMMANUEl: Kritik der reinen Vernunft, Riga 1787. S. 143 - 156. Smiths und Kants Überlegungen sind nicht rein theoretische Konstrukte, sie haben unmittelbar praktische Relevanz. Denn wenn Smith mit der Charakterisierung der Sympathie als der Grundlage der Beurteilung sittlicher Richtig- oder Unrichtigkeit von Handlungen Recht hat, so muss der Förderung von Kreativität und Imagination in Jugend- und Erwachsenenbildung höchste Priorität beigemessen werden. Selbiges gilt für die Schulung des emotionalen und kognitiven Selbstbewusstseins.
Vgl. VON VILLIEZ, CAROLA: Sympathetische Unparteilichkeit: Adam Smiths moralischer Kontextualismus. in: 39
FRICKE, CHRISTEL; SCHÜTT, HANS-PETER (Hrsg.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 64-87.
wir uns nicht gleichsam von unserem natürlichen Standort entfernen, und sie gleichsam
aus einem gewissen Abstand von uns selbst anzusehen trachten.” Das Entfernen vom 40
natürlichen Standort, so Smith, ist aber nicht anders möglich als durch den Versuch,
unsere eigenen Empfindungen und Beweggründe mit den Augen des oder der Anderen
zu sehen. Smith folgert daraus, dass jedes Urteil, das wir fällen, immer eine gewisse
unausgesprochene Bezugnahme auf die Urteile anderer hat, da wir jederzeit danach streben,
unser Verhalten so zu prüfen, wie es ein „gerechter und unparteiischer Zuschauer”
prüfen würde. 41
Der von Smith so genannte unparteiische Zuschauer, dessen Position wir kraft unserer
Imagination zumindest annähernd einzunehmen in der Lage sind, hat eine zentrale Rolle
in Smiths Moralphilosophie. Er ist es, der uns das rechte Urteil anempfiehlt. „Wenn wir 42
uns erst in seine Lage versetzen und wir dann immer noch an allen Affekten und
Beweggründen, die unser Verhalten bestimmten, durchaus inneren Anteil nehmen, dann
billigen wir dieses Verhalten aus Sympathie mit der Billigung dieses gerechten Richters,
den wir in Gedanken aufgestellt haben.” Fällt die Prüfung jedoch anders aus, so
missbilligen wir unsere Beweggründe und verurteilen unser Verhalten. So entsteht nach 43
Smiths Verständnis also aus dem Prinzip der Sympathie das moralische Bewusstsein und
schließlich das Gewissen des Menschen, welches das Selbstinteresse moralisch qualifiziert
und an das kollektive moralische Empfinden bindet. Diese Bindung drückt sich aus in
den moralischen Gefühlen. Durch Beobachtung des Handelns anderer Menschen lernen
wir, welches Verhalten als angemessen empfunden wird und bilden so unbewusst eine
Art moralischen Kompass aus, also gewisse Grundregeln, die eine intuitive Bewertung
konkreter Einzelfälle ermöglichen. Die wechselseitige Begegnung, Beobachtung und
Beurteilung ist also die treibende Kraft hinter kollektiven moralischen Standards.
Immanuel Kant (1724-1804) hatte großes Interesse für Smiths Philosophie und nimmt in
seinen Reflexionen zur Anthropologie Smiths Theorie des unparteiischen Zuschauers
!17
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 177f.40
Ebd., S. 178.41
Es kann hier allerdings nicht ohne weiteres von einem objektiven Urteil gesprochen werden. Weiterführendes dazu 42
in: OTTESON, JAMES R.: Adam Smith und die Objektivität moralischer Urteile: Ein Mittelweg. in: FRICKE, CHRISTEL; SCHÜTT, HANS-PETER (HRSG.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 15-32.
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 178.43
interessanterweise an der Stelle auf, wo er den Begriff des Geschmacks bespricht. Der 44
Geschmack sei ein gesellschaftlich-sinnliches Urteil über das, „was wohlgefällt nicht
unmittelbar durch den Sinn, auch nicht durch allgemeine Begriffe der Vernunft. Der
Geschmak geht auf das angenehme das Schöne (edle) und das rührende. Das letztere ist
nicht eigentlich erhaben, ob es zwar oft die wirkung vom erhabnen ist.” Der 45
Geschmack bewirke, so Kant weiter, dass der Genuss sich kommuniziert. Er ist für Kant
folglich „ein Mittel und eine Wirkung von Vereinigung der Menschen.” Die bloße
Gründlichkeit desjenigen, den ein Gegenstand interessiert, sei aus der Perspektive der
Anderen eine Grobheit, so Kant. „Der Gründliche, der dergleichen sieht oder ließt, hat
doch kein vollkommen wohlgefallen daran, weil er auch nicht blos aus seinem sondern
aus Gemeinschaftlichem Gesichtspunkte es betrachtet (der unpartheyische zuschauer).”
Der Pedant, so Kant weiter, begehe diese Grobheit aus Ungeschicktheit und werde
deshalb verlacht. „Der Mangel des Geschmaks oder wohl gar die Abneigung und
Gleichgültigkeit dagegen zeigt immer ein enges Herz an, welches sein Wohlgefallen auf
sich einschränkt.” Kant unterscheidet daraufhin das Urteil vom Gefühl und schreibt:
„Der Geschmak geht auf das Urtheil, nicht auf das Gefühl”. Der Geschmack, so Kant,
ist deshalb die Geschliffenheit der Urteilskraft. So kann Kant von einem moralischen 46
Geschmack sprechen, der sich vom ästhetischen Geschmack unterscheidet. „Der
moralische Geschmak ist das Vermögen, an demienigen, was beym Guten zur
Allgemeinheit gehöret, Wohlgefallen zu finden.” Anders der ästhetische Geschmack: „das
Vermögen, an dem, was beym sinnlichen Wohlgefallen zur allgemeinheit desselben
gehöret, wohlgefallen zu finden.” Der Begriff des moralischen Geschmacks grenzt Kant
insofern von Smith ab, als er (zumindest in diesem konkreten Fall) das Urteil dem Gefühl
gegenüberstellt und seine Moraltheorie auf ersterem aufbaut, während Smith explizit vom
moralischen Gefühl spricht und Urteil und Gefühl nicht dichotomisch versteht.
C. Harmonie der Einzelinteressen
Teil A und B haben gezeigt: Die Sympathie als Prinzip der Feststellung sittlicher
Richtigkeit und Unrichtigkeit von Handlungen ist keineswegs gleichbedeutend mit
!18
Weiterführendes zum spezifischen Einfluss Smiths auf Immanuel Kant in: KRAUSE, JENS PATRICK: Immanuel 44
Kant und Adam Smith. Präsenz, Wirkung und Geltung der ‘Theory of Moral Sentiments’ in Kants Werk. Dissertation an der Universität zu Köln, Philosophische Fakultät, Köln 1997.
KANT, IMMANUEL: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie, Berlin 1900ff. S. 334.45
Ebd.46
Wohlwollen und Altruismus. Im Gegenteil: Smith sieht die Antriebe der Selbstliebe sogar
als stärker als die Antriebe des Wohlwollens an. Es sei nicht die sanfte Gewalt der
Menschlichkeit, nicht „jener schwache Funke von Wohlwollen, den die Natur im
menschlichen Herzen entzündet hat”, die derart imstande wären, den stärksten Antrieben
der Selbstliebe entgegenzuwirken, so Smith. Allerdings ist die Selbstliebe für Smith auch 47
nicht nur negativ konnotiert: „Die Rücksicht auf unser eigenes Glück und auf unseren
persönlichen Vorteil erscheint aber in zahlreichen Fällen auch als ein sehr lobenswertes
Prinzip des Handelns. [...] Wirtschaftlichkeit, Fleiß, Umsicht, Aufmerksamkeit, geistige
Regsamkeit werden nach allgemeinem Dafürhalten aus eigennützigen Beweggründen
gepflegt und doch hält man sie zugleich für sehr lobenswürdige Eigenschaften.” Indem 48
er betont, dass auch die Triebfeder der Selbstliebe zu tugendhaftem Verhalten führen
könne, widerspricht Smith ausdrücklich seinem Lehrer Hutcheson.
Auch hier ist ein Blick zu Kant von Belang, der hier nun weitgehend Smiths Position
folgt: „Den Neigungen des Genusses hat etwas müssen entgegen gesetzt werden, welches
blos darauf gerichtet ist, daß andre Richter seyn müssen.” Der unparteiische Zuschauer 49
verhilft, so Kant, zum Geschmack, also zur „Modestie und Gefalligkeit [als] Charakter,
welcher dem Geschmak zum Grunde liegt.” Die Tugend solle sich daher vom 50
Geschmack gewissermaßen informieren lassen. Andere Richter sein zu lassen fordere 51
viele heraus, so Kant. Es zeuge aber von Geschmack und Tugend, die eigenen
Bedürfnisse in einer Art und Weise zu befriedigen, die „den fleis und auch die
Geschiklichkeit anderer cultivirt. Es ist eine triebfeder des Fleisses und
Geschiklichkeit.” 52
Zurück zu Smith: In seiner Distanzierung von denjenigen Systemen der
Moralphilosophie, die vor allem das Wohlwollen als Tugend averstehen, steckt eine der
grundlegenden Voraussetzung für die später im Wealth ökonomisch explizierte Theorie
!19
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 215.47
Ebd., S. 496f.48
KANT, IMMANUEL: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie, Berlin 1900ff. S. 335.49
Ebd.50
Im Original schreibt Kant: „Das störrische hält viele ab und ist also der Ausbreitung entgegen; daher die Tugend 51
selbst vom Geschmak empfehlung entlehnen.” in: KANT, IMMANUEL: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie, Berlin 1900ff. S. 335.
KANT, IMMANUEL: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie, Berlin 1900ff. S. 335.52
der Harmonie der Einzelinteressen. Wenn die Selbstliebe nicht mehr als lasterhaftes 53
Gegenüber des Wohlwollens, sondern als zumindest potenziell tugendfördernd
verstanden wird, verändern sich einige entscheidende Parameter der moralischen
Bewertung ökonomischer Theorien. Das Verfolgen des Eigeninteresses wird nicht mehr
als egoistisch, sondern potenziell gemeinwohlfördernd verstanden. Mit der Theorie der
Harmonie der Einzelinteressen verfolgt Smith also gewissermaßen die Umdeutung eines
Lasters zur Tugend. Mit Goethes Mephisto gesprochen wird das Laster zum „Teil von
jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.” 54
In der Theory findet sich diese Theorie im Kapitel über den Einfluss der Nützlichkeit auf
das Gefühl der Billigung. Dort schreibt Smith über die Freuden, die uns dazu treiben, viel
Mühe und Ängste auf Rang und Wohlstand zu verwenden. Es sei gut, sagt er, dass „die
Natur uns in dieser Weise betrügt.” Denn diese Täuschung ist es, die den Fleiß der
Menschen weckt und in Bewegung hält. Smith beschreibt anschaulich, wie „der stolze 55
und gefühllose Grundherr seinen Blick über seine ausgedehnten Felder schweifen lässt
und ohne einen Gedanken an die Bedürfnisse seiner Brüder in seiner Phantasie die ganze
Ernte, die auf diesen Feldern wächst, selbst verzehrt. Das ungezierte und vulgäre
Sprichwort, dass das Auge mehr fasse als der Bauch, hat sich nie vollständiger
bewahrheitet als in Bezug auf ihn. Das Fassungsvermögen seines Magens steht in keinem
Verhältnis zu der maßlosen Größe seiner Begierden, ja, sein Magen wird nicht mehr
aufnehmen können als der des geringsten Bauern.” Den Rest müsse der Grundherr unter
denjenigen verteilen, „die auf das sorgsamste das Wenige zubereiten, das er braucht”,
unter denjenigen, „die den Palast einrichten und instandhalten, in welchem dieses Wenige
verzehrt werden soll”, sowie unter denjenigen, „die all den verschiedenen Kram und
Tand besorgen und in Ordnung halten, der in der Haushaltung der Vornehmen
gebraucht wird”. Sie alle bezögen, so Smith, von seinem Luxus und seiner 56
Launenhaftigkeit ihren Teil an lebensnotwendigen Gütern, den sie sonst vergebens von
!20
Smith entfernt sich mit seiner Kritik an den „Systemen der Moralphilosophie, die die Tugend allein im 53
Wohlwollen bestehen sehen” inhaltlich von Francis Hutcheson, der in seiner Philosophie den christlichen Liebesbegriffs durch die Betonung des Wohlwollens deutlich zur Geltung kommen lässt. Vgl LEIDHOLD, WOLFGANG (HRSG.): Francis Hutcheson: Eine Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Tugend, Hamburg 1986.
VON GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Werke - Hamburger Ausgabe, Band III, Dramatische Dichtungen I, Faust I, 54
München 1982, S. 47.
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 295f.55
Ebd., S. 296.56
seiner Menschlichkeit oder von seiner Gerechtigkeit erwartet hätten. Der Ertrag des
Bodens erhalte zu allen Zeiten ungefähr jene Anzahl von Bewohnern, die er zu erhalten
fähig ist. „Nur dass die Reichen aus dem ganzen Haufen dasjenige auswählen, was das
Kostbarste und ihnen Angenehmste ist.” 57
Hier wird die stoische Prägung Smiths deutlich: Die Reichen, so Smith, verzehren wenig
mehr als die Armen trotz ihrer „natürlichen Selbstsucht und Raubgier und obwohl sie nur
ihr eigene Bequemlichkeit im Auge haben”. Obwohl ihr alleiniges Ziel also nicht mehr als
die Befriedigung ihrer „eitles und unersättlichen Begierden” sei, teilten sie ihren Ertrag
mit den Armen. Das berühmte Bild der unsichtbaren Hand, welches bis heute die
populäre Smith-Rezeption maßgeblich prägt, findet sich in diesem Kontext: „Von einer
unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum
Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die
Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre; und so fördern
sie, ohne es zu beabsichtigen, ja ohne es zu wissen, das Interesse der Gesellschaft und
gewähren die Mittel zur Vermehrung der Gattung.” Interessant ist, dass das zentrale 58
Anliegen Smiths hier die gerechte Verteilung der Güter ist. Er macht klar, dass er das
selbstsüchtige Verhalten des Grundherren nicht für gut hält. Die kapitalistische
Organisation des Wirtschaftens hält er aber trotzdem nicht für gänzlich ungerecht, da die
Verteilung der lebensnotwendigen Güter zumindest nahezu gleich sei, wie wenn der
Boden zu gleichen Teilen verteilt gewesen wäre. Das ist für ihn deshalb ein annähernd
gerechter Modus, da Smith als Stoiker allen „eitlen” Luxus nicht nur als wertneutralen
Überfluss, sondern als tatsächlich überflüssig ansieht. 59
Zu beachten ist das kleine Wörtchen „nahezu”. Smith sieht in einem kapitalistischen
Wirtschaftssystem die lebensnotwendigen Güter nicht vollständig, aber nahezu gerecht verteilt.
Hier schimmert eines der Herzensanliegen Smiths durch: der Ausgang aus der Armut für
die working poor, für die er deutlich mehr Sympathie als für den merkantilistischen Adel zu
hegen scheint. Die Bedeutung einer starken Mittelklasse für den Wohlstand der Nation
!21
Ebd.57
Ebd., S. 296f.58
Ob Smiths Beschreibung der adeligen Grundherren seiner Zeit ohne Weiteres auf andere Zeiten und 59
Weltgegenden zu übertragen ist, darf bezweifelt werden.
macht er auch im Wealth unmissverständlich klar: „Es kann sicherlich eine Gesellschaft
nicht blühend und glücklich sein, deren meiste Glieder arm und elend sind.” 60
Smith ohne Weiteres den Gerechtigkeitsbegriff der neoklassischen Marktlogik
zuzuschreiben, die von knappen Ressourcen ausgehend maßgeblich Konkurrenzlogik ist,
ist also abwegig. Allerdings geht auch Smith wie beschrieben davon aus, dass in der
kapitalistisch organisierten Gesellschaft ein gewisses Maß an Gerechtigkeit herrscht, da
der Mensch durch die göttlich grundgelegte Moral in der Weise einer unsichtbaren Hand
dahin geführt werde, seinen Überfluss in dem Maße zu teilen, dass annähernd dieselbe
Verteilung erreicht ist wie bei gerechter Bodenverteilung.
Unter theologischen Gesichtspunkten sind die darauffolgenden Zeilen Smiths besonders
interessant: „Als die Vorsehung die Erde unter eine geringe Zahl von Herren und
Besitzern verteilte, da hat sie diejenigen, die sie scheinbar bei ihrer Teilung übergangen
hat, doch nicht vergessen und nicht ganz verlassen. Auch diese letzteren genießen ihren
Teil von allem, was die Erde hervorbringt.” Smith arbeitet hier offen mit einer religiösen
Providenzvorstellung, die charakteristisch für den damals unter Intellektuellen populären
Duktus einer deistischen Vernunftreligion ist. Smiths ökonomische Lehre steht unter den
eschatologischen und soteriologischen Vorzeichen der Vorsehung des allmächtigen und
allwissenden Gottes, der die Welt gut geschaffen und geordnet hat. Smiths deistische 61
Prägung kommt hier in ähnlicher Weise wie bei US-amerikanischen Deisten seiner Zeit
zum Tragen. Die Providenzvorstellung, der Versuch der Vereinbarung von Vernunft 62
und Religion bzw. Natur und Religion, sowie ein aufgeklärtes, aufs Diesseits fokussiertes
Denken führt im entstehenden US-amerikanischen Nationalstaat zum Entstehen einer
Zivilreligion. Weitere Konsequenzen des deistischen Denkens sind dort die Ausbildung 63
des religiösen Nationalismus (American exceptionalism) und eines säkularisierten,
!22
STIRNER, MAX (HRSG.): Adam Smith. Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des 60
Nationalreichthums, Band I, Leipzig 1846. S. 110.
Weiterführendes zu den theologischen Grundannahmen in Smiths Schriften in: LUTERBACHER-MAINERI, 61
CLAUDIUS: Adam Smith - theologische Grundannahmen: eine textkritische Studie, Fribourg 2008.
Der Fokus aufs Diesseits, die Unterscheidung zwischen Natürlichem und Übernatürlichem, sowie die Reduktion 62
metaphysisch-spekulativer Theologie auf wenige als vernünftig empfundene Denkfiguren, die in den deistisch-vernunftreligiösen Kreisen in den amerikanischen Kolonien und dem Gebiet des heutigen Großbritanniens aufkommt kann mit Habermas als Entwicklung hin zum nachmetaphysischen Denken interpretiert werden. Vgl. HABERMAS, JÜRGEN: Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 2012.
! Vgl. BELLAH, ROBERT N.: Civil Religion in America. in: Dædalus. Journal of the American Academy of Arts and 63Sciences, Vol. 96, Nr. 1, Cambridge 1967. S. 1-21. Und: BELLAH, ROBERT N.: The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial, Chicago 1992.
protestantischen Berufsethos’, wie es sich exemplarisch bei Benjamin Franklin zeigt. 64
Dessen Autobiographie wird Max Weber später als eine der primären Quellen für seine 65
Theorie von der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus dienen. 66
Auf die Gedanken zur Bodenverteilung durch Vorsehung folgen Zeilen, die Aufschluss
geben über Smiths Vorstellung vom guten Leben, das für den besitzlosen Armen
unmittelbar, für den reichen König jedoch nur mit erheblichem Aufwand zu erreichen ist:
„In dem Wohlbefinden des Körpers und in dem Frieden der Seele stehen alle
Lebensstände einander nahezu gleich und der Bettler, der sich neben der Landstraße
sonnt, besitzt jene Sicherheit und Sorglosigkeit, für welche Könige kämpfen.” Smith ist 67
in diesem Reichtumsverständnis nah bei Aristoteles, das Streben nach Reichtum versteht
der allerdings ganz anders: Reichtümer sind für Aristoteles in Wahrheit „die zur
Erhaltung des Lebens notwendigen Dinge, sobald sie sicher im Rahmen der
Gemeinschaft aufbewahrt sind, deren Unterhaltsmittel sie repräsentieren.” Die
menschlichen Erfordernisse in Haushalt und polis sind nach Aristoteles nicht grenzenlos.
Für ihn gibt es in der Natur auch keine Knappheit an Lebensmitteln wie es die
Neoklassik postuliert. 68
Obwohl Aristoteles und Smith ganz Ähnliches unter dem wahren Reichtum verstehen,
gehen sie anthropologisch getrennte Wege. Smith geht den zynischen Weg und macht aus
seiner Verachtung für den gierigen Menschen keinen Hehl. Womöglich erklärt sich so,
warum Smith so hart daran arbeitete, diesen in seinen Augen verachtenswerten Zug in
der Natur des Menschen zu rationalisieren und zum Guten hin fruchtbar zu machen.
Durch die Idee, dass die Selbstsucht des Menschen das Gemeinwohl fördert, konnte er
ein Denksystem konstruieren, in dem die zu verachtende, egoistische Selbstsucht zu
einem moralisch neutralen wohlverstandenen Eigeninteresse wird. Für Aristoteles ergibt sich
diese Notwendigkeit nicht, da sein Verständnis von Reichtum nicht in Verachtung,
!23
Vgl. GAUSTAD, EDWIN S.; SCHMIDT, LEIGH: The Religious History of America: The Heart of the American 64
Story from Colonial Times to Today, New York 2004. S. 121 - 138.
Vgl. FRANKLIN, BENJAMIN: The Autobiography of Benjamin Franklin (Dover Thrift Editions), Mineola 1996.65
Vgl. WEBER, MAX: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. in: DERS.: Gesammelte Aufsätze 66
zur Religionssoziologie, Band I, Tübingen 1920. S. 17 - 206.
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 297.67
POLANYI, KARL: Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der 68
Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 287f.
sondern dem aufklärerischen Interesse mündet. Er geht den pädagogischen Weg
soziologischer Prägung. Aristoteles lehnt eines der Axiome der neoklassischen Theorie, 69
die Knappheit der Ressourcen, ab. Die Grundnahrungsmittel sind nicht knapp. Was 70
knapp ist, sind die nicht lebensnotwendigen Konsumgüter. Wenn also durch hohe
Nachfrage eine Knappheit entsteht, dann gibt Aristoteles die Schuld einer falschen
Vorstellung vom guten Leben. Dieser falschen (hedonistischen) Vorstellung zufolge ist
das Leben nicht mehr als eine Fülle von materiellen Gütern und ihren Freuden. Das
Elixier des guten Lebens aber kann „weder gehortet noch physisch besessen werden.” 71
Aus einem zweiten Grund lehnt Aristoteles das Postulat der Knappheit der Ressourcen
ab: „Die Ökonomie - der Wortwurzel nach eine Angelegenheit des engeren Haushalts
oder des oikos - befaßt sich direkt mit den Beziehungen von Personen, die die natürlichen
Institution des Haushalts bilden. Er besteht nicht aus Besitztümern, sondern aus Eltern,
Nachwuchs und Sklaven.” 72
Aristoteles’ Begriff der Ökonomie legt nahe, sie als einen Prozess zur Sicherung der
Nachrungsmittelversorgung zu verstehen. „Mit ähnlicher Freiheit der Wortwahl könnte
man sagen, daß Aristoteles die irrtümliche Vorstellung von unbegrenzten menschlichen
Bedürfnissen und Erfordernissen oder von einer allgemeinen Knappheit an Gütern zwei
Umständen zuschreibt: erstens der Beschaffung von Nahrungsmitteln durch
kommerzielle Händler, wodurch Geldverdienst in die Suche nach Nahrung eingeführt
wird; zweitens einer falschen Vorstellung vom guten Leben als einer utilitaristischen
Akkumulation physischer Freuden.” 73
III. Das „Adam-Smith-Problem”
A. Verhältnisbestimmung von Theory und Wealth
!24
Ebd., S. 288.69
Aristoteles hat Recht: „Rein rechnerisch stehen heute jedem Menschen täglich etwa 2.700 Kilokalorien zur 70
Verfügung. Die Nahrung reicht aus, um die Weltbevölkerung von etwa 6,5 Milliarden Menschen gut und angemessen zu ernähren. Das Problem ist die ungleiche Verteilung: Überschussproduktion in den reichen Ländern – mangelnde landwirtschaftliche Erträge in einigen Entwicklungsländern, Tendenz sinkend.” Vgl. WELTHUNGERHILFE (HRSG.): Hunger. Ausmaß, Verbreitung, Ursachen, Auswege, Bonn 2005. S. 10.
POLANYI, KARL: Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der 71
Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 288.
Ebd., S. 288f.72
Ebd., S. 289.73
Die Herausforderung, der sich Adam Smith stellt, ist eine der Grundfragen der
Anthropologie: Wie ist das Verhältnis von Selbst- und Gemeinschaftsbezug und wie
verhalten sich selbstische Triebe zum moralischen Bewusstsein? Smith bewegt sich damit
in einem Spannungsfeld, das die Menschheit wohl schon immer, spätestens aber mit dem
Rationalisierungsschub der Achsenzeit. Das, was man paradox als eine Art 74
anthropologischen Imperativ der Bibel bezeichnen könnte, beschreibt mit Gott, dem
Nächsten und der eigenen Person die drei entscheidenden Bezugsgrößen der religiösen
Anthropologie im Lukasevangelium so: „Du sollst Gott, deinen HERRN lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und
Deinen Nächsten wie Dich selbst.” Damit formuliert die christliche Tradition mit ihrer 75
normativen Vorstellung der Gesellschaftsordnung gleichsam ein gewisses deskriptiv-
anthropologisches Moment: den Transzendenz-, Gemeinschafts- und Selbstbezug des
Menschen. Damit formuliert sie eine der schwierigsten Fragen aller Philosophie und
Theologie: Wie und worin konkretisiert sich die formale Bezogenheit aufeinander? Wie
ist das Individuum in seiner Gemeinschaft zu verstehen? Woran orientiert sich unser
moralisches Bewusstsein? Wie funktioniert die Sozialisation des Menschen und welche
ethische Reflexion ist für ein gelingendes Leben in Gemeinschaft notwendig? Modern
formuliert könnte hinzugefügt werden: Welche ökonomische Interaktion ist die gerechte?
Welchen institutionellen Rahmenbedingungen folgt unser Wirtschaften und welche
Konsequenzen hat die reziproke Bezogenheit des Menschen für den Freiheitsbegriff ?
Durch die Vorläufigkeit und Ambiguität aller Antworten auf diese Frage bedingt kehrt
auch in der Rezeptionsgeschichte Adam Smiths eine Frage immer wieder: Wie ist das
Verhältnis seiner unterschiedlichen Schriften zueinander zu bewerten? Geprägt ist die
Frage vom sogenannten Adam-Smith-Problem, das angenommene Gegensätze in den
Grundaussagen der Theorie der moralischen Gefühle und der Untersuchung des
Wohlstands der Nationen thematisiert. Vertreter dieser Annahme unterstellen, dass die
Moraltheorie Smiths durch die Betonung der Sympathie den Menschen als durchweg
altruistisch darstellt, während die ökonomische Theorie durch die Betonung des
Selbstinteresses den Menschen als durchweg egoistisch beschreibt.
!25
Vgl. JASPERS, KARL: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Frankfurt am Main, Hamburg 1955.74
Vgl. Leviticus 19,18; Matthäus 19,19; Markus 12,31; Lukas 10,27; Galater 5,14; Römer 13,9; Jakobus 2,8.75
In der Tat weisen Smiths Hauptwerke im Spannungsfeld von Individualität und Sozialität
einige interpretationsbedürftige Merkmale auf, die äußerst widersprüchlich erscheinen.
Die Untersuchung einiger unterschiedlicher Lösungsansätze des postulierten Gegensatzes
wird aber zeigen, dass die Gegenüberstellung von Egoismus im Wealth und Altruismus in
der Theory bei näherer Lektüre beider Werke und im Vergleich der unterschiedlichen
Auflagen der Theory unmöglich aufrecht zu erhalten ist.
Die seinerzeit vor allem von Nationalökonomen vertretene Umschwungtheorie möchte
die empfundenen Gegensätze zwischen Theory und Wealth mit einem Gesinnungswandel
Smiths während dessen Frankreichbesuchs 1759 erklären. Die Grundgedanken jener
beiden Werke waren jedoch schon Bestandteil der bereits erwähnten Ethikvorlesung in
Smiths Zeit als Professor für Moralphilosophie in Glasgow und ebenso finden sich in
einem von Dugald Stewarts erschlossenen Manuskript aus dem Jahr 1755 bereits einige
Grundlehren aus dem Wealth. Zudem müsste sich solch ein Gesinnungswandel in den 76
verschiedenen Auflagen der Theory nach 1759 niederschlagen. Das ist nicht der Fall und
die Umschwungtheorie damit obsolet.
Als Zwei-Wesen-Lehre bezeichnen könnte man die von Henry Thomas Buckle in seiner
„Geschichte der Zivilisation in England” geäußerte Überlegung, Smith habe den
Menschen phänomenologisch zunächst in seinem mitfühlenden Wesen und sodann in
seinem egoistischen Wesen darstellen wollen. Die Theorie geht davon aus, dass Smith 77
gerade im Wealth den Menschen bewusst auf sein eigennütziges Verhalten reduziert habe,
um eine Aufstellung ökonomischer Gesetze zu ermöglichen. So gesehen ist der Wealth
seinem Anspruch nach vor allem relative Arbeitshypothese und als Exkurs in einen
spezifischen Kontext menschlichen Verhaltens einzuordnen.
Hans Vaihinger nimmt die Zwei-Wesen-Lehre Buckles auf und entwickelt sie im Sinne
einer Fiktionstheorie weiter. In seiner Philosophie des Als Ob behandelt Vaihinger
vorangegangene Erklärungsversuche und beschreibt den Wealth als ein Beispiel der
abstraktiven oder neglektiven Fiktion. Smith bediene sich des „Kunstgriffs, vorläufig und
einstweilen eine ganze Reihe von Merkmalen zu vernachlässigen und nur die wichtigsten
!26
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 76
2010. S. XLIV.
Ebd.77
Erscheinungen herauszugreifen.” Walther Eckstein erläutert Vaihingers These mit dem 78
Hinweis, dass demzufolge Smith in seinem nationalökonomischen Hauptwerk die
„bewusst falsche Voraussetzung [...], dass der Mensch egoistisch sei” gemacht habe, um
eine Vereinfachung der Probleme des Wirtschaftslebens zu erzielen. 79
Wie die Theorien Buckles und Vaihingers geht auch der Lösungsversuch Charles Gides
davon aus, dass Smith die Gebiete der Moral und der Wirtschaft ihrer Natur nach
trennen wollte. Gide geht noch weiter und interpretiert Smiths Philosophie als eine Art
Zwei-Reiche-Lehre: „Das Gefühl oder, wie Smith sagt, die Sympathie hat ihr eigenes
Reich, die Welt der Moral, während in der wirtschaftlichen Welt der Nutzen herrscht.” 80
Auch dieser Interpretation muss vorgehalten werden, dass Smith seine Hauptwerke als
Ausarbeitung einer moralphilosophischen Vorlesung entwickelt hat und auch sonst
nirgends explizite Anzeichen für ein Bestreben, Wirtschaft und Moral zu trennen, zu
finden sind. Eckstein wendet insbesondere gegen Gides Erklärung eine grundsätzliche
Überlegung ein: Es ist „kaum einzusehen, wie sich die wirtschaftliche Welt von der Welt
der Moral trennen ließe, da doch die letztere gar nicht anders gedacht werden kann, als
das ganze Leben umfassend.” 81
Martin Patzen stellt in seiner Diskussion des sogenannten Adam-Smith-Problems drei
weitere Klärungsversuche dar. Demzufolge sehe die Sein-Sollen-Theorie die Theory als 82
präskriptive Aussage darüber, wie sich der Mensch verhalten solle, den Wealth hingegen
als deskriptive Aussage darüber, wie der Mensch wirklich sei. Diese Theorie vermag aber
ebensowenig den grundlegend deskriptiven Charakter der Theory wie die durchaus
vorhandenen präskriptiven Elemente des Wealth zu erklären.
Die Natürliche-Harmonie-Theorie betont den Deismus Smiths und sein Vertrauen auf
die im Menschen göttlich grundgelegte moralische Ordnung. Sie betont die Entkopplung
!27
VAIHINGER, HANS: Philosophie des Als Ob, Leipzig 1922. S. 29f, 341ff. Zitiert nach: ECKSTEIN, WALTHER: 78
Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. XLIV.
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 79
2010. S. XLIV.
GIDE, CHARLES: Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, Jena 1913. S. 95. Zitiert nach: ECKSTEIN, 80
WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. XLV.
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 81
2010. S. XLV.
MARTIN PATZEN: Zur Diskussion des Adam-Smith-Problems – Ein Überblick. in: ULRICH, PETER; MEYER-FAJE, 82
ARNOLD (HRSG.): Der andere Adam Smith, Bern 1991, S.25ff.
des individuellen Verhaltens von dem kollektiven Vorteil und Smiths Überzeugung, dass
durch die Lenkung der Gottheit die freie Interaktion der eigennützigen Marktteilnehmer
die allgemeine Wohlfahrt gestärkt wird. Diese Theorie nimmt anders als die oben
beschriebenen Theorien die prägende Kraft der religiösen Überzeugung für Smiths
akademisches Wirken wahr und wirft gleichzeitig ein neues Adam-Smith-Problem auf,
nämlich die Frage, ob dieses tiefe Vertrauen auf das mit der Metapher der unsichtbaren
Hand berühmt gewordene Postulat einer grundlegend moralischen Veranlagung des
Menschen als naiver Ausdruck des aufklärerischen Fortschrittsglaubens zu werten ist, der
zumindest die Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts mit seiner technisierten
Massenvernichtung nicht zu erklären vermag, oder ob solch eine Überzeugung noch
heute trägt.
Eine wieder andere Betonung setzt die von Patzen entwickelte Realismustheorie, die von
zahlreichen neueren Smith-Forschungen als der ergiebigste Lösungsansatz gesehen wird.
Die Realismustheorie sieht in der Gesamtschau der Smithschen Moralphilosophie eine
reife Einsicht in die Ambivalenz menschlicher Existenz, die geprägt ist von sowohl der
menschlichen Fähigkeit zum Altruistischen als auch der Neigung zum Egoistischen. Sie
erklärt die auf den ersten Blick unverständlichen Spannungen im Werk und kommt Smith
insofern entgegen, als sie ihn von den auf menschliche Fakultäten grenzenlos
vertrauenden Entwürfen anderer Autoren der Aufklärung abgrenzt. Insofern hätte Smith
also eine Mittelposition zwischen radikalen Deisten, die an die Perfektion von Natur und
Vernunft glauben, und reformatorischer Theologie, die Bewusstsein und Bekenntnis der
Sündhaftigkeit des Menschen, den Willen zur metanoia und die Bitte um Vergebung als
konstituierend für gelingende Gottesbeziehung und erlöste, gerechtfertigte
zwischenmenschliche Beziehung versteht. Vor dem Hintergrund der deistischern
Tendenzen Smiths und seiner protestantischen Sozialisation ist die Realismustheorie nicht
nur theologisch und philosophisch plausibel, sondern auch biographisch wahrscheinlich.
Gemeinsam mit der Natürliche-Harmonie-Theorie stellt sie einen vielversprechenden
Ansatz dar. Das „Adam-Smith-Problem” stellt sich bei genauer Betrachtung also als
weniger problematisch heraus, als die oberflächliche Lektüre suggerieren könnte.
Smith kann keineswegs als Vertreter eines radikalen Manchesterliberalismus, wie er von
klassischen Autoren nach Smith entwickelt und weiterentwickelt wurde, gelten. Seine
Theorie des freien Marktes kann selbst nicht als Moraltheorie kategorisiert werden,
vielmehr muss sie als in eine umfassende Moraltheorie eingebettet verstanden werden.
!28
Gottheit und Moral in Smiths Denken können nicht durch ökonomische
Gleichgewichtstheorien ersetzt werden. Tatsächlich war Smith an der gedanklichen
Integration der menschlichen Eigenschaften als einerseits sozial-gemeinwohlorientiertes
und andererseits individualistisch-egoistisch geneigtes Lebewesen interessiert. In der
Rezeptionsgeschichte reichte die Vereinfachung seiner Beschreibungsversuche der
differenzierten, menschlichen Natur mitunter so weit, dass Franz Oppenheimer den
Ausspruch Lessings - „wir wollen weniger erhoben und fleißiger gelesen werden” - auf
Adam Smith anwendet. 83
Von der Theory her interpretiert bekommt der Wealth seine moraltheoretische Grundlage
und verliert seine oft unterstellte marktradikale Schärfe. Die freie Interaktion der
Marktteilnehmer ist für Smith beileibe kein letztes Prinzip oder gar eine Gottheit. Die
freie Preisbildung und möglichst uneingeschränkte Kooperationsmöglichkeiten bringen
seiner Meinung nach die besten Voraussetzungen für die Menschen, ihre Talente dort
einzusetzen, wo sie gebraucht werden und damit ein selbstbestimmtes, gesellschaftlich
anerkanntes und als produktiv empfundenes Leben zu führen. Durch die genauen
Beobachtungen der Theory sensibilisiert kann ein Smith-Anhänger aus den
Marktprinzipien allerdings keine absoluten, in sich tragfähigen Größen machen.
Die Einstufung der Jugend- und Erwachsenenbildung als Aufgabe des Gemeinwesens ist
eines der zahlreichen Beispiele für die Konsequenzen, die Smith in seiner ökonomischen
Theorie aus den Grundlagen der Theorie der moralischen Gefühle zieht. In der Vielfalt
der ökonomischen Theorien heute würde sich Smith also wohl am ehesten mit den
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft identifizieren, möglicherweise mit einer
tendenziell ordoliberalen Prägung. Ganz gewiss nicht könnte er Privatisierungen im
Bildungswesen oder der Landesverteidigung als ethisch sinnvolle oder logisch aus seiner
ökonomischen Theorie abgeleitete Entscheidungen akzeptieren. Sie widersprechen den in
der Theory formulierten Grundüberzeugungen radikal. Darauf hinzuweisen produziert
jedoch kein Adam-Smith-Problem, sondern fordert vor allem die populäre Lesart des
Wealth heraus. Denn nicht nur in der Theory finden sich einschränkende Momente zum
später entwickelten System des laisser faire. Auch im Wealth notiert Adam Smith, der selbst
zeitweise vom öffentlichen Souverän als Zollbeamter eingestellt war und zeitlebens gute
!29
Zitiert nach: ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen 83
Gefühle, Hamburg 2010. S. XLIII.
Beziehungen zu Behörden und Politik hatte, zahlreiche Einschränkungen für die
Anwendung der Prinzipien des freien Marktes.
Das fünfte Buch des Wealth widmet sich den „Finanzen des Landesherrn oder des
Staates” und beschreibt als öffentliche Aufgaben Landesverteidigung, Justiz,
Infrastruktur, Bürokratie, Repräsentation, sowie Jugend- und Erwachsenenbildung. Als
Quellen der Finanzierung dieser öffentlichen Aufgaben behandelt er - mal affirmativ, mal
kritisch - unter anderem Grundsteuer, Umsatzsteuer, Kapitalertragssteuer,
Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Lohnsteuer, Reichensteuer, Verbrauchsteuern, sowie
die Staatsschulden. Prinzipielle Staatsverachtung oder ein programmatisches Bekenntnis
zur Ideologie des small government ist in Smiths Werken nicht zu finden, auch wenn er den
durch den Adel getragenen merkantilistischen Staat seiner Zeit durchaus als gierig
empfindet. Diese Ablehnung gilt jedoch vor allem dem Adel, über den Smith wie
beschrieben mit gewisser Verachtung schreibt. Im Kontext eines demokratisch
legitimierten Sozialstaats Smiths Kritik am Merkantilismus als Legitimation für
marktradikale Logik anzuführen, ist anachronistisch und nach tatsächlicher Lektüre seiner
Schriften nicht zu begründen. Sowohl staats- als auch wirtschaftstheoretisch ist das
„Adam-Smith-Problem” also weitgehend obsolet.
B. Moral Hazard und die Rationalitätenfalle
Einer der großen Punkte im Streit um die Deutungshoheit des Smithschen Werks ist die
Harmonie der Einzelinteressen. An ihr stoßen sich zahlreiche Kritiker seines „Systems
der natürlichen Freiheit”. Und tatsächlich verweisen uns die finanzpolitischen 84
Entwicklungen des angehenden 21. Jahrhunderts auf die zahlreichen Probleme der Figur,
zumindest in ihrer vereinfachten, neoklassisch-rationalistischen Version als Theorie des
marktwirtschaftlichen Gleichgewichts.
Der Unternehmer und Autor Rolf Dobelli widerspricht Smiths Vorstellungen von der
Harmonie der Einzelinteressen ausdrücklich und illustriert das mit dem Beispiel der
Allmende, einer landwirtschaftlichen Nutzfläche im Gemeinschaftsbesitz, die es so in der
Schweiz, der Alpenregion und im Schwarzwald noch gibt. „Stellen Sie sich ein saftiges
Stück Land vor, das allen Bauern einer Stadt zur Verfügung steht. Es ist zu erwarten, dass
jeder Bauern so viele Kühe wie möglich zum Weiden auf diese Wiese schickt. Das
!30
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: II in: Journal of Political Economy, 84
Vol. 48, No. 5. S. 704.
funktioniert, solange gewildert wird oder Krankheiten grassieren, kurz: solange die
Anzahl Kühe eine bestimmte Zahl nicht überschreitet, das Land also nicht ausgebeutet
wird. Sobald dies aber nicht mehr der Fall ist, schlägt die schöne Idee der Allmende in
Tragik um.” Der Bauer nämlich wird als individualrationaler Landwirt die Frage stellen, 85
welcher Nutzen daraus erwächst, eine zusätzliche Kuh auf die Weide zu stellen. Der
individuelle Nutzen liegt hier bei „+1”. Die Nachteile, die aus der Übervölkerung der
Weide erwachsen, liegen jedoch nur bei einem Bruchteil von „-1”, da sie auf alle
Schultern verteilt werden. Es droht die Rationalitätenfalle, ein Widerspruch also zwischen
dem, was für das Kollektiv rational ist, und dem, was für ein Individuum im Kollektiv
rational erscheint. Je stärker das Konkurrenzdenken unter den gemeinsam
wirtschaftenden Bauern ist, desto größer die Gefahr der Rationalitätenfalle. 86
Diese Dynamik begünstigt die Ausbildung eines Moral Hazard, der entsteht, wenn eine
Instanz des Gemeinwesens individuelle Risiken absichert. Eine solche Situation liegt vor,
wenn Banken als too big to fail eingestuft werden und sich somit sicher sein können, nicht
für die Konsequenzen ihrer Handlungen zur Rechenschaft gezogen zu werden und für
den Schaden nicht selbst aufkommen zu müssen. Eine solche Situation liegt ebenso bei
klassischem Versicherungsbetrug vor, wenn ein Individuum das Kollektiv für eigene
Zwecke ausnutzt, obwohl das langfristig auch für das Individuum selbst höhere
Versicherungsprämien nach sich ziehen wird. Die Gefahr des Moral Hazard liegt aber
auch dann vor, wenn unser Bauer auf der Allmende selbst nur einen Bruchteil der
Konsequenzen tragen muss, aber meint, in vollem Umfang von der Gewinnsteigerung
profitieren zu können, ohne durch per Gewaltmonopol gesicherte, allgemein gültige
Regeln beschränkt zu sein.
Langfristig - und holistisch verstandene Rationalität ist in der Lage das zu erfassen -
beraubt sich der einzelne Bauer auf der Allmende seiner Wirtschaftsgrundlage, indem er
durch Ausbeutung der Ressourcen und Unterwanderung des Kollektivvertrauens sein
eigenes Wirtschaften langfristig unmöglich macht oder zumindest deutlich erschwert.
Und auch wenn viele sogenannte Experten in den Jahren seit dem Beginn der Banken-
und Finanzkrise 2008 erklären, es habe sich nichts an der Kultur des Wirtschaftens in
Finanzinstitutionen geändert: Dass Bankiers und Börsenhändler seit der Finanzkrise mit
!31
DOBELLI, ROLF: Die Kunst des klaren Denkens, München 2011. S. 77.85
Vgl. HERDER-DORNEICH, PHILIPP: Der Sozialstaat in der Rationalitätenfalle: Grundfragen der sozialen 86
Steuerung, Stuttgart 1982.
großer Unterstützung und Ansehen in der Bevölkerung gesegnet sind, kann nicht
behauptet werden. Im Gegenteil, in manchen Teilen der Gesellschaft ist das Ideal eines
Bankiers oder Börsenhändlers regelrecht zum Schimpfwort geworden. Auch mit
Gehaltseinbußen müssen die meisten der Genannten leben.
Insofern lässt sich die Entwicklung der letzten Jahre als Quittungsbeleg für den
individualrational forcierten Substanzverlust im Wirtschaften zahlreicher
Finanzinstitutionen verstehen. Beispiele für die bewusste Forcierung individueller
Rationalität in das Allgemeininteresse berührenden Finanzgeschäften sind die
exorbitanten Bonuszahlungen für kurz- und mittelfristig hohe Gewinnmargen, die
Investmentbanker im Zusammenspiel mit den großen Ratingagenturen Moody’s, Fitch
und Standard and Poor’s und Versicherungen wie AIG mit zu hoch bewerteten und
risikoversicherten Paketen von subprime mortgages, also Hypotheken minderer Qualität und
Sicherheit, erwirtschaften konnten. Das Risiko war hoch, die Investmentbank jedoch
dagegen versichert, und so traf der Zusammenbruch des Systems nach der Pleite von
Lehman Brothers und dem Bekanntwerden des Ausmaßes des Handels mit fälschlich als
robust eingestuften Kreditpaketen im Hypothekensektor diejenigen Kleininvestoren
besonders hart, die ihr Vermögen in die von ihrer Bank geschnürten Hypothekenpakete
angelegt hatten. Zudem blieb ein großer Teil des Schadens bei Versicherungen hängen,
die wie die Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac ebenfalls als systemrelevant
eingestuft wurden und vom Steuerzahler gerettet werden mussten. Wir können also in 87
der so kompliziert anmutenden Finanzmarktanalyse der ersten Dekade des 21.
Jahrhunderts dieselben Gefahren wie bei unserem Bauern auf der Allmende erkennen.
So Recht nun Adam Smith mit der Grundannahme hat, dass die freie Kooperation
einzelner Marktteilnehmern in vielen Fällen zur Steigerung des Wohlstands aller
Teilnehmer führt, so sehr zeigen die Erfahrungen des 21. Jahrhunderts beim CO2-
Ausstoß, bei der Überfischung der Weltmeere, bei der Abholzung der Regenwälder und
all unseren vorangegangenen Beispielen, dass ein Wirtschaftssystem, das rein auf die
Harmonie individueller Einzelinteressen aufbaut, zum Scheitern verurteilt ist. Dobellis
Antwort: „Der große Irrtum besteht darin, zu hoffen, dass [die Tragik der Allmende] sich
über Erziehung, Aufklärung, Informationskampagnen, Appelle an die soziale Gefühle,
päpstliche Bullen oder Popstar-Predigten aus der Welt schaffen lassen werde. Wird sie
!32
BUCHTER, HEIKE: Das schwarze Loch. Der Versicherungskonzern AIG trieb Amerika tief in die Finanzkrise – 87
und kostet das Land jetzt mehr als jede Bank. in: Die Zeit, 04. Mai 2009, Nr 8.
nicht.” Er skizziert zwei Lösungsmöglichkeiten: „Privatisierung oder Management. 88
Konkret: Das saftige Stück Land wird in private Hände gelegt, oder der Zugang zur
Weide wird geregelt.” Management kann konkret bedeuten, dass ein Staat Regeln
aufstellt. Der Staat kann eine Nutzungsgebühr einführen oder den Zugang zeitlich
beschränken, so Dobelli. Die Privatisierung wäre die einfachere Lösung, allerdings lasse
sich auch fürs Management argumentieren. Dobelli schließt mit der Frage: „Warum tun
wir uns mit beidem so schwer? Warum hängen wir immer wieder der Idee der Allmende
nach?” 89
Sein Antwortvorschlag geht von evolutionstheoretischen Gründen aus. Zum Einen:
Während der gesamten Menschheitsgeschichte standen uns unbeschränkte Ressourcen
zur Verfügung. Zum Andern: Bis vor 10 000 Jahren lebten wir in Kleingruppen. War 90
jemand auf seinen alleinigen Vorteil bedacht, wurde das sofort registriert und mit der
schlimmsten aller Strafen, der Rufschädigung nämlich, belegt. Im Kleinen funktioniere
Sanktion durch Scham noch heute, so Dobelli. In der anonymen Gesellschaft spiele sie
aber keine Rolle mehr. Hier decken sich Dobellis Thesen mit Elementen des Smithschen
Denken, der sowohl die soziale Anerkennung und das Streben nach sozialem Status, als
auch das materielle Selbstinteresse als Triebfeder wirtschaftlicher Aktivität ausmacht.
C. Die funktionalistische Anonymität des Marktes
Smiths versteht als konstituierende Dynamik von Gesellschaft nicht wie Aristoteles die
Wiederherstellung der natürlichen Selbstgenügsamkeit, sondern die von der Selbstliebe als einer
der Triebfedern des Erwerbsstrebens motivierte, auf den eigenen Vorteil gerichtete
ökonomische Transaktion. Er legitimiert das aus einer postulierten natürlichen Neigung
des Menschen zum Handel. Allerdings bekommt der Handel an sich seine entscheidende
gesellschaftsprägende Relevanz erst unter Bedingungen der Anonymität. Diese
Anonymität setzt Smith voraus, sie ist aber keineswegs selbstverständlich. Er spricht in
der berühmten Passage des Wealth vom Bäcker, Metzger und Brauer lediglich in ihren
Funktionen als Wirtschaftsakteure: „Nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers
oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr
eigenes Interesse. Wir wenden uns nicht an ihre Humanität, sondern an ihre Eigenliebe
!33
DOBELLI, RALF: Die Kunst des klaren Denkens, München 2011. S. 78.88
Ebd.89
Ebd.90
und sprechen ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren Vortheilen. Nur
einem Bettler ist gedient, fast ganz von dem Wohlwollen seiner Mitmenschen
abzuhängen.” 91
Das ist plausibel, verleitet aber zu Fehlinterpretationen. Smith beschreibt hier nur einen
Aspekt der sozialen Interaktion in einer Gesellschaft. Herr Meier ist in einer
kommerziellen Gesellschaft selbstverständlich nicht nur Privatmann Meier, sondern eben
auch der Bäcker im Ort, genau wie Herr Müller der Metzger und Herr Schmidt der
Brauer ist. Trotzdem besteht die Ordnung der Gesellschaft nicht aus sich selbst heraus,
sondern durch die sie tragenden Menschen. Der Bäcker ist eben immer auch Herr Meier,
der Metzger immer auch Herr Müller und der Brauer immer auch Herr Schmidt. Adam
Smith war das bewusst. Im ersten Satz der Einleitung der Theory schreibt Smith ja: „Mag
man den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse
Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu
nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen,
obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu
sein.” Wieso Smith diese Selbstverständlichkeit, die er ausmacht, nicht auch in der 92
Passage zur Triebfeder des ökonomischen Handelns der Herren Meier, Müller, Schmidt
erwähnt, ist aus heute nicht rekonstruierbar. Vermutlich war es für Smith tatsächlich
schlechthin unvorstellbar, dass diese ihm völlig offensichtlich erscheinende Beobachtung
für spätere Generationen nicht selbstverständlich sein könnte. Allerdings hat Smith mit
seinen eigenen Schriften selbst dazu beigetragen hat, dass die von ihm beschriebene
Selbstverständlichkeit ihre Selbstverständlichkeit verloren hat.
Von keinem Ökonomen kann Smith erwarten, den Wealth nur als durch die Lektüre der
Theory qualifizierte Schrift zu lesen. Dennoch muss jeder moderne Ökonom,
Wirtschaftsphilosoph und Anthropologe dazu herausgefordert werden, nicht nur isoliert
Passagen aus dem Wealth zu rezipieren, die scheinbar den Eigennutz als einzig relevante
menschliche Dynamik ausmachen, sondern auch die Passagen in der Theory, die die
Sympathie als Prinzip sittlicher Richtigkeit und Urteilsfindung beschreiben, zur Kenntnis
zu nehmen und in die Interpretation einzubeziehen. Wie die Betrachtung der
ökonomischen Interaktion in der eben zitierten Alltagssituation von Bäcker, Metzger und
!34
STIRNER, MAX (HRSG.): Adam Smith. Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des 91
Nationalreichthums, Band I, Leipzig 1846. S. 26.
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S.5.92
Brauer rein nach den beschriebenen Funktionen zeigt: Das für Smith selbstverständliche
Prinzip der Sympathie als einem Prinzip der Natur, das die Menschen miteinander
verbindet, verliert umso mehr an Kraft je anonymer die ökonomische Transaktion ist.
Unter Bedingungen einer computergesteuerten Mathematik ist die Finanzwirtschaft
deshalb seit der Digitalisierung auch weitgehend frei von dem Prinzip der sittlichen
Richtigkeit, das Smith als das Konzept der Sympathie entwickelt. Hier ist es wichtig, sich
in Erinnerung zu rufen: Wenn bei Smith von Sympathie die Rede ist, ist nicht wie bei
Francis Hutcheson das Wohlwollen (benevolence), sondern das Einfühlungsvermögen
mithilfe der Einbildungskraft gemeint. In jedem Fall versteht Smith die Sympathie aber
als sozialen Kitt und als alle menschliche Interaktion durchziehende Dynamik, die die
egozentrischen Impulse des Menschen durchdringt und begrenzt. 93
D. Der Markt als System der sozialen Kommunikation
Im dritten Kapitel des Wealth behandelt Adam Smith eine der entscheidenden
Grundfragen seiner Idee von Marktwirtschaft: die Größe eines Marktes. Smith stellt fest,
dass ein Markt erst ab einer gewissen Größe in einem befriedigenden Maße in der
erstrebten Art und Weise funktioniert. Dem zugrunde liegt die Feststellung, dass das 94
individuelle Subjekt angewiesen ist auf eine funktionierende überindividuelle Ordnung.
Menschlich ausgehandelte, rechtliche Rahmenbedingungen müssen also die Vorbereitung
dafür treffen, dass die göttlich gesetzte moralischen Ordnung wie durch eine unsichtbare
Hand zur vollen Blüte kommt. Bei Smith, der schon in seiner ersten Ethikvorlesung die
Rechtswissenschaft zum Gegenstand, einen ausführlichen rechtswissenschaftlichen
Dialog mit David Hume pflegte und vor seinem Tod noch eine umfassende 95
Rechtsgeschichte verfassen wollte, zeigt sich hier deutlich die Natur der deistischen
Vernunftreligion im Vertrauen auf die abstrakte Gottheit, die den Menschen zur
Vernunft befähigt und zum Guten geschaffen hat. Was für die Smith-Rezeption heute oft
!35
Francis Hutcheson studierte sechs Jahre lang Theologie in Glasgow und gründete in Dublin eine 93
presbyterianische Privatakademie. Hutchesons protestantische Prägung ist deutlich stärker als Smith, der sich stärker dem Deismus zuwendet. Das plausibilisiert die unterschiedlichen Wege, die sie in der Interpretation des Sympathiebegriffs gehen. Vgl. LEIDHOLD, WOLFGANG: Einleitung. Liebe, Moralsinn, Glück und Civil Government. Anmerkungen zu einigen Zentralbegriffen bei Francis Hutcheson. in: DERS. (HRSG.): Francis Hutcheson: Eine Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Tugend, Hamburg 1986.
Das Kapitel trägt den Titel: „Die Größe des Marktes - eine Grenze für die Arbeitsteilung”. Vgl. RECKTENWALD, 94
HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978. S. 19ff.
Vgl. MEEK, R.L.; RAPHAEL, D.D.; STEIN, P.G. (HRSG.): Adam Smith. Lectures on Jurisprudence (Glasgow 95
Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 5), Oxford 1978.
eine Herausforderung darstellt: Er schreibt nicht unter den Bedingungen des säkularen
Staates. Führ ihn sind Moral und Religion in Staat und Individuum noch weitgehend
präsent. Seine Theorie ist also formuliert für ein moralbewusstes, weitgehend religiöses
Gemeinwesen. Dass die Religion als Quelle der Moral nicht selbstverständlich ist, kann
sich Smith im 18. Jahrhundert nicht vorstellen. Die Säkularisierungsprozesse der
vergangenen zwei Jahrhunderte legen aber genau das nahe. Insofern ist am Kern der
vielen Missverständnisse, die Sraffa beklagt, ein Unverständnis der Religion. 96
Das Vertrauen in die menschlichen Fakultäten ist bei Smith trotz seiner mitunter
herablassenden Haltung gegenüber dem Adel und der Beeinflussbarkeit des Menschen
durchaus ausgeprägt. Man bedenke: Smith schreibt gegen ein merkantilistisch-
monarchisch organisiertes Gesellschaftswesen an, deren Eliten dem Volk keineswegs
zutrauen, sich allein durch die geregelte, freie Kooperation ökonomisch geordnet an der
Mehrung des Wohlstands zu beteiligen. Ein Verdienst Smiths ist die Stärkung des
Vertrauens ins Individuum in den politischen Eliten. Smith hat so nicht nur an der
Grundlage für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mitgearbeitet, sondern
einen gleichsam bedeutenden Beitrag zur Ausbildung einer Kultur des Respekts vor dem
Individuum geleistet, der sich bis heute in der rechtsstaatlichen Verfasstheit der meisten
Staaten Europas niederschlägt. Nun kann Smith aber keineswegs rein subjektivistisch
oder individualistisch gedeutet werden. Vielmehr hält er die gemeinschaftliche
Verfasstheit der Menschheit für unaufhebbar in der Natur des Menschen verankert. 97
Und auch die Idee des Marktes ist entsprechend überindividuell bzw. voraussetzungsreich
zu verstehen. Die wirtschaftliche Aktivität des Individuums ist immer intersubjektiv
veranlagt. Dort, wo der Marktteilnehmer seinen Horizont auf sich selbst beschränkt, hört
das marktwirtschaftliche System auf marktwirtschaftlich zu sein. Vereinfacht lässt sich
sagen: Ein Markt ohne Marktteilnehmer existiert nicht. Und: Ein Marktteilnehmer ohne
!36
Vgl. das eingangs erwähnte Zitat: „The classical economists said things which were perfectly true, even according 96
to our standards of truth: they expressed them very clearly, in terse and unambiguous language, as is proved by the fact that they perfectly understood each other. We don’t understand a word of what they said: has their language been lost? Obviously not, as the English of Adam Smith is what people talk today in this country. What has happened then?” in: PASINETTI, LUIGI L.: Continuity and Change in Sraffa’s Thought: an Archival Excursus, in: COZZI, TERENZIO; MARCHIONATTI, ROBERTO: (HRSG.): Piero Sraffa’s Political Economy: a Centenary Estimate, London 2001. S.153.
Vgl. ANDREE, GEORG JOHANNES: Sympathie und Unparteilichkeit. Adam Smiths System der natürlichen 97
Moralität, Paderborn 2003.
andere Marktteilnehmer nimmt nicht an einem Markt teil, ist also kein Subjekt in einem
wirtschaftlichen Interaktionssystem, sondern ein Subsistenzwirtschafter.
Ein Tauschsystem impliziert eine gemeinschaftliche Wirtschaftsordnung. Das bedeutet also,
auch eine freie, individualistische Wirtschaftsordnung ist nie bar der gemeinschaftlichen
Dimension. „Der Markt” ist keine eigene Entität, sondern die Gesamtheit aller
möglichen Tauschabschlüsse durch ökonomisch interagierende Individuen, die zwar ein
Kollektivbewusstsein entwickeln können, deren Gesamtheit aber nicht als eine von ihren
konstituierenden Elementen losgelöste Einheit gedacht werden kann. Ökonomische
Theorie ist dementsprechend vor allem Interaktionstheorie und muss gewissermaßen
eine Anthropologie der Beziehung entwickeln, um tatsächlich die Wirklichkeit realer
ökonomischer Interaktion zu erfassen. Zusammengefasst: Adam Smith versteht
Tauschbeziehungen als Systeme der sozialen Kommunikation. 98
Anders als spätere Autoren der Klassik sieht Smith also nicht nur Wettbewerb und
Eigennutz, sondern auch Kommunikation und Kooperation als konstitutive Elemente
arbeitsteiliger Marktwirtschaften. Die freie Kooperation wiederum führt Smith im
Kontext der Selbstliebe als Triebfeder des Erwerbslebens zur Einsicht, dass nicht ein
merkantilistisches, sondern ein freies, wettbewerblich verfasstes Wirtschaftssystem der
kommunikativ-kooperativen Veranlagung des Menschen in arbeitsteiligen Gesellschaften
zur vollen Blüte verhilft. 99
Zum Verständnis ökonomischer Theorie als Interaktionstheorie gesellt sich ein Zweites:
Ein Mensch, der sich seiner Angewiesenheit auf seine Mitmenschen nicht bewusst ist, ist
naiv. Die anthropologische Ausformulierung dieser Naivität äußert sich unter anderem im
Paradigma des homo oeconomicus. Smith dagegen ist sich der relationalen Dimension des 100
Wirtschaftens voll bewusst. Es wäre eine fatale Verkürzung, seine Idee der Selbstliebe als
im luftleeren Raum bestehend zu begreifen, Smith denkt den sozialen Kontext stets mit,
wie ein Blick in seine Theorie der Arbeitsteilung zeigt: „Wie das Verhandeln, Tauschen
!37
WALLACHER, JOHANNES: Die bleibende Bedeutung der Politischen Ökonomie Adam Smiths. in: 98
HOCHGESCHWENDNER, MICHAEL; LÖFFLER, BERNHARD (HRSG.): Religion, Moral und liberaler Markt. Politische Ökonomie und Ethikdebatten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 101.
BALLESTREM, KARL GRAF: Adam Smith, München 2001. S. 145f.99
Entsprechend scharf ist die Kritik an den Modellen des homo oeconomicus, die die Dimension der Angewiesenheit 100
nicht zu erfassen in der Lage sind. Karlheinz Ruckriegel kann in der von der Ludwig-Erhard-Stiftung herausgegebenen Zeitschrift „Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik” vom homo oeconomicus sogar als realitätsfernem Konstrukt reden. Vgl. RUCKRIEGEL, KARLHEINZ: Der Homo oeconomicus - Ein realitätsfernes Konstrukt. in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bd. 120, Bonn 2009. S. 49-55.
und Kaufen das Mittel ist, uns gegenseitig mit fast allen nützlichen Diensten, die wir
brauchen, zu versorgen, so gibt die Neigung zum Tausch letztlich auch den Anstoß zur
Arbeitsteilung. Unter Jägern oder Hirten stellt beispielsweise ein Mitglied des Stammes
besonders leicht und geschickt Pfeil und Bogen her. Häufig tauscht er sie bei seinen
Gefährten gegen Vieh oder Wildbret ein, und er findet schließlich, dass er auf diese
Weise mehr davon bekommen kann, als wenn er selbst hinaus geht, um es zu jagen. Es
liegt deshalb in seinem Interesse, daß er das Anfertigen von Pfeil und Bogen zur
Hauptbeschäftigung macht und somit gleichsam zum Büchsenmacher wird.” 101
Hier beschreibt Smith die Grundmotivation zur Arbeitsteilung als das Streben nach
materiellem Mehr im Individuum. Zu beachten ist zunächst, dass Smith hier nicht die
conditio humana schlechthin auf die Selbstliebe und ein resultierendes Eigeninteresse
reduziert. Vielmehr erklärt er ein allerorts zu beobachtendes Phänomen, die arbeitsteilige
Gesellschaft nämlich, und bemüht sich, das in einen systematischen Zusammenhang
einzuordnen und als eine Theorie der wirtschaftlichen Interaktion auszuformulieren.
Wofür das erwirtschaftete Mehr an Gütern als Resultat der Arbeitsteilung verwandt wird,
ist hier nicht das Thema. Auch postuliert Smith hier nicht das ökonomische Prinzip als
allumfassende Anthropologie, die auch die letzten Ecken, die Reziprozitätsbeziehungen
innerhalb einer Familie beispielsweise, deskriptiv erfassen oder präskriptiv verordnen soll.
Auch die Idee der Arbeitsteilung ist keine Erfindung Smiths. Unter anderem die antike
Philosophie und die frühen kanonischen Schriften der jüdisch-christlichen Tradition 102
kennen ganz selbstverständlich die Arbeitsteilung in menschlichen Gemeinschaften, ganz
zu schweigen von den basalen Grundmustern der Arbeitsteilung, die im Fortpflanzungs-
und Ernährungsverhalten tierischer Gemeinschaften zu erkennen sind. 103
Neu an Smiths Ausführung ist ein gänzlich Anderes: Smith kombiniert uralte Gedanken
zur Arbeitsteilung mit neuzeitlichen Ausprägungen des Naturrechts zu einer Art
mythologischen Urszene seiner ökonomischen Theorie. Bei näherem Hinsehen erweist
!38
RECKTENWALD, HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978. S. 17.101
Zu nennen sind hier insbesondere Xenophons „Oeconomicus” und Platons „Politeia”. Vgl. auch POLANYI, 102
KARL: Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 291-297.
Für eine übersichtliche Zusammenfassung der Smithschen Theorie der Arbeitsteilung vgl. WALLACHER, 103
JOHANNES: Die bleibende Bedeutung der Politischen Ökonomie Adam Smiths. in: HOCHGESCHWENDNER, MICHAEL; LÖFFLER, BERNHARD (HRSG.): Religion, Moral und liberaler Markt. Politische Ökonomie und Ethikdebatten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 99f.
sie sich aber als ganz und gar nicht ursprünglich. Sie ist ein mit der Rhetorik des
Naturvolks aufgeladenes Konstrukt, das seiner ökonomischen Theorie maßgeschneidert
ist. Im Beispiel der Jäger und Hirten beschreibt Smith in einfachen Bildern seine
Vorstellung von Tauschwirtschaft als ursprüngliche Form der Vergesellschaftung. 104
Entscheidend dabei ist: Das Eigeninteresse ist konstituierend für den
Gemeinschaftsbegriff. Hier ist das zentrale Motiv klassischer und neoklassischer 105
Theorie angelegt. Antike Philosophie und die Theologie hingegen gingen immer von
einer ursprünglich bestehenden Gemeinschaft aus, die sich dann durch immer
komplexere Prozesse wie die Entwicklung von der Subsistenz- zur Tauschwirtschaft
ausdifferenzierte. Neuere theologische Entwürfe wie der von Wolfgang Huber arbeiten
an dieser Stelle unter Rückgriff auf Michael Theunissen und Jürgen Habermas mit dem
Motiv der „unhintergehbaren Verbindung von Individualität und Sozialität im Schenken
der Freiheit durch Gott.” Geprägt ist dieses Motiv von der in lutherischer Tradition 106
stehenden Verbindung von communio und communicatio. „Gerade das reformatorische
Freiheitsverständnis ist durch die Gleichursprünglichkeit von Individualität und Sozialität
gekennzeichnet. Die Reformation versteht Freiheit als kommunikative Freiheit.” 107
Festzuhalten bleibt, dass Smiths Ausführungen die relationale Dimension des
Wirtschaftens betont und den Tausch als natürliche Neigung und damit als im Menschen
ursprünglich angelegt versteht: „Die Arbeitsteilung, die so viele Vorteile mit sich bringt,
ist in ihrem Ursprung nicht etwa das Ergebnis menschlicher Erkenntnis, welche den
allgemeinen Wohlstand, zu dem erstere führt, voraussieht und anstrebt. Sie entsteht
vielmehr zwangsläufig, wenn auch langsam und schrittweise, aus einer natürlichen
!39
Weiterführendes zu Smiths Sozialtheorie in: MEDICK, HANS: Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen 104
Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Soialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Göttingen 1973.
Vgl. SINGER, BRIAN C. J.: Montesquieu, Adam Smith and the Discovery of the Social. in: Journal of Classical 105
Sociology, Nr. 4, Thousand Oaks 2004. S. 31-57.
FOURIE, WILLEM: Von der Freiheit eines Christenmenschen. Eine südafrikanische Interpretation von Freiheit in 106
der Theologie Wolfgang Hubers. in: BEDFORD-STROHM, HEINRICH; NOLTE, PAUL; SACHAU, RÜDIGER (HRSG.): Kommunikative Freiheit. Interdisziplinäre Diskurse mit Wolfgang Huber. S. 164.
HUBER, WOLFGANG: Der Protestantismus und die Ambivalenz der Moderne. in: MOLTMANN, JÜRGEN (HRSG.): 107
Religion der Freiheit. Protestantismus in der Moderne, München 1990. S. 61.
RECKTENWALD, HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978. S.16.108
Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander auszutauschen.” Smith 108
führt an dieser Stelle diese Ursprünge der Neigung nicht näher aus. 109
Deutlich wird: Der Ursprung der Arbeitsteilung besteht nicht in der Erkenntnis, sondern
in einer natürlichen Neigung zum Tausch. So verstanden beruht Smiths Theorie der 110
Arbeitsteilung anders als der Ansatz des homo oeconomicus nicht auf ökonomischer Rationalität,
sondern auf der triebhaften Neigung zum Tausch in der Natur des Menschen, gegen die er
sich auch mit der bestausgeprägtesten Rationalität nicht wehren kann. Nun äußert Smith
aber doch die Vermutung, dass das Denken und Sprechen den Ursprung der Neigung
zum Tausch darstellt. Insofern ist die Ablehnung der Rationalität bei Smith weniger
ausgeprägt, als der erste Blick nahe legt. Es bleibt zumindest eine gewisse Spannung in
Smiths Ausführungen. Ein Vorschlag zur Versöhnung der Rationalität und des Triebes,
die Smith durchaus ein Anliegen ist, könnte wiederum das System der sozialen
Kommunikation aus der Theory sein: Es ist nicht der Tausch selbst, der in der Natur
veranlagt ist, sondern die Reflexion und Kommunikation, aus der natürlicherweise die
Neigung zur ökonomischen Interaktion und somit dem Tausch resultiert.
Das aus der Theory bekannte Prinzip der Sympathie als sittlicher Richtigkeit der
Handlungen legt nahe, dass er Denken und Sprechen nicht im Raum eines sich selbst
genügenden Individuums verortet, sondern als relational versteht. So wird aus dem
abstrakten Denken ein denken an oder nachdenken über und aus dem Sprechen ein sprechen
mit oder sprechen von. Sprachphilosophisch formuliert: Das Prädikat existiert nicht in sich
oder für sich. Es verbindet ein konkretes Subjekt mit einem konkreten Objekt,
wenngleich das grammatikalische Objekt zugleich auch das lebenswirkliche Subjekt sein
kann, wie im Fall der Selbstreflexion. Die kommunikative Bezogenheit auf andere
menschlichen Subjekte, die sich auch in der grammatischen Bezogenheit von Subjekt und
Objekt ausdrückt, ist anthropologisch festzuhalten.
!40
Vgl. ebd.: „Ob es sich bei dieser Neigung um eine jener angeborenen oder ursprünglichen Eigenschaften der 109
menschlichen Natur handelt, die nicht weiter erklärt werden kann, oder ob sie, was wohl wahrscheinlicher sein dürfte, die notwendige Folge der menschlichen Fähigkeit, denken und sprechen zu können, ist, diese Frage wollen wir hier nicht näher untersuchen.”
Christoph Kucklick kann aus Smiths Ausführungen über die Verehrung der Reichen und Mächtigen und ihrer 110
„nichtigsten und unbedeutendsten Gelüste” sogar schließen: „Die soziale Welt wird vom Nachahmen, nicht vom Nachdenken beherrscht.” Diese Analyse erscheint mir übertrieben. Smiths Skeptizismus ist ein gemäßigter. Er gesteht dem Menschen zumindest eine gewisse Vernunft zu, selbst wenn er die Triebhaftigkeit menschlichen Verhaltens stets mitdenkt. Vgl. KUCKLICK, CHRISTOPH: Das unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der Negativen Andrologie, Frankfurt am Main 2008. S. 159.
Smiths Gedanken könnten insofern sinnvoll weitergedacht werden, als eine relational
qualifizierte Rationalität den Menschen in ökonomischen Kontexten zur Kooperation und
Arbeitsteilung bewegt. Die Kooperation verspricht ein Mehr an Material, aber bedeutet
eben auch ein Mehr an Beziehung. Derlei ist in unserem Begriff der Handelsbeziehung
aufgenommen und ebenso impliziert der Begriff der Marktwirtschaft grundlegend die
Interaktion einzelner Subjekte in einem Kollektiv, ob organisiert und verrechtlicht oder
nicht. Der Soziologe Christoph Kucklick interpretiert diese Beziehungsorientierung
Smiths als „Feminisierung der Moral”. Smith baue die Sympathie zu einem „raffinierte[n]
Medium der Verkopplung atomistischer Individuen” aus. Was Kucklick negativ als 111
„gesteigerte Auflösung der männlichen Autonomie” wertet, könnte helfen, die verengte
Anthropologie des homo oeconomicus zu renovieren und so zu rehabilitieren.
E. Relationale Rationalität und detranszendentalisierte Vernunft
Die Terminologie des homo oeconomicus hat die Intersubjektivität der Beziehung nicht
adäquat in sich aufzunehmen vermocht und deshalb als defizitär erwiesen. Sie verleitete
zur fehlerhaften Annahme, Rationalität sei prinzipiell mit egoistischem Kalkül
gleichzusetzen. Den Begriff des homo oeconomicus gleich ganz aufzugeben, könnte sich aber
als Fehler erweisen. Zu offensichtlich ist, dass Menschen in intimen Kontexten mit ihren
Angehörigen andere Kalküle oder Affekte aufweisen als in unpersönlichen Kontexten,
die sich als explizit wettbewerbsorientiert darstellen. Das Unterfangen sollte deshalb sein,
den naiven Rationalitätsbegriff des homo oeconomicus durch einen realistischen zu ersetzen.
Eine relational qualifizierte Rationalität kann hier einen Denkansatz bieten.
Kucklick sieht diese Form der relationalen Rationalität bei Smith schon angelegt, wenn er
schreibt: „Smith bereitete damit den modernen Begriff des Individuums vor, das sich
nicht mehr autonomes, rationales, ‘heldenhaftes’ Subjekt verstehen kann, sondern als
Produkt einer sozialen Bestimmung, das gleichwohl danach strebt, sich als
selbstgeschaffen und selbstgesteuert auszugeben.” Kucklick liegt zwar falsch, wenn er 112
das vormoderne Subjekt pauschal als autonom und rational bezeichnet und im Gegensatz
zum modernen „Produkt einer sozialen Bestimmung” versteht. Sowohl Aristoteles’ zôon
politikon, als auch vormoderne Stammeskulturen und religiöse Gemeinschaften sehen den
!41
KUCKLICK, CHRISTOPH: Das unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der Negativen Andrologie, Frankfurt am 111
Main 2008. S. 159.
Ebd., S. 158.112
Menschen als in der Gemeinschaft und nicht aus sich selbst heraus verortet, sondern Teil
eines gemeinschaftlichen Schicksals ohne daraus einen Gegensatz zur Rationalität zu
konstruieren. Gleichwohl hat Kucklick durchaus Recht, wenn er analysiert, Smith wende
seine Anthropologie hin zum durch die Sympathie intersubjektiv verknüpften
Individuum, das sich selbst gerne als self-made man verstehen würde, daran allerdings
kläglich scheitert. Begünstigt wird dieses Phänomen der Moderne, wie Kucklick richtig
beschreibt, durch die von Smith beschriebene Arbeitsteilung: „Die instrumentelle
Vernunft des Einzelnen, seine Fähigkeit im Umgang mit seinem Gewerbe, wächst,
zugleich verschwinden die breiten, übergeordneten intellektuellen Fähigkeiten, die
notwendig sind für eine integrierende Deutung der Welt. Gewinn und Verlust sind
untrennbar verbunden.” 113
Die Frage nach dem Verhältnis von Relationalität und Rationalität ist also beeinflusst
durch die kulturellen Bedingungen der Moderne und die strukturelle Veränderung hin zu
hochdifferenzierten, arbeitsteiligen Gesellschaften. Smith zeigt seinerzeit schon die
Sensibilität für diese Prozesse und bietet hier mit seinem empirisch-historisch
unterlegten, soziologisch kompetentem moralphilosophischen Ansatz zahlreiche
Anknüpfungspunkte. Insofern könnte an Smiths kooperativ-kommunikatives Verständnis
der zum Handel geneigten Menschen und ihrer in jedem Fall arbeitsteilig verfassten
Wirtschaftsordnungen anknüpfend eine relational qualifizierte Rationalität, wie Jürgen
Habermas es vorschlägt, als kommunikative Rationalität konkretisiert werden. 114
Wie Adam Smith ist auch Habermas daran interessiert, was unter den Bedingungen der
entgleisenden Moderne der differenzierten Gesellschaft Solidarität stiften kann.
Interessanterweise sieht Habermas anders als Smith, der mit seinem Deismus den Gott
der geschichtlichen Offenbarung aus dem alltäglich-diesseitigen Leben verdrängt, die
Religion als eine der solidaritätsstiftendenden Kräfte, die durch den archaischen Ritus mit
einer eigenen Rationalität gemeinschaftsstiftend wirkt. Und doch lassen sich auch in 115
Smiths deistischem Ansatz Spuren der solidaritätsstiftenden Religion erkennen, selbst
!42
Ebd., S. 155.113
Vgl. HABERMAS, JÜRGEN: Theorie des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrationalität und 114
gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt am Main 1981. Und: HABERMAS, JÜRGEN: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main 1983.
Vgl. HABERMAS, JÜRGEN: Religion und nachmetaphysisches Denken. Eine Replik. in: DERS.: 115
Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 2012.
wenn sie bei Smith nicht als Wirken eines heiligen Geistes, sondern mit dem Sympathie
als Prinzip sittlicher Richtigkeit als moralpsychologischen Mechanismus versteht.
Jürgen Habermas setzt mit seiner Konzeption einer detranszendentalisierten Vernunft dort
an, wo Smith noch gescheitert ist. Der nämlich gibt die Vernunft als einigende Kraft 116
der Gesellschaft tatsächlich weitgehend auf. Deutlich wird das in seiner Beschreibung des
Aspekts der Arbeitsteilung, der Karl Marx später zu seiner Kapitalismuskritik veranlassen
wird: „Mit fortschreitender Arbeitsteilung wird die Tätigkeit der überwiegenden
Mehrheit derjenigen, die von ihrer Arbeit leben, als der Masse des Volkes, nach und nach
auf einige wenige Arbeitsgänge eingeengt, oftmals auf nur einen oder zwei. […] So ist es
ganz natürlich, daß er verlernt, seinen Verstand zu gebrauchen, und so stumpfsinnig und
einfältig wird, wie ein menschliches Wesen eben nur werden kann.” Die Vernunft wird 117
als nicht herausgefordert oder gestört durch die Dummheit der Menschen, sondern
durch die Komplexität der Gesellschaft. Die differenzierte Gesellschaft kann die
einheitliche Perspektive der Vernunft schlicht nicht mehr leisten. Smith entwickelt 118
deshalb mit der unsichtbaren Hand eine vage Metapher der hintergründigen
Koordination, die die Vernunft und den in der Geschichte wirkenden Gott der
Offenbarungsreligion ersetzten soll. „Das Genialische der Metapher von der
unsichtbaren Hand liegt also darin, dass sie die Unmöglichkeit der Vernunft durch deren
Unnötigkeit kompensiert.” Smiths Metapher als säkularistisch zu verstehen, verbietet 119
sich allerdings. Als Deist behält Smith sowohl den Glauben an den perfekten
Schöpfergott (Grand Architect), die göttliche Vorhersehung (Divine Providence) und ein
höheres Wesen (Supreme Being) stets bei. 120
F. Die Kontextualität menschlicher Existenz
!43
Vgl. HABERMAS, JÜRGEN: Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft. in: DERS.: Zwischen 116
Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main 2009.
RECKTENWALD, HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978. S. 662.117
KUCKLICK, CHRISTOPH: Das unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der Negativen Andrologie, Frankfurt am 118
Main 2008. S. 155.
Ebd., S. 157.119
Eine ähnliche Sprache und Überzeugung findet sich bei den founding fathers der Vereinigten Staaten von Amerika. 120
Bei 52 von 56 Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung lassen sich eindeutig deistische Tendenzen nachweisen, selbst wenn sie zum Teil ihr Leben lang die Kirche besucht haben. Weiterführendes zur US-amerikanischen Aufklärung, die maßgeblich von der englischen und schottischen christentumsaffinen Aufklärung beeinflusst war vgl. Kapitel 6 „Liberty and Enlightenment” in: GAUSTAD, EDWIN S.; SCHMIDT, LEIGH: The Religious History of America: The Heart of the American Story from Colonial Times to Today, New York 2004. S. 121 - 138.
Der Denkansatz der relational qualifizierten Rationalität gewinnt weiter an Gestalt durch
die begriffliche Ausarbeitung der Kontextualität von individueller Existenz in
menschlichen Gemeinschaften. Smiths Beispiel der Jäger und Hirten nötigt regelrecht
dazu. Denn auch Smith kann seine mythologische Urszene nicht ohne ursprünglichere
Gemeinschaftsbegriffe gestalten. Er spricht nämlich vom Handel, einer Aktivität also, die
nicht anders als in Gemeinschaft gedacht werden kann. Er spricht ferner vom Tausch,
der ebenfalls in Gemeinschaft, zumindest aber in Beziehung, gedacht werden muss. Des
Weiteren spricht er nicht von dem Jäger und dem Hirten, sondern von den Jägern und den
Hirten. Ganz selbstverständlich spricht Smith also in seiner Erklärung der Arbeitsteilung
im Plural und damit von einem Eigeninteresse in Gemeinschaft. Der wirtschaftliche Akteur
im Beispiel wird zudem als „Mitglied des Stammes” in Gemeinschaft mit „seinen
Gefährten” eingeführt und damit in eine dem Prozess der Vergesellschaftung durch
Arbeitsteilung vorausgehende Gemeinschaft gestellt. 121
Was zeichnet menschliche Existenz in Gemeinschaft aus? Für unsere Überlegungen
erscheinen Michael Welkers Konzeption der Multikontextualität menschlicher Identität
und Interaktion aus seiner Analyse der historischen Jesusforschung als relevant. In einer
Vorbemerkung zu seinem Plädoyer für eine „vierte Frage” nach dem historischen Jesus
beschreibt er das, was er die erschließende Kraft der Multikontextualität nennt:
„Die meisten Menschen bewegen sich relativ mühelos in verschiedenen Umgebungen. Sie
kleiden sich je nach Kontext unterschiedlich, äußern sich je nach Kontext unterschiedlich,
reagieren unterschiedlich.” Unmittelbar deutlich wird die Multikontextualität des
menschlichen Lebens in den starken Kontraste von Disco und Beerdigung, Bolzplatz und
Vorstellungsgespräch, von Stadionfeier und privatem Seelsorgegespräch. Aber auch
weniger offensichtliche Kontextveränderungen prägen unser Leben: fortschreitendes
Lebensalter, Orts- und Arbeitsplatzwechsel zum Beispiel. Wir verändern dabei, so
Welker, nicht nur unser Denken, sondern auch Grundmuster unseres Erinnerns und
Erwartens. Auch von seinen Mitmenschen wird ein Mensch kontextuell unterschiedlich
wahrgenommen. Welker weist zum Beispiel hin auf die Präsenz eines leiblich
abwesenden Menschen, der in der Vorstellung seiner Mitmenschen präsent ist oder durch
Medien wie die Zeitung oder das Fernsehen bekannt ist.
!44
RECKTENWALD, HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978. S.17.121
Was ist nun der Wert multikontextuellen Denkens? „Wenn wir uns selbst, unsere
Mitmenschen, aber auch historische Gestalten multikontextuell wahrzunehmen beginnen,
entwickeln wir ein komplizierteres, aber auch schärferes geistiges Bild der betreffenden
Personen und Situationen. Wohl erwarten wir Kontinuität und Stimmigkeit im Leben und
in der persönlichen Entwicklung unserer Mitmenschen. Wir erwarten oder erhoffen
zumindest Charakter, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit.” Deshalb empfiehlt es sich
gerade dann, wenn unsere Erwartungen enttäuscht oder irritiert werden, biografische
Diskontinuitäten, Identitätskonflikte und Anpassungszwänge in der Lebenswelt des
Anderen zu ergründen. Welker hält fest: „Multikontextuelles Denken schärft oder schult
unser eigenes soziales, kulturel les und historisches Vorstel lungs- und
Wahrnehmungsvermögen.” 122
Was bedeutet das für unser Verständnis des Smithschen Gesamtwerks? Es bedeutet, dass
alle Versuche, die eine menschliche Natur zu beschreiben, sind zum Scheitern oder
Missverständnis verurteilt, solange sie nicht explizit kontextsensibel formuliert werden.
Smith versäumt, das hinreichend deutlich zu machen und provoziert damit, dass seine
Beobachtungen in den verschiedenen Werken als widersprüchlich empfunden werden.
Zudem ist Smith durch das Bedürfnis, elementare Erfahrungen des menschlichen Lebens
in der Natur zu verorten, geprägt und verleitet so dazu, die Sozialisation als Prägefaktor
menschlicher Existenz zu unterschätzen. Daraus zu folgern, Smiths Beobachtung sei
falsch, ist jedoch ein Schnellschuss. Smith zeichnet ein realistisches Portrait menschlicher
Eigenschaften, ohne die lebenspraktischen Widersprüche und ethischen Dilemmata
auszubügeln. Menschen, deren Wohlstand an materiellen Gütern und Beziehung vom
Erfolg des eigenen Wirtschaftens abhängt, werden andere Prioritäten in ihren ethischen
Bewertungen setzen, als solche, deren Existenz durch das Gemeinwesen oder den
eigenen sozialen Hintergrund gesichert ist. Was richtig ist: Smiths Versuch, eine
universale Theorie der moralischen Gefühle kohärent zu entwickeln, ist angesichts der
Kontextualität und Komplexität menschlicher Existenz sehr ambitioniert. Er stellt uns
Lesern und Interpreten, die wir so häufig nach einfachen Lösungen und Antworten
suchen, damit vor eine große Herausforderung. Die Standards akademischen Arbeitens
müssen uns hier Auftrag sein, der Verlockung der Reduktion und dem Verlangen nach
Ordnung zu widerstehen und uns mit Gelassenheit und Ambiguitätstoleranz auf die
mitunter spannungsvolle Bandbreite Smithscher Gedanken einzulassen.
!45
WELKER, MICHAEL: Gottes Offenbarung, Neukirchen 2012. S.83f.122
IV. „Inquiry into the Nature” - Smiths Rhetorik der Natur
A. Der deistische Naturbegriff
So angenehm und wirkmächtig Smiths Werke zu lesen sind, so problematisch wird die
wenig systematische Anordnung seiner Schriften, wenn es um die weniger
offensichtlichen Grundbegriffe seiner Theorie geht. Zwar streut Smith immer wieder
Gedanken zur Wissenschaftstheorie ein, bleibt dabei aber recht vage. Smiths vor- oder
frühmoderner Stil stellt unter den Bedingungen einer Informationsgesellschaft, die auf
den Kern reduzierte und systematisch vorgetragene Theorien mit explizit definiertem
normativem Status dem Impliziten des beschreibenden Narrativs vorzieht, eine weitere
Herausforderung in der Wirkungsgeschichte Smiths dar. Die Gedanken, die heute im
Wissenschaftsbetrieb als explizite Wissenschaftstheorie markiert und systematisiert
ausgeführt werden, sind bei Smith implizit gehalten und über die Breite seines Werks
verteilt. Das gilt besonders für seine Verwendung des Begriffs Natur in seinen 123
verschiedenen Spielarten, so zum Beispiel beim vielzitierten natürlichen Preis und der
natürlichen Neigung zum Tausch im Wealth. Bittermann verweist zum Verständnis des
Smithschen Naturalismus auf die natürliche Theologie seines Lehrers Francis
Hutcheson (1694-1746) und die Ideen des Naturrechts. 124 125
Smith hat die Klassiker der griechischen Literatur der Antike stark rezipiert und ordnet
sich selbst immer wieder in die Tradition der Stoa ein. Deutlich wird das auch an 126
!46
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: I in: Journal of Political Economy, 123
Vol. 48, No. 4. S. 497f. (eigene Übersetzung).
Wie das Namensregister zeigt, zählt Hutcheson zu den meistzitierten Autoren der Theory. So stellt Smith zum 124
Beispiel auf S. 529 die Gedanken von „Dr. Hutcheson” als Referenzpunkt seiner eigenen Überlegungen dar. Smith verweist auf Hutchesons „Essay on the Nature and Conduct of the Passions, with Illustrations upon the Moral Sense”. Inhaltlich nimmt er außerdem Gedanken aus Hutchesons „Philosophiae moralis Institutio compendiaria lib. III Ethices et Jurisprudentiae Naturalis Elementa continens” auf. (vgl. Anm. d. Hrsg. Nr. 149 auf S. 598 in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010.)
Zum Zusammenhang der schottischen Moralphilosophie mit dem christlichen Naturrecht vgl. TROELTSCH, 125
ERNST: Die englischen Moralisten des 17. und 18. Jhds. in: DERS.: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 374. Zur Wirkungsgeschichte der Naturrechtstradition in Theologie und Protestantismus, sowie zur Zentralstellung des Naturrechtsbegriffs im Werk von Ernst Troeltsch vgl. TANNER, KLAUS: Der lange Schatten des Naturrechts. Eine fundamentalethische Untersuchung, Stuttgart 1993.
Für die letzte eigenhändig überarbeitete Auflage der Theory hat Smith, wie er im Vorwort schreibt, im siebten Teil 126
(„Über einige Systeme der Moralphilosophie”) „die Mehrzahl der verschiedenen Stellen, welche die stoische Philosophie betreffen, zusammengestellt, die in den früheren Auflagen über die einzelnen Abteilungen des Werks verstreut waren.” Die stoischen Bezüge ziehen sich also als einer der Hauptfäden durch Smiths Gesamtwerk. Es überrascht deshalb auch nicht, dass das Namensregister der Theory die meisten Referenzen neben Cicero, Aristoteles und Voltaire für Zeno verzeichnet.
seinem Philosophieverständnis: Das aristotelische thaumazein bzw. das platonische
Staunen, die Verwunderung, die Verunsicherung, sie bilden auch für Smith die Grundlage
aller Wissenschaft. Das thaumazein bzw. das Staunen treiben den Philosophen an, das
Unbehagen des Unbekannten durch die Sicherheit der Klärung zu beseitigen. Wenn eine
erklärende Theorie, die das Unbehagen zunächst beseitigt, wiederum zu komplex wird,
verunsichert sie erneut und verliert ihren erklärenden Charakter. Insofern ist plausibel,
dass Smith einen historisch-narrativen Modus für sein wissenschaftliches Schreiben
wählt. Praktische Erklärungsfähigkeit und unmittelbare Plausibilität sind für Smith
essentiell für gute Philosophie bzw. Wissenschaft. Eine Unterscheidung zwischen
empirischen Wissenschaften und Philosophie existiert seinerzeit nicht.
Isaac Newton illustriert als Theologe, Philosoph und empirisch arbeitender
Wissenschaftler (damals genannt Naturphilosoph) die weit verbreitete Personalunion
verschiedener, heute oft als gegensätzlich verstandener Disziplinen. Smith versteht wie
Newton und die Mehrzahl der Denker ihrer Zeit die empirische Beobachtung im
Erkenntnisprozess als komplementär zur vernünftigen Interpretation durch
Vorstellungskraft und nicht gegenläufig zum vernünftigen Räsonieren. Außerdem ist auf
Smiths Betonung der Kontextualität historischer Ereignisse und Entwicklungen
hinzuweisen. Für Smith gehen Theoriebildung und historische Analyse in redlicher
Wissenschaft immer einher. Zu einem vernünftigen Verständnis gegenwärtiger Theorie
und ihrer Probleme kommt man in Smiths Verständnis nur, indem man
moralphilosophische und ökonomische Denksysteme im Kontext ihrer Zeit und
Wirkungsgeschichte untersucht. 127
Weitgehend Konsens ist in der Forschung der Einfluss von Isaac Newton und dessen
Gravitationstheorie, an die Smith sich rhetorisch bei der Entwicklung seiner Theorie des
natürlichen Preises anlehnt. Das wird besonders vor dem Hintergrund von Smiths History
of Astronomy deutlich. Darin schreibt er Sir Isaac Newton die größte und
bemerkenswerteste Verbesserung, die jemals in der Philosophie erreicht wurde, zu. 128
!47
Ein einfacher Blick in den inhaltlichen Aufbau der Theorie der moralischen Gefühle zeigt Smiths Fokus auf 127
historische Analyse. Im siebten Teil seiner Theory analysiert er mit Akribie das, was vor ihm auf dem Feld der Moralphilosophie gedacht wurde. Für eine übersichtliche Zusammenfassung der Smithschen Methodik und Wissenschaftstheorie vgl. WALLACHER, JOHANNES: Die bleibende Bedeutung der Politischen Ökonomie Adam Smiths. in: HOCHGESCHWENDNER, MICHAEL; LÖFFLER, BERNHARD (HRSG.): Religion, Moral und liberaler Markt. Politische Ökonomie und Ethikdebatten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 93-95.
WIGHTMAN, W.P.D.; BRYCE, J.C.; ROSS, I.S. (HRSG.): Adam Smith. Essays on Philosophical Subjects (Glasgow 128
Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 3), Oxford 1980. S. 98.
Smiths begeisterte Zeilen über Newton zeigen, dass der Einfluss der
gravitationstheoretischen Prinzipien auf Smiths ökonomische Theorie existent gewesen
ist. Wie groß er gewesen ist, bleibt umstritten. Bittermann meint, Smiths Vorgehen sei
eine direkte Anwendung der Techniken des Newtonschen Experimentialismus auf
Fragen der Moral.” Experimente waren durch die Natur der behandelten Materie
ausgeschlossen, aber: „Analyse, Kritik und Formulierung von Schlussfolgerungen war
empirischer Art.” 129
Unterstützt wird diese Interpretation durch Smiths Aussagen zu Isaac Newton und einem
Blick auf Smiths Umfeld. So war er gut bekannt mit Joseph Black (1728-1799), dem
schottischen Physiker und Chemiker, der als einer der Mitbegründer der chemischen
Industrie und unter anderem als Entdecker des Kohlenstoffdioxids gilt. Zu Smiths
Bekanntenkreis zählte außerdem der schottische Erfinder James Watt (1736-1819), der
durch seine entscheidende Weiterentwicklung der Dampfmaschine als deren Erfinder gilt.
Ausführliche Beachtung findet bei Smith aber weder die Industrialisierung, noch deren
naturwissenschaftlich-technische Grundlagen und auch allgemeine naturwissenschaftliche
Bezüge finden sich in seinen Hauptwerken nur wenige. Smith scheint also vor allem an
der ph i losoph i schen In te rpre ta t ion und rhe tor i schen Adapt ion der
naturwissenschaftlichen Arbeiten seiner Zeit gelegen gewesen zu sein. Auch wenn das bei
Smith selbst gelegentlich so anklingt und von Henry Bittermann auch entsprechend 130
interpretiert wird: Smith übernimmt keineswegs direkt deren Methodik.
Im Verlauf seiner Geschichte der Astronomie preist Smith Newtons Methode in den
höchsten Tönen: „His system, however, now prevails over all opposition, and has
advanced to the acquisition of the most universal empire that was ever established in
philosophy. His principles, it must be acknowledged, have a degree of firmness and
solidity that we should in vain look for in any other system. The most sceptical cannot
avoid feeling this.”
Nach all den preisenden Tönen im Text nimmt Smith in den letzten Zeilen seiner
Geschichte der Astronomie aber demjenigen, der an die absolute Gültigkeit und
erkenntnistheoretische Perfektion der Newtonschen Prinzipien glaubt, jede Illusion,
indem er alle ausgedrückte Euphorie radikal relativiert: „Sogar wir, die wir angetreten
!48
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: I in: Journal of Political Economy, 129
Vol. 48, No. 4. S. 504, (eigene Übersetzung).
Vgl. ebd.130
sind, alle philosophischen Systeme zu verstehen als bloße Erfindungen der
Vorstellungskraft, mithilfe derer sonst zusammenhangslose und unvereinbare Phänomene
der Natur verknüpft werden können, sind wie von Sinnen dazu verführt worden, eine
Sprache zu verwenden, die die verknüpfenden Prinzipien ausdrückt als seien sie echte
Ketten, mit denen die Natur die ihr eigenen Operationen verbindet.” Smith endet die
Passage mit einer als kryptischer Aussagesatz formulierten Frage: „Can we wonder then,
that it should have gained the general and complete approbation of mankind, and that it
should now be considered, not as an attempt to connect in the imagination the
phaenomena of the Heavens, but as the greatest discovery that ever was made by man,
the discovery of an immense chain of the most important and sublime truths, all closely
connected together, by one capital fact, of the reality of which we have daily
experience.” 131
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) wird später genau diese Frage in seinem Tractatus wie
folgt kommentieren: „Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung
zugrunde, daß die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen
seien.” Dadurch blieben sie bei den Naturgesetzen als etwas Unantastbaren stehen, wie
die Älteren bei Gott und dem Schicksal. „Und sie haben ja beide Recht, und Unrecht. Die
Alten sind allerdings insofern klarer, als sie einen klaren Abschluss anerkennen, während
es bei dem neuen System scheinen soll, als sei alles erklärt.” Adam Smith wiederum 132
weist sowohl Spuren der vormodernen als auch der modernen Weltanschauung auf. So ist
bei ihm als Deisten, oder zumindest als mit dem Deismus sympathisierenden
vernunftreligiösen Protestanten zwar überall ein Gottesbild im Hintergrund der Theorie.
Allerdings ist es nicht - zumindest nicht in letzter Konsequenz - der in der Geschichte
wirkende Gott einer Offenbarungsreligion. 133
Für Smith scheint es sich an vielen Stellen seines Werks mit der Welt tatsächlich so wie in
Wittgensteins Beschreibung zu verhalten. Der Uhrmachergott des Deismus, der die Welt
mit perfekten Naturgesetzen geschaffen hat, greift eben nicht ein in die Gesetze der Welt.
Es bleibt keinerlei Raum für das Übernatürliche, oder vielmehr macht Smith überhaupt
!49
WIGHTMAN, W.P.D.; BRYCE, J.C.; ROSS, I.S. (HRSG.): Adam Smith. Essays on Philosophical Subjects (Glasgow 131
Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 3), Oxford 1980. S. 105.
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus Logico-philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt am 132
Main 2003. S. 106.
Vgl. TROELTSCH, ERNST: Der Deismus. in: DERS.: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur 133
Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 429 - 487.
erst eine Trennung zwischen der immanent-weltlichen Natürlichkeit und der
transzendent-göttlichen Übernatürlichkeit auf. Ernst Troeltsch sieht im Deismus den
Versuch, eine „allgemeine, überall gleiche, jedermann erkennbare religiöse
Normalwahrheit zu suchen, auf die man von den konkurrierenden einzelnen Religionen
zurückgehen kann, von der aus Wert und Recht der unmittelbar sich gebenden
Offenbarungsansprüche sich prüfen läßt, und die mit den metaphysischen Ergebnissen
der neuen Wissenschaften übereinstimmt.” Das hat Konsequenzen für die Bedeutung des
Naturbegriffs: Es ist dieselbe Bedeutung, die das Wort bereits in der bisherigen Theologie
hatte, nur mit immer geringer werdender Nebenwirkung des Gegensatzes
‘übernatürlich’. 134
Insofern ist präziser zu sagen: Es bleibt kein Raum mehr für das Unerklärliche. In
Wittgensteins Worten: Die moderne Weltanschauung strebt nach einem System, das alles
erklärt. Wittgenstein möchte diese Sicherheit brechen, wenn er lakonisch feststellt: „Daß
die Sonne morgen aufgehen wird, ist eine Hypothese; und das heißt: Wir wissen nicht, ob
sie aufgehen wird. Einen Zwang, nach dem Eines geschehen müßte, weil etwas anderes
geschehen ist, gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Notwendigkeit.” Wittgensteins 135
Kritik an der modernen Weltanschauung trifft im Kern auch den Deismus Adam Smiths.
B. Der natürliche Preis und die Gravitationsmetapher
Im Folgenden werden wir einige Stellen untersuchen, in denen der Einfluss Newtons auf
Adam Smith konkret wird. Entscheidend ist hier die Gravitationsmetapher, mit der Smith
einen Marktpreis und einen natürlichen Preis aufeinander bezieht. Den natürlichen Preis
führt Smith im siebten Kapitel des Wealth ein. In jeder Gesellschaft gibt es zu jedem
Zeitpunkt einen üblichen Wert für die Arbeitslöhne, Kapitalgewinne und Bodenrenten in
der Herstellung eines Guts. Diese üblichen Werte, die Durchschnittswerte also,
bezeichnet Smith als natürliche Arbeitslöhne, Kapitalgewinne und Bodenrenten. Von
einem natürlichen Preis spricht Smith, wenn der Preis eines Guts sich genau aus den
natürlichen Sätzen von Bodenrente, Kapitalgewinn und Arbeitslohn zusammensetzt. Der
natürliche Preis ist also eine abhängige Variable.
!50
TROELTSCH, ERNST: Der Deismus. in: DERS.: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte 134
und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 431.
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus Logico-philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt am 135
Main 2003. S. 106.
Dem natürlichen Preis gegenüber steht der Marktpreis. Er bezeichnet den individuellen
Handelswert einer Ware zu einem gegebenen Zeitpunkt und wird durch Angebot und
Nachfrage bestimmt. Wie der natürliche Preis ist auch der Marktpreis eine abhängige
Variable, diesmal allerdings nicht abhängig von den üblichen Sätzen von Lohn, Rente und
Gewinn, sondern vom Verhältnis der verfügbaren zur nachgefragten Gütermenge. Bei
Smith ist der direkte Zusammenhang von Angebot und Nachfrage noch nicht wie später
bei Ricardo und anderen in letzter Konsequenz beschrieben. Neu an Smiths
Ausführungen ist die Formulierung eines jeder ökonomischen Transaktion zugrunde
liegenden Prinzips, das über die bloße Beschreibung der Wirklichkeit hinausgeht.
Insofern kann hier von einer Modellentwicklung gesprochen werden.
Die Größe des Gefälles zwischen Marktpreis und natürlichem Preis hängt einerseits von
Überschuss bzw. Mangel eines Produkts auf dem Markt und andererseits von
spezifischen Überlegungen der Handelspartner ab. Wenn beispielsweise ein Verkäufer
sein Produkt besonders schnell loswerden will oder ein Käufer besonders schnell an ein
Produkt kommen möchte, wird der Marktpreis ungewöhnlich niedrig bzw. ungewöhnlich
hoch angesiedelt sein. Prinzipiell geht Smith aber davon aus, dass sich der Marktpreis mit
der Zeit dem natürlichen Preis anpasst, wenn das Angebot die Nachfrage deckt. Die
Marktpreise gravitieren also gewissermaßen um den natürlichen Preis. Hier wird
üblicherweise der Einfluss Newtonscher Rhetorik gesehen: „The natural price, therefore,
is, as it were, the central price, to which the prices of all commodities are continually
gravitating. [..] But whatever may be the obstacles which hinder them from settling in this
center of repose and continuance, they are constantly tending towards it.” 136
Wenn der individuell ausgehandelte Marktpreis dem natürlichen Preis zu jeder Zeit
entspräche, so bestünde für Smith wohl durchaus die Möglichkeit ein geschlossenes
System wie die Gravitationslehre auf die Preisbildung am Markt direkt und absolut zu
übertragen. Ein Marktpreis, der immer wieder neu durch Angebot und Nachfrage
bestimmt wird, entspricht jedoch nur selten genau dem natürlichen Preis. Es stellt sich
zudem das Problem der Messbarkeit und fixen Benennung des natürlichen Preises, da
auch er als abhängige Variable im Laufe der Zeit großen Schwankungen unterliegt. Smith
versteht den natürlichen Preis also keineswegs als Fixstern in einem Sonnensystem mit
den Marktpreisen als Planeten, vielmehr oszillieren die Marktpreise in einem durch die
!51
WAKEFIELD, EDWARD GIBBON (HRSG.): Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 136
Nations, London 1843. S. 24.
(schwankenden) üblichen oder durchschnittlichen Preise konstituierten Rahmen. Der
natürliche Preis ist folglich eine reflexive, die Wirklichkeit interpretierende Größe, die als
eine Art volatile Leitplanke für die Marktpreise verstanden werden kann. Von einem
Fixstern mit absolutem oder vorhersagenden Charakter kann trotz der Verwendung der
Gravitationsmetaphorik bei Smith also nicht gesprochen werden.
Da der natürliche Preis der übliche oder durchschnittliche Preis ist, kann von einer
wechselseitigen Einflussnahme von Markt- und natürlichem Preis gesprochen werden.
Und wie oben beschrieben kann der konkrete Marktpreis durch die Umstände einer
spezifischen Tauschhandlung die Leitplanken des natürlichen Preises mitunter weit nach
außen schieben: „But though the market price of every particular commodity is in this
manner continually gravitating, if one may say so, towards the natural price; yet
sometimes particular accidents, sometimes natural causes and sometimes particular
regulations of police, may, in many commodities, keep up the market price, for a long
time together, a good deal above the natural price.” 137
Leonidas Montes weist in dieser Passage auf ein wichtiges Detail hin: Smith fügt nämlich
ein einschränkendes „if one may say so” an, wenn er von Gravitation spricht. Montes
wertet das als Hinweis, dass Smith daran gelegen war, den metaphorischen Charakter der
Figur zu bewahren und zu markieren, dass es sich bei der Gravitation um ein hilfreiches
Bild handelt, das aus einem gänzlich anderen Kontext im Bewusstsein aller Unterschiede
zur Bebilderung der Idee herangezogen wird. Doch es gibt eben auch klare Unterschiede
zu Newtons Gravitationstheorie: Für Newton sind Aktion und Reaktion immer
gleichwertig, es gibt also nicht den einen prägenden Körper, der hegemonial auf alle
anderen wirkt. Körper gravitieren auch nicht nur in Richtung eines einzigen Epizentrums
hin. Sollte die Illustration der Preisbildung im Wealth also tatsächlich mit den
Grundgedanken der Newtonschen Gravitationstheorie identisch sein, müssten in Smiths
Theorie alle Preise zueinander in Gravitationsbeziehungen stehen, der natürliche Preis also
ebenso zu den Marktpreisen wie andersherum die Marktpreise auf den natürlichen Preis
hin. 138
Bernard Cohen argumentiert, dass Smith die Newtonsche Theorie zu einem gewissen
Grad „vollkommen korrekt” auf den Preismechanismus angewandt hat. Sie sei lediglich
!52
Ebd., S. 25.137
Vgl. MONTES, LEONIDAS: Adam Smith: real Newtonian. in: DOW, ALEXANDER; DOW, SHEILA (HRSG.): A 138
History of Scottish Economic Thought, Oxon 2006. S. 110.
unvollständig gewesen. Als Experte für Newtons Werk hat Cohen sicher ein gutes 139
Gespür für den Einfluss Newtons auf Smith. Ob aber der Begriff Preismechanismus
hier angebracht ist, sollte in Zweifel gezogen werden. Von der direkten Übernahme einer
physikalischen Theorie kann bei Smith keine Rede sein. Physikalische Modelle nutzen die
Mathematik als Theoriemodus, einen mathematischen Weg geht Smith aber gerade nicht.
Er illustriert mit der Gravitationsmetapher von Markt- und natürlichem Preis eine
Schwankung. Eine gewisse Gleichmäßigkeit des Kreisens der Marktpreise um den
natürlichen Preis ist vielleicht angelegt, aber bei Smith nicht programmatisch formuliert.
Die Neoklassik setzt ein Gleichgewichtsmodell voraus und trägt dieses System
nachträglich bei Smith ein. Sie suggeriert einen stabilen Gleichgewichtspreis, der zu
berechnen und vorherzusagen ist. Mit der Gravitationsmetapher bei Smith hat das nichts
mehr zu tun. Ähnliches gilt im Übrigen für die vielzitierte Metapher der unsichtbaren
Hand, die von einer typischerweise religiösen Metapher für die göttlich grundgelegte
Moral im Menschen zur Zeit Smiths einen bemerkenswerten Bedeutungswandel hin zu
einer numinosen Marktkraft, die perfekten, konstanten Naturgesetzen folgend die
wirtschaftliche Interaktion der Menschen ordnet. Smiths Gottheit bzw. die göttlich 140
grundgelegte Moral wurden im Laufe der Zeit durch eine Effizienzmarkt- und
Gleichgewichtshypothese ersetzt. 141
Aristoteles geht in seiner Preistheorie völlig andere Wege. Den natürlichen Preis versteht
Aristoteles als festgesetzten Preis. Preisschwankungen sind in seinem Verständnis
widernatürlich. Die festgesetzten Preise dienen nach Aristoteles der Sicherung des
natürlichen Handelns, denn: Der ausgehandelte Preis könnte einer der beteiligten
Parteien auf Kosten der anderen einen Profit einbringen und damit den Zusammenhang
der Gemeinschaft untergraben, statt ihn zu festigen. Dem modernen Marktdenken 142
läuft das zuwider. Der Markt ist bei Aristoteles kein Instrument des Handels, die
Preisbildung keine Funktion des Marktes, sondern lediglich die Plattform für die
!53
Zitiert nach: ebd.139
Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Motiv der unsichtbaren Hand vgl. SMITH, CRAIG: Adam 140
Smith’s Political Philosophy. The Invisible Hand and Spontaneous Order, London/New York 2006.
Vgl. LUTERBACHER-MAINERI, CLAUDIUS: Adam Smith - theologische Grundannahmen: eine textkritische Studie, 141
Fribourg 2008.
POLANYI, KARL: Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der 142
Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 298f.
Widerherstellung der natürlichen Selbstgenügsamkeit der barbarischen Naturvölker. Aristoteles 143
versteht Märkte und Handel als getrennte Institutionen und Preise als Ergebnis von
Brauch, Gesetz oder Proklamation. Gewinnbringender Handel ist für ihn unnatürlich,
festgesetzte Preise natürlich. Den natürliche Preis versteht Aristoteles nicht als eine
unpersönliche Bewertung der Tauschgüter, sondern als Ergebnis der wechselseitigen
Einschätzung des Status der Tauschenden. 144
C. Das System der natürlichen Freiheit
Wie unsere Untersuchung des natürlichen Preises bei Smith zeigt, ist Vorsicht bei der
Untersuchung seiner Rhetorik geboten. Die nachträglichen Eintragungen durch
Ökonomen, die ihre eigene Theorie mit der Autorität des Gründervaters der Disziplin zu
legitimieren oder aufzuwerten versucht haben, sind immens. Um die Geschichte des
Naturbegriffs bei Smith zu verstehen, lohnt es, zunächst die gängige Verwendung des
Naturbegriffs im 18. Jahrhundert zu untersuchen. Dazu schreibt Bittermann: „Sometimes
the word referred to the totality of phenomena or some particular aspect thereof, the
natura naturata of the later scholastics. At other times it implied the ‘action of
Providence’, ‘the principle of all things’, or the activity of God as natura naturans.” 145
Beide Varianten finden sich bei Adam Smith. Naturally meint in vielen Fällen, so
Bittermann, „spontan”, „normalerweise”, „offensichtlich”, „ohne bewusste Absicht”
oder „instinktiv” und ist somit nah am modernen Sprachgebrauch. In anderen Fällen
aber ist genauer hinzusehen. So findet sich bei Smith mit seiner deistischen Überzeugung
von der göttlich grundgelegten Moral im Menschen eine Art „natürlicher Verlauf aller
Dinge” angelegt, und das auch in ökonomischer Hinsicht: „a ‘natural order of things’
determining capital investment, that is, the desire of the capitalist to obtain a high rate of
return and at the same time to be able to watch his investment. The rate of profit tends
to be ‘naturally low in rich, and high in poor countries.’” In diesen Fällen ist die 146
Verwendung von natural letztlich kongruent mit „als Ergebnis der ökonomischen und
!54
Ebd. S. 299.143
Ebd.144
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: II in: Journal of Political Economy, 145
Vol. 48, No. 5. S. 703.
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: II in: Journal of Political Economy, 146
Vol. 48, No. 5. S. 704.
politischen Umstände”, da in diesen Fällen ein direktes Argument zur Erklärung eines
Phänomens vorgebracht wird.
In wiederum anderen Fällen, so zeigt Bittermann, ist natural verknüpft mit liberty und der
Freiheit von Regulierung: „Natural price is a competitive price equal to the costs of
production when the factors are remunerated at their ‘natural rates’, which are the
‘ordinary or average rates’ determined by free competition. [...] While monopoly and
‘police’ might be regarded as violations of natural liberty, ‘natural causes’ could scarcely
be regarded as conflicting with the laws of nature.” Bittermann kommt zu dem 147
Ergebnis, laisser faire sei ein System der natürlichen Freiheit. Während Bittermann 148
sicher recht hat, wenn er laisser faire als ein „System der natürlichen Freiheit” bezeichnet,
ist die Verknüpfung zu Smiths Denken problematisch. Samuel Fleischacker spricht in
seiner Monographie zu Freiheit und Urteilskraft bei Smith und Kant von einem „dritten
Konzept der Freiheit”. Dieses dritte Konzept ist mit laisser faire keineswegs 149
gleichzusetzen. Zu diesem Ergebnis kommt auch Johannes Wallacher und beruft sich
dabei auf Smiths Rechtsverständnis: „Die Bedeutung, die Smith den mit staatlicher
Zwangsgewalt durchsetzbaren Gesetzen zur Kontrolle des Eigeninteresses beimisst,
verweist bereits darauf, dass man Smith wohl kaum als Vorreiter eines „Laissez-faire”-
Kapitalismus ansehen kann.” 150
Adam Smith definiert seine Grundbegriffe nicht immer präzise. Daher ist Wachsamkeit
angebracht, denn die intuitive Plausibilität seiner Argumente und der erzählerische Stil
verführen dazu, in der kritischen Betrachtung der Grundbegriffe nachlässig zu werden.
Auch wenn Smith streckenweise suggeriert, dass das, was er und von ihm geschätzte
Autoren wie Isaac Newton zu Papier gebracht haben, die objektive Beschreibung der
„Natur der Sache” und all der daraus auf ganz „natürliche” Art und Weise abgeleiteten
Prinzipien ist, muss - - ganz im Sinne Smiths - betont werden, dass jede Theorie auf
Grundannahmen ohne Letztbegründung beruht. Michael Schmidt-Salomon nennt dies
!55
Ebd.147
Ebd. (eigene Übersetzung).148
Vgl. FLEISCHACKER, SAMUEL: A third concept of liberty. Judgement and freedom in Kant and Adam Smith, 149
Princeton 1999. Vgl. auch: FLEISCHACKER, SAMUEL: Philosophy in Moral Practice: Kant and Adam Smith. in: Kant-Studien, Jg. 82, Nr. 3, Berlin 1991. S. 249-269.
WALLACHER, JOHANNES: Die bleibende Bedeutung der Politischen Ökonomie Adam Smiths. in: 150
HOCHGESCHWENDNER, MICHAEL; LÖFFLER, BERNHARD (HRSG.): Religion, Moral und liberaler Markt. Politische Ökonomie und Ethikdebatten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 103f.
unter Rückgriff auf Hans Albert das Münchhausen-Trilemma und beschreibt drei
mögliche Verfahren: den infiniten Regress (kontinuierliches Weiterfragen ohne je zu einer
Letztbegründung vorzudringen), den logischen Zirkel (ein kreisendes Argumentieren mit
Begründung der Begründung durch sich selbst) und den Abbruch des Verfahrens (ein
gesetztes Dogma, das nicht begründet wird, von dem aus die Theorie aufgebaut werden
kann). Kurt Gödel stieß mit mathematischer Methode in eine ähnliche Richtung vor, 151
als er seine Unvollständigkeitssätze formulierte. Der erste Unvollständigkeitssatz zeigt, 152
dass es in hinreichend komplexen widerspruchsfreien Systemen immer unbeweisbare
Aussagen (Axiome) gibt. Der zweite Unvollständigkeitssatz zeigt, dass hinreichend
komplexe widerspruchsfreie Systeme ihre eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen
können. Sowohl Schmidt-Salomons, als auch Gödels Überlegungen lehren uns in Bezug
auf die suggerierte Selbstverständlichkeit des Naturbegriffs bei Smith Vorsicht walten zu
lassen.
D. Vergesellschaftung durch Kommerzialisierung
Ein den Wealth durchziehendes Postulat Smiths ist, dass die Kommerzialisierung
Vergesellschaftung gewirkt hat. Diese These ist eng verknüpft mit seiner Geldtheorie. Vor
allem die Entwicklung des Münzgeldes sieht er als Treiber der Vergesellschaftung an.
Dem zugrunde liegt ein weiteres Postulat, nämlich, dass vor der Handelswirtschaft eine
Naturalwirtschaft in Gemeinschaften vorgelegen hat. Der Anthropologe David Graeber
zeigt, wie absurd diese Annahme ist. Auch ein Blick in den biblischen Kanon hätte 153 154
dem Protestanten Smith vor Augen gestellt, dass schon zu Zeiten des Alten Testaments
!56
SCHMIDT-SALOMON, MICHAEL: Das „Münchhausentrilemma" oder: Ist es möglich, sich am eigenen Schopfe aus 151
dem Sumpf zu ziehen? in: Aufklärung und Kritik, Sonderheft 5 (2001).
Eine Einführung in die Bedeutung der Gödelschen Unvollständigkeitssätze findet sich in: VON RAUCHHAUPT, 152
ULF: Kurt Gödel. Der Herr Professor und die Wahrheit. in: Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 23. April 2006.
Vgl. Kapitel 2 „Der Mythos vom Tauschhandel” in: GRAEBER, DAVID: Schulden. Die ersten 5000 Jahre, 153
München 2014.
Man bedenke: Smith liest die Bibel vermutlich noch nicht historisch-kritisch, zumindest nicht in der Form, wie es 154
heute in der akademischen Theologie üblich ist. Obwohl die einschlägige Entwicklung schon im 18. Jahrhundert einsetzt, erfolgt die Vervollständigung des historisch-kritischen Methodenapparats erst im 19. Jahrhundert.
Schuldenwirtschaft betrieben wurde. Schuldverschreibungen gab es in jedem Fall vor 155
der institutionellen Münzprägung, das zeigt auch die Rede vom Schuldenerlassjahr im
biblischen Israel. 156
Vor der Entwicklung monetärer Handelswirtschaften war also nicht, wie Smith
unterstellt, die währungslose Naturalwirtschaft vorherrschend. Im Gegenteil, die
gemeinschaftlichen Strukturen waren vermutlich der monetären Gesellschaft recht
ähnlich, die Währung war lediglich eine andere. Nicht ein quantifizierbarer Geldbetrag,
sondern die Deckung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Annahme, Zuneigung und
Schutz waren die Entlohnung für die adäquate Beteiligung an der Wohlfahrt der
Gemeinschaft. Insofern kann eher von einer kommunitären Handelsgesellschaft mit
nichtmonetärer Währung gesprochen werden als von einer Gemeinschaft mit
Naturalwirtschaft. Beispiele für solche Gesellschaften sind diverse Nomadenkulturen, 157
die großfamiliäre Stammeskulturen des Alten Testaments, sowie die ersten 158
christusgläubigen Juden in der Zeit unmittelbar nach dem Kreuzesgeschehen, dann 159
allerdings schon unter Bedingungen der von der römischen Besatzungsmacht
eingeführten monetären Handelsgesellschaft. Smith nutzt also eine rhetorische
Erfindung, nämlich die naturaltauschende Wirtschaftsgemeinschaft, um seine Theorie der
!57
Interessant ist im Vergleich der sechs Originalauflagen der Theory die Frage nach den religiösen Überzeugungen 155
Adam Smiths. Vor dem Hintergrund der reduzierten Rezeption heutiger Tage überrascht der dezidiert christliche Bezug Smiths, den er mit leicht ironischem Ton in einem Brief über die Gestattung von Veränderungen am Manuskript vom 4. April 1760 an seinen Verleger ausdrückt: „Ich glaube gerne, dass Sie weit unfehlbarer sind als der Papst, aber da ich Protestant bin, erlaubt es mir mein Gewissen nicht, mich einer anderen Autorität zu unterwerfen als der (heiligen) Schrift.” Zitiert nach: Smith, Adam: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. XXV.
Vgl. Leviticus 25,8-55. Die Tora schreibt hier den Israeliten für jedes 50. Jahr einen vollständigen Schuldenerlass 156
für ihre Untergebenen, eine grundlegende Bodenreform und die Aufhebung der Schuldsklaverei vor. Eingebürgert hat sich hierfür der Begriff Erlass- oder Jubeljahr. In den letzten Jahrzehnten diente dieses biblische Motiv u.a. als Vorbild für politische Forderungen nach Schuldenschnitten für hochverschuldete Entwicklungsländer.
Beispiele dafür sind die skythischen Reitervölker im 7. und 8. Jahrhundert v. Chr. in den eurasischen Steppen auf 157
dem Gebiet der heutigen Ukraine und Südrussland. (vgl. FORBIGER, ALBERT: Handbuch der alten Geographie, Leipzig 1842. S. 287.)
Vgl. Abraham in Genesis 11-25, vgl. auch Jakob in Genesis 25-49 und in Koran 3:84, 4:163, 38:45-47.158
Vgl. Acta 2,43-45 und Acta 4,32-37: „Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte 159
etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. [...] Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.”
Vergesellschaftung zu plausibilisieren. Vom Story Bias verleitet haben Smith 160
nachfolgende Rezipienten diese Idee weit verbreitet, ohne sie einer angemessenen
Prüfung zu unterziehen. Bei genauem Hinsehen wird deutlich: Smith formuliert in einer
intuitiv verständlichen, mit fantasiestimulierenden Beispielen gespickte Sprache mit seiner
Gesellschaftstheorie einen Mythos.
Auch hier geht Smith andere Wege als Aristoteles. Der nämlich betont in seiner Politik die
Widerherstellung der natürlichen Selbstgenügsamkeit als Zweck allen Tauschens, nicht die
profitorientierte Erwerbstätigkeit, wobei auch Aristoteles von einer Form des
Naturaltauschs ausgeht. In der Schlüsselpassage über den Ursprung des Tausches (allagé)
gibt Aristoteles eine Beschreibung der grundlegenden Institution der archaischen
Gesellschaft: den Austausch von Gleichwertigkeiten. Manche barbarischen
Völkerschaften betrieben immer noch diese Art von Naturaltausch, schreibt Aristoteles
dort, „denn solche Völkerschaften tauschen nur das untereinander aus, was sie brauchen,
aber nicht mehr, indem sie zum Beispiel Wein hergeben und dafür Getreide in Empfang
nehmen, und ebenso bei allen anderen Gütern. Ein solcher Tauschhandel ist weder gegen
die Natur, noch ist er eine Art des Gelderwerbs, denn er dient ja nur der
Wiederherstellung der natürlichen Selbstgenügsamkeit.” Smith hat gänzlich andere 161
Vorstellungen, sowohl von der Motivation zum Tausch, als auch dem, was natürlich
genannt werden kann.
V. Erkenntnistheoretische Grundlagen
A. Grundgedanken des angelsächsischen Empirismus
Adam Smith orientiert seine Moralphilosophie an den Werken der Empiristen
Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und Hume. Bei aller Kritik an den Zeitgenossen 162
und den bewusst anders gesetzten Akzenten, kann von einer deutlichen Prägung Smiths
!58
Mit dem Begriff Story Bias bezeichnet die Psychologie das menschliche Bedürfnis nach Sinn und Identität, die ein 160
Individuum oder eine Gruppe durch einen fortlaufenden Sinnzusammenhang konstruiert. Dort, wo dies nicht nach wissenschaftlichen Kriterien geschieht oder der Mensch an epistemische Grenzen stößt, ist er versucht, durch Mythen erzählerisch Sinn zu stiften. Rolf Dobelli zeigt auf, dass die mythische Tendenz auch vor Wissenschaftlern und um möglichst redliche Methodik bemühten Menschen nicht Halt macht. (vgl. DOBELLI, ROLF: Die Kunst des klaren Denkens, München 2011. S. 53-55.)
ARISTOTELES: Politik, 1257a 24-31. Zitiert nach: POLANYI, KARL: Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: 161
HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 299f.
Für einen Überblick über die angelsächsische Moralphilosophie vgl. TROELTSCH, ERNST: Die englischen 162
Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts. in: DERS.: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 374-394.
durch den Empirismus gesprochen werden. Empirismus (lat. empiricus = der Erfahrung
folgend) ist diejenige philosophische Strömung, die die gerechtfertigte, wahre Erkenntnis
in der Sinneserfahrung und der experimentellen Beobachtung begründet sieht. Der
Empirismus wird oft als Gegenentwurf zum Rationalismus gesehen, welcher die
Erkenntnis aus reinem Denken ohne vorausgehende äußere Sinneswahrnehmung als
legitime oder sogar ausschließliche Quelle des Wissens versteht. Allerdings soll die
Verarbeitung dieser Sinneswahrnehmung auch im Empirismus nach rationalen Kriterien
erfolgen.
John Locke (1632-1704) beispielsweise befürwortet die Wende zur rationalen Theologie
und zur neuzeitlichen Philosophie, wehrt sich aber gegen die erkenntnistheoretischen
Fundierungen der Wissenschaft in der Ratio und betont die Erfahrung als ursprüngliche
Quelle der Erkenntnis. Seine empiristische Erkenntnistheorie betont die Trennung von
interner und externer Welt. Locke unterscheidet entsprechend äußere Wahrnehmungen
(sensations) und innere Wahrnehmungen (reflections). Locke leiht sich die empiristische
Grundthese von Thomas von Aquin: Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensibus.
(„Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre“). Thomas von 163
Aquin (1225-1274) versteht den menschlichen Intellekt als Seele, die ihrem Wesen nach
Form des Leibes ist. Wir nehmen Gegenstände in der Welt nicht nur in ihren sinnlichen
Gegebenheiten sowie ihren allgemeinen und individuellen Wesenszügen wahr, sondern
zugleich als Seiende. Es besteht also zwischen dem Allerbekanntesten, dem Sein, und
dem sinnlich Gegebenen ein Verhältnis des Einschlusses: Am Sinnlichen entfaltet sich
das Seinsverständnis, es geht aber nicht darin auf. Das Sinnliche ist bereits im ersten
Anheben menschlicher Wahrnehmung als Seiendes anwesend. 164
Henry Bittermann verweist zudem auf den Einfluss David Humes und erkennt den
rationalismuskritischen Einschlag Humes auch in Smiths Werken wieder: „In his strictly
empirical epistemology reason consisted merely in the comparison of ideas, the copies of
sense impressions; it could note relations among the data of experience; it could
!59
Diese Denkfigur war auch zu Zeiten Thomas von Aquins nicht neu. Sie findet sich schon in der aristotelischen 163
Schule und bei Cicero.
SCHERER, GEORG: Sinn und Sein bei Thomas von Aquin in Wirklichkeit und Sinnerfahrung. in: HÜNTELMANN, 164
RAFAEL (Hrsg.): Grundfragen der Philosophie im 20. Jahrhundert, Herford 1998.
determine the probable consequences of action; but it could not oppose the passions or
direct the will.” 165
David Humes (1711-1776) Grundanliegen war, wie Bittermann richtig beschreibt, eine
strikt empirische Erkenntnistheorie. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die empirische
Untersuchungsmethode in die Wissenschaft vom Menschen einzuführen, und vertritt im
Hinblick auf die menschlichen Erkenntnismöglichkeiteneine gemäßigte Skepsis. Auch 166
Immanuel Kant zeigte sich beeindruckt von Humes Überlegungen zu den
Bewusstseinsinhalten (perceptions) als unmittelbaren Gegenständen unserer Erfahrung,
wobei er Eindrücke (impressions) und Vorstellungen (ideas) unterschied. Hume habe ihn
aus seinem „dogmatischen Schlummer” erweckt, so Kant. Wie in Smiths Theory 167
bekommt auch bei Hume die Einbildungskraft (imagination) einen besonderen Stellenwert,
da wir mit ihrer Hilfe dem Gesetz der Assoziation folgend in der Lage sind, aus
„einfachen Vorstellungen komplexe Vorstellungen zu bilden, die so nicht einem
unmittelbaren Eindruck entspringen.” Entscheidende Prägung erfuhr Adam Smith 168
auch durch David Humes Verständnis von Moralphilosophie. Als ihre Aufgabe 169
versteht Hume die beobachtbaren, existierenden moralischen Wertungen von Menschen
ohne spekulative Voraussetzungen auf der Basis empirischer Methodik zu erklären. „In
der Moral spielen Vernunft und Gefühl eine Rolle, jedoch ist das moralische Empfinden
(moral sentiment) grundlegender.” 170
B. Moderne Wirkungsgeschichte des Empirismus
Geprägt von schottischer Aufklärung und Moral-Sense-Philosophie geht nun Adam
Smith grundlegend andere Wege als der Logische Empirismus des 20. Jahrhunderts, der
lehrt, Sätze seien nur sinnvoll, wenn sich ihr Inhalt empirisch prüfen lasse bzw. wenn sich
angeben lässt, wie er zu prüfen wäre. So schreibt der Philosoph Rudolf Carnap
!60
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: I in: Journal of Political Economy, 165
Vol. 48, No. 4. S. 494.
PFLEIDERER, EDMUND: Empirismus und Skepsis in David Humes Philosophie als abschließende Zersetzung der 166
englischen Erkenntnislehre, Moral und Religionswissenschaft, Berlin 1874
Zitiert nach: KUNZMANN, PETER (u.a.): dtv-Atlas Philosophie, München 2009 (14. Auflage). S. 125.167
Ebd. 168
Auch dem Naturrecht gilt das geteilte Interesse Smiths und Humes. Vgl. HAAKONSSEN, KNUD: The Science of a 169
Legislator: the Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith, Cambridge 1988.
Zitiert nach: KUNZMANN, PETER (u.a.): dtv-Atlas Philosophie, München 2009 (14. Auflage). S. 125.170
(1891-1970): „Die Bedeutung eines Satzes ist ... damit identisch, wie wir seine Wahrheit
oder Falschheit feststellen; und ein Satz hat nur Bedeutung, wenn solch eine Feststellung
möglich ist.” Er geht hier ähnlich vor wie A. J. Ayers (1910-1989), der nicht nur 171
Philosophie als Metaphysik ablehnt, sondern zugleich davon ausgeht, dass alle ethischen
Aussagen prinzipiell nicht empirisch verifizierbar und somit nicht analysierbar sind.
Daraus leitet er ab, dass ethische Aussagen „nur Pseudobegriffe sind. Ihr Vorhandensein
fügt dem tatsächlichen Inhalt nichts hinzu.” Hier wird Ludwig Wittgensteins Einfluss 172
auf den Logischen Empirismus deutlich. Ein System mit einer Art ethischen Axiomen zu
entwickeln, also eine systematische Ethik zu formulieren, ist Wittgenstein zuwider: Für
ihn ist klar, dass die Ethik sich nicht aussprechen lässt. Darum kann es keine Sätze der 173
Ethik geben. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. 174 175
Vom Moralphilosophen Adam Smith sind solche Töne nicht zu lesen. Und doch scheint
auch Smith, der selbst eher durch die griechische Klassik und die stoische Tradition
geprägt ist, schon eine gewisse Faszination für die Foki des Logischen Empirismus’ zu
empfinden. Das legt zumindest die Betonung der entscheidenden Relevanz der
Berechnungen (computations) für die Entdeckung der Gravitationsgesetze in Smiths
Geschichte der Astronomie nahe. Auch wenn Smith kein Logiker war, eine gewisse 176
Sympathie ist unübersehbar. Sollte der rationale Geist aber tatsächlich nur die objektive,
äußere Welt untersuchen und beschreiben ohne selbst schon durch eigene
Grundannahmen und Interpretation Realität zu konstruieren - und zwar nicht nur durch
Interpretation der Ergebnisse im Nachhinein, sondern durch Voraussetzungen im
Versuchsaufbau im Vorhinein - dann dürften die Berechnungen, die Newton überhaupt
erst zur Entdeckung der Gravitationsgesetze und deren experimenteller Bestätigung
geführt haben, für Smith eigentlich keine Rolle spielen. Insofern könnte man hier eine
!61
Ebd.171
Ebd.172
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus Logico-philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt am 173
Main 2003. S. 108.
Ebd.174
Ebd. S. 7. 175
Vgl. WIGHTMAN, W.P.D.; BRYCE, J.C.; ROSS, I.S. (HRSG.): Adam Smith. Essays on Philosophical Subjects 176
(Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 3), Oxford 1980. S. 98-105.
Brücke zum Rationalismus sehen, der rein aus dem Denken das Weltwissen zu
vermehren gedenkt.
Und trotzdem kann Smith klar und deutlich erklären, dass das System, das dem
Versuchsaufbau zugrunde liegt, keinerlei Effekt auf die unabhängige Objektivität des zu
untersuchenden Objekts hat: „I shall only observe, that whatever system may be adopted
[...], the certainty of our distinct sense and feeling of its externality, or of its entire
independency upon the organ which perceives it [...], cannot in the smallest degree be
affected by any such system.” 177
Auch der moderne von Mathematisierung und klassischer bzw. neoklassischer Lehre
geprägte Ökonom hält die Welt für eine kohärente Ansammlung von objektiven Fakten,
die zu entdecken bzw. zu berechnen ist. Auf dieser Grundannahme beruht diejenige 178 179
These, welche die Vorhersagbarkeit ökonomischer Entwicklung und Berechenbarkeit des
„Marktgeschehens” postuliert: die sogenannte Effizienzmarkthypothese. Allerdings ist
diese Hypothese kein empirisch gestützter Befund, sondern ein erdachter. Es ist quasi ein
synthetisches Urteil a priori. Hier zeigt sich die von Hans Albert ausgemachte 180
Immunisierung gegen die Erfahrung, die ausdrücklich nicht aus Smiths Ansatz 181
herzuleiten ist.
Die philosophischen Konsequenzen der Quantentheorie verunsichern das Weltbild der
Effizienzmarkthypothese. Die Quantentheorie geht davon aus, dass unser Entdecken des
einen Faktums die Entdeckung eines anderen Faktums häufig schon unmöglich macht
und somit einen Eingriff in die Erkenntnis darstellt. Der Physiker Werner Heisenberg
(1901-1976) geht mit diesem Widerspruch auf eine Reise durch die Philosophie und
untersucht zunächst den Dualismus von mind and matter bei Descartes, den er als
!62
SMITH, ADAM: Essays on Philosophical Subjects, London 1822. S. 167.177
Wobei schon der Begriff des Faktums durch die lateinische Wortwurzel das Gemachte einschließt.178
Für einen Schlüsseltext der Weiterentwicklung der Smithschen Begriffe und die Erklärung ökonomischer 179
Zusammenhänge mit mathematischen Methoden vgl. RICARDO, DAVID: Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung (Auszug), in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 69-82.
Zur Frage, wie wir zu Urteilen kommen, und den Unterscheidungen der verschiedenen Formen von Urteilen, die 180
Kant in der Kritik der reinen Vernunft vornimmt, vgl. die Einleitung zur zweiten Auflage in: KANT, IMMANUEl: Kritik der reinen Vernunft, Riga 1787.
ALBERT, HANS: Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer 181
Beleuchtung. in: KARRENBERG, FRIEDRICH; ALBERT, HANS (HRSG.): Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard Weisser, Berlin 1963. S. 45-78.
Grundlage für den Glauben an eine unabhängig existierende materielle Welt, die es durch
unsern Geist zu entdecken gilt, ausmacht. 182
Der (neo-)klassische Glaube an eine objektive Realität folgt im Kern dem kartesischen
Dualismus und auch wenn Descartes selbst nicht als Empirist, sondern als Rationalist gilt
- er hat dem späteren Siegeszug empirischer Wissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert
wohl den Weg geebnet. Auch wenn sich der Empirismus kritisch zum Rationalismus
positioniert, die Grundannahmen des Empirismus beruhen auf der rationalistischen
Trennung von mind und matter und spezifischen Annahmen über Materie im Allgemeinen.
Descartes sieht das Wesen der Materie in ihrer räumlichen Ausdehnung nach Länge,
Breite, Tiefe und sieht diese Kriterien als kraft der Vernunft klar und deutlich vorstellbar.
Härte, Gewicht, Farbe wiederum beruhten nur auf Sinneswahrnehmung, die als Quelle
der Erkenntnis unzuverlässig ist. Der Empirismus würde hier widersprechen. Und doch
bewegen sich auch Empiristen, die sich als im Widerspruch zu Descartes verstanden, im
Feld der grundlegenden Unterscheidung von mind und matter bzw. der Trennung von
Außen- und Innenwelt.
Das ist keineswegs selbstverständlich. Aristoteles, der, wie Smith schreibt, „sicherlich die
Welt kannte”, sah haptisch erfahrbare Materie lediglich als „imposition of form on a 183
potentia, a sort of universal essence comprising possibility rather than actuality.” Aus 184
dieser Beobachtung lässt sich ableiten, dass die heute vielerorts selbstverständliche
Autorität empirischer Wissenschaft keineswegs notwendig oder offensichtlich ist,
sondern das Ergebnis einer Rezeptions- und Wirkungsgeschichte ist. Wenn solche
wissenschaftstheoretischen Leitbilder sich in der Vergangenheit verändert haben, so
können sie sich freilich auch in Zukunft verändern. Nur weil irgendein Ideen- und
Prinzipiensystem sich in der einen Arena als nützlich erwiesen haben, sollten wir uns, wie
Heisenberg zu bedenken gibt, uns nicht dazu verführen lassen, zu glauben, wie hätten
eine Wahrheit gefunden, die gleichsam in jeder anderen Arena gilt. 185
Der Theologie und Existenzphilosoph Paul Tillich (1886-1965) widerspricht der
Fragmentierung der Personalität in Körper und Geist, wie es der kartesische Dualismus
!63
Vgl. HEISENBERG, WERNER: Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science, New York 2007.182
SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. 421.183
HEISENBERG, WERNER: Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science, New York 2007. S. XV.184
Ebd.185
vorsieht. Er versteht das Göttlich-Unendliche als Grund des Seins und die Beschäftigung
mit dem, was uns unbedingt angeht, als Zentrum der Person. Dieses Zentrum (ultimate
concern) integriert für Tillich alle Aspekte des persönlichen Lebens. Ohne das, was uns
unbedingt angeht, zu sein, bedeute notwendigerweise ohne persönliches Zentrum zu
sein: „The center unites all elements of man’s personal life, the bodily, the unconscious,
the conscious, the spiritual ones. In the act of faith every nerve of man’s body, every
striving of man’s soul, every function of man’s spirit participates. But body, soul, spirit,
are not three parts of man. They are dimensions of man’s being, always within each
other; for man is a unity and not composed of parts. Faith, therefore, is not a matter of
the mind in isolation, or of the soul in contrast to mind and body, or of the body (in the
sense of animal faith), but is the centered movement of the whole personality toward
something of ultimate meaning and significance.” Tillich möchte die geistige und 186
materielle Dimension der menschlichen Existenz durch faith as ultimate concern integriert
verstehen: „Ultimate concern is passionate concern; it is a matter of infinite passion.
Passion is not real without a bodily basis, even if it is the most spiritual passion. In every
act of genuine faith the body participates, because genuine faith is a passionate act.” 187
Auch Smith geht einen Weg, der kognitive Rationalität und intuitives Gefühl kombiniert.
Es ist der Weg, der ihn zum Begriff des moralischen Gefühls bringt, der Rationalität,
Imagination und Anschauung verknüpft. In Wittgensteins Worten: „Ethik und Ästhetik
sind Eins.” 188
C. Der Wissenschaftsbegriff: Popper, Kant, Smith
Nachdem wir mit Tillich den Dualismus von Körper und Geist kritisch reflektiert haben,
wollen wir nun mit Popper auf den Dualismus von innerer und Außenwelt eingehen.
Karl Popper (1902-1994) vertritt die Auffassung, Wissenschaft sei das systematische und
nachvollziehbare Überprüfen von Vermutungen über die Wirklichkeit, um
generalisierbare Schlussfolgerungen zu ziehen, bei denen der Sachverhalt für die
Betrachter erkennbar sein muss. „Er nennt sich selbst einen Realisten, der mit dem
Alltagsverstand (common sense) die Außenwelt und Gesetzmäßigkeiten in ihr als real
!64
TILLICH, PAUL: Dynamics of Faith, New York 1957. S. 106.186
TILLICH, PAUL: Dynamics of Faith, New York 1957. S. 106.187
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus Logico-philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt am 188
Main 2003. S. 108.
gegeben ansieht. Er lehnt dagegen die Auffassung ab, in der Wissenschaft sei irgendein
Wesen der Dinge zu erfassen.” Popper vertritt den Nominalismus, den er in der 189
Naturwissenschaft vorherrschen sieht, und stellt dem den Essentialismus gegenüber, den
er in der seinem Verständnis nach rückständigen Sozialwissenschaft vorherrschen sieht.
Letzterer behandelt Begriffe, deren Sinn sich durch Definition erschließt. Der
Nominalismus dagegen überprüft Aussagen und Theorien durch Ableitungen auf ihre
Wahrheit. Wie schon David Hume lehnt auch Karl Popper „die Möglichkeit ab, aus noch
so vielen Fällen auf ein Gesetz zu schließen.” Der redliche Wissenschaftsprozess 190
verläuft nach Popper, indem aus einer Beobachtung ein induktiver Schluss folgt, woraus
dann eine Theorie gebildet wird. Anhand dieser Theorie werden durch Deduktion
Hypothesen hergeleitet, welche dann gegebenenfalls falsifiziert und durch eine neue
Theorie ersetzt werden können.
Poppers Wissenschaftsbegriff ist ein betont empirischer. Als Problem des Empirismus
kann neben der Gefahr der Nivellierung der differenzierten Wahrnehmung auch die
potenzielle Unterbestimmtheit der Vernunft gelten. Das wird deutlich am Verhältnis von
Einzelnem und Allgemeinem. Aristoteles gibt dazu am Beispiel des Arztes zu bedenken:
„Wenn nun jemand den Begriff besitzt ohne Erfahrung und das Allgemeine weiß, das
darin enthaltene Einzelne aber nicht kennt, so wird er das rechte Heilverfahren oft
verfehlen; denn Gegenstand des Heilens ist vielmehr das Einzelne.” Die Erfahrung ist für
Aristoteles Erkenntnis des Einzelnen. Die Kunst des Allgemeinen, ja alles Handeln und
Geschehen überhaupt, gehe jedoch am Einzelnen vor. „Denn nicht einen Menschen
überhaupt heilt der Arzt, [...] sondern den Kallias oder den Sokrates oder irgendeinen
anderen Einzelnen, für welchen es ein Akzidens ist, daß er auch Mensch ist.” Die 191
Erfahrung des Einzelnen also qualifiziert oder informiert die Kunst des Allgemeinen.
Eine Kunst des Allgemeinen, die am Einzelnen vorbeigeht, ist eine schlechte. Smith nun,
das ist deutlich geworden, bemüht sich darum, die Alltagserfahrung mit der
Theoriebildung zu versöhnen. Wie wir gezeigt haben, führt das immer wieder zu
Unschärfen und irreführenden Verallgemeinerungen einzelner Situationen, deren
spezifische Umstände den allgemeinen nicht hinreichend entsprechen.
!65
KUNZMANN, PETER (u.a.): dtv-Atlas Philosophie, München 2009 (14. Auflage). S. 235.189
Ebd.190
ARISTOTELES: Metaphysik, Hamburg 2010 (6. Auflage). S. 38.191
Kant sieht nun weder allein in der Anschauung, noch allein im Verstand eine fundierte
Grundlage für die Wissenschaft. Im Vernunftbegriff versucht er deshalb, beide
Dimensionen sinnvoll zu verknüpfen. Salopp formuliert: Wir müssen in die Natur
hineindenken, damit sie erfahrbar antworten kann. Nun ist es kein Zufall, dass Adam
Smith als Kants „Liebling” galt. Denn auch Smith geht über die bloße Empirie hinaus. 192
Er verknüpft Beobachtungen und Gedanken zu einem neuen System und prägt Begriffe.
Der Akt der Begriffsbildung ist nicht ein sinnlich-empirischer Akt, sondern ein Akt des
Verstandes. Ein Begriff wird für die Interpretation der Anschauung eines Gegenstandes
benötigt und ohne die Anschauung des Gegenstandes selbst wäre kein zu
interpretierender Bewusstseinsinhalt vorhanden. Interessanterweise widmet sich Kant in
seinen Reflexionen zur Anthropologie der Bedeutung von Begriffen direkt nach dem
Hinweis auf Smiths „unpartheyschen Zuschauer” zu. Er schreibt: „Gefühl, 193
Anschauungen und Begriffe sind die verschiednen Zweke, worauf sich der Dichter lenkt.
Je roher der Leser ist, desto mehr gilt das erste. Denn das Zweytem und endlich das
Dritte. Jetzt müssen Anschauungen und Gefühle den Begriffen nur zur Hilfe kommen,
aber ihnen nicht verdunkel oder überschreyen.” Obwohl Smith einen entschieden 194
anderen Weg als Kant geht, wenn er von moral sentiments spricht und die Moral in den
natürlichen Gefühlen des Menschen verortet, lässt sich sagen: Der Begriffsbildung
kommt auch für Smiths philosophiegeschichtliche Einordnung eine entscheidende
Bedeutung zu. 195
D. Common Sense statt Moral Sense
Im Vergleich von common sense und moral sense finden die Fragen der Erkenntnis- und
Moraltheorie zusammen. Poppers Rekurs auf den Alltagsverstand knüpft an die
Common-Sense-Philosophie von Thomas Reid (1710-1796) an, verwendet den Begriff
!66
Kant hat sowohl Theory als auch Wealth gelesen und geschätzt. Markus Herz schreibt 1771, noch vor der 192
Veröffentlichung des Wealth also, an Kant: „Ueber den Engländer Smith, der, wie Herr Friedländer mir sagt, Ihr Liebling ist, habe ich verschiedene Remarken zu machen.” Kant verweist immer wieder auf Smiths Ideen (z. B. der Arbeitsteilung) und zitiert an mehreren Stellen direkt den Wealth: Met. Anf. der Rechtslehre AA VI, S. 289 und AA VII Anthropologie, S. 209. (vgl. SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. XXII.)
KANT, IMMANUEL: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie, Berlin 1900ff. S. 334.193
Ebd.. S. 335.194
Näheres zu Vergleich, Interaktion und Unterschieden von Smiths und Kants Philosophie ist zu finden in: 195
ONCKEN, AUGUST: Adam Smith und Immanuel Kant. Der Einklang und das Wechselverhältnis ihrer Lehren über Sitte, Staat und Wirtschaft. Leipzig 1877.
des common sense jedoch in spezifisch naturwissenschaftsaffiner Weise. Interessant ist 196
deshalb, den Ursprung des Begriffs im Kontrast zu Smith und Kant zu verstehen.
Thomas Reids „An Inquiry Into the Human Mind on the Principles of Common
Sense” von 1764 gilt als Gründungsdokument der Strömung, die sich im Schottland 197
des 18. und 19. Jahrhundert entwickelte. Der Zeitgenosse von Smith und Kant sprach 198
weder von moralischem Geschmack (Kant), noch vom moralischen Sinn (Hume) oder dem
moralischen Gefühl (Smith).
Es hat sich die Übersetzung des common sense als „gesundem Menschenverstand”
eingeschliffen, obwohl sie das Kommunitäre des Begriffs nicht recht zu fassen vermag.
Hannah Arendt (1906-1975) weist darauf hin, dass die Realität selbst jedoch erst im
common entsteht. Sie schreibt: „Nichts ist partikularer als sinnliche Erfahrung. Ihr 199
können wir nur trauen, weil sich zu unserer fünf Sinnen ein sechster gesellt, der [...] uns
allen gemeinsam ist: ‘common sense’. [...] Die Sinne indizieren eine Welt der Objekte, sie
indizieren keine Menschenwelt. Was uns mit anderen Menschen verbindet, ist unser
‘common sense’, der als solcher unser eigentlich politischer Sinn ist.” 200
VI. Schlussfolgerungen für die Politische Ökonomik
A. Die Autonomie der Wirtschaftswissenschaft
Terence Hutchison schreibt 1988, Smith sei ohne bewusste Absicht von einer
unsichtbaren Hand dazu geführt worden, etwas zu verfolgen, das er keineswegs
beabsichtigt hatte, nämlich „establishing political economy as a separate autonomous
discipline.” Die Volkswirtschaftslehre versteht sich heute als genau das: eine autonome 201
!67
Vgl. POPPER, KARL: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Teil 1: Der Zauber Platons, München 1957. Und: 196
POPPER, KARL: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Teil 2: Falsche Propheten: Hegel, Marx und die Folgen, München 1958.
In deutscher Übersetzung erschienen als: REID, THOMAS: Untersuchungen über den menschlichen Geist nach 197
Prinzipien des gesunden Menschenverstandes, Leipzig 1782.
Die Strömung blieb auch in den britischen Kolonien nicht ohne Einfluss, wie die Monographie des britisch-198
amerikanischen Deisten und Unitariers Thomas Paine zum Thema zeigt. Paine war einer der Gründerväter des US-amerikanischen Nationalstaats, ein Zeitgenosse Adam Smiths und unter anderem mit dem Deisten Benjamin Franklin befreundet. Der entschiedene Gegner der Monarchie und Freund der französischen Revolution Paine entging der Enthauptung durch die Revolutionsführung nur knapp. Vgl. PAINE, THOMAS: Common Sense, London 2004.
ARENDT, HANNAH: Denktagebuch, Band I, München 2002. S. 360.199
Ebd., S. 335.200
HUTCHISON, TERENCE WILMOT: Before Adam Smith: the Emergence of Political Economy, 1662–1776, Oxford 201
1988. S. 355.
Disziplin der Wissenschaft. Das Interesse an einer ganzheitlichen Rezeption Smiths kann
also auch als Rebellion gegen eine Abkapselung der Volkswirtschaftslehre von anderen
Sozialwissenschaften und der Philosophie verstanden werden. Tony Aspromourgos
schreibt: „In fact, much interest in Adam Smith’s entire corpus, still, more than two
centuries after his writing, springs from interest in a conception in Smith’s thought (partly
explicit, partly necessarily implicit), of a wider political economy than that entailed by
modern marginalism.” Die Antwort auf die Frage nach dem disziplinären Separatismus 202
der Volkswirtschaftslehre und der neoklassischen Abkehr von der philosophischen Natur
der Disziplin, ist vielschichtig und mit der simplen Schuldzuweisung an „die Ökonomen”
nicht erfasst.
Offensichtlich sind die interdisziplinären Bezüge des Institutionalismus, der 203
marxist ischen Wir tschaftstheorie, der Polar isat ionstheorie, oder der 204
Regulationstheorie und der an den alten Institutionalismus anknüpfenden Neuen 205
Institutionenökonomik. Aber auch liberale Autoren der Österreichischen Schule wie
Friedrich von Hayek (1899-1992) bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für den
interdisziplinären Diskurs, unter anderem auch, weil er Wirtschafts- als
!68
ASPROMOURGOS, TONY: The Science of Wealth. Adam Smith and the framing of political economy, Oxon 2009. 202
S. 61f.
„Kennzeichnend für den Institutionalismus sind: Betonung der Dynamik des Wirtschaftsablaufs gegenüber der 203
Statik des Gleichgewichts; Darstellung soziologischer, psychologischer und rechtlicher Phänomene und deren Einfluss auf Wirtschaftsordnung, wirtschaftliches Verhalten; Bestimmung des Wirtschaftsablaufs nicht durch das Marktgeschehen, sondern durch die das Marktgeschehen bestimmenden Institutionen.” Zititiert nach: SPRINGER GABLER VERLAG (HRSG.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Institutionalismus, abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/11577/institutionalismus-v8.html (Stand: 18. Juni 2014 um 16.43 Uhr).
Die Polarisationstheorie wendet sich gegen das Gleichgewichtsmodell der neoklassischen Theorie. Sie geht von 204
starken Ungleichgewichten in Wirtschaftssystemen aus. Die sektorale Ausprägung der Polarisationstheorie betont den Wachstumsimpuls und Investitionsschub von führenden Unternehmen einzelner Branchen und wurde von Joseph Schumpeter und François Perroux begründet. Die regionale Ausprägung der Polarisationstheorie betont die wirtschaftlichen Impulse, die von bestimmten Wachstumspolen ausgehen und so viele Standortvorteile vereinen, dass Unternehmen dort zum Impulsgeber für den umliegenden Raum werden können. Sie wurde maßgeblich von Gunnar Myrdal und Albert Hirschman geprägt.
Die Regulationstheorie erklärt „die langfristige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung durch ein nicht-205
deterministisches Abfolgen von Entwicklungsphasen und Entwicklungskrisen [...] Die Entwicklungsphasen sind durch einen in sich stimmigen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklungszusammenhang charakterisiert, der ein Akkumulationsregime bzw. eine Wachstumsstruktur als Ausdruck einer technologisch-ökonomischen Struktur einem Koordinationsmechanismus bzw. einer Regulationsweise als Ausdruck der institutionell-gesellschaftlichen Struktur gegenüberstellt. Der Übergang zwischen den Entwicklungsphasen wird durch strukturelle Krisen ausgelöst.” Zititiert nach: SPRINGER GABLER VERLAG (HRSG.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Institutionalismus, abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9354/regulationstheorie-v7.html (Stand: 18. Juni 2014 um 16.55 Uhr).
Sozialwissenschaft versteht. Im Vorwurf zu seinem wirtschaftsphilosophischen Werk 206
„Die Verfassung der Freiheit” schreibt von Hayek: „Obwohl ich [das Buch] nicht hätte
schreiben können, wenn ich nicht den größeren Teil meines Lebens dem Studium der
Volkswirtschaftslehre gewidmet hätte und mich in jüngster Zeit auch bemüht hätte, die
Ergebnisse anderer Sozialwissenschaften kennenzulernen, befasse ich mich hier doch
nicht ausschließlich mit Tatsachen und beschränke mich nicht auf die Untersuchung des
Verhältnisses von Ursachen und Wirkungen.” 207
Für Smith ist die Ökonomik völlig selbstverständlich Teil der Philosophie. Er sieht die
Arbeitsteilung zwischen verschieden interessierten Philosophen als die Ausbildung
verschiedener Zweige der Philosophie: „Philosophy or speculation, in the progress of
society, naturally becomes, like every other employment, the sole occupation of a
particular class of citizens. Like every other trade it is subdivided into many different
branches, and we have mechanical, chymical, astronomical, physical, metaphysical, moral,
political, commercial, and critical philosophers. In philosophy as in every other business
this subdivision of employment improves dexterity and saves time. Each individual is
more expert at his particular branch. More work is done upon the whole and the quantity
of science is considerably increased by it.” 208
Eine autonome ökonomische Wissenschaft ist für Smith unvorstellbar. Im Gegenteil:
„Smithian political economy consciously and explicitly rests upon suppositions of
psychology, and in its normative dimension, principles of political theory.” Tony 209
Aspromourgos gibt zu bedenken, dass in der mathematisierten neoklassischen Theorie
die vermeintliche Autonomie der Wirtschaftswissenschaft bis ins Menschenbild
hineinreicht: „it is the autonomy of the individual agents of the theory, stripped of their
identities as anything other than pursuers of their independently given preferences;
!69
Vgl. VON HAYEK, FRIEDRICH AUGUST: Die Verfassung der Freiheit, Tübingen 2005 (4. Auflage). S. XVII.206
Von Hayek fährt fort: „Mein Ziel ist, ein Ideal darzustellen, zu zeigen, wie es erreicht werden kann, und zu 207
erklären, was seine Verwirklichung in der Praxis bedeutet würde. Dazu ist wissenschaftliche Erörterung ein Mittel, nicht ein Zweck. Ich glaube, ich habe von meinen wissenschaftlichen Kenntnissen der Welt, in der wir leben, ehrlichen Gebrauch gemacht. Es bleibt dem Lesen überlassen zu entscheiden, ob er die Werte zu den seinen machen will, in deren Dienst ich jenes Wissen gestellt habe.”
MEEK, R.L.; RAPHAEL, D.D.; STEIN, P.G. (HRSG.): Adam Smith. Lectures on Jurisprudence (Glasgow Edition of 208
the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 5), Oxford 1978. S 570. Zitiert nach: ASPROMOURGOS, TONY: The Science of Wealth. Adam Smith and the framing of political economy, Oxon 2009. S. 62.
ASPROMOURGOS, TONY: The Science of Wealth. Adam Smith and the framing of political economy, Oxon 2009. 209
S. 261.
people without characteristics as social or political actors; people without any history.” 210
Der Mathematiker Claus Peter Ortlieb sieht genau hier das populäre Potenzial der
neoklassischen Theorie: Der „Reiz des neoklassischen Dogmas [besteht], polemisch
gesagt, in seiner Stammtischnähe, die aus dem so genannten methodologischen
Individualismus resultiert. Der besagt, dass sich die Funktionsweise einer Volkswirtschaft
aus dem Handeln der einzelnen Wirtschaftssubjekte erklären lassen muss.” Diese
Erklärung bestehe dann aus Begründungen, die auf den ersten Blick plausibel schienen,
indem sie Alltagssituationen betriebswirtschaftlicher Art auf ganze Volkswirtschaften
übertrugen. Hätte die Politische Ökonomik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 211
allerdings nicht diesen Weg gewählt, so Aspromourgos, wären womöglich andere
Sozialwissenschaften in ihrer heutigen Form gar nicht entstanden. „One wonders
whether sociology, for example, in at least some respects filled a vacuum resulting from
the impoverishment of economic analysis.” 212
Um Adam Smiths philosophische Theorie und ökonomische Lehre zu verstehen, muss
also die moderne Vorstellung der Volkswirtschaftslehre als autonomer Disziplin
methodisch ad acta gelegt werden. Die Lektüre Smiths regt zu einem Verständnis der
Ökonomie als großem, interdisziplinären Projekt an. Sie erteilt dem streng abgegrenzten
Verständnis der Volkswirtschaftslehre eine Absage.
B. Marktbegriff und „Marktversagen”
In der Rezeptionsgeschichte sind Smiths rhetorische Stilmittel immer wieder mit dem
Inhalt seiner Theorie gleichgesetzt worden. Das wird Smith nicht gerecht. Er baut
mithilfe neu geprägter Begriff unmittelbare Alltagserfahrung und ermittelte Hypothesen
zu einem umfassenden Interpretationssystem zusammen. Insofern lässt sich sagen, dass
Smith die Deskription der Beobachtung und die Konstruktion der Vernunft vereint, um
seine Theorie zu entwickeln. Im Wealth wird dieses Vorgehen am Marktbegriff, dem
Smith zu einer bemerkenswerten Karriere verholfen hat, deutlich. Seit dem fundamental
prägenden Erfolg des Wealth wird der Markt nicht nur als ein konkreter Ort (als
!70
Ebd.210
MARGUIER, ALEXANDER: Ökonomie ist eigentlich keine Wissenschaft, Gespräch mit Claus Peter Ortlieb, in: 211
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 9. Mai 2010.
ASPROMOURGOS, TONY: The Science of Wealth. Adam Smith and the framing of political economy, Oxon 2009. 212
S. 261.
Marktplatz also) verstanden, wie die agora der Antike es war. Er wird heute als 213
personifizierte Metapher für die Summe aller möglichen und tatsächlichen
Vertragsabschlüsse des Gegenstandsbereiches Wirtschaft verstanden. Zudem hat die
klassische Ökonomik den Begriff so weiterentwickelt, dass der Markt als nach
Naturgesetzen geordnet und in seiner ursprünglichen Struktur als regelmäßig und
berechenbar verstanden wird.
Von „Marktmechanismen”, wie sie in der neoklassischen, mathematisierten Ökonomik
selbstverständlicher Teil der Alltagssprache geworden sind, ist bei Smith keine Rede. Die
Gravitationskräfte sind bei Smith nicht mehr als eine etwas schwammige Illustration
seiner Überlegungen, nicht aber ein programmatischer Grundsatz. Auch die Rede vom
„Marktversagen” ist weit weg von allen Smithschen Überlegungen. Marktversagen
versteht die Ökonomie heute als „Abweichungen des Ergebnisses marktmäßiger
Koordination von der volkswirtschaftlich optimalen Allokation von Gütern und
Ressourcen im Modell der vollkommenen Konkurrenz. Die Abweichungen zeigen einen
potenziellen wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf an.” Diese Definition wirft 214
Fragen auf. Warum zeigt die Abweichung vom Modell der vollkommenen Konkurrenz
wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf an? Dieses Postulat ist ein nicht begründetes
Dogma. Formal korrekt kann diese Setzung nur deswegen sein, weil sie auf Wörter der
Folgerung in der Definition verzichtet. Es wird lediglich postuliert, dass die
Abweichungen Handlungsbedarf anzeigen. Der zweite folgt aber nicht deduktiv aus dem
ersten Satz. Also ist der Satz im Sinne der Aussagenlogik zwar logisch wahr, aber nicht
logisch gültig.
Die Benutzung des Begriffs Marktversagen ist insgesamt in Zweifel zu ziehen, denn sie
schiebt die Verantwortung für die Abweichung auf die abstrakte Personifikation des
Marktes ab, anstatt Kritik am eigenen Modell zu formulieren und die Abweichung als
Modellversagen zu verstehen. Das ist insofern problematisch, weil es die eigenen Theorie
!71
Zum Marktbegriff im 4. und 5. Jahrhundert v. Chr. und der agora des antiken Athens vgl. POLANYI, KARL: 213
Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 293ff.
SPRINGER GABLER VERLAG (HRSG.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marktversagen, abrufbar unter: 214
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marktversagen.html (Stand: 18. Juni 2014 um 16.59 Uhr).
gegen die erfahrene Wirklichkeit immunisiert. Phänomene, die heute als Marktversagen 215
bezeichnet werden, sind nicht mehr als das Versagen der gängigen Erklärungsmodelle
wirtschaftlicher Interaktion. Wenn von realen Menschen als wirtschaftliche Akteure
ausgegangen wird, kann auch von „Unregelmäßigkeiten” am Markt nicht gesprochen
werden. Der Markt funktioniert dann nämlich immer, selbst wenn die gängigen
Erklärungsmodelle nicht in der Lage sind, diese Funktion schlüssig in mathematischen
Kategorien auszudrücken. Die Unregelmäßigkeiten des Marktes sind Unregelmäßigkeiten
von unzulänglichen Modellen, nicht aber Marktunregelmäßigkeiten im eigentlichen Sinne.
Regelrecht gefährlich ist die Rede von unvorhergesehenen Entwicklungen als „exogenen
Faktoren”. Exogen sind die Faktoren nämlich auch nur dann, wenn ein Modell von sich
selbst und nicht realen Menschen als der Wirklichkeit ökonomischer Interaktion ausgeht.
Das Abstraktionsniveau der finanzmathematischen Modelle der Neoklassik ist derart
hoch, dass sie die Illusion ihrer Objektivität aufrecht erhalten können. Die Relativität 216
aller Vorhersagen und Berechnungen wird auch heute, nach der tiefen Krise seit 2008,
von vielen Ökonomen nicht in ihrer vollen Tragweite benannt. Die heranwachsende
Generation von Ökonomen aber ist unter einem völlig anderen Paradigma aufgewachsen,
nämlich der totalen Fehlbarkeit mathematischer Modelle und der erschreckenden Naivität
vieler neoklassischer Ökonomen im Bezug auf Vorhersagbarkeit und Risikoeinschätzung.
Dass ökonomische Akteure Menschen sind und keine Roboter ist so offensichtlich, dass
es keiner Erklärung bedarf. Dieses Bewusstsein hat die Finanzkrise auch in der
akademischen Ökonomie wieder wach gerufen. Eine Reihe von Selbstverständlichkeiten
des ausgehenden 20. Jahrhunderts sind relativ geworden, so zum Beispiel im Umgang mit
den Vorhersagen ökonomischer Expertise: Als Experte gilt nicht länger nur derjenige, der
korrekt vorhersagt, sondern vor allem derjenige, der sinnvoll erklären kann, warum eine
Vorhersage falsch war. 217
!72
Vgl. wiederum: ALBERT, HANS: Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in 215
kritischer Beleuchtung. in: KARRENBERG, FRIEDRICH; ALBERT, HANS (HRSG.): Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard Weisser, Berlin 1963. S. 51.
Vgl. ORTLIEB, CLAUS PETER: Mathematisierte Scharlatanerie. Zur ‘ideologiefreien Methodik’ der neoklassischen 216
Lehre, in: DÜRMEIER, THOMAS; VON EGAN-KRIEGER, TANJA; PEUKERT, HELGE (HRSG.): Die Scheuklappen der Wirtschaftswissenschaft. Postautistische Ökonomik für eine pluralistische Wirtschaftslehre, Marburg 2006.
Zum Begriff der Expertise vgl. TETLOCK, PHILIP: Expert Political Judgment: how good is it? How can we know, 217
Princeton 2005.
Die in der digitalisierten, globalen Finanzwirtschaft vorherrschende Kultur von rational
choice, ceteris paribus und homo oeconomicus erinnert an die sich in theologischen und
philosophischen Spitzfindigkeiten verlierende Spätscholastik des anbrechenden Zeitalters
der Neuzeit. Ihre weltfremde Rhetorik hat Martin Luther, Philipp Melanchthon und viele
andere zum grundsätzlichen Angriff auf die akademische und kirchliche Gesellschaft
ihrer Zeit veranlasst. Die nächsten Jahrzehnte werden zeigen, ob Ähnliches der noch
einflussreichen neoklassischen Ökonomik des ausgehenden zweiten Jahrtausends blüht.
Erste Anzeichen dafür sind sowohl in der akademischen Elite, als auch unter
Studierenden und in der Popularkultur unübersehbar. 218 219
B. Der neue Protest gegen die neoklassische Lehre
Nicht nur populäre Bewegungen wie Occupy Wall Street formulieren Protest gegen die
a k a d e m i s c h e M o n o k u l t u r ö k o n o m i s c h e n D e n k e n s . A u c h a n
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten rund um den Globus wird die Grundsatzkritik
an neoklassisch dominierten Lehrplänen immer lauter. Verfasst ist diese Kritik immer
häufiger auch als interdisziplinäres Gespräch. Nicht nur Ökonomen, sondern zunehmend
auch Theologen, Philosophen, Geschichtswissenschaftler, Soziologen, Psychologen,
Ethnologen und Philologen beteiligen sich am Gespräch über Wirtschaftsformen der
Zukunft. Die Besinnung auf die Entstehungsphase der politischen Ökonomie lohnt,
denn besonders die Lektüre des Wealth im Kontext von Smiths Moralphilosophie zeigt,
wie voraussetzungsreich und unselbstverständlich der heutige ökonomische Mainstream ist
und demonstriert, wie ertragreich eine kritische Reflexion der eigenen
Erkenntnisbedingungen für die Wirtschaftswissenschaften ist.
!73
Deutlich wird das auch am vielfältigen Protest unter Studierenden der Volkswirtschaftslehre, der sich der 218
heterodoxen Ökonomie verschrieben hat und quer durch die deutsche Wissenschaftslandschaft organisiert. Als Plattformen fungieren unter anderem der Arbeitskreis Postautistische Ökonomie e.V. (heute: AK Real World Economics), sowie das Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. mit zur Zeit fünfzehn assoziierten Hochschulgruppen im deutschsprachigen Raum. Zunehmend organisiert sich der Protest auch international. Ein Aufruf der von 65 assoziierten Studierendengruppen aus 30 Ländern gestarteten „International Student Initiative for Pluralism in Economics” ist abrufbar unter: http://www.isipe.net (Stand: 20. Mai 2014 um 19.53 Uhr).
Die wohl bekannteste populäre Initiative gegen die vorherrschende ökonomische Lehre äußerte sich Rahmen des 219
Protests der Occupy-Bewegung. Inspiriert durch den Arabischen Frühling und unterstützt durch das Magazin „Adbusters” der Adbusters Media Foundation verbreitete sie sich im Herbst 2011 in kürzester Zeit, vor allem in den USA und Europa. Einer der Vordenker der Bewegung ist der Ethnologe David Graeber, der in seinem Bestseller „Schulden: Die ersten 5000 Jahre” unter anderem entscheidende Grundgedanken der Smithschen Geldtheorie widerlegt. Seit 2013 lehrt er an der anthropologischen Fakultät der London School of Economics. Die Webseite der Occupy-Bewegung ist abrufbar unter: http://occupywallst.org (Stand: 20. Mai 2014 um 20.10 Uhr)
Hierzulande sind die akademischen Diskurse der Volkswirtschaftslehre sogar noch
deutlicher als in den USA von einem nicht immer explizierten, aber quer durch alle
Fakultäten präsentem neoklassischen Konsens dominiert. Anders als in den USA, wo
Fondsmanager George Soros mit dem „Institute for New Economic
Thinking” (INET) eine mit mit prominenten Wissenschaftlern besetzte Denkfabrik für 220
die Entwicklung einer neuen, innovationsfreundlichen, kritisch-reflexiven Ökonomik
gegründet hat, passiert auf Ebene der Lehrstühle und Chefetagen in Banken und
wirtschaftswissenschaftlichen Instituten in Deutschland eher das Gegenteil. So hat die
Deutsche Bank beispielsweise ihre einst unabhängige Denkfabrik DB Research im Jahr
2012 mit der Abteilung für Marktanalyse zusammengelegt. Aber auch das INET wird 221
in der heterodoxen Ökonomik kontrovers diskutiert. Während die einen die Gründung
des INET als Durchbruch oder zumindest Anzeichen eines Umdenkens werten, wird es
von den anderen als eine persönliche Imagekampagne von George Soros gewertet, der
mit seinen Spekulationen ganze Volkswirtschaften in Turbulenzen stoßen konnte und in
dem System, das er jetzt mit einem neuen Denken reformieren möchte, jahrzehntelang
eine tragende Stütze bzw. ein erfolgreicher Nutznießer gewesen ist. Sicher ist, dass das 222
INET systemkritische Diskussionen zumindest zu einem gewissen Grad in die Diskurse
der akademischen Elite der Ökonomie eingeführt und gewissermaßen salonfähig gemacht
hat.
Im einem gewissen Gegensatz dazu stehen deutschsprachige Plattformen wie
oekonomenstimme.org, die von ganz anderen als grundsätzlichen Debatten über die
Paradigmen ökonomischer Forschung dominiert sind. Bei insgesamt 1631 Beiträgen sind
auf der Themenseite der Plattform unter der Rubrik „B5: Aktuelle heterodoxe Ansätze”
vier und unter der Rubrik „P4: Andere Wirtschaftssysteme” nur zwei Artikel verzeichnet.
!74
Geschäftsführer des INET ist Robert Johnson, ehemals Direktor des Hedge Fonds „Soros Fund Managment”. 220
Mitbegründer sind unter anderem die Nobelpreisgewinner Akerlof, Spence und Stiglitz. Das Institut vergibt Stipendien, gibt eine eigene Zeitschrift heraus und organisiert öffentlichkeitswirksam Konferenzen und Dialoge, so zum Beispiel in der Diskussionsreihe „Economics and Theology” mit dem Union Theological Seminary in New York, NY.
WELT ONLINE: Der ungehörte Chefökonom der Deutschen Bank, abrufbar unter: http://www.welt.de/221
wirtschaft/article110882633/Der-ungehoerte-Chefoekonom-der-Deutschen-Bank.html (abgerufen am: 2. April 2014 um 13.15 Uhr).
Für die kritische Auseinandersetzung mit dem INET vgl. HÄRING, NORBERT: Das INET von George Soros - 222
Instrument zur Weltverbesserung oder trojanisches Pferd der Finanzoligarchie? abrufbar unter: http://www.norberthaering.de/index.php/de/newsblog2/27-german/news/67-das-inet-von-george-soros-instrument-zur-weltverbesserung-oder-trojanisches-pferd-der-finanzoligarchie (Stand: 18. Juni 2014 um 18.40 Uhr).
Wenig Aufmerksamkeit bekommen außerdem Beiträge zu Bildung (10 Artikel),
Gesundheit (8 Artikel), sowie Wohlfahrt und Armut (9 Artikel). Die beliebtesten
Rubriken sind „E5: Geldpolitik, Zentralbank, Geld- und Kreditangebot” (87 Artikel),
„H6: Öffentlicher Haushalt, Dezifit und Staatsverschuldung” (92 Artikel), sowie
Spitzenreiter „E6: Wirtschaftspolitik; makroökonomische Aspekte öffentlicher Finanzen;
Wirtschaftspolitik und allgemeine Perspektive” (135 Artikel). Die großen 223
paradigmatischen Debatten, die die US-amerikanische Ökonomik vorsichtig zu führen
begonnen hat, gehen an Deutschland vorbei. 224
Abschließend ist zu sagen: Die an Isaac Newton angelehnte Rhetorik bei Adam Smith
kann selbst nicht als klassische oder neoklassische Ökonomik bezeichnet werden. Sie hat
aber entscheidend zu deren Entstehung beigetragen. Smith hat dadurch bis heute einen
starken Einfluss auf die Ökonomie, selbst wenn der Großteil der universitären Lehrpläne
rund um den Globus von philosophischer Reflexion der mathematischen Modelle völlig
befreit wurden.
C. Abschließende Überlegungen zu Smiths Anthropologie
Letztlich ist das Präskriptive von Smiths Theorie die Deskription. Smith beschreibt, wie
Mitgefühl Urteilskraft verleiht und neben der Selbstliebe die entscheidende Triebfeder
der Handlungen ist. Smith sieht im Menschen keinen durch einen von Hobbes’ Leviathan
zu bändigenden homo homini lupus, sondern einen zur Moral fähigen Menschen, der anders
als das zôon politikon von Aristoteles vor allem durch das Verfolgen seines Eigeninteresses
das Gemeinwohl mehrt. Insofern formuliert er in abgewandelter Form das als 225
Indikativ, was die christliche Tradition als Imperativ an den Menschen heranträgt: Liebe
Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Möglicherweise könnte das Smithsche
Doppelgebot der Liebe heißen: Die Gottheit hat in der Natur des Menschen die Moral
angelegt und mit der unsichtbaren Hand und der Sympathie als Prinzip der sittlichen
Richtigkeit Sicherungsmechanismen eingebaut, drum liebt er seinen Nächsten und sich
!75
Stand: 2. April 2014 um 13.35 Uhr.223
Ausgewählte Titel von aktuellen Beitragen der Plattform oekonomenstimme.org zwischen 20. und 28. März 2014: 224
„Das QE-Paradox: QE wird schrittweise beendet und die Zinsen sinken” von Georg Erber, „Wechselkursuntergrenze: Folgt Inflation oder Deflation?” von Tobias Rötheli und „Ein Mindestalter für den Mindestlohn? Eine volkswirtschaftliche Betrachtung” von Justina Fischer.
HÖFFE, OTFRIED: zôon politikon, in: DERS. (HRSG.): Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005.225
selbst. Womöglich würde er sogar sagen: Er liebt seinen Nächsten durch sich selbst.
Ganz gewiss nicht sagt Smith: Liebe dich selbst und sonst nichts.
Es wäre ein Anachronismus Smith Antworten auf die Bedrohungen unserer Zeit in den
Mund zu legen. So hatte Smith weder die systematische Massenvernichtung im 20.
Jahrhundert, noch das Versagen moderner Gesellschaften im Schutz der
außermenschlichen Natur vor Augen. Anlass für eine zugespitzte Sündenlehre scheint
Smith nicht gehabt zu haben. Vor dem Hintergrund der Aufklärung des 17. und 18.
Jahrhundert verwundert das kaum: Er folgt in seiner anti-merkantilistischen
Aufbruchstimmung, im Vertrauen in die intersubjektive Vernunft und die Natur des
Menschen der Mehrheit seiner Zeitgenossen im akademischen Milieu der
angelsächsischen Aufklärung. Und hier ist Smiths Moralphilosophie aus
anthropologischer und theologischer Perspektive tatsächlich angreifbar. Allerdings ist
Smith damit nicht isoliert, sondern im Kontext seiner Zeit samt vielen seiner Kollegen zu
kritisieren. Die Begründung der Kritik müsste deswegen als umfassende Kritik an der
angelsächsischen Aufklärung formuliert und solide belegt sein.
Innerhalb des aufklärerischen Spektrums seiner Zeit ist Smith nicht in die von der
Frühaufklärung geprägte Strömung der heute naiv anmutenden Vernunfteuphorie
einzuordnen. Smith ist vielmehr der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
dominanten und durch Humes Skeptizismus und Kants Vernunftkritik geprägten
Strömung der kritischen Aufklärung zuzurechnen. Insofern überrascht es nicht, dass der
erklärte Protestant Smith durch seine charakteristische Beobachtungsgabe vielen explizit
theistisch geprägten Theologen anthropologisch recht nahe kommt: Mitgefühl, Moral
und Gottesbezug spielen hier wie dort eine wichtige Rolle und hier wie dort finden sich
Versuche, ein integriertes Verständnis von Gemeinwohl und Eigennutz zu finden. Smiths
ökonomische Theorie speist sich maßgeblich aus dem guten Handeln Gottes im
Schöpfungsakt und der daraus resultierenden positiven Anthropologie. Die christliche
Theologie argumentiert neben dem Schöpfungsakt mit dem Wirken Gottes in der Welt in
Jesus Christus. Die christliche Tradition misst diesem Heilsgeschehen besondere
Bedeutung bei, da sie den Menschen als gefallenen versteht, der sich aus seiner Sünde
nicht selbst zu erlösen vermag. Letztlich entwickeln die von der Aufklärung geprägten
Ansätze der liberalen Theologie selbst unter Beibehaltung des Dogmas des gefallenen
Menschen wie Smith positive Anthropologien und verstehen den Menschen als zum
Guten befähigtes, intelligibles Wesen.
!76
Salopp könnte man sagen, Smith wählt eine deistische Abkürzung von der Schöpfung zur
Moral, die meint, auf das Motiv des Sündenfalls und die Erlösung in Jesus Christus
verzichten zu können. Nach den einschneidenden Erfahrungen zweier Weltkriege,
massiver ökonomischen Verwerfungen und der Klimakatastrophe des angebrochenen
Jahrhunderts muss die Feststellung nach der Selbstgefährdung des Menschen und Fragen
des Moral Hazard allerdings neu an Smiths Texte herangetragen werden. Smith, der sich
der historischen Bedingtheit ökonomischer und politischer Kulturen stets bewusst war,
würde heute sicher neue, veränderte Überlegungen anstellen. Diese neuen Überlegungen
allerdings in seine Theorie eigenmächtig einzutragen und Smith für die kontingente
Kontextualität seines Schaffens zu kritisieren, wäre nicht nur anachronistisch, sondern
auch für die Diskussion moderner Wirtschaftsordnungen wenig hilfreich. Gleichsam
töricht wäre es, Smiths Werk seiner Kontextualität wegen ungelesen beiseite zu legen und
sich der auch heute noch beeindruckend erschließenden Kraft seiner philosophischen
Theorie und ökonomischen Lehre prinzipiell zu verschließen. Was wir auch heute noch
von Smith und seiner Wirkungsgeschichte lernen können, fassen die folgenden neun
Thesen zusammen.
D. Zusammenfassende Thesen
1. Ganzheitliche Rezeption: Ohne Blick für Smiths Gesamtwerk hat die Lektüre von
„Wohlstand der Nationen” (1776 veröffentlicht) oft ins Missverständnis geführt. Seine
„Theorie der ethischen Gefühle” (1759 veröffentlicht, bis 1791 mehrfach überarbeitet)
geht seiner Beschreibung ökonomischen Handelns voraus. Das so genannte Adam-
Smith-Problem kann nicht als immanentes Problem der Smithschen Theorie
verstanden werden. Vielmehr setzt sich Smith mit der ambivalenten Struktur der
menschlichen Natur auseinander, insofern sind die Spannungen und Ambiguitäten in
der Natur des Menschen „Adam Smiths Problem” und damit auch heute noch als
wissenschaftliche Herausforderung für eine integrierte, ambiguitätstolerante,
holistische Anthropologie zu verstehen.
2. Empirismus vs. Idealismus: Smiths Moralphilosophie ist pragmatisch an der Wirklichkeit
menschlichen Verhaltens orientiert. Er folgt dem Gedanken: Um sinnvoll zu erkennen,
was sein soll, muss verstanden werden, was ist. Deswegen ist alle Theorie bei Smith
historisch und empirisch unterlegt und dadurch für seine Zeit soziologisch
außergewöhnlich kompetent. Allerdings hat unsere Untersuchung gezeigt, dass Smith
!77
durchaus eine mittlere Position zwischen den Reinformen von Empirismus und
Idealismus bezieht und praktisch durchaus mit einem Vernunftbegriff arbeitet, selbst
wenn er ihn nicht expliziert und immer wieder betont empiristische Grundannahmen
vertritt. Endgültig zu beantworten ist die Beziehung von Empirie und Vernunft bei
Smith nicht, da er keine systematisch klare, erkenntnistheoretische Schrift hinterlassen
hat.
3. Sympathie als Prinzip des Urteilens: Wir urteilen nicht über Handlungen an sich, sondern
vergleichen das beobachtete Gefühl des Handelnden mit dem Gefühl, das wir für uns
selbst in entsprechender Situation antizipieren. Sind diese Gefühle deckungsgleich,
billigen wir die Handlung, fallen sie auseinander, missbilligen wir sie. Eine ausgebildete
Einbildungskraft ist also Voraussetzung für das moralische Bewusstsein und fundiertes
moralisches Urteilen.
4. Urteilskraft und Konstitution der Moralität: Smith verortet die moralische Urteilskraft des
Menschen in seiner Natur und definiert mit der Sympathie als Prinzip der Sittlichkeit
moralisches Urteilen als moralisches Gefühl. Nach der Lektüre Smiths spricht Kant vom
moralischen Geschmack, in dem sich Anschauung und Vernunft treffen. Hume sprach
anders als sein Gesprächspartner Smith nicht nur von einem moralischen Gefühl,
sondern vom moralischen Sinn, dem moral sense. Reid entwickelt dagegen ein Konzept
des common sense, den Arendt später als den politischen Sinn des Menschen und die
Konstitution von Realität interpretiert.
5. Triebfedern des Erwerbstrebens: Neben der Existenzsicherung und materiellem Wohlstand
ist die soziale Anerkennung die kräftigste Triebfeder des Erwerbstrebens. Der Mensch
ist soziales Wesen und nicht ohne sein Bedürfnis nach Lob und Lobenswürdigkeit,
sowie seiner Furcht vor Tadel und Tadelnswürdigkeit zu verstehen. Die Gut- oder
Schlechtheit der individuellen Motive des Erwerbstrebens ist von ihrer Fruchtbarkeit
für die Gemeinschaft entkoppelt. Mit Goethe gesprochen ist das Selbstinteresse „Teil
von jener Kraft, die stets das Böse will, und stets das Gute schafft.”
6. Sozio-politische Dimension der Ökonomie: Nicht die Menge an Arbeit allein ist für Erfolg
entscheidend, sondern vor allem die zugrundeliegende politische Ordnung. Den
Vorteil der Marktwirtschaft sieht Smith in der Freiheit zur Kooperation und der
dynamischen Interaktion der Wirtschaftenden, die durch die Anstrengung für den
eigenen Wohlstand den Wohlstand insgesamt heben. Smith ist sich der Kontextualität
!78
ökonomischer Ordnungen bewusst. Er schärft das Bewusstsein dafür, dass sowohl
politische Rahmenbedingungen, als auch ökonomische Theorie immer kulturell und
historisch geprägt oder sogar bedingt sind. Mit Wallacher lässt sich in der Linie Smiths
sagen: „Menschen wirtschaften nie in abstrakten, sondern immer in konkreten
Gesellschaften mit bestimmten sozio-kulturellen Merkmalen.” 226
7. Wohlverstandenes Selbstinteresse: Ignorante Selbstsucht wird moralisch missbilligt,
desinteressierte Leistungsverweigerung ebenfalls. Moralisch qualifiziert rational ist also
das, was mit Bewusstsein für das kollektive Wohl das eigene Interesse verfolgt. Bei
Smith ist das eigene Schicksal mit dem allgemeinen Wohlstand der Nation eng
verbunden. Das Streben nach eigenem Vorteil geschieht jederzeit in sozialem Kontext.
Hier spielt die göttlich grundgelegte Fähigkeit zur Moral („die unsichtbare Hand”)
zusammen mit menschlich ausgehandelten Regeln der Ethik und des positiven Rechts,
die erklärbar sind aus der Natur des Menschen und dem Prinzip der Billigung und
Missbilligung über das Prinzip der Sympathie.
8. Smiths Deismus: Die Metapher der unsichtbaren Hand erwähnt Smith in Wealth und
Theory nur am Rande. Sie ist aus der deistischen Überzeugung Smiths zu erklären und
als bildhafter Ausdruck für die göttlich grundgelegte Moral im Menschen zu verstehen.
Sie ist keine Metapher für Gleichgewichtstheorien oder Effizienzmarkthypothesen.
Auch Smiths Gravitationsmetapher in seiner Theorie des natürlich Preises ist im Laufe
der Zeit missverstanden worden. Sie ist keine direkte Kopie der Newtonschen Theorie,
sondern eine nur relativ taugliche Illustration der oszillierenden Marktpreise, die um
den üblichen, durchschnittlichen, von Smith als natürlich verstandenen Preis kreisen.
9. Rezeptionsgeschichte: Smiths Werk hat eine bedeutende Rezeptionsgeschichte und die
Grundlagen des ökonomischen Denkens für Jahrhunderte geprägt. Es erfuhr immer
wieder Konjunkturen, Um- und Fehlinterpretationen, die zur reformatorischen
Einsicht ad fontes mahnen. Mit Smith nimmt die Ethik Kurs auf die allgemeine
Kulturphilosophie und untersucht innerhalb derselben die spezifisch ethischen
Beurteilungen und deren Bedeutung und Wirkung für das Ganze des Gemeinlebens. 227
!79
WALLACHER, JOHANNES: Die bleibende Bedeutung der Politischen Ökonomie Adam Smiths. in: 226
HOCHGESCHWENDNER, MICHAEL; LÖFFLER, BERNHARD (HRSG.): Religion, Moral und liberaler Markt. Politische Ökonomie und Ethikdebatten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 105.
TROELTSCH, ERNST: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, 227
Tübingen 1925. S. 426.
VII. Literaturverzeichnis
A. Werkausgaben
BRYCE, J. C. (HRSG.): Adam Smith. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 4), Indianapolis 1985.
CAMPBELL, R. H.; SKINNER, A. S.; TODD, W. B. (HRSG.): Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 2), 2 Bde., Oxford 1976.
ECKSTEIN, WALTHER; BRANDT, HORST D. (HRSG.): Adam Smith. Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. Im Text zitiert als: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010.
KOSEGARTEN, LUDWIG GOTTHARD (HRSG.): Adam Smith. Theorie der sittlichen Gefühle, Leipzig 1791.
MEEK, R. L.; RAPHAEL, D. D.; STEIN, P. G. (HRSG.): Adam Smith. Lectures on Jurisprudence (Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 5), Oxford 1978.
RAUTENBERG, CHRISTIAN GÜNTHER (HRSG.): Adam Smith. Theorie der moralischen Empfindungen, Braunschweig 1770.
SMITH, ADAM: Essays on Philosophical Subjects, London 1822.
STIRNER, MAX (HRSG.): Adam Smith. Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Nationalreichthums, Band I, Leipzig 1846.
RECKTENWALD, HORST CLAUS (HRSG.): Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, München 1978.
WAKEFIELD, EDWARD GIBBON (HRSG.): Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1843.
WIGHTMAN, W. P. D.; BRYCE, J. C.; ROSS, I. S. (HRSG.): Adam Smith. Essays on Philosophical Subjects (Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, Vol. 3), Oxford 1980.
!B. Sekundärliteratur zu Adam Smith: Monographien
ANDREE, GEORG JOHANNES: Sympathie und Unparteilichkeit. Adam Smiths System der natürlichen Moralität, Paderborn 2003.
ASPROMOURGOS, TONY: The Science of Wealth. Adam Smith and the framing of political economy, Oxon 2009.
BALLESTREM, KARL GRAF: Adam Smith, München 2001.
FLEISCHACKER, SAMUEL: A third concept of liberty. Judgement and freedom in Kant and Adam Smith, Princeton 1999.
!80
FORMAN-BARZILAI: Adam Smith and the Circles of Sympathy: Cosmopolitanism and Moral Theory, Cambridge 2010.
HAAKONSSEN, KNUD: The Science of a Legislator: the Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith, Cambridge 1988.
KRAUSE, JENS PATRICK: Immanuel Kant und Adam Smith. Präsenz, Wirkung und Geltung der ‘Theory of Moral Sentiments’ in Kants Werk. Dissertation an der Universität zu Köln, Philosophische Fakultät, Köln 1997.
KUCKLICK, CHRISTOPH: Das unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der Negativen Andrologie, Frankfurt am Main 2008.
LUTERBACHER-MAINERI, CLAUDIUS: Adam Smith - theologische Grundannahmen: eine textkritische Studie, Fribourg 2008.
MEDICK, HANS: Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Soialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Göttingen 1973.
ONCKEN, AUGUST: Adam Smith und Immanuel Kant. Der Einklang und das Wechselverhältnis ihrer Lehren über Sitte, Staat und Wirtschaft. Leipzig 1877.
SMITH, CRAIG: Adam Smith’s Political Philosophy. The Invisible Hand and Spontaneous Order, London, New York 2006.
SCHÄFER, RIEKE: Sympathie und politische Urteilskraft. Zum politischen Denken Adam Smiths, Berlin 2011.
VAIHINGER, HANS: Philosophie des Als Ob, Leipzig 1922.
ZEYß, RICHARD: Adam Smith und der Eigennutz. Tübingen 1889.
!C. Sekundärliteratur zu Adam Smith: Aufsätze und Artikel
BERRY, CHRISTOPHER J.: Smith and Science. in: HAAKONSSEN, KNUD (HRSG.): The Cambridge Companion to Adam Smith, Cambridge 2006. S. 112-135.
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: I, in: Journal of Political Economy, Vol. 48, No. 4, Chicago 1940.
BITTERMANN, HENRY: Adam Smith’s Empiricism and the Law of Nature: II, in: Journal of Political Economy, Vol. 48, No. 5, Chicago 1940.
BROWN, VIVIENNE: Moralische Dilemmata und der Dialogismus von Adam Smiths Theorie der moralischen Gefühle. in: FRICKE, CHRSITEL; SCHÜTT, HANS-PETER (Hrsg.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 190-213.
DIE ZEIT: Auf der Suche nach Adam Smith, 14. August 2013, Nr. 34.
ECKSTEIN, WALTHER: Einleitung des Herausgebers. in: SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 2010. S. XI-LXXI.
!81
FLEISCHACKER, SAMUEL: Philosophy in Moral Practice: Kant and Adam Smith. in: Kant-Studien, Jg. 82, Nr. 3, Berlin 1991. S. 249-269.
KÜHNEMUND, BURKHARD: Über den Widerspruch von religiöser Hoffnung und politischer Analyse in Adam Smith Theorie des freien Marktes, abrufbar unter: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/23096 (Stand: 11. September 2013 um 19.03 Uhr).
MONTES, LEONIDAS: Adam Smith: real Newtonian. in: DOW, ALEXANDER; DOW, SHEILA (HRSG.): A History of Scottish Economic Thought, Oxon 2006.
OTTESON, JAMES R.: Adam Smith und die Objektivität moralischer Urteile: Ein Mittelweg. in: FRICKE, CHRISTEL; SCHÜTT, HANS-PETER (HRSG.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 15-32.
OVERHOFF, JÜRGEN: Adam Smiths Menschenbild und Wirtschaftstheorie. Ist das Adam-Smith-Problem wirklich gelöst? in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Nr. 1. S. 181-191, Berlin 2005.
PATZEN, MARTIN: Zur Diskussion des Adam-Smith-Problems – Ein Überblick. in: ULRICH, PETER; MEYER-FAJE, ARNOLD (HRSG.): Der andere Adam Smith, Bern 1991.
PRISCHING, MANFRED: Adam Smith und die Soziologie - Zur Rezeption und Entfaltung seiner Ideen. in: KURZ, HEINZ D. (HRSG.): Adam Smith (1723-1790). Ein Werk und seine Wirkungsgeschichte, Marburg 1991. S. 53-90.
RUCKRIEGEL, KARLHEINZ: Der Homo oeconomicus - Ein realitätsfernes Konstrukt. in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bd. 120, Bonn 2009. S. 49-55.
SINGER, BRIAN C. J.: Montesquieu, Adam Smith and the Discovery of the Social. in: Journal of Classical Sociology, Nr. 4, Thousand Oaks 2004. S. 31-57.
SOLOMON, ROBERT C.: Sympathie für Adam Smith. Einige aktuelle philosophische und psychologische Überlegungen. in: FRICKE, CHRISTEL; SCHÜTT, HANS-PETER (HRSG.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 251-276.
VON VILLIEZ, CAROLA: Sympathetische Unparteilichkeit: Adam Smiths moralischer Kontextualismus. in: FRICKE, CHRISTEL; SCHÜTT, HANS-PETER (HRSG.): Adam Smith als Moralphilosoph, Berlin 2005. S. 64-87.
WALLACHER, JOHANNES: Die bleibende Bedeutung der Politischen Ökonomie Adam Smiths. in: HOCHGESCHWENDNER, MICHAEL; LÖFFLER, BERNHARD (HRSG.): Religion, Moral und liberaler Markt. Politische Ökonomie und Ethikdebatten vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. S. 89-105.
WITZTUM, AMOS: Social circumstances and rationality: some lessons from Adam Smith why we may not all be equally sovereign. in: American Journal of Economics and Sociology, Volume 64, Issue 4, Hoboken 2005. S. 1025-1047.
!D. Ergänzende Primärliteratur
!82
ARISTOTELES: Metaphysik, Hamburg 2010 (6. Auflage).
ARENDT, HANNAH: Denktagebuch, 2. Bde., München 2002.
BELLAH, ROBERT N.: Civil Religion in America. in: Dædalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 96, Nr. 1, Cambridge 1967. S. 1-21.
BELLAH, ROBERT N.: The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial, Chicago 1992.
CARNAP, RUDOLF: Der logische Aufbau der Welt, Hamburg 1999.
DE MANDEVILLE, BERNARD: Die Bienenfabel, oder: Private Laster, öffentliche Vorteile (Auszüge), in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 28-40.
Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Standardausgabe; revidierte Fassung von
1984, Stuttgart 1985.
FRANKLIN, BENJAMIN: The Autobiography of Benjamin Franklin (Dover Thrift Editions), Mineola 1996.
FRIEDMAN, MILTON; FRIEDMAN, ROSE: Chancen, die ich meine. Ein persönliches Bekenntnis (Auszug), in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 130-154.
HABERMAS, JÜRGEN: Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft. in: DERS.: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main 2009.
HABERMAS, JÜRGEN: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main 1983.
HABERMAS, JÜRGEN: Religion und nachmetaphysisches Denken. Eine Replik. in: DERS.: Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 2012.
HABERMAS, JÜRGEN: Theorie des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt am Main 1981.
HEISENBERG, WERNER: Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science, New York 2007.
HERDER-DORNEICH, PHILIPP: Der Sozialstaat in der Rationalitätenfalle: Grundfragen der sozialen Steuerung, Stuttgart 1982.
JASPERS, KARL: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Frankfurt am Main, Hamburg 1955.
JODL, FRIEDRICH: Lehrbuch der Psychologie, Band II, Stuttgart/Berlin 1903.
KANT, IMMANUEL: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie, Berlin 1900ff.
KANT, IMMANUEl: Kritik der reinen Vernunft, Riga 1787.
!83
KANT, IMMANUEL: Kritik der Urteilskraft, Hamburg 2009.
MÜLLER-ARMACK, ALFRED: Gedanken zu einer sozialwissenschaftlichen Anthropologie. in: KARRENBERG, FRIEDRICH; ALBERT, HANS (HRSG.): Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard Weisser, Berlin 1963. S. 3-16.
PAINE, THOMAS: Common Sense, London 2004.
POPPER, KARL: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Teil 1: Der Zauber Platons, München 1957.
POPPER, KARL: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Teil 2: Falsche Propheten: Hegel, Marx und die Folgen, München 1958.
REID, THOMAS: Untersuchungen über den menschlichen Geist nach Prinzipien des gesunden Menschenverstandes, Leipzig 1782.
RICARDO, DAVID: Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung (Auszug), in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 69-82.
SCHELER, MAX: Wesen und Formen der Sympathie, Frankfurt am Main 1948.
TANNER, KLAUS: Der lange Schatten des Naturrechts. Eine fundamentalethische Untersuchung, Stuttgart 1993.
TETLOCK, PHILIP E.: Expert Political Judgment: how good is it? How can we know, Princeton 2005.
TILLICH, PAUL: Dynamics of Faith, New York 1957.
VON GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Werke - Hamburger Ausgabe, Band III, Dramatische Dichtungen I, Faust I, München 1982, S. 47.
VON HAYEK, FRIEDRICH ALBERT: Die Verfassung der Freiheit, (4. Auflage) Tübingen 2005.
WEBER, MAX: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. in: DERS.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Band I, Tübingen 1920. S. 17 - 206.
WELKER, MICHAEL: Gottes Offenbarung, Neukirchen 2012.
WELTHUNGERHILFE (HRSG.): Hunger. Ausmaß, Verbreitung, Ursachen, Auswege, Bonn 2005.
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus Logico-philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, Frankfurt am Main 2003.
!E. Ergänzende Sekundärliteratur
ALBERT, HANS: Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer Beleuchtung. in: KARRENBERG, FRIEDRICH; ALBERT, HANS (HRSG.): Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard Weisser, Berlin 1963. S. 45-78.
!84
DOBELLI, ROLF: Die Kunst des klaren Denkens, München 2011.
ETTEL, ANJA; JOST, SEBASTIAN: Der ungehörte Chefökonom der Deutschen Bank, in: WELT ONLINE, abrufbar unter: http://www.welt.de/wirtschaft/article110882633/Der-ungehoerte-Chefoekonom-der-Deutschen-Bank.html (abgerufen am: 4. Juni 2014 um 13.53 Uhr).
FOURIE, WILLEM: Von der Freiheit eines Christenmenschen. Eine südafrikanische Interpretation von Freiheit in der Theologie Wolfgang Hubers. in: BEDFORD-STROHM, HEINRICH; NOLTE, PAUL; SACHAU, RÜDIGER (HRSG.): Kommunikative Freiheit. Interdisziplinäre Diskurse mit Wolfgang Huber. S. 150-174.
GAUSTAD, EDWIN S.; SCHMIDT, LEIGH: The Religious History of America: The Heart of the American Story from Colonial Times to Today, New York 2004.
GIDE, CHARLES: Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, Jena 1913.
GRAEBER, DAVID: Schulden. Die ersten 5000 Jahre, München 2014.
GRÖSCHNER, ROLF: Der homo oeconomicus und das Menschenbild des Grundgesetzes. in: ENGEL, CHRISTOPH; MORLOK, MARTIN (HRSG.): Öffentliches Recht als ein Gegenstand ökonomischer Forschung, Tübingen 1998.
HÄRING, NORBERT: Das INET von George Soros - Instrument zur Weltverbesserung oder trojanisches Pferd der Finanzoligarchie? abrufbar unter: http://www.norberthaering.de/index.php/de/newsblog2/27-german/news/67-das-inet-von-george-soros-instrument-zur-weltverbesserung-oder-trojanisches-pferd-der-finanzoligarchie (Stand: 18. Juni 2014 um 18.40 Uhr).
HUBER, WOLFGANG: Der Protestantismus und die Ambivalenz der Moderne. in: MOLTMANN, JÜRGEN (HRSG.): Religion der Freiheit. Protestantismus in der Moderne, München 1990. S. 29-65.
HUTCHISON, TERENCE WILMOT: Before Adam Smith: the Emergence of Political Economy, 1662–1776, Oxford 1988.
JODL, FRIEDRICH: Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, Stuttgart/Berlin 1930.
KUNZMANN, PETER (u.a.): dtv-Atlas Philosophie, München 2009 (14. Auflage).
LEIDHOLD, WOLFGANG: Einleitung. Liebe, Moralsinn, Glück und Civil Government. Anmerkungen zu einigen Zentralbegriffen bei Francis Hutcheson. in: DERS. (HRSG.): Francis Hutcheson: Eine Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Tugend, Hamburg 1986.
MARGUIER, ALEXANDER: Ökonomie ist eigentlich keine Wissenschaft, Gespräch mit Claus Peter Ortlieb, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 9. Mai 2010.
ORTLIEB, CLAUS PETER: Markt-Märchen. Zur Kritik der neoklassischen akademischen Volkswirtschaftslehre und ihres Gebrauchs mathematischer Modelle, in: EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft, Heft 1, Bad Honnef 2004. S. 166-183.
ORTLIEB, CLAUS PETER: Mathematisierte Scharlatanerie. Zur ‘ideologiefreien Methodik’ der neoklassischen Lehre, in: DÜRMEIER, THOMAS; VON EGAN-KRIEGER, TANJA;
!85
PEUKERT, HELGE (HRSG.): Die Scheuklappen der Wirtschaftswissenschaft. Postautistische Ökonomik für eine pluralistische Wirtschaftslehre, Marburg 2006.
ORTLIEB, CLAUS PETER: Methodische Probleme und methodische Fehler der mathematischen Modellierung in der Volkswirtschaftslehre, in: Hamburger Beiträge zur Modellierung und Simulation, Heft 18, Hamburg 2004. S. 1-22.
PASINETTI, LUIGI L.: Continuity and Change in Sraffa’s Thought: an Archival Excursus, in: COZZI, TERENZIO; MARCHIONATTI, ROBERTO: (HRSG.): Piero Sraffa’s Political Economy: a Centenary Estimate, London 2001. S. 139-156.
PFLEIDERER, EDMUND: Empirismus und Skepsis in David Humes Philosophie als abschließende Zersetzung der englischen Erkenntnislehre, Moral und Religionswissenschaft, Berlin 1874
POLANYI, KARL: Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft, in: HONNETH, AXEL; HERZOG, LISA (HRSG.): Der Wert des Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014. S. 268-305.
SCHERER, GEORG: Sinn und Sein bei Thomas von Aquin in Wirklichkeit und Sinnerfahrung. in: HÜNTELMANN, RAFAEL (Hrsg.): Grundfragen der Philosophie im 20. Jahrhundert, Herford 1998.
SCHMIDT-SALOMON, MICHAEL: Das „Münchhausentrilemma" oder: Ist es möglich, sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen? in: Aufklärung und Kritik, Sonderheft 5 (2001).
TANNER, KLAUS: „Ein verstehendes Herz”. Über Ethik und Urteilskraft, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik, 56. Jg., S. 9-23, Gütersloh 2012.
TROELTSCH, ERNST: Der Deismus. in: DERS.: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 429 - 487.
TROELTSCH, ERNST: Die englischen Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts. in: DERS.: Gesammelte Schriften, Band IV: Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Tübingen 1925. S. 374-394.
VON RAUCHHAUPT, ULF: Kurt Gödel. Der Herr Professor und die Wahrheit, in: Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 23. April 2006.
!F. Lexikonartikel
HÖFFE, OTFRIED: zôon politikon, in: DERS. (HRSG.): Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005.
SPRINGER GABLER VERLAG (HRSG.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Institutionalismus, abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/11577/institutionalismus-v8.html (Stand: 18. Juni 2014 um 16.43 Uhr).
SPRINGER GABLER VERLAG (HRSG.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marktversagen, abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marktversagen.html (Stand: 18. Juni 2014 um 16.59 Uhr).
!86
SPRINGER GABLER VERLAG (HRSG.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Regulationstheorie, abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9354/regulationstheorie-v7.html (Stand: 18. Juni 2014 um 16.55 Uhr).
!G. Links
Insitute for New Economic Thinking: http://www.ineteconomics.org.
International Student Initiative for Pluralism in Economics: http://www.isipe.net.
Occupuy Wall Street: http://www.occupywallst.org.
Plattform Ökonomenstimme: http://www.oekonomenstimme.org.
!!
!87
VIII. Erklärung
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter
Zuhilfenahme der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Sämtliche Stellen, die dem
Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken, gegebenenfalls auch elektronischen
Medien, entnommen sind, sind durch Angabe der Quellen als Entlehnungen kenntlich
gemacht. Mir ist bekannt, dass eine unwahrheitsgemäße Erklärung als
Täuschungsversuch zu gewertet wird.
München, 5. August 2014
!Unterschrift: .................................................................
!88