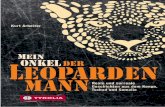Helmut Galle „Wahrhaftige Geschichten “ – die Historia im Entstehungskontext von Roman und
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Helmut Galle „Wahrhaftige Geschichten “ – die Historia im Entstehungskontext von Roman und
Helmut Galle
„Wahrhaftige Geschichten“ – die Historia im Entstehungskontext von Roman und
Autobiographie: Faustbuch, Wagnerbuch und Hans Staden
„Historia“ nennen sich sowohl der Reisebericht des Hans Staden (1557) als auch die Bücher von Dr. Faust (1587) und seinem Famulus Wagner (1593). Alle drei beanspruchen damit „Tatsachengehalt“, Faktualität, während aus heutiger Sicht nur das Buch Stadens als faktual gelten kann, die beiden Magierbücher da-gegen als Vorformen des Romans eingestuft werden. Der Artikel untersucht die narrativen und paratextuellen Strategien, mit denen die Autoren den faktualen Status ihrer Bücher geltend zu machen versuchen. Ziel ist, Elemente zu identifi-zieren, in denen sich schon hier die Differenz von fiktionalem bzw. faktualem Lektürepakt ankündigt, die bis in die Gegenwart die Rezeption von erzählender Prosa steuert. Roman, Reisebericht, Fiktionalität, Faktualität, Frühe Neuzeit, Neue Welt.
“Truthful (hi)stories” – the Historia in the Origins of the Novel and the Autobiography: Faustbuch, Wagnerbuch and Hans Staden
“Historia” is the name given to the travelogue by Hans Staden (1557) as well as to the Faustbuch (1587) and the Wagnerbuch (1593). By this title they all claim factuality, although from our perspective only Staden’s text could be treated as factual, since the two magicians’ books are considered early forms of the genre of the novel. This article examines the narrative and paratextual strategies used by the authors to stress the factual status of their books. The objective is to iden-tify elements which prefigure the difference between the fictional and factual pact of reading, a distinction that has shaped the reception of narrative prose until the present day. Novel, Travelogue, Fictionality, Factuality, Early modern period, New World.
1. Historia
Die Bezeichnung „Historia“ wird im 15. und 16. Jahrhundert für die un-terschiedlichsten Texte verwendet: „Chroniken, Fürstenspiegel, Legen-den, Novellen oder Reisebeschreibungen“ können nach Manuel Braun (2004: 317) diesen Titel tragen, „was durch einen gemeinsamen An-spruch gedeckt ist: den auf ‚Tatsachenwahrheit‘, und zwar weniger im Sinne von Exaktheit oder Nachprüfbarkeit, sondern von Relevanz für die eigene Gegenwart“. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts entwickelt sich im Feld der Historia der Prosaroman und mit ihm auch ein „Fiktionalitätsbe-wusstsein“, das allmählich in das moderne Verständnis von Fiktion ein-
Helmut Galle
8
mündet.1 Die Differenzen der Frühen Neuzeit zur Moderne stecken wahr-scheinlich nicht nur in der unterschiedlichen Erwartung an die Texte selbst, sondern auch in den von vornherein anderen Vorstellungen von Realität und Geschichte, die ihrerseits natürlich wieder mit der materiel-len Form und Verfügbarkeit von Texten und unterschiedlichen Verifizie-rungsstrategien für Informationen zusammenhängen. Dass die Differen-zierung von Geschichte und Fiktion im 16. Jahrhundert ihren Ausgang genommen hat, dürfte mit dem Medienwechsel von der Handschrift zum Buch und mit der massenhaften Produktion von Texten verknüpft sein – wie in der griechischen Antike die allmähliche Differenzierung von poie-sis und historia mit dem Wechsel von der mündlichen zur schriftlichen Tradierung verbunden ist (vgl. Rösler 1980).
Das Realitätsverständnis von Menschen des 16. Jahrhunderts konnte bekanntlich auch bei ‚Akademikern‘ wie Martin Luther den Glauben an materielle Manifestationen des Teufels im Hier und Jetzt umfassen. Dies gilt um so mehr für die später als ‚Volksbücher‘ bezeichneten Texte, die sich in der Volkssprache an weniger gebildete, sogar nicht alphabetisierte Schichten richten: dieses Publikum verstand die Wundertaten, Feen und Fabeltiere der zeitlich und räumlich entrückten Historien von Troja, Ale-xander und Melusine Jan-Dirk Müller zufolge (1990: 993), „als ‚res fac-tae‘, als Geschichte. Sie werden nicht als tatsächlich geschehen bloß ge-glaubt, sondern Erzähler, Vorredner, Drucker bemühen sich um Verifika-tion“. Die Verifikation ist prinzipiell zunächst nur eine textuelle Strate-gie, mit der die Leser überzeugt werden sollen, und es bleibt offen, ob der Autor diese Strategie im guten Glauben an ihre Berechtigung verfolgt oder ob er sie als bewusste Täuschung des Lesers in Szene setzt. Im Ver-lauf des 16. Jahrhunderts wagen es dann Autoren, die Erfundenheit eines Plots offen zugeben und dieser eine positive Qualität zuzuschreiben, in-dem sie einen anderen Modus von Wahrheitsgehalt für ihre Fiktionen re-klamieren, so z.B. im Fortunatus, in Wickrams Prosaromanen und – auch in metanarrativer Form – in seinem Dialog zum Knabenspiegel.2
2. Roman und Autobiographie
Die drei hier behandelten Texte wurden der zweiten Hälfte des sechzehn-ten Jahrhunderts gedruckt, alle mit der Bezeichnung Historia. Die halb bzw. ganz erfundenen Lebensgeschichten von den Magiern Dr. Faust 1 „Doch stehen diese Adaptationen [älterer Erzählstoffe im Prosaroman des 16. Jahrhun-
derts] mit einigem Recht an der Spitze der Gattung Roman, weil in ihnen sich, in Abkehr von mittelalterlichen Erzähltraditionen, Ansätze für ein Fiktions- und Realitätsverständnis, für literarische Verfahren und Funktionen ausbilden, wie sie für den Roman des 17. und 18. Jahrhunderts konstitutiv werden.“ (Müller 1990: 991)
2 Vgl. Müller 1990: 995; Röcke 2004: 501ff.; Haferland 2007.
„Wahrhafte Geschichten“
9
(„Faustbuch“ 1587) und seinem Famulus Wagner („Wagnerbuch“ 1593) erscheinen aus heutiger Sicht fiktional, romanhaft, der Reisebericht Hans Stadens dagegen („Warhaftige Historia“ 1557) wird allgemein als auto-biographisch eingestuft. Wenn man annimmt, dass die Ausdifferenzie-rung der „Historia“ in fiktionale und faktuale Erzählungen sich in dieser Zeit bereits bemerkbar machen sollte, dann wäre der Blick vor allem auf die Art und Weise zu richten, in der die Autoren sich mit ihren Lesern über den Status des Mitgeteilten verständigen, also auf die Paratexte und metanarrativen Äußerungen. Bedeutsam wäre zweifellos auch die Wahl der spezifischen Erzählstruktur,3 denn das unmittelbarste Erzählverhalten einer autobiographischen Stimme wäre eine autodiegetische Position mit interner Fokalisierung,4 während der Autor von expliziten Fiktionen seine Stimme „natürlicherweise“ einem heterodiegetischen Erzähler geben würde, der über alle seine Geschöpfe in gleicher Weise verfügen könnte (auktoriale Fokalisierung).5 Im Folgenden soll daher untersucht werden, ob sich in den drei Büchern Indizien finden für unterschiedliche Strate-gien zur Markierung von Fiktionalität bzw. Faktualität.
Der Reisebericht Hans Stadens soll hier als Untergattung des autobio-graphischen Feldes und anstelle der „eigentlichen“ Autobiographie be-trachtet werden. Zwar findet sich im 16. Jahrhundert schon eine Reihe von Autobiographien oder zumindest von umfangreichen narrativen ‚Selbstzeugnissen‘6 (Wenzel 2004: 573; Velten 1995), die auch vereinzelt den Titel „historia“ tragen,7 aber es handelt sich mit wenigen Ausnahmen nicht um Schriften, die für den Druck bestimmt sind und die daher in ei-nem anderen medialen und rezeptionellen Umfeld stehen. Zwar lassen sich diese Texte möglicherweise – mit Misch (1969) – als geistesge-schichtliche Dokumente der Subjektwerdung oder – mit Wenzel (2004: 573) – als sozialgeschichtlicher Indikator für den „Umbruch der Selbst-deutungsmuster“ im Zuge städtischer und ländlicher Differenzierungspro-zesse deuten, aber beides übersieht den spezifischen Ort in der „literari-schen“ Kommunikation. Denn die Lebensbeschreibungen der Sastrow,
3 Dorrit Cohn (1999) hat in The Distinction of Fiction gezeigt, dass die meisten gedruckten
Prosatexte durchaus spezifische Merkmale aufweisen, die den Leser unmittelbar darüber orientieren, ob es sich um fiktionale oder faktuale Erzählungen handelt.
4 Die Terminologie folgt Genette (1998). 5 Zwar lassen sich sowohl im Roman wie in der Autobiographie schon bald Imitationen der
jeweils in der anderen Gattung vorherrschenden Erzählstruktur antreffen, aber für diese frühen Zeugnisse kann man wohl von einem verhältnismäßig naiven Gebrauch dieser Mit-tel ausgehen.
6 Da man den Autobiographiebegriff für die gattungsprägenden Werke ab der Mitte des 18. Jahrhunderts reservieren will, hat sich Wenzel (2004: 680) zufolge eingebürgert, für die äl-teren Texte den Begriff „Selbstzeugnis“ zu verwenden.
7 Sastrow, Bartholomäus. Historia von Herkommen, Geburt und Lauf seines ganzen Lebens (1823-26), siehe auch Misch IV, 2: 619.
Helmut Galle
10
Platter, Schweinichen und Berlichingen hat man zumeist erst Jahrhunder-te später als historische Dokumente ‚publiziert‘; geschrieben – oder dik-tiert – wurden sie in einem Kontext, der noch eher von Mündlichkeit und face-to-face-Kommunikation geprägt ist: im Kreis der Familie und der Schüler, im Hinblick auf die Nachkommen, als Bestandteil einer Chronik des Geschlechts oder des Gemeinwesens, dem man angehört hat.8 Als Handschriften werden sie gelesen von den Verwandten, Freunden und Mitbürgern, die alle in einem engen lebensweltlichen Kontakt zum Ver-fasser stehen. Unter diesen Bedingungen bedarf der Autor keiner speziel-len Strategien, um seine Existenz und Vertrauenswürdigkeit abzusichern, wie dies angesichts einer Öffentlichkeit auf dem anonymen Markt der deutschsprachigen Buchproduktion der Fall wäre. Seine Aussagen bezie-hen sich auf einen räumlichen und zeitlichen Referenzrahmen, der seinen Adressaten so vertraut ist wie ihm selbst. Die Referenzobjekte stehen nicht in Zweifel, allenfalls die über sie gemachten Aussagen; doch auch diese Aussagen können gemessen werden an denen, die andere zu den je-weiligen Gegenständen gemacht haben und machen könnten.9
Dies gilt nicht für gedruckte Reiseberichte wie den Stadens. Die bis dahin meist relativ unbekannten Autoren wenden sich von vornherein an ein großes Publikum, das Buch löst die Erzählung von der physischen Quelle des Erzählens ab und bedarf eines textuell vermittelten Ersatzes für die vertrauensbildende face-to-face-Situation. Denn der Reisebericht als Mitteilung des Unbekannten und Neuen bedarf des konkreten Erle-bens und des Erinnerns durch ein Subjekt, das für die von ihm bezeugten Erlebnisse einsteht – so wie das erzählende Subjekt der Autobiographie als Zeuge seiner Gedanken, Gefühle und Erinnerungen einstehen muss. Horst Wenzel ordnet Autobiographie und Reisebeschreibung (trotz des Unterschiedes der wahrgenommenen Weltausschnitte) einem gemeinsa-men „subliterarischen“ Typus zu: „Beide Erzählformen gehören nicht zur ‚schönen Literatur‘, sondern zur Gebrauchsprosa, vertreten einen Typus von Literatur, der im Übergang von der Erfahrung zur ästhetischen Erfin-dung stehen bleibt.“ (Wenzel 2004: 573) Mit Blick auf das Medium des Buchdrucks wäre hier erneut zu differenzieren, denn der Text Stadens nä-
8 Vgl. hierzu die verschiedenen von Wenzel behandelten Texte; sein Resümee zur Autobio-
graphie im 16. Jahrhundert kommt zu dem Ergebnis, dass diese vorrangig in einer von Ge-meinschaft geprägten Kommunikation verortet war: „der Publikumsbezug bleibt zunächst sehr begrenzt: Gedacht ist häufig nur an die unmittelbaren oder mittelbaren Nachkommen und Verwandten, die Darstellung des öffentlichen Lebens bleibt derart der Veröffentli-chung weitgehend entzogen“ (2004: 595).
9 Vgl. zu diesen Begriffen und ihrem referenztheoretischen Bezugsrahmen Robert Bran-doms (2000) Entwurf einer Sprachphilosophie, mit der die pragmatische Unterscheidung von faktualen und fiktionalen Texten auf eine neue Basis gestellt werden kann (hierzu: Galle 2005).
„Wahrhafte Geschichten“
11
hert sich zweifellos jenen Texten, die sich im 16. Jahrhundert der späte-ren Rubrik „schöne Literatur“ zuordnen ließen.
3. Hans Stadens Reisebericht aus Brasilien
Im Unterschied zu den mysteriösen anonymen Verfassern des „Faustbu-ches“ und des „Wagnerbuches“ war Hans Staden ein zwar unbekannter Mann, aber doch einer, den man kennenlernen konnte. Die 1557 erschie-nene Warhaftig Historia vnd beschreibung eyner Landtschafft der Wilden / Nacketen / Grimmigen Menschfresser Leuthen / in der Newenwelt Ameri-ca gelegen […] nimmt schon im Titel eine klare Referentialisierung vor und verortet ihren Verfasser „Hans Staden von Homburg auß Hessen“, der die dargestellten Ereignisse und Sachverhalte „durch sein eygne erfa-rung erkant / vnd yetzo durch den truck an tag gibt“ (Staden 2007). Dass man die Authentizität seines Textes anzweifeln konnte,10 erscheint ange-sichts der Dichte und Genauigkeit von topographischen, anthropologi-schen, linguistischen und biologischen Details schwer glaublich.11 Sicher-lich zielt der sensationsträchtige Titel auch auf hohe Verkaufszahlen, und ein solches Kalkül wird offenbar bestätigt von der weiten Verbreitung des Buches (Obermeier 2007: II). Aber obwohl Staden ähnlich wundersame Dinge zu erzählen hat wie die beiden Magierbücher, bemüht er sich deut-lich stärker und auf andere Weise um die Absicherung seines Wahrheits-anspruches.
Für deutsche Leser, zumal für das Laienpublikum, an das sich ein „populäres abenteuerliches Volksbuch“ (Obermeier 2007: III) vorrangig gerichtet haben dürfte, waren die Nachrichten aus der Neuen Welt auch nach einem halben Jahrhundert noch wunderlich genug, um eine beson-dere Beglaubigung des Zeugnisses erforderlich erscheinen zu lassen. Das gilt zumal für diesen unwahrscheinlichen Fall, dass ein deutscher Christ über neun Monate unter brasilianischen Indianern – Kannibalen gar – ge- 10 „Die neuere Forschung hat an der Authentizität von Stadens Bericht erhebliche Zweifel
geäußert, und wenn man die Entstehungsbedingungen des Werks betrachtet, sind diese auch nur zu berechtigt: Stadens Werk wurde herausgegeben von dem Marburger Anato-mieprofessor Dryander, der vermutlich gerade jene Gefangenschaftspassagen bearbeitet und mit Hilfe seiner Literaturkenntnis ausgeschmückt hat. Daraus würde sich erklären, wa-rum Stadens Bericht in wesentlichen Punkten mit den Kannibalismusdarstellungen in den früheren Amerikabeschreibungen übereinstimmt. Dryander dürfte das Werk noch mit wei-terem humanistischen Zierat ausgestaltet haben: So darf auch bei ihm ein Stamm von Amazonen im brasilianischen Urwald nicht fehlen.“ (Wolf 2004: 522) Dazu muss man wohl sagen: Wenn man (aus welchen Gründen auch immer) um keinen Preis an die Mög-lichkeit von Kannibalismus glauben will, bleiben in der Tat keine anderen Erklärungen üb-rig als die intertextuellen Beziehungen. Es gibt freilich noch eine Welt außerhalb der Bü-cher, und Brasilien ist – damals wie heute – zweifellos ein Teil von ihr.
11 Vgl. etwa das Vorwort von Franz Obermeier (Staden 2007) und seine Angaben zum histo-rischen (III-XII) und ethnologischen Hintergrund (XII-XVI).
Helmut Galle
12
lebt und sich in dieser Zeit weitgehend an ihre Sitten und Gebräuche hat anpassen müssen. Ginge es hier um eine unterhaltsame Reiseabenteuer-geschichte, die im geographischen Kontext der Alten Welt bzw. der euro-päischen Mythentradition angesiedelt wäre würde kaum derselbe Auf-wand mit der Identität des Autors und der Beglaubigung seiner Augen-zeugenschaft getrieben. Der Autor gibt selbst lapidar zu, „das der innhalt dieses büchlins etlichen wirt frembd beduncken. Wer kann da zuo.“ (Sta-den 2007: 176) Was er zu berichten hat, ist aber vor dem Horizont tra-dierten Wissens so ungewöhnlich, dass man es nicht beim schieren Er-zählen und der bloßen Beteuerung der Augenzeugenschaft belassen kann, sondern den Leser mit exakteren Angaben über die Quellen und die Ko-härenz mit seinem Weltmodell zufriedenstellen muss. Ist dieser referen-tielle Rahmen aber sichergestellt, dürfen Autor und Leser das Fremde ge-trost als Faktum anerkennen.
Um den Leser seine Identität als Autor zu versichern, gibt Staden nicht nur den Druckort (Marburg), seine eigene Herkunft (Homberg) und seinen Aufenthaltsort an (Wolfhagen in Hessen). Er widmet sein Buch mit dem Landesfürsten Philipp von Hessen einer hohen Autorität und bit-tet außerdem einen Gelehrten der Marburger Universität um ein Vorwort und die gegebenenfalls nötige Korrektur seines Berichts, denn als einfa-cher Mann verfügt er zwar über Erfahrungen, aber nicht unbedingt über das Wissen, diese angemessen auszusprechen und einzuordnen.
Der Humanist und Anatomieprofessor Johann Dryander tut freilich noch mehr. Er diskutiert im Vorwort seine Beweggründe, Stadens Erzäh-lung Vertrauen zu schenken. Da geht es nicht wie bei Faust und Wagner um kontextlose Schriftstücke, die angeblich wörtlich zitiert werden und damit eine rhetorische Basis für das Gedruckte abgeben, sondern um ei-nen Augenzeugen und die Bedingungen seiner Glaubwürdigkeit. Die Ma-gierbücher bemühen mit der Berufung auf schriftliche Dokumente noch die mittelalterliche Aura des (seltenen) Schriftstücks und der Überset-zung. Im Zeitalter des massenhaften Buchdrucks ist die Tatsache an sich, dass etwas verschriftet wurde und als „Dokument“ vorliegt, entwertet. Worauf es nunmehr ankommt, ist die Überprüfbarkeit des Inhalts; diese basiert auf seiner Kompatibilität mit den bekannten Fakten und auf der Verifizierbarkeit der Quelle. Solche Angaben werden in Titel, Widmung und Vorrede dem Buch mitgegeben, Vorläufer des Paratextes, der bis in unsere Gegenwart die Brückenfunktion zwischen Text und Realität über-nimmt und den fiktionalen oder faktualen Status des Mitgeteilten steuert.
Dryander führt in seiner Vorrede als erstes Argument die Lebenser-fahrung an: Er kannte den Vater Stadens von Kind auf und geht davon aus, dass der Sohn ein ehrlicher Mann geblieben ist, wie der Vater (3). Das Zeugnis des Professors kompensiert hier die Anonymität des Buch-
„Wahrhafte Geschichten“
13
markts, indem er seine persönliche Kenntnis der Familie Stadens einsetzt, um die Glaubwürdigkeit des Autors zu stützen. Das zweite Argument be-trifft den Inhalt: eine Vielzahl der erzählten Details fällt in seinen Kom-petenzbereich (Mathematik, Kosmographie, Geographie) (3) und wird hinsichtlich seiner Kohärenz mit wissenschaftlicher Erkenntnis im Ver-lauf abgesichert (6f.).12 Drittens schreibe der Autor „seine Historia und wegefarth / nicht aus anderer leut anzeygung / sonder aus seiner eygen er-farung grüntlich und gewis“ (4). Viertens sei die manifeste Funktion des Buches nicht die egoistische Ruhmsucht des Autors, sondern sein Bedürf-nis, die göttliche Errettung aus der Not zu bezeugen und ihr zu danken. Fünftens ist der Text in einfacher Sprache, ohne rhetorischen Aufwand vorgetragen (4). Sechstens ist der Autor ortsfest, jederzeit greifbar und könnte durch weitere Augenzeugen (Heliodorus Hessus) im Zweifelsfall der Lüge überführt werden (5). Dass Staden sich und seinen guten Ruf diesem Risiko (ohne Not) ausgesetzt hat, ist für Dryander ein letztes un-trügliches Zeichen für die Aufrichtigkeit des Autors.13
Dryanders Argumente begründen seine eigene Entscheidung, sollen aber zugleich den Leser veranlassen, die ungewöhnlichen Nachrichten aus Brasilien nicht als Lügenbericht aufzunehmen, wie dergleichen viele in Umlauf sind. Natürlich folgt die „Beweisführung“ den Regeln der Rhetorik, wie alle Texte jener Zeit, was aber ihre Ernsthaftigkeit durch-aus nicht schmälert. Es ist auch keineswegs trivial, dass Dryander auf der Bekanntheit der Familie und der Sesshaftigkeit des Autors insistiert, denn gerade diese Elemente sind es, welche die Glaubwürdigkeitskriterien der face-to-face-Kommunikation in die Bedingungen des anonymen Buch-markts überführen. Wenn die Autoren der Magierbücher sich durch Ano-nymität der Verantwortung für die Behauptungen ihrer Texte entziehen, bürgen im Falle des Brasilienbuches sowohl der Autor als auch der Ge-lehrte mit ihren guten Namen dafür, dass der Inhalt des Buches tatsäch-lich so „erfahren“ wurde und dass er mit der Wissenschaft, die hier be-reits das Erbe der biblischen Schöpfungsberichts angetreten hat, im Ein-klang steht. Die rhetorischen Anstrengungen im Faust- und Wagnerbuch dagegen laufen als faktuale Beglaubigungsversuche ins Leere, da sie text-immanent bleiben und nicht vom Leser referentialisiert werden können.
Auch die Erzählstruktur der Historia erweist sich als kohärent mit dem faktualen Rezeptionsangebot. Von den 178 Seiten entfallen zwei 12 Christian Kiening (2002) attestiert den Reiseberichten von Staden, de Léry und Thevet
nicht weniger als protowissenschaftliche Qualitäten, was um so bemerkenswerter ist, als Staden keinerlei universitäre Bildung genossen hat. Immerhin ist denkbar, dass ihm Dry-ander bei der Strukturierung der Beschreibung von Natur und Bewohnern zu Seite gestan-den hat.
13 Staden selbst nennt in seiner „Beschluss rede“ an den Leser noch einmal namentlich zehn verschiedene Personen, die für die verschiedenen Etappen der Reise bürgen können.
Helmut Galle
14
Drittel auf den ersten Teil, der die chronologische Erzählung von den bei-den Brasilienreisen und der Rückkehr Stadens enthält. Der zweite Teil ist betitelt „Warhafftiger kurtzer bericht / handel vnd sitten der Tuppin Inbas / derer gefangener ich gewesen bin […]“ (127) und beschreibt in systema-tischer Form das was man als ethnologische, biologische und geographi-sche Beobachtungen bezeichnen könnte.
Die durchgängige erste Person Singular verweist schon im ersten Satz des Textes auf den Autor des Titels und der Vorrede: „Ich Hans Staden vonn Homberg in Hessen / name mir vor / wens Gott gefellig were / Indi-am zu besehen“ (Staden 2007: 17), in der Klassifizierung Genettes eine homo- bzw. autodiegetische Erzählstruktur mit interner Fokussierung und damit der „klassische“ Fall des autobiographischen Schreibens – wie an-dererseits die heterodiegetisch-auktoriale Struktur die des klassischen Ro-mans war.14 Sein Text verlässt auch zu keinem Zeitpunkt diese „natürli-che“ Erzählhaltung, indem er etwa dem Leser Einblicke in die Gedanken und Gefühle der anderen Figuren zumuten würde oder Mitteilungen, die die Reichweite seiner Erfahrung und Erinnerung übersteigen.15 Erst da wechselt er von der ersten Person zum „man“, wenn er im zweiten Teil vom Erfahrungsbericht zur Beschreibung übergeht; aber auch hier kann die Perspektive wieder zum „ich“ zurückkehren: „Wie das Landt America oder Brasilien gelegen ist / wie ich zum teyl gesehen.“ (Staden 2007: 129). Dass die Historia Stadens als „wahrhaftiger“ Bericht gemeint war und auch so gelesen wurde, steht und fällt der Verifizierbarkeit ihres Ver-fassers, der sich eben nicht im Text durch einen fingierten Erzähler ver-treten lässt, sondern alle in der ersten Person getroffenen Aussagen zu verantworten bereit ist, ganz im Sinne von Lejeunes „autobiographi-schem Pakt“. Wenn Franz Obermeier hier zwischen einem Erzähler und einem textinternen Autor differenziert,16 so sind dies moderne Bestim-
14 Mit Thomas Nashes The Unfortunate Traveller erscheint bereits 1594 einer „der ersten
Ich-Romane“ (vgl. Stanzel 1991: 274), in dem allerdings durch die klare Differenz von Autor (der sich als Herausgeber gibt) und Protagonist/Erzähler (John Wilton) eine ähnliche Konstellation entsteht wie in den Magierbüchern und dem Lazarillo de Tormes (1554). Vgl. hierzu auch die klare Unterscheidung in Käte Hamburgers Logik der Dichtung.
15 So teilt er zwar den größten Teil der ethnologischen Informationen über die Tupinambá im Präsens universalen Wissens mit, ohne bei jedem Detail zu erläutern, woher die Informati-on stammt, doch hatte er schließlich neun Monate Zeit, die Dinge zu beobachten. Sobald aber Phänomene zur Sprache kommen, die außerhalb seines raum-zeitlichen Erfahrungsra-dius’ liegen, wird die Informationsquelle offengelegt: „Ich hab sie offt gefragt / woher sie das muster der haar hetten / Sagten sie / Yhre vorvätter hettens an eynem Manne gesehen / der hette Meire Humane geheyssen / vnd hette vil wunderbarliches dings vnter inen gethan / vnd man wil es sei eyn Prophet oder Apostel gewesen. // Weiter fragte ich sie / womit sie hetten die har konnen abschneiden / ehe inen die schiff hetten scheren bracht / sagten sie hetten eynen steinkeil genommen […].“ (Staden 2007: 145)
16 „Stadens Erzähler ist natürlich [!] trotz seines autobiographischen Redens nicht mit der historischen Gestalt identisch, er beschreibt durch die chronologische Perspektive auch
„Wahrhafte Geschichten“
15
mungen, die weder durch die naive Gesinnung des Autors, noch durch textliche Anhaltspunkte gedeckt werden. Denn weder für die mündliche noch für die textbasierte Erzählung muss zwischen einem Autor-Ich und einem Erzähler-Ich unterschieden werden: Wenn ich gesprächsweise ein Erlebnis wiedergebe, spalte ich nicht notwendig für mich und meine Zu-hörer einen Erzähler von mir ab, nur weil ich meine Erzählung kommen-tiere oder weil ich meine Erlebnisse aus dem Horizont des Erlebens wie-dergebe oder sie niederschreibe.17 Differenzierungen dieser Art werden erst sinnvoll, wenn sich das literarische Erfinden bewusst vom subjektge-bundenen Erfahren und Erinnern löst und die Aussagen der gesteuerten Phantasie von den pragmatischen Aussagen des Subjekts unterschieden werden müssen. Dies scheint mir bei Hans Staden nicht der Fall.
Betrachtet man den Reisebericht im Gattungskontext autobiographi-schen Schreibens fällt auf, dass sich hier zwei abendländische Traditio-nen kreuzen. Die eine ist die auf Augustinus zurückgehende Confessio, die – bereits in einer protestantischen Variante – das göttliche Eingreifen in das eigene Leben bezeugt und erst daraus – zumindest topisch – die Legitimität für die Publikation der Vita bezieht. Aber der Autor und sein Mentor Dryander beschränken sich nicht auf den rhetorischen Aufruf die-ses Motivs. Der ganze Bericht ist gerahmt und durchzogen von Glaubens-bekundungen. Diese liegen einesteils auf der Ebene der Diegese: Notsitu-ationen in denen der Gefangene sich an die Leidensgeschichte Jesu erin-nert (Staden 2007: 62), in Gedanken ein Stoßgebet formuliert (Staden 2007: 57; 59; 75) oder den Indianern damit imponiert, dass sein Gott ihm scheinbar besondere Macht verliehen hat (Staden 2007: 59; 112). Zum andern finden sich Lobpreisungen (Staden 2007: 118) und Dankgebete (Staden 2007: 124f.) des Autors auf der Äußerungsebene, in denen er –
sehr geschickt sein Erleben in der Reihenfolge und vermeidet Vorgriffe auf sein späteres Schicksal, um das Spannungselement, wie er den Tupinambá entkam, aufrechtzuerhalten.“ Und: „Die Textintention der religiösen Erbauung wird auch ausgesprochen, dazu dient die Funktion des textinternen Autors. Staden ist als textinterner Autor an mehreren Stellen präsent, vor allem in der Widmungsvorrede und schließlich in einigen sehr wichtigen Pas-sagen, die drucktechnisch auch durch ein anderes Schriftbild und inhaltlich durch eine di-rekte Leseransprache abgegrenzt sind.“ (Obermeier 2007: XIX)
17 Vgl. Genette (1992: 88) mit Bezug auf Lejeunes Modell der Identität von A (Autor), P (Protagonist) und N (Erzähler) in autobiographischen Texten: „zwischen A und N symbo-lisiert es [das Gleichheitszeichen] die ernsthafte Verantwortlichkeit des Autors hinsichtlich seiner narrativen Assertionen, wodurch zugleich die Eliminierung von N, das sich als über-flüssige Instanz erweist, dringend nahegelegt wird: wenn A = N, exit N, denn es ist ganz einfach der Autor, der erzählt; welchen Sinn hätte es, vom „Erzähler“ der Confessions oder der Geschichte der französischen Revolution zu sprechen?“
Helmut Galle
16
gut lutherisch – darauf verweist, dass allein Gottes Wort und sein Glaube den Menschen in der Not zu schützen vermögen (Staden 2007: 126).18
Neben dieser religiösen Motivierung des Autobiographischen steht aber der Reisebericht überhaupt – und zumal eine Geschichte der Kalami-täten wie die des Staden – auch in der Tradition der Odyssee. In der euro-päischen Literaturgeschichte ist die mündliche Erzählung, die der schiff-brüchige Fremde in der Halle des Alkinoos über seine Irrfahrt und die Bedrohung durch den Kyklopen vorträgt, gewissermaßen die fiktionale Gründungsurkunde von Autobiographie und Reisebericht. Odysseus, der Bettler und Niemand, der an seine frühere Identität als Held von Troja und Fürst von Ithaka erst durch die Erzählung seiner Leiden anschließen kann, erscheint uns zugleich als das mythische Urbild des traumatisierten Überlebenden.19 Odysseus erwirkt seine Wiederaufnahme in die mensch-liche Gemeinschaft bei den Phäaken durch das narrative Zeugnis seiner fast erfolgten Auslöschung. Staden hatte seine Identität eines hessischen Christen und Landsknechts in der Gefangenschaft zuerst als potentielles Objekt der kannibalistischen Praktiken und dann als deutsch-indianischer „Mameluck“, einer hybriden Mischung von kulturellen Prägungen,20 ein-gebüßt und muss sie nun wieder herstellen, indem er sich als schreiben-des Subjekt erneut seiner Geschichte und seiner Identität zu bemächtigen versucht und das Ergebnis der Gemeinschaft zur Beurteilung vorlegt, in die er zurückgekehrt ist.
In der Tat verdankt Staden sein Überleben ja einer Anpassung an die Sitten des Stammes, er benutzt wie die Tupinambás Pfeil und Bogen, er fischt und jagt mit ihnen die Tiere und verzehrt nicht ohne Genuss21 die Früchte des Landes. Als er schließlich von einem französischen Schiff mitgenommen wird, ähnelt dies weniger einer Befreiung aus Gefangen-schaft als vielmehr einem tränenreichen Abschied. Denn der Häuptling, der ihn „für seinen sohn gehalten“ (Staden 2007: 118) lässt ihn nur zie-hen, weil zehn (!) der französischen Matrosen sich als seine Brüder aus-geben und darum flehen, ihn noch einmal zu seinem sterbenden Vater in Europa zu bringen. „Vnd seiner weiber eyns / welchs mit im schiff war /
18 Vgl. hierzu Wenzel 1991. Freilich ist Stadens Buch insgesamt viel weniger von theologi-
schen Intentionen durchzogen als die 1578 erschienene Histoire d’un voyage fait en la ter-re du Brésil von Jean de Léry. Vgl. Mahlke 2005.
19 Vgl. hierzu Schlesier 2003 und Galle 2006. 20 Die These, dass Staden durch seinen Aufenthalt bei den Tupinambá die Charakteristik ei-
nes Mamelucken aufweist, hat Luciana Villas Bôas in ihrem Essay zu Stadens Reisebe-richt vertreten (2004: 250). Als Mamelucken werden in Brasilien üblicherweise die Nach-kommen von europäischen Vätern und indianischen Müttern bezeichnet, die eine doppelte Sozialisation erfahren und von beiden Kulturen geprägt sind.
21 Nachdem er minutiös die Herstellung von Maniok- sowie von Fleisch- und Fischmehl be-schrieben hat, bemerkt er „Solch meel essen sie dann zuo dem wurtzel meel / vnd es schmecket ziemlich wol.“ (Staden 2007: 140)
„Wahrhafte Geschichten“
17
muste mich beschreien nach irer gewonheyt / vnn ich schrey auch nach irem gebrauch.“ (Staden 2007: 119) Auch wenn man diese Frau nicht für eine Staden zugeteilte Partnerin halten will – er nämlich teilt selbst an an-derer Stelle mit, dass allen zum späteren Verzehr bestimmten Gefangenen eyn weib das inen verwaret / vnnd auch mit ime zuthun hat“ (Staden 2007: 157) beigesellt wird –, so verhält er sich hier ganz gemäß den Ge-bräuchen der Indianer, die er nicht nur kennt, sondern eben auch ange-messen auszuüben versteht. Da er sich in Aussehen und Verhalten kaum noch von seinen zwangsweisen Gastgebern abhebt, betont der Bericht die Elemente, mit denen er seine Differenz während der Gefangenschaft auf-recht erhalten hat: sein christliches Vertrauen in Gott und die Abstinenz von den kannibalistischen Gelagen; kurioserweise zeigen ihn viele der il-lustrierenden Holzschnitte gerade in dieser zwitterhaften Identität: einer-seits nackt, anderseits mit langem Bart (den man ihm eigentlich abge-schnitten hatte; Staden 2007: 63) und zum Gebet erhobenen Händen unter den ebenfalls nackten „Wilden“ (Staden 2007: 57; 76; 81; 111; 113). Zwar nennt er sie immer wieder „grimmig“ und „Tyrannen“, weil sie ihn gefangen halten und die Gefahr eines gewaltsamen Todes in all den Mo-naten nie völlig schwindet, doch seine generelle Einschätzung der India-ner ist weder völlig negativ, noch stellen sie für ihn das ganz Fremde dar: „Es ist eyn feines volck / von leib vnd gestalt / beyd fraw vnn man / gleich wie die leut hie zuo lande / nur das sie braun von der Sonnen sein / dann sie gehen alle nacket / jung und alt […].“ (Staden 2007: 137) Ihre Kultur und die brasilianische Natur werden ausgesprochen unvoreinge-nommen und objektiv dargestellt, so dass man den systematischen Teil seines Berichts als „proto-wissenschaftlich“ (Kiening 2002) und die komplementäre Einheit von Bericht und Beschreibung „eindeutig als Vorläufer moderner Ethnographien“ ansehen konnte (Villas Bôas 2004). Will man das Werk anhand postkolonialer Theorie, wie sie in dem erhel-lenden Aufsatz von Oliver Lubrich (2005) skizziert wurde, beschreiben, so lassen die genannten Eigenschaften sowohl den Reisebericht als auch seinen Autor als frühe Beispiele einer Hybridisierung im Sinne Homi Bhabas (1994) erscheinen, auch wenn dieser schließlich in seine Heimat zurückkehrt und augenscheinlich wieder ungebrochen seine alte Identität annimmt. Aber er ist nach dieser Erfahrung – wie Odysseus – nicht mehr derselbe, als der er ausgezogen war und die öffentliche Erzählung seiner Zeit bei den Menschenfressern muss nun für das einstehen, was ihm von dieser Episode verblieben ist. Wie sein christliches Zeugnis die alte Iden-tität in der Gefangenschaft behauptete, so behauptet das Zeugnis der Rei-se nun seine Fremdheitserfahrung in der wiedergefundenen Heimat.
Die Aspekte der Confessio und des Überlebendenberichts sind für die Historia des Hans Staden zweifellos weniger zentral als die schlichte Ab-
Helmut Galle
18
sicht, über die (für Europäer) außerordentlichen Dinge zu informieren, die er in Brasilien gesehen und erlebt hat. Gleichwohl sind alle drei Funk-tionen strukturell daran beteiligt, dass der Text eine Gestalt annimmt, in der die einzelnen Aussagen für den Autor auf einer existentiellen Ebene verantwortet werden und nach einer faktualen Rezeption durch den Leser verlangen. Dass die Welt jenseits des Atlantik trotz ihrer Fremdartigkeit der persönlichen Erfahrung offen steht, dass seine Mitteilungen sich also jederzeit überprüfen lassen und dass selbst sein Abenteuer unter den Kan-nibalen wiederholbar ist, darauf verweist der Autor am Ende seinen Le-ser: „So nun ettwan eyn junger gesell were / der mit diesem schreiben vnd zeugen keynen genuegen hette / Darmit er nit im zweiffel lebe / so neme er Gott zu hilff / vnd fahe diese reyse an / Ich hab im hierin kundt-schafft genug gelassen / der spur volge er nach / Dem Gott hilfft / ist die wellt nicht zuogeschlossen.“ (Staden 2007: 178)
4. Fiktionalitätsbewusstsein im Faustbuch
Zu den früher als ‚Volksbücher‘ bezeichneten Werken der eher populären Literatur zwischen pragmatischer Belehrung (durch Moral und Wissen) und unterhaltsamer Sensation gehören auch Faust- und Wagnerbuch, die anonym als „Historien“ publiziert wurden und heute zu den frühen Bei-spielen des Prosaromans gezählt werden, wenngleich keines von beiden dezidiert „als literarische Fiktion an die Öffentlichkeit [tritt], sondern als historischer Bericht“ (Müller 1990: 1333). Schon die Widmungsvorrede des Druckers Spies schwankt zwischen dem Unterhaltungswert „deß weitbeschreyten Zauberers vnnd Schwartzkünstlers“ nach dessen Aben-teuern „allenthalben ein grosse nachfrage […] bey den Gastungen vnnd Gesellschaften geschicht“ (Faustbuch 833) und der didaktischen Funktion des abschreckenden Beispiels: „allen denen / so sich wöllen warnen las-sen / einen wolgefälligen Dienst zuerzeigen“ (ebd. 834).
Anders als beim Fortunatus oder den Romanen Wickrams beruht die üblich gewordene Einstufung als Fiktion22 – und damit die Einreihung in die Genealogie des Romans – jedoch noch nicht auf den Einlassungen des historischen Autors, sondern auf der Einsicht des heutigen Literatur-wissenschaftlers, der dem Verfasser nachweist, wie dieser die verschiede-nen Bruchstücke der Fausttradition zu einer Biographie formt (Müller 1990: 995) und sich zum Zweck der Täuschung auf Augenzeugen und authentische Dokumente beruft: „Die Historia benutzt historiographische Verfahrenum den Leser zu illusionieren.“ (ebd. 996).
22 Vgl. Müller 1900 und Füssel/Kreutzer 2006. Dennoch hat es noch in den letzten Jahrzehn-
ten ernst zu nehmende Bemühungen um die Bestimmung des „historischen Kerns“ der Faustsage gegeben wie die Studien Günther Mahals.
„Wahrhafte Geschichten“
19
Dass sich bereits in den Jahrzehnten nach Erscheinen des Faustbuchs ein schneller Wandel in der Rezeption vollzog, zeigen die im Abstand von wenigen Jahrzehnten erfolgenden Reaktionen von Augustin Lerchei-mer und Wilhelm Schickard: Während der erste die Historia noch als Tatsachenbericht auffasst und kritisiert, versteht sie der zweite bereits als Fiktion im heutigen Sinne. Im „Christlich Bedencken“ von 1597 hatte Lercheimer (i.e. Hermann Witekind bzw. Hermann Wilken) seine Kritik am Faustbuch mit dem Nachweis falscher Ortsangaben untermauert; der Vorwurf, die Historia D. Johann Fausten sei „bößlich vnd bübelich er-dichtet und erlogen“ (zit. n. Füssel/Kreutzer 2006: 298), gilt noch einem Werk, das einen historischen Wahrheitsanspruch reklamiert. Für Schi-ckard in seinem Buch Bechinath Happeruschim von 1624 dagegen ist das Faustbuch eine „famosissima […] fictitii cujusdam Doctoris Fausti legen-da“ (2006: 300). Die Qualifikation des Protagonisten als fiktive Figur führt Schickard freilich nicht zur Abwertung des Buches, sondern er ver-gleicht es, wie Füssel und Kreutzer (2006: 301) hervorheben, durchaus positiv mit den biblischen Parabeln und heidnischen Epen von Homer, Vergil, Ovid. Als „legenda“ brauchen sie nicht faktisch wahr zu sein, um ihre beispielhafte Bedeutung zu entfalten. Man darf annehmen, dass der bei Schickard zu verzeichnende Sinneswandel nicht auf dem Nachweis der Nichtexistenz des Teufelsbündlers beruht, sondern eher aus einer neu-en Leseweise resultiert, die am Faustbuch Signale wahrnimmt, welche in gleicher Weise an anderen Werken zu Tage treten, die sich selbst explizit der fiktionalen Gattung einschreiben.
Folgt der Leser den expliziten Einlassungen des Druckers Spies und des anonymen Verfassers, so muss er mit Lercheimer eine wahrheitsge-treue Erzählung erwarten, denn es fehlt nicht an Beteuerungen schon im Titel, dass die Historia „mehrerteils auss seinen [Fausts] eygenen hinder-lassenen Schrifften“ verfasst worden sei und der Protagonist „noch bey Menschen Gedächtnuß gelebet“ habe (Vorrede 839). Doch die in der Die-gese aufgeführten Elemente treten zu diesen Bekundungen in Wider-spruch.
Ist sich der Verfasser des Faustbuches bewusst, dass er „den Leser il-lusionieren“ will? Glaubt er, dass die Berufung auf Quellen durch seinen eigenen „Wahrheitswillen“ gedeckt ist? Die prononcierte lutherische Be-lehrungstendenz deutet darauf hin, dass er von einem recht unbeirrbaren Glauben getrieben wurde und den Magier auf jeden Falls als negatives Exempel darstellen wollte. Man darf annehmen, dass in seinem Weltbild Zauberer und Teufel und die von ihnen ausgehende Versuchung eine durchaus reale Gefahr darstellten. Andererseits kann man wohl ausschlie-ßen, dass ihm der von Faust mit dessen Blut unterzeichnete Vertrag als Dokument vorgelegen hat, von dem der Teufelsbündler ja angeblich eine
Helmut Galle
20
Kopie erhalten hatte (ebd. 858). Dass der Autor diesen Vertrag wörtlich wiedergibt (ebd. 856f.) und in der Erzählung – wie schon im Titel – mehrfach auf die angeblich nach Fausts Tod aufgefundenen Schriften zu-rückkommt, wird im Text damit begründet, er wolle solches „zur War-nung und Exempel aller frommen Christen melden“ (ebd. 854), und hier-zu wird sogleich das Beispiel Wagners angeführt, den Faust „baldt her-nach“ verführt habe. Man kann zwar nicht völlig ausschließen, dass dem Verfasser ein Schriftstück vorlegen hat, dass dieser tatsächlich für Fausts Vertrag mit dem Teufel hielt, aber wahrscheinlicher ist, dass er den Wort-laut eines solchen Schriftstücks erfunden hat, dass er also bewusst täuscht, und gleichzeitig glauben mag, dass der gute Zweck (den verfüh-rungsanfälligen Leser zu warnen) auch die Fingierung des Dokuments nach allen Regeln der juristischen Kunst rechtfertigt.
Gerade eine Seite zuvor hatte der Autor sein Fiktionalitätsbewusstsein in einem Satz dokumentiert, der zur Illustration der superbia des Teufels-bündlers allerlei Vergleiche aus den loci communes anführte, darunter den biblischen Engelssturz und die antike Gigantomachie:
Eben in dieser Stundt fellt dieser Gottloß Mann von seinem Gott vnd Schöp-fer ab […] vnnd ist dieser Abfall nichts anders / dann sein stoltzer Hochmuth / Verzweifflung / Verwegung vnd Vermessenheit / wie den Riesen war / dar-von die Poeten dichten / daß sie die Berg zusammen tragen / vnd wider Gott kriegen wollten / ja wie dem bösen Engel / der sich wider Gott setzte / da-rumb er von wegen seiner Hoffahrt vnnd Vbermuth von GOtt verstossen wur-de / Also wer hoch steygen will /der fellet auch hoch herab. (Ebd. 853)
Dichten als Tätigkeit der heidnischen Poeten umfasst in dieser Zeit se-mantisch neben der Versifizierung auch die Lüge (obwohl der Mythos hier in der rhetorischen Reihe scheinbar gleichwertig mit der christlichen Legende von der Erhebung Luzifers). Dagegen bezeichnet der Autor sei-ne eigene Tätigkeit des Überlieferns von Dokumenten (s.o.) als „mel-den“, was deutlich eher in den Bereich des (juristischen) Anzeigens von Fakten gehört.23 Der Verfasser des Faustbuches verfügt also durchaus über ein gewisses „Bewusstsein“ von der Differenz zwischen Erdichte-tem und Berichtetem, anstatt zuzugeben, dass er dichtet, hält es aber für nötig, seinen Lesern vorzutäuschen, dass er berichte. Wenn es um die Zeugen für gefundene Dokumente geht, schützt er ein neutrales „man“24
23 Vgl zu „dichten“ Grimms Deutsches Wörterbuch Bd. 2, Sp. 1057-1063 und zu „melden“
Bd. 12, Sp. 1991-1995. 24 „DJese Geschicht hat man auch bey jm funden / so mit seiner eygen Handt concipiert vnd
auffgezeichnet worden / welches er seinem guten Gesellen einem Jonæ Victori, Medico zu Leiptzig, zugeschrieben, welches schreibens Innhalt war, wie folgt:“ (Faustbuch 896)
„vnnd sagt man warhafftig, daß in solcher Hand ein gegrabne vnnd blutige Schrifft gese-hen worden.“ (Ebd. 854)
„Wahrhafte Geschichten“
21
vor oder Fausts anonyme Studenten,25 er behauptet nicht von sich selbst, dass er Augenzeuge gewesen sei. In seiner Vorrede spricht er davon, er habe das „schrecklich Exempel“ Fausts „für die Augen stellen“ wollen, und „allein das gesetzt, was jederman zur warnung vnnd besserung die-nen mag“ (841). Diese Funktion dürfte das Ausmalen von Szenen und das Fingieren von Dokumenten sanktioniert haben. Eine Thematisierung des eigenen Schreibens, eine Reflexion über das „wahrheitsgemäße“ Er-finden wie in den Romanen Wickrams (vgl. Haferland 2007) kommt im Verlauf des Buches nicht vor. Das Pronomen „ich“ taucht im Text der Er-zählung fast ausschließlich in der Rede von Faust oder Mephostophiles auf und bezieht sich fast nie auf den Verfasser.26 Dieser nimmt – wie ge-sagt – auch nicht für sich in Anspruch, selbst in Kontakt mit Dokumenten oder gar mit dem Protagonisten getreten zu sein. Der Verfasser und Kom-pilator beansprucht „Wahrhaftigkeit“ für seine Geschichte und täuscht den Leser systematisch über die weitgehende Fiktivität von Figuren und Handlung.27
Nimmt man aus literaturwissenschaftlicher Routine hier eine Diffe-renzierung von fiktivem Erzähler und Verfasser vor,28 so wäre der Erzäh-ler in der Terminologie Genettes als ein heterodiegetischer mit auktoria-ler Fokalisierung anzusprechen (Genette 1998: 275) und damit als der ‚klassische‘ Fall fiktionalen Erzählens. Hätten die Leser des 16. Jahrhun-derts über unser Sensorium für Fiktionalitätssignale verfügt (wie vermut-lich bereits Schickard), hätten sie den Erzählerblick in die Gedanken und Gefühle der verschiedenen Figuren als unmöglich für einen faktualen Be-
25 „Sie fanden auch diese deß Fausti Historiam auffgezeichnet, vnd von jhme beschrieben,
wie hievor gemeldt, alles ohn sein Ende, vnnd was sein Famulus auffgezeichnet, da auch ein neuw Buch von jhme außgehet.“ (Ebd. 979)
26 Von insgesamt 241 Belegstellen für das Pronomen finden sich acht in der Widmung, zwei in der Vorrede und weitere zwei im ersten Kapitel, das einen Überblick über Fausts Leben gibt. Ein weiteres auf den Verfasser/Erzähler zu beziehendes Pronomen findet sich im letz-ten Satz (ebd. 980). Alle übrigen beziehen sich (in mündlicher Rede oder „Dokumenten“) auf Faust, Mephostophiles oder andere Figuren.
27 Vgl. hierzu den überzeugenden Artikel von Harald Haferland (2007) über die Frage des Erzählers in den Romanen Wickrams.
28 Man beachte etwa den eher unspezifischen Gebrauch der Ausdrücke bei den Koryphäen des Faches: W. Röcke (2004: 488): „Auch die ‚Historia‘ entsteht aus einer diffusen Mi-schung mündlicher und schriftlicher Überlieferungsstränge, die von einem unbekannten Erzähler zu einer Lebensgeschichte (‚Vita‘) Fausts zusammengefaßt […] worden ist.“ J.D. Müller (1990: 1329): „Die Historia von 1587 behandelt Faustus als historische Figur, ja der Verfasser behauptet sogar, auf deren eigenen Aufzeichnungen zu fußen.“ [Hervorhe-bungen hinzugefügt] – Spricht in der Vorrede der (unbekannte) Verfasser, in der eigentli-chen Erzählung dagegen ein von diesem unterschiedener (unbekannter) Erzähler? Sind diese Differenzierungen für das Verständnis dieser Texte des 16. Jahrhunderts produktiv?
Helmut Galle
22
richt identifiziert, ebenso wie die den gesamten Text stark dominierende wörtliche Rede der Figuren.29
Fiktionalitätsbewusstsein müsste im Falle des Faustbuches also hei-ßen: der Autor dürfte durchaus bereits zwischen faktualem von fiktiona-lem Schreiben unterschieden haben, denn er tut nahezu alles, um seinen Lesern die faktuale Geltung seiner erfundenen Erzählung vorzuspiegeln. Andererseits fingiert er in seinem Text ganz bewusst „Dokumente“, ver-traut also auf den illusionierenden Effekt der Wirklichkeit imitierenden Rede, ohne dem Leser zugleich einen fiktionalen Pakt anzubieten, der die Täuschung tatsächlich in Fiktion überführen würde. Dieser Widerspruch ließe sich auf der Basis der Überzeugungen erklären, die dieser Autor wahrscheinlich hatte: dass Faust im Prinzip so ähnlich gelebt habe, wie es die umlaufenden Schwänke berichteten und dass die von ihm erdichteten Szenen, Dialoge und Dokumente nahe an den Tatsachen sein müssten, dass sie aber vor allem auch der Funktion des abschreckenden Beispiels gerecht würden.
Die Aussagen des Druckers Spies in der Widmung weisen auf ein Verständnis, das noch stark dem anonymen Dichter des Mittelalters äh-nelt, der mündliche Überlieferungen aufgreift und sie literarisch geformt weitergibt an sein Publikum (Faustbuch 833): „Nach dem nun viel Jar her ein gemeine ynd grosse Sag in Teutschlandt von Doct. Johannis Faus-ti mancherley Abenthewren gewesen / vnd allenthalben ein grosse nach-frage nach gedachtes Fausti Historia bey den Gastungen vnnd Gesell-schaften geschicht.“ Mündlichkeit ist hier noch das Medium und es dürfte wie bei den älteren Sagenstoffen die Autorität des kollektiv Gewussten sein, die der Faustgeschichte zunächst den Charakter der res gestae ver-leiht. Zugleich wird aber auch „hin vnd wider bey etlichen newen Ge-schichtschreibern dieses Zauberers […] gedacht“, so dass sich Spies „[…] auch zum offtermal verwundert / daß so gar niemandt diese schreckliche Geschicht ordentlich verfassete / vnnd der gantzen Christen-heit zur warnung / durch den Druck mittheilete“. Wenn also Spies selbst – oder sein mysteriöser „gute[r] Freundt von Speyer“30 – die verstreuten Nachrichten und Schwänke zu einer chronologisch geordneten Vita mit abschreckender Funktion zusammenstellen, müsste er das nicht unbedingt ein Erfinden verstehen.
Offenbar lag ihm aber doch zuviel daran, die faktische Geltung des von ihm Mitgeteilten zu garantieren, als dass er es bei diesen älteren, der
29 Dorrit Cohn hat solche Elemente, die einen Text als fiktional ausweisen, in einem Kapitel
ihres Buches The Distinction of Fiction dargestellt. Cohn 1999: 18-37. 30 Müller (1990: 1363) hält es für möglich, dass der Drucker „einen Gewährsmann nur vor-
schiebt, um seine eigene Autorschaft oder einen Verfassers in seiner Umgebung zu de-cken“.
„Wahrhafte Geschichten“
23
Mündlichkeit angehörenden Beglaubigungsstrategien belassen wollte oder dass er dem Leser sein Material gar als von Erdachtes hätte anbieten wollen. Denn schließlich handelte es sich bei der Geschichte des D. Faust um einen außerordentlichen, geradezu unglaubhaften Fall, der sich nicht in ferner Vergangenheit, sondern in der jüngeren deutschen Geschichte, an wohlbekannten Orten zugetragen haben sollte. Um einen so unwahr-scheinlichen Fall zudem, dass er von den Lesern kaum als typisches Bei-spiel für den Lauf der Welt hätte verstanden werden können. Das Insistie-ren auf dem dokumentarischen Charakter verweist auf die Krise, in die das Erzählen der Historiae durch den Buchdruck und die Ablösung von der konkreten erzählenden Person geraten ist.
In einem denkwürdigen Kontrast zu diesem Insistieren auf dem Fakti-schen der eigentlichen Faustvita steht freilich das Wissen über die Welt, das der Teufel seinem Lehrling mit magischen Mitteln zugänglich macht. Dazu gehören Fausts Disputationen und seine Fahrten in „fuornembste Laender vnd Staette“, „in die Helle“ und „ins Gestirn“, die letztlich so scheinhaft sind, wie sein „Schlaffweib“ Helena und ihr gemeinsamer Sohn. Jan-Dirk Müller (vor allem 1992) hat geltend gemacht, die äußerst nachlässige Kompilation obsoleter mittelalterlicher Quellen31 sei im Fall des Faustbuchs so auffällig, dass hier eine Absicht anzunehmen sei, und zwar eine orthodox-lutherische Wendung gegen die Todsünde der curio-sitas, wie sie sich in den neuen weltlichen Tendenzen des Zeitalters zei-ge: dem Humanismus, der Erfahrungswissenschaft und deren Einbindung in die Reformation durch Philipp Melanchthon. Der Autor habe den Teu-fel gewissermaßen als unzuverlässigen Erzähler gekennzeichnet, dessen kosmographische und theologische Kenntnisse sich als völlig inkohärent und konfus herausstellen. Das gilt auch für die Reisen Fausts auf dem Zaubermantel, dem geflügelten Dromedar und zu Pferde, die gleichfalls aus den Informationen einer älteren Quelle, der Schedelschen Weltchro-nik (1493), zusammengesetzt wurden. In der Tat dürfte es auch ungebil-deten Rezipienten merkwürdig erschienen sein, wenn – nahezu hundert Jahre nach der Entdeckung Amerikas – Faust aus der Höhe der Gestirne lediglich die drei Kontinente der Alten Welt zu sehen bekommt: „Dar-nach sahe ich am Tag herab auff die Welt / […] also daß ich die gantze Welt / Asiam / Aphricam vnnd Europam / gnugsam sehen kondte.“ (Faustbuch 899) Das aus veralteten Büchern kompilierte Material wird vom Autor des Faustbuchs freilich nicht mit Verweis auf die Autorität der Quellen vorgeführt, sondern statt dessen als Erfahrungswissen Me-phostophiles’ oder als Beobachtung Fausts deklariert. Müller (1992: 181) zufolge soll diese „abstruse Empirie“ den Leser gerade zu einer Einsicht 31 In erster Linie der Elucidarius, eines Gesprächs über die Schöpfung von 1190/95 in einer
Bearbeitung des 16. Jahrhunderts. Vgl. Müller 1990: 1327; 1384.
Helmut Galle
24
in die Beschränktheit „menschlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten“ füh-ren. Wenn „Erfarung in einem umfassenden, den wörtlichen einschlie-ßenden Sinn […] das Ziel zeitgenössischer Reiseliteratur“ ist (ebd.), so reduziert sich das Reisen im Faustbuch auf ein geradezu sinn- und lustlo-ses Abhaken der Sehenswürdigkeiten. Lediglich die Streiche, die Faust dem Papst und dem Sultan spielt, geben den Stationen etwas mehr Farbe.
Auch in dieser Hinsicht löst das Faustbuch also die vorgebliche Refe-rentialität auf, indem seine autoritativen Wissensquellen verschweigt und deren Ordnungsrahmen dermaßen destruiert, dass dem zeitgenössischen Leser eine Situierung der Handlung in der Realität seines Weltbildes nicht mehr gelingen kann. Ob er dabei die von Müller postulierte Ver-knüpfung mit dem Dämonischen vornimmt, bleibt fraglich, zumal der Teufel ja an anderer Stelle durchaus ernst zu nehmen ist, wenn er den verzweifelten Faust mit authentischen Volksweisheiten quält. Die Autori-tät des Geschriebenen, auf die sich das Buch beruft, um seinen Wahr-heitsgehalt zu untermauern, unterläuft es selbst immer wieder, indem es seinen Inhalt und seinen Erzähler in die innertextliche Welt verbannt und eine referentielle Vernetzung mit der äußeren Welt verhindert.
5. „Fiktionalisierung“ des Reiseberichts im Wagnerbuch
Betrachtet man das sogenannte Wagnerbuch von 1593 (Wagnerbuch 2005), so ist der explizit vorgeschlagene Rezeptionsmodus ebenso als faktual anzusetzen wie bei seinem Vorläufer, zumindest gemessen am Ti-tel Ander theil D. Johan Fausti Historien und an der Behauptung „Alles aus seinen verlassenen schrifften genommen“. Der Status des Protagonis-ten ist allerdings noch prekärer als der Fausts: „Wagner ist keine histo-risch fassbare Figur“ (Wagnerbuch 2005: 8), wie die Herausgeber des modernen Neudrucks anmerken, sondern der Verfasser des Faustbuchs hat ihr „eigentlich zum Leben verholfen“ (Füssel/Kreutzer 2006: 189). In der Tat hat der Autor des Wagnerbuchs sämtliche Hinweise aus dem Vor-läufertext aufgegriffen und in die Anfangskapitel seines eigenen Werks eingebettet. Aber selbst das kann nicht verhindern, dass sein faktuales Gewebe äußerst fadenscheinig wirkt. Er tarnt die fehlenden Hinweise auf einen historischen Wagner durch die Verlegung der Haupthandlung nach Spanien sowie in die fernen Erdteile Amerika und Asien und gibt vor, es handle sich um eine Übersetzung aus einem mehr als 70 Jahre alten spa-nischen Buch (Wagnerbuch 2005: 316).32 Dies wird allerdings – als sei es dem Autor zum Schluss noch eingefallen – erst auf der letzten Seite er-
32 Dieses fiktive Original dient auch dazu, zu unterstreichen, dass die ausführlichen und an-
stößigen Teufelsbeschwörungen der Vorlage in der deutschen Fassung übergangen wur-den. (Wagnerbuch 2005: 316).
„Wahrhafte Geschichten“
25
wähnt und steht weder auf dem Titel noch in der Vorrede. In dieser nennt der Verfasser zunächst biblische Hinweise auf den Teufel und die Zaube-rei, um dann auf das Exempel Faust zu kommen. Die Reihe der „histori-schen“ Magier endet so bei Wagner
welcher des D. Fausti Famulus gewesen / diesem hat der Teuffel auch so lang nach gegangen / vnd gestellet / biß er ihn auch berücket / vnnd in seine Crap-pen bekommen / von dem ich in diesem Büchlein etwas schreiben / vnd sei-nes lebens vnnd wandels gedencken / auch seines ausgangs vnnd endes gründlichen bericht darthun will. (Wagnerbuch 2005: 4; Hervorhebung vom Autor)
Der Vorsatz, er wolle vom Leben und Sterben Wagners „etwas schrei-ben“ und „gedencken“ klingt von vornherein eher nach einem selbständi-gen Verfasser als nach einem Übersetzer. Auch dem damaligen Leser sollte diese Unstimmigkeit aufgefallen sein, zumal das Buch nur den apo-kryphen Verfasser33 nennt: „Fridericus Schotus“ in Toledo, „jetzt zu P.“ Die referentielle Einbindung in die damalige literarische Kommunikation ist äußerst mager: es gibt keinen Hinweis auf einen Drucker, keinen Her-ausgeber, keine Widmungen, keinen Druckort und kein Druckprivileg (vgl. Mahal/Ehrenfeuchter 2005: 347). Zwar gibt sich auch im Faustbuch der Verfasser nicht zu erkennen, aber der Drucker Spies, seine Frankfur-ter Werkstatt und die Widmungsempfänger sind in der Zeit gut bekannt.
Durch die suspekte paratextuelle Verortung des Wagnerbuches ist der Leser vorgewarnt. Hinzu kommt, dass Wagner gewissermaßen eine lite-rarische Dublette Fausts darstellt und der Verfasser am Ende sogar ver-spricht, bei günstigen Verkaufszahlen wolle er den dritten Serienhelden, Johann de Luna, Wagners Schüler, „auch gleicher gestalt ans Liecht brin-gen“ (Wagnerbuch 2005: 316). An diesen Besonderheiten des Wagner-buchs sollte schon der damalige Leser wahrgenommen haben, dass hier nicht von einer historisch fassbaren Gestalt erzählt wird, welche da stu-diert, spekuliert, paktiert, um die Welt reist und zuletzt, voller Reue, vom Teufel geholt wird. All dies wird im Wagnerbuch in seinen Einzelheiten entfaltet, weil das literarische Gesetz der Serie es so verlangt und weil Autor und Publikum an dieser Art von Geschichten Gefallen haben. Es handelt sich nicht mehr um den einzigartigen, abschreckenden Fall, son-dern um dessen kurzweilige Wiederholung und Variation. Damit verlie-ren im Wagnerbuch auch die – ohnehin dürftigen und raren – „Dokumen-te“ ihren Wert als Illusionierungsmechanismen. Von den behaupteten Schriften Wagners wird lediglich der Vertrag mit dem Teufel mitgeteilt, ansonsten gibt es keine eingefügten Zitate oder gar Wehklagen wie im 33 Das angebliche spanische Original will er von einem „Bruder Martino“ des Benediktiner-
ordens erhalten haben, eine nicht verifizierbare Angabe wie Mahal und Ehrenfeuchter (2005: 269) konstatieren.
Helmut Galle
26
Fall Fausts. Anders als der vielfach bezeugte Faust, der ein leibhaftiges Exempel für das Wirken des Teufels abgeben konnte, ist die nur mehr li-terarische Figur Wagner ein Vorwand, um das Material bestimmter The-menkreise personell zu bündeln und aus einer Subjektperspektive abzu-handeln.34
Leider ist nichts über die zeitgenössischen Reaktionen auf das Wag-nerbuch bekannt. Immerhin muss es sich verkauft haben, denn es wurden noch 1794 vier Neuauflagen gedruckt und drei weitere Ausgaben lassen sich von 1795 bis 1601 identifizieren (Classen 1994: 13); Mahal und Eh-renfeuchter (335) bezeichnen es als Bestseller. Das sagt allerdings nichts darüber, wie das Buch gelesen wurde, sondern nur, dass es beim Publi-kum ankam. Man hat dies vor allem darauf zurückgeführt, dass es mit zahlreichen Informationen zur Magie und durch die Reisen in die Neue Welt angereichert wurde, mit denen schon auf dem Titel geworben wird. Auch das Faustbuch kompilierte scheinbar wahllos aus verschiedenen Quellen, aber selbst da, wo der Protagonist seine Tour durch die Städte der Schedelschen Weltchronik absolviert, sind die Angaben eingebunden in die Erzählung; alle Informationen über Himmel und Hölle werden – auf der Ebene der Erzählung – vermittelt durch die Reden des Teufels oder die Erfahrung Fausts. Der Verfasser des Wagnerbuchs dagegen prä-sentiert seine Ausführungen zur Magie und vollends über Amerika von vornherein als „feine Beschreibung“ wie im Titel angekündigt: sie stehen im Präsens und werden behandelt wie verfügbares Wissen, das dem Leser über die betreffende Region mitgeteilt wird, die der Protagonist nun be-reisen soll. Als wahrnehmendes Subjekt dieser Reise erscheint Wagner nur ganz zu Beginn und am Ende des Kapitels. Über eine Strecke von 15 Seiten (242-257) ist der Protagonist inexistent, und der Verfasser gibt sei-ne Lesefrüchte aus Girolamo Benzonis Historia del Mondo Nuovo (Ben-zoni 1989) zum besten – ohne freilich den Leser über seine Quelle in Kenntnis zu setzen.35 Hier wird von den Indios, ihren Lebens- und Ernäh-rungsgewohnheiten, von den Gräueltaten der Spanier (Benzoni ist ein Ge-währsmann der Leyenda negra), den Tieren und Pflanzen Venezuelas, Hispaniolas, Nicaraguas und Perus gehandelt, ohne dass auch nur die ge-ringste Motivierung in Gestalt von Erlebnissen des Protagonisten vorge-nommen wird. Bezeichnenderweise ist auch schon die Vorlage Historia
34 Vgl. Müller (1984: 265) mit Bezug auf das Wagnerbuch: „In jenen alten historien war das
Subjekt der erfarung vielfach nur der Fluchtpunkt, dem sich die Phänomene der sichtbaren Welt zuordneten.“
35 Diese war 1565 und 1572 auf Italienisch erschienen, 1578 von dem französischen Calvi-nisten Urbain Chauveton ins Lateinische übersetzt worden, der 1579 schließlich noch eine französische Ausgabe folgen ließ (vgl. Benzoni 1989: 53f.). Der Verfasser des Wagnerbu-ches hat sich offensichtlich vor allem auf die lateinische, möglicherweise aber auch auf die französische Version gestützt (vgl. Scholz Williams 1992: 301).
„Wahrhafte Geschichten“
27
del Mondo Nuovo über weite Strecken nicht in der Form des Reisebe-richts gehalten,36 sondern sie handelt die Dinge der Neuen Welt ganze Kapitel hindurch in enzyklopädischer und historiographischer Form ab, meist ohne zu erwähnen, ob das Wissen aus eigener Beobachtung, aus Erzählungen oder Lektüren geschöpft ist. Da die Referenzen zur Erfah-rungsebene auch in Benzonis Buch eher sparsam sind, hat man sogar an der Authentizität des Reiseberichts zweifeln können.37
Der Leser des Wagnerbuchs mag sich an den wunderlichen Beschrei-bungen und auch an den anschließenden Possen Wagners unter den India-nern erfreut haben, aber er dürfte schwerlich geglaubt haben, dass es sich hier noch um einen „gründlichen Bericht“ tatsächlich vorgefallener Er-eignisse handelt. Wenn das Faustbuch schon einigen Aufwand treiben musste, um die phantastische Geschichte des Teufelsbündlers als histori-schen Bericht hinzustellen, so können die deutlich dünneren „Authentizi-tätsbelege“ im Wagnerbuch dies kaum noch geleistet haben.
Wo der Faustbuchverfasser die Wissensbestände aus Schedels Welt-chronik und dem Elucidarius instrumentalisiert, um die – vermeintlich realen – Gestalten Faust und Mephostophiles abzuqualifizieren, nimmt der Autor des Wagnerbuchs seinen phantastischen Protagonisten Wagner zum Vorwand, um die für wahr gehaltenen Informationen über schwarze und natürliche Magie sowie über fremde Völker in einen lockeren Erzähl-zusammenhang zu bringen. Während dem Faust-Autor klar war, dass er einzelne Dokumente fingierte, wusste der Wagner-Autor, dass er seine ganze Figur und ihre Biographie erfunden hatte. Eine tatsächliche Illusio-nierung der Leser durch die vorgebliche Authentizität des Protagonisten und der spanischen Vorlage spielt bei ihm keine zentrale Rolle mehr. Das im Wagnerbuch verwendete Material (Magische Traktate und Benzonis Historia) ist zwar deutlich aktueller und „zuverlässiger“ als das des Faust-buchs, aber da es der Beglaubigung durch seine Quellen38 beraubt und 36 Müller (1984: 262, 270 Fn. 74) hebt dagegen die Stellen hervor, an denen das Beobachter-
subjekt und der narrative Reisekontext Benzonis aufgelöst werden. 37 Der Übersetzer und Herausgeber der modernen spanischen Ausgabe, Manuel Carrera Díaz,
macht in seinem Vorwort mehrere Anspielungen dieser Art (15, 40) und zitiert aus einem Buch von Carlos Pereyra WELCHES BUCH? (45): „dass ‚es sich um einen Hochstapler handelt‘ und dass ‚vielleicht diejenigen der Wahrheit nahekommen, die im Anschluss an Thévet behaupten, die Reisen Benzonis seien eine literarische Fiktion, deren sich die Fein-de Spaniens bedienten, um ihre Sache der europäischen Meinung gegenüber mit der Auto-rität eines Augenzeugen zu stärken‘“. Von Thévet freilich wissen wir, dass er seinen eige-nen Bericht über die „singularitez de la france antarctique“ an Bord seines Schiffes ver-fasst hat, ohne das Land zu betreten; er hatte gute Gründe, die Schriften der Gegenseite als Hochstapeleien zu denunzieren – oder vielleicht sogar: er hätte nicht so sehr darauf insis-tieren sollen, dass man zur Beschreibung eines Erdteils denselben selbst in Augenschein genommen haben müsse.
38 Neben Benzoni nennen Mahal und Ehrenfeuchter (2005: 217) den Commentarius de prae-cipuis divinationum generibus (1553) von Caspar Peucer als Vorlage für die Reise zu den
Helmut Galle
28
statt dessen an den prekären Status des Protagonisten geknüpft wird, muss es dem Leser (zumal einem nicht mit Magie und Amerikaberichten vertrauten) eher phantastisch denn als Tatsachenbericht anmuten. Das Wagnerbuch stellt also deutlich einen weiteren Schritt in Richtung Fikti-on dar, wenngleich es sich dem Leser – nun auf reichlich „verwilderte“ Weise – immer noch als Historia andient.
Die Kompilation von Elementen der Teufelsbündlergeschichte, magi-schen Praktiken, wundersamen Nachrichten von amerikanischen Natur-völkern, antikatholischer und antispanischer Propaganda wird nur lose zusammengehalten durch die Lebensgeschichte Wagners, und die Figur wird nicht entfernt so plastisch und überzeugend wie die des Doktor Faust mit ihrem verzweifelten Ende. Wenn im Faustbuch trotz aller Fas-zination und Ambivalenzen deutlich die Intention erkennbar ist, den neu-gierigen, macht- und wissensdurstigen Magier als negatives Exempel für protestantische Christen darzustellen, ist im Wagnerbuch der unterhaltsa-me, „kurzweilige“ Charakter der aneinandergereihten Episoden beherr-schend. Ob diese letztlich auf Tatsachen beruhen oder frei erfunden sind, bleibt nebensächlich, und die topische Berufung auf Dokumente und „verlassene schrifften“ erfüllt keine rezeptionssteuernde Funktion mehr.
Der kompilatorische Charakter und die lockere Anbindung an den Protagonisten führt gleichzeitig dazu, dass die Perspektive auf die Neue Welt keinen festen Erzählerstandpunkt gewinnt und die einzelnen Szenen kaleidoskopartig und widerspruchsvoll ablaufen – Müller spricht von ei-nem „landeskundlichen Panorama, besser: Kuriositätenkabinett“ (Müller 1984: 263). Der Leser bestaunt mit Wagner nach der Ankunft in Cumana eine Indianerin von extremer Hässlichkeit, wird dann sogleich mit Zahlen konfrontiert, die das Wüten der „bluotgirigen Spanier“ belegen sollen, um dann auf die kulturelle Einzelheiten wie Barttracht, Waffen und den Bau von Kanus zu kommen. Alles dies ist zum großen Teil wörtlich von Benzonis Historia übernommen, der seinerseits neben seinen eigenen Be-obachtungen aus den Schriften von Kolumbus, Las Casas und anderen Vorgängern schöpft.39 Von Benzoni übernimmt der Wagnerbuchautor die antikatholische und antispanische Haltung der Beschreibungen, die ande-rerseits kaum zu seinem Protagonisten passen will, der unter den Katholi-ken lebt und bei seinem Besuch in Amerika zu keiner der beiden Seiten eine klare Beziehung entwickelt. Die Indianer sind einerseits positiv ge-zeichnet als Opfer der Spanier, die deren Gier durchschauen und sich zur
Lappen (einer Untersuchung von Kunze folgend) sowie für die Informationen zur Magie Georg Pictorius’ De speciebus Magiae, den Arbatel de Magia Veterum, Agrippa von Net-tesheims Occulta Philosophia, Johann Wiers De praestigiis Daemonum und Jean Bodins Daemonomania (ebd. 343).
39 Laut Scholz-Williams Vespucci und de Léry (1992: 195).
„Wahrhafte Geschichten“
29
recht wehren. Andererseits sind die als Heiden den Machenschaften des Teufels ausgesetzt, der „betreugt sie gar offt in mancherley gestalt“ (Wagnerbuch 2005: 250). Der christliche Gott, zu dem die spanischen Missionare sie bekehren wollen, kann aus Sicht der Indianer nur ein „bö-ser Gott sein / weil seine Kinder / vnd die in ehren / so voll Bosheit ste-cken“ (Wagnerbuch 2005: 250), folglich besteht für diese „arme Leut“ wenig Hoffnung, aus ihrem Aberglauben zur Wahrheit zu finden. Nach Benzoni wird ausführlich ein religiöses Fest beschrieben (Wagnerbuch 2005: 251), bei dem getrommelt, gesungen und getanzt wird. Nach einem rituellen Erbrechen zur inneren Reinigung nimmt die Szene die Gestalt eines Abendmahls an: „da kommen noch ein hauffen andere Weiber dar-zu / die tragen Koerb mit Brot vnn opffern es dem Gott. Diß Brot naem-men die Priester vnd theylen es auß / gleich als ein heylig Ding vnn gut Zeichen. Nach diesem gehen sie widerumb heym zu Hauß froelig vnd gu-ter ding.“ Scholz-Williams sieht hier ein „teuflisches Abendmahl“ (1992: 302), wie sie überhaupt die Amerikafahrt des Wagnerbuchs ganz in einer Verbindung zum europäischen Hexenwesen versteht. Aber die Beschrei-bung als solche stellt nur die Analogie zum christlichen Sakrament her. Dass die heidnische Zeremonie auf die Indianer einen wohltuenden Ef-fekt hat, wird hier keineswegs als Blendwerk kommentiert, dazu ist die Perspektivierung des Buches nicht konsequent genug. Somit bleiben viele der Darstellungen rein pittoresk, ohne Einordnung in ein festes Vorstel-lungssystem.
An einigen wenigen Stellen verlässt der Autor die reine Beschreibung und lässt Wagner schwankhaft in das Geschehen eingreifen. Mit seinen „Zaubereien“ kann sich Wagner dann gegen das im Umgang mit den Spaniern entstandene Misstrauen durchsetzen, schwingt sich zum Herren über die Indianer auf und bereichert sich an ihnen; auch „eyne huepsche Junckfraw […] welche gar nit vngestalt“, die ihm zugeführt wird, ver-schmäht er nicht (Wagnerbuch 2005: 262). Zwar verhält er sich nicht so brutal wie die Spanier, insofern sie schließlich „vngeplagt“ lässt, als er „der guten Leut einfaeltigkeit und fromkeit sahe“ (Wagnerbuch 2005: 263), aber prinzipiell ist sein Verhalten nicht in konsequenter Weise auf die kompilierte Textschicht bezogen. Weder wird sein eigener Teufels-pakt in einer wesentlichen Einheit zu Götzenanbetung und Magie der In-dianer begriffen, noch hat er wirklich teil an dem Verständnis, das der Er-zähler in den Benzonizitaten für die Eingeborenen aufbringt. Anders als der Verfasser des Faustbuches, hat dieser Autor die Neugier seines Prota-gonisten und der Leser nicht als Sünde gebrandmarkt. Die zusammenge-tragenen Wissensbestände werden nicht aus theologischen Absichten de-nunziert und verzerrt, sondern es ist gerade das Fehlen einer durchgehen-den Haltung, die das Buch als recht beliebiges Sammelsurium erscheinen
Helmut Galle
30
lässt. In diesem Sinne ist es auch eher ein Verfallsprodukt in der Nachfol-ge des Faustbuchs als ein echter Schritt in Richtung auf den Roman: Wenn der Prototyp noch aus der – wie immer diffusen – historischen Ge-stalt und der paränetischen Tendenz eine gewisse Einheit erhalten, so stif-tet in der Kopie weder eine klare Erzählerperspektive noch eine einiger-maßen umrissene Figur die Einheit, die einem fiktionalen Werk Sinn und Form geben muss.
6. Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unter dem Titel „Historia“ veröffentlichten Texte sich bezüglich der in ihnen zur Anwendung kom-menden „Verifikationsstrategien“ deutlich unterscheiden, was ihrer Ein-stufung als Vor- und Frühformen von Roman beziehungsweise Autobio-graphie entspricht. Obzwar alle drei Texte prinzipiell für sich reklamie-ren, „res factae“ darzustellen, untermauern das Faust- und das Wagner-buch dies durch Berufung auf „Schriften“, die durch den Leser nicht veri-fizierbar sind und ihm einen Glauben abverlangen, der von den (fiktiona-len) narrativen Befunden und den Verfassermystifikationen durchkreuzt wird. Die Autoren vertrauen ihrerseits auf die substantielle Wahrheitswir-kung ihrer Quellen, des mittelalterlichen Weltbildes (Faust) bzw. der „wissenschaftlichen Fakten“ (Wagner), ohne den Leser über die tatsäch-lich von ihnen praktizierte Fingierung von Handlungen, Fakten und Figu-ren ins Bild zu setzen wie zu gleicher Zeit bereits andere Autoren. Diese „deklarierten“ Fiktionen operieren freilich auch mit anderem Material, allgemeingültigen, wahrscheinlichen, modellhaften Typen und Biogra-phien (Wickram) oder im Modus der übertreibenden Parodie (Rabelais). Das Außerordentliche, Unglaubhafte des Teufelsbündlers und das Wun-derbare des Reiseberichts aus Neuen Welt war in diesen Formen von Fik-tionalität nicht angemessen darstellbar, daher das misslungene Insistieren auf Authentizität.
Das Buch Stadens weist ein ungleich moderneres Verständnis von Wissen und Erkenntnis auf, indem es das Aussagesubjekt sämtlicher Pro-positionen eindeutig und nachprüfbar festlegt. In Text und Paratext er-scheinen die Verifikationen nicht als bloße rhetorische Strategien, son-dern als lebensweltlich nachvollziehbare Mechanismen der Kommunika-tion, deren Übergang von der Mündlichkeit zur Buchform geglückt ist. Insofern erweist sich der Reisebericht Stadens als frühes Beispiel einer sich für die rezeptionsästhetische Unterscheidung von Roman und Auto-biographie im Laufe des 18. Jahrhunderts definitiv einspielenden Praxis.
Interessant mag in diesem Zusammenhang auch sein, dass die Auto-ren von Faust- und Wagnerbuch (wohl nicht nur aus Furcht vor der Inqui-sition) ihre Namen verschweigen wie die Autoren des Mittelalters: es
„Wahrhafte Geschichten“
31
geht hier vorrangig um die Darbietung des schrecklichen bzw. kuriosen Inhalts, der mit seinen „Quellen“ für sich zu sprechen scheint. Bewusst als Romane auftretende Bücher dagegen wollen durchaus als Leistung ih-rer Autoren gewürdigt werden. Der individuelle Autor wird wichtig so-wohl im Roman wie im Reisebericht: hier identifiziert als kluger Schöp-fer der imaginierten Welt, dort ebenso unabdingbar als verantwortungs-voller Augenzeuge der berichteten Welt. In beiden Fällen, im „echten“ Roman wie in der Autobiographie wird die mittelalterliche Fokussierung auf die Texte abgelöst von einer Zentrierung auf das Subjekt des Textpro-duzenten: als erlebendes bzw. als imaginierendes Subjekt. Die angemes-sene Rezeption muss nun in jedem Fall den Urheber der Texte in das Verständnis einbeziehen und so auch seriöse Kriterien entwickeln, um das vom Autor im Text hergestellte Verhältnis zur Welt (fiktional oder faktual) zu identifizieren. Dass die Magierbücher anonym verfasst sind, korrespondiert ihrem noch nicht vollzogenen Bekenntnis zur Fiktionali-tät. Wo der Schritt zur klaren Unterscheidung von Roman und Autobio-graphie vollzogen ist, bezieht der Leser fortan den Verfasser und dessen Intentionen in den Lese- und Deutungsprozess ein.
Dass dieser Differenzierungsprozess verknüpft ist mit der Verbreitung des Buchdrucks und einer neuen Dimension gesellschaftlicher Kommuni-kation, wurde eingangs angesprochen. Es ist aber sicher auch kein Zufall, dass er vor dem Hintergrund der Dezentrierung des europäischen Welt-bildes durch die Entdeckung Amerikas und seiner Kulturen stattfindet. Solange sich die Produktion von Texten in einem geschlossenen Univer-sum von einem göttlichen Ursprung her fortschrieb, bedurfte es weder der klaren Scheidung von Mythos und Wahrheit, noch der Identifizierung der individuellen Stimme. In dem Maße, in dem die Pluralität der mensch-lichen Kulturen sichtbar wurde und die Welt in immer neue, bisher unbe-kannte Einzelphänomene zu zerfallen begann, wuchs dem Beobachter und seiner Perspektive auf die Dinge immer mehr Bedeutung zu, denn das Ganze war nicht mehr mit einer vorgegebenen Perspektive zu erfas-sen. Eine solche konnte nur künstlich-kunstvoll in der Fiktion hergestellt oder aber aus den vielen partikularen faktualen Einzelperspektiven zu-sammengesetzt werden.
Literaturverzeichnis
Baron, Frank. „The Faustbook’s Indebtedness to Augustin Lercheimer and Wit-tenberg Sources“. Daphnis 14 (1985): 517-45.
Benzoni, Girolamo. Historia del Nuevo Mundo. Introducción y notas Manuel Carrera Diaz. Madrid 1989.
Bhabha, Homi. The Location of Culture. New York 1994. Blumenberg, Hans. Die Genesis der kopernikanischen Welt. Frankfurt a.M. 1981.
Helmut Galle
32
Brandom, Robert B. Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und dis-kursive Festlegung. Übers. Eva Gilmer und Hermann Vetter. Darmstadt 2000.
Braun, Manuel. „Historie und Historien“, in: Röcke, Werner/Münkler, Marina (Hg.), Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hansers Sozi-algeschichte der deutschen Literatur 1. Band Hansers Sozialgeschichte der Literatur, 1. München 2004. 317-61.
Classen, Albrecht. „Die Entdeckung Amerikas in der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts: Der Fall Wagnerbuch.“ German Life and Letters 47/1 (1994): 1-13.
Cohn, Dorrit. The Distinction of Fiction. Baltimore/London 1999. „Faustbuch.“ Romane des 15. und 16. Jahrhunderts. Nach den Erstdrucken mit
sämtlichen Holzschnitten. Hg. von Jan-Dirk Müller. Frankfurt a.M. 1990: 829-986.
Füssel, Stephan/Kreutzer, Hans Joachim (Hg.). Historia von D. Fausten. Text des Druckes von 1587. Kritische Ausgabe. Stuttgart 2006.
Galle, Helmut. „A representação lingüística nas concepções de Luhmann, Haber-mas e Brandom e as conseqüências para o status do discurso testemunhal.“ Itinerários 23 (2005): 49-68.
Galle, Helmut. „Viagens para o desconhecido. Paralelos estruturais entre os rela-tos de viagens do século XVI e testemunhos de sobreviventes do holocausto.“ Lugares dos discursos. X Congresso internacional Abralic. CD-Rom. Rio de Janeiro 2006.
Galle, Helmut. „Fausto, Wagner e o Novo Mundo: Ander theil D. Johan Fausti Historien (‚Wagnerbuch‘, 1593)“, in: Helmut Galle/Marcus Mazzari (Hg.). Fausto e a América Latina. São Paulo (im Druck), xx.
Genette, Gérard. Fiktion und Diktion. Übers. Heinz Jatho. München 1992. Genette, Gérard. Die Erzählung. Übers. Andeas Knop. München 1998. Haferland, Harald. „Gibt es einen Erzähler bei Wickram? Zu den Anfängen mo-
dernen Fiktionsbewusstseins. Mit einem Exkurs: Epistemische Zäsur, Para-texte und die Autor/Erzähler-Unterscheidung“, in: Marina E. Müller/Michael Mecklenburg (Hg.). Vergessene Texte – Verstellte Blicke. Neue Perspektiven der Wickram-Forschung. Frankfurt a.M. 2007. 361-293.
Hamburger, Käte. Die Logik der Dichtung. Berlin 1980. Kiening, Christian. „Ordnung der Fremde. Brasilien und die theoretische Neu-
gierde im 16. Jahrhundert“. Pandaemonium Germanicum. Revista de Estudos Germanísticos 6 (2002): 137-168.
Lämmert, Eberhard. Bauformen des Erzählens. Stuttgart 1993. Lejeune, Philippe. Der autobiographische Pakt. Übers. Dieter Hornig und Wolf-
ram Bayer. Frankfurt a.M. 1994. Lubrich, Oliver. „Welche Rolle spielt der literarische Text im postkolonialen Dis-
kurs?“ In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 157: 242 (2005): 16-39.
Lugowski, Clemens. Die Form der Individualität im Roman. Mit einer Einleitung von Heinz Schlaffer. Frankfurt a.M. 1976.
Mahal, Günther. Faust. Spuren eines geheimnisvollen Lebens. Reinbek 1995. Mahal, Günther/Ehrenfeuchter, Martin. Das Wagnerbuch von 1593. Bd. II. Zei-
lenkommentar, Nachwort und Register. Tübingen 2005.
„Wahrhafte Geschichten“
33
Mahlke, Kirsten. Offenbarung im Westen. Frühe Reiseberichte aus der Neuen Welt. Frankfurt a.M. 2005.
Misch, Georg. Geschichte der Autobiographie. Vierter Band, Zweite Hälfte. Von der Renaissance bis zu den Hauptwerken des 18. u. 19. Jahrhunderts, bearb. und hg. von Bernd Neumann, 4., 2. Hälfte. Frankfurt a.M. 1969.
Müller, Jan-Dirk. „Ausverkauf menschlichen Wissens. Zu den Faustbüchern des 16. Jahrhunderts“, in: Haug, Walter/Wachinger, Burghart (Hg.). Literatur, Artes und Philosophie. Tübingen 1992: 163-194.
Müller, Jan-Dirk. „Curiositas und Erfahrung der Welt im frühen Prosaroman“, in: Grenzmann, Ludger/Stackmann, Karl (Hg.). Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Stuttgart 1984: 252-271.
Müller, Jan-Dirk (Hg.). Romane des 15. und 16. Jahrhunderts. Nach den Erst-drucken mit sämtlichen Holzschnitten. Bibliothek der Frühen Neuzeit. Bd. 1 Frankfurt a.M. 1990.
Müller, Jan-Dirk. „Formen literarischer Kommunikation im Übergang vom Mit-telalter zur Neuzeit“, in: Röcke, Werner/Münkler, Marina (Hg.). Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hansers Sozialgeschichte der deut-schen Literatur 1. Band, 1. München 2004: 21-53.
Münkler, Marina. „Historia von D. Johann Fausten (1587)“, in: Herberichs, Cor-nelia/Kiening, Christian (Hg.). Literarische Performativität. Lektüren vormo-derner Texte. Zürich 2008: 354-71.
Obermeier, Franz. „Hans Staden und sein Brasilienbuch. Vorwort zur Ausgabe von Warhaftige Historia“, in: Obermeier, Franz (Hg.). Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555). História de duas viagens ao Brasil. Kiel 2007: I-LXVI.
Riedl, Peter Philipp. „Nützliches Erschrecken. Die ältesten Versionen der Faust-Historia und das Verhältnis von prodesse und delectare in der Literatur der Frühen Neuzeit.“ Daphnis 32/3-4 (2003): 523-557.
Röcke, Werner. „Fiktionale Prosa und literarischer Markt: Schwankliteratur und Prosaroman“, in: Röcke, Werner/Münkler, Marina (Hg.). Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hansers Sozialgeschichte der deut-schen Literatur 1. Band, 1. München 2004: 463-506.
Rösler, Wolfgang. „Die Entdeckung der Fiktionalität in der Antike“. Poetica 12 (1980): 283-319.
Sastrow, Bartholomäus. Bartholomäi Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauff seines gantzen Lebens, auch was sich in dem Denckwerdiges zugetragen so er mehrentheils selbst gesehen und gegenwärtig mit angehöret hat, von ihm selbst beschriben. Hg. von Gottlieb Christian Friedrich Mohnike. Greifswald 1823-1824.
Schmidt, Peer. Spanische Universalmonarchie oder „teutsche Libertet“. Stuttgart 2001.
Schmitt, Eberhard und Friedrich K. v. Hutten. Das Gold der Neuen Welt. Berlin 1999.
Scholz Williams, Gerhild. „Der Zauber der Neuen Welt: Reise und Magie im 16. Jahrhundert.“ The German Quarterly 65/3-4 (1992): 294-305.
Staden, Hans. Warhaftige Historia. Zwei Reisen nach Brasilien (1548-1555). História de duas viagens ao Brasil. Kritische Ausgabe. Hg. von Franz Ober-
Helmut Galle
34
meier, Übers. Guiomar Carvalho Franco (pt.), Joachim Thiemann (dt.). Kiel 2007.
Stanzel, Franz K. Theorie des Erzählens. Göttingen 1991. Todorov, Tzvetan. Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen. Übers.
Wilfried Böhringer. Frankfurt a.M. 1985. Velten, Hans Rudolf. Das selbst geschriebene Leben. Eine Studie zur deutschen
Autobiographie im 16. Jahrhundert. Heidelberg 1995. Villas Bôas, Luciana. „A German Mamluk in Colonial Brazil?“, in: Wellbery,
David E./Ryan, Judith (Hg.) A New History of German Literature. Cam-bridge, Massachussetts 2004: 246-50.
von Engelhardt, Michael. „Faust in Amerika“, in: Cziesla, Wolfgang/von Engel-hardt, Michael (Hg.). Vergleichende Literaturbetrachtungen. München 1995: 133-153.
„Wagnerbuch“. Ander theil D. Johann Fausti Historien / von seinem Famulo Christoff Wagner 1593. Hrgs. u. eingel. von Josef Fritz. Halle a.d.S. 1910.
„Wagnerbuch.“ Mahal, Günther/Ehrenfeuchter, Martin (Hg.). Das Wagnerbuch von 1593. Bd. I. Faksimiledruck des Exemplars der Bayerischen Staatsbiblio-thek. Tübingen 2005.
Wenzel, Horst. „Autobiographie“, in: Röcke, Werner/Münkler, Marina (Hg.). Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur 1. Band, 1. München 2004: 572-95.
Wenzel, Horst. „Deutsche Conquistadoren. Hans Staden in der Neuen Welt“, in: Huschenbrett, Dietrich/Margetts, John (Hg.). Reisen und Welterfahrung in der deutschen Literatur des Mittelalters. Würzburg 1991: 290-305.
Wolf, Gerhard. „Fremde Welten – bekannte Bilder: Die Reiseberichte des 15./16. Jahrhunderts“, in: Röcke, Werner/Münkler, Marina (Hg.). Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hansers Sozialgeschichte der deut-schen Literatur 1. Band, 1. München 2004: 507-628.