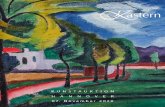„Die astronomische Uhr am Rathaus zu Olmütz/Olomouc“, in: Manfred SCHUKOWSKI, Uta JAHNKE and...
-
Upload
metropolitanstudies -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of „Die astronomische Uhr am Rathaus zu Olmütz/Olomouc“, in: Manfred SCHUKOWSKI, Uta JAHNKE and...
1
Manfred SCHUKOWSKI, Uta JAHNKE und Wolfgang FEHLBERG (Hg.). Mittelalterliche astronomische Großuhren: Internationales Symposium in Rostock, 25. bis 28. Oktober 2012 (= Acta Historica Astrono-miae, 49), Leipzig 2014, S. 125–154 [S. 125]
Die astronomische Uhr am Rathaus zu Olmütz/Olomouc1
Günther Oestmann, Bremen Behandelt wird die Geschichte der astronomischen Uhr an der Fassade des Rathauses von Olomouc/Olmütz unter besonderer Berücksichtigung der umfassenden Überarbeitung und Erweiterung in den Jahren 1573–75 sowie den erhaltenen Bestandteilen aus dem 16. Jahrhun-dert, unter denen das Rete des Astrolabzifferblattes das bedeutendste Objekt ist. The paper treats the history of the astronomical clock at the face of the town hall of Olmütz/Olomouc with special consideration of the substantial reconstruction executed in 1573–75 and the extant parts of the clock. Among these the rete of the astrolabe dial is the most significant object.
Von der astronomischen Uhr an der Fassade des Rathauses von Olomouc sind
nur noch wenige Bestandteile aus früheren Zeiten erhalten, denn diese ist im
Laufe der Jahrhunderte wiederholt um- und neugebaut worden. Am Aufstel-
lungsort ist inzwischen keinerlei historische Substanz mehr vorhanden, denn
bei der gegenwärtig vorhandenen Uhr handelt es sich um einen in der Nach-
kriegszeit erfolgten Neubau. Sehr treffend stellte Richard Michalik (1901–1993)
in seiner 1943 veröffentlichten Broschüre über die Olmützer Uhr fest: „Ihre Ge-
schichte ist die Geschichte ihrer Wiederherstellungen“2 – und man muß hinzu-
fügen: auch ihrer Vernachlässigung. Dies als besonders negativen Einzelfall
hervorzuheben hat allerdings wenig Berechtigung, denn nahezu sämtliche mo-
numentalen Uhren [S. 126] unterlagen, sofern diese nicht gänzlich beseitigt
wurden, im Laufe der Jahrhunderte erheblichen Veränderungen und sind dem
jeweiligen Zeitgeschmack angepaßt worden. Dabei fanden konservatorische As-
pekte – wenn überhaupt – in der Regel eher nachrangige Berücksichtigung.
1 Die Hans R. Jenemann-Stiftung (Frankfurt/M.) und die Seeberg-Stiftung (c/o Ernst-Abbe-
Stiftung, Jena) stellten freundlicherweise die Mittel für die erforderlichen Forschungsarbei-ten zur Verfügung. Ohne diese Unterstützung wäre mir die Abfassung des vorliegenden Aufsatz unmöglich gewesen, und hierfür sei beiden Institutionen herzlich gedankt. Bei mei-nen Recherchen in Olomouc waren mir Martin Zdražil, Dr. Peter Adamik (Vlastivědné mu-zeum/Regionalmuseum) und Dr. Miroslav Koudela (Státní okresní archiv/Bezirksarchiv Olomouc) sehr behilflich.
2 Michalik 1943, S. 9.
2
I. Zur frühen Geschichte der Olmützer Rathausuhr bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts
Bereits 1392 findet sich Erwähnung eines gewissen Nicolaus als „rector horolo-
gii“ im ältesten Stadtbuch.3 Es gab demnach gegen Ende des 14. Jahrhunderts
eine öffentliche Uhr in Olmütz, und um 1460 arbeiteten dort bereits 8 Uhrma-
cher4, so daß man die Stadt neben Prag als zweites bedeutendes Zentrum der
Uhrmacherei in Böhmen und Mähren ansehen kann. Über die frühe Geschichte
der Rathausuhr sind jedoch nur sehr spärliche Überlieferungen vorhanden.
Das angebliche Entstehungsjahr 1422 taucht erstmals in der 1746 von dem
Stadtsyndikus Florian Joseph Lautsky verfaßten, handschriftlichen „Geschichte
der königlichen Hauptstadt Olmütz“ auf.5 1808 wird von Joseph Wladislaw
Fischer der Name des aus Sachsen stammenden Uhrmachers Anton Pohl einge-
führt. Dieser soll zunächst 1419 die Uhr am Altstädter Rathaus in Prag, an-
schließend die Olmützer Rathausuhr für 156 Schock Groschen gebaut haben
und danach nach Breslau gegangen sein.6 Inwieweit es sich um eine historische
Tatsache oder eine Legendenbildung handelt, muß offenbleiben, denn es exis-
tieren keinerlei archivalische Nachweise, die eine derart frühe Entstehung der
Uhr belegen könnten.7 Vielfach wird auch erwähnt, daß der Rat besagtem Meis-
ter Pohl die Augen habe ausstechen lassen, damit dieser nicht für eine andere
Stadt ein etwa noch bedeutenderes Werk hätte schaffen können. Derartige Ge-
schichten werden jedoch über nahezu jede berühmte Monumentaluhr kolpor-
tiert und spiegeln keinesfalls historische Begebenheiten wider. Vielmehr gehö-
ren diese in den Fundus der Künstlerlegenden.8
Der Humanist Stephanus Taurinus (Stieröxl, geb. um 1485, † 1519) rühmt
im alphabetischen Index seiner Stauromachia, einem Versepos über den unga-
rischen Bauernkrieg von 1514, ein automatisches Werk, an dem sich wunderba-
rerweise die Tierkreiszeichen bewegten:
[S. 127] „In Autemate illo horario quod miris quibusdam signis semet volven-tibus ad fabre elaboratum est / ab mercatoribus extrariis quibus pleraque pars orbis peragrata est palma tribuitur uni Olomuntio.“9
3 Čermák 2005, S. 5. 4 Čermák 1972/73, S. 57f. 5 Kux/Kreß 1904, S. 9. 6 Fischer 1808, Bd. 1, S. 170. 7 Jenes Datum findet sich anschließend in mehreren späteren Publikationen (etwa Peyscha
1886, S. 1f.; Fischer 1966, S. 38). Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kursierte auch die Zeitanga-be um 1490 (Kux/Kreß 1904, S. 21f.).
8 Kris/Kurz 1934, S. 118. 9 Taurinus 1514, fol. L2r.
3
Diese Erwähnung deutet darauf hin, daß es in Olmütz zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts eine astronomische Uhr gegeben haben muß. Über deren Aussehen
vor der umfassenden Neugestaltung in den Jahren 1573–75 ist – abgesehen von
einer kurzen Erwähnung von Simon Ennius Klatovsky (1520–1561) – nichts
überliefert. In seinem 1550 erschienenen Lobgedicht auf die Stadt Olmütz heißt
es:
„Inferius monstrat certas properantibus horas,/ Quae stat in ambigua lubrica Sphaera rota./ Effigies odstant circum,/ temoneque recto Anni demonstrant ordine cuique dies“10
Wie es auch von anderen monumentalen Uhren überliefert ist, bedurfte die
Olmützer Uhr fortdauernder Wartungsarbeiten, die seit 1529 in den Stadtrech-
nungen und anderen Quellen belegt sind.11 1561 wurde der Uhrmacher Hans
Pohl für die Wartung der beiden städtischen Uhren (des Rathauses und von St.
Michael) als „städtischer Zeigermeister“ unter Vertrag genommen.12
II. Die erste umfassende Überarbeitung und Erweiterung in den Jahren 1573–1575
Die erste Neugestaltung der astronomischen Uhr erfolgte im Zuge umfassender
Baumaßnahmen, die in den Jahren 1564–1581 durchgeführt wurden.
Olmütz hatte sich zum politischen und kulturellen Zentrum Nordmährens ent-
wickelt und die Stadt war durch die Vermehrung des Landbesitzes etlicher Bür-
ger zu großem Wohlstand gelangt. Man suchte nunmehr das Rathaus repräsen-
tativer auszustatten: 1564 wurde dessen Ostportal vollendet und 1581 die Rats-
stube außerordentlich reich neu ausgestaltet.
Zunächst hatte der Rat über seinen Vertrauensmann, den kaiserlichen Hof-
sekretär Walter v. Waltersperg, mit dem Arzt und Astronomen Thaddäus Hage-
cius (Tadeáš Hájek z Hájku, 1525–1600)13 verhandelt, allerdings erfolglos, da
[S. 128] dieser nicht abkömmlich war. Waltersperg benannte daraufhin einen
10 Klatovsky 1550; dt. Übers.: Unten zeigt eine Uhr mit eilenden Zeigern die Stunden,/ Deren
Rund über zwei kreisende Scheiben sich dreht;/ Ringsum stehen Gestalten, mit sicherem Stabe sie weisen/ Nach der Ordnung des Jahrs Jeglichem richtig den Tag (Michalik 1943, S. 6).
11 S. d. Nachweise bei Kux/Kreß 1904, S. 101f., 107, 109f. 12 Ebd., S. 111; Čermák 2005, S. 12. Lt. J. W. Fischer war dieser angeblich ein Urenkel von An-
ton Pohl (Fischer 1808, Bd. 1, S. 172). 13 Kux/Kreß 1904, S. 31.
4
Kollegen von Hagecius, den kaiserlichen Mathematiker und Leibarzt Paulus
Fabricius (1529–1588), der größtes Interesse an den Arbeiten bekundet hatte.
Fabricius stammte aus Lauban in der Lausitz (heute Lubań in Polen)14 und
scheint bei Johann Schöner in Nürnberg Astronomie studiert zu haben.
Er wurde 1554 mit einem Empfehlungsschreiben des Bischofs von Eichstätt per
saltum zum Magister an der Universität Ingolstadt zum Magister promoviert.
Zum Beweis seines Könnens veranstaltete Fabricius vor der versammelten Uni-
versität eine Vorführung mit mathematischen Instrumenten, die derartigen
Eindruck machte, daß der Promotion zugestimmt wurde. Die Instrumente
schenkte Fabricius anschließend der Universität und machte sich sogleich nach
Wien auf, wo er eine Lektur für Mathematik übernahm.15 An der Wiener Uni-
versität lehrte er neben der Mathematik auch Poesie und Rhetorik und wandte
sich medizinischen Studien zu. 1557 wurde Fabricius der Doktortitel verliehen
und er im Jahr darauf zum Professor ernannt. Neben der Botanik und Karto-
graphie16 galt sein Interesse auch der Konstruktion und dem Bau wissenschaft-
licher Instrumente und Uhren. So berichtete Fabricius 1557 von einer Uhr, die
Bruchteile von Sekunden anzuzeigen vermochte17, und er entwarf Holzschnitte
für die Anfertigung von wissenschaftlichen Instrumenten. 1564 überreichte er
der Stadtbibliothek in Zittau eine Säulchensonnenuhr18, und im Inventar der
herzoglichen Kunstkammer in München ist 1598 ein Kartonastrolabium mit
aufgeklebten Holzschnitten von Fabricius erwähnt, das auf der Rückseite eine
Landkarte zeigte.19
1577 entwarf Fabricius zwei Triumphbögen für den Einzug Rudolfs II. in
Wien und sah hierbei neben diversen Mechanismen auch einen beweglichen
Erdglobus zur öffentlichen Demonstration der copernicanischen Lehre vor.20
Von 1558 bis 1578 war Fabricius fünfmal Dekan seiner Fakultät und Hofma-
thematiker dreier Kaiser in Folge (von Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf
II.). Er wurde 1578 Mitglied der Kaiserlichen Kommission für die Reform des
Julianischen Kalenders und zählte zu den Gutachtern des Vorschlags Aloisius
14 Biobibliographische Angaben bei Otto 1800/21, Bd. I, S. 300–303, Aschbach 1865/88,
Bd. III, S. 187–194, Winter 1980 (zu Fabricius’ astronomischer Tätigkeit s. S. 62–87), Fröde 2010.
15 Schöner 1994, S. 374. 16 Winter 1980, S. 88–91; Fröde 2010, S. 62–64. 17 „[...] Horologium, exigua quantitate est, et sine ambiguitate in eo non modo minuta, sed
etiam secunda scrupula, imo & quindena tertia scrupula, notari poterunt“; zit. nach Da-Costa Kaufmann 1991, S. 224.
18 Die Sonnenuhr ist erhalten (Zittau, Städtisches Museum: Inv. Nr. 3234/2743), und der Be-gleitbrief von Fabricius an Bürgermeister Nikolaus v. Dornspach (1516–1580) wird in der Christian-Weise-Bibliothek in Zittau verwahrt (Mscr. A 72 [17]; s. Fröde 2010, S. 67–70).
19 „Ein gedruckht doppelt Astrolabium, aines Coeleste, das ander Terrestre, Pauli Fabritij Caesarej Mathematici, auf Papen gezogen“ (Diemer 2004, S. 151, Nr. 1884).
20 DaCosta Kaufmann 1993, S. 142–144.
5
[S. 129] Lilios (geb. um 1510, † 1576), der die Grundlage für die 1582 unter
Papst Gregor XIII. beschlossenen Maßnahmen bildete.21
Die Konzeption der astronomischen Anzeigen der Olmützer Rathausuhr wurde
von Fabricius erstellt und auch zum Teil selbst praktisch ausgeführt. In dem am
6. Juli 1573 geschlossenen Vertrag mit der Stadt (Transkription im Anhang)
verpflichtete sich Fabricius, der Stadt und dem Uhrmacher Hans Pohl als Bera-
ter zur Seite zu stehen und zwei Hauptbestandteile zur „vornewerung vnnd
vorbesserung des alten weitberumbten Vhrwercks“ anzufertigen: die Grund-
platte (Tympanum) für das Astrolabium mit einer Erdkarte und das darüberlie-
gende Netz (Rete). Weiterhin sollte die „alte vnderste scheiben“ erneuert wer-
den, womit sehr wahrscheinlich die Kalenderscheibe gemeint war.22 Zudem be-
inhaltete der Vertrag die Verpflichtung zur Übergabe von Planzeichnungen
(Visirungen) und einer Beschreibung der fertiggestellten Uhr für die Instand-
haltung des Werkes (diese Dokumente sind leider nicht erhalten). Sämtliche
Arbeiten waren binnen eines halben Jahres fertigzustellen, und Fabricius soll-
ten dafür 500 rheinische Gulden in zwei Raten gezahlt werden. Darüberhinaus
erhielt Fabricius zwei Pferde, und ihm wurde freie Verpflegung am Orte zugesi-
chert. Die Fertigstellung der Arbeit hat sich zwar etwas verzögert, war aber in
weniger als einem Jahr vollendet. Später (1580/86) kam zu dem Ensemble
noch die Steuerung eines Zifferblattes im Sitzungssaal des Rathauses hinzu.
Diese Arbeit wurde von dem aus Annaberg in Sachsen stammenden Uhrmacher
Daniel Sandberger ausgeführt, der dazu einen Mechanismus zum Schlagen der
„halben deutschen Uhr“ (von 1 bis 12) baute.23
Die Kunde von den anstehenden Arbeiten an der astronomischen Uhr
scheint sich weit verbreitet zu haben: Unmittelbar nach Beendigung der Arbei-
ten an der Straßburger Münsteruhr bewarb sich der Straßburger Mathematiker
Conrad Dasypodius (1531–1601) im September 1574 mit einem Empfehlungs-
brief Kaiser Maximilians II. um das Projekt.24
21 S. dazu im einzelnen Kaltenbrunner 1877, S. 491–493, 530. 22 Die stark verwitterte, im 18. Jahrhundert für die Jahre 1746–1849 übermalte Kalender-
scheibe mit einem Durchmesser von 190 cm befindet sich im Depot des Vlastivědné mu-zeum (Regionalmuseums) in Olomouc (Inv.-Nr. CH 967; s. Horský/Šimková 1985, S. 20).
23 Kux/Kreß 1904, S. 34, 36f.; Wiedergabe der Rechnungsbelege auf 115f. Mit einer Summe von 340 Schock Groschen waren die Kosten hierfür exorbitant hoch.
24 Empfehlungsbrief Kaiser Maximilians für Conrad Dasypodius vom 30.9.1570 (Olomouc, Státní okresní archiv (Bezirksarchiv): Archiv města Olomouc, Zlomky registratur 1426–1786 (Archiv der Stadt Olmütz, Bruchstücke der Registraturen 1426–1786), Karton 161; Inv.-Nr. 4471); Brief von Dasypodius an den Rat der Stadt Olmütz vom 20.9.1574 (ebd., Inv.-Nr. 4481).
6
[S. 130] Rete des Astrolabiums der Olmützer Rathausuhr von Paulus Fabricius (Olomouc, Vlastivědné muzeum: Inv.-Nr. CH 936) [S. 131] Rete des Astrolabiums der Olmützer Rathausuhr (Detailaufnahme der Plejaden und des Sterns Procyon) [S. 132] Rete des Astrolabiums der Olmützer Rathausuhr (Detailaufnahme der Sterns Sirius) [S. 133] Räderwerk für die astronomischen Indikationen der Olmützer Rat-hausuhr aus dem 16. Jahrhundert (Olomouc, Vlastivědné muzeum) [S. 134] Astronomisches Getriebe der Olmützer Rathausuhr mit Angabe der Inventarnummern der Bestandteile (Zeichnung des Verfassers)
[S. 135] Vom Astrolabium der Olmützer Rathausuhr ist nur das Rete erhalten,
dessen Durchmesser 1460 mm beträgt.25
Es ist aus vier einzelnen, aus Kupferblech geschnittenen Quadranten zu-
sammengesetzt, die mit schmiedeeisernen Streben auf der Rückseite vernietet
sind. Von der ursprünglich vorhandenen Vergoldung sind aufgrund der
jahrhundertelangen Exposition in Wind und Wetter nur noch vereinzelte Reste
erhalten. Alle Linien, Teilungen und Schriftzüge wurden wahrscheinlich zuerst
in die Metallplatte graviert und erst danach die einzelnen Quadranten getrennt
und an bestimmten Stellen ausgeschnitten, damit das Netz die Grundplatte so
wenig wie möglich verdeckte. Das reiche Dekor ist fast genau symmetrisch zum
Kolur (Großkreis) der Solstitien angelegt.
Der Wendekreis des Steinbocks bildet den äußeren Kreisumfang des Rete,
und daraus ergibt sich, daß es sich um ein Astrolabium handelt, bei dem das
Projektionszentrum im Südpol der Himmelskugel liegt („nördliches Astrolab“).
Es handelt sich um die bei tragbaren Astrolabien und den späteren Monumen-
taluhren des ausgehenden 15. und 16. Jahrhunderts verwendete Standardpro-
jektion. Bei den älteren Uhren wurde bei der Astrolabkonstruktion dagegen die
Projektion vom Himmelsnordpol aus angewandt („südliches Astrolab“), so daß
der Wendekreis des Krebses außen liegt. Dies ist bei den astronomischen Uhren
in Lund, Stralsund, Bad Doberan, Wismar, Bourges, Chartres, Villingen, Prag,
Bern, wie auch wahrscheinlich in Frankfurt und bei der ersten Straßburger
25 Olomouc, Vlastivědné muzeum (Regionalmuseum): Inv.-Nr. CH 936, ausführlich beschrie-
ben von Zdenĕk Horský in seinem Aufsatz „Fabriciovo planisférium z olomouckého orloje“, in: Horský/Šimková 1985, S. 29–32, dem zahlreiche der nachfolgenden Angaben entnom-men sind.
7
Münsteruhr der Fall, die sämtlich bis etwa Mitte des 15. Jahrhunderts entstan-
den sind.26
Die Genauigkeit und Ablesemöglichkeiten sind in beiden Fällen gleich.
Bei den frühen monumentalen Astrolabuhren gelang es durch die Verwendung
der stereographischen Projektion aus dem Himmelsnordpol den Jahreslauf der
Sonne anschaulicher darzustellen, denn hier ist der Tagesbogen der Sonne im
Sommer länger als im Winter, wie es ja den natürlichen Verhältnissen ent-
spricht. Liegt das Projektionszentrum im Himmelssüdpol, verhält es sich um-
gekehrt. Daß die ältere Darstellungsart verlassen wurde, hängt sicherlich mit
der wachsenden Verbreitung tragbarer Astrolabien im 15. und 16. Jahrhundert
zusammen, die bis auf ganz wenige Ausnahmen die stereographische Projektion
aus dem Himmelssüdpol aufweisen. Die Olmützer Uhr gehört mit Münster,
Ulm, St. Omer, Lyon [S. 136] und der zweiten Straßburger Münsteruhr von
1571/74 zu jener Gruppe späterer Monumentaluhren.27
Außer der Ekliptik finden sich auf dem Rete sowohl der Himmelsäquator als
auch der Wendekreis des Steinbocks, die Koluren der Sonnenwende und der
Tagundnachtgleiche sowie der Großkreis, welcher den Ekliptikpol und die
äquinoktialen Punkte durchschneidet. Der Himmelsäquator, lateinisch als cir-
culus aequinoctialis bezeichnet, ist – beginnend mit dem Frühlingspunkt –
in 360° und die Ekliptik in jeweils zwölf Abschnitte zu 30° geteilt.
Die Darstellung der Ekliptik ist jedoch sehr ungewöhnlich, und durch diese
Formgebung wurde eine im Vertrag festgelegte Forderung erfüllt: Da die Mond-
bahn der Ekliptik gegenüber um etwa fünf Grad geneigt ist, weicht der Mond in
diesem Umfang auf beiden Seiten von der Ekliptik in die Breite aus, und ent-
sprechend unterscheidet sich die Zeit des Auf- und Untergangs von dessen Po-
sition auf der Ekliptik. Damit man an der Uhr auch die Zeit der tatsächlichen,
d. h. von der Breitenbewegung beeinflußten Auf- und Untergänge des Mondes
ablesen konnte, fügte Fabricius an beiden Seiten der Grundkreislinie der Eklip-
tik fünf jeweils um ein Grad verschobene Kreislinien mit der gleichen ekliptika-
len Breite hinzu. Weil aber dadurch ein sehr breiter Streifen entstand, der das
Liniensystem auf der Grundplatte zu sehr verdeckt und es unmöglich gemacht
hätte, direkt entlang des Ekliptikrings abzulesen, wählte Fabricius eine originel-
le und scharfsinnige Lösung: Entlang der Ekliptik wurden Flächen von zehn
Graden ekliptikaler Länge und fünf Graden ekliptikaler Breite abwechselnd auf
26 Die astronomische Uhr Richard Wallingfords (1292–1336) besaß dagegen ein Astrolabium
mit Südprojektion, woraus gefolgert werden kann, daß er an die antike Tradition der anaphorischen Uhren anknüpfte, denn die in Salzburg und in den Vogesen gefundenen Bruchstücke von Bronzescheiben anaphorischer Uhren aus dem 2. Jahrhundert besaßen ebenfalls Südprojektionen (North 1975, S. 388).
27 Horský 1967, S. 29–32.
8
der nördlichen und südlichen Seite der Ekliptik schachbrettartig geöffnet.
Auf diese Weise ist eine Ablesung der Gradmarkierungen und Linien auf der
Grundplatte entlang des gesamten Ekliptikumfangs, insbesondere der Hori-
zontlinie zur Beobachtung der Auf- und Untergänge der Sonne, möglich.
Durch diese à jour-Technik erhielt das Rete der Olmützer Rathausuhr seine
charakteristische Gestalt, die es auf den ersten Blick von allen anderen unter-
scheidet.28
Alle Zeichen der Ekliptik, die beiden Koluren, der Äquator und die Kreisli-
nien der ekliptikalen Breiten sind beschriftet. Die Schrift ist eingraviert und war
ursprünglich mit schwarzer oder roter Farbe gefüllt, von der nur noch wenige
Spuren sichtbar sind. Wie es bei dem Rete eines Astrolabiums üblich ist, sind
auch hier nur einige der hellsten Sterne eingezeichnet, deren Auswahl sich nach
der Möglichkeit richtet, ihre Zeichen problemlos zu der Grundstruktur des Net-
zes hinzuzufügen. Der breite Streifen entlang der Ekliptik ermöglichte es Fabri-
cius, besonders die zodiakalen Sterne zu bevorzugen.
Insgesamt sind auf dem Netz 28 Sterne vorhanden und namentlich bezeich-
net. Nur die Sterngruppe der Plejaden ist summarisch benannt. Die Fläche, auf
der die sechs Sterne der Plejaden eingezeichnet sind, ist sehr klein und besitzt
[S. 137] nur einen Durchmesser von 16 mm. Ansonsten sind die Sterne sechs-
zackig mit Kreisen entsprechend ihrer scheinbaren Größe konstruiert.
Der Kreis für den hellsten Stern (Sirius) hat einen Durchmesser von 23 mm, für
Procyon sind es 18 mm und für die anderen Kreise 15 mm. Sirius und Procyon,
bei Fabricius mit den Namen ihrer Sternbilder als Großer Hund und Kleiner
Hund (Canis maior und Canis minor) beschriftet, sind als einzige in figürliche
Darstellungen ihrer Zeichen eingegliedert, während andere Sterne nur mit ih-
rem Zeichen und der Beschriftung versehen sind. Betrachtet man die Plejaden
als eine Gruppe, sind die Sterne auf dem Rete ungleichmäßig verteilt: Im Quad-
rant der Sommerzeichen (Krebs, Löwe und Jungfrau) befinden sich 8 Sterne, in
dem vorangehenden Quadranten (Widder, Stier, Zwillinge) 7 Sterne, im dritten
Quadranten (Waage, Skorpion und Schütze) 6 Sterne, und in den restlichen
drei Zeichen nur 2 Sterne. Das Zeichen des Löwen weist die meisten Sterne (4)
auf.
Die Sternpositionen weisen eine gewisse Streuung auf, und es ist bislang
nicht bekannt, welches Sternverzeichnis Fabricius für die Positionierung der
Fixsterne auf dem Rete verwendet hat. In zwei Fällen kam es zu Fehlern: Arctu-
rus (α Bootis) ist in der Deklination stark abweichend. Ein noch gravierender
28 Die geometrische Konstruktion zu erläutern, würde hier zu weit führen. Diese ist bei Ritter
1613, S. 89–92 beschrieben.
9
Fehler ist die Position von Capella (α Aurigae), dessen ekliptikale Breite negativ
statt positiv genommen wurde. Capella rutschte dadurch zwischen drei Sterne
im Sternbild Orion (α Orionis/Betelgeuse, γ Orionis/Bellatrix und β Orio-
nis/Rigel). Es ist erstaunlich, daß Fabricius dieser Fehler entgangen ist und un-
korrigiert blieb.
Paulus Fabricius hat den neuen Stern in der Cassiopeia beobachtet, der 1572
aufleuchtete und einige Monate lang neben Sonne und Mond das hellste Objekt
am Himmel blieb, und fand keine wahrnehmbare Parallaxe.29 Das Himmels-
phänomen war bis Anfang des Jahres 1574, also während eines Großteils der
Zeit, in der das Rete des Astrolabiums angefertigt wurde, sichtbar. Fabricius hat
die Position dieses außergewöhnlichen Objekts jedoch nicht auf dem Rete ein-
getragen.30
Den äußeren Rand des Rete bildet ein Ring mit dem Julianischen Kalender.
Jedem Jahrestag ist ein Teilstrich zugewiesen und am 31. Dezember noch ein
Vierteltag hinzugefügt. Das Frühlingsäquinoktium fällt auf den 11. März, das
Sommersolstitium auf den 12. Juni, das Herbstäquinoktium auf den 13. Sep-
tember und das Wintersolstitium auf den 12. Dezember. Der Frühling dauerte
demnach 93 Tage, der Sommer 93,2 Tage, der Herbst 90 und der Winter 89,05
Tage. [S. 138] Der nach mittlerer Zeit rotierende Sonnenzeiger berücksichtigte
die ungleichmäßige Einteilung des Kalenderringes natürlich nicht.
Auf dem Kalenderring sind 74 Feiertage namentlich eingetragen, und hier zeigt
sich, daß das Rete in Wien angefertigt wurde, denn die Auswahl nimmt keine
Rücksicht auf die Feiertage in Mähren, sondern entspricht den Gegebenheiten
in Wien. Bereits acht Jahre nach Fertigstellung der Olmützer Rathausuhr wur-
de der Kalender durch die gregorianische Kalenderreform ungültig. Eine Ver-
schiebung der Markierungen für die Äquinoktial- und Solstitialpunkte um 10
Tage hat man offenbar nicht in Betracht gezogen.
Auf der nicht erhaltenen Grundplatte (Tympanum) war neben den Wende-
kreisen und dem Himmelsäquator wahrscheinlich das bei tragbaren Astrola-
bien übliche Liniennetz (Höhenkreise/Almucantarate, Azimutlinien, Dämme-
rungslinie, Linien für die Grenzen der astrologischen Häuser und Temporal-
stunden) eingezeichnet. Hierzu war im Vertrag gefordert, daß von diesen Krei-
sen „mehr als in gemeinem brauch“ vorhanden sein sollten. Möglicherweise
29 Hellman 1944, S. 115, 360f. 30 Auf dem Astrolabium der zweiten Straßburger Münsteruhr von 1571/74 waren zwar keine
Sternpositionen vermerkt, aber Conrad Dasypodius stattete die Uhr mit einem mechanisch angetriebenen Sternglobus aus, auf dem die Position der Nova eingezeichnet ist. Dasypodi-us war allerdings der Auffassung, daß es sich um ein Phänomen der sublunaren Sphäre handeln müsse und bezeichnete es als Komet (Dasypodius 1580/2008, S. 132/133).
10
waren damit kleine Gradabstände der Almucantarate und Azimutlinien ge-
meint.
Über die Landkarte („Mappa des Erdtreichs“), die den Raum innerhalb des
Wendekreis des Krebses31 einnahm, ist nichts überliefert, was um so bedauerli-
cher ist, als dieses Objekt ein wichtiges Belegstück für Fabricius’ Aktivität als
Kartograph wäre.
Vor dem Rete bewegten sich ursprünglich ein Sonnen- und ein Mondzeiger.
Der Sonnenzeiger lief einmal an einem mittleren Sonnentag um; auf dem
Zifferblatt zeigte er die Zeit an und auf der Ekliptik die Position der Sonne im
jeweiligen Zeichen. Die Position des Mondes ergab sich aus der Stellung des
Mondzeigers. Eine rotierende, zur Hälfte geschwärzte und vergoldete Kugel am
Ende des Zeigers zeigte die Mondphasen an. Da aber kein Zeiger für die Bewe-
gung der Mondknoten vorhanden war, konnten Finsternisse nicht angezeigt
werden.
Das Netz der Olmützer Rathausuhr ist nicht nur hinsichtlich seiner Kon-
struktion ungewöhnlich, sondern auch, was die Fülle der Daten betrifft. Es war
offenbar das Bestreben des Stadtrats, ein möglichst großartiges und anspruchs-
volles Werk zu schaffen, doch ist kaum anzunehmen, daß die im Vertrag nie-
dergelegten, sehr detaillierten Spezifikationen von den Ratsherren selbst for-
muliert wurden. Vielmehr wird Fabricius seine Ideen und Vorstellungen einge-
bracht haben, die sich dann in den Ausführungsbestimmungen niederschlugen.
Vergleicht man das Rete mit dem Gegenstück der zweiten astronomischen
Uhr des Straßburger Münsters von 1571/74 (Straßburg, Musée des Beaux-Arts),
so fällt auf, daß diese wesentlich mehr astronomische Informationen als die
Olmützer Rathausuhr bot, wurden doch neben der Bewegung der Mondknoten
auch der Umlauf von Mars, Jupiter und Saturn angezeigt. Jedoch war das Rete
der [S. 139] Straßburger Uhr wesentlich einfacher konstruiert. Im Gegensatz
zur Olmützer Uhr gab es in Straßburg nur einen exzentrischen, in die zwölf Zei-
chen eingeteilten Ekliptikring, und Sternpositionen fehlten gänzlich.32 Anderer-
seits war der praktische Nutzen der ambitionierten Konstruktion in Olmütz
eher gering, denn aufgrund der Höhe des Zifferblattes und der verhältnismäßig
großen Entfernung waren weder die winzigen Darstellungen der Sterne noch
deren Bezeichnung zu sehen. Allenfalls mochte man die Lage der Ekliptik und
einzelnen Tierkreiszeichen wahrnehmen, die verhältnismäßig groß beschriftet
waren. Auch abgesehen davon scheint das Ganze in gewisser Hinsicht Selbst-
zweck und eine Art wissenschaftlicher tour de force gewesen zu sein, denn es
31 Im Vertragstext ist auf fol. 1r irrtümlicherweise der Wendekreis des Steinbocks genannt
(s. Anhang Nr. 1). 32 Oestmann 2000, S. 101ff.
11
war ohnehin nur entsprechend gebildeten Fachleuten möglich, die astronomi-
schen Inhalte des Zifferblattes zu verstehen. Jedoch war der repräsentative
Wert eines derartigen Spitzenerzeugnisses von Wissenschaft und Technik sehr
groß, und die Stadt Olmütz ließ sich dieses etwas kosten: Die für die Neugestal-
tung der Uhr aufgewendeten Beträge erreichten im Zeitraum von 1570 bis 1575
rund 750 Schock Groschen, was etwa einem Sechstel des jährlichen Budgets
von 4000–5000 Schock Groschen entsprach (s. Anhang, Nr. 4).
III. Die Geschichte der Uhr bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges, besonders aber der Besetzung der Stadt
durch schwedische Truppen in den Jahren 1642–1650, wurde die Uhr stark
mitgenommen, weshalb eine Renovierung notwendig wurde. Diese fand in den
Jahren 1661/62 statt und wurde von dem Uhrmacher Franz Jahn durchgeführt,
der von dem in der Mathematik und Astronomie bewanderten Jesuiten Anton
Gebhardt beraten wurde. Kurz darauf mußte die Uhr allerdings wegen ihres un-
regelmäßigen Ganges wiederholt gerichtet werden, so daß die ausgeführten Ar-
beiten offenbar unzureichend waren. Aus dieser Zeit stammt die älteste erhal-
tene bildliche Darstellung der Olmützer Rathausuhr. Es handelt sich um eine
lavierte Federzeichnung, die eine ungefähre Vorstellung vom Aussehen der Uhr
um die Mitte des 17. Jahrhunderts vermittelt.33
1746–1747 wurden im Zusammenhang mit der Renovierung des Rathauses
auch Umbauten an der Uhr vorgenommen, wobei die uhrentechnischen Arbei-
ten Johann Gervasius Gemple aus Olmütz und das Orgelspiel dem aus Passau
zugewanderten Johann Paul Weniger übertragen wurde. Die Malerarbeiten
führte
[S. 140] Älteste Darstellung der Olmützer Rathausuhr (Federzeichnung, um 1660; Olomouc, Státní okresní archiv: Karten- und Plansammlung, IX/2) [S. 141] Ansicht der Olmützer Rathausuhr nach der Renovierung von 1746/47 (Aquarell von Joseph Wladislaw Fischer, 1805; Olomouc, Státní okresní archiv, Lithographien- und Photographiensammlung: XXXII/25)
33 663 x 382 mm; Olomouc, Státní okresní archiv (Bezirksarchiv): Karten- und Plansamm-
lung, IX/2.
12
[S. 142] Frühe Photographie der Olmützer Rathausuhr (Atelier A. Pichler & Co., 1863; Olomouc, Státní okresní archiv, Lithographien- und Photographien-sammlung: X/5)
[S. 143] der im mährischen Johnsdorf gebürtige Freskomaler Johann Chris-
toph Handke (1694–1774)34 aus. Aus dieser Zeit existiert keine bildliche Quelle,
aber neben Skizzen Handkes35 und einer Beschreibung von seiner Hand ist ein
Aquarell von Joseph Wladislaw Fischer aus dem Jahre 1805 erhalten, das den
Zustand der Uhr nach der Renovierung zeigt.36 Unten ist die Kalenderscheibe
für den Zeitraum von 1746 bis 1849 und darüber das Astrolabium mit Sonnen-
und Mondzeiger zu sehen. Dieses wird von vier kleineren Zifferblättern flan-
kiert (links zur Anzeige der Viertelstunden und Stunden, rechts ein Halbkreis
vermutlich zur Angabe der Planetenstunden und ein Zifferblatt mit ungleicher
Teilung, dessen Funktion unklar ist). Anstelle der gotischen Baldachine sind
nunmehr barocke Dachhauben angebracht; in einem weiteren Stockwerk der
Uhr kamen links die Darstellung von Adam und Eva und rechts die Flucht nach
Ägypten hinzu. Im Medaillon (oben in der Mitte) ersetzte ein Bildnis Kaiserin
Maria Theresias das bis dahin vorhandene Porträt Leopolds I., und zu beiden
Seiten des Kalendariums befanden sich ein Porträt des Malers Handke und des
angeblichen ersten Schöpfers der Uhr Anton Pohl mit der Jahreszahl 1422.
Auch der lateinische Spruch am Sockel sowie die Mondphasenanzeige über dem
Bilde der Maria Theresia kamen neu hinzu. Nach der Belagerung der Stadt
durch die Truppen Friedrichs II. im Jahre 1758 und infolge mangelnder Pflege
war die Uhr „ihrer gänzlichen Erlöschung nahe“, wie J. W. Fischer 1808 be-
klagte.37 In den Jahren 1810–1811 erfolgten zwar Ausbesserungsarbeiten durch
den aus Dillingen stammenden Johann Martin Brügel, doch versagte die Uhr
1823 erneut ihren Dienst und stand bis 1898 endgültig still. 1832 machte der
Olmützer Uhrmacher Ludwig Leowille einen Vorschlag zur Wiederherstellung,
doch wurde dieser nicht umgesetzt. Im Laufe der Jahre gingen Bestandteile des
vernachlässigten Werkes und auch einzelne der mechanisch bewegten Figuren
verloren. Die inzwischen verblaßten und beschädigten Fresken und Inschriften
wurden durch den Olmützer Maler Anton Komarek im Jahre 1871 überarbei-
tet.38
34 Neue Deutsche Biographie, Bd. 7, S. 606–608; Kux/Kreß 1904, S. 146f. 35 Olomouc, Státní okresní archiv (Bezirksarchiv): Lithographien- und Photographiensamm-
lung, XXXII/26; Olomouc, Muzeum umění: K 1318, 1384. 36 754 x 392 mm, bez. Abbildung der kunstlichen Uhr an dem Olmützer Rathause in ihren
vortreflichen Zustand vom Jahre 1747; Josephus Wladislaus Fischer Iuris Doctor, deli-neavit, pinxit que Olomutii die XV. Februarii MDCCCV (Olomouc, Státní okresní archiv [Bezirksarchiv], Lithographien- und Photographiensammlung: XXXII/25).
37 Fischer 1808, Bd. 1, S. 170. 38 Kux/Kreß 1904, S. 151.
13
Aus dem Jahre 1863 ist eine Photographie der Uhr erhalten39, die noch im we-
sentlichen dieselben Details wie das bereits erwähnte Aquarell Fischers von
1805 zeigt. Jedoch war inzwischen das Bildnis Maria Theresias durch ein Port-
rät von Kaiser Franz I. ausgetauscht worden.
[S. 144] Feierliche Enthüllung der neugebauten Uhr am Olmützer Rathaus am 22.5.1898 (Aufnahme von H. Schleif; Olomouc, Státní okresní archiv, Lithogra-phien- und Photographiensammlung: XXXIX/4) [S. 145] Die in den Jahren 1947–1955 neuerrichtete Uhr am Olmützer Rathaus (Postkarte, um 1990)
[S. 146]
IV. Die umfassende Neugestaltung der Uhr in den Jahren 1894–1898 und deren Aussehen bis in die Gegenwart Der umfangreichen fünften Wiederherstellung von 1894–1898 gingen Anläufe
über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren voraus. Bereits im Jahre 1866 hat-
te der Stadtrat von dem Prager Uhrmacher Johann Hollub einen Projektent-
wurf erbeten, und 1878 arbeitete auch Pfarrer Anton Schwarz in Speitsch bei
Mährisch-Weißkirchen, der sich mit astronomischen Fragen beschäftigte, an
einem Plan zur Erneuerung der Rathausuhr. Jedoch starb Schwarz vier Jahre
darauf, ohne die Arbeiten vollendet zu haben. 1885 wurde schließlich der „Ver-
ein zur Wiederherstellung der astronomischen Kunstuhr in Olmütz“ gegründet,
ein Betrag von 25.000 Gulden eingeworben und 1891 ein Wettbewerb für die
Wiederherstellung der Kunstuhr ausgeschrieben.40 Drei Jahre darauf wurden
die Verträge mit den Unternehmern und Künstlern abgeschlossen und die
Turmuhrenfabrik Eduard Korfhage & Söhne im westfälischen Buer mit der
Herstellung eines Werkes beauftragt. Das mit einer Schwerkrafthemmung aus-
gestattete Uhrwerk stellte man im ersten Stockwerk des Rathauses unmittelbar
hinter der Uhrennische auf. Die im Laufe der Zeit mehrfach übermalten Fres-
ken Handkes wurden gänzlich beseitigt und neue Gemälde bei dem Wiener Ma-
ler Richard Bitterlich (1862–1940) in Auftrag gegeben. Bitterlich entwarf auch
neue Figuren, die vom nachmals bekannten expressionistischen Bildhauer
Bernhard Hoetger (1874–1949), damals Technischer Leiter der Werkstatt für
kirchliche Kunst von Franz Goldkuhle in Wiedenbrück, ausgeführt wurden.
39 Olomouc, Státní okresní archiv [Bezirksarchiv], Lithographien- und Photographiensamm-
lung: X/5. 40 Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst, 16, 1891, S. 218f.
14
Die dekorativen Holzarbeiten übernahm der Olmützer Bildschnitzer Karl Cel-
ler. Die Oberaufsicht des Neubauprojekts oblag seit 1894 zunächst dem Ver-
trauensmann der „K. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung
der Kunst- und historischen Denkmale“, Architekt Heinrich Holitzky aus
Brünn, der entschied, daß die Uhr im spätgotischen Stil gebaut werden solle.
Holitzky lieferte dann jedoch nicht die Einzelentwürfe für die praktische Aus-
führung, weshalb die Stadt das Vertragsverhältnis löste und die Arbeiten 1895
dem Wiener Architekten Robert Dammer übertrug. Die Gestaltung entsprach
einer idealtypischen, im Historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts ge-
pflegten Vorstellung gotischer Architektur. Das Astrolabium aus dem 16. Jahr-
hundert wurde demontiert und der Uhr ein heliozentrisches Planetarium beige-
geben, das die Bewegungen von Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn
zeigte. Aufgrund der langen Umlaufszeiten verzichtete man allerdings auf eine
Darstellung der Bewegungen von Uranus und Neptun. Am 22. Mai 1898 erfolg-
te die feierliche Einweihung der neuen Uhr.
[S. 147] Die Gemälde Bitterlichs wiesen jedoch erhebliche maltechnische Män-
gel auf und waren schon bald durch Witterungseinflüsse teils zerstört, teils
stark nachgedunkelt und daher nur noch schwer erkennbar. Aus diesem Grund
beschloß der Stadtrat 1925, neue Gemälde in Auftrag zu geben, bei dieser Gele-
genheit auch die polychromen Fassungen der Holzteile und der plastischen Fi-
guren zu erneuern sowie im Giebelfeld ein neues Stadtwappen in Stuck anbrin-
gen zu lassen. Mit diesen Arbeiten wurde der aus Brünn gebürtige Maler Jano
Köhler (1873–1941) beauftragt, der diese in den Jahren 1926/27 ausführte.
Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Uhr von deutschen
Truppen auf dem Rückzug zerstört. Der Wiederaufbau und die vollständige
Neugestaltung erfolgten nur wenig später in den Jahren 1947–1955 durch Karel
Svolinský (1896–1986), diesmal im Stil des Sozialistischen Realismus. Die Fas-
sade wurde mit Mosaikbildern dekoriert, die Apostelprozession durch Figuri-
nen von zwölf Zünften ersetzt, und links und rechts vom Kalendarium symboli-
sieren nunmehr die in Mosaik gelegten Ganzfiguren eines Arbeiters und Wis-
senschaftlers die „Arbeit von Kopf und Hand“.
15
Anhang
Quellentexte zur Olmützer Rathausuhr
Die Transkriptionen bei Kux/Kreß 1904, S. 112–114 sind mangelhaft und voller
Fehler, weshalb nachfolgend der Vertrag der Stadt mit Paulus Fabricius und
zwei Anschreiben von diesem nach Autopsie des Verfassers wiedergegeben
werden. Groß-/Kleinschreibung, Interpunktion und Absatzgliederung entspre-
chen dem Original. Weiterhin sind unter Nr. 4 die Ausgaben für die Neugestal-
tung der astronomischen Uhr in den Jahren 1570–1575 angegeben.
1. Vertrag des Olmützer Stadtrats mit Paulus Fabricius, 6.7.1573 Olomouc, Státní okresní archiv (Bezirksarchiv): Archiv města Olomouc, Zlomky registratur 1426–1786 (Archiv der Stadt Olmütz, Bruchstücke der Registraturen 1426–1786), Karton 161, Inv.-Nr. 4477
[Fol. 1r] Auff heut dato Montags nach Procopi, anno fünffzehenhundert vnnd
drey vnnd siebenzig Ist eine freundtliche gutwillige beredung geschlossen vnnd
gehalten worden, Zwischen den Ersamen Wolweisen Herrn Burgermeister vnnd
Radt der Stadt Olomutz, an einem, vnnd dem Ehrenvhesten, Achtbarn, Hochge-
larten Herrn Doctorn Paulo Fabricio Rhöm. Keys. Majestät Mathematico, we-
gen [S. 148] vornewerung vnnd vorbesserung des alten weitberumbten
Vhrwercks, an gemeiner Stadt Olomutz Radthause, anderstheils, nach volgen-
der gestaldt, Das Her Doctor Paulus Fabricius der Stadt Olomutz zum theil dem
Vhrmacher zuhulff vnnd an sein Räderwerck solle machen drey scheyben,
Erstlich die matricem zum Astrolabio, darin gerissen seindt ihre nottwendige,
vnnd mehr als in gemeinem brauch sein circulos sampt der Mappa des
Erdtreichs, bis vber den Tropicum Capricorni nach bester gelegenheit, Zum an-
dern ein scheyben, daruber, die mahn das rete nennet, die sol kupffern pallirt
und zum vorgulden tuglich sein, dahin gerichtet, das sie der Vhrmacher auff ein
kreutz vnd ring auffniete, darauff soll der Zodiacus oder Thierkreyss mit seinen
zwelff zeichen gerissen vnnd ausgetheilet sein, auch auff beyden seiten zurei-
tung auffgangs vnd niedergangs des monats, vnd andern in dem termin begrif-
fenen quinque gradus latitudinis haben, dar [fol. 1v] zu zwischen allen andern
Cirkeln die vornembsten vnnd ansehenlichsten stern des gantzen himels bis
vber den Tropicum capricorni eingesatzt gestochen vnd vorzeichnet werden,
16
das aus oder durchbrechen aber, an dieser scheiben auch das vorgulden sol
ausgenommen sein, vnd durch andere leuth, darzu ein Ersamer Radt das goldt
geben sol, dan durch obbemelten Herren Doctorem Fabricium vorrichtet wer-
den, Zum dritten sol die alte vnderste scheiben ernewert werden, Vnd hat sich
mehrermelter Doctor Fabricius erbotten, erbeut sich auch hirmith noch, da ehr
nach seinem besten, treuesten radt, bessere und wichtigere sachen als itzo dar-
innen vnd darauff seindt, ordenen will, welches ihme dann vff sein gut vortra-
wen ist heimgesetzt worden,
Ehr wirdt auch hie neben die vnkosten auff Kupffer palliren vnd stechen des-
gleichen auff mahlen vor sich selbst auff sein vnkosten, was diese scheiben be-
rureth, vorrichten vnd zalen auch wo ehr kan dem Vhrmacher zum werck hulff-
lich vnnd rötlich sein, Letztlich so gross das werck ist, sol ehr Visirungen beim
werck lassen, darzu die stuck in einem buche sampt ihren nutz zum notwendi-
gen richten beschreiben vnnd mit vbergeben, Solches soll beschehen vngerfer-
lich in frist eines halben Jahres,
Entkegen sollen anderstheils obbemelte Hern Burgermeister vnd Radt ihme
Doctori Fabricio in ansehung seiner Zehrungen vberlandt, von Wien kegen
Olomutz zwey zimlicher guter Ross geben, auch was ehr itzo alhier in der Her-
berge vorzehret, erlegen, ferner funffhundert gulden Reinisch, ieden gulden zu
funffzehen patzen in guter ganger vnnd im Osterreich landesweriger muntz, vor
vnkosten, mühe vnd kosten bezalen, also das zum ersten den halben theil,
nemblich zweyhundert vnd funffzig gulden Reinisch in muntz, ihme bevor her-
aus darauff erlegen, [fol. 2r] wie sie dan auch also solche itzo gemelte summa
bar von stunden mit dem bescheidt gereicht vnnd dem Doctor Fabricio erlegt
haben, das wo nach Gottes willen ehr D. Fabricius von diesem leben erfordert
würde, vor gefertigtem werck, sie die Hern von Olomutz dieses geldes halben zu
seinen erben vnd guth zuspruch hetten, den andern halben theil nemblich die
zweyhundert vnd funffzig gulden Reinisch in muntz, sollen vnnd wollen die ob-
bemelte Hern, nach [S. 149] gefertigtem des Doctoris Fabricij werck erlegen
vnd als baldt bezalen, beyderseits treulich vnnd vngerferlich, Zu gewissen
Vrkunden, vnd mehrer nachrichtigunge ist diese freundtliche gutwillige beyder-
seits beredung zwiffach vffs Papir gebracht, Vnd mit der Stadt Olomutz gemei-
nem Insiegel, desgleichen des offtgemelten Herrn Doctorn Fabricij pitschafft
bekrefftiget, vnd iedem theil eine zugestaldt Actum Olomutz wie oben vormel-
det.
[Stadtsiegel]
17
Ich Paulus Fabricius Doctor Ro: Kay: Matt etc. mathematicus beken mit diser
meiner handtschrifft das ich dj obbemelte summa nemlich zweyhundert vnd
funffzig gulden also bar empfangen habe Actum den achten Julij 1573.
Paulus Fabricius Doctor ut supra manu propria.
2. Schreiben von Paulus Fabricius an den Rat der Stadt Olmütz, 16.1.1574 Inv.-Nr. 4478
[Äußere Seite des Briefs mit Siegelrest und der Aufschrift:]
Dem Edlen vesten Ersamen vnd hochweisen Hern N. Bürgermeister Richter
vnd Rathmannen der Statt Olomuntz meinen großgünstigen Hern vnd freun-
den/ Olomuntz
Meine willige dinst bevor.
Edle Ersamen hochweisen gunstige herrn. Inn dem werck zu Ewerer vnd Ge-
meiner Statt Olmuntz vhr gehörig, habe ich bishero fleissig an vnd an fort züge-
richtet vnd dahin Gottlob kommen das ich das kupffer zu der einen grossen
scheiben mache, vnd nach dem ich allen vmbstenden nach befinde auch schon
mit gutten leuten gehandelt habe das es alhie zu Wien auffs fürderlichst mit
durchbrechung vergüldung vnd aller außbereitung derselben schejben, daran
sehr vil gelegen ist zugieng, ist mein anlangen an Ewer vest vnd Ersame hoch-
weisheit die wöllen mir diewejl diese fuhrleut gewiß wider zurück fahren vnd
Inen wie ich höre zuvertrauen ist hundert gulden mit schicken. Damit ich das
durchbrechen vnd vergulden der kupfferen schejben alhie zu Wien da ichs an
vnkosten auch am geringsten zeugen kan vnd auffs schönest vnd gerechtest
weiß zu erhalten, verrichte, dann solchs Zubefürderung des wercks bejde mir
vnd E. vest. auch dinstlich ist.
Vnd nach dem das durchbrechen vnd vergulden nicht In meiner Instruction
auff meine vnkosten felt, wil ich was auff dasselb gehen wirt E. vest. verraiten
vnd von denen die mir vmbs gelt daran arbejten vor E. vest vnd Ersamen Rth.
quittung vorbringen was mir vberbleibt zeucht man mir darnach an meiner be-
stallung ab, hiemit thue ich E. Vest vnd w. Gott dem almechtigen bevelhen.
Wer mir das gelt zustelt den will ich darumb quittieren.
[S. 150] Datum Wien 1574 den 16. tag Januarij.
18
Euer Edl vest und hochweisheit dinstwilligster Paulus Fabricius der Erznei Doc-
tor, Ro: kais: Mait. etc. mathematicus
3. Schreiben von Paulus Fabricius an den Rat der Stadt Olmütz, 4.4.1574 Inv.-Nr. 4479
[Äußere Seite des Briefs mit dem Siegel von Paulus Fabricius und der Auf-
schrift:]
Dem Edlen Ehruesten Ersamen wolweisen Herrn. N. Bürgermeister Richter
vnd Ratthsfreunds der Stat Olomuntz, meinen sonders großgünstigen hern
vnnd freunden zusenden/ Olomuntz
[Seitlich Vermerk:] Paulus Fabricius, will zu einrichtung der Uhr herkommen
1574.
Meine willige dinst vnd alles gutts bevor.
Edlen Ehrnvesten, Ersamen, wolweisen gunstigen hern. Ich kann E. Vest vnd
hr. [?] nicht bergen das ich mit denen sachen, so ich mich zu der uhr zu machen
vnterfangen, nun fast fertig bin, auch am Gottwol in oder baldt nach den Oster-
feiertagen willens hie auff zu sein vnd die sach mit mir hinein zu bringen.
Ich habe das durchbrechen gleich auff mich genommen vnd dasselb verrichtet,
wöllen vns wol darumb vergleichen, dan es ist von nöten gewesen vnd ich hette
sonst nichts richten können mit meinen andern sachen. Wollen derhalben mei-
ne herrn dahin gedacht sein, das die kupfer auff ehiste muege verguldet wer-
den. Vnd so es sein möchte das wen ich gen Olomuntz komme möchte ein ai-
gens zimmer haben wen es gleich nicht so gar nahendt gelegen wäre mir nichts
daran gelegen. Solchs so es sein kan währe mir angenäm. Es hatt der her Mee-
peck ein hauß bej der mauer. Ist zu jener zeit ledig gestanden. Ich wäre wol con-
tent damit.
Hiemit was meinen großgünstigen herrn lib vnd angenäm ist Gott sej mit vns
allen.
Datum Wien. 1.5.7.4. den 4 tag Aprilis.
E. vest vnd w. Dinstwilligst Paulus Fabricius Doctor Ro: Kej: Matt:&c Mathe-
maticus
19
[S. 151]
4. Ausgaben für die Arbeiten an der astronomischen Uhr von August 1570 bis Herbst 1575 (Kux/Kreß 1904, S. 33) Schock Groschen Denare Vorarbeiten für die Neuherstellungen 52 ½ 13 4 Auslagen für Kupfer 127 14 – Auslagen für Blei 1 ½ 24 – Für den Rotgießer (Glockengießer) Georg Hochperger 92 23 – Für den Uhrmacher Hans Pohl 80 – – Für Dr. Fabricius (500 fl. rhein. samt seinen Taggeldern) 230 17 2 ½ Goldschmied- und Goldschlägerarbeiten 52 – – Tischler- und Bildhauerarbeiten 32 ½ – – Malerarbeiten 80 – – Summe 750 1 6 ½
Literatur Aschbach 1865/88 ASCHBACH, Joseph Ritter von. Geschichte der Wiener Universität. Wien 1865/88 Čermák 1970/71 ČERMÁK, Miloslav. „Die Olmützer Uhrmacher in der Vergangenheit“. Schriften des Historisch-Wissenschaftlichen Fachkreises „Freunde Alter Uhren“ in der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie/Freunde Alter Uhren, 10, 1970/71, S. 90–104 Čermák 1972/73 ČERMÁK, Miloslav. „Die Olmützer Uhrmacher – Ein Resümee“. Schriften des Historisch-Wissenschaftlichen Fachkreises „Freunde Alter Uhren“ in der Deut-schen Gesellschaft für Chronometrie/Freunde Alter Uhren, 12, 1972/73, S. 57–58 [S. 152] Čermák 2005 ČERMÁK, Miloslav. Olomoucky orloj. Olomouc 2005
20
DaCosta Kaufmann 1993 DaCOSTA KAUFMANN, Thomas. „Astronomy, Technology, Humanism and Art at the Entry of Rudolf II. into Vienna, 1577: The Role of Paulus Fabricius“, in: Ders., The Mastery of Nature: Aspects of Art, Science, and Humanism in the Renaissance, Princeton 1993, S. 136–150 Dasypodius 1580/2008 DASYPODIUS, Conrad. Heron mechanicus: Seu de Mechanicis artibus, atque disciplinis. Eiusdem Horologii astronomici, Argentorati in summo Templo erecti, descriptio, Straßburg 1580, Hg. Günther Oestmann, Übers. Bernard Ara-towsky† (= Algorismus: Studien zur Geschichte der Mathematik und der Na-turwissenschaften, Hg. Menso Folkerts, H. 68). Augsburg 2008 Diemer 2004 DIEMER, Peter (Hg.). Johann Baptist Fickler: Das Inventar der Münchner herzoglichen Kunstkammer von 1598 (= Bayerische Akademie der Wissen-schaften, Phil.-Hist. Klasse, Abhandlungen, N. F., 125). München 2004 Fischer 1808 FISCHER, Joseph Wladislaw. Geschichte der königlichen Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz im Markgrafthume Mähren. Olmütz/Brünn 1808 Fischer 1966 FISCHER, Karl. „Die Uhrmacher in Böhmen und Mähren zur Zeit der Gotik und Renaissance“. Bohemia: Jahrbuch des Collegium Carolinum, 7, 1966, S. 27–58 Fröde 2010 FRÖDE, Tino. „Paulus Fabricius – ein universaler Humanist aus Lauban: Sein Leben, seine Schriften und seine Beziehungen zur Oberlausitz“. Neues Lausitzisches Magazin: Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wis-senschaften e. V., N. F., 13, 2010, S. 55–70 Hellman 1944 HELLMAN, Clarisse Doris. The Comet of 1577: Its Place in the History of As-tronomy (= Studies in History, Economics and Public Law Edited by the Fac-ulty of Political Science of Columbia University, 510). New York 1944 [S. 153] Horský 1967 HORSKY, Zdeněk. “Astronomy and the Art of Clockmaking in the Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Centuries”. Vistas in Astronomy, Hg. Arthur Beer, 9, Oxford/London 1967, S. 25–34 Horský/Šimková 1985 HORSKY, Zdeněk und Anežka ŠIMKOVÁ. Olomoucky orloj. Olomouc 1985 Kaltenbrunner 1877 KALTENBRUNNER, Ferdinand. „Die Polemik über die Gregorianische Kalen-derreform“, in: SB Österreich. Akademie der Wissenschaften, 87, 1877, S. 485–586
21
Klatovsky 1550 KLATOVSKY (GLATOVINUS), Simon Ennius. Breve encomion Olomucii me-tropolis, scriptum carmine elegiaco Breve encomion Olomucii metropolis: In Moraviae Marchionatu, scriptum in gratiam amplissimi Senatus Urbis ejusdem, carmine Elegiaco. Prostĕjov (Proßnitz)1550 Kris/Kurz 1934 KRIS, Ernst und Otto KURZ. Die Legende vom Künstler: Ein geschichtlicher Versuch. Wien 1934 Kux/Kress 1904 KUX, Hans und Max KRESS. Das Rathaus zu Olmütz: Ein Gedenkblatt zu sei-ner Wiederherstellung. Olmütz 1904 Michalik 1993 MICHALIK, Rudolf. Die Kunstuhr (= Das schöne Olmütz: Schriftenreihe hg. von Oberbürgermeister der Hauptstadt Olmütz, H. 1). Olmütz 1943 (Ndr. in: Olmützer Blätter: Heimatzeitung der Olmützer und Mittelmährer, 41, 1993, S. 142–151) North 1975 NORTH, John David. „Monasticism and the First Mechanical Clocks“, in: FRASER, J. T. und N. LAWRENCE (Hg.), The Study of Time II: Proceedings of the Second Conference of the International Society for the Study of Time, Ber-lin/ Heidelberg/New York 1975, S. 381–398 Oestmann 2000 OESTMANN, Günther. Die Straßburger Münsteruhr: Funktion und Bedeutung eines Kosmos-Modells des 16. Jahrhunderts. 2. Aufl. Berlin/Diepholz 2000 [S. 154] Otto 1800/21 OTTO, Gottlieb Friedrich. Lexikon der seit dem funfzehenden Jahrhunderte verstorbenen und jeztlebenden Oberlausizischen Schriftsteller und Künstler. Görlitz/Leipzig 1800/21 Peyscha 1886 PEYSCHA, Franz. Die Olmützer Kunstuhr: Ein Beitrag zur Lokalgeschichte der Stadt Olmütz. Olmütz 1886 Ritter 1613 RITTER, Franz. Astrolabium, Das ist: Gründliche Beschreibung und Unter-richt/ wie solches herrliche und hochnützliche Astronomische Instrument/ auff allerley Polus Höh/ so wol auch nach eines jeden selbst gefälligen Größ auf-fgerissen/ und verfertigt werden soll. Darnach wie dasselbe vielfältig zu gebrauchen: Mit Kupferstücken verfertiget. Nürnberg o. J. [1613] Schöner 1994 SCHÖNER, Christoph. Mathematik und Astronomie an der Universität Ingol-stadt im 15. und 16. Jahrhundert (= Ludovico Maximilianea Universität Ingol-stadt-Landshut-München: Forschungen und Quellen, 13), Berlin 1994
22
Taurinus 1519 TAURINUS [STIERÖXL], Stephanus. Stauromachia id est, cruciatorum servile bellum […]. Olmütz 1519 Winter 1980 WINTER, Robert. Paulus Fabricius: Ein Wiener Universitätsprofessor des 16. Jahrhunderts. Diss. Universität Wien 1980 (masch.schr.) Anschr. d. Verf.: PD Dr. Günther Oestmann, Gandersheimer Str. 20, 28215 Bremen; e-mail: [email protected]