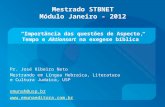Conference Presentation: Die Perspektive auf die jüdische Exegese und Philosophie bei Albertus...
-
Upload
albertus-magnus-institut -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Conference Presentation: Die Perspektive auf die jüdische Exegese und Philosophie bei Albertus...
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
©Henryk Anzulewicz
Die Perspektive auf jüdische Exegese und Philosophie bei Albertus Magnus. Versuch einer ersten Bestandsaufnahme
Zum Genius Loci Speyer sei eine historische Vorbemerkung erlaubt, die den deutschen König, Rudolf I. von Habsburg und die Person des Albertus Magnus betrifft. Wie die Chronisten und Biographen des Albertus Magnus überliefern, setzte sich dieser Dominikanergelehrte und ehemalige Bischof von Regensburg beim Papst Gregor X. am Rande des Konzils in Lyon 1274 für den Habsburger Rudolf I. ein, der am 1.Okt. 1273 in Frankfurt am Main zum deutschen König gewählt wurde. Rudolfs Anerkennung als deutscher König durch Gregor X. erfolgte am 26. Sept. 1274. Die Teilnahme des Albertus am Konzil in Lyon ist zwar historisch nicht zweifelsfrei erwiesen und in der Forschungsliteratur nicht unumstritten, aber die persönlich guten Beziehungen zwischen Albertus und dem König sind nicht von der Hand zu weisen.1 Es steht fest, dass die beiden Männer sich kannten, es ist wahrscheinlich, dass sie sich im November 1273 in Köln persönlich begegneten, und es ist bekannt, dass Albert im Auftrag von Rudolf I einige Geschäfte ausführte.2 König Rudolf I. von Habsburg starb am 15. Juli 1291 und fand seine in letzte Ruhestätte in der Grablege der deutschen Kaiser, Könige und Königinnen im Kaiserdom zu Speyer.
I
Wenden wir uns aber nun von Alberts Beziehungen mit Rudolf I. von Habsburg und damit indirekt mit Speyer dem eigentlichen Thema des Vortrages zu. Mit folgenden drei Fragen möchten wir ihn beginnen unduns dezidiert auf zwei dieser Fragen beschränken: (1) Was sagt uns die bisherige Forschung über Alberts Verhältnis zum Judentum und demgenuin jüdischen Element in Theologie, Philosophie und den anderen Wissenschaften? (2) Welche Einsichten bieten uns hierzu das Werk desAlbertus? (3) Zu fragen wäre auch, ob dieses Verhältnis des Doctor universalis einer geschichtlich gefestigten Ausprägung entspricht,
1 Das vierzehnte allgemeine Konzil in Lyon wurde von Papst Gregor X. am 7. Mai 1274 eröffnet. Die Krönung Rudolfs I. von Habsburg erfolgte am 24. Okt.1273 in Aachen; sie wurde durch den Kölner Erzbischof Engelbert II. vorgenommen. Cf. SIGHART 1857, 225–238. SEPPELT 1956, 524, 530–531. SCHEEBEN 1931, 116–117.2 Cf. SIGHART 1857, 225–238, bes. 235. SCHEEBEN 1931, 114–117, 151–152, 108.
1
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
welche es als zwiespältig, wechselhaft und exklusiv charakterisierenlässt, oder ob dieses Verhältnis sich von den Stereotypen abhebt. ImRahmen unseres Vortrags werden wir die erste Frage hinreichend beantworten können und bereits hier bei der Präsentation der Forschungslage hinsichtlich der Bibelexegese unsere eigenen Erkenntnisse einfließen lassen. Bei der Erörterung der zweiten Frageallerdings müssen wir uns aufgrund des enormen Umfangs der einzubeziehenden Schriften auf das Frühwerk und auf das bislang kaumerforschte Verhältnis von Albert und Isaac Israeli beschränken. Einegesonderte Behandlung der dritten Frage lässt sich in dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen nicht unterbringen und bleibt damit einer künftigen Betrachtung vorbehalten.
Soweit wir die Forschungslage überblicken, stellen wir fest, dass die Anfänge der systematischen Forschungen zu Alberts Kenntnissen und Assimilation jüdischer Philosophie und Wissenschaft – ausgenommen die Bibelexegese – in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu datieren sind. Dieser Umstand legt eine Koinzidenz der ersten systematischen Versuche einer Erschließung der jüdischen Anteile an der lateinischen Scholastik einerseits und einer Beschäftigung mit den lateinischen Anteilen an der jüdischen Philosophie andererseits in der sogenannten Neuscholastik nahe. Die zum großen Teil von jüdischen Gelehrten entfalteten, regen Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet kamen allerdings im Vorfeld des 2. Weltkrieges zum fast völligen Erliegen und der Neuanfang nachdem Krieg gestaltete sich überaus schwierig.3 Zu den wichtigsten Akteuren der ersten Stunde der neuscholastischen Periode zählten diejüdischen Gelehrten Manuel Joël, Jacob Guttmann, Adolf Jellinek und Moritz Steinschneider. Aus dem Kreis der nichtjüdischen Wissenschaftler, die sich in dieser Zeit der jüdischen Tradition beiAlbert annahmen, sind Josef Bach und der Dominikaner Anselm Rohner zu nennen.
Worin besteht aber das Verdienst der älteren Forschung, fragen wir, welche neuen Erkenntnisse sind ihr zu verdanken? Wie beeinflusste sie künftige Entwicklungen auf diesem Gebiet und welche Bedeutung wird ihr noch heute beigemessen?
Zunächst muss man festhalten, dass diese Forschungen erstmalig Alberts breite Kenntnisse der jüdischen Philosophie und der
3 Cf. RESNICK/KITCHELL, JR. 2002, pp. 328–330; speziell zu Moses Maimonides cf. HASSELHOFF 2004; ANZULEWICZ 2007, pp. 579–599.
2
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
nichtphilosophischen jüdischen Literatur im Allgemeinen aufgezeigt haben. Noch wichtiger aber waren die spezifischen Untersuchungen zumVerhältnis Alberts des Großen zu den Lehransichten der jüdischen Philosophen Isaac Israeli (um 832 – um 932), Avicebron (1021 – 1058)und Moses Maimonides (1138 – 1204). Diese Einzeluntersuchungen zeigten die für Albert und die jüdischen Denker gemeinsamen philosophischen und religionsphilosophischen Fragen auf und urteilten mit einzigartiger Fachkompetenz über das Gemeinsame und das Trennende der jeweiligen Standpunkte. Die Studien von J. Guttmann und J. Bach stellten Alberts breite Kenntnisse der jüdischen Quellen gegenüber ihrer sehr begrenzten Bekanntschaft in der lateinischen Scholastik heraus und sind an ihrem Erkenntnisgehalt gemessen nach wie vor unersetzlich, obwohl sie sichauf unkritische Ausgaben der Werke Alberts stützten, gelegentlich Schriften von unsicherer Echtheit in die Untersuchung einbezogen (z.B. Summa theologiae II) und noch nicht auf alle authentischen Schriften unseres Autors zugreifen konnten.4 Zu den von Guttmann sorgfältig untersuchten und geklärten Fragen gehören u.a. Alberts indirekte, kaum nennenswerte Kenntnis des Talmuds, seine beachtlicheVertrautheit mit den arabisch-jüdischen Schriften zu Astronomie und Astrologie sowie sein Verhältnis zu den philosophischen Lehren der Juden, darunter insbesondere zur Erkenntnislehre Avicebrons, Isaac Israelis und Moses Maimonides’. Die Frage, welche Kenntnisse des Talmuds Albert besaß ist nicht nur deshalb wichtig, weil er als Theologieprofessor der Pariser Universität mit anderen Fakultätskollegen ein Dekret des päpstlichen Legaten Odo von Chateauroux gegen den Talmud 1248 (15. Mai) unterzeichnete,5 sondern auch weil in seinem Werk einige direkte Anknüpfungen und indirekte Anspielungen an den Talmud vorhanden sind, deren Ursprung und Verständnis sich uns bis heute nicht gänzlich erschließen.6
So wichtig die Erkenntnisse der älteren Forschung zu Albertus waren,gaben sie doch offenkundig in mancher Hinsicht dem Druck nach, welcher damals von der stark auf Thomas von Aquin ausgerichteten Forschung zur Scholastik ausging. So urteilte beispielsweise Manuel Joël im Einklang mit der vorherrschenden Auffassung von der 4 GUTTMANN 1902. BACH 1881.5 CUP I, 178. Cf. RESNICK 2002, pp. 72f.6 Cf. ALBERTUS MAGNUS Super Dionysium De ecclesiatica hierarchia VII, p. 148.45; De animalibus VII.1.3, p. 504; Super Isaiam VI,4, p. 93.6; De natura boni, p. 5, Quellenapp. Anm. 65. Für die umfassendste Aufarbeitung dieser Frage siehe: Resnick 2002, 69–86.
3
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
privilegierten Stellung des Thomas von Aquin und dessen Überlegenheit gegenüber seinem Lehrer, dass Albert „in seiner geschichtlichen Stellung noch zu sehr Sammler und noch zu wenig systematischer Bearbeiter seiner Themata [gewesen sei], um das Beispiel, das Maimonides gegeben hatte, genügend nutzen zu können“.7 Diese Aussage wird von Guttmann zwar relativiert, jedoch nicht aufgehoben. Denn so wie Joël die Fähigkeit auf dem intellektuellen Niveau des Maimonides zu arbeiten bei Albert vermisste und sie erst bei Thomas von Aquin zu sehen glaubte, so sprach auch Guttmann Albert Originalität und ein systematisches Denkvermögen ab. Er betonte dennoch, dass Albert durch seine Gelehrsamkeit und die Breite seines wissenschaftlichen Interesses alle seine Zeitgenossen übertraf.8 So urteilte Guttmann mit Bezug auf Alberts Verhältnis zu Isaac Israeli, dass kein Scholastiker den philosophischen Ansichten dieses jüdischen Arztes und Philosophen so viel Beachtung gewidmet hatte wie Albertus Magnus. Aus den Untersuchungen von Guttmann und auch von Bach geht hervor, dass die Sachbereiche in Alberts Werk, indenen Isaacs Lehransichten berücksichtigt werden, hauptsächlich die Logik und die Erkenntnislehre, die Psychologie und die Kosmologie sowie die Lehre der Prophetie einschließen.9
Nach Guttmanns Studien musste dann ein halbes Jahrhundert vergehen bis die jüdische Tradition bei Albertus Magnus und auch dessen Einfluss auf die jüdische Philosophie wieder allmählich zum Gegenstand der Forschung wurden. Die Impulse hierzu gingen offenbar von dem von Josef Koch gefassten Plan einer kritischen Edition des lateinischen Dux neutrorum von Moses Maimonides aus. Als Wolfgang Kluxen mit diesem Projekt betraut wurde, stellte sich bald für ihn heraus, dass die Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte der Hauptschrift des Maimonides nicht ohne die Klärung von Alberts Rollein diesem Prozess möglich ist. Diesen Fragen ging Kluxen in seiner Dissertation und seinen darauf folgenden Publikationen nach, in denen Albert als ein wichtiger Zeuge der lateinischen Überlieferung des Maimonides-Werkes Moreh ha-nevukhim erscheint. Mit dieser Schrift kam Albert in Berührung zuerst durch eine Teilübersetzung von Buch II Prolog und Kap. 1, die er im Frühwerk mit dem Titel Liber de uno deo benedicto zitiert. Bei der Abfassung des Sentenzenkommentars (Buch I d.2 a. 15) kennt er bereits die Übersetzung des gesamten Dux
7 JOËL 1863, p. II–III.8 GUTTMANN 1902, p. 47.9 GUTTMANN 1902, pp. 55–60. Cf. BACH 1881, p. 173.
4
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
neutrorum. Von nun an wird Albert, wie Kluxen in seinen Studien zeigt, zum Wegbereiter einer ‚christlichen‘ Adaptation der religionsphilosophischen Gedanken des großen jüdischen Philosophen.10
Weitere Forschungsstationen zu Albertus Magnus und zur jüdischen Philosophie markieren die Untersuchungen von Giuseppe B. Sermoneta und James A. Weisheipl. Sermoneta widmete sich der Erforschung des Verhältnisses von Rabbi Jehudàh ben Mosheh Romano (um 1292 – nach 1330) zu Albertus Magnus. Seine Analysen der Schriften des R. Jehudàh Romano, insbesondere des Kommentars zum Schöpfungswerk, deckten Albert als eine seiner wichtigsten lateinischen Quellen auf.Sermoneta wies nach, was vor ihm schon teilweise Jellinek und Steinschneider ermittelt hatten, dass R. Jehudàh Romano bei der Entfaltung seiner eigenen philosophischen Lehren nicht nur viele Anleihen bei Albert machte, sondern auch eine Textauswahl aus Alberts Werken ins Hebräische übertrug.11 Die von Sermoneta initiierten Forschungen zu R. Jehudàh Romano und zu Albert führte und führt Sermonetas Schülerin Caterina Rigo weiter fort. Von ihr stammen unter anderem vergleichende philologisch-philosophische Untersuchungen zu der hebräischen Übersetzung von Alberts Kommentar zu De anima III.2.16, die Jehudàh in zwei Versionen angefertigte. Bei ihrer Untersuchung der beiden Übersetzungsversionen des Kapitels über den einen Intellekt, der zwischen den Sinnesgegenständen und dem Intelligiblen, dem Besonderen und dem Allgemeinen unterscheidet, stützt sich Rigo auf ihre kritische Edition der Textzeugen.12 Zwei Untersuchungen widmet sie darüber hinaus der hebräischen Anthologie philosophischer Texte scholastischer Autoren von R. Jehudàh Romano und präsentiert darin die aus Alberts Werken entliehenen Textteile.13
Zu den wichtigen Einsichten, die Caterina Rigo aus ihren Untersuchungen zum Werk des R. Jehudàh Romano gewann, gehört vor allem die Feststellung, dass dieser der Lehrtradition des Moses Maimonides verpflichtete Denker dessen Hauptwerk Dux neutrorum in ähnlicher Weise wie Albert rezipierte und dass er die Texte Alberts,welche er ins Hebräische übersetzt hatte, nach dem Vorbild des Maimonides interpretierte.14
10 KLUXEN 1951. KLUXEN 1954, pp. 23–50; KLUXEN 2002, pp. 299–311; für weitere Lit.-Angaben siehe HASSELHOFF 2004, p. 370.11 SERMONETA 1965, pp. 3–78, bes. 40–53; zu Jellinek und Steinschneider cf. ANZULEWICZ 1999, pp. 115–116.12 RIGO 1993b, pp. 65–90. Cf. RIGO 1993c, pp. 1073–1095.13 RIGO 1993a, pp. 73–104. RIGO 1995, pp. 141–170.14 Cf. RIGO 1993a. ANZULEWICZ 1999, pp. 115–116. RIGO 1998.
5
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
Neben Sermoneta und seiner Schülerin Rigo reflektierte James A. Weisheipl in einer kleinen Studie im Zusammenhang mit Avicebron und Albert die Genese des universalen Hylemorphismus in der Hochscholastik. Er hob das Neuartige an der Theorie des jüdischen Philosophen hervor und ging auf ihre früheste Rezeption bei Albert, auf ihre ideengeschichtliche Einordnung in die Nähe des Platon sowieihre Zurückweisung ein.15 Neuerlich unterzog Mária Mičaninová AlbertsVerhältnis zu den Lehren des Werkes Fons vitae des Avicebron einer Relektüre und kam zu dem Schluss, dass die Theorie des Avicebron in der Schrift De causis et processu universitatis a prima causa des Doctor universalis inadäquat wiedergegeben werde und die dort vorgebrachtenEinwände gegen Avicebron mit Alberts Einstellung zum Platonismus im Allgemeinen nicht im Einklang stünden.16
Gegenwärtig erschließen Jean-Pierre Rothschild, Gilbert Dahan, Caterina Rigo, Yossef Schwartz, Irven M. Resnick, Görge K. Hasselhoff und Carsten Wilke durch ihre Studien und teilweise durch Texteditionen die verschiedenen Einflussbereiche der jüdischen Philosophie und der Bibelexegese bei Albertus Magnus.17 Im Mittelpunkt dieser Untersuchungen stehen neben den erwähnten R. Jehudàh ben Mosheh Romano und Avicebron vor allem Moses Maimonides und die systematischen sowie literargeschichtlichen Fragen seiner Rezeption durch Albertus Magnus. Hervorgehoben seien die kritischen Editionen der hebräischen Übersetzungen zweier Textfragmente aus Alberts Schriften, die R. Jehudàh Romano in seine Anthologie aufnahm. Es handelt sich zum einen um die Schrift De causis et processu universitatis a prima causa II.3.2, eingeleitet und lateinisch-hebräisch–französisch herausgegeben von Jean-Pierre Rothschild;18 zum andern geht es um das Werk De anima III, ediert von Carsten L. Wilke.19 Mit der Edition des letztgenannten Textes wurden die Vorarbeiten zum Projekt eines Albertus Hebraicus einen großen Schritt vorangebracht. Dieses sah vor eine kritische Edition aller hebräischen Übersetzungen von Alberts Texten zu erstellen, wird jedoch bis auf Weiteres nicht weiter verfolgt.20
15 WEISHEIPL 1980, pp. 239–260.16 MIČANINOVÁ 2010, pp. 161–169.17 Cf. Rothschild 1997, pp. 473–513; die relevanten Untersuchungen der genannten Autoren sind in der Bibliographie am Schluss dieses Beitrags verzeichnet. 18 ROTHSCHILD 1992, pp. 159–173.19 WILKE 2013, pp. 369–436.
6
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
Im deutlichen Gegensatz zu diesen historisch-philosophischen Themen sind die Fragen nach Präsenz und Rolle der jüdischen Exegese in den Bibelkommentaren des Doctor universalis sowie seine Haltung gegenüber der jüdischen Bibelhermeneutik in der Vergangenheit und auch neuerlich in den einschlägigen Studien z.B. bei Henri de Lubac,21Guy Lobrichon,Frans van Liere22 oder in The New Cambridge History of the Bible,23 aber auch in den speziell Albertus gewidmeten Untersuchungen von Alberto Vaccari, Iacobus-M. Vosté, Ceslas Spicq und Giuseppe Ferraro stiefmütterlich behandelt worden.24 Auf diesen Umstand wies mit RechtBeryl Smalley schon Anfang der 1950er Jahre hin und bemühte sich mitErfolg, dieses Defizit in ihrer Studie zu beheben.25 Die darauf folgenden Untersuchungen von Antonin-M. Jutras, Roberto Coggi und Ruth Meyer zum Iob-Kommentar des Albertus und die Studien von Gilbert Dahan gehen in diese Richtung.26 Smalley machte deutlich, und
20 Die ursprüngliche Idee eines Albertus-Semitico-Latinus nahm die Gestalt des Projekts Albertus Hebraicus an, zu den Carsten L. Wilke und Caterina Rigo wichtige Vorarbeiten bereits geleistet haben; cf. ANZULEWICZ 1999, pp. 114–116. WILKE 2013, p. 371 Anm. 8. 21 Cf. DE LUBAC 1959, pp. 422, 651.22Bei LOBRICHON 2003 und bei VAN LIERE 2014 findet Albert keine Erwähnung.23 MARSDEN/MATTER 2012.24 VACCARI 1932, pp. 369–370, weist darauf hin, dass Albert bei seiner Literalauslegung der Bibel auf folgende jüdische Quellen, die ihm in lateinischen Übersetzungen zugänglich sind, mehrfach rekurriert: Abraham Hispalensis, Isaac, Moses Maimonides und sein Werk Dux neutrorum; darüber hinaus zitiert er einmal aus zweiter Hand, so Vaccari, drei Rabbis zusammen: Rabbi Vasse, Rabbi Josue und Rabbi Joanna. VOSTÉ 1932–1933 zählt unter den nichtchristlichen Quellen von Alberts Kommentaren zu den Büchern des Alten Testaments einige jüdische Autoren und Schriften auf, so z.B. fürden Kommentar zum Buch Daniel nennt er Joseph Flavius und Rabbi Moyses (ibid. p. 24); zum Buch Iob (ibid. p. 46) „Abraham, Isaac et Moyses Aegyptius philosophi Iudaeorum“, „Rabbi Moysis in libro, qui dicitur dux neutrorum cap. XXIV, quam opinionen sequuntur Abraham, Isaac, Moyses Aegyptius, Iudaeorum philosophi“, „philosophantes Iudaei, Moyses Aegyptius sc., Abraham Hispalensis et Isaac et Iacob Alkindi et quidam alii“. Im Gesamtüberblick über Alberts Schriftkommentierung von C. SPICQ 1954 und den exegetischen Studien zum Neuen Testament von G. FERRARO 1998 werden keine Bezüge zur jüdischen Exegese und Bibelhermeneutik hergestellt.25 SMALLEY 1952, pp. XVI, 264, 294f., 298–300, 312 u.ö.; cf. SMALLEY 1985, pp.241–256. DAHAN 2009, pp. 36f.26 JUTRAS 1955. COGGI 1981, p. 109, hebt hervor, dass Albert sich im stärkerenMaße als Thomas von Aquin von Moses Maimonides bei der Auslegung vom Buch Iob inspirieren ließ; er präsentiert und vergleicht die Interpretation des Maimonides und des Albertus Magnus. Die Bedeutung, die Maimonides in Alberts Auslegung vom Buch Iob zukommt, erkennt auch MEYER 2009, pp. 329, 340, 367–368, 371, 373 an. Ein differenziertes Bild von Alberts Verhältnis zur jüdischen Exegese zeichnet G. Dahan, der die Forschungen zur
7
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ihr schließt sich Dahan an, dass die Rezeption des Aristoteles und die Anwendung seines Wissenschaftsbegriffs auf die Theologie die Exegese bei den Dominikanern und insbesondere die Schriftauslegung des Albertus Magnus revolutionierten. Der Einfluss der Schrift Dux neutrorum des Moses Maimonides auf Albertus muss in diesem Kontext gesehen werden. Die für den jüdischen Gelehrten charakteristischen Rationalisierungstendenzen und ihre Konvergenz mit dem von Aristoteles ausgehenden Impuls der Verwissenschaftlichung der Exegese, der durch die Bezugnahme auf das Gesetz zusätzlich verstärkt wurde, waren für Albert die entscheidende Voraussetzung für die Assimilation dieser maimonidischen Methode, wie Smalley mit Recht annimmt. Die Vorbildlichkeit des Maimonides dürfte jedoch aufgrund seiner Bevorzugung der Metapher und Allegorie bei Albert anihre Grenzen stoßen. Gleiches gilt für die rabbinische Exegese, wie Smalley über die Tatsache urteilt, dass in Alberts Jesaia-Kommentar die Hebraei nur zweimal erwähnt werden und dass über die im Matthäus-Kommentar zitierten Rabbiner Vasse, Josue und Joanna nicht Sicheres bekannt ist.27
Albert war an einer unbegrenzten Möglichkeit verschiedener Auslegungen des biblischen Textes, wie ihn die jüdische Hermeneutik mit Moses Maimonides kannte, offenbar nicht interessiert. Im Gegenteil, der Methode der Schriftauslegung der Viktoriner und der dominikanischen, von Hugo von St. Cher etablierten Tradition folgend, bevorzugte Albert den Literalsinn der Hl. Schrift und bediente sich der drei im Literalsinn gründenden ‚geistigen Sinne‘ (sensus spirituales) – Allegorie (sensus allegoricus), Tropologie (sensus tropologicus) und Anagogie (sensus anagogicus) – mit Behutsamkeit und Zurückhaltung.28 Man muss allerdings wissen, dass Albert der hebräischen Sprache nicht mächtig war und daher keinen unmittelbarenZugang zu den Quellen der jüdischen Exegese hatte. Seine Kenntnisse dieser Tradition schöpfte er, soweit bekannt, vor allem aus den lateinischen Bibelkommentaren und den onomastischen Lexika des Hieronymus, aus der Glossa ordinaria Bibliae und den Etymologiae des Isidor von Sevilla sowie möglicherweise aus der Oraltradition. Mit der
mittelalterlichen Bibelexegese von B. Smalley fortführt; cf. DAHAN 1999, pp.376–387; DAHAN 2009, p. 37 und passim.27 SMALLEY 1985, pp. 245–246. Cf. GUTTMANN 1902, pp. 49–51. VACCARI 1932, pp. 369–370.28 Cf. ALBERTUS MAGNUS I Sent. d. 1 a. 5, p. 20a; Summa theol. I tr. 1 q. 5 c. 4, pp. 21.44–56. SMALLEY 1952, p. 299. AWERBUCH 1980, pp. 197–215. GHISALBERTI 1996, p. 295. DAHAN 2004, pp. 65–99.
8
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
Erklärung der hebräischen Namen beschränkte er sich auf die Schriftauslegung und den moraltheologisch-paränetischen, sich stark an die biblischen Erzählungen anlehnenden Bereich.29
Aus der hier angedeuteten hermeneutischen Koordinaten, die Albert seiner nunmehr als biblische Theologie aufgefassten Schriftauslegungzugrunde legte, lässt sich seine wiederkehrende Kritik an den fabulae Iudaeorum besser verstehen, die schon in seinem theologiesystematischen Frühwerk, bevor er mit der Kommentierung derbiblischen Bücher begann, anzutreffen ist.30 Diese Kritik, die in derchristlichen Exegese tief verwurzelt ist – Albert begegnet ihr oftmals bei Hieronymus –, kommt in den Bibelkommentaren verstärkt, am häufigsten jedoch im Jesaja-Kommentar, zum Ausdruck.31
Alberts Abgrenzung von der jüdischen Schriftauslegung muss aber auchvor dem Hintergrund der Beibehaltung der Bibel Israels im Christentum und der genuin christlichen Interpretation der Heiligen Schriften gesehen werden. Die christliche Exegese kann insofern nicht mit der jüdischen Interpretation der Bibel übereinstimmen als 29 Cf. Albertus Magnus De natura boni, p. 134 (Index).30 Cf. beispielsweise ALBERTUS MAGNUS De homine, pp. 559.44–50, 562,51–55: „dicendum quod Gamaliel mentitur et sequitur fabulam Iudaeorum dicentium quod Lilith creata fuit ante Evam, quae nolens consentire Adae assignata est daemoni, et genui ex daemone illos daemones qui dicuntur Asmodaei et Asmodaei filii et nepotes“. AWERBUCH 1980, p. 217.31 Zur Verdeutlichung solcher kritischen Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass der Begriff ‘Iudaei’ gleichwertig mit mit ‘Hebraei’ und ‘Pharisei’ sowie ‚gentiles’ und ‚iudaizantes‘ ist, seien einige von ihnen angeführt: ALBERTUS MAGNUS Super Isaiam VI.4, p. 93.6–7: „Hebraeus tamen fabulas Talmud sequens dicit, quod fumus ille fuit fumus thymiamiatis...“; ibid. VII.2, p.102.90–91: „Aliam causam dicunt Hebraei, quorum fabulas ego non ponerem, nisi Hieronymus posuisset.“ Ibid. XI.6, p. 178.5–9: „Et etiam Iudaei hoc deMessia suo exponunt et fabulantur auream Ierusalem futuram, in qua illa impleantur. Nos autem talia non curantes de domino nostro Iesu, vero Emmanuele, exponimus dicentes...“; ibid. XI.14, p. 183.23–32: „Mare ad litteram significat mare magnum et in orientales partes porrectum ad insulas, in quibus habitabant hostes Iudeorum, quos postea viceversa impugnaverunt et subiecerunt, sicut dicunt Iudaei. Has enim insulas simul Ephraim et Iuda per mare navali bello et impugnaverunt et subiecerunt. Quiaante hoc numquam factum est, fabulantur hoc futurum sub Messia, quem expectant. Nos autem fabulas istas refutantes dicimus, quod mare est hoc saeculum.“ Ibid. XXXIV.9, p. 367.81-83: „Nos autem in talibus expositionibus nullam vim ponentes, eo quod nulla utilitas est in eis – fabulae enim Iudaeorum et variae et vanae sunt ...“. Weitere Fundstellen inAlberts Jesaia-Kommentar: Super Isaiam XI.2, p. 201.67–69; ibid. XIV.19, p. 208.90; ibid. XXX.26, p. 339.40–41; ibid. XXXIII.21, p. 363.16–17; ibid. XLI.4, p. 422.35–36.
9
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
sie ihr Proprium wahrnimmt, nämlich „die Interpretation des Christusgeschehens von der vorliegenden Schrift her“.32 Darin liegt das grundlegend Trennende der jüdischen und christlichen Schriftauslegung und Theologie, aus dem sich das geschichtlich gewachsene, schwierige Verhältnis von Christen und Judentum ergibt. Auf diesen Umstand spielt Albert in seinen Schriftkommentaren und theologiesystematischen Werken an, wenn er aus der Position des christlichen Glaubens die Juden wegen ihres Unglaubens an die Gottessohnschaft Christi und wegen seiner Kreuzigung als von Gott verworfenes Volk bezeichnet.33 Ob hinter den pejorativ gefärbten Vorstellungen des Judentums, die uns bereits in Alberts theologischem Frühwerk begegnen, auch seine Wahrnehmung des jüdischen Lebens aus dem Alltag liegt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist jedoch, dass er diese Wahrnehmung schon in der Erstlingsschrift De natura boni formuliert und damit auf die Ablehnung des Christusglaubens durch die Juden anspielt. Wegen dieses Unglaubens, dessen Grund er in der Unfähigkeit der Juden sichvom Glaubenslicht erleuchten zu lassen, sieht, betrachtet er sie gleichsam wie Heiden und Häretiker.34
II
Die jüdische Tradition ist bei Albert nicht nur in der Bibelexegese,sondern auch im Kontext der systematischen Theologie, u.a. in der theologischen Tugendlehre, in der Schöpfungslehre und sogar in der Sakramentenlehre präsent. Die Zweiteilung der christlichen Bibel gewährte dem Theologen und forderte zugleich von ihm einen angemessenen Zugang zur jüdisch-exegetischen Tradition. Dieser Zugang aber konnte nicht folgenlos für die systematische Theologie bleiben, denn er sicherte die Kontinuität und transponierte zugleichdie Differenz im Glauben des Alten und Neuen Testaments in Alberts Werk in die systematische Theologie. Die gemeinsame Traditionsbasis 32 DOHMEN 1996, p. 137.33 Cf. ALBERTUS MAGNUS Super Matthaeum VIII.10, p. 282.63–64.86–94: „praedicit (sc. Christus) futuram excaecationem et eiectionem futuram Iudaeorum. [...]sicut consuetum est, cum dicimus quibusdam fidelibus Iudaeis: Non inventa est tanta fides in Iudaeis quanta in gentibus. Et ideo Iudaei dicuntur faeces, quia eliquatis electis fidelibus alii quasi nihil rationis et omnino nihil fidei habuerunt.“ Für weitere Belege von Aussagen ähnlicher Art cf. ibid. p. 738 s.v. ‚Iudaei‘.34 ALBERTUS MAGNUS De natura boni, p. 52.65–68: „Radiis refulget dictis beata virgo, et ideo ut nostra illuminatrix illuminat oculos fidelium et obcaecatoculos Iudaeorum, paganorum et haereticorum.“ Cf. ALBERTUS MAGNUS De homine, p.532.26.
10
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
erwies sich als sehr schmal. Ausgehend von der Sakramentenlehre seines Quästionen-Kommentars zu den Sententiae des Petrus Lombardus nahm sich Albert vor, die Differenz zwischen den Sakramenten des Alten und des Neuen Bundes zu bestimmen.35 Die Fragestellung kam nicht überraschend auf, da sie auch zu Beginn des IV. Buches der Sententiae vom Lombarden selbst gestellt wird.36 Was uns in diesem Zusammenhang interessiert, ist die Aufwertung der typologischen Funktion des alttestamentlichen Ritus als das sakramentale Bindeglied zwischen der Lex nova und der Lex vetus. Hierbei ging es vor allem um das alttestamentliche ‚Sakrament‘ der Beschneidung. Die systematische Entfaltung und der Ertrag dieser Frage werden hiermit zum Ausgangspunkt und zur Maßgabe des christlichen Glaubens erhoben und so als Inhalte und Ursprung des vorchristlichen Glaubens der Juden in die Perspektive des christlichen Glaubens eingebunden.
Wie ist aber Alberts Verhältnis zur jüdischen Philosophie, die er, wie zuvor erwähnt, hauptsächlich durch die Schriften ihrer drei prominenten Repräsentanten: Isaac Israeli, Moses Maimonides und Avicebron nacheinander rezipiert? Was sagen die Reihenfolge und die Inhalte der Aneignung der jüdischen Philosophie durch Albert über dieses Verhältnis aus?
In der diachronen Sicht auf den Rezeptionsprozess erscheint bei Albert zuerst Isaac Israeli als Vertreter der jüdischen Philosophie.Mit seinem Buch der Definitionen und dem Werk De elementis bietet er Albert ein philosophisches Kompendium von Begriffsdefinitionen und ihren Erklärungen einerseits und eine naturphilosophische Kompilation überdie ersten Prinzipien der Naturdinge andererseits. Das letztgenannteWerk jedoch übte offenbar keinen größeren Einfluss auf Albert aus, obwohl er es erstmalig im Sentenzenkommentar, Buch IV, später im Kommentar zum Matthäusevangelium und in der Summa theologiae I explizitzitiert und es möglicherweise schon zuvor bei der Abfassung von De homine benutzt hatte.37 Außer der gelegentlich erwähnten Unterscheidung zwischen einer natürlichen, jeder Kreatur eignenden Empfindung (sensus naturales) und einer Wahrnehmung, die nur den Sinnenwesen eigentümlich ist (sensus animales) und außer der Begriffserklärung von elementum, bot ihm diese Quelle anscheinend wenig Nutzen. Einem anderen Werk des Israeli, dem „Buch der Ernährungslehre“ (Liber de dietis), widerfährt ein ähnliches Schicksal, 35 ALBERTUS MAGNUS De sacramentis I.7, pp. 15–16.36 Cf. PETRUS LOMBARDUS Sententiae, IV.6–10, pp. 235–239.37 Cf. unten Anm. 54.
11
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
denn auch hierauf nimmt Albert lediglich in seinem Spätwerk „Über die Eucharistie“ (De corpore Domini) explizit nur dreimal Bezug.38
Im Gegensatz zu Alberts limitiertem Bezug auf den Liber de dietis, finden wir bei ihm Isaac Israelis Buch der Definitionen als ein oft zitiertes Werk. Die Vielfalt der definierten und erläuterten Gegenstände in diesem Buch macht es jedoch zunächst schwierig, es einem systematischen Bereich der Philosophie eindeutig zuzuordnen. Die Definitionen und Erklärungen der philosophischen Grundbegriffe und die Sachgehalte erstrecken sich auf weite Bereiche der Erkenntnislehre, Metaphysik und Naturphilosophie. Der jüdische Verfasser bekennt sich zur philosophischen Tradition des Platon und ist offenkundig an der Verschmelzung der platonisch-neuplatonischen Tradition mit der jüdischen Philosophie interessiert.
Albert nimmt schon im Frühwerk oft Bezug auf diese Quelle und bedient sich der Definitionen solcher Begriffe und ihrer Beschreibung wie ratio im Sinne einer ordnenden Kraft,39 Himmel (caelum) und seine Kraft40 sowie Lebensgeist (spiritus vitalis) und seine Funktionen im Körper.41 Die Definitionen und Beschreibungen dieser philosophischen Termini adaptiert Albert theologisch in der Christologie und Eschatologie. In seinen nachfolgenden Synthesen derSchöpfungslehre und der Anthropologie – De IV coaequaevis und De homine – kommt dem Liber de definicionibus quantitativ und qualitativ viel größere Bedeutung zu als je zuvor. Im Traktat über die Zeit lehnt sich Albert an Isaacs Definition der Ewigkeit als ein zusammenhängender und ununterbrochener Zeitraum an.42 Er begreift die Ewigkeit gemäß dieser Definition als Ewigkeit an sich, als eine ontologische Bestimmung, die Gattung und Arten in sich einschließt. Die Definition des Isaac integriert Albert in sein Konzept der Zeit als dessen komplementärer, ontologisch fundierender Bestandteil.43 38 ALBERTUS MAGNUS De corpore domini 3.1.2, p. 239b; ibid. 3.1.9, p. 276b; ibid. 3.2.1, p. 281b.39 ALBERTUS MAGNUS De incarnatione IV.1.9, p. 227.85–87; De resurrectione IV.1.12, p. 334.25–29.40 ALBERTUS MAGNUS De resurrectione I.1.1, p. 239.52–54.41 ALBERTUS MAGNUS De resurrectione I.5, p. 248.52–32; ibid. I.6.9, p. 256.74–81.42 ALBERTUS MAGNUS De IV coaequaevis II.3.2, p. 340a: „Isaac in libro de Diffinitionibus dicit, quod aeternitas est spatium continuum non intersectum.“43 ALBERTUS MAGNUS De IV coaequaevis II.3.2, p. 350a: „Si autem consideratur [sc. aeternitas] absolute, non secundum quod etiam potest participari a creatura, tunc magis propria sua comparatio est ad esse, et sic diffinitur ab Isaac et Dionysio, quorum diffinitiones differunt in hoc, quod
12
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
Stärker als im Zeittraktat und anders geartet ist Isaacs Einfluss inden Traktaten über den Himmel und über die Engel in der Frühschrift De IV coaequaevis. Er erfasst die kosmologischen und vermögenspsychologischen Fragen der Erkenntnis, die für die Beweger der Himmelssphären eigentümlich sind.44 Israeli bietet für Albert diephilosophische Erklärung der sublunaren, durch die kosmischen Intelligenzen als sekundäre Ursachen bewirkten, auf Gottes Lenkung zurückgeführten Ordnung45 und er lässt die Seele als Form in der Hierarchie von Formen genetisch qua Lichtmetaphysik sowie die Differenz von ratio und intellectus versus anima und intelligentia begreifen.46
Der hohe Anteil philosophischer Lehrmeinungen des Isaac Israeli an Alberts Schöpfungslehre, der im Werk De IV coaequaevis erreicht wurde, steigt in der Schrift De homine noch weiter. In diesem an die Schöpfungslehre unmittelbar anschließenden und sie fortsetzenden Anthropologie-Entwurf werden nunmehr vermehrt Lehransichten aus dem Liber de definicionibus herangezogen, die Alberts Begriff vom Menschen, vonseiner seelisch-körperlichen Konstitution und seinen psychischen Vermögen, dem natürlichen Lebensraum und der Stellung im Universum diskursiv anreichen und stützen. Zu den berücksichtigten Lehrinhalten gehören insbesondere die Interpretation des Ursprungs der Seele, der Hierarchie der Seelenformen und der Eigenschaften desphysiologisch verstandenen Lebensgeistes (spiritus vitalis) aus der Perspektive der Lichtmetaphysik;47 die Frage der postmortalen Seelenstrafen;48 das Gedächtnis als inneres Seelenvermögen und das Phänomen des Vergessens;49 prophetische Träume und ihre Vermittlung durch getrennte Wesen bzw. Engel;50 syllogistisches Denken
diffinitio Isaac videtur colligere genus et differentias. Sicut enim supra patuit, spatium genus est ad tres mensuras: continuum autem et non intersectum sunt differentiae in comparatione ad aevum et tempus.“44 ALBERTUS MAGNUS De IV coaequaevis III.16.2, pp. 441a, 444b.45 ALBERTUS MAGNUS De IV coaequaevis III.18.1, p. 449b. 46 ALBERTUS MAGNUS De IV coaequaevis IV.20.1, p. 459a; ibid. IV.22.1, p. 468a; ibid. IV.36.2.2, p. 542a; ibid. IV.67.5, p. 689a.47 ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 15.7–11; ibid. p. 75.61–66, pp. 76.70–77.12, p. 155.31–34.53–55, p.328.66–68, p. 409.1–6, p. 413.41–48, p. 466.16–22.48 ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 466.37–38: „Item, Isaac dicit, quod animae malorum deprimuntur sub tristi orbe et cremabuntur in igne magno.“49 ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 297.10–12; p. 301.6–17; p. 307.31–33; p. 380.43-44.50 ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 356.3–8, p. 390.38–42.
13
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
(ratiocinatio);51 das Philosophieverständnis und die finale Glückseligkeit des Menschen.52
VieIe Inhalte aus Isaacs Liber de definicionibus, die Albert im Frühwerk bis einschließlich zu De homine rezipierte, sind auch in seinem Sentenzenkommentar anzutreffen. Die Adaption der Definitionen und Begriffserklärungen ist nicht zufällig, sondern sie richtet sich naturgemäß nach dem Gegenstand der einzelnen Bücher des Kommentars und ist jeweils an den diskursiven Kontext gebunden. Die Frage der wechselnden Präsenz und Wirksamkeit von Isaacs Schriften und Lehre dürfte jedoch nicht nur von den Inhalten der einzelnen Bücher der Kommentarvorlage abhängen. Auch der Umstand, dass ein Großteil der Themen vom zweiten Sentenzenbuch schon zuvor in den Schriften De IV coaequaevis und De homine unter Verwendung des Liber de definicionibus abgehandelt wurde, erklärt anscheinend nicht, wie sich noch herausstellen wird, die ganze Dimension der erwähnten Frage. Die häufigsten Entlehnungen aus Isaacs Schrift, die im ersten Buch des Sentenzenkommentars festgestellt werden, betreffen die Auffassung von Ewigkeit, die nunmehr als Gottes Attribut aufgefasst, im Spiegeleinschlägiger Definitionen und Begriffstraditionen durchbuchstabiertwird. Hinzu kommen ferner je einmal die Konzepte von ‚Lebensgeist‘ (spiritus animae per quod operatur vita) und von ‚Geburt‘ der ratio im Schattender Intelligenz. Erstmalig, wie wir im Rückblick auf das im Frühwerkvorhandene Rezeptionsgut feststellen, begegnet man in dieser von derQuelle abweichenden Form Isaacs Definition des Terminus sententia. Albert stützt sich auf diese Definition bei seiner Erklärung der Nützlichkeit, die der Inhalt des Sentenzenbuches von Petrus Lombardus seinem Hörer oder dem Leser bringt.53 Im zweiten Buch des
51 ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 459.3–5.52 ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 466.23–36: „Item, Isaac in explanatione diffinitionis philosophiae, huius scilicet ‘philosophia est assimilatio creatoris operibus secundum veritatem humanitatis’, dicit sic: ‘Causa finalis hominis spiritualis est, ut unio animae cum corpore sit ad hoc, ut homini manifestetur veritas rerum perceptibilium, et discernat inter bonum et malum, et faciat quod expedit vivens in sanctitate et iustitia quousque remuneretur et coniungatur splendori intelligentiae et pulchritudini sapientiae, et fiat spiritualis coniunctus splendori causato ex virtute creatoris sine medio, quod est paradisus eius et retributio eius et supremabonitas et sublimitas integra et pulchritudo eius perfecta. Et propter hoc Plato dixit quod philosophia est cura et sollicitudo mortis.“53 ALBERTUS MAGNUS I Sent. prol., p. 12a: „Tertio, tangit rationem utilitatis ex materia, cum dicit: ‘Patrum sententias’. Et nota quod Avicenna dicit, quod sententia est conceptio definita et certissima. Isaac autem in libro Diffinitionum fere idem dicit sic: Sententia est conceptio alterius partis
14
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
Sentenzenkommentars schwindet Isaacs Einfluss massiv, im dritten Buch scheint er keine Rolle, zumindest explizit, zu spielen, und im vierten Buch wird er erneut wirksam und sogar verstärkt durch eine bei Albert bislang nicht in Erscheinung getretene naturphilosophische Schrift mit dem Titel De elementis. Aus dieser Schrift übernimmt er die Unterscheidung zwischen natürlichen Empfindungen (sensus naturales) und Sinneswahrnehmungen (sensus animales). Die ersteren eignen allen Dingen, auch solchen, die unbelebt sind, wie z.B. Mineralien, so dass jede Kreatur nach Albert in der Lage ist, den Wink des Schöpfers zu perzipieren und ihm zu gehorchen. DieSinneswahrnehmungen indes eignen nur den Lebewesen.54 Die übrigen Anlehnungen an Isaac stammen aus dem Liber de definicionibus; sie alle nehmen Bezug auf ein und dieselbe Frage, nämlich auf die die postmortalen Seelenstrafen der Sünder.
Alberts Bemerkung am Schluss des Sentenzenkommentars stellt allerdings die ‚natürliche‘ Eschatologie des Isaac in Frage: „Man muss sagen, dass Isaac seine Behauptungen nicht bewiesen hat und siesind auch keine Glaubenswahrheiten, weshalb sie mit der gleichen Leichtigkeit, mit der sie behauptet werden, auch verworfen werden“.55
Diese kritische Äußerung, die in ihrer Deutlichkeit überrascht und eine Wendung in der bisher durchweg positiven Einstellung gegenüber dem jüdischen Philosophen darstellt, signalisiert eine bereits vollzogene Korrektur an der von Albert in Frühwerk verfolgten Harmonisierung der Philosophie mit der Theologie und der Rückführungder ersteren auf die Theologie. Diesen Eindruck bestätigen einige contradictionis. Et a certitudine harum sententiarum quae hic collectae sunt, vocatur Liber Sententiarum.“ Cf. ALBERTUS MAGNUS De homine, p. 505.33–35: „Dicit enim Isaac in libro De diffinitionibus quod ‘sententia est credulitas alicuius rei’.“ ISAAC ISRAELI Liber de diffincionibus, p. 321.7–8: „Definicio sentenciae sentencia est credulitas vel firmitudo rei alicuius.“54 ALBERTUS MAGNUS IV Sent. 43.4, p. 511b: „dicendum, quod sicut dicit Isaac, sensus duplices sunt, scilicet naturales, et animales: et ad similitudinem sensus naturalis non animalis possumus dicere, quod quaelibet creatura nutum potest percipere Creatoris: sic, Matth. VIII, 26: Imperavit ventis etmari, et facta est tranquillitas magna: et ideo talis auditus, id est, vis perceptiva nutus et voluntatis Dei est in cineribus et mortuis“; Super Matth. VIII.27, p. 296.25–30: „Omnis enim creatura sensum habet naturalem, quo imperium perficit et percipit creatoris, quamvis in se sit insensibilis. Etideo distinguit Isaac philosophus sensus in naturales et animales et dat sensus naturales etiam rebus insensibilibus“ (cf. Isaac Israeli, De elementis pars 3, f. 10ra); Summa theol. I.4.20.2, p.137a; ibid. I.6.26.1.2.4, p. 244a.55 ALBERTUS MAGNUS IV Sent. 48.11, p. 663b: „dicendum, quod Isaac ea quae dixit, non probavit, nec fidei sunt: et ideo ea facilitate condemnantur, qua dicuntur.“
15
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
weitere Beobachtungen, die mit der Assimilation der Lehren des IsaacIsraeli und des Moses Maimonides im zweiten Buch des Sentenzenkommentars zusammenhängen. Dass Albert seine reduktionistische Position in Bezug auf das Verhältnis von Philosophie gegenüber der Theologie revidierte und sie in der genuinen Form spätestens bei der Abfassung des Kommentars zum zweiten Buch der Sententiae des Petrus Lombardus aufgab, schließen wir aus seiner eigenen Aussage. Im Sentenzenkommentar, Buch II Distinktion 14 Artikel 6, erwähnt er in der Vergangenheitsform seinereduktionistische Position, die er als Theologe gegenüber den naturphilosophischen Meinungen vertrat, indem er diese, ähnlich wie es Bonaventura tat, auf die Theologie zurückführte. Er gibt zu, dasser zuvor das traditionelle Modell des Verhältnisses von Theologie und Philosophie mit einigen älteren Theologieprofessoren teilte.56 Seine Selbstkorrektur und damit die Beanstandung der Vereinbarkeit mit dem christlichen Glauben der mit Isaac Israeli und Moses Maimonides geteilten Auffassung bezüglich des Erkenntnismodus, der den kosmischen Intelligenzen in ihrer Eigenschaft als Sphärenbewegereigentümlich ist, und der Gleichsetzung dieser Sphärenbeweger mit den Engel der biblischen Offenbarung nahm er schon zu Beginn des Kommentars zum zweiten Sentenzenbuch vor.57 Seine Distanzierung von Isaac Israeli und Moses Maimonides in dieser Frage, die in die zeitliche und sachliche Nähe mit der Verurteilung der 10 Lehrirrtümer fällt, die der Bischof von Paris Wilhelm von Auvergne 1241 inkriminierte, darunter fünf Lehrsätze bezüglich der Engel, erfolgte mit Rücksicht auf die Orthodoxie:58
56 ALBERTUS MAGNUS II Sent. 14.6, p. 266b: „Alibi etiam disputatum est de ista materia multum et prolixe: et ibi secuti sumus dicta qorundam Magistrorum theologiae, qui voluerunt opiniones naturalium ad theologiam reducere dicendo quod Angeli deserviunt Deo in motibus caelorum, et quod illi ab eisanimae dicuntur: sed nihil ita secure dicitur, sicut quod sola Dei voluntate moveantur, et natura propria non contrariante motui.“ Näheres dazu cf. ANZULEWICZ 2009, 219–221.57 Cf. ALBERTUS MAGNUS II Sent. 1.4, p. 15b; ibid. 2.2, p. 45b; ibid. 3.1, p.61b; ibid. 3.3, p. 64b–65b.58 ALBERTUS MAGNUS II Sent. 3.16, p. 94b: „Praenotandum, quod difficultatem istiusquaestionis ostendunt diversae sententiae etiam Auctorum. Unde Isaac et Rabbi Moyses, Philosophi Judaeorum, hac difficultate coacti, auferebant ab Angelis quos secundum legem coacti sunt ponere, notitiam particularium, et dicebant ipsos Angelos esse intelligentias moventes orbes, et non cognoscere particularia, sed potius influere orbibus vel motoribus orbium formas simplices, quae ad particularia determinantur per diversitatem motuset materiae et accidentium materiae: et ideo diversitas particularium nequedescendit ab intelligentia, nec scitur ab ea nisi per accidens, scilicet in
16
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
„Man muss wissen, dass die Schwierigkeit dieser Frage auch die unterschiedlichen Aussagen der Autoren deutlich machen. Durch diese Schwierigkeit gezwungen sprechen daher die jüdischen Philosophen Isaac und Rabbi Moyses den Engeln, zu deren Annahme sie durch Gesetz gezwungen sind, die Kenntnis des Besonderen ab.Und sie behaupteten, dass die Engel selbst Intelligenzen seien, welche die Himmelssphären bewegen, und dass sie das Besondere nicht erkennen, sondern vielmehr die einfachen Formen den Himmelsspähren oder den Bewegern der Himmelssphären einfließen, die dann zu dem Besonderen durch die Verschiedenheit der Bewegung und der Materie sowie der Akzidenzien bestimmt werden. Und deshalb weder steigt die Verschiedenheit des Besonderen von der Intelligenz ab noch wird sie von dieser gewusst, es sei dennakzidentell, insofern sie nämlich durch die Bewegung der Himmelssphäre verursacht und nicht wie diese oder jene Verschiedenheit ist. Andere [Autoren] aber, die sich noch viel mehr geirrt haben, behaupteten, dass die Engel nicht uns sondernnur Gott zugewandt sind und allgemeine Offenbarungen empfangen, und dass die Materie ihnen gemäß dem Gebot gehorche, damit dieses oder jenes geschehe. Aber all das weisen wir in unserem Glauben zurück, und es ist nötig, dass wir einen Weg suchen, derdem Glauben angemessen ist.“
Hat Albert seine Auffassung bezüglich des Erkenntnismodus der substantiae separatae unverändert beibehalten, ist er in der Frage der Gleichsetzung der Beweger der Himmelssphären mit den Engel und hinsichtlich der ‚natürlichen‘ Eschatologie des Isaac Israeli nicht dezidiert und nicht konsequent negativ geblieben. Nach der Abfassungdes Sentenzenkommentars (Buch II: 1246–1247) schreibt er in seinem Kommentar zu De divinis nominibus des Ps.-Dionysius Areopagita (um 1250),dass die Auffassung, die Engel bewegten den Himmel, weder für noch gegen den Glauben spricht.59 Deutlichere Stellung gegen die Isaac Israeli und Moses Maimonides zugeschriebene Gleichsetzung der
quantum est causata per motum orbis, et non ut est haec vel illa. Alii autem magis errantes, dixerunt Angelos non esse circa nos, sed tantum circaDeum, et accipere revelationes universales, et secundum praeceptum oboedireeis materiam ut fiat hoc vel illud. Sed omnia haec in fide refutamus nostra, et oportet nos quaerere viam competentem fidei ...“ Cf. RIGO 2005, pp. 351f. Die Liste der von Wilhelm von Auvergne 1241 verurteilten 10 Artikeln ist abgedruckt bei ANZULEWICZ 1992, pp. 381f. 59 ALBERTUS MAGNUS SuperDionysium De divinis nominibus c.4, p. 123.4–5: „Sed hoc non est pro fide nec contra fidem, quod angeli roveant caelos.“
17
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
insgesamt neun Reihen der kosmischen Intelligenzen mit den Engeln bezieht Albert in seinem Werk De causis et processu universitatis a prima causa (Buch I). Er glaubt nicht, dass die von ihm dargestellten Reihen derIntelligenzen mit der hierarchischen Ordnung der Engel identisch sind, wie „Isaac, Rabbi Moyses und andere jüdische Philosophen“ behaupten. „Denn“ führt Albert fort, „die Engel unterscheidet man entsprechend den unterschiedlichen Erleuchtungen und Theophanien, die man durch die Offenbarung und im Glauben annimmt, welche auf dieVollkommenheit des Himmelreiches in der Gnade und Seligkeit hinordnen. Darüber kann die Philosophie gestützt auf philosophische Argumente nichts Bestimmtes sagen“ – soweit Albert an dieser Stelle in De causis et processu universitatis a prima causa.60 Eine nachträgliche Würdigung gegenüber der früheren Kritik erfährt indes Isaac Israeli in Alberts philosophischer Abhandlung über den Zustand und die Werkeder Seele, die vom Körper durch den Tod getrennt ist. In dieser knapp zehn Jahre vor dem letztgenannten Werk verfassten Abhandlung, die den zweiten Traktat der Schrift Liber de natura et origine animae bildet,präsentiert Albert die ‚natürliche‘ Eschatologie des Isaak Israeli und macht sich dessen philosophische Positionen, die er offensichtlich als konform mit dem christlichen Glauben interpretiert, wiederholt zu eigen.61
Schlussbemerkung
Welche Schlüsse sind aus unserem Versuch einer partiellen Erschließung von Alberts Kenntnissen, Rezeption, Wertschätzung und Kritik der philosophischen und religionsphilosophischen Ideen und 60 ALBERTUS MAGNUS De causis et processu universitatis a prima causa I.4.8, p. 58.19–29: „Ordines autem intelligentiarum, quas nos determinavimus, quidam dicunt esse ordines angelorum et intelligentias vocant angelos. Et hoc quidem dicunt Isaac et Rabbi Moyses et ceteri philosophi Iudaeorum. Sed nos hoc verum esse non credimus. Ordines enim angelorum distinguuntur secundum differentias illuminationum et theophaniarum, quae revelatione accipiuntur et fide creduntur et ad prfectionem regni caelestis ordinantur in gratia etbeatitudine. De quibus philosophia nihil potest per rationem philosophicam determinare.“ Cf. ibid. II.5.24, p. 191.30–192.6: „Scimus etiam, quod quidam contendunt spiritus, qui vulgariter angeli vocantur, intelligentias esse. Sed hoc certum est, quod angeli intellectuales substantiae sunt secundum ministeria gratiae distributae. Sed quod hoc modo intelligentiae sint, quo intelligentiae a Peripateticis ponuntur, scilicet quod immobiles sint loco et operatione, penitus absurdum est et non convenit cum dictis eorum qui de motibus et apparitionibus et operationibus angelorum locuti sunt.“61 ALBERTUS MAGNUS Liber de natura et origine animae II.11, p. 35.21–36.52; cf. ibid.II.13, p. 39.24–56; II.14, p.41.59–70.
18
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
Begrifflichkeit des Isaac Israeli zu ziehen? Die Tatsache, dass unsere Präsentation nur einen relativ kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk des Doctor universalis umfasst, erlaubt uns noch keine Verallgemeinerungen der Zwischenergebnisse. Vor dem Hintergrund der noch zu leistenden Gesamtschau auf Alberts Werk wollen wir daher diegewonnen Einblicke in Form von Fragen formulieren, deren Antworten, die einen vorläufigen Charakter aufweisen, der zweite Teil dieser Präsentation in toto darstellt. Unsere Anfangsfrage betraf Alberts selektive Überführung in die Theologie und Adaption bestimmter Begriffe und Konzepte aus einem religionsphilosophisch verwandten, aber im Wesentlichen dennoch andersartigen Bereich. Kann nicht aus diesem Sachverhalt die Antwort auf die Frage nach Alberts Motiv, Absicht und Zweckbestimmung der Anleihen bei Isaac gewonnen werden? Welche Folgen ziehen jene Anknüpfungen, Übernahmen oder Ablehnungen der Konzepte und Modelle, die dem Rezeptionsgut zugrunde liegen, in der Theologie und Philosophie nach sich? Werden diese ohne ihren ursprünglichen Kontext und ohne enge Zweckbindung von Albert entfaltet? Diese und ähnliche Fragen scheinen uns auf der Folie der skizzierten Assimilationsvorgänge, ihres äußeren Rahmens und Inhaltsnahzulegen, dass Isaac Israelis philosophisches und religionsphilosophisches Gedankengut im Diskurs bei Albert sowohl eine explikative als auch eine probative Funktion erfüllt. Isaacs Schriften, insbesondere sein Liber de definitionibus, bot sich als Quelle von Definitionen und Konzepten, die Alberts theologisches Denken inspirierten, eine Reihe von Fragestellungen und deren Lösungen philosophisch zu vertiefen und zu legitimieren oder zu widerlegen. Eine entkontextualisierte Fortführung der philosophischen Reflexionen des Isaac Israeli lässt sich zwar, soweit wir sehen, ansatzweise in Alberts Liber de natura et origine animae feststellen, ihre wahren Wurzeln bleiben aber dennoch aufgrund der inhaltlichen und begrifflichen Koinzidenz unverkennbar.
*
BIBLIOGRAPHIE
Quellen
ALBERTUS MAGNUS De animalibusALBERTUS MAGNUS: De animalibus libri XXVI. Nach der Cölner Urschrift herausgegeben
von von HERMANN STADLER, Erster Band, Buch I–XII (BGPhMA XV), Münster 1916.
19
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ALBERTUS MAGNUS De corpore dominiALBERTUS MAGNUS: De corpore domini [Liber de sacramento Eucharistiae], edd. AUGUSTE
ET ÉMILE BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia XXXVIII), Paris 1890, 191–432.
ALBERTUS MAGNUS De natura boniALBERTUS MAGNUS: De natura boni, ed. EPHREM FILTHAUT (Alberti Magni Opera
Omnia XXV/1), Münster 1974.
ALBERTUS MAGNUS De homineALBERTUS MAGNUS: De homine, edd. HENRYK ANZULEWICZ/JOACHIM R. SÖDER (Alberti
Magni Opera Omnia XXVII/2), Münster 2008.
ALBERTUS MAGNUS De incarnationeALBERTUS MAGNUS: De incarnatione, ed. IGNAZ BACKES (Alberti Magni Opera
Omnia XXVI), Münster 1958, 171–235.
ALBERTUS MAGNUS DeIV coaequaevisALBERTUS MAGNUS: De IV coaequaevis, ed. STEPHANE C. A. BORGNET (Alberti Magni
Opera Omnia XXXIV), Paris 1895, 307–761.
ALBERTUS MAGNUS De resurrectioneALBERTUS MAGNUS: De resurrectione, ed. WILHELM KÜBEL (Alberti Magni Opera
Omnia XXVI), Münster 1958, 237–354.
ALBERTUS MAGNUS De sacramentisALBERTUS MAGNUS: De sacramentis, ed. ALBERT OHLMEYER (Alberti Magni Opera
Omnia XXVI), Münster 1958, 1–170.
ALBERTUS MAGNUS I Sent.ALBERTUS MAGNUS: Commentarii in I Sententiarum (Dist. I–XXV), ed. AUGUSTE
BORGNET, Paris 1893.
ALBERTUS MAGNUS II Sent.ALBERTUS MAGNUS: Commentarii in II Sententiarum, ed. STEPHANE C. A. BORGNET
(Alberti Magni Opera Omnia XXVII), Paris 1894
ALBERTUS MAGNUS IV Sent.ALBERTUS MAGNUS: Commentarii in IV Sententiarum (Dist. XXIII–L), ed. STEPHANE
C. A. BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia XXX), Paris 1894.
ALBERTUS MAGNUS Summa theol. IALBERTUS MAGNUS: Summa theologiae sive de mirabili scientia dei I.1.1–50A, edd.
DIONYSIUS SIEDLER ET AL. (Alberti Magni Opera Omnia XXXIV/1), Münster 1978.
20
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ALBERTUS MAGNUS Super Dionysium De divinis nominibusALBERTUS MAGNUS: Super Dionysium De divinis nominibus, ed. PAUL SIMON (Alberti
Magni Opera Omnia XXXVII/1), Münster 1972.
ALBERTUS MAGNUS Super Dionysium De ecclesiastica hierarchiaALBERTUS MAGNUS: Super Dionysium De ecclesiastica hierarchia, edd. MARIA BURGER/PAUL
SIMON/WILHELM KÜBEL (Alberti Magni Opera Omnia XXXVI/2), Münster 1999.
ALBERTUS MAGNUS Super IsaiamALBERTUS MAGNUS: Super Isaiam, ed. FERDINAND SIEPMANN (Alberti Magni Opera
Omnia XIX), Münster 1952.
ALBERTUS MAGNUS Super MatthaeumALBERTUS MAGNUS: Super Matthaeum, capitula I–XIV, ed. BERNHARD SCHMIDT
(Alberti Magni Opera Omnia XXI/1), Münster 1987.
CUP IHENRICUS DENIFLE/AEMILIUS CHATELAIN: Chartularium Universitatis Parisiensis, T. I,
Parisiis 1889.
ISAAC ISRAELI: Liber de diffincionibus, ed. JOSEPH TH. MUCKLE, in: Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age 11 (1937–1938) 299–340.
Isaac Israeli De elementisISAAC ISRAELI: De elementis, in: Omnia Opera Ysaac, Lugduni 1515, f. 4v–
10v.
PETRUS LOMBARDUS SententiaePETRUS LOMBARDUS: Sententiae in IV libris distinctae, IV (Spicilegium
Bonventurianum 5), Grottaferrata 1981.
Sekundärliteratur
ANZULEWICZ 1992HENRYK ANZULEWICZ: „Eine weitere Überlieferung der Collectio errorum in Anglia
et Parisius condemnatorum im Ms. lat. fol. 456 der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin“, in: Franziskanische Studien 74 (1992) 375–399.
ANZULEWICZ 1999HENRYK ANZULEWICZ: De forma resultante in speculo des Albertus Magnus. Handschriftliche
Überlieferung, literargeschichtliche und textkritische Untersuchungen, Textedition, Übersetzung und Kommentar (BGPhMA 53/1), Münster 1999.
21
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ANZULEWICZ 2007HENRYK ANZULEWICZ: „Das Bild von Moses Maimonides. Kritische
Anmerkungen zu einer Studie“, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie undTheologie 54 (2007) 579–599.
ANZULEWICZ 2009HENRYK ANZULEWICZ: „Die Emanationslehre des Albertus Magnus: Genese,
Gestalt und Bedeutung“, in: HONNEFELDER/MÖHLE/BULLIDO DEL BARRIO 2009,219–242.
AWERBUCH 1980MARIANNE AWERBUCH: Christlich-jüdische Begegnung im Zeitalter der Frühscholastik
(Abhandlungen zum christlich-jüdischen Dialog 8), München 1980.
BACH 1881JOSEF BACH: Des Albertus Magnus Verhältnis zu der Erkenntnislehre der Griechen, Lateiner,
Araber und Juden. Ein Beitrag zur Geschichte der Noetik, Wien 1881 (Unveränderter Nachdruck Frankfurt/Main: Minerva 1966).
BATAILLON/DAHAN/GY 2004LOUIS-JACQUES BATAILLON/GILBERT DAHAN/PIERRE-MARIE GY: Hugues de Saint-Cher
(†1263) Bibliste et théologien (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Âge 1), Turnhout 2004.
BRACHTENDORF 2002JOHANNES BRACHTENDORF: Prudentia et Contemplatio. Ethik und Metaphysik im Mittelalter.
FS für GEORG WIELAND, Paderborn/München/Wien/Zürich 2002, 107–119.
COGGI 1981ROBERTO COGGI: „Il significato del libro di Giobbe secondo S. Alberto
Magmo“, Sacra doctrina 95 (1981) 105–122.
CREMASCOLI/LEONARDI 1996GIUSEPPE CREMASCOLI/CLAUDIO LEONARDI: La Bibbia nel Medioevo (La Bibbia nella
storia 16), Bologna 1996.
DAHAN 1999GILBERT DAHAN: L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval XIIe–XIVe siècle,
Paris 1999.
DAHAN 2004GILBERT DAHAN: L’Exégese de Hugues. Méthode et Herméneutique, in:
BATAILLON/DAHAN/GY 2004, pp. 65–99.
DAHAN 200922
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
GILBERT DAHAN: Lire la Bible au Moyen Âge. Essais d’herméneutique médiévale, Genève 2009.
DE LUBAC 1959HENRI DE LUBAC: Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, 1/II, Paris 1959.
DOHMEN 1996CHRISTOPH DOHMEN: „Hermeneutik des Alten Testaments“, in:
DOHMEN/STERNBERGER 1996, pp. 133–158.
DOHMEN/STERNBERGER 1996CHRISTOPH DOHMEN/GÜNTER STERNBERGER: Hermeneutik der Jüdischen Bibel und des Alten
Testaments, Stuttgart – Berlin – Köln 1996.
FERRARO 1998GIUSEPPE FERRARO: Lo spirito Santo nel commentari al quarto Vangelo di Bruno Segni,
Ruperto di Deutz, Bonaventura e Alberto Magno (Letture Bibliche 11), Cittàdel Vaticano 1998.
FIDORA/HAMES/SCHWARTZ 2013ALEXANDER FIDORA/HARVEY J. HAMES/YOSSEF SCHWARTZ: Latin–into–Hebrew: Textes and
Studies, vol. Two: Texts in Context, Leiden – Boston 2013.
GHISALBERTI 1996ALLESSANDRO GHISALBERTI: „L’esegesi della scuola domenicana del secolo
XIII“, in: CREMASCOLI/LEONARDI 1996, 291–304.
GUTTMANN 1902JACOB GUTTMANN: Die Scholastik des dreizehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum
Judenthum und zur jüdischen Literatur, Breslau 1902.
HASSELHOFF 2004GÖRGE K. HASSELHOFF: Dicit Rabbi Moyses. Studien zum Bild von Moses Maimonides im
lateinischen Westen von 13 bis zum 15. Jahrhundert, Würzburg 2004.
HONNEFELDER/MÖHLE/BULLIDO DEL BARRIO 2009LUDGER HONNEFELDER/HANNES MÖHLE/SUSANA BULLIDO DEL BARRIO: Via Alberti. Texte –
Quellen – Interpretationen (Subsidia Albertina 2), Münster 2009.
JOËL 1863MANUEL JOËL: Verhältniss Albert des Grossen zu Moses Maimonides. Ein Beitrag zur
Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Breslau 1863.
JUTRAS 1955
23
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ANTONIN-M. JUTRAS: „Le Commentarium in Iob d’Albert le Grand et la disputatio“, Études et Recherches 9 (1955) 9–20.
LOBRICHON 2003GUY LOBRICHON: La bible au Moyem Age (Les Médiévistes français 3), Paris
2003.
KLUXEN 1951WOLFGANG KLUXEN: Untersuchungen und Texte zur Geschichte des lateinischen Moses
Maimonides; ungedr. Diss. Köln 1951.
KLUXEN 1954WOLFGANG KLUXEN: „Literargeschichtliches zum lateinischen Moses
Maimonides“, Recherches de Théologie ancienne et médiévale 21 (1954) 23–50.
KLUXEN 2002WOLFGANG KLUXEN: „Maimonides und die philosophische Orientierung deiner
lateinischen Leser. Eine interpretatorische Reflexion“, in: BRACHTENDORF 2002, 107–119.
KOVACH/SHAHAN 1980FRANCIS J. KOVACH/ROBERT W. SHAHAN: Albert the Great, Commemorative Essays,
Norman 1980.
LOBRICHON 2003GUY LOBRICHON: La Bible au Moyen Age (Les Médiévistes français 3), Paris
2003.
LUSIGNAN/PAULMIER-FOUCART/DUCHENNE 1997
SERGE LUSIGNAN/MONIQUE PAULMIER-FOUCART, MARIE-CHRISTINE DUCHENNE: Lector et compilator. Vincent de Beauvais, frère prêcheur. Un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle, Grâne 1997.
MARSDEN/MATTER 2012RICHARD MARSED/E. ANN MATTER: The New Cambridge History of the Bible, vol. 2,
Cambridge 2012.
MEYER 2009RUTH MEYER: „Hanc auten disputationem solus Deus determinare potest. Das Buch Hiob
als disputatio bei Albertus Magnus und Thomas von Aquin“, in: HONNEFELDER/MÖHLE/BULLIDO DEL BARRIO 2009, pp. 325–383.
MIČANINOVÁ 2010
24
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
MÁRIA MIČANINOVÁ: „Avicebronov Prameň Života a Albert Vel’ký“, in: Filozofia 65/2 (2010) 161–169.
RAVITZKY 1998AVIEZER RAVITZKY: Joseph Baruch Sermoneta Memorial Volume (Jerusalem Studies
in Jewish Thought XIV), Jerusalem 1998, 181–222.
RESNICK 2002IRVEN M. RESNICK: „Talmud, Talmudisti, and Albert the Great“, Viator 33
(2002) 69–86.
RESNICK/KITCHELL, JR. 2002IRVEN M. RESNICK/ KENNETH F. KITCHELL, JR.: Albert the Great. A Selectively
Annotated Bibliography (1900–2000) (Medieval and Renaissance Texts and Studies 269), Tempe, Arizona 2002.
RIGO 1993a CATERINA RIGO: „Un’antologia filosofica di Yehuda b. Mosheh Romano“,
in: Italia 10 (1993) 73–104.
RIGO 1993b CATERINA RIGO: „Yehuda b. Mosheh Romano traduttore si Alberto Magno.
Commento al De anima III, II, 16“, Henoch 15 (1993) 65–90.
RIGO 1993c CATERINA RIGO: „Le traduzioni dei commenti scolastici al De anima da
Yehuda b. Mosheh Romano nella tradizione filosofica ebraico-italiana dei secoli XIII–XIV“, in: Vattioni 1993, 1073–1095
RIGO 1995 CATERINA RIGO: „Yehudah ben Mosheh Romano traduttore degli scolastici
latini“, in: Henoch 17 (1993) 141–170.
RIGO 1998 CATERINA RIGO: „Human Substance and Eternal Life in the Philosophy if
Rabbi Judah Romano“, in: RAVITZKY 1998, 181–222.
RIGO 2005CATERINA RIGO: „Zur Redaktionsfrage der Frühschriften des Albertus
Magnus“, in: HONNEFELDER ET AL. 2005, 325–374.
ROHNER 1913ANSELM ROHNER: Das Schöpfungsproblem bei Moses Maimonides, Albertus Magnus und
Thomas von Aquin (BGPhMA XI/5), Münster 1913.
25
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ROTHSCHILD 1992JEAN-PIERRE ROTHSCHILD: „Un traducteur hébreu qui se cherche: R. Juda B.
Moïse Romano et le De causis et processu universitatis, II, 3, 2 d’Albert le Grand“, Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age 59 (1992) 159–173.
ROTHSCHILD 1997JEAN-PIERRE ROTHSCHILD: „Philosophie (gréco-arabe), ‚Philosophie‘ de la
loi, d’après les sources juives médiévales, dans la littérature latine: un bilan provisoire“, Medioevo 23 (1997) 473–513.
SCHEEBEN 1931HERIBERT CHR. SCHEEBEN: Albert der Große. Zur Chronologie seines Lebens (Quallen
und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 27), Vechta/Leipzig 1931.
SEPPELT 1956FRANZ XAVER SEPPELT: Die Vormachtstellung des Papstums im Hochmittelalter von der
Mitte des elften Jahrhunderts bis zuCielestin V. (Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 3), München 1956.
SERMONETA 1965JOSEF BARÙKH SERMONETA: „La dottrina dell’intelletto e la ‘fede
filosofica’ di Jehudàh e Immanuel Romano“, in: Studi medievali 6/2 (1965) 3–78.
SIGHART 1857JOACHIM SIGHART, Albertus Magnus. Sein Leben und seine Wissenschaft. Nach Quellen
dargestellt, Regensburg 1857.
SMALLEY 1952BERYL SMALLEY: The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1952 (Reprinted
1984).
SMALLEY 1985BERYL SMALLEY: The Gospels in the Schools c. 1100–c.1280, London – Ronceverte
1958.
SPICQ 1944CESLAS SPICQ: Esquisse d’une Histoire de L’exégèse Latine au Moyen Age (Bibliothèque
Thomiste XXVI), Paris 1944.
VACCARI 1932
26
IGTM Jahrestagung 2015, 19.–20. June, Speyer. ––This is a draft,please do not circulate.
ALBERTO VACCARI: „S. Alberto Magno e l’esegesi medievale“, Biblica 13 (1932) 257–272, 369–384.
VAN LIERE 2014FRANS VAN LIERE: An Introduction to the Medieval Bible, Cambridge 2014.
VOSTÉ 1932–1933IACOBUS-M. VOSTÉ: S. Albertus Magnus Sacrae Paginae Magister, II. In Vetus
Testamentum (Divus Thomas, Placenza XXXV/1–2, 1933), Romae 1932–1933.
WEISHEIPL 1980JAMES A WEISHEIPL: „Albertus Magnus and Universal Hylomorphism:
Avicebron“, in: KOVACH/SHAHAN 1980, 239–260.
WILKE 2013 CARSTEN L. WILKE: „Judah Romano’s Hebrow Translation from Albert, De
anima III“, in: FIDORA/HAMES/SCHWARTZ 2013, pp. 369–436.
27