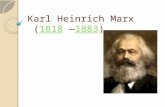Heinrich Hertz – Vom Funkensprung zur Radiowelle
-
Upload
deutsches-museum -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Heinrich Hertz – Vom Funkensprung zur Radiowelle
Inhalt 7
Grußwor te 9
Inhalt 15
Einleitung Von Michael Ecker t 17
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f 39
»Originale Kopien« Her tz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althof f 59
Der lange Weg zu Her tz Von Jörg Bradenahl 83
Vom Funkensprung zur Radiowelle Von Ralph Burmester und Jörg Bradenahl 99
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UK W-Rundfunk kam Von Andreas Vogel 109
Bildnachweise 125
Anmerkungen 133
Autorenverzeichnis 143
Impressum 147
Inhalt
7
Grußworte
Der Beitrag, den der Grundlagenforscher Heinrich Hertz für unsere globalisierte Informationsgesellschaft geleistet hat, kann heute kaum überschätzt werden. Das Bewusstsein für den bahnbrechenden Charakter seiner Arbeiten über die elektromagnetischen Wellen sorgte auch schon bald nach der Gründung des Deutschen Museums dafür, dass Hertz Apparate und ein großer Teil seines Nachlasses in das nationale Schatzhaus zur Wissenschafts- und Technikgeschichte überführt wurden. Dort findet sich heute der apparative Nachlass von Heinrich Hertz vollkommen zu Recht in der exklusiven Kategorie der Meisterwerke. Für die aktuelle Sonderausstellung »Heinrich Hertz – vom Funkensprung zur Radiowelle«brauchten wir die besten Stücke aber nicht auf die Reise zu schicken. Dem engagierten Team des Deutschen Museums Bonn ist es in enger Kooperation mit der Universität Bonn gelungen, einen bisher weithin unbe-kannten Schatz der Wissenschaftsgeschichte zu heben und erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich wünsche der Ausstellung viele Besucher und den vielen Besuchern noch mehr Freude am Bonner Vermächtnis von Heinrich Hertz!
Professor Dr. Wolfgang M. Heckl Generaldirektor des Deutschen MuseumsOskar von Miller Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Universität München
11
Das Wesen des Deutschen Museums ist es, die technische Innovationskraft im Verlauf der Geschichte darzu-stellen und dabei stets auch einen kleinen Schritt weiter in die Vision zu tun. Als Bonner Oberbürgermeister freue ich mich natürlich immer besonders, wenn Visionen in Bonn Spuren hinterlassen!Es war nicht Amerika oder Berlin, sondern die Rheinische Friedrich Wilhelms- Universität zu Bonn, für deren Physik-Lehrstuhl sich Heinrich Hertz nach seiner bahnbrechenden Entdeckung der elektromagnetischen Wellen entschied, bevor er 1894 mit nur 36 Jahren verstarb. Sein geistiges Erbe ist nicht nur in Bonn allgegen-wärtig – denken Sie nur an das Radioprogramm oder Ihr Mobiltelefon!Im Wissenschaftsjahr „ZukunftErde 2012“ ehrt das Deutsche Museum mit ihm einen der „Väter der Zukunft“, einen mutigen Visionär und innovativen Denker, der unsere Kommunikation und Information von Grund auf revolutionierte. Ich danke den Ausstellungsmachern und -partnern für diese ebenso informative wie gelungene Ausstellung, deren Besuch ich nur empfehlen kann!
Jürgen NimptschOberbürgermeister der Bundesstadt Bonn
Die Angabe 89.1 MHz auf einigen Bussen der SWB ist wohl den meisten Mitbürgern weit geläufiger als die Bedeutung der Einheit Hz. Sie quantifiziert die Zahl von Schwingungen pro Sekunde und erinnert an den großen Physiker Heinrich Hertz, der die letzten Jahre seines Lebens in Bonn geforscht und gelehrt hat. Mit dem expe-rimentellen Nachweis der zuvor nur theoretisch vermuteten Existenz elektromagnetischer Wellen brach er der Physik neue Bahnen und revolutionierte unseren Alltag. Es ist mir, als einer von Hertz Nachfahren im Physikalischen Institut der Universität Bonn, eine Ehre, daran mitzuwirken, sein Vermächtnis zu bewahren und seine Apparaturen in der Lehre als Zeugen menschlicher Krea-tivität erlebbar zu machen. Und es ist mir eine große Freude, eine Hertz-Ausstellung mit den Originalapparaturen aus unserem Institut realisiert zu sehen. In Zeiten überhäufiger seichter Berieselung ist es eine große Aufgabe, Zusammenhänge zwischen Forschung und gesellschaftlichen Entwicklungen authentisch, profund und begeis-ternd zu vermitteln. Zur Erreichung dieses Ziels wünsche ich dem Deutschen Museum Bonn denkbar großen Erfolg in Besucherzahl und Interesse und gebe daher gerne unsere Unterstützung.
Professor Dr. Friedrich KleinGeschäftsführender Direktor des Physikalischen Instituts der Universität Bonn
12
Grußworte
Das Deutsche Museum Bonn und die Universität Bonn freuen sich außerordentlich, Ihnen im Rahmen unserer langjährigen Kooperation nach den gemeinsamen Sonderausstellungen zum Astronomen Friedrich Argelander und dem Chemiker August Kekulé in den vergangenen Jahren nun den ‚Vater’ des Radios, den Physiker Heinrich Hertz, mit der Sonderausstellung „Heinrich Hertz – Vom Funkensprung zur Radiowelle“ zu präsentieren.Hertz, erst wenige Jahre vor seinem Tod an die Bonner Universität gekommen, hat während seiner Schaffensphase der Universität ein sehr beachtenswertes Vermächtnis hinterlassen. Dieses Vermächtnis wird besonders greifbar im so genannten Heinrich -Hertz-Zimmer, in welchem das Bonner Physikalische Institut die wichtigsten Stücke der Hertz’schen Originalapparaturen liebevoll pflegt und der wissenschaftlichen Nachwelt erhält. Mit dieser Ausstellung wird es nun dank des Deutschen Museums in Bonn möglich, einer breiteren Öffentlichkeit dieses Kleinod zugänglich zu machen.Ich wünsche Ihnen beim Besuch dieser hochspannenden Ausstellung viel Vergnügen und stets guten Empfang.
Professor Dr. Jürgen FohrmannRektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Als lokaler Energieversorger sind die Stadtwerke Bonn in besonderem Maße Bonn und seinen Museen verpflichtet. Wir freuen uns sehr, diese technische Ausstellung unterstützen zu können. Heinrich Hertz hat nicht nur als Professor an der Universität Bonn Spuren hinterlassen, sondern beeinflusst noch heute die tägliche Arbeit von SWB Energie und Wasser. Uns eint mit dem berühmten Physiker nicht nur die Verbundenheit mit Bonn, sondern auch die Frequenz unserer Stromnetze. So weist das Wechselstromnetz in Deutschland eine Frequenz von 50 Hz aus. Trotz vieler Berufungen zur Professur in bekannte Städte Deutschlands oder gar ins Ausland ist Heinrich Hertz Bonn treu geblieben. So auch wir, denn seit mehr als 130 Jahren ist SWB fest in der Region verwurzelt. Ob mit dem ersten Gaswerk 1879 oder dem derzeitigen Ausbau des Heizkraftwerks Nord in der Karlstraße, seit jeher sind wir ein vertrauensvoller Partner für Bonn und seine Bürger. Als Nachbarn nehmen wir uns daher gerne gesell-schaftlich in die Verantwortung und engagieren uns für ein lebens- und liebenswertes Bonn. Ich wünsche allen großen und kleinen Besuchern viel Spaß mit Heinrich Hertz im Deutschen Museum Bonn.
Peter Weckenbrock Geschäftsführer von SWB Energie und Wasser
13
»Es ist recht traurig, daß man so schnell älter wird, und so wenig in der kurzen Zeit fertig bringt.« Heinrich Hertz
»The brightest flame burns quickest« James Hetfield
Nur wenige Forschungsleistungen der letzten 150 Jahre haben unsere Welt so verändert, wie die bahnbrechenden Untersuchungen der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz. Von der drahtlosen Telegraphie, über Funktechnik, Radio und Fernsehen bis hin zum mittlerweile allgegenwärtigen Mobiltelefon: ohne die von Hertz beschriebenen »Strahlen elektrischer Kraft« ist unsere heutige globale Kommunikationskultur undenkbar. Heinrich Hertz, der schon mit 36 Jahren in Bonn verstarb, hat den Prozess dieser technischen Revolution, die bis heute andauert, nicht mehr miterleben können. Sein Beispiel zeigt jedoch in seltener Klarheit den »Nutzen« der rein erkenntnisorientierten Grundlagenforschung.Heinrich Hertz passt somit hervorragend in die Reihe von Sonderausstellungen, in denen das Deutsche Museum Bonn in enger Kooperation mit der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität herausragende Bonner Naturwissenschaftler und ihr Werk einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich machen möchte. 2009 stellten wir den Astronomen Friedrich Wilhelm Argelander (2009) und sein astrometrisches Großprojekt, die »Bonner Durchmusterung« vor. Er schuf damit 1859 erstmals einen verlässlichen Positionskatalog des nördlichen Sternenhimmels mit nicht weniger als 324.198 Objekten. Ein Werk, das noch über hundert Jahre später dem NASA-Mondprojekt gute Dienste leistete. 2011 folgte mit August Kekulé ein überaus origineller Chemiker, der 1865 mit der Entschlüsselung der Ringstruktur des Benzolmoleküls zielgerichtete Synthesen und damit den kometenhaften Aufstieg der chemischen Industrie ermöglichte.
Wie seine beiden »Vorgänger« in der Reihe, legte auch Heinrich Hertz mit seinen Arbeiten Grundlagen und eröffnete gänzliche neue Innovationspfade. Das Deutsche Museum Bonn reizt an diesem Thema neben der wissenschaftshistorischen Relevanz auch der ganz besonders charmante Bezug zu Bonn. Denn obwohl Heinrich Hertz nur etwa viereinhalb Jahre in unserer Stadt wirken konnte, hinterließ er ein bedeutendes Vermächtnis, das noch heute im Physikalischen Institut der Universität gepflegt und gelebt wird. Gemeint ist damit nicht nur der nach wie vor starke Anteil an experimenteller Grundlagenforschung im Institut, sondern auch der große Bestand von
Apparaten, die Hertz zum Teil selbst hergestellt hat und die bis heute in der Lehre eindrucksvoll zum Einsatz kommen. Diese nur wenig bekannten Schätze nun im Rahmen einer Sonderausstellung öffentlich zu präsentieren, ist eine Her(t)zensangelegenheit aller Partner: der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, deren Physikalischem Institut, der Stadtwerke Bonn und des Deutschen Museums Bonn.
Ausstellungen werden von Institutionen ermöglicht aber von Individuen realisiert. Die unermüdliche Begeisterung von Professor Dr. Karl-Heinz Althoff für Hertz´ Versuche und seine jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit dessen Apparaten gab die Initialzündung für dieses Ausstellungsprojekt. Ohne ihn wäre diese Ausstellung nicht entstanden. Ganz selbstverständlich fungierte er dann auch als wissenschaftlicher Berater und begleitete Ausstellung und Publikation mit kritischem Geist und notwendiger Geduld. Bei der Leitung des Physikalischen Instituts rannten wir mit der Ausstellungsidee bereits offene Türen ein. Der geschäftsführende Direktor, Professor Dr. Friedrich Klein, sorgte für eine reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unentbehrliche Stützen des Projektes waren von Institutsseite auch Dr. Tobias Jungk und Michael Kortmann, die dem
Einleitung
14
Museumsteam inhaltlich und technisch mit Rat und Tat zur Seite standen.Gewohnt engagierte Unterstützung erfuhren wir auch bei diesem Projekt von vielen Kollegen in unserem Münchner Mutterhaus. Ein paar schöne Ergänzungen zum Bonner Apparatebestand erhielten wir vom Kurator für Physik, Dr. Johannes-Geert Hagmann. Im Archiv von Dr. Wilhelm Füßl durften wir nach Herzenslust im schriftlichen Nachlass von Heinrich Hertz stöbern und aus der Bibliothek von Dr. Helmut Hilz einige seiner Werke ausleihen. Bildstelle und das Fotoatelier unter Leitung von Hans-Joachim Becker sorgten auch diesmal wieder für eine reiche und ansprechende Bebilderung von Publikation und Ausstellung.
Die vorliegende Begleitpublikation verdankt ihre Entstehung vor allem der Begeisterungsfähigkeit ihrer Autoren, die mit ihren Beiträgen die Ausstellungsinhalte aufgreifen, vertiefen und auf originelle Weise erweitern.
Für die Anschlussfähigkeit der Ausstellungsinhalte an die schulischen Lehrpläne trug Richard Herder Sorge. Heinz Stollenwerk mobilisierte eine stattliche Gruppe begeisterter Amateurfunker, die die Faszination ihres Hobbys in der Ausstellung erlebbar machen. Eine spannende Erweiterung der
Ausstellung in das Stadtbild und in die digitale Welt hat Dr. Helge David angeregt und umgesetzt: die »HzCachingTour« durch Bonn mittels internetfähiger Mobiltelefone und die begleitende Internetseite »heinrichhertz.de«. Markus Kahlenberg verdanken Publikation und Ausstellung ihre attraktive und dem Thema entsprechende grafische Gestaltung.Und wenn unsere Heinrich-Hertz-Ausstellung wie erhofft, komplexe naturwissenschaftliche Inhalte informativ, unterhaltsam, anschaulich und interaktiv vermittelt, dann hat der couragierte Einsatz und der Ideenreichtum von Jörg Bradenahl großen Anteil daran. Zum 125-jährigen Jubiläum der Untersuchungen der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz wünschen wir allen Lesern und Ausstellungs-besuchern vor allem eins: Möge der Funke über-springen!
Ralph Burmester
15
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
Heinrich Hertz wurde am 22. Februar 1857 in Hamburg geboren. Heins, wie ihn die Eltern nannten, wuchs in wohlbehüteten Verhältnissen auf. Sein Vater war Rechtsanwalt und später Justizsenator in Hamburg. Seine Mutter stammte aus Frankfurt und war die Tochter eines Arztes.
Als Heins sieben Jahre alt war, gaben ihn seine Eltern in eine private Reformschule, die erst wenige Jahre zuvor gegründet worden war. Er war in fast allen Fächern ein sehr aufgeweckter Schüler und bewies auch großes handwerkliches Geschick. Nur in einem Fach zeigte er keinerlei Begabung: Musik. Alle Versuche, ihm Singen oder Musizieren beizubringen, scheiterten kläglich. »Heinrich gehört, was das theoretische Verständnis betrifft, zu unsern besten Schülern, aber in Bezug auf Gehörbildung stehen wir leider noch auf dem alten Punkt«, schrieben ihm die Lehrer 1865 ins Zeugnis.
Das Abitur legte Heinrich Hertz nach zwei Jahren häuslichen Privatunterrichts am Johanneum ab, einem traditionsreichen Hamburger Gymnasium, wo schon sein Vater die Schulbank gedrückt hatte. Danach stand er vor der Wahl eines Studienfachs. »Ich gedenke«, schrieb er in einem Lebenslauf über seine Pläne, »nach Frankfurt am Main zu gehen und dort ein Jahr bei einem preußischen Baumeister zu arbeiten, wie es für die spätere Ablegung vom Staatsexamen im Ingenieur-fach erforderlich ist«. Das Hamburger Elternhaus blieb ihm aber zeitlebens ein Ort, an dem er sich geborgen fühlte und wohin er zurückkehrte, wann immer es ihm möglich war. Dieser engen Verbundenheit verdanken wir auch unser Wissen über sein Innenleben, denn er ließ die Eltern in langen Briefen an seinem Denken und Fühlen teilhaben, und viele dieser Briefe sind erhalten.
Die Briefe verraten nicht, warum Hertz Bauingenieur werden wollte. Vielleicht war es die rege Bautätigkeit Hamburgs während seiner Schulzeit, die ihn beein-druckte? Nach einem großen Brand im Jahr 1842 wurde die Stadt praktisch neu aufgebaut. Auch in Frankfurt, wo Hertz im Frühjahr 1875 sein Bauprak-tikum antrat, beeindruckten ihn die vielen Neubauten. Doch das Praktikum ödete ihn bald an. »Unlust, aufs Bureau zu gehen«, notierte er am 25. September 1875. Insgeheim scheint er schon mit einem Studienwechsel geliebäugelt zu haben, denn er brachte sich im Selbst-[2] Heinrich Hertz als Schüler Dezember 1865.
[3] Heinrichs Elternhaus in Hamburg.
19
studium höhere Mathematik bei und las das Lehrbuch des englischen Physikers Tyndall »Die Wärme als Art der Bewegung«, das 1867 in deutscher Übersetzung herausgekommen war.
Das einjährige Praktikum im Frankfurter Baubüro diente als Vorbereitung für das Studium des Baufachs. Hertz entschied sich für Dresden als Studienort. Dresden galt als das »Elbflorenz des Ostens« und bot mit seinem Polytechnikum für angehende Bauingeni-eurstudenten ausgezeichnete Studienmöglichkeiten. Hertz fand die Vorlesungen aber bald »ziemlich lang-weilig«, wie er nach Hause schrieb, und er scheint immer weniger Neigung für das einmal gewählte Fach verspürt zu haben.
Am 1. Oktober 1876 meldete er sich bei einem Eisen-bahnregiment in Berlin zum Dienst als »Einjährig Freiwilliger«. Der Militärdienst ersparte ihm vorläufig die Entscheidung darüber, ob er wirklich Bauin-genieur werden sollte, was ihm zwar einen sicheren Beruf verschafft, aber wenig intellektuelle Befriedi-gung bereitet hätte. Nach dem Militärdienst entschloss er sich, das Studium nicht in Dresden, sondern in München fortzusetzen. Dort gab es neben dem Polytechnikum auch noch eine Universität, so dass er neben den Vorlesungen für Ingenieure auch noch andere Fächer
kennenlernen konnte. Am 1. November 1877 gestand er seinen Eltern, dass er »umsatteln und Naturwis-senschaften studieren« wolle. Der Brief ist ein bewe-gendes Zeugnis dafür, was den zwanzigjährigen Noch-Ingenieurstudenten in seinem Inneren bewegte. Er habe sich, schrieb er, an das Schillerwort erinnert: »Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein«. Es war ihm aber auch bewusst, dass er als Physikstudent dem Vater noch einige Zeit auf der Tasche liegen würde. »Und so bitte ich Dich, lieber Papa, nicht sowohl um Deinen Rat, als um Deine Entscheidung, denn Rat brauche ich nicht mehr, und es ist auch nicht mehr Zeit, lange zu beraten; aber wenn Du mir sagst, ich solle Naturwis-senschaften studieren, so werde ich dies als ein großes Geschenk von Dir annehmen... wenn Du es aber für mein Bestes hältst, wenn ich den einmal eingeschla-genen Weg verfolge (was ich jetzt nicht mehr glaube), so werde ich auch dies tun, und zwar ganz und voll, denn ich bin das Zweifeln und Zaudern jetzt satt, und wenn ich so fortfahre wie bisher, so bleibe ich ewig auf dem alten Fleck.«Der Vater verstand die Nöte seines Sohnes, und so begann Hertz noch im Wintersemester 1877/78 an der Münchener Universität mit dem Studium der Naturwissenschaften. Da er sich schon reichliches Vorwissen angeeignet hatte, hielt er sich nicht lange mit Anfängervorlesungen auf. Auch in Mathematik [4] Hertz als Einjährig-Freiwilliger 1876/77.
20
besuchte er gleich Vorlesungen, die eigentlich für höhere Semester gedacht waren. Im darauffolgenden Sommersemester 1878 absolvierte er das physikali-
sche Praktikum. »Im ganzen habe ich dies Semester leichtere Arbeit wie im vorigen«, schrieb er den Eltern, da er sich in der Physik schon besser auskannte als in den anderen Naturwissenschaften.
Im Herbst 1878 wechselte Hertz erneut den Studi-enort. Er fühlte sich mehr und mehr zur Physik hinge-zogen und zog nach Berlin, denn mit dem physikali-schen Institut der Universität Berlin konnte sich kein anderes Physikinstitut in der ganzen Welt vergleichen. Sein Direktor war Hermann Helmholtz, der »Reichs-kanzler der Physik«, wie man ihn bald nannte. Helm-holtz hatte bahnbrechende Leistungen in Physiologie, Akustik, Elektrodynamik und anderen Teilgebieten der Naturforschung aufzuweisen, er war Experimen-tator und Theoretiker in einer Person, und er galt als herausragender Lehrer und Organisator. Den Lehrstuhl für theoretische Physik an der Berliner Universität bekleidete Gustav Kirchhoff. An den meisten anderen Universitäten gab es noch gar keine eigenen Lehrstühle für die theoretische Physik. Kirchhoffs Vorlesungen bereiteten diesem Fach den Weg zu einer eigenständigen Disziplin. Er trage den Stoff so vor, »dass es wirklich ein Genuss ist, ihn zu hören«, schwärmte Hertz von Kirchoffs Vorlesungen zur Elektrodynamik, wo er sich aber schon aus dem Studium von Lehrbüchern vieles selbst beigebracht hatte. Aber »gerade dadurch, dass ich die Resultate
und die üblichen Ableitungsweisen schon kenne, habe ich vielleicht mehr Genuss davon.« Hertz begnügte sich aber nicht mit dem Besuch von Vorlesungen. Wie in Frankfurt, Dresden und München brachte er sich vieles im Selbststudium bei. Was ihn jedoch am meisten interessierte, das expe-rimentelle Forschen, konnte er sich auf diesem Weg
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[5] Hermann von Helmholtz.
[6] Robert Kirchhoff.
21
nicht aneignen. Hertz hoffte, dass er das bei Helm-holtz im Praktikum lernen konnte. Er wollte aber nicht irgendwelche Studentenversuche durchführen - er hatte ja schon in München das Physikpraktikum absolviert - sondern sich einer besonderen Herausfor-derung stellen, mit der er sich bei Helmholtz profi-lieren konnte. Die Gelegenheit dazu bot ihm eine von Helmholtz gestellte Preisaufgabe der Berliner Univer-sität. Das Thema berührte ein Problem, das Helm-holtz besonders am Herzen lag. Hertz beschrieb den Eltern die Aufgabenstellung folgendermaßen:
»Wenn sich die Elektrizität in den Körpern mit träger Masse bewegte, so würde sich das in der Größe der Extracurrents (der Ströme, welche beim Öffnen und Schließen eines Stromes nebenbei entstehen) unter gewissen Umständen zeigen. Es sollen solche Versuche über die Größe der Extracurrents angestellt werden, aus welchen ein Schluss auf die bewegte träge Masse gezogen werden kann.«
Elektrischer Strom ist Transport von elektrischer Ladung, würden wir heute sagen; wenn diese Ladungsträger eine Masse haben, dann sollte bei ihrer Beschleunigung oder beim Abbremsen die Massen-trägheit eine Rolle spielen. Aber als diese Preisaufgabe formuliert wurde, lag die Entdeckung des Elektrons, in dem wir heute den elementaren Träger der elekt-
rischen Ladung sehen, noch zwei Jahrzehnte in der Zukunft. Erst vor dem Hintergrund der recht verwi-ckelten Vorstellungen vom Wesen der Elektrizität in den 1870er Jahren erschließt sich die eigentliche Problematik der Preisaufgabe. Sie sollte das elektro-dynamische Theoriengewirr lichten helfen, indem sie den Trägheitswirkungen auf den Grund ging, über die verschiedene dieser Theorien unterschiedliche Vorhersagen machten. Wenn es ihm gelang, diese Aufgabe zu lösen, würde er mit einem Schlag zum Kreis der Auserwählten vordringen, die unter der Anleitung des Meisters im Physikinstitut experimentierten, so mag sich Hertz gedacht haben. »Es ist mir sehr angenehm, über-haupt mich an einer derartigen Arbeit versuchen zu können«, schrieb er den Eltern. Aber das Experiment sei »nicht gerade sonderlich dankbar, da das mutmaß-liche Resultat ein negatives ist, d. h. gewisse Erschei-nungen werden nicht eintreten, was im ganzen weniger Vergnügen als das Eintreten bereitet, indessen liegt das in der Natur der Sache«. Helmholtz erwartete nämlich, dass die mit den »Extracurrents« verbun-denen Trägheitseffekte nicht existieren, weil er sich die Elektrizität nicht als etwas Materielles vorstellte.
Wie auch immer die Lösung der Preisaufgabe ausfallen mochte, Hertz lernte dabei den Alltag im Helmholtz-schen Institut gründlich kennen. Außerdem zwang
ihn die Aufgabe, sich auch gründlich mit den theo-retischen Vorstellungen über das Wesen der Elek-trizität auseinanderzusetzen. Was er am Ende des
[7] Hertz als Student.
22
Fern- und Nahwirkungstheorien
Im Wettstreit lagen vor allem zwei konträre Vorstellun-
gen, die als »Fernwirkungstheorie« beziehungsweise als
»Nahwirkungstheorie« in die Physikgeschichte eingin-
gen. Die Fernwirkungstheorie postulierte elektrisch ge-
ladene Teilchen, die Kräfte aufeinander ausübten, ohne
dass es dazu einer vermittelnden Instanz zwischen den
Teilchen bedurfte. Die Nahwirkungstheorie setzte ein
Medium voraus, das die Kräfte zwischen den Teilchen
vermittelte. James Clerk Maxwell hatte in den 1860er
Jahren die Nahwirkungstheorie in vier Grundgleichun-
gen gekleidet, die praktisch alle bekannten elektrischen
und magnetischen Erscheinungen beschreiben konnten.
Für die Fernwirkungstheorie stand die NewtonschenGra-
vitationstheorie Pate: Sonne und Planeten zogen einan-
der nach einem ganz einfachen Kraftgesetz an, ohne
dass es eines Mediums bedurfte, das die Wirkung der
Schwerkraft zwischen den Himmelskörpern vermittelte.
In der Himmelsmechanik gingen nur die Massen der
sich anziehenden Körper und ihr Abstand voneinander
in die Theorie ein. Bei der Elektrodynamik mussten die
Fernwirkungstheoretiker aber ziemlich komplizierte An-
nahmen machen, wenn sie den Phänomenen gerecht
werden wollten. Eine dieser elektrodynamischen Fern-
wirkungstheorien nahm zum Beispiel an, dass die von
einer Ladung auf eine andere ausgeübte Kraft nicht nur
von der Größe der Ladung und dem Abstand abhängt,
sondern auch von der Geschwindigkeit und der Be-
schleunigung der Ladung.
Helmholtz war von den Nahwirkungstheorien stärker be-
eindruckt als von den Fernwirkungstheorien, wollte diese
aber nicht gänzlich ausschließen. Ging es ihm bei der
ersten Preisaufgabe darum zu entscheiden, ob es sich
bei den Trägern der Elektrizität überhaupt um »Teilchen«
mit einer Masse handelte, so wollte er jetzt den Raum
zwischen den Elektrizitätsträgern unter die Lupe nehmen.
»Die von Faraday aufgestellte und von Hrn. Cl. Maxwell
mathematisch durchgeführte Theorie der Elektrodynamik
setzt voraus, dass das Entstehen und Vergehen dielekt-
rischer Polarisation in isolierenden Medien, so wie auch
im Welträume, ein Vorgang sei, der die elektrodynami-
schen Wirkungen eines elektrischen Stromes habe und
wie ein solcher durch elektrodynamisch induzierte Kräfte
erregt werden kann«, so formulierte Helmholtz den Aus-
gangspunkt der neuen Preisaufgabe. »Die Akademie
verlangt, dass entweder für oder gegen die Existenz
der elektrodynamischen Wirkungen entstehender oder
vergehender dielektrischer Polarisation in der von Hrn.
Maxwell vorausgesetzten Stärke oder für oder gegen
die Erregung dielektrischer Polarisation in isolierenden
Medien durch magnetisch oder elektrodynamisch indu-
zierte elektromotorische Kräfte entscheidende experi-
mentelle Beweise gegeben werden.«
Was versteht man unter dem »Entstehen und Verge-
hen dielektrischer Polarisation in isolierenden Medi-
en«? In Leitern fließt bei Anlegen einer Spannung ein
elektrischer Strom. In »isolierenden Medien« sollte es
nach der Maxwellschen Theorie auch eine Art Strom
geben, wenn eine zeitlich veränderliche Spannung
angelegt wird: er kommt durch das Ausrichten (»Pola-
risation«) der entgegengesetzten Ladungen zustande
und wird als »Verschiebungsstrom« bezeichnet.
Hertz gelang die Lösung der Preisaufgabe erst ein
Dutzend Jahre später mit dem Nachweis elektroma-
gnetischer Wellen, die sich durch ein isolierendes
Medium hindurch ausbreiten können. Diese Wellen
beruhen auf dem von Maxwell postulierten Verschie-
bungsstrom. Oder, um es in der Sprache der Helm-
holtzschen Preisaufgabe auszudrücken: sie künden
von dem »Entstehen und Vergehen dielektrischer Pola-
risation in isolierenden Medien«. Nachdem Hertz vie-
le Jahre später solche Wellen erzeugt und ihr Verhal-
ten untersucht hat, erinnerte er sich der Preisaufgabe
als ersten Ansporn. Sie habe seine »Aufmerksamkeit
geschärft für Alles, was mit elektrischen Schwingun-
gen zusammenhing«, schrieb er im ersten Band seiner
1892 veröffentlichten »Untersuchungen über die Aus-
breitung der elektrischen Kraft«.
23
Wintersemesters 1878/79 als Lösung ablieferte, löste nicht wirklich die Frage nach der materiellen Natur der Elektrizität; aber Hertz hatte mit seinem Expe-riment eine neue Nachweisgrenze gesetzt - und sich als geschickter Experimentator präsentiert. Da keine bessere Lösung eingereicht wurde, erkannten ihm Helmholtz und Kirchhoff den Preis zu.
Ermutigt durch diesen Erfolg wollte Hertz die Preisschrift gleich zur Doktorarbeit ausbauen, doch Helmholtz bremste seinen Ehrgeiz und schlug ihm eine andere Arbeit vor. Sie würde ihn »zwei bis drei Jahre vollständig in Anspruch nehmen«, schrieb Hertz enttäuscht an seine Eltern. Allerdings signa-lisierte ihm »die Art, wie er mich aufforderte«, dass Helmholtz ihm noch viel zutraute. Auch bei dieser neuen Herausforderung handelte es sich um eine von Helmholtz gestellte Preisarbeit, die diesmal aber nicht von der Universität, sondern von der Preußischen Akademie der Wissenschaften ausgeschrieben wurde. Auch dabei sollten wieder die rivalisierenden Theo-rien über die Elektrodynamik auf den Prüfstand des Experiments gestellt werden.
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Hertz konnte die neue Preisaufgabe nicht lösen. »Die Aufgabe wurde nicht bearbeitet«, heißt es 1882 in den Akten der Akademie. Hertz hatte sich anfangs alle Mühe gegeben, dem Problem mit einem geeigneten Experi-ment beizukommen; er musste jedoch feststellen, dass bei jeder von ihm zugrunde gelegten Anordnung das gesuchte Phänomen durch andere Effekte, wie zum Beispiel Reibungselektrizität, überlagert würde. Er übergab Helmholtz seine Rechnungen und gestand ihm, dass er eine experimentelle Bearbeitung der Preisaufgabe für wenig aussichtsreich hielt.
Bei seiner Auseinandersetzung mit den zeitgenös-sischen Theorien der Elektrizität war ihm jedoch einiges untergekommen, das sich ebenfalls als Thema einer Doktorarbeit eignete. Am Ende behandelte er die Induktion von Strömen bei einer rotierenden Metallkugel in einem Magnetfeld - nicht experimen-tell, sondern theoretisch. Wenn sich Metall in einem Magnetfeld bewegt, wird darin ein Stromfluss indu-ziert. Für die rotierende Kugel war das aber noch nie im Detail berechnet worden. Nachdem er seine Talente als Experimentalphysiker schon unter Beweis gestellt hatte, sah Hertz bei diesem Problem die Gele-genheit, sich auch als Theoretiker zu profilieren. Die Arbeit ging ihm leicht von der Hand, nur die bevor-stehende Doktorprüfung machte ihm angesichts
[8] »Nun fehlte ihm die Fähigkeit, Tonhöhen zu unterscheiden, in einem Maße, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Sein Gesang war also nur eine Reihe absolut unreiner Töne (...)«, berichtete Heinrich Kayser, sein geplagter Zimmernachbar und Assistentenkollege bei Helmholtz.
24
seines unkonventionellen Studiums etwas Sorge. Er habe »kräftig repetiert«, schrieb er den Eltern vor der Prüfung im Januar 1880. Aber er bestand die Prüfung mit Auszeichnung (»magna cum laude«). »Doktoren von hiesiger Universität mit meinem Prädikat sind gezählt«, erklärte er den Eltern, »und besonders bei Helmholtz und Kirchhoff soll es noch nicht vielen widerfahren sein.«
Hertz fühlte sich als Physiker aus Berufung, und um dieser Berufung weiter zu folgen, gab es nur einen Karriereweg: er musste Professor an einer Universität werden. Der erste Schritt dazu war die Habilitation. Sie bescherte dem Kandidaten den Titel eines Privat-dozenten und die Berechtigung, Vorlesungen abzu-halten. Alles weitere hing dann von dem Ansehen ab, das sich ein Privatdozent als Lehrer und Forscher erwarb, und aufgrund dessen er zum Professor auf einen Lehrstuhl an einer Universität berufen werden würde.
Mit diesem Ziel vor Augen war Hertz überglücklich, dass ihm Helmholtz im Sommer 1880 eine Assisten-tenstelle in seinem Laboratorium anbot. Die Assisten-tentätigkeit bestand im wesentlichen in der Betreuung von Studenten bei Praktikumsversuchen und ließ ihm Zeit für eigene Forschungen. Als erstes publizierte Hertz noch einmal eine theoretische Arbeit, diesmal
aber nicht zur Elektrodynamik, sondern aus dem Bereich der Elastizitätstheorie. Wenn zwei elastische Körper zusammenstoßen oder zusammengepresst werden, bilden sie eine gemeinsame Kontaktfläche aus. Hertz berechnete, wie diese von den Materialei-genschaften abhängt. »Übrigens hat die Arbeit schon eine Anwendung gefunden«, schrieb er den Eltern im Mai 1881 über seine Abhandlung. Bei Vermessungen wurden Stahlmaßstäbe zur Vermeidung von Verkan-tungen nicht mit ihren Endflächen aneinandergefügt, sondern mit leichtem Druck an eine dazwischen einge-fügte Glaskugel gepresst. Mit der Hertzschen Theorie konnte man die Verformung der Glaskugel berechnen und damit den Messfehler genau abschätzen.
Danach experimentierte er im Helmholtzschen Labo-ratorium eine Weile ohne rechtes Ziel »unordentlich hin und her«, wie er den Eltern gestand, aber auch bei diesem planlosen Forschen kamen publikations-würdige Ergebnisse zustande, mit denen er sich in der Fachwelt der Physiker einen Namen machte. Am Ende seiner Berliner Assistentenzeit erhielt er das Angebot, seine Habilitation in Kiel abzuschließen und mit einem Privatdozentenstipendium die unterste Sprosse der akademischen Karriereleiter zu erklimmen. Mit dem Angebot war die Anwartschaft auf eine außer-ordentliche Professur verbunden. Da Hertz in Kiel unverzüglich die Lehre in der mathematischen Physik
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
25
übernehmen sollte, sorgte man für eine rasche Durch-führung des Habilitationsverfahrens. Seine Abhand-lung über die »Berührung fester elastischer Körper« wurde als Habilitationsschrift angenommen, und auch das Prüfungsgespräch war eher eine Formsache. Er beschrieb es den Eltern als »ein einigermaßen förm-liches Gerede ohne Inhalt«, dann sei er hinaus- und gleich wieder hineingebeten worden, »worauf mir alle anwesenden Professoren sehr freundlich gratulierten. Am folgenden Morgen konnte ich dann meine Vorle-sungen anschlagen«. Doch ganz glücklich war der frischgebackene Privat-dozent in Kiel nicht. »Die Kollegien hatten in den letzten Wochen zu meiner nicht geringen Betrübnis
zu leiden, so dass einige mal die Präsenzstärke auf zwei sank«, schrieb er enttäuscht über die geringe Zahl seiner Hörer im Sommersemester 1883, seinem ersten Semester als Hochschullehrer. Für das nächste Semester nahm er sich vor, die Theorievorlesung mit Experimenten zu begleiten, und richtete sich privat eine kleine Experimentierstätte ein. Dabei wurde ihm schmerzlich bewusst, was er in Berlin zurückgelassen hatte. Doch als er mit seiner Vorlesung begann, stellte er erfreut fest, dass sich die Zahl der Hörer gegenüber dem Sommersemester mehr als verdoppelt hatte. Bei seiner Physikvorlesung für Medizinstudenten war der Hörsaal sogar voll besetzt. Aber mit fortschreitendem Semester kam die Ernüchterung. »Ich bin wieder in mancher Richtung recht unzufrieden«, schrieb er nach Hause. »Meine eigene Arbeit kommt nicht weiter und kommt nicht weiter, mit dem Kolleg bin ich auch unzufrieden«.
Im Sommer 1884 hielt Hertz eine Vorlesung über die »Konstitution der Materie«, von der er hoffte, dass sie allgemein verständlich sei und den Studenten etwas von der Faszination vermittelte, die er selbst empfand. »28. Mai. An der Konstitution der Materie gearbeitet, das Kolleg findet keinen rechten Anklang,« notierte er jedoch enttäuscht in seinem Tagebuch. Dabei behan-delte er in dieser Vorlesung Themen, die eigentlich jeden naturwissenschaftlich Interessierten bewegen
mussten. Ist die Materie aus Atomen zusammen-gesetzt? Im Manuskript zu dieser Vorlesung verriet Hertz zum ersten Mal, wie sehr ihn die letzten Fragen seiner Wissenschaft bewegten. Das ganze 19. Jahr-hundert hindurch blieb die Frage nach der atomaren Konstitution der Materie unentschieden. Hertz arbei-tete heraus, wie man die Frage nach Atomen durch konkrete physikalische Befunde in dem einen oder anderen Sinn beantworten konnte. Aus der Tatsache, dass heiße Gase leuchten, folgerte er zum Beispiel, dass in den Atomen »sehr viele gegeneinander bewegliche Massen« vorhanden sein mussten, um die Schwin-gungen zu erzeugen, die man in den Lichtwellen beobachten konnte. Die Atome konnten also keine starren Kugeln sein; es musste sich um Gebilde mit einer inneren Struktur handeln, vergleichbar »etwa mit unserem Planetensystem, in welchem sich ja auch eine Reihe von Kugeln in harmonischer Bewegung befindet.«
Auch dem Äther, der Ursubstanz der Physik des 19. Jahrhunderts, widmete Hertz in dieser Vorlesung einige Betrachtungen. Wie man an den Lichtwellen sehen könne, die von der Sonne zur Erde gelangen, müsse es auch im leeren Raum »etwas geben, das Wellen schlägt, und wir können dasselbe Äther nennen.« Für Hertz, wie für die Begründer des Elektromagnetismus, Faraday und Maxwell, diente [9] Heinrich Hertz im Kreise seiner Kieler Kollegen.
26
der Äther auch den elektrischen und magnetischen Erscheinungen als Medium. Nach den Gleichungen, die Maxwell dafür ersonnen hatte, breiteten sich die Ätherschwingungen genau mit Lichtgeschwindig-keit aus. Lichterscheinungen und elektromagnetische
Phänomene gehorchten denselben Grundgesetzen. Das konnte kein Zufall sein.
Es war daher nicht verwunderlich, dass Hertz in seiner Vorlesung über die Konstitution der Materie auch auf die Maxwellsche Theorie einging. Dabei nahm er fast schon vorweg, was ihn einige Jahre später zur Entde-ckung der elektromagnetischen Wellen führte. In seinem Tagebuch häuften sich in diesem Sommerse-mester 1884 abwechselnd »Konstitution der Materie« und »Elektrodynamik« als Einträge. »Mit Sorgen Elektrodynamik nachgedacht (20. Oktober), Wieder zur Elektrodynamik gewendet (24. Oktober), Elek-trodynamik nachgedacht (25. Oktober)«, so lauten auch die Einträge im Herbst 1884. »Sehr schlechte Laune«, schrieb er jedoch ein paar Tage später. Dann verbannte er die Elektrodynamik für viele Monate aus seinem Denken.
Was wollte Hertz mit seinen Bemühungen um die Elektrodynamik? Wollte er den Streit der Physiker um das richtige Verständnis der Elektrodynamik im Sinne Faradays und Maxwells entscheiden? In einer Arbeit in den Annalen der Physik, die man als ein Teilergebnis dieser Bemühungen ansehen kann, leitete er eine Darstellung der Maxwellschen Gleichungen ab, aus der die Symmetrie zwischen elektrischen und magnetischen Kräften ins Auge stach: »Die magneti-
schen und elektrischen Kräfte sind jetzt miteinander vertauschbar.« Das war ein Indiz dafür, dass in der Maxwellschen Theorie eine tiefere Wahrheit schlum-merte, aber keine zwingende Entscheidung über die letzten Fragen der Elektrodynamik.
Ende 1884 traten wieder Gedanken über die eigene Karriere in den Vordergrund. Hertz stand auf der Berufungsliste für eine Professur am Polytechnikum in Karlsruhe, die zuvor Ferdinand Braun inne hatte. Braun wurde auf einen Lehrstuhl an der Universität Tübingen berufen. Er sollte später als Erfinder der Braunschen Röhre berühmt werden; 1884 war er wie Hertz noch am Beginn seiner Karriere. Eine Professur an einem Polytechnikum galt weniger als die an einer Universität, so dass Hertz zunächst zögerte, den Ruf anzunehmen. Er habe »große Abneigung gegen Karls-ruhe«, schrieb er am 28. Dezember in sein Tagebuch. Als er sich bei einem Besuch in Karlsruhe aber von den guten Experimentiermöglichkeiten am Polytech-nikum überzeugte, war sein »Wunsch nach Karlsruhe sehr groß«. Er ging noch am selben Tag ins Badische Kultusministerium, wo man ihn drängte, sich sofort zu entscheiden. »Ultimatum, abends sicher ange-nommen,« schrieb er am Ende dieses ereignisreichen 29. Dezember 1884 in sein Tagebuch.
Der Ruf nach Karlsruhe hätte Hertz eigentlich von
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[10] James Clerk Maxwell.
27
allen Karriereängsten befreien können - stattdessen brachte er ihn an den Rand eines seelischen Zusam-menbruchs. Anstatt Vorfreude auf sein neues Leben als Herr über sein eigenes, gut ausgestattetes Physik-institut zu empfinden, fühlte er sich »so trübselig und gottverlassen« wie nie zuvor. Offensichtlich hatte das Gefühl der Verlassenheit andere Gründe. In Kiel scheint Hertz für kurze Zeit verliebt gewesen zu sein, doch darüber ist nichts Näheres bekannt. Mit 28 Jahren war Hertz bei seinem Amtsantritt in Karlsruhe
in einem Alter, in dem die Gründung einer Familie wie selbstverständlich zu einem erfüllten Lebensent-wurf gehörte - noch dazu für einen Professor. Kurz nach seiner Ankunft in Karlsruhe lernte Hertz die Tochter eines Kollegen kennen - und hielt ohne langes Zaudern um ihre Hand an. Drei Tage später folgte die Verlobung - und wieder drei Tage später die Entlo-bung. Danach litt Hertz abwechselnd an nervöser Unruhe und apathischer Niedergeschlagenheit. Auch eine Kur in einer »Wasserheilanstalt« im Thüringer Wald brachte keine Besserung. Er fühlte sich unsicher
und menschenscheu. Der Skandal der überstürzten Ver- und Entlobung nahm jedoch einen glimpflichen Ausgang. Die gedemütigte Beinahe-Braut versicherte ihm mit einem »Schwamm drüber«, dass er sich nicht weiter grämen sollte. Auch die Professorenschaft zeigte sich mitfühlend. Dennoch befreite ihn dies nicht von seinen Seelenqualen. Am Sylvestertag 1885 schrieb er in sein Tagebuch: »Froh, dass dieses Jahr herum, und hoffend, dass kein solches folgt.«
Im März 1886 lernte Hertz Elisabeth Doll kennen. Auch sie war die Tochter eines Kollegen, aber diesmal, so schrieb Hertz seinen Eltern nach Hamburg, habe sich die Verlobung »wie von selbst« ergeben. Am Ende des Sommersemesters 1886 fand die Hochzeit statt. Allen erhaltenen Quellen zufolge war es eine sehr glückliche Ehe. In den Briefen an die Schwieger-mutter sprach Elisabeth voll Zärtlichkeit von ihrem lieben »Heins« oder ihrem »Bibie«, der sie fürsorg-lich verwöhnte. Am 2. Oktober 1887 brachte sie ein Mädchen zur Welt. Nach dem Fiasko mit der gescheiterten Verlobung war Hertz viele Monate lang zu keiner produktiven Arbeit fähig, und auch nach seinem Krisenjahr 1885 war lange nicht erkennbar, was er zum Gegenstand neuer Forschungen machen würde. Erst im Herbst 1886 zeichnete sich ab, dass er sich mit einer Sache gründ-
[11] Das Polytechnikum in Karlsruhe.
28
licher zu beschäftigen begann: Funkenversuchen. Dabei bezog er sogar seine Frau mit ein. »Elisabeth bei mir im Laboratorium, Funken bei den Rühm-korffentladungen untersucht«, schrieb er einmal ins Tagebuch. Mit »Rühmkorff« - benannt nach Heinrich Daniel Rühmkorff - bezeichnete man so genannte Funken-induktoren, Apparate, die mit einer Spule, einem Kondensator und einem Unterbrecher aus dem Gleich-strom einer Batterie kurzzeitige Stromentladungen in Form von Funken erzeugen. Am 5. Dezember 1886 beschrieb Hertz seinem alten Lehrer Helmholtz diese Funkenexperimente. Er übertrug die Funken des »Rühmkorff« auf einen 3 m langen Kupferdraht, an dessen Enden Messingkugeln mit einem Durchmesser
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[12] Heinrich und Elisabeth nach der Verlobung.
[13] Rühmkorff-Induktor mit Funkenüberschlag.
29
von 30 cm angebracht waren. Diesen Draht habe er in der Mitte unterbrochen und zwei kleine Messing-kugeln an die losen Enden angebracht.
Von dieser Anordnung - heute würden wir sagen: Antenne - gingen sehr starke Induktionswirkungen aus. Er habe in einem ähnlich geformten in der Mitte unterbrochenen Draht – also einer Empfangsantenne - »noch in einer Entfernung von 2 m seitlich von der induzierenden Bahn Funken erhalten«. Hertz bewies mit diesem Experiment, dass durch den »Rühmkorff«-
Funken elektromagnetische Induktionswirkungen in die Umgebung ausgestrahlt werden. Dabei fiel ihm auf, dass die Funken im Empfangs-draht nicht immer gleich stark waren, auch wenn sonst die Anordnung von
Sender und Empfänger unverändert war. Wenn er die direkte Sichtverbindung zwischen den auslösenden »Rühmkorff«-Funken und den Empfängerfunken mit Papier, Glas oder anderen Gegenständen störte, beein-flusste das die Stärke des Empfängerfunkens. Im Mai 1887 fasste er die Ergebnisse dieser Untersuchungen in einer Arbeit »Über einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die elektrische Entladung« zusammen. Sie beschrieb das Phänomen des Photoeffekts. Eine Erklärung konnte er nicht bieten - das gelang erst Einstein mit Hilfe der Quantentheorie: Die von dem »Rühmkorff«-Funken ausgesandten Lichtquanten schlagen aus den Metallkugeln, zwischen denen der Funke im Empfangsdraht überspringt, Elektronen heraus; diese ionisieren die Luft und erleichtern so den Funkenüberschlag. Die Funkenexperimente brachten Hertz auch noch einen anderen Erfolg. »Die Arbeit, die ich in den nächsten Tagen mit Gottes Hilfe beendigen werde«, schrieb er am 30. Oktober 1887 an seine Eltern,
»ist eigentlich eine Lösung der Aufgabe, welche im Jahr 1879 die Berliner Akademie gestellt hat, welche aber ohne Bearbeitung geblieben ist.« Damit spielte er auf die Preisaufgabe an, die ihm Helmholtz als Thema für die Doktorarbeit gestellt hatte, und die er damals für unlösbar gehalten hatte. Jetzt sei ihm das »fast spielend geglückt, auf einem Wege, der damals freilich nicht zu vermuten war. Darum ist auch die Arbeit für mich eine Art persönlichen Triumphes«. Er hatte seine Experimente mit Sende- und Empfangs-drähten so weit verfeinert, dass zum Beispiel schon ein dazwischen gehaltener Metalldraht die Funken im Empfangsdraht zum Erlöschen brachte. Wenn das auch mit isolierendem Material gelang, so wäre dies ein Nachweis dafür, dass die elektromagnetische Induktion auch in nicht leitendem Material elektri-sche Wirkungen (die so genannten »Maxwellschen Verschiebungsströme«) hervorrufen kann. »Großen Schwefelklotz von zwei Zentner gegossen«, notierte er am 17. Oktober 1887 in sein Tagebuch. »Pechklotz
[14] Funkenstrecke von Heinrich Hertz.
[15] Original Skizze von Heinrich Hertz.
30
bestellt, Niederschrift der Arbeit überlegt«, heißt es eine Woche später. Er verbrauchte für diesen Nachweis riesige Mengen an Material, »16 Zentner Asphalt, 9 Zentner Pech, 2 Zentner Schwefel«, wie er den Eltern schrieb. Am Ende konnte er aber »das Entstehen und Vergehen dielektrischer Polarisation in isolierenden Medien«, um im Wortlaut der Preisaufgabe von 1879 zu bleiben, sicher nachweisen.
»Bravo!!« gratulierte ihm Helmholtz zu diesem Erfolg. Das Lob aus dem Munde seines Lehrers war für Hertz eine besondere Genugtuung und ein Ansporn, auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu forschen. Im Nachhinein hat es den Anschein, als ob Hertz mit diesen Versuchen elektromagnetische Wellen nachweisen wollte, die es der Theorie Maxwells zufolge geben sollte. Aber Hertz sprach noch nicht von elektromagnetischen Wellen, sondern nur von »Wirkungen«. Es würde zu weit führen, die Experi-mente im Einzelnen zu beschreiben, die Hertz am Ende zu einem überzeugten »Maxwellian« machten. Einige Andeutungen müssen genügen. Er erzeugte wieder mit dem »Rühmkorff« elektrische Schwin-gungen in einem Sendedraht und untersuchte mit den in einem Empfangsdraht erregten Funken deren Ausbreitung. Er übertrug die Schwingungen an einen durch das Laboratorium gespannten Draht, wo sie wie bei einem an einer Wand befestigten Seil, das
am anderen Ende auf- und ab bewegt wird, stehende Wellen mit Schwingungsbäuchen und Schwingungs-knoten ausbildeten. Mit dem auf einen Holzrahmen gespannten Empfänger schritt Hertz den Draht ab, um anhand der Funken die Schwingungsbäuche, also die Orte maximaler elektrischer Erregung, aufzu-finden. Aus dem Abstand der Bäuche ergab sich die Wellenlänge, und daraus konnte er die Geschwindig-keit berechnen, mit der sich die elektrodynamischen Wirkungen im Draht ausbreiteten. Da sich die vom Sender ausgehende Erregung auch in der Umgebung des Drahtes ausbreitete, kam es an verschiedenen Stellen im Laboratorium zu Schwingungsbäuchen und -knoten, so dass Hertz auch die Ausbreitungs-geschwindigkeit im Luftraum ermitteln konnte. »Versuche, Interferenzen zwischen den direkten und den durch Drähte fortgeleiteten Wirkungen herzu-stellen, gelingen«, notierte er am 10. November 1887 im Tagebuch.
Am 21. Januar 1888 berichtete er Helmholtz über die Ergebnisse dieser Versuche. Er habe noch gar nicht versucht, »eine bestimmte Theorie auf die Erschei-nungen anzuwenden«. Helmholtz war so beein-druckt, dass er die Ergebnisse seines Meisterschülers umgehend in der Berliner Physikalischen Gesellschaft vorstellte. Ein amerikanischer Physiker, der dieser Veranstaltung beiwohnte, berichtete, Helmholtz habe
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[16] Heinrich und Elisabeth bei gemeinsamen Experimenten im Karlsruher Hörsaal.
31
dabei »ein triumphierendes Leuchten in seinen Augen« gehabt und den Vortrag »mit einer Lobrede auf seinen geliebten Schüler Hertz und einem Glückwunsch an die deutsche Wissenschaft« beendet.
Hertz wollte zuerst nur »drei kleine Abhandlungen« über seine Ausbreitungsversuche in den Annalen der Physik veröffentlichen. Da sich seine Experimente jedoch als immer interessanter entpuppten, packte er nach Ostern 1888 noch eine vierte dazu. Das Wich-tigste daran teilte er Helmholtz am 19. März 1888 in einem Brief mit. Darin kündigte er auch seine Absicht an, die »elektrodynamischen Wellen« in einer neuen Versuchsserie noch gründlicher zu erforschen. Was Hertz bis zum Sommer 1888 mit seinen Expe-
rimenten aufgedeckt hatte, reichte eigentlich schon aus, um den Streit zwischen den verschiedenen elek-trodynamischen Theorien zugunsten Maxwells zu entscheiden. Hertz habe mit seinem »experimentum crucis« die Richtigkeit der Maxwellschen Theorie bewiesen, jubilierte ein »Maxwellian« in England. Man werde später von »Hertz’s klassischem Expe-riment« reden, und das Jahr 1888 werde »in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem diese große Frage experimentell durch Hertz in Deutschland entschieden wurde und, so hoffe ich, durch andere in England.«
Nachdem es Hertz gelungen war, stehende elektro-magnetische Wellen im Raum zu erzeugen, war der Gedanke naheliegend, mit einem metallenen Hohl-spiegel die elektromagnetischen Wellen zu bündeln. Das konnte aber nur gelingen, wenn die Wellenlänge kleiner als der Spiegel war. Eher zufällig hatte Hertz beim Experimentieren mit »ganz kleinen Resona-toren« auch solche Wellen erzeugt, wie er er am 12. November 1888 in seinem Tagebuch festhielt. Er konnte die Wellenlänge bis auf etwa 40 cm reduzieren. »Den großen Induktionsapparat mit dem kleinen vertauscht... Es gelingt ziemlich gut, die früheren Versuche im zehnfach kleineren Maßstabe zu wieder-holen«. Diese kurzen Wellen konnte er mit einem metallenen Hohlspiegel bündeln und damit fast wie
mit Lichtstrahlen experimentieren. Wieder verraten die Tagebucheinträge, wie rasch Hertz für seine »Strahlen« neue Versuche ersann. Am 26. November 1888 hatte er »für ein Prisma« Pech bestellt, am 1. Dezember machte er »Versuche über Reflexion und Polarisation des Strahles«. Zwei Wochen später schickte Hertz eine Abhandlung über diese Experimente an Helmholtz. Sie trug den Titel »Über Strahlen elektrischer Kraft« und machte Hertz mehr als alle vorherigen Arbeiten zu einer Berühmtheit. Das wirkte sich auch auf die Karriere
aus. Wie sein Vorgänger Ferdinand Braun erwartete auch Hertz, dass er nun an der Reihe sei, um auf einen ordentlichen Physiklehrstuhl an eine Univer-sität berufen zu werden. Trotz der hervorragenden Experimentiermöglichkeiten in Karlsruhe galten die
[18] Die von Hertz 1888 benutzten Parabolspiegel.
[17] Hertz fotografierte seine Apparate 1887 selbst.
32
Polytechnika oder technischen Hochschulen, wie sie sich bald nannten, noch nicht als den Universi-täten gleichrangige Stätten der Lehre und Forschung. Hertz musste nicht lange warten, bis ihn ein Ruf an eine Universität erreichte. In Bonn wollte man ihn als Nachfolger des berühmten Rudolf Clausius, der im August 1888 verstorben war. »Bonn scheint jetzt sicher zu sein«, schrieb Hertz am 16. Dezember 1888 seinen Eltern nach Hamburg. Er zögerte nicht lange und nahm den Ruf an. Er übernahm auch das Haus, in dem Clausius gewohnt hatte.
Als Hertz zu Beginn des Sommersemesters 1889 seine Bonner Stelle antrat, galt sein erstes Augenmerk dem Laboratorium, das in großen, von dicken Mauern umgebenen Kellerräumen untergebracht war. Die ersten Eindrücke, die er seinen Eltern mitteilte, klingen nicht gerade nach heller Begeisterung. »Und alle die Keller und Gänge, wo das Wasser von der Decke tropft und man Quellen rauschen hört - hu - hu -. Werden wir Leben in die Sache bringen, das frage ich mich mit großen Zweifeln.« In den verwaisten Kellerräumen ein Laboratorium einzu-richten, das seinen Bedürfnissen entsprach, kostete Hertz in seinem ersten Bonner Semester viel Kraft. Er fühlte sich bald ausgelaugt und sehnte das Semes-terende herbei. Doch Zeit für Entspannung blieb ihm kaum, denn er hatte für einen Kongress in Heidelberg
im September 1889 einen Vortrag »Über die Bezie-hungen zwischen Licht und Elektrizität« vorzube-reiten. Er bot darin in allgemeinverständlicher Form
eine Zusammenfassung seiner Karlsruher Expe-rimente. Der Vortrag stieß auf so großes Interesse, dass die von einem Bonner Verleger als kleine Broschüre verbreitete Vortragsfassung innerhalb von drei Monaten sieben Auflagen erlebte.
Nach dem Heidelberger Kongress machte Hertz eine Weile einen Bogen um das Laboratorium, das immer noch nicht seinen Anforderungen entsprach und widmete sich den theoretischen Grundlagen der Elektrodynamik. »In dieser Zeit ununterbrochen gearbeitet an den Grundgleichungen für ruhende Leiter«, notierte er im Oktober 1889 in sein Tage-buch. Was er dann 1890 in zwei Abhandlungen über die Grundlagen der Elektrodynamik veröffentlichte, zählt zu den Klassikern der theoretischen Physik. Das Maxwellsche Formel- und Begriffssystem sei »in seiner möglichen Entwickelung reicher und umfassender, als ein anderes der zu gleichem Zwecke ersonnenen Systeme«, so rühmte Hertz darin die Maxwellsche Theorie. Allerdings sei Maxwells eigene Darstellung sehr unklar, was die logischen Grundlagen angeht, »sie schwankt häufig hin und her zwischen den Anschauungen, welche Maxwell vorfand, und denen, zu welchen er gelangte«. Hier schaffte Hertz Klarheit. Erst in der von ihm bereinigten Form wurde das von Maxwell geschaffene System von Gleichungen zur Grundlagentheorie der modernen Elektrodynamik.
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[19] Wohnhaus von Heinrich Hertz in der Bonner Quantiusstraße (historische Aufnahme).
33
Vielleicht war Hertz des vielen Theoretisierens über-drüssig, dem er sich mit den beiden Abhandlungen über die Grundgleichungen der Elektrodynamik so intensiv gewidmet hatte, denn zu Beginn des Winter-semesters 1890/91 schrieb er seinen Eltern, er wolle sich in diesem Semester »ausschließlich mit dem Expe-rimentalkolleg und dem Laboratorium« beschäftigen.
Doch zu einem unbeschwerten Experimentieren kam er nicht. Am 1. Dezember 1890 verlieh ihm die Royal Society in London die Rumford-Medaille. Ausser Gustav Kirchhoff hatte vor ihm noch nie ein deutscher Physiker diese höchste Auszeichnung der Royal Society erhalten. Dann stellte sich Nachwuchs ein. »Ein Töchterchen, Mutter und Kind sind wohl«, schrieb Hertz am 14. Januar 1891 in das Tagebuch. Als er danach endlich zu experimentieren begann, wollte ihm nichts Rechtes gelingen – und er wandte sich wieder der theoretischen Physik zu. Im Sommer 1891 notierte er immer wieder in sein Tagebuch, dass er über die »mechanischen Prinzipien« nachdachte. Die Mechanik, so empfand Hertz, bedurfte noch viel mehr als die Elektrodynamik der Klärung ihrer Grundlagen. In der Mechanik beruhte zum Beispiel das Gesetz der universellen Gravitation auf dem Konzept der Fernkraft. Während sich elektromag-netische Wirkungen mit einer sehr schnellen, aber endlichen Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindig-keit, durch den Raum ausbreiten, setzt das Fernwir-kungskonzept der Newtonschen Gravitationstheorie voraus, dass die Anziehungskraft einer Masse augen-blicklich auf eine andere Masse einwirkt, unabhängig davon, wie weit diese entfernt ist. Es musste jemanden wie Hertz, der gerade die Fernkraft aus der Elektrody-namik verbannt und durch eine konsequente Nahwir-kungs- oder Feldphysik ersetzt hatte, sehr irritieren,
dass zwischen den Wirkungen der Schwerkraft und denen des Elektromagnetismus ein so fundamentaler Unterschied bestehen sollte.
In der Mechanik gab es aber keine, mit der Maxwell-schen Theorie vergleichbare Grundlage, von der aus alle Erscheinungen abgeleitet werden konnten. Hertz musste aus eigener Kraft leisten, was Faraday und Maxwell in der Elektrodynamik auf den Weg gebracht hatten. Für die Mechanik eine solche Grundlage zu schaffen muss ihm erhebliche Mühe bereitet haben. »Ich stecke gerade etwas fest in theo-retischem Nachdenken«, schrieb er zum Beispiel am Tag vor Weihnachten 1891 an seine Eltern, »so dass ich mich mit Gewalt herausreißen muss, um das Fest nicht zu verträumen.« Ein paar Tage danach notierte er in sein Tagebuch: »Alle diese Zeit fleißig an den Prinzipien der Mechanik gearbeitet.« Tatsächlich dauerte es noch fast zwei Jahre, bis die »Prinzipien der Mechanik« druckfertig waren. Sie seien ihm »eine große Last« gewesen, schrieb er den Eltern am 10. Oktober 1893, und er habe auch sogleich ein »hohes Gelübde« abgelegt, »so bald nicht wieder auf eine theoretische Arbeit einzugehen.« Abgesehen von einer philosophisch-wissenschaftstheoretischen Einleitung handelt es sich bei der Hertzschen Mechanik nach Form und Inhalt eher um ein Mathematik- als ein Physikbuch. Hertz zwang seine Leser durch Hunderte
[20] Heinrich Hertz zu seiner Bonner Zeit.
34
von durchnummerierten Absätzen, gespickt mit differentialgeometrischen Formeln, ohne auch nur ein einziges konkretes Beispiel. Selbst ein Kenner der Materie wie Ludwig Boltzmann, der die Hertz-sche Mechanik intensiv studierte und sehr bewun-
derte, stand ihr am Ende etwas ratlos gegenüber: »Er schuf so ein frappierend einfaches, von ganz wenigen, gewissermaßen sich logisch von selbst darbietenden Prinzipien ausgehendes System der Mechanik. Leider schloss sich im gleichen Moment sein Mund auf ewig den tausend Fragen um Erläuterungen, die gewiss
nicht auf meinen Lippen allein schweben.«
Auch wenn Hertz die meiste Zeit mit den »Prinzi-pien der Mechanik« beschäftigt war, fühlte er sich primär als Experimentalphysiker und erst in zweiter Linie als Theoretiker. Im Herbst 1890 war Vilhelm Bjerknes als Stipendiat aus Norwegen nach Bonn gekommen, um unter seiner Anleitung das Expe-rimentieren mit elektromagnetischen Wellen zu erlernen. Bjerknes blieb nur ein Jahr, aber er hat Hertz zeitlebens als seinen Lehrer betrachtet. Im Sommer 1891 wurde Philipp Lenard Assistent von Hertz. Es sei »immer wunderbar« gewesen, schwärmte Lenard, wie sehr sich Hertz »über Versuche freute, die etwas Wesentliches, Neues lehrten.« Seit Hertz nach Bonn gekommen war, hatte er zwar immer wieder das eine oder andere Experiment in Angriff genommen, aber es ist nicht klar, worauf er eigentlich hinaus wollte. 1892 experimentierte er mit Kathodenstrahlen, von denen man damals noch nicht wusste, dass sie aus Elektronen bestehen. Er prüfte dünne Metallfolien auf ihre Durchlässigkeit für Kathodenstrahlen und für Licht - aber auch hier ließ er offen, was ihn dazu motivierte. Am 15. Dezember 1892 schrieb Hertz an Helmholtz, dass sein Assistent Lenard eine »sehr merkwürdige Entdeckung« gemacht habe. Lenard hatte in eine Kathodenstrahlröhre ein mit einem hauchdünnen Aluminiumplättchen verschlossenes
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[21] Hertz und Lenard während der Experimente mit Kathodenstrahlen.
35
Fenster eingefügt, durch das die Strahlen aus dem luftleeren Raum der Röhre ins Freie treten konnten.
Durch solche »Lenardfenster« - wie sie später genannt wurden - konnte man nun viel umfassender mit Katho-denstrahlen experimentieren als zuvor. Man konnte ihre Ausbreitung in verschiedenen Gasen unter-suchen und vieles andere, was innerhalb der Röhre nicht möglich gewesen wäre. Für Lenard markierte diese Entdeckung den Beginn einer sehr erfolgreichen Karriere als Experimentalphysiker. 1905 erhielt er für seine Kathodenstrahlforschung den Nobelpreis für Physik.
Nach 1892 kamen keine Erfolgsmeldungen mehr aus dem Bonner Physikinstitut. Stattdessen häuften sich in den Tagebucheinträgen und in den Briefen von Hertz an seine Eltern Berichte über seinen Gesundheitszustand. Sein Leiden begann mit einem »ebenso hartnäckigen wie unangenehmen Schnupfen«, wie Hertz im August 1892 nach Hamburg schrieb. Er begab sich in die Behand-lung eines Spezialisten, doch wenn eine Besserung eintrat, war diese immer nur von kurzer Dauer. Im Oktober 1892 unterzog er sich einer Nasenope-ration. Danach litt er an einer Halsentzündung und an Ohrenschmerzen. Er verbrachte mehrere Wochen fiebernd im Bett und musste sich einer
weiteren Operation unterziehen. »Aufmeißelung des mastoidus. Alles gut gegangen«, schrieb er am 29. Oktober in das Tagebuch. Vermutlich litt er an einer bakteriellen Nasen- und Nebenhöhleninfek-tion, die sich zu einer Mittelohrentzündung auswei-tete und dann eine Entzündung der Schleimhaut in dem hinter dem Ohr gelegenen Warzenfortsatz (Mastoideus) zur Folge hatte.
Die »Aufmeißelung« hinter dem Ohr brachte aber auch nur eine vorübergehende Besserung. Das Auf und Ab seines Zustands zehrte an seinen Nerven. Der Sommer 1893 verging mit »Zittern und Zagen«, aber er fühlte sich nicht gesund. Im September dieses Jahres wurde ihm in einer weiteren Opera-tion wieder ein Eiterherd entfernt. Danach stellte sich eine Blutvergiftung ein. »Wenn mir wirklich etwas geschieht«, schrieb er schon mit einer Todes-ahnung im Dezember 1893 an seine Eltern, »so sollt Ihr nicht trauern, sondern sollt ein wenig stolz sein und denken, dass ich dann zu den besonders Auserwählten gehöre, die nur kurz leben und doch genug leben. Dies Schicksal habe ich mir nicht gewünscht und gewählt, aber wo es mich getroffen, muss ich zufrieden sein, und wenn mir die Wahl gelassen wäre, würde ich es vielleicht selbst gewählt haben.« Am 1. Januar 1894 erlag er den Folgen der Blutvergiftung. [22] Philipp Lenard um 1905.
36
Weiterführende Literatur:Buchwald, Jed Z.: The Creation of Scientific Effects: Heinrich Hertz and Electric Waves. Chicago: Univer-sity of Chicago Press, 1994.
Fölsing, Albrecht: Heinrich Hertz: eine Biographie. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1997.
Hertz, Johanna (Hrsg.): Heinrich Hertz: Erinne-rungen, Briefe, Tagebücher. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft, 1927; neu aufgelegt von Mathilde Hertz und Charles Süsskind, Weinheim: Physik-Verlag, 1977.
Lenard, Philipp (Hrsg.): Heinrich Hertz. Gesammelte Werke. 3 Bände. Leipzig: Barth, 1894-1895.
Wolfschmidt, Gudrun (Hrsg.): Heinrich Hertz (1857-1894) and the Development of Communication. Norderstedt: Books on Demand, 2008.
Heinrich Hertz – Eine biographische Skizze Von Michael Eckert
[23] Heinrich Hertz’ Grabstein in Hamburg-Ohlsdorf.
37
Vom öffentlichen Umgang mit
Heinrich Hertz und seiner Familie
im Nationalsozialismus
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolff
39
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
1. Die jüdische Herkunft von Heinrich HertzBis in die Gegenwart hinein ist Heinrich Hertz (1857 – 1894) in Deutschland immer wieder als »jüdischer Wissenschaftler« bezeichnet worden.1 Mit diesem Begriff wird eine Gruppe umschrieben, deren Mitglieder einen nicht näher qualifizierten jüdischen Familienhintergrund besitzen. Insoweit gehören sowohl Menschen dazu, die in ihrem Selbstverständnis jüdisch sind als auch solche, bei denen einzelne Vorfahren dem Judentum angehört hatten, sie selbst aber damit gar nichts mehr verbinden müssen. Daher ist es kaum möglich, den überdurchschnittlichen beruflichen Erfolg dieser heterogenen Gruppe auf die Vermittlung jüdischer Traditionen und Werte zurück-zuführen. Es handelt sich vielmehr um ein soziales Phänomen, das dazu noch eine spezifisch deutsche Komponente besitzt. So stammte der akademische Nachwuchs in Deutschland zu einem großen Teil aus einer wohlhabenden Schicht des Bildungsbürger-tums, der im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhun-dert auch zunehmend Juden angehörten, von denen wiederum viele konvertierten. Die Attraktivität einer Universitätslaufbahn für das Bürgertum im deutschen Sprachraum findet ihre Erklärung in einem beson-ders hohen Sozialprestige, das es in anderen Ländern in dieser Form nicht gab. Kausal für die erfolgreiche Beteiligung am deutschen Wissenschaftssystem war in erster Linie also die soziale Herkunft, nicht die
Zugehörigkeit zum Konstrukt einer Gruppe mit der Bezeichnung »jüdische Wissenschaftler.«2 Die Familie Hertz ist ein Beispiel dafür. Heinrich Hertz war nach allen gängigen Definiti-onen kein Jude.3 Allein sein Vater stammte aus einer jüdischen Familie. Dessen Eltern waren zusammen mit ihren Kindern 1834 zum Protestantismus über-getreten.4 Als Heinrich Hertz 1857 in Hamburg zur Welt kam, lag dies bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Sein Großvater Heinrich David Hertz (1797 – 1863) hatte es als Hamburger Kaufmann durch Handelsgeschäfte mit England, wo er außerdem eine Firmenbeteiligung besaß, schon in jungen Jahren zu beträchtlichem Reichtum gebracht. Der damit einher-gehende soziale Aufstieg machte ihn für den Bankier Salomon Oppenheim (1772 – 1828) zu einem akzep-
tablen Schwiegersohn. Im Jahr 1826 heiratete Hein-rich David Hertz dessen Tochter Betty Oppenheim (1802 – 1872), deren sechs Schwestern sonst mehr-heitlich mit der europäischen Bankendynastie ehelich verbunden wurden. Der Gegensatz zwischen dem Aufstieg in die ökonomische Oberschicht und dem Umstand, als Jude in einem Zustand minderen Rechts zu verbleiben, suchte geradezu nach einer Auflösung. Einen entsprechenden Ausweg bot eine kurzfristig arrangierbare Taufe, also der Übertritt zum Chris-tentum. Nicht nur die Großeltern von Heinrich Hertz wählten diesen Weg, sondern auch die meisten der insgesamt zwölf Kinder von Salomon Oppenheim. Ähnlich war es bei den Geschwistern seines Großva-ters und dessen Nachkommen. So konnte Heinrich Hertz dem Judentum auch in der eigenen Verwandt-schaft kaum noch begegnen. Diese Konversionen stellten hier offenbar mehr als nur Formalien dar, die man lediglich erfüllte, um die vollen Bürgerrechte zu erhalten. Die alte Religion scheint vielmehr als ein nicht mehr bedeutsames Relikt einer vergangenen Epoche abgestreift worden zu sein. Bei der Familie Hertz in Hamburg treffen wir auch nicht auf das Phänomen einer fortbestehenden sozialen Ab- oder Ausgren-zung, die sie in einer gesellschaftlichen Enklave gehalten hätte. So etwas ließ sich beispielsweise daran erkennen, wenn konvertierte Juden vornehmlich weiterhin unter sich heirateten. Aber sowohl Heinrich
[1] Heinrich (2. von rechts) mit seinen Eltern Gustav Ferdinand und Anna Elisabeth Hertz sowie den Geschwistern Gustav, Otto und Rudolf (von links) im Jahre 1869.
41
Davids Sohn Gustav Ferdinand Hertz (1827 – 1914) als auch dessen Kinder, darunter der älteste Sohn Heinrich Hertz, wählten christliche Ehepartner, die keinen jüdischen Familienhintergrund besaßen. Die Taufe ermöglichte der Familie in der Tat auch den gesellschaftlichen Aufstieg. Gustav Ferdinand Hertz, der als erster in der Familie ein Universitätsstudium absolvierte und 1849 mit dem Doktor der juristi-schen Fakultät der Universität Göttingen abschloss, führte bald eine der bedeutendsten Anwaltspraxen in Hamburg. Seit 1857 gehörte er der Bürgerschaft an und wurde später Senator und Leiter der Justizbe-hörde, womit man ihn der Führungselite der Freien und Hansestadt Hamburg zurechnen kann.5 Nach allen bekannten Quellen spielte die »jüdische Herkunft« für Heinrich Hertz, wie man seine Famili-enzusammenhänge etwas vage zu beschreiben pflegt, keine Rolle in seiner Biographie. Sie war einzig noch in seinem Namen präsent, der sich von Hirsch, dem Symbol für einen der zwölf Stämme Israels ableitete. Wie alle protestantischen Kinder ist er 1872 im Alter von 15 Jahren konfirmiert worden.6 Während seines Studiums schloss er sich mit den »Cheruskern« 1876 einer schlagenden Verbindung an.7 Die Ausgren-zungen jüdischer Studenten im Verbindungswesen setzten erst in den 1880er Jahren ein. So stellte eine solche Mitgliedschaft damals noch kein Unterschei-dungsmerkmal gegenüber den jüdischen Deutschen
[2] Der Hamburger Rechtsanwalt und Senator Gustav Ferdinand Hertz, Heinrichs Vater. [3] Heinrich Hertz´ Herme im Ehrensaal des Deutschen Museums.
42
dar.8 Anders verhielt es sich aber mit dem Status des preußischen Reserveoffiziers, der Hertz offenbar sehr wichtig war. Sonst hätte er sich wohl nicht der umständlichen bürokratischen Prozedur ausgesetzt, die ihn im Sommer 1881 schließlich sein Ziel errei-chen ließ. Dies gelang keinem der 25-30.000 jüdisch Einjährig Freiwilligen, die nach 1880 in der preußi-schen Armee dienten. Selbst unter den 1.200 bis 1.500 zum Christentum Konvertierten lag die Erfolgsquote bei lediglich 20%.9 Im Verlauf seiner akademischen Karriere stieß Hertz ebenfalls nicht auf die Hinder-nisse, die Wissenschaftler in jener Zeit zu vergegen-wärtigen hatten, die jüdischer Konfession waren oder ihr vor einer Konversion zum Christentum angehört hatten. So musste er nicht unverhältnismäßig lange auf seine erste Professur warten und befand sich 1888 sogar in der besonders komfortablen Lage, zwischen einem der Lehrstühle in Gießen, Berlin oder Bonn auswählen zu können. Heinrich Hertz war nie ein Außenseiter. Daher findet sich bei ihm nichts an Prägungen oder Problemen, die für die Lebensläufe jüdischer Deutscher damals charakteristisch gewesen sind.
2. Ehrungen für Hertz und VereinnahmungDie große wissenschaftliche Bedeutung von Hertz führte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dazu, seiner an vielen Orten in Deutschland in verschiedenster
Form zu gedenken. Unter künstlerischer Mitwirkung der Tochter Mathilde Hertz (1891 – 1975) entstand 1916 eine Herme für den Ehrensaal des Deutschen Museums in München, wo den bedeutendsten deut-schen Erfindern und Forschern ein Denkmal gesetzt wurde.10 Zu ihrem 100jährigen Jubiläum errichtete die Technische Hochschule Karlsruhe, wo Hertz der Nachweis der elektromagnetischen Wellen gelungen war, auf einem Ehrenhof einen Portikus, der eine von Mathilde Hertz geschaffene überlebensgroße Büste von ihm einrahmte. Die Einweihungsfeier fand im Beisein der Witwe und der beiden Töchter von Hertz am 30. Oktober 1925 statt.11 Im Jahr zuvor war in Hamburg die »Heinrich-Hertz-Gesellschaft zur Förderung des Funkwesens« gegründet worden. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenar-beit zwischen Wissenschaft und Technik zu koordi-nieren sowie durch Bereitstellung von finanziellen Mitteln zu unterstützen. Mit dem Namen wollte man »gleichzeitig unserm großen Physiker das Denkmal setzen, das ihm die ganze Welt für seine Entde-ckung schuldet.«12 Auf der Berliner Funkausstellung von 1928 war eine kleine Ehrenhalle dem Andenken von Hertz gewidmet.13 Am 1. August 1927 wurde in Berlin ein mit der Technischen Hochschule verbun-denes »Heinrich-Hertz-Institut für Schwingungsfor-schung« gegründet und 1930 eröffnet. Im 1931 einge-weihten neuen Hamburger Funkhaus der damaligen
Nordischen Rundfunk AG war ein Heinrich-Hertz-Gedenkzimmer eingerichtet worden, in dem sich ein Relief seines Kopfes sowie eine Inschrift befanden. Letztere wies auf seine Entdeckung der elektromag-netischen Wellen hin.14
Unter den jüdischen Deutschen gab es angesichts von Ausgrenzungen und Zurücksetzungen, die durch die rechtliche Gleichstellung seit der Reichsgrün-dung nicht verschwunden waren, das Bedürfnis, auf
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
[4] Denkmal für Heinrich Hertz in Karlsruhe.
43
herausragende Leistungen aus ihren Reihen beson-ders hinzuweisen. Das schien ein Weg zu sein, die bislang versagte gesellschaftliche Integration einzu-fordern. Auch Hertz wurde für diesen Zweck verein-nahmt. Dabei spielten die oben beschriebenen famili-ären Details zumeist keine Rolle. Eine Monographie über »Berühmte israelitische Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit« von 1901 führt Hertz in der Sparte Physik an erster Stelle an.15
In einem Werk »Juden als Erfinder und Entdecker« von 1913 ist von ihm als dem »zu früh verstorbene[n] jüdische[n] Professor« die Rede.16 Ein Artikel aus dem gleichen Jahr, worin Hertz einmal korrekt als Enkel eines Hamburger Juden bezeichnet wurde und auch der Hinweis nicht fehlte, dass er selbst kein Jude gewesen sei, führte ihn dennoch in diesen Kontext ein. Dabei bediente sich der Autor der damals verbrei-teten rassischen Terminologie, um der Herabsetzung der Juden als vermeintliche Rasse entgegenzutreten. Es sollte gezeigt werden, »was die Wissenschaft und Zivilisation der gesamten Kulturwelt von Söhnen unseres Volksstammes an Anregungen und Beiträgen entgegengenommen haben, welche Summe von Kulturwerten die Menschheit den Söhnen unserer, angeblich inferioren Rasse zu danken hat.«17
3. Die Tilgung der öffentlichen Erinnerung an Heinrich Hertz im NS-StaatIm NS-Staat wurde Hertz aus anderen Gründen auf seine jüdischen Wurzeln reduziert. Der diskrimi-nierende Umgang mit »jüdischen Wissenschaftlern« bzw. denen, die man noch posthum dazu machte, erstreckte sich auch auf öffentliche Würdigungen, die nun als unerwünscht galten. Davon zu unterscheiden war der fachinterne Gebrauch von Namen, sei es in Zitaten oder als ehrende Bezeichnung für den Entde-cker eines Phänomens bzw. den Begründer einer
Theorie. Dieser Bereich blieb von solchen Einschrän-kungen weitgehend unberührt.18 Problematisch wurde eine solche Aufteilung zwischen öffentlicher
und fachlicher Würdigung mitunter dann, wenn das Ausland bzw. das internationale Ansehen Deutsch-lands betroffen war. Bei Hertz trat noch eine gewisse Unsicherheit hinzu, weil er nach den rassischen Krite-rien der Nationalsozialisten als »Mischling« galt, für die es nicht immer eindeutige Regelungen gab. Der ranghöchste NS-Rundfunkfunktionär Eugen Hadamovsky (1904 – 1945) versuchte 1934 die Repu-tation von Hertz zu beschädigen, indem er ihm seine wissenschaftliche Bedeutung absprach. Er musste den Stellenwert von Grundlagenforschung ignorieren, um feststellen zu können: »Nicht der Jude Heinrich Hertz, der keinerlei Beziehungen zur Funktechnik hatte, und
[6] Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky (am Rednerpult) bei der Eröffnung des regelmäßigen Fernsehprogramms 1935.
[5] Heinrich-Hertz-Gedenkzimmer im Gebäude der Nordischen Rundfunk AG.
44
der erst recht keinerlei Erfindungen auf dem Gebiete des Rundfunks gemacht hat, sondern der junge itali-enische Student und heutige faschistische Senator Guglielmo Marconi und andere Erfinder schufen am Ende des 19. Jahrhunderts die Unterlagen für Funkte-legraphie.«19 Die nach Hertz benannten Institutionen, wie die »Heinrich-Hertz-Gesellschaft zur Förderung des Funkwesens«, verschwanden um 193520 oder
änderten ihren Namen, wie das »Heinrich-Hertz-Institut für Schwingungsforschung«, das ab 1936 nur noch schlicht »Institut für Schwingungsforschung« hieß. In Karlsruhe war die Büste von Hertz spätes-tens 1939 aus dem Ehrenhof entfernt worden.21 Die Herme im Ehrensaal des Deutschen Museums wurde dagegen zu jener Zeit und auch später nicht bean-standet.22 Bei allen Institutionen in Deutschland, die sich dazu aufgerufen fühlten, des 50. Jahrestages der Entde-ckung der elektromagnetischen Wellen durch Hertz 1938 zu gedenken, herrschte Unsicherheit darüber, ob dies überhaupt opportun sei. Jonathan Zenneck (1871 – 1959) als Leiter des Deutschen Museums, in dem auch die Originalapparate von Hertz ausge-stellt waren, verwarf seine Idee alsbald wieder, das Jubiläum bei der Jahresversammlung am 7. Mai 1938 besonders zu betonen.23 Die Technische Hochschule Karlsruhe, wo sich das Ereignis zugetragen hatte, ging mit Einverständnis der Partei, d.h. formal des »Stellvertreter[s] des Führers« im Januar noch davon aus, eine entsprechende Feier ausrichten zu können.24 Das Reichserziehungsministerium erhob im Mai jedoch Bedenken und sah sich zunächst nicht in der Lage, einem solchen Vorhaben zuzustimmen.25 Die Gesellschaft für technische Physik hatte inzwi-schen geplant, unter dem Titel »Elektrische Wellen«, also ohne Bezug auf den Namen von Hertz, am 10.
August eine Gedenkfeier auszurichten. Neben einer Ausstellung waren zwei bis drei Vorträge lediglich vor geladenen Gästen vorgesehen. Aufgrund von vielleicht nur vorgeschobenen technischen Gründen wie einer zu geringen Vorbereitungszeit und Platzmangel wurde die Veranstaltung im Einverständnis mit dem Reich-
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
[7] Jonathan Zenneck.
[8] Der Vorsitzende der Gesellschaft für technische Physik, Karl Mey.
45
serziehungsministerium im Juli kurzfristig wieder abgesagt.26 Zur gleichen Zeit erhielt die Technische Hochschule Karlsruhe vom Ministerium die Nach-richt, dass ihr nur die Option einer Veranstaltung des Dozentenbundes offen stünde. Sie müsste jedoch außerhalb der Hochschule stattfinden, da sie selbst dafür keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen dürfte.27 Offenbar ist es dann zu keiner Art von Feier in Karlsruhe gekommen. So blieb mit Genehmigung des Ministeriums in Deutschland allein die Jahres-tagung der beiden physikalischen Gesellschaften in Baden-Baden als Forum für eine Erinnerung an dieses Jubiläum übrig.28 Dort sprach nur der Vorsit-zende der Gesellschaft für technische Physik Karl Mey (1879 – 1945) das Thema in seiner Eröffnungs-rede am 12. September 1938 dazu noch eher beiläufig an: »Herr Dr. Mey gedachte ferner der vor 50 Jahren erfolgten Entdeckung der elektrischen Wellen durch Heinrich Hertz in Karlsruhe i.B. und grüßte endlich« - die Sudetenkrise spitzte sich gerade zu - »die deut-schen Volksgenossen in der Tschechoslowakei.«29 Das Ministerium hatte Zenneck inzwischen in seiner Funktion als Leiter der deutschen Delegation der im September 1938 in Venedig und Rom stattfindenden Generalversammlung der »Union Radio Scientifique Internationale« noch angefragt, ob ein Vortrag aus diesem Anlass dort »zweckmäßig« erscheine.30 Für die Präsentation deutscher Wissenschaft im Ausland
galten offensichtlich etwas andere Kriterien. So ging in diesem Fall die Initiative sogar vom Ministerium selbst aus.31 Zenneck war in der Lage, die Aufnahme eines solchen Vortrages in das offizielle Programm kurzfristig zu arrangieren und erhielt vom Ministe-rium den erforderlichen offiziellen Auftrag, ihn auch selbst zu halten.32 Das korrespondierte mit einem persönlichen Anliegen von ihm, hatte die Entde-
ckung von Hertz doch erst die Grundlagen für seine eigene Forschung geschaffen. Der vorbereitete Vortrag, zu dem einige Lichtbilder gehören sollten, kam dann aber überraschend doch nicht zustande. Er wurde zwar nicht formal aus dem Programm genommen, der italienische Länderausschuss wusste ihn jedoch durch eine Art von passivem Widerstand zu verhindern. Zenneck hatte den Eindruck, dass ein solcher Vortrag, vielleicht angesichts der kurz zuvor veröffentlichten Verordnungen Mussolinis gegen die Juden, nicht mehr erwünscht gewesen wäre.33 Während einer Kommissionssitzung nützte er eine passende Gelegenheit, um wenigstens noch in einer längeren Diskussionsbemerkung auf das Jubiläum der Entdeckung hinzuweisen.34
In Karlsruhe hatte Alfons Bühl (1900 – 1945) eine Gruppe von Studenten veranlasst, sich 1937 im Rahmen des 3. Reichsberufswettkampfes in der Sparte »Deutsche Naturerkenntnis« mit dem Werk von Heinrich Hertz auseinanderzusetzen.35 Bühl war NS-Dozentenführer und Schüler von Philipp Lenard (1862 – 1947), dem Protagonisten einer »Deutschen Physik« im völkischen Sinn. Mit der Arbeit »Heinrich Hertz in seinem Wirken und Schaffen unter beson-derer Berücksichtigung seiner rassischen Gebunden-heit« wurde die Studentengruppe 1938 Reichssieger. Während die experimentellen Leistungen von Hertz Bewunderung hervorriefen, stießen seine theoreti-
[9] Philipp Lenard 1942.
46
schen Untersuchungen auf grundsätzliche Ableh-nung, weil die Studenten sie als »artfremd« und »als eine Folge seines jüdischen Blutanteils« betrachteten.36 Heidelberger Kommilitonen hatten dies 1937 in einer Festschrift für Lenard ebenfalls schon in ähnlicher Weise skizziert: »Die bei ihm vorhandene Blutmi-schung der jüdischen und der nordischen Rasse spie-gelt sich wider in einer inneren Zwiespältigkeit, welche auf der einen Seite Eigenschaften eines nordischen Naturforschers, auf der anderen Seite eine uns fremde Denkweise erkennen läßt.«37 Lenard, der noch selbst als Assistent bei Hertz gearbeitet hatte, veränderte in der 1941 erschienenen vierten Auflage seines Buches »Große Naturforscher« gegenüber der dritten Auflage von 1937 die Bewertung von Hertz auch unter Bezug auf jene Reichssiegerarbeit. Da heißt es u.a. in einer zusätzlich eingefügten Fußnote: »Arischer und jüdi-scher Geist äußerten sich bei Hertz oft merkwürdig unvermittelt nebeneinander.«38 Diese von der »Deut-schen Physik« behaupteten Gegensätze konnten im Fall des »halbjüdischen« Hertz in eine einzige Person projiziert werden. Aber die Anhänger jener Richtung um Lenard blieben im Wissenschaftsbetrieb nur eine kleine, sektiererische Gruppe, die sich allein durch ihre Übereinstimmung mit Teilen der nationalsozi-alistischen Ideologie eine gewisse Zeit überproporti-onales Gehör verschaffen konnte. Der Beitrag jener »Deutschen Physik« gehört hier aber in die Reihe von
zweideutigen Wertungen, die für die Behandlung der Person von Hertz im NS-Staat charakteristisch gewesen sind. Dabei setzte sich die Position durch, Hertz in Deutschland möglichst keine öffentliche Würdigung mehr zuteil werden zu lassen.Ein allgemeiner Erlass des Reichsinnenministeriums vom 27. Juli 1938, der die Umbenennung von all jenen Straßen verpflichtend forderte, die Namen von
Juden oder »Mischlingen 1. Grades« trugen, korres-pondierte mit solchen Bestrebungen.39 Es gab viele »Hertzstrassen« in Deutschland, und manche hatten wohl schon zuvor ihren Namen verloren, wie auch aus einem Brief von Max von Laue (1879 – 1960) an die Witwe von Hertz im September 1937 hervor-geht. Demnach überraschte ihn eine solche Straße in Flensburg: »Ich muß mich wundern, dass sie der allgemeinen Umtaufung bisher entgangen ist.«40 Jener Erlass sorgte dann für ein systematischeres Vorgehen. So wurde in Kiel am 6. April 1939 aus der Hertz-straße unter Beibehaltung der Fachrichtung die Röntgenstrasse41, während Bonn 1938 Hertz gegen den Lehrer Beethovens, Christian Gottlob Neefe, getauscht hatte.42 In Berlin-Siemensstadt wiederum erhielt die Hertzstraße am 17. September 1938 den Namen des belgischen Elektroingenieurs Zénobe Théophile Gramme.43
4. Der Streit um die Einheit der FrequenzSolche Maßnahmen waren sicherlich geeignet, all solche Bemühungen zu ermutigen, den Namen von Hertz nunmehr gänzlich aus der Öffentlich-keit zu verbannen. Eine individuelle Aktion vom 19. September 1938 gab Anstoß zu einer Diskus-sion über die Bezeichnung Hertz für die Einheit der Frequenz, die erst nach mehreren Jahren zu einem Abschluss gelangte. Es handelte sich um einen Brief,
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
[10] Max von Laue.
47
den der Berliner Elektroingenieur und »alte Kämpfer« Hermann Gönningen (1894 – 1976) an den im Propa-gandaministerium für Wissenschaft zuständigen Referenten Wilhelm Ziegler (1891 – 1962) sandte.44 Darin wandte er sich gegen den weiteren Gebrauch des Namens von Hertz: »Da Heinrich Hertz ein Jude war, so muß doch unbedingt verhindert werden, dass Deutschland für diesen Juden in der Welt den Spit-zenreiter abgibt.«45 Sodann beklagte sich Gönningen über die bislang noch existierende breite Unter-stützung für diese Bezeichnung, wobei er in einem Reichsministerium »Freunde des Juden« ausmachte und dem Generaldirektor der Firma Lorenz46, in der er selbst beschäftigt war, attestierte, »zum Juden Hertz« zu stehen. Daher sollte nach seiner Ansicht das Propagandaministerium die »Dinge entscheidend in die Hand« nehmen. Diese Initiative löste eine Kette von An- und Nachfragen aus, in der auch die Hierar-chie der dafür zuständigen Stellen sichtbar wird.Das Propagandaministerium leitete die Frage zwecks fachlicher Klärung an das Hauptamt für Technik in München weiter. Für den dort zuständigen Reichs-hauptstellenleiter gab es aufgrund einer klaren anti-semitischen Position, die für seine Behörde gewiss repräsentativ war, keine Zweifel, dass die Bezeichnung Hertz nicht mehr akzeptabel sei. Für die Umsetzung einer solchen Willenserklärung in eine konkrete Handlung benötigte er aber weitere Informationen
und Unterstützung. Dazu konsultierte er am 21. Oktober 1938 die Fachgruppe »Elektrotechnik, Gas und Wasser« im NSBDT (Nationalsozialistischer Bund Deutscher Techniker), der er mitteilte: »Es ist nach meiner Meinung mit unserer grundsätzlichen weltanschaulichen Einstellung unvereinbar, dass Deutschland weiterhin für den Namen des Juden Hertz in der Welt Schrittmacher ist. Ich wäre dankbar, wenn Sie baldmöglichst einmal überprüfen ließen, ob und auf welche schnellste Art und Weise die genannte Bezeichnung aus dem deutschen technischen Sprach-gebrauch verschwinden kann.«47 Der Verantwortliche der Fachgruppe bat daraufhin den Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) um eine Stellungnahme. Da man dort sehr unterschiedliche Ansichten in Fach-kreisen der Physik und Elektrotechnik wahrnahm, bestand die Antwort vom 7. November 1938 in einer ausführlichen Schilderung der historischen Entwick-lung.48 So hatte sich Deutschland schon seit 1930 international darum bemüht, den Namen von Hertz für die Einheit der Frequenz festzulegen. Das führte schließlich auf der Sitzung der Internationalen Elekt-rotechnischen Kommission im Oktober 1933 in Paris auf Antrag von Italien zum Erfolg. Mit den Stimmen von Deutschland, Italien, Frankreich, Holland, Polen und Rumänien und gegen England, Japan und die USA, bei Stimmenthaltung von Schweden, war der Antrag angenommen worden. Seit dem Frühjahr
1933 sei laut VDE in Deutschland aber auch auf den Umstand hingewiesen worden, dass »Heinrich Hertz Halbjude gewesen sei« und es daher nicht angebracht sei, die Frequenzbezeichnung nach ihm weiter zu betreiben. Der VDE wies außerdem darauf hin, dass die maßgebenden Stellen der deutschen Wissenschaft und Technik wie die Physikalisch-Technische Reichs-
[11] Hermann von Helmholtz 1891.
48
anstalt und die technischen Dienststellen der Reichs-post und Reichsbahn durch die weitere Verwendung der Bezeichnung Hertz jedoch Fakten geschaffen hätten. Insoweit würde der aktuelle Entwurf des deutschen Ausschusses für Einheiten und Formel-größen (AEF) vom 1. Oktober 1938 vorsehen, die Frequenzbezeichnung Hertz aufzunehmen. Das dürfe aber nicht als Interesse an der Propagierung des Namens Hertz verstanden werden, sondern wäre lediglich »die Normung eines … bereits weit verbreiteten Gebrauchs.«49 In der nun als unglücklich empfundenen Situation, die es kaum empfehlenswert erscheinen ließ, einen offenen Propagandafeldzug gegen die Frequenzbezeichnung Hertz zu beginnen, andererseits aber auch nicht die allgemeine Einfüh-rung durch die Normung zu unterstützen, machte der VDE einige Vorschläge, deren öffentliche Erörterung jedoch nicht angebracht schien. So könnte dem AEF empfohlen werden, von der Normung der Frequenz-bezeichnung Hertz Abstand zu nehmen. Außerdem sei den staatlichen Behörden nahezulegen, durch internen Erlass auf die erwünschte Vermeidung der Bezeichnung hinzuweisen und die grossen Firmen durch nicht zur Veröffentlichung bestimmte Rund-schreiben ebenfalls entsprechend zu unterrichten. Der Vertreter der Fachgruppe schloss sich dem an, weil hier ein Weg aufgezeigt werde, die Frage zu erledigen, »ohne einen Prestigeverlust der deutschen Wissen-
schaft im Ausland befürchten zu müssen.«50 Während-dessen hatte es wegen der bis dahin ausgebliebenen Antwort schon mehrfach mahnende Nachfragen des Propagandaministeriums gegeben.51 Am 25. Januar 1939 sandte das Hauptamt für Technik die Ausfüh-rungen des VDE aber nicht direkt dorthin, sondern zunächst an die Parteizentrale, d.h. an das »Braune Haus« in München, mit der Bitte um Weiterleitung.52 Auf Grundlage dieser ersten Denkschrift erhielt der VDE dann gemeinsam vom Propagandaministerium und dem Hauptamt für Technik den Auftrag, heraus-zufinden, »ob und auf welche Weise die genannte Bezeichnung aus dem deutschen Sprachgebrauch zum Verschwinden gebracht werden kann.«53
Im VDE glaubte man bald einen besonders eleganten Ausweg gefunden zu haben. Mit Hermann Helm-holtz (1821 – 1894) gab es einen deutschen Physiker, der Hertz in der Bezeichnung der Frequenz adäquat und fachlich begründet ersetzen konnte. Außerdem ließe sich in diesem Fall wegen der identischen Anfangs- und Endbuchstaben des Namens sogar die Abkürzung »Hz« beibehalten. Ehe dieser Vorschlag offiziell zur Vorlage kam, ging es dem VDE darum, die Zustimmung der wichtigsten davon betroffenen Institutionen einzuholen. Das Reichspostministerium begrüßte diese Idee »lebhaft«, und auch das Reichs-verkehrsministerium, der Präsident des Staatlichen
Materialprüfungsamtes sowie die Wirtschaftsgruppe Elektroindustrie waren mit einer solchen Regelung einverstanden, nicht zuletzt weil sie den Vorteil bot, bei der Abkürzung »Hz« bleiben zu können. In dieser daraufhin am 8. November 1939 dem Hauptamt für Technik zugeleiteten Denkschrift des VDE wurden die positiven Reaktionen der vier erwähnten Instanzen aufgeführt. Das Hauptamt für Technik übermittelte sie am 20. November 1939 schließlich der Parteizentrale mit der Bemerkung: »Wir halten diese Lösung für den besten Vorschlag, der bisher auf diesem Gebiet gemacht worden ist.«54 Den VDE wiederum lobte das Hauptamt für Technik mit den Worten: »Wir halten die Lösung, welche gestattet die Abkürzung »Hz« beizubehalten, für sehr glücklich, da gerade dieser Umstand die Einführung der Änderung der Bezeichnung sehr erleichtert.«55 Erst anschließend wurde auch der Berufsverband der Physiker vom VDE dazu befragt. Von siebzehn in einem Rundschreiben angesprochenen Vorstandsmitgliedern der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) antworteten elf.56 So betrachtete Zenneck eine solche Umbenennung einerseits als »eine besonders wirksame Methode, uns im Ausland lächerlich zu machen.« Schließlich wäre das einmal von deutschen Organisationen nicht nur eingeführt, sondern anderen Ländern geradezu aufge-drängt worden. »Es wird niemand verstehen, warum wir das jetzt ohne jeden Anlass abändern wollen;
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
49
an der Abstammung von Hertz hat sich inzwischen nichts geändert.« Andererseits hielt er einen Namen für die Einheit der Frequenz ohnehin für überflüssig. Auch die meisten seiner anderen Kollegen wollten sich auf diese Diskussion eher nicht einlassen. Max von Laue zog sich darauf zurück, dass die DPG bislang nicht involviert gewesen war und sich deshalb auch weiterhin jeder Stellungnahme enthalten sollte. Nur von drei Mitgliedern kam vorbehaltlose Zustim-mung, darunter befand sich der Freiburger Professor Eduard Steinke (1899 – 1963), der dies im völki-schen Sinn zu begründen wusste: »Eine konsequente Durchführung der heutigen Volkstumspolitik lässt es als selbstverständlich erscheinen, auch auf dem Gebiete der Wissenschaft die Leistungen volksfremder Forscher nicht unnötigerweise in den Vordergrund zu schieben.«57
Alles deutete nun eigentlich auf die vorgeschlagene Umbenennung hin. Dennoch gelang es offenbar zunächst nicht, eine verbindliche Regelung zu finden. Das Propagandaministerium wollte deshalb nach über einem Jahr eine Entscheidung des »Stellvertreter[s] des Führers« einholen. Walter Tießler (1903-?), dem Verbindungsmann zwischen beiden Institutionen in der Parteikanzlei (bzw. im Stab des »Stellvertreter[s] des Führers«), fiel die Aufgabe zu, dies angesichts einer ausbleibenden Antwort wiederholt anzumahnen.
In einer Zusammenfassung vom 26. März 1941 ging er irrtümlich davon aus, dass es anlässlich des 50. Jahrestages der Entdeckung elektromagnetischer Wellen die Anordnung gegeben hätte, die Heinrich-Hertz-Feiern durchzuführen und Heinrich Hertz für Deutschland in Anspruch zu nehmen. Dabei bezog er sich auf eine Mitteilung des offensichtlich nicht gut informierten Propagandaministeriums, das dahinter sogar eine Weisung des Führers selbst vermutete.58 Die Intervention des Reichserziehungsministeriums und die dadurch erwirkten Absagen der Feiern waren offenbar unbekannt geblieben. Es brauchte noch mehrere Nachfragen, bis die Antwort am 15. August 1941 endlich vorlag: »…der Reichsleiter den Führer befragt hat. Der Führer hat entschieden, dass die Frequenzbezeichnung Herz [sic] beibehalten werden soll.«59 In dem totalitären Hitler-Staat war dies absolut bindend und die Diskussion damit beendet. Daraufhin beschloss der VDE, den Bereich, in dem die Bezeichnung »Hertz« gelten sollte, sogar noch auf die Starkstromtechnik auszudehnen. Bis dahin war sie allein in der Fernmeldetechnik üblich gewesen. Dies, so teilte der VDE dem Hauptamt für Technik im Dezember 1941 mit, sei »in einer Entscheidung des Führers über die Beibehaltung der Frequenzbe-zeichnung Hertz begründet.«60
Die Bemühungen um die Tilgung des Namens Hertz waren hier nicht zuletzt wegen einer internationalen
Konvention, die einmal dem Ansehen Deutschlands hatte dienen sollen, an ihre Grenze gestoßen.
5. Die Wirkung auf die nächste Generation der Familie Hertz
5.1 Mathilde HertzNachdem der Umgang mit der Erinnerung an Hein-rich Hertz im Nationalsozialismus untersucht worden ist, stellt sich die Frage nach dem Schicksal seiner
[12] Mathilde Hertz.
50
Familie in jener Zeit. Das betrifft in erster Linie seine Witwe und die beiden Töchter, die erst drei bzw. sechs Jahre alt gewesen waren, als ihr Vater so jung verstarb. Sie schlugen ganz unterschiedliche Berufs-wege ein. Johanna, die ältere von beiden, wurde Kinderärztin. Über sie ist sonst wenig bekannt. Mathilde wählte zunächst eine künstlerische Ausbil-dung und war, wie schon erwähnt, an der Gestaltung der Herme ihres Vaters für das Deutsche Museum beteiligt, wo sie selbst zwischen 1918 und 1923 in der Bibliothek arbeitete. Ab 1921 ging sie parallel an der Münchener Universität einem Studium der Zoologie und Paläontologie nach, das sie 1925 mit der Promo-tion abschloss. Ein Forschungsstipendium der Notge-meinschaft ermöglichte ihr zunächst eine Tätigkeit in der Zoologischen Staatssammlung in München, ehe sie 1927 als selbständige Gastwissenschaftlerin an die Abteilung für Vererbungslehre und Biologie der Tiere am Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) in Berlin wech-selte. Im April 1929 erhielt sie schließlich eine feste Stelle am KWI für Biologie. In demselben Jahr habi-litierte sie sich an der Berliner Universität mit einer Abhandlung über »Die Organisation des optischen Feldes bei der Biene« und erhielt im Mai 1930 die Lehrbefugnis.61 Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeam-tentums zwang alle Lehrkräfte der Universität wie auch die Mitarbeiter der KWIs 1933 dem zustän-
digen Ministerium Auskunft über die eigene Abstam-mung zu erteilen. Dabei war die Religionszugehö-rigkeit von Eltern wie Großeltern anzugeben. Ein jüdischer Großelternteil war hinreichend dafür, als sogenannter Nichtarier klassifiziert und entlassen zu werden. Mathilde Hertz fühlte sich nicht betroffen,
weil der väterliche Großvater Gustav Ferdinand Hertz bereits als Kind getauft worden war. So schrieb sie am 19. Juli 1933 noch ergänzend zu ihrem Frage-bogen: »Alle 8 Urgroßelternteile waren evangelisch getauft, bei der vätermütterlichen und der müttervä-terlichen Seite handelt es sich um Pastorenfamilien. Mein Urgroßvater Heinrich D. Hertz gehörte zum Vorstand seiner Hamburger Kirchengemeinde. Mein Großvater Dr. jur. Gustav F. Hertz, als Kind getauft, war als Senator (seit 1866) und Chef der Hamburger Justizbehörde zugleich Kirchenspielherr (Kirchenauf-sichtsbehörde).«62
Max Planck (1858 – 1947) teilte dem Reichsminis-terium des Innern in seiner Eigenschaft als Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft am 21. Juli 1933 daraufhin noch ergänzend mit, dass die Assistentin und Privatdozentin Mathilde Hertz Arierin sei, da alle acht Urgroßeltern evangelisch getauft gewesen seien. Aus Plancks Sicht schien die drohende Entlas-sung damit abgewendet, und er vergaß nicht auf ihren Vater hinzuweisen, »weil eine Entlassung der Tochter des berühmten Physikers im In- und Ausland einen sehr ungünstigen Eindruck hervorgerufen haben würde.«63 Aber aufgrund des Gutachtens eines Sach-verständigen für Rasseforschung stufte das Ministe-rium Mathilde Hertz schließlich doch als »nichtarisch« ein und forderte Planck am 27. Oktober 1933 auf, den Vertrag mit ihr zu kündigen. Ihre Venia Legendi an
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
[13] Max Planck.
51
der Universität hatte sie bereits aufgrund des Berufs-beamtengesetzes verloren. Daraufhin kündigte Planck ihr nun pflichtgemäß, versuchte aber dennoch gleich-zeitig eine Ausnahmeregelung für sie zu erreichen. Zum einen würde das von ihr vertretene Forschungs-gebiet sonst in Deutschland nicht gepflegt, zum
anderen, so argumentierte Planck, »würde es auch im Inlande wie im Auslande dankbar anerkannt werden, wenn die Tochter von Heinrich Hertz, dem allein wir die Entdeckung der drahtlosen Welle verdanken, ihre wissenschaftliche Arbeit fortsetzen könnte.«64 Im Januar 1934 kam es daraufhin tatsächlich zu einer der ganz seltenen Ausnahmeregelungen durch das Ministerium des Innern, das damit die Belassung von Mathilde Hertz auf ihrer Stelle genehmigte.65 Dennoch glaubte sie offenbar nicht mehr an eine berufliche Zukunft in Deutschland. Während eines Aufenthaltes in England im November 1935 sondierte sie dort ihre Arbeitsmöglichkeiten. Dabei profi-tierte sie von der freundschaftlichen Sympathie, die es unter den älteren englischen Physikern für ihren Vater gegeben hatte. Sie zeigten sich schockiert über die »German authorities who make it impossible for a member of the Hertz family to continue her work in Germany.”66 Ernest Rutherford (1871 – 1937) sah in der Aufnahme von Mathilde Hertz auch einen symbolischen Akt, »when we consider the enormous prestige Germany of the old days gained from the discoveries of her father.«67 Im Januar 1936 siedelte Mathilde Hertz nach Cambridge über und holte ein halbes Jahr später sowohl ihre ältere Schwester als auch ihre Mutter nach, die Max von Laue etwas später von ihrer Emigration berichtete: »Wir leben hier sehr still und zurückgezogen, sind aber sehr froh
damit.«68 Allerdings gelang es Mathilde Hertz länger-fristig nicht mehr, ihre Karriere erfolgreich fortzu-setzen. Spätestens seit 1940 war sie ernsthaft krank und zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit offenbar nicht mehr imstande. Auch in politisch-menschlicher Hinsicht scheint sie sich in England nicht adaptiert
[14] Ernest Rutherford gehörte 1933 zu den Unterzeichnern des Gründungsaufrufs einer Organisation (Academic Assistence Council), die Wissenschaftsemigranten bei der Vermittlung von Stellen helfen sollte.
[15] Gustav Hertz.
52
zu haben. Im Unterschied zu anderen Emigranten bemühte sie sich nie um die englische Staatsbürger-schaft und erweckte offenbar den Eindruck, sich trotz ihrer schlechten persönlichen Erfahrungen stärker mit Deutschland als mit ihrem Aufnahmeland zu identi-fizieren.69 In ihren letzten Lebensjahren beteiligte sie sich noch an den Arbeiten zu der zweiten, nunmehr doppelsprachigen Auflage der »Erinnerungen, Briefe und Tagebücher« ihres Vaters.70
5.2 Gustav HertzAls Sohn des ein Jahr nach Heinrich Hertz geborenen Bruders Gustav Theodor war Gustav Hertz (1887 – 1975) ein Cousin von Mathilde.71 Gustav Hertz promovierte 1911 mit einer spektroskopischen Arbeit in Berlin. Nach der Kriegsteilnahme an der Ostfront, von der er schwer verwundet zurückkehrte, wurde er 1917 Privatdozent an der Berliner Universität. Im Jahr 1920 ließ er sich von dieser Funktion beurlauben, um in dem neugegründeten Forschungslaboratorium der Philips Glühlampenfabriken in Holland zu arbeiten. Für das Jahr 1925 erhielt er gemeinsam mit James Franck (1882 – 1964) den Physiknobelpreis. Seine Berufung als Hochschullehrer zurück nach Deutsch-land, zunächst 1926 auf einen Lehrstuhl nach Halle, führten Kollegen wie Zenneck auf »unerwünschte jüdische Kräfte« zurück.72 Solche Unterstellungen scheinen aber ansonsten für die Karriere von Hertz
keine Rolle gespielt zu haben. Im Dezember 1927 erhielt er den Ruf an die Technische Hochschule Berlin, wo er fortan als Ordinarius und Direktor des physikalischen Instituts wirkte.Das schon erwähnte Berufsbeamtengesetz von 1933 betraf Hertz aufgrund seiner Abstammung zwar
prinzipiell in gleicher Weise wie seine Cousine, aber die Ausnahmeregelung für Frontkämpfer bewahrte ihn zunächst vor der Entlassung. Im Jahr 1934 entzog man ihm als »Nichtarier« jedoch die Prüfungsberech-tigung. In dieser Situation setzte sich sogar der natio-nalsozialistische Kollege Johannes Stark (1874 – 1957) engagiert für sein Verbleiben an der Hochschule ein: »Hertz … hat in seinem Äußeren, in seinem Auftreten und in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit nichts Jüdisches. Er gehört zu den wenigen erstklassigen Physikern, die wir haben, ist auch Nobelpreisträger. Er ist zudem der Neffe des großen Physikers Heinrich Hertz, also der Träger dieses berühmten Namens. Es wäre eine Dummheit sondergleichen, diesem Mann deswegen die Prüfungserlaubnis zu entziehen, weil sein Grossvater Jude war.«73 Es gibt Hinweise, dass Hertz die Prüfungsberechtigung möglicherweise doch noch hätte behalten können. Da sich ihm aber inzwischen eine andere, attraktivere Option bot, trat er am 30. Juni 1935 von seiner Professur zurück. Unmittelbar anschließend übernahm er die hoch dotierte Leitung eines eigens für ihn geschaffenen Forschungslaboratoriums bei der Firma Siemens, wo ihm ca. zwanzig wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verfügung standen.74 Mit seiner Fakultät fand er ein Arrangement, das ihm durch die Verleihung einer Honorarprofessur die Möglichkeit beließ, auch weiterhin Studenten zu promovieren.75
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
[16] Johannes Stark
53
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
Cambridge 3.X.37
3 St. Margaret s Road
Hochgeehrter Herr Professor!
Ich möchte doch nicht versäumen, Ihnen einmal Grüße von hier zu senden. Ich hoffe, dass es
Ihnen gut geht. Von uns kann ich nur gutes berichten. Wir leben hier sehr still und zurückgezogen,
sind aber sehr froh damit. Meine Tochter Mathilde ist vorübergehend in der Schweiz, sie arbeitet
in Bern am Zool. Institut. Eine besonders grosse Freude wurde mir kürzlich zu Teil durch einen
Brief aus Amerika, der mir zeigt, dass die physikalische Wissenschaft sich erinnert, dass vor nun
gerade 50 Jahren meinem Mann die entscheidenden Versuche über den Nachweis der elektri-
schen Schwingungen im freien Raum gelungen sind. Ich gedenke natürlich lebhaft jener Zeit und
erinnere genau, wie mein Mann in diesen Oktobertagen nach Hause kam mit strahlend glück-
lichen Augen: Jetzt seien ihm Versuche geglückt, so schön, dass er gerne alle seine bisherigen
Arbeiten dafür hergäbe. Und kurze Zeit danach sah ich in seinem ganz verdunkelten Hörsaal,
im Physik. Laboratorium in Karlsruhe die ersten winzig kleinen Fünkchen, als Beweise der Wellen
in der freien Luft. Ich glaube, er konnte zuerst in dem so beschränkten Raum nur 3-4 Wellenlän-
gen nachweisen. Damals dachte mein Mann nur an einen rein wissenschaftlichen Wert dieser
Versuche. Aber ich freue mich, dass ihm in seinem so kurz bemessenen Leben doch noch so viel
Anerkennung zu Teil wurde, wie er sie nie erwartet hatte.
Ihre sehr ergebene
Elisabeth Hertz
Brief von Elisabeth Hertz an Max von Laue vom 3. Oktober 1937.
55
Etwa in der Mitte des Jahres 1938 wollte das Reich-serziehungsministerium auch alle noch im Dienst befindlichen Hochschullehrer ihres Amtes entheben, die »Mischlinge« oder »jüdisch versippt« bzw. mit »Mischlingen« verheiratet waren. Die weitere Tätig-keit von »Vierteljuden« im öffentlichen Dienst wurde ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet.76 Im Fall von Gustav Hertz konnten jedoch beamten-rechtliche Regelungen nicht greifen, da er nur noch eine Honorarprofessur innehatte. Das Ministerium versuchte daher, Hertz zunächst über den Rektor der Technischen Hochschule zu einer freiwilligen Niederlegung seiner akademischen Funktion zu bewegen. Aber Hertz war keineswegs gewillt, dies zu tun. Dabei distanzierte er sich in gewisser Weise von seinem »nichtarischen« Viertel: »Der Herr Dekan der Fakultät für Allgemeine Wissenschaften hat mir die Frage vorgelegt, ob ich bereit sei, mit Rücksicht auf meine zu einem Viertel nicht arische Abstammung auf meine Honorarprofessur an der Technischen Hochschule Berlin zu verzichten. … bin ich jedoch der Ueberzeugung, dass ich in allen wesentlichen Erbanlagen durch meine arischen Vorfahren bestimmt bin, was nach den Vererbungs-gesetzen durchaus möglich ist. Auch die Art meiner Amtsführung als ordentlicher Professor in den Jahren 1925 bis 1935 dürfte dies beweisen. Nicht zuletzt ist durch meine im Jahr 1935 erfolgte Ernen-
nung zum Honorarprofessor die Tatsache anerkannt worden, dass eine rein formale Behandlung der Abstammungsfrage der Beurteilung meiner Persön-lichkeit nicht gerecht wird. … Ich bitte daher, mir das durch meine Ernennung zum Honorarpro-fessor zum Ausdruck gebrachte Vertrauen auch weiterhin entgegen zu bringen und mir dadurch für die Zukunft die Möglichkeit zu geben, mit vollen Einsatz meiner Kräfte an der Lösung der dringenden Aufgaben der gegenwärtigen Zeit mit zu arbeiten. Heil Hitler!«77 Da auch die Hochschule stark daran interessiert war, Hertz zu halten, lenkte schließlich sogar das Ministerium ein. Hertz wurde als »ein einzig dastehender Sonderfall« betrachtet, den man aufgrund seines großen Verständnisses für die nati-onalsozialistischen Belange im Amt beließ.78 Damit hatte es Hertz im Juli 1939 definitiv erreicht, als besondere Ausnahme in seiner Nische verbleiben zu können. Aber selbst dies reichte nicht aus, um jede Unsicherheit im Umgang mit ihm auszuräumen. Als die Reichsstudentenführung 1942 im Rahmen der wissenschaftlichen Auslandspropaganda eine Studienmappe über »Geometrische Elektronen-optik« vorbereitete, holte das Propagandaministe-rium zuvor noch die Erlaubnis der Parteikanzlei ein, dabei den Namen von Gustav Hertz nennen zu dürfen.79
6. SchlussbetrachtungenDie zahlreichen Ehrungen von Heinrich Hertz und deren überwiegende Tilgung im nationalsozialisti-schen Deutschland wie auch seine Vereinnahmungen für Deutschland, die deutsche Wissenschaft und die jüdischen Deutschen hatten sich teilweise recht weit von seiner Person entfernt. Hertz eignete sich ohne Zweifel dazu, die Bedeutung der deutschen Wissen-schaft des 19. und 20. Jahrhunderts zu repräsentieren. Mit seinem frühen Tod umgab ihn dazu noch eine Tragik, die es der Nachwelt beinahe verpflichtend aufgab, an ihn zu erinnern. Die jüdische Herkunft von Hertz besaß erst für die Nachwelt eine Bedeu-tung, die sie für ihn selbst nie gehabt hatte. Weder gab es soziale Prägungen durch die Familie, noch erfuhr Hertz Benachteiligungen oder Ausgrenzungen in seinem gesellschaftlichen oder beruflichen Umfeld. Erst durch die Annahme »rassischer« Eigenschaften, die für das Judentum charakteristisch wären, exis-tierte scheinbar eine Möglichkeit dieser jüdischen Herkunft eine Qualität zuzuordnen. Zum einen sollte die Person von Hertz einigen jüdischen Autoren dazu dienen, der Behauptung von der Minderwertigkeit des Judentums entgegenzutreten. Zum anderen galt er in der Zeit des Nationalsozialismus als nicht mehr deutsch genug, um weiterhin in prominenter Weise öffentlich gewürdigt zu werden. Angesichts internati-onaler Verflechtungen musste aber selbst in jener Zeit
56
davon Abstand genommen werden, die auf seinen Namen lautende Frequenzbezeichnung zu verändern. Die kleine Minderheit völkisch denkender Physiker um Lenard versuchte, die experimentelle Forschung von Hertz einem positiven arischen, seine theoreti-schen Arbeiten dagegen einem negativen jüdischen Anteil seiner Persönlichkeit zuzuordnen. Tatsächlich zeigten sie damit eher, dass Jüdisches und Deutsches
in der Wissenschaft des 19. und 20. Jahrhundert nicht mehr voneinander zu trennen waren. Heinrich Hertz steht für die Verbindung desjenigen Teils eines ökonomisch aufstrebenden Judentums in Deutschland, der sich von seiner alten Religion abgewandt hatte, mit einer christlichen Mittel- und Oberschicht. Während Hertz mit diesem Hinter-grund noch unbestritten zur deutschen Gesellschaft gehörte, sollte dies für die folgende Generation unter den Bedingungen des Nationalsozialismus nicht mehr gelten. Deren Angehörige waren nun sogenannte Mischlinge, die ebenso wie die Juden bzw. diejenigen, die per Gesetz als solche galten, aus dem wissenschaft-lichen und kulturellen Leben im Deutschen Reich weitgehend ausgeschlossen wurden. Diese Gruppe umfasst also nicht nur Juden und darf für statistische Betrachtungen daher nicht auf den jüdischen Bevöl-kerungsanteil von einem Prozent bezogen werden. Der Neffe von Heinrich Hertz konnte als Ausnahme-fall in einer Nische in Deutschland verbleiben, weil er neben seiner Honorarprofessur eine wichtige Posi-tion in der Industrie bekleidete und außerdem bereit war, dem NS-Staat seine Loyalität zu versichern. Die Witwe und die beiden Töchter emigrierten dagegen nach England. Zum 100. Geburtstag von Heinrich Hertz im Jahr 1957 fanden in Deutschland zahlreiche Veranstal-tungen zu seinen Ehren statt. Die Post brachte eine
Sonderbriefmarke heraus, und der Minister für Post- und Fernmeldewesen telegrafierte an die Töchter: »Nach einer eindrucksvollen Feier in der Technischen Hochschule in Karlsruhe ist es mir ein Herzensbe-dürfnis, Ihnen mitzuteilen, daß wir Ihres großen Vaters an seinem 100. Geburtstag in Verehrung und Dankbarkeit gedacht haben.«80 In der Zeitschrift der jüdischen Emigranten in England erschien ein Artikel des emigrierten Physikers Herbert Fröhlich (1905 – 1991) zu diesem Anlass. Die von der Redaktion abge-fasste Einleitung erwähnte die beiden in Cambridge lebenden Töchter.81 Deren Emigration hatte im Verständnis von Rutherford symbolische Bedeutung gehabt. So erinnerte auch ihr Exil weiter daran, dass in der Heimat von Hertz ein Stück Wissenschafts-kultur verloren gegangen war.
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolf f
[17] Heinrich-Hertz-Sondermarke, herausgegeben von der Bundespost zum 100. Geburtstag des Physikers.
57
61
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
EinleitungDie Apparaturen, mit denen Heinrich Hertz in Karlsruhe zwischen 1886 und 1888 seine berühmten Versuche zum Nachweis elektromagnetischer Wellen unternahm, stehen im nationalen Schatzhaus für Wissenschafts- und Technikgeschichte, dem Deut-schen Museum in München. Dort, in Vitrinen geschützt und doch sichtbar, verströmen sie die Aura des Einmaligen und gehören zweifellos zur Klasse der »Meisterwerke« in der Sammlung auf der Isarinsel.
Während die originalen Apparate in München sind, gibt es in Bonn jedoch »originale Kopien« der berühmten Parabolspiegel, mit denen Hertz die licht-ähnlichen Eigenschaften der elektromagnetischen Strahlen nachgewiesen hat. Heinrich Hertz hat sie im Laufe seiner – wenn auch kurzen – Zeit als Direktor des physikalischen Instituts der Universität Bonn nach dem Vorbild der in Karlsruhe verbliebenen
Stücke hergestellt. Zudem existieren noch weitere Apparaturen und Objekte aus Hertz Bonner Zeit. Im Folgenden sollen die Voraussetzungen und Umstände für die Entstehung dieses bis heute im Institut gehü-teten materiellen Vermächtnisses nachgezeichnet werden.
I. Hertz´ neue Wirkungsstätte – Das Physikali-sche Institut der Universität Bonn»3. April 1889. Nach Bonn.«1 So lakonisch doku-mentiert Hertz seinen Wechsel von Karlsruhe auf den Lehrstuhl für Experimentalphysik der Univer-
sität Bonn in seinem Tagebuch. Das Institut, das er von nun an leiten sollte, befand sich im Südwest-flügel des Universitätshauptgebäudes, dem ehema-ligen Kurfürstlichen Schloss. Dieser Flügel des Schlosses, der an der Ecke Hofgarten und Kaiser-platz gelegen ist, diente seit seiner Errichtung 1715 als »Buen-Retiro«, also Ruhe – und Zufluchtsort der Kurfürsten. Vor allem Joseph Clemens (1671 – 1723) und Clemens August (1700 – 1761) richteten sich im Obergeschoss ihre Privatgemächer ein.2 Nach der Errichtung der preußischen Rheinprovinz, in Folge der Beschlüsse des Wiener Kongresses 1815, wurde
[1] Die originalen Apparaturen von Heinrich Hertz in der Dauerausstellung des Deutschen Museums.
[2] Der »Buen-Retiro«-Flügel des ehemaligen Kurfürstlichen Schlosses und jetzigen Universitätshauptgebäudes
62
Bonn 1818 Sitz der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Das ehemals kurfürstliche Schloss wurde zum Hauptgebäude der neuen Hochschule. Die kurfürstliche Zufluchtsstätte im »Buen-Retiro«-Flügel wurde profaniert und war bis 1885 noch Sitz der medizinischen Kliniken. Nach ihrem Auszug bot man Rudolf Clausius (1822 – 1888), dem Vorgänger von Heinrich Hertz in der Institutsleitung, die zahl-reichen freigewordenen Räume an. Die Physik musste sich bis dahin mit zwei Räumen und einem Hörsaal im Mitteltrakt des Schlosses bescheiden. Für den
eher theoretisch orientierten Clausius mag das auch genügt haben. Die nun für das Physikalische Institut recht üppig zur Verfügung stehenden Räumlich-keiten kamen ihm aber dennoch zupass. Da Clausius seit seiner Teilnahme als Führer eines studentischen Sanitätscorps am Deutsch-Französischen Krieg in der Schlacht bei Gravelotte am 18. August 1870 am Knie verwundet worden war,3 war er schlecht zu Fuß und nutzte die Gelegenheit um seinen Wohnsitz direkt ins Institut zu verlegen. Geschmackssicher wählte Clau-
sius die ehemaligen Zimmer des Kurfürsten Clemens August (1700 – 1761) als eigenes Domizil. Von dort hatte er einen schönen Ausblick auf das Poppelsdorfer Schloss und den Hofgarten. Ein weiterer Vorzug für ihn, wenn auch nicht für sein Institut, war ein begeh-barer Garten im extra dazu aufgeschütteten Innenhof des Schlossflügels. Ursprünglich gedacht, um dem Kurfürsten den direkten Gang von seinen Gemächern in einen privaten Garten zu ermöglichen, erwies sich dieses gartenbauliche Kleinod als schwere Hypothek
[4] Das Eckzimmer im Obergeschoss diente Heinrich Hertz als Büro.
[3] Rudolf Clausius.
63
für spätere Nutzer. In Ermangelung einer Drainage sogen sich die inneren Mauern des Erdgeschosses zunehmend mit Wasser voll. Dessen ungemütlicher Charakter wurde noch durch die dicken Mauern des einst als Bastion angelegten Schlossflügels verstärkt.4
Vor diesem Hintergrund ist auch die schon im Beitrag von Michael Eckert erwähnte Passage aus Hertz Tagebuch vom 5. April 1889 zu lesen: »Nachdem ich ein warmes Zimmer habe, gefällt es mir recht gut im Institut, nur so entsetzlich leer und
einsam ist es in diesen Räumen; wenn ich hier sechs Praktikanten denke, wo fünfzig bequem arbeiten könnten, wird mir angst, und einstweilen irre ich allein nicht ohne Beklemmung in denselben herum. Und alle die Keller und Gänge, wo das Wasser von der Decke tropft und man Quellen rauschen hört – hu– hu– hu.«5 Das warme Zimmer, das Hertz hier erwähnt, war einst das kurfürstliche Schlafgemach. Schon während eines Ortstermins im Zuge der Berufungsverhandlungen hatte Hertz noch Ende Dezember 1888 die Raumsituation im Physikalischen Institut geprüft und gemeinsam mit der Universi-tätsleitung und dem maßgeblichen Referenten im preußischen Kultusministerium Friedrich Althoff6 erörtert. Hertz beschrieb die Dienstwohnung seinen Eltern als »eine lange Reihe von Zimmern von fürstli-chen Dimensionen«. Für das eigentliche Physikalische Institut blieb daher nur noch vergleichsweise wenig Platz übrig. Da keine Mittel für einen Neubau bereit-standen, schlug die Fakultät Hertz vor, die Dienstwoh-nung für den Institutsbetrieb zu nutzen. Zugleich legte sie ihm nahe, sich andernorts einzuquartieren. Entschei-dungshilfe gab es sowohl von einem Mediziner, der die
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[5] Grundriss des Universitätshauptgebäudes etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Im »Buen-Retiro«-Flügel ist noch die Universitätsklinik untergebracht.
[6] Friedrich Althoff.
64
Besonderheiten des Gebäudes ja noch bestens aus den Kliniktagen kannte und die Wohnung »überhaupt für ungesund«7 hielt, als auch von Althoff, der Hertz einen Wohngeldzuschuss bewilligte8. Hertz kaufte daraufhin das ehemalige Wohnhaus seines Vorgängers Clausius in der Quantiusstraße. »Daß das Haus von einem in meiner Wissenschaft hochberühmten Mann bewohnt wurde, ist natürlich noch ein weiterer Reiz für mich und alle Physiker, welche mich etwa besu-chen«, gestand er seinen Eltern. Zwar lag das Haus auch schon damals genau an der Bahnlinie, doch der Verkehr hielt sich noch in Grenzen, und die Familie Hertz fühlte sich nach eigenen Aussagen recht wohl darin. Weniger kommod blieb das feuchte und dunkle Institut. Doch auch eine ungeschminkte Zustandsbe-schreibung, die Hertz gemeinsam mit dem Kurator der Universität und deren Bauinspekteur an Althoff abschickte, brachte keine substantiellen Verbesse-rungen. Trotz des »wegen Feuchtigkeit und mangel-hafter Beleuchtung«9 als »völlig unbrauchbar«10 einge-schätzten Erdgeschosses und erheblicher Nässe auch in manchen der oberen Räume, blieb es bei einer eher kosmetischen Renovierung. Hertz richtete sich nun darin ein. Ihm standen auf den beiden Etagen etwa 20, zum Teil recht große Räume zur Verfügung. Dazu kamen noch ein großer und ein kleiner Hörsaal. Die Laboratorien wurden in das besonders ungemüt-liche und düstere Erdgeschoss verlegt, wo heute die
[7] Hertz begutachtet das feuchte Untergeschoss. Wie er später berichtete, brauchte man nach starken Regenfällen beim Experimentieren noch tagelang einen Regenschirm.
65
Skandinavisten residieren. In den helleren und etwas trockeneren Räumen der einstigen Clausius schen Dienstwohnung richtete Hertz sein Arbeitszimmer und die Bibliothek ein. Heute befindet sich dort das Kunsthistorische Institut.
II. Die apparative AusstattungDie Ausstattung des Instituts hielt der kritischen Überprüfung durch den neuen Direktor nicht stand. »An Apparaten fehlt viel.«11 Das verwunderte nicht weiter, denn Clausius war an experimenteller Arbeit nur wenig interessiert. Hertz verschaffte sich zunächst mühsam einen Überblick. »Im Laboratorium mache ich mir viel Arbeit mit Neuordnungen der Sammlung, und ich will auch ein ganz neues Inventar aufstellen. Ob s mir jemand dankt, ist wohl fraglich, aber einmal muß doch wenigstens alle zwanzig Jahre Ordnung gemacht werden, und da ich lange bleiben möchte, tue ich s lieber zu Anfang. Hoffentlich hält der Eifer, bis alles in Ordnung ist.«12 Das Resultat seiner Bemü-hungen, ein von Hertz ab November 1889 hand-schriftlich verfasstes Inventar aller vorhandenen Inst-rumente, wird noch heute im Physikalischen Institut der Universität Bonn in Ehren gehalten. Da Hertz viele Apparate in Bonn vermisste, mit denen er in seinem gut sortierten Karlsruher Laboratorium gearbeitet hatte, begann er schon recht bald mit der Ergänzung des Bestandes. Eine überaus faszinierende
[8] Inventar das Physikalischen Instituts der Universität Bonn. Heinrich Hertz hat es im November 1889 eigenhändig angelegt.
[9] Vorwort zum Inventar von 1889. Die Abschnitte 1 – 3 hat Heinrich Hertz selbst verfasst.
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis
66
Dokumentation dieser Aktivitäten findet sich im sogenannten »Copirbuch«, das er im August 1889 anlegte. Darin ist die gesamte Korrespondenz mit den jeweiligen Geschäftspartnern bis 1893 enthalten. Hertz drückte bei dieser damals weit verbreiteten Methode der Duplikation seine mit Tinte geschrie-benen und noch feuchten Briefe auf dünnes Trans-parentpapier. Bei der Lektüre lernt man den jungen Institutsdirektor als freundlichen und höflichen Zeitgenossen kennen, der es aber auch nicht an der notwendigen Deutlichkeit fehlen ließ, wenn er mit seinen Geschäftspartnern einmal unzufrieden war. Einer der ersten, dem Hertz aus Bonn schrieb war sein ehemaliger Institutsmechaniker in Karlsruhe, Julius Amman. »Erlaubt es Ihre Zeit, mir für das hiesige Institut eine genaue Copie der in Karlsruhe vorhan-denen sog. Knochenhauerschen Spiralen zu machen? Es sind das die beiden sich gegenüberstehenden Holz-scheiben, mit spiralig eingelassenen Drähten, (...).«13 Derartige Spiralen inspirierten Hertz 1886 zu den Versuchen, die ihn in der Folge auf die Spur der damals unbekannten elektromagnetischen Wellen führten. Früheren Physikergenerationen dienten diese Spiralen, die jeweils durch eine Funkenstrecke unter-brochen waren, zur Demonstration der Induktion. Als Induktion bezeichnet man das Auftreten einer elektrischen Spannung bei einer zeitlichen Änderung eines Magnetfeldes. Als Hertz in Karlsruhe bei den
Vorlesungsvorbereitungen mit diesen Spiralen expe-rimentierte, machte er eine ungewöhnliche Beob-achtung. »Es hat mich überrascht, daß es nicht nötig war, große Batterien durch eine Spirale zu entladen, um in der anderen Funken zu erhalten, daß vielmehr hierzu auch kleine Leydener Flaschen genügten, ja der
Schlag eines kleinen Induktionsapparates, sobald nur die Entladung eine Funkenstrecke zu überspringen hatte.«14 Nach Erhalt der beiden gewünschten Spiralen einige Wochen später,15 kommt es aber nicht zu einem systematischen Aufbau einer Apparatesammlung für
[10] Aus dem »Copirbuch«: Brief von Heinrich Hertz an Julius Amman vom 28. Oktober 1889.
67
Experimente mit elektromagnetischen Wellen und speziell zur weiteren Bestätigung der Ergebnisse seiner Karlsruher Hörsaal-Experimente. Das hätte eigent-lich nahe gelegen, denn in Karlsruhe erschienen ihm weitere Wiederholungen nutzlos, weil »ich ganz sicher war, unter gleichen Umständen mit gleichen Appa-raten, das Gleiche wieder zu finden«.16 In Bonn hätte er ja nun zumindest neue Räume und damit neue Bedingungen gehabt, doch noch im Mai 1890 war das verblieben. »Denn ich habe mir die nötigen Appa-rate noch gar nicht machen lassen, auch fehlt mir eine tüchtige Hilfe, wie ich sie in Karlsruhe an meinem Mechaniker hatte. Sie wundern sich vielleicht, aber die viele andere Arbeit, die ich vorfand, die Notwendig-keit, meine Augen zu schonen, und auch ein gewisser Überdruß an den elektromagnetischen Wellen, mit denen ich mich zwei Jahre ausschließlich beschäftigt hatte und die mich nun nicht wieder loslassen wollen, macht doch die Sache erklärlich.«17 Die Lage, die Hertz hier seinem Schweizer Kollegen Édouard Sarasin schilderte, änderte sich erst im Herbst 1890 mit der Ankunft des Norwegers Vilhelm Bjer-knes im Bonner Institut. Bjerknes wollte das Winter-semester nutzen, um bei Hertz das Experimentieren mit elektromagnetischen Wellen zu erlernen. Hertz wurde somit durch die Betreuung seines Gastes trotz des zuvor geäußerten Überdrusses nolens volens wieder mit der Thematik konfrontiert. Bjerknes
baute, nach Vorschlag von Hertz, einen neuen Dipol-sender mit zwei quadratischen Zinkblechplatten (40 x 40 cm2) an den Enden, den er in seinen Veröffent-lichungen auch ausführlich beschrieb.18 Es ist nicht abwegig zu vermuten, dass Hertz in dieser Zeit wieder Geschmack an der Beschäftigung mit »seinen Wellen« fand. Ende Januar beschreibt er in seinem Tagebuch den Bau der beiden Parabolspiegel und eines Polari-sationsgitters, die er schon Anfang Februar erstmals
in der Vorlesung demonstrierte.19 Im Unterschied zur ersten Karlsruher Ausführung, die zwei Meter hoch war, bei einer Öffnung von 120 cm, sind die Bonner Spiegel nur einen Meter hoch. Ansonsten ist der Aufbau identisch mit dem Original. Das dünne Zinkblech wurde auf einem gewölbten Holzrahmen zur parabolischen Form gebogen. Um die Spiegel besser handhaben zu können, wurden sie auf ein fahr-bares Holzgestell gesetzt.
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[11] Die Bonner Parabolspiegel. Links ist der Sende-Spiegel, rechts der Empfänger-Spiegel abgebildet.
68
In der Sammlung des Physikalischen Instituts befindet sich noch ein Dipolsender, der aus zwei Zinkblechplatten (31 x 31 cm2) besteht und mit zwei Anschlüssen für eine Doppelleitung versehen ist. Mit einer ähnlichen Anordnung hatte Hertz in Karlsruhe die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen entlang von Drähten bestimmt. Ihm unterlief dabei allerdings bei der Berechnung der Frequenz ein Fehler. Messen konnte man diese hohen Frequenzen damals noch nicht. Statt des Wertes von 300.000 km/sek., also der Lichtgeschwindigkeit, erhielt er einen Wert, der um den Faktor 1,4 kleiner war. Doch dieses Ergebnis war ihm selbst nicht ganz geheuer, wie ein Brief an seinen verehrten Lehrer Helmholtz zeigt: »Die Schwin-gungsdauer aus Potential und Capacität berechnet,
war 1,5 Hundertmillionstel Secunde, darnach wäre die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 200.000 Kilo-meter/Secunde. Vielleicht rechnet man aber besser die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den Drähten gleich Lichtgeschwindigkeit (...).«20
Nach der Veröffentlichung haben mehrere seiner Kollegen versucht, den Fehler zu finden. Schließlich gelang es dem französischen Mathematiker Henri Poincaré (1854 – 1912). Hertz Versuche hatten aber trotz der anfänglich nicht korrekt berechneten Ausbreitungsgeschwindigkeit ihren wissenschaftlichen Wert, denn er hatte immerhin herausgefunden, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit endlich war.Zu den Schmuckstücken der Sammlung des Physikali-schen Instituts gehören auch zwei kreisförmige Detek-toren mit Funkenstrecken zum Nachweis der magneti-
schen Komponente der elektromagnetischen Wellen. Sie haben einen Durchmesser von 65 und 86 cm. Obwohl noch aus Clausius Zeiten ein recht großer Rühmkorff-Funkeninduktor21 vorhanden war, entschied sich Hertz zu einer Neuanschaffung. Schon im Oktober 1889 hatte er die Firma Keiser & Schmidt in Berlin gebeten, ihm »an die Adresse und die Rechnung des physikalischen Instituts der Universität« einen »Funkeninduktor No. 11, Funkenlänge 8 cm, liefern zu wollen«.22 Mit einem ähnli-chen Fabrikat dieses Herstellers, dessen Funkenlänge 4,5 cm betrug, hatte er 1888 in Karlsruhe die Versuche mit den dortigen Parabolspiegeln durchgeführt.23 Der nach Bonn gelieferte Induktor existiert ebenfalls noch heute.
III. Der Einsatz im VorlesungsbetriebGemeinsam mit den Parabolspiegeln, den Detektoren und dem Polarisationsgitter bilden die Induktoren
[12] Dipolsender zur Untersuchung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen entlang von Drähten.
[13], [14] Keisförmige Detektoren mit Funkenstrecken zum Nachweis der magnetischen Komponente der elektromagnetischen Wellen.[15] Detailaufnahme der verstellbaren Funkenstrecke.
69
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[16] Funkeninduktor von Keiser & Schmidt.
70
ein Ensemble, das noch heute regelmäßige Auftritte vor großem Publikum erlebt. Denn die »originalen Kopien« verschwanden im Laufe der Zeit nicht im Abstellkeller oder wanderten gar in den Müll. Sie sind bis heute fester Bestandteil der Einführungsvor-lesung in die Experimentalphysik. Ihren historischen Wert hatte 1957 anlässlich des 100. Geburtstages von Heinrich Hertz schon der damalige Institutsdirektor und spätere Physiknobelpreisträger Wolfgang Paul (1913 – 1993) herausgestellt: »Als Hertz den Physi-kalischen Lehrstuhl unserer Universität übernahm, blieben bei seinem Umzug die Instrumente in Karls-ruhe und kamen später in das Deutsche Museum nach München. Was lag aber näher, als daß Hertz sich hier in Bonn neue Geräte für eigene Untersuchungen und für die Vorlesungen aufbaute? (...) Unsere Inventar-Bücher zeigen, daß neben großen Funken-Induk-torien Holz- und Blech-Tafeln gekauft wurden, aus denen die großen Parabolspiegel (...) gebaut wurden (...). So glaube ich, daß wir, obwohl die Apparate nicht die alleroriginalsten sind, doch sagen können, es sind Originalapparate von Heinrich Hertz, denn er hat sie bei seiner handwerklichen Geschicklichkeit teils selbst gebaut und damit gearbeitet.«24 Seitdem haben Generationen von Bonner Physikstu-dierenden das Privileg genossen, die Eigenschaften der elektromagnetischen Wellen anhand originaler Appa-raturen alljährlich in der Vorlesung demonstriert zu
bekommen. Auch wenn eine Beschreibung der Funk-tion nicht die Faszination einer realen Demonstration ersetzen kann, sollen die wesentlichen Bestandteile und ihr Zusammenwirken hier vorgestellt werden.
Zwei Komponenten, die schon bei Hertz im Dauerbe-trieb Probleme bereiteten, sind bei der heute im Vorle-sungsbetrieb verwendeten Anordnung etwas modifi-ziert worden: Die Stromversorgung des Induktors und der Funkennachweis am Empfänger-Spiegel. Der Induktor hat einen Kern aus Eisendrähten, der von einer Primärspule mit wenigen Windungen aus dickerem Kupferdraht und einer Sekundärspule mit sehr vielen Windungen aus dünnem Draht umgeben ist. Als Spannungsquelle für den Induktor nutzte Hertz Bleiakkumulatoren, wie sie auch heute noch in unseren Autos zum Einsatz kommen. Sie können bei niedrigen Spannungen große Ströme liefern. Wie bei jedem Transformator erzeugt ein zeitlich veränderter Strom in der Primärspule ein zeitlich veränderliches Magnetfeld in der Sekundärspule, das dort eine Span-nung induziert. Um hohe Spannungen zu erzeugen, muss neben einem hohen Windungsverhältnis der Primärstrom groß sein und periodisch unterbrochen werden. Bei den damals üblichen Induktoren wurde dazu ein mechanischer Magnetschalter benutzt (ein so genannter »Wagnerscher Hammer«). Die Unterbre-chung der hohen Ströme führt schnell zu Verbren- [17] Funkenentladung am Dipol des Sende-Spiegels.
71
nungen an den Kontakten. Eine wesentliche Verbesse-rung konnte mit einem rotierenden Quecksilberstrahl als Stromschalter erreicht werden. Ein solches Gerät, das Bjerknes 1891 bei seinen Experimenten benutzt hat25, befindet sich noch im Bonner Institut. Im heutigen Betrieb wird ein einfaches elektronisches Gerät als Stromquelle benutzt, das den Induktor mit Rechteckimpulsen betreibt. Stromstärke und die Frequenz lassen sich so leicht verändern. Die so erzeugten Hochspannungspulse werden nun über Drähte an einen Dipol geleitet. Dort im Zentrum des Sende-Spiegels führen sie zu Funkenüberschlägen. Um zunächst einmal überhaupt den Nachweis zu führen, dass die Wellen auch beim Empfänger-Spiegel ankommen, wird dieser in einigen Metern Entfer-nung gegenüber dem Sende-Spiegel positioniert. Die emittierten elektromagnetischen Wellen werden nun im Brennpunkt des Empfänger-Spiegels gebün-delt, wo sie auf einen weiteren Dipol als Empfänger treffen und mittels zweier Drähte auf die Rück-seite des Empfänger-Spiegels geleitet werden. Dort befindet sich eine überaus sensible Funkenstrecke als Nachweisinstrument. Eine weitere, geringfügige Veränderung wurde an der Funkenstrecke an dem Empfängerspiegel vorgenommen. Im ursprünglichen Aufbau von Heinrich Hertz stand eine feine Kupfer-spitze in geringem Abstand über einer Messingkugel. »Es ist absichtlich die Spitze aus weicherem Metall als
die Kugel gewählt: ohne diese Vorsicht drückt sich leicht die Spitze in die Kugel ein und die winzigen Fünkchen entziehen sich in dem entstehenden Grüb-chen der Betrachtung.«26 Was Hertz hier in seiner Versuchsbeschreibung schon als mögliches Problem andeutet, hat sich bei den Bonner Apparaten als Hindernis für einen reibungslosen Demonstrations-betrieb erwiesen. Nach einigen Versuchen wurde statt der filigranen Kupferspitze eine robustere, keilartige Schneide verwendet, die sich seitdem bestens in der Praxis bewährt. Wie die Abbildung zeigt, entstehen auf der gesamten Fläche Funken, was den Demonst-rationswert natürlich deutlich erhöht.Als Nachweis der elektromagnetischen Wellen benutzte Hertz ausschließlich den Funkenüberschlag an den Detektoren: einen linearen Dipol für den elektrischen und einen kreisförmigen für den magne-tischen Anteil der Wellen. Die Helligkeit des Funkens war für ihn der Maßstab für deren Amplitude. Zu Demonstrationszwecken vor einem großen Publikum sind diese kleinen Funken aber schlecht geeignet. Empfindliche elektronische Hilfsmittel gab es damals noch nicht. Heute kann man mit einer handelsübli-chen Hochfrequenzdiode die Empfangsfunkenstrecke überbrücken und den gleichgerichteten Strom einem Spiegelgalvanometer zuführen. Ein Laserstrahl wird am Spiegel reflektiert und erzeugt an der Hörsaal-wand einen hellen Lichtpunkt. Selbst kleine Ampli-
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[18] Funkenstrecke als Nachweisinstrument am Empfänger-Spiegel.
72
tudenänderungen sind für das Publikum so deutlich zu erkennen. Trotz dieser Veränderungen ist jeder Betrieb mit den Originalgeräten ein neues Abenteuer und glückt nicht immer auf Anhieb. Die Oberfläche des kugelförmigen Sendedipols spielt eine große Rolle, sowie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Hörsaal. Manchmal hilft das Putzen der Dipole mit einem Taschentuch.
Aber warum sollte es den Nachfolgern mit den origi-nalen Kopien auch besser ergehen als Heinrich Hertz selbst: »Denn die Apparate, mit welchen ich arbeite, sind gar nicht von einem geschickten Mechaniker nach guten Zeichnungen in eleganter Weise ausge-führt, sondern teils von mir selbst, teils vom Mecha-niker des physikalischen Kabinetts in Karlsruhe in roher und provisorischer Weise aus Holzstücken, Drähten, Siegellack zusammengeklebt und dann beständig abgeändert worden.«27 Hertz wollte 1888 mit dieser Versuchsanordnung den Nachweis führen, dass die elektromagnetischen Wellen die gleichen Eigenschaften wie Lichtwellen haben. Daher ersann er für die elektromagnetischen Wellen Nachweismethoden der schon in der Optik bekannten Phänomene der Polarisation, Reflexion und Brechung. Über die Polarisation schreibt Hertz: »Dass der Strahl durch Transversalschwingungen gebildet wird und gradlinig polarisiert im Sinne der Optik ist, daran haben wir freilich schon nach der Art, in welcher wir ihn erzeugen, keinen Zweifel. Wir können die Tatsache aber auch durch den Versuch erweisen.«28 Bei seinen Versuchen stand der Sendedipol senkrecht. Folglich wird der elektrische Anteil der Welle auch in einer senkrechten Ebene emittiert. Alle anderen Richtungen kommen nicht vor! Die Welle ist linear polarisiert. Um dies experimentell nachzuweisen, hat Hertz den Empfängerspiegel um 900 gedreht, so dass
[19] Funkenüberschlag an der keilartigen Schneide des Empfänger-Spiegels.
[20] Drahtgitter zum Nachweis der Polarisation der elektromagnetischen Wellen in waagerechter Position...
73
der Empfängerdipol waagerecht stand. Die Funken verschwanden. Hertz stellte daraufhin fest: »Die beiden Spiegel verhalten sich wie Polarisator und Analysator einer Polarisationsapparatur«.29 Er hat dann noch eine weitere Methode zum Nach-weis der Polarisation erdacht. Dabei benutzte er ein Drahtgitter. Solch ein Gitter hat Hertz auch in Bonn gebaut. Es besteht aus Kupferdrähten von etwa einem Millimeter Durchmesser, die im Abstand von zwei Zentimetern parallel auf einen achteckigen Holzrahmen gespannt sind. Zum Zwecke einer einfacheren Handhabung wurde das Gitter auf einen Ständer montiert und ist in der Mittelachse drehbar. Für den Einsatz dieses Polari-sationsgitters werden die beiden Parabolspiegel mit der geöffneten Seite einander gegenüber gestellt. Der Abstand kann einige Meter betragen. Das Gitter wird nun ungefähr in der Mitte zwischen beiden Spiegeln positioniert.Da der Sendedipol senkrecht steht, werden auch die elektrischen Wellen in einer senkrechten Ebene emittiert. Dreht man das Gitter so, dass die Drähte ebenfalls senkrecht stehen, tragen sie auf ihrer ganzen Länge zur Reflexion bei. Das Gitter wirkt fast wie eine metallische Wand. Die Welle erreicht den Empfänger nicht mehr. Die Funken verschwinden. Dreht man das Gitter um 900, stehen die elektrischen Feldlinien jetzt senkrecht auf den
Drähten, und die nur einen Millimeter dünnen Drähte tragen nur unwesentlich zur Reflexion bei. Die Welle kann fast ungehindert den Empfänger erreichen und erzeugt dort Funken.
Mit den Parabolspiegeln konnte Hertz auch über-prüfen, ob die elektromagnetischen Wellen sich ebenso wie das Licht spiegeln und reflektieren lassen. Dazu werden die beiden Spiegel mit etwas Abstand nebeneinander vor einer metallenen Wand aufgestellt. Die Öffnung der Spiegel zeigt in Richtung der Wand, und beide Spiegel sind einander mit einem Winkel von 45 Grad zugeneigt. Wenn nun der Funkenin-duktor eingeschaltet wird und es die ersten Funken-überschläge am Sende-Dipol gibt, lassen sich auch an der Rückseite des Empfängerspiegels kleine Funken erkennen. Wie in der Optik gilt somit auch für die elektromagnetischen Wellen: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel!
Das Prisma dient in der Optik allgemein als Spek-tralapparatur zur Auffä-cherung des Lichts in seine Farbkomponenten. Die Lichtgeschwindigkeit in Glas ist abhängig von der Wellenlänge (Farbe)
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[21] ...und in senkrechter Position.
[22] Grafische Darstellung des Reflexionsexperiments.
74
des Lichts. Bei der keilförmigen Form des Prismas führt dies zu verschiedenen Ablenkungswinkeln. Das Prisma kann auch zur Ablenkung benutzt werden. Das hat Hertz bei seinem Versuch ausgenutzt. Der Ablenkungswinkel ist abhängig von der Geometrie und der Dielektrizitätskonstante. Hertz ließ in Karls-ruhe dazu ein großes Prisma anfertigen. Es bestand allerdings nicht aus Glas, sondern aus »Hartpech«, einer teerartigen Substanz, und wog bei einer Höhe von 150 cm etwa 600 kg. Im Bonner Vorlesungs-betrieb kommt stattdessen ein Paraffinprisma zum Einsatz. Der experimentelle Aufbau ist denkbar einfach. Der Empfängerspiegel wird so aufgestellt, dass der »Strahl« des Primärspiegels den Empfänger gerade verfehlt. Wird das Prisma in geeigneter Form dazwischen positioniert, werden die Wellen in den Empfänger gelenkt.
Diese drei grundlegenden Demonstrationen bestä-tigen auch heute noch die Schlussfolgerung, die Hertz am Ende seiner Versuchsreihe in Karlsruhe niederschrieb: »Wir haben die von uns untersuchten Gebilde als Strahlen elektrischer Kraft einge-
führt. Nachträglich dürfen wir dieselben vielleicht auch als Lichtstrahlen von sehr großer Wellenlänge bezeichnen. Mir wenigstens erscheinen die beschrie-benen Versuche in hohem Grad geeignet, Zweifel an der Identität von Licht, strahlender Wärme und elek-trodynamischer Wellenbewegung zu beseitigen.«30
IV. Hertz´ Bonner Vermächtnis jenseits der elekt-romagnetischen WellenEin neues InstitutSicherlich nicht ausschließlich, aber wohl doch zu einem gewissen Grade gehört das heutige Physi-kalische Institut in der Nußallee auch zum Bonner Vermächtnis von Heinrich Hertz. Zwar steht der Neubau auch mit dem Wunsch der Physiker nach einem erschütterungsfreien Arbeitsplatz in Zusam-menhang – denn schließlich nahm der damals nur knapp hundert Meter am alten Institut vorbeirol-lende Bahnverkehr stetig zu – aber er ist auch eine Folge des tragischen Schicksals von Heinrich Hertz. Die eingangs erwähnten Zustände im alten Institut »trugen zu einer schweren chronischen Erkrankung von Heinrich Hertz und zu seinem frühen Tod«31 bei. Diese Folgerung eines seiner Biographen ist zumindest schlüssig, denn auf die Dauer wirkt sich der Aufent-halt in nassen und kalten Räumen nicht gut auf die Schleimhäute aus. Auch der Hertz behandelnde Arzt »behauptete mit aller Bestimmtheit, Hertz sei am
Institut gestorben«32. Die Nasennebenhöhlenentzün-dung, an der Hertz 1892 erkrankte, sollte nicht die einzige Folge der ungesunden Arbeitsbedingungen im feuchten Schloss bleiben. Auch August Hage-bach, der Assistent von Hertz Nachfolger Heinrich Kayser (1853 – 1940) zeigte schon nach wenigen Monaten ähnliche Symptome und zog daraufhin aus seiner Dienstwohnung im Schlossflügel aus. Nachdem Kayser daraufhin dem preußischen Kultus-ministerium vorwarf, am Tode von Heinrich Hertz Mitschuld zu sein und einen Institutsneubau forderte, erhielt er eine zynische Abfuhr. »Nein lieber Professor, so schnell geht das nicht. Da müssen noch ein paar Herren draufgehen.«33 Zum Glück für alle Beteiligten musste es dann doch nicht zum Äußersten kommen. Zwar dauerte es noch viele Jahre, doch Kaysers Beharr-lichkeit sollte von Erfolg gekrönt werden. Nach zwei-
[23] Grafische Darstellung des Experiments zur Ablenkung elektromagnetischer Wellen durch ein Prisma.
[24] Das »neue« Physikalische Institut der Universität Bonn in der Nußallee vor dem Zweiten Weltkrieg.
75
jähriger Bauzeit konnte 1913 ein großzügiger Neubau an der Nußalle von den Physikern bezogen werden.34 Der schönste Raum in diesem Institut ist zweifellos das »Heinrich-Hertz-Zimmer«. Dort stehen nicht nur die wertvollsten Bände der Bibliothek (viele davon aus Hertz Zeiten), der Raum dient auch der Erinnerung an prägende Figuren der Institutsgeschichte. Vitrinen bewahren Schätze aus fast zwei Jahrhunderten. Neben den virtuosen Gasentladungsröhren von Hein-rich Geissler (1814 – 1879) finden sich hier auch die Nobelpreisurkunde von Wolfgang Paul (1913 – 1993) und eben Stücke aus der Zeit von Heinrich Hertz. Den Raum ziert zudem sein Ölporträt, vor dem eine von Albert Küppers (1842 – 1929) geschaffene Büste des Physikers steht.
StimmgabelnEine auch aus ästhetischer Perspektive schöne Ergän-zung der apparativen Ausstattung des Bonner Insti-tuts hatte ebenfalls mit Wellen zu tun. Allerdings ging es diesmal nicht um »elektrodynamische Wellen«, sondern um Schallwellen. Am 20. Oktober 1889 schrieb Hertz an den renommierten Feinmechaniker und Spezialisten für akustische Präzisionsinstrumente Dr. Rudolph König in Paris: »Ich möchte gern für unser Institut einige Ihrer schönen Stimmgabeln haben, die leider ganz fehlen. Ginge es nach meinem Wunsche, so könnte ich nicht genug davon bekommen, in Wirk-
lichkeit muß ich nur allzu auf die vorhandenen Mittel sehen.«35 Schon Anfang November erreicht Dr. König die enthusiastische Reaktion des Bonner Instituts-direktors. »Ihre Sendung ist heute in meine Hände gekommen und hat mir die größte Freude gemacht. Sie kam auch frühzeitig, da ich gar nicht erwartet hatte, daß ich sie noch in meinem diesjährigen Colleg benutzen kann, und diese wenigen Gabeln werden in einer ganzen Reihe von Vorlesungen erscheinen. Wir haben verschiedene Gabeln, die den Ihren äußer-lich ganz ähnlich sind, aber wenn sie neben einander klingen, so sieht man den Unterschied, es ist einfach kein Vergleich. Hoffentlich gelingt es mir nun auch, die Gabeln zu vertheidigen gegen die vielen Schänd-lichkeiten von Seiten ungeschickter Menschen, welche sie bedrohen, daß sie sich lange halten. Ich habe heute
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[25] Blick durch die Tür in das »Heinrich-Hertz-Zimmer«.[26] Im Inneren des »Heinrich-Hertz-Zimmers«. Links im Hintergrund die
Vitrine mit einigen Institutsschätzen.
76
den ganzen Nachmittag mit ihnen experimentiert, immer war ich wieder erfreut.«36 Offenbar ist es Hertz und seinen Nachfolgern gelungen, diese feinen Stücke vor Misshandlungen zu schützen. Wenn man sie anschlägt, erschließt sich Hertz Begeisterung auch heute noch.
KathodenstrahlröhreWährend das Parabolspiegel-Ensemble zumindest die Physik-Studierenden regelmäßig bewundern durften, blieb ein weiterer Bonner Schatz aus der Zeit von Heinrich Hertz weitgehend im Verborgenen. Schon 1860 hatte der Bonner Physiker Julius Plücker (1801 – 1868)37 herausgefunden, dass in einem Glas-gefäß mit verdünnten Gasen, in die zwei metallische Elektroden (Kathode und Anode) eingeschmolzen waren, beim Anlegen einer Spannung von der nega-tiven Kathode farbige Strahlen ausgingen, die er Kathodenstrahlen nannte. Sie ließen sich magnetisch, aber nicht mit elektrischen Feldern ablenken. Daraus schloss man, dass es sich nicht um geladene Teilchen handeln konnte.Als Hertz die 1882 in Berlin begonnenen Experimente mit Kathodenstrahlen in Bonn wieder aufnahm, war auch er dieser Meinung. Hertz machte aber eine entscheidende Entdeckung: Kathodenstrahlen können dünne Metallfolien durchdringen. Seinem Assistenten Philipp Lenard (1862 – 1947) schlug er
[27] Ein Ölporträt von Heinrich Hertz schmückt den Raum.
77
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[28] Die von Heinrich Hertz so geliebten Stimmgabeln von Dr. König aus Paris. Daneben der zitierte Brief aus dem »Copirbuch«.
78
[29] Kathodenstrahlröhre von Heinrich Hertz. Mit dieser Röhre gelang es seinem Assistenten Philipp Lenard erstmals, die Kathodenstrahlen unabhängig vom Entladungsvorgang zu untersuchen.
[30] Kathodenstrahlröhre von der Firma Müller-Unkel aus Braunschweig, darunter Eintrag von Philipp Lenard im Inventar zur Anschaffung der abgebildeten Röhre.
79
vor, in die Anode ein Loch zu bohren und es mit einer dünnen Metallfolie abzuschließen. Damit war es nun möglich die Kathodenstrahlen vom Plasma in der Röhre zu trennen und mit ihnen zu experimen-tieren. Jetzt ließen sich auch die Kathodenstrahlen elektrisch ablenken und man konnte nachweisen, dass Kathodenstrahlen Elektronen sind. Der Grund für das Versagen der Ablenkung innerhalb der Röhre fand damit seine Erklärung: das Plasma in der Röhre besteht auch aus geladenen Teilchen. Ein angelegtes elektrisches Feld erreicht die Kathodenstrahlen nicht ungehindert.
Hertz überließ Lenard dieses vielversprechende Arbeitsfeld, weil er zugleich an der Abfassung seines theoretischen Hauptwerkes, den »Prinzipien der Mechanik« saß, deren Fertigstellung ihm letztlich wichtiger war.38 Lenard erhielt 1905 für seine Arbeiten über Elektronenstrahlen und seine Beiträge zur Elekt-ronentheorie den Nobelpreis für Physik. In Bonn ist noch eine zweite Kathodenstrahlröhre vorhanden, die Lenard anfertigen ließ. Diese alten Röhren wieder zum Leben zu erwecken ist ein langwieriges und riskantes Unternehmen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie bisher nur dreimal in den Jahren 1973, 2003 und 2007 öffent-lich im großen Wolfgang-Paul-Hörsaal der Univer-sität vorgeführt wurden.
Besucher der Sonderausstellung »Heinrich Hertz – Vom Funkensprung zur Radiowelle« im Deutschen Museum Bonn können sich an den schönsten Stücken aus Hertz Bonner Vermächtnis erfreuen, ohne extra ins Münchner Mutterhaus fahren oder gar ein Studium der Physik in Bonn beginnen zu müssen.
»Originale Kopien« Hertz' Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
[31] Beide Röhren im Betrieb.
80
Elektromagnetische Wellen bestehen aus elektrischen und magnetischen Feldern
ca. 300000 km/s
FrequenzWellenlänge
Lichtgeschwindigkeit=
Alles strahlt
Langwelle
Gamma-strahlung
Röntgenstrahlungweiche- mittlere- harte-
RadiostrahlungInfrarot(IR)
Ultra-Violett(UV)
sichtbaresLicht
- RadarKosmischeStrahlung
Tera-hertz-
strahlung
MikrowellenMW-Herd
1 m1 nm 1 mm1 m 1 km
UKW MittelwelleKurzwelle
Nanometer Mikrometer Millimeter KilometerMeter Wellenlänge (Meter)
Frequenz Hz (pro Sekunde)
Exahertz MegahertzGigahertz Terahertz Petahertz Kilohertz
Wechsel-ströme
MHzPHz GHzTHz kHzEHz
Neben unterschiedlichen Eigenschaften haben die elektromagnetischen Wellen eines gemeinsam, ihre Geschwindigkeit. Sie ist nach dem Licht benannt, den Wellen die wir sehen können. Diese Lichtgeschwindigkeit beträgt 299 792,458 km/s im Vakuum.und kann mit der Wellenlänge und der Frequenz in einer Formel dargestellt werden:
Wellen definieren sich durch ihre Höhe (Amplitude)
und ihre Länge(Wellenlänge)
Die Häufigkeit der Schwing-ungen pro Sekunde ist von der Wellenlänge unabhängig: Je kürzer die Wellenlänge, desto mehr Wellen schwingen pro Sekunde.
Dieser Schwingungswert Wellen/Sekunde nennt sich Frequenz und hat die Einheit Hz (Hertz).
1 Sekunde
7 Wellen7 Hz
14 Hz
Um den Zusammenhang besser zu verstehen, hier zwei kleine Rechenbeispiele:Welche Wellenlänge hat die Schwingung mit einer Frequenz von 1 Hz? Da die Schwingungen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, hat die 1 Hz-Welle eine Wellenlänge von 300000 km.
Welche Frequenz haben Schwingungen, deren Wellenlänge 1 Meter beträgt? Die Wellengeschwindigkeit beträgt 300000 km/s. Die Welle von 1 Meter wird sich also in einer Sekunde 300000 x 1000 mal wiederholen = 300000000 Hz; kürzer ausgedrückt 3 x 108 Hz
Frequenz1 m
300000000 m/s= = 3 x 108 Hz
oderWellenlänge =Frequenz
Lichtgeschwindigkeit
Wellenlänge300000 km/s
1 s-1= = 300000 km
14 Wellen
Jeder Körper sendet elektromagnetische Wellen aus. Alles was wärmer ist als der absolute Nullpunkt von −273,15 °C gibt Wärmestrahlung ab, also auch Menschen, Steine oder Fahrräder.
Elektromagnetische Wellen können unterschiedlichste Wellenlängen haben. Von kilometerlangen Wellen bis zu ganz kurzen Wellen mit Längen im atomaren Bereich.
10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 101 102 103 104 105
1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 109 108 107 106 105 104 103
Die unterschiedlichen Wellen werden im elektromagnetischen Spektrum zusammengefasst. Von der extrem energiereichen kurzwelligen Gammastrahlung, wie sie bei radioaktiven Zerfall entsteht, bis zur langwelligen energiearmen Radiostrahlung sind die unterschiedlichste Wellenbereiche aufgezeigt. Das menschliche Auge kann nur einen sehr kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums sehen. Trotzdem nutzt der Mensch die ganze Bandbreite der Strahlung zu ganz unterschiedlichen Zwecken.
Diese Felder liegen um 90° verschränkt ineinander. Sie schwingen wellenförmig in die Ausbreitungsrichtung mit Lichtgeschwindigkeit:ca. 300000 km/s
81
Elektromagnetische Wellen bestehen aus elektrischen und magnetischen Feldern
ca. 300000 km/s
FrequenzWellenlänge
Lichtgeschwindigkeit=
Alles strahlt
Langwelle
Gamma-strahlung
Röntgenstrahlungweiche- mittlere- harte-
RadiostrahlungInfrarot(IR)
Ultra-Violett(UV)
sichtbaresLicht
- RadarKosmischeStrahlung
Tera-hertz-
strahlung
MikrowellenMW-Herd
1 m1 nm 1 mm1 m 1 km
UKW MittelwelleKurzwelle
Nanometer Mikrometer Millimeter KilometerMeter Wellenlänge (Meter)
Frequenz Hz (pro Sekunde)
Exahertz MegahertzGigahertz Terahertz Petahertz Kilohertz
Wechsel-ströme
MHzPHz GHzTHz kHzEHz
Neben unterschiedlichen Eigenschaften haben die elektromagnetischen Wellen eines gemeinsam, ihre Geschwindigkeit. Sie ist nach dem Licht benannt, den Wellen die wir sehen können. Diese Lichtgeschwindigkeit beträgt 299 792,458 km/s im Vakuum.und kann mit der Wellenlänge und der Frequenz in einer Formel dargestellt werden:
Wellen definieren sich durch ihre Höhe (Amplitude)
und ihre Länge(Wellenlänge)
Die Häufigkeit der Schwing-ungen pro Sekunde ist von der Wellenlänge unabhängig: Je kürzer die Wellenlänge, desto mehr Wellen schwingen pro Sekunde.
Dieser Schwingungswert Wellen/Sekunde nennt sich Frequenz und hat die Einheit Hz (Hertz).
1 Sekunde
7 Wellen7 Hz
14 Hz
Um den Zusammenhang besser zu verstehen, hier zwei kleine Rechenbeispiele:Welche Wellenlänge hat die Schwingung mit einer Frequenz von 1 Hz? Da die Schwingungen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, hat die 1 Hz-Welle eine Wellenlänge von 300000 km.
Welche Frequenz haben Schwingungen, deren Wellenlänge 1 Meter beträgt? Die Wellengeschwindigkeit beträgt 300000 km/s. Die Welle von 1 Meter wird sich also in einer Sekunde 300000 x 1000 mal wiederholen = 300000000 Hz; kürzer ausgedrückt 3 x 108 Hz
Frequenz1 m
300000000 m/s= = 3 x 108 Hz
oderWellenlänge =Frequenz
Lichtgeschwindigkeit
Wellenlänge300000 km/s
1 s-1= = 300000 km
14 Wellen
Jeder Körper sendet elektromagnetische Wellen aus. Alles was wärmer ist als der absolute Nullpunkt von −273,15 °C gibt Wärmestrahlung ab, also auch Menschen, Steine oder Fahrräder.
Elektromagnetische Wellen können unterschiedlichste Wellenlängen haben. Von kilometerlangen Wellen bis zu ganz kurzen Wellen mit Längen im atomaren Bereich.
Es ist viel leichter “unsichtbare Engel” zu verstehen, als eine elektromagnetische Welle.Richard Feynman 1963, Quantenphysiker und Nobelpreisträger
82
Der lange Weg zu Hertz Von Jörg Bradenahl
Auf vielerlei Art wird jedes Unbekannte untersucht, dem sich Forscher nähern. Die Hilfsmittel, die sie dabei anwenden, sind oft erst vor kurzem dem Reich des Unbekannten abgerungen worden. Das Neue ist so immer das letzte Glied einer Kette von Vorausset-zungen. Eine solche Kette aus Erkenntnissen über Strom, Magnetismus und Licht war es, welche Hertz die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen ermög-lichte. Sie einmal genauer zu betrachten, könnte ein lohnendes Unterfangen sein:
Die Batterie – der StromBedauernswerte Frösche und zwei Italiener stehen im Mittelpunkt der Erfindung der Batterie. In Bologna experimentierte Luigi Galvani mit Froschschen-keln, als er am 6. November 1780 bemerkte, dass bei der Berührung von Kupfer und Eisen die Muskeln eines Frosch-beines zuckten. Es war durch die Metalle und das Elektrolyt »Körper f lüssigkeit« elektrochemisch Strom entstanden, der durch die Muskelkontrak-tion angezeigt wurde.Zwölf Jahre später erfuhr der Physik-professor Alessandro Volta, der an der 1361 gegründeten lombar-dischen Universität von Pavia lehrte, von Galvanis Expe-rimenten. Seine daraufhin einset-zenden Forschungsar-beiten mündeten 1800
in der Konstruktion der voltaischen Säule, der ersten funktionierenden Batterie der Welt. Sie bestand aus abwechselnd aufeinander geschichteten Kupfer- und Zinkplättchen, zwischen denen sich jeweils elektrolytgetränkte, also stromleitende Pappstücke befanden. Damit stand erstmals eine Stromquelle mit einem kontinuierlichen Strom zur Verfügung, mit der sich die Elektrizität wissenschaftlich erfor-schen ließ. Die Nachfolger Voltas beschlossen 1897 ihm zu Ehren die Einheit der elektrischen Spannung Volt zu nennen.[1] Luigi Galvani (1737 – 1798).
[3] Alessandro Volta (1745 – 1827).
[2] Die Voltaische Säule.
85
Die endliche LichtgeschwindigkeitIst Licht unendlich schnell? Diese Frage wurde noch im 17. Jahrhundert meist bejaht. Der dänische Astronom Ole Rømer begann im Jahr 1672 in Paris den Grund-stein zur Klärung dieser Wissenslücke zu legen. Es gibt einen Mond namens Io, der etwa alle 1,8 Tage
den Jupiter umrundet. Schon 1668 hatte Giovanni Domenico Cassini in Bologna Tabellen erstellt, die genau zeigten, wann der Io vor dem Planeten zu sehen ist und wann er sich hinter ihm wieder verdun-kelt. Rømer bemerkte Ungenauigkeiten in diesen
Tabellen. Wenn die Erde sich auf ihrer jährlichen Bahn um die Sonne dem Jupiter näherte, verdunkelte Io sich früher als vorausgesagt. Entfernte sich die Erde wieder, verdunkelte er sich später. Nachdem Rømer sich seiner Daten vergewissert hatte, veröffentlichte
[4] Ole Rømer (1644 – 1710).
SonneIo
Erde
Erdbahn- durchmesser Jupiter
86
Der lange Weg zu Hertz Von Jörg Bradenahl
SonneIo
Erde
Erdbahn- durchmesser Jupiter
er 1676 seine Ergebnisse und die dazugehörige Erklä-rung. Die Lichtgeschwindigkeit ist endlich! Je geringer die Entfernung zum Jupiter, desto eher erreicht uns sein Licht. Deshalb die Abweichungen der errech-neten Verdunkelungen. Rømer legte 22 Minuten als
den Zeitraum fest, den das Licht benötigt, um von einem Ende des Erdbahndurchmessers um die Sonne zum anderen zu gelangen.Es war aber nicht Rømer, der als erster die Geschwin-digkeit des Lichts berechnete, sondern 1678 der
holländische Astronom und Physiker Christiaan Huygens, der ebenfalls in Paris lebte. Dazu verknüpfte dieser die 22 Minuten von Rømer mit den Berech-nungen Cassinis zum Erdbahndurchmesser. Die so von ihm ermittelte Geschwindigkeit des Lichts kam dem heute gültigen Wert von 299792,458 km/s sehr nahe. Berühmt wurde Christiaan Huygens besonders als Erneuerer des Uhren- und Fernrohrbaus. Kaum beachtet wurde hingegen seine Wellentheorie des Lichts aus dem gleichen Jahr 1678.
[6] Christiaan Huygens (1629 – 1695).
[5] Schematische Darstellung der Verdunkelung des Jupitermondes Io und der Bahn der Erde um die Sonne.
87
Das Licht als WelleGrundlagen zur Entzifferung der ägyptischen Hiero-glyphen legte der englische Augenarzt und Physiker Thomas Young im Jahre 1814. Viel wichtiger für den Fortschritt der Physik war, was er 12 Jahre vorher über das Licht herausfand. 1802 konnte er als Professor in London die seit 125 Jahren bestehende Wellentheorie des Lichtes bestätigten. In dem von ihm entworfenen Doppelspaltexperiment wird Licht durch zwei senk-rechte Spalten einer Wand geschickt. An einer zweiten,
dahinter liegenden Wand bilden sich nun keine zwei Lichtstreifen, sondern ein Muster aus vielen Linien ab. Dieses so genannte Interferenzmuster war schon von den Wasserwellen bekannt. Young bewies damit nicht nur die Wellennatur des Lichtes, sondern maß später auch die ersten Wellenlängen. Der französische Physiker und Ingenieur Augustin Jean Fresnel beschäftigte sich seit 1814 in Paris mit der Optik. Er verhalf der Wellentheorie des Lichtes endgültig zum Durchbruch. Durch vielfältige Expe-rimente und insbesondere aufgrund seines mathema-tischen Talents gelang ihm die überzeugende Darstel-lung der Youngschen Hypothesen.
[9a, 9b] Doppelspaltversuch zur Klärung der Teilchen- oder Welleneigenschaften von zum Beispiel Licht.[7] Thomas Young (1773 – 1829).
Teilchen-eigenschaften
Wellen-eigenschaften
[8] Augustin Jean Fresnel (1788 − 1828).
88
Der lange Weg zu Hertz Von Jörg Bradenahl
Der elektrische Strom und der MagnetismusEs war an einem Abend im April 1820, als der däni-sche Physiker und Philosoph Hans Christian Ørsted für Freunde und Studenten eine physikalische Vorführung vorbereitete. In seinem Kopenhagener Haus spannte er dabei eine Stromleitung über einen
Kompass. Als er nun eine Batterie an die Leitung anschloss, veränderte der einsetzende Stromfluss die Stellung der vorher längs zur Leitung stehenden Kompassnadel. Zum ersten Mal wurde der Zusam-menhang zwischen elektrischem Strom und Magnetismus deutlich. Ørsteds Veröffentli-chung im Juli 1820 über diesen »elektrischen Conflict«, wie er die Ursache des Magne-tismus bezeichnete, eröffnete ein neues Forschungsgebiet. Der Franzose André-Marie Ampère war der erste, der diese Erkenntnisse im glei-chen Jahr aufnahm. Er begründete mit einer Vielzahl von Experimenten die Elektrodynamik. Diese neue physika-lische Disziplin beschäftigte sich mit bewegten elektrischen Ladungen und zeitlich veränderlichen elektrischen und magnetischen Ereignissen. Ampère defi-nierte die Begriffe »elektrischen Spannung« und »elektrischer Strom« und behauptete, dass Strom eine Richtung hat. Sein Name wurde in einer Maßeinheit verewigt. Seit 1948 steht das Ampère (A) für die elektrische Stromstärke. Sie ist heute die elektrische SI-Basiseinheit. Übrigens regte Ampère schon Ende 1820 einen Telegrafenapparat an, der auf der Ablenkung einer Magnetnadel durch elektrischen Strom basiert.[10] Hans Christian Ørsted (1777 – 1851).
[11] André-Marie Ampère (1775 – 1836).
89
Die elektrische Telegrafie und die MaßeinheitenIm Frühjahr des Jahres 1833 konnten die Göttinger, wenn sie nach oben schauten, einen Draht sehen, der sich neuerdings über ihre Dächer spannte. Mit dem Draht war die Sternwarte mit dem etwa einen Kilo-meter entfernt liegenden physikalischen Kabinett verbunden worden. Die Einwohner ahnten nicht, dass
dieser Draht der zentrale Bestandteil des ersten elekt-romagnetischen Telegrafen war. Carl Friedrich Gauß, der »Fürst der Mathematik«, wie er später genannt wurde, und der junge Physikprofessor Wilhelm Weber hatten sich in Göttingen etwas Besonderes ausgedacht. Neben dem Doppeldraht gehörten eine Sender- und eine Empfangsapparatur zu der Anlage. Als Sender
diente eine Spule, die über einen Magneten gezogen wurde und so Stromstöße erzeugte. Diese führten beim Empfänger zur Bewegung einer Magnetnadel. Je nachdem in welche Richtung die Spule über den Magneten gezogen wurde, zeigte die Empfangsma-gnetnadel nach rechts oder links. Ein binärer Code ermöglichte die Übersetzung der Rechtslinksbewe-gung in Buchstaben und Zahlen. Ob die ersten Worte wirklich der Ankunft des Institutsdieners galten: »Der Michelmann kommt«, bleibt indess ungewiss, ist aber eine schöne Anekdote. Eine praktische Anwendung hatten die Forscher weniger im Blick, so dass es letzt-lich Samuel Morse war, dessen System sich ab 1850 auch in Deutschland durchsetzte. Am treffendsten charakterisiert ein Zitat des engli-
[12] Der erste elektromagnetische Telegraph der Welt in Göttingen.
[13] Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855).
90
Der lange Weg zu Hertz Von Jörg Bradenahl
schen Physikers James Clerk Maxwell aus dem Jahre 1873 die Leistungen von Weber und Gauß: »Wir haben dem großen Weber unendlich viel auf dem Gebiete der Elektrizitätslehre zu verdanken. Er hat unsere Wissenschaft mächtig gefördert, als er die abso-luten Einheiten zur Messung der elektrischen Größen einführte. Er hat im Verein mit Gauß die Messung der magnetischen Größen auf die höchste Stufe der Präzision gebracht, dann gab er in seinen Elektrody-namischen Maßbestimmungen die Grundlage zur Fixierung der Maßeinheiten, die eine Anwendung finden sollten, und schließlich lehrte er die einzelnen elektrischen Größen mit einem nie geahnten Grade
von Genauigkeit in diesen Einheiten zu messen.« Gauß und Weber schufen ein physikalisches Einhei-tensystem, das später, 1881, auf einem internationalen Kongress in Paris, zur Grundlage der elektrotechni-schen Maßeinheiten wurde.Die elektromagnetischen Felder in Praxis und TheorieEin Weicheisenring bildete den Kern eines wegwei-senden Versuchs des englischen Naturforschers und begnadeten Experimentalphysikers Michael Faraday. Am 29. August 1831 wurde dieser Ring in seinem Londoner Laboratorium auf zwei Seiten mit isoliertem Kupferdraht umwickelt. Der Draht der einen Wicklung führte zu einer Batterie, der der anderen zu einer Magnetnadel. Wurde nun die Batterie angeschlossen, zuckte die Magnetnadel am gegenüberliegenden Ende. Der Batteriestrom floss dabei durch die erste Wicklung und induzierte dort ein Magnetfeld im Weicheisenring. Dieses induzierte wiederum einen Strom in der zweiten Wicklung, der dann das Magnet-feld an der Magnetnadel beeinflusste. Kurzum, das Prinzip der elektro-magnetischen Induktion war entdeckt worden und wurde von Faraday in einem Induktionsgesetz
festgehalten: »In einer Spule wird eine Spannung induziert, wenn sich das von ihr umfasste Magnet-feld ändert.«. Er war es auch, der als erster den Begriff des magnetischen Feldes verwendete.
[14] Wilhelm Eduard Weber (1804 – 1891).
BatterieWeich-eisen-kern
SpuleSpule
Magnetnadel
Schalter
[15] Michael Faraday (1791 – 1867).
[16] Aufbau des Faradayschen Versuchs zur elektromagnetischen Induktion.
91
Während Faraday in seinem Leben fast 30000 Expe-rimente durchführte, war der schottische Physiker James Clerk Maxwell ganz der Theoretischen Physik verhaftet. Seit Ørsteds Versuch von 1820 hatte sich die Vorstellung über die Natur des Lichtes, der Elek-trizität und des Magnetismus dramatisch erweitert. Maxwell gelang es 1864 dieses neue Wissen in einem System von Gleichungen zusammenzufassen. Ein Geniestreich, wie sich später erweisen sollte.
Der Wiener Physiker Ludwig Boltzmann – der selbst viel zur Einführung der sogenannten »Maxwell-schen Gleichungen« beitrug – stellte mit Bewunde-rung ob deren Schönheit und Symmetrie fest:
»War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, Die mit geheimnisvoll verborg nen Trieb
Die Kräfte der Natur um mich enthüllen, Und mir das Herz mit stiller Freud erfüllen?«
frei nach Goethe: Faust – Der Tragödie erster Teil – Nacht
Maxwell legte dar, dass elektrische und magneti-sche Kräfte sich ergänzende Erscheinungen des Elektromagnetismus seien. Er behauptete, dass
sich elektrische und magnetische Felder als elekt-romagnetische Wellen durch den Raum bewegen. Maxwell berechnete auch deren Geschwindigkeit und prognostizierte: »Diese Geschwindigkeit ist so nahe an der Lichtgeschwindigkeit, dass wir einen starken Grund zu der Annahme haben, dass das Licht selbst (einschließlich Wärmestrahlung und anderer Strahlung, falls es sie gibt), eine elektroma-gnetische Welle ist, die sich durch elektromagne-tische Felder ausbreitet nach elektromagnetischen Gesetzen.« Diese Wellentheorie musste noch 22 Jahre warten, bis ihre Gültigkeit in einem Karls-ruher Hörsaal bewiesen wurde.
[17] James Clerk Maxwell (1831 – 1879).
[18] Die Maxwellschen Gleichungen.
92
Der lange Weg zu Hertz Von Jörg Bradenahl
Die elektrischen SchwingungenDer britische Physiker William Thomson, der spätere Lord Kelvin, hat sich neben vielen anderen Forschungs-gebieten auch mit dem sogenannten Schwingkreis beschäftigt. Im Jahr 1853 gelang es ihm, die nach ihm benannte Schwingungsgleichung aufzustellen. Diese Formel beschreibt die Zusammenhänge, die einen Schwingkreis kennzeichnen.
[19 ] William Thomson, 1. Baron Kelvin, oft auch Lord Kelvin genannt (1824 – 1907).
Der Schwingkreis
Ein Schwingkreis besteht aus einer
Spule und einem Kondensator, die
mit einer Leitung ringförmig zusam-
mengeschlossen sind. Ein Kondensa-
tor ist eine Art elektrischer Ladungs-
speicher, dessen Speichergröße als
Kapazität bezeichnet wird. Er be-
steht aus zwei gegenüberliegenden
Platten, die durch nicht leitendes
Material voneinander getrennt sind.
In einer Spule erzeugt ein sich än-
dernder Stromfluss ein Magnetfeld.
Die elektrische Energie wird in magnetische umgewandelt, die sich dann wieder in die elektrische Form zu-
rückverwandelt. Die Induktivität einer Spule bezeichnet die Stärke dieses Effekts. Sie kann durch die Größe
der Spule und die Zahl der Windungen verändert werden.
Wird nun der Kondensator geladen, also eine Spannung angelegt, fließt der Strom über die Spule von
einer Kondensatorhälfte zur anderen und wieder zurück. Der Strom schwingt also in einer bestimmten Fre-
quenz hin und her. Diese Frequenz ist bauartbedingt und abhängig von der Kapazität und Induktivität der
Bauteile.
Dies drückt die Thomsonsche Schwingungsgleichung aus:
SpuleKondensatorInduktivität (L)Kapazität (C)
Frequenz (f)
93
Sein raffinierter Versuchsaufbau wurde belohnt: Er konnte nachweisen, dass der Stromfluss wirklich oszilliert, also sich zwischen den Kondensatorhälften in einer bestimmten Frequenz hin und her bewegt. Der Funke sprang also im Takt dieser Frequenz hin und her. Feddersen konnte durch Veränderung des Versuchsaufbaus auch die Frequenz modulieren, wie Thomson es vorausgesagt hatte.
Mit einer Speziellen Variante des Schwingkreises beschäftigte sich der deutsche Physiker Berend Wilhelm Feddersen in Leipzig Ende der 1850er Jahre. Statt der Spule verwendete er einen Widerstand und baute eine Funkenstrecke in die Leitung ein. Das heißt er schnitt ein kurzes Stück Leitung heraus. Wenn
nun eine Spannung angelegt wurde, bildeten Funken die kurzzeitige elektrische Verbindung zwischen den beiden Seiten der Lücke. Genau dieser überspringende Funke sollte ihm Details über die Frequenz verraten und Thomsons Gleichung auf ihre Gültigkeit hin überprüfen. Mit einem sich drehenden Spiegel konnte er letztlich 1862 den Funkensprung in viele Bilder pro Sekunde zerlegen und auf eine Fotoplatte bannen.
[21] Meßapparatur mit Drehspiegel zur Bestimmung des Funkensprungs.
[20 ] Berend Wilhelm Feddersen (1832 – 1918).
94
Der lange Weg zu Hertz Von Jörg Bradenahl
Die elektromagnetische WelleDas Feld war bereitet, und das Phänomen der elek-tromagnetischen Welle wartete auf seine Entde-ckung. Viele Forscher hätten in dieser Zeit die Indizien richtig deuten können – taten es aber nicht. Es war Heinrich Hertz, der in Karlsruhe am 4. Oktober 1886 einen kleinen Nebenfunken an Knochenhauerschen Spiralen beobachtete. Er expe-rimentierte während einer Vorlesungsvorbereitung mit diesen zwei übereinanderliegenden Spiralen mit Funkenstrecke, als er auf dieses unerwartete Funkenverhalten stieß. Was Andere wohl als induktive Randerscheinung abgetan hätten, warf bei Hertz Fragen auf, die ihn nicht mehr losließen. Er kannte natürlich die Erkenntnisse seiner Physikerkollegen, die Fragestel-lungen der Zeit, und plötzlich muß es eine Verbin-dung gegeben haben zwischen diesem Wissen, den Funken und seiner Vorstellungskraft. Er begann weitere Versuche. Er ersetzte die Spiralen durch gerade Drähte, der »Hertzsche Dipol« entstand; dieser Draht mit der Funken-strecke funktionierte als »offener Schwingkreis«. Ein Resonanzrechteck aus Draht mit eingebauter Funkenstrecke diente als Empfänger. Die Funken wurden in vielerlei Versuchsanordnungen zum Übersprung gebracht und die Resonanz der elekt-rischen Erscheinungen protokolliert.
[22] Heinrich Hertz auf der Suche nach elektromagnetischen Wellen. In der Hand hält er den Resonator, mit dessen Lupe er, im Falle elektromagnetischer Einwirkungen, sehr kleine Funken erkennen kann.
95
In der zweiten Hälfte 1887 wurde Hertz bewusst, dass er sich von den alten Vorstellungen lösen müsste, um noch weiter zu kommen. »Erst ganz allmählich gelang es mir, mir klar zu machen, dass jener Satz, welcher die Voraussetzung meines Versuches bildete, hier keine Anwendung fände; dass bei der Schnelligkeit der Bewegung auch Kräfte, welche ein Potential besassen, in der fast geschlossenen Leitung Funken erregen könnten; dass überhaupt die grösste Vorsicht zu beob-achten sei bei Anwendung der allgemeinen Begriffe und Lehrsätze, welche der gewöhnlichen Elektricitätslehre
[23] Orginalzeichnung von Heinrich Hertz zu seinem Versuchsaufbau. (A = Induktor, C = Kondensator, 1+2 = Funkenstrecke im Resonanzrechteck 1 (a,b,c,d), 3+4 = Funkenstrecke im Resonanzrechteck 2 (e,f,g,h)
[24] Stilisierung der Hertzschen Orginalzeichnung in grafischer Form.
entstammten.« (Heinrich Hertz, «Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft” Leipzig 1892, S. 5.). Langsamwurde ihm klar, was an seinem Dipol geschah: Wellen, die sich dort abschnüren um in den Raum zu wirken. Und dieser Raum wurde jetzt untersucht, die Erscheinungen ausgemessen und die Wellen identifiziert und katalogisiert. Die Glei-chungen des acht Jahre vorher verstorbenen Maxwell drängten nach vorne und wurden in ihrer Gültigkeit bestätigt. Wieder war es das praktische Experiment, das die durch Überlegung gewonnenen Erkenntnisse eines Theoretikers von einer unbestätigten Theorie zu einer wissenschaftlichen Realität werden ließ. Die elektromagnetischen Wellen waren entdeckt und konnten nun weiter untersucht werden. Was mit einem, kleinen unscheinbaren Funken in Karlsruhe begann, ermöglichte später drahtlose Über-tragungen rund um den Globus und darüber hinaus.
[24] Stilisierung der Hertzschen Orginalzeichnung in grafischer Form.
96
Vom Funkensprung zur Radiowelle Von Ralph Burmester und Jörg Bradenahl
Heinrich Hertz hat weder das Radio noch das Mobil-telefon erfunden. Aber indem er in mühevollen Expe-rimenten die Eigenschaften der »Strahlen elektri-scher Kraft« ermittelte, legte er den Grundstein für drahtlose, länderübergreifende Kommunikation, die unmittelbar nach seinem Tod einsetzte. Es gehört zu den gut gepflegten Mythen der Wissenschafts- und Technikgeschichte, dass Hertz nicht an die Möglich-keit der Informationsübertragung mittels elektroma-gnetischer Wellen geglaubt hat.1 Richtig ist in jedem
Fall, dass Hertz »seine« Wellen vor allem unter dem Aspekt der Naturerkenntnis betrachtete. Er hatte sich, als Idealtypus des exakten Naturwissenschaft-lers, der erkenntnisorientierten Grundlagenforschung verschrieben. Sein auffälliges Talent als Handwerker und Tüftler nutzte er zur Konstruktion und Planung seiner Versuchsapparaturen. Der von Hertz dabei gezeigte Erfindungsreichtum galt aber nicht der prak-
tischen Verwertung seiner Erkenntnisse; dies schien außerhalb seines Interesses zu liegen. Nachdem er seine Arbeiten über die elektromagnetischen Wellen 1888 beendet hatte, bauten viele Physiker weltweit seinen Versuchsaufbau nach und wiederholten seine Experimente. Das Ensemble aus Dipolsender und -empfänger wurde dabei weiter optimiert. Der französische Physiker Édouard Branly (1844 – 1940) entdeckte 1890 eine Art Schalter, der durch elektromagnetische Wellen aktiviert wurde, den »Kohärer«. Dieser ersetzte den Funken am Empfänger. Sein russischer Kollege Alexander Stepanowitsch Popow (1859 – 1906) ergänzte das Ensemble mit einer geerdeten Antenne, welche die Reichweite der Anlage deutlich erhöhte. Im Jahre 1897 gelang ihm sogar die Übertragung des ersten drahtlosen Telegramms über fünf Kilometer mit dem schönen Wortlaut »Heinrich Hertz«. Popow fand aber in seinem Land keine Unter-stützung und wurde offenbar ein tragisches Opfer institutioneller Ignoranz. 1906 soll er nach einem weiteren sinnlosen Gespräch mit dem zuständigen Minister an einem Gehirnschlag gestorben sein.2
Doch nicht diese Wissenschaftler sollten später mit der Erfindung der Funktechnik in Erinnerung bleiben, sondern ein Autodidakt aus der Nähe von Bologna. Auf dem väterlichen Anwesen Villa Grif-fone begann 1894 der erst zwanzigjährige Guglielmo Marconi (1874 – 1937) mit Versuchen zur Funk-
[1] Guglielmo Marconi vor seinem Funkapparat (Holzschnitt von 1897).
101
technik. Schon früh interessierte Marconi sich für Elektrizität. Der Tod von Heinrich Hertz 1894 sorgte noch einmal für eine erhöhte Publizität seiner Entde-ckungen und weckte wohl auch Marconis Interesse an Hertz »Strahlen elektrischer Kraft«. Außerdem war er Schüler des italienischen Physikers Augusto Righi (1850 – 1920), der mit Marconis Familie befreundet war und selbst über elektromagnetische Wellen forschte. Righi stellte Marconi auch die erste technische Funkausstattung zur Verfügung. Bereits im August 1895 konnte Marconi Signale über drei Kilometer senden. Der Durchbruch gelang ihm aber nicht im heimatlichen Italien, sondern in der Handelsmetropole London. Dorthin ging er mit seiner Mutter, die schottisch-irischer Herkunft war und auf die Förderung ihrer Familie rechnen konnte, nachdem er in Italien kein Interesse an seiner Technik wecken konnte. Mit Unterstützung der englischen Post glückte 1897 eine Aufsehen erregende Signal-übertragung über einen fünf Kilometer breiten Teil des Bristolkanals. Um die kommerzielle Dimension seiner Erfindung voranzutreiben, gründete Marconi mit dem Kapital von Freunden und seiner Familie im gleichen Jahr die private »Wireless Telegraph and Signal Company«.Marconi hatte nie Probleme, die Forschungsergeb-nisse anderer für sich zu nutzen und dann als Teil seiner Anlage patentieren zu lassen. Mit dem Kohärer [2] Erster gekoppelter Versuchssender von Guglielmo Marconi von 1899 (Nachbildung).
102
von Branly und der geerdeten Antenne von Popow startete er 1894 seine Versuche. Marconi fand heraus, dass sich die Reichweite mit Erdung einer Seite der Sendefunkenstrecke stark erweitern ließ. So gelang 1899 die Übertragung über den Ärmelkanal und 1901 über den Atlantik. Da die leitungsgebundene Telegrafie schon lange etablierte Technik war, musste sich Marconis Gesell-schaft eine Marktnische suchen. Diese fand sich beim Militär. Kriegsschiffe und sich bewegende Heeresab-teilungen konnten nicht oder nur schlecht über Kabel erreicht werden. Hier konnte die drahtlose Telegrafie ihre Stärken ausspielen. Diese Nutzung leuchtete damals allen führenden Industriestaaten ein. Rasch wurden auf nationaler Ebene Forschungsgruppen gebildet, deren primäres Ziel die Erhöhung der Reich-weite war. Erste Ergebnisse ließen so nicht lange auf sich warten. Der deutsche Physiker Ferdinand Braun (1850 – 1918) ließ sich 1898 ein System patentieren, das sowohl die Sende- als auch die Empfangsqualität deutlich verbes-serte.3 Zwar erhielten Marconi und Braun für ihre Pionier-leistungen auf dem Gebiet der Funktechnik 1909 den Nobelpreis für Physik, doch es gab durchaus noch weitere Protagonisten mit substantiellen Beiträgen. In Deutschland wurde der Charlottenburger Elektrotech-nikprofessor Adolf Slaby (1849 – 1913) auf Marconis
Funkversuche aufmerksam. Durch seine Bekannt-schaft mit dem Chef der englischen Telegrafenverwal-tung, Sir William Henry Preece, konnte Slaby im Mai 1897 zusammen mit seinem Assistenten Georg Graf von Arco an Marconi-Versuchen mit der drahtlosen Telegrafie vor der englischen Kanalküste teilnehmen. Slaby und Arco erkannten sofort die militärische Bedeutung dieser neuen Technik und gewannen rasch die Unterstützung Kaiser Wilhelms II.4 Umge-hend begannen sie nun ihrerseits mit der Untersu-chung der physikalisch-technischen Grundlagen der Funktechnik. Schon im Sommer 1898 konnten sie mit einer Übertragung über 60 Kilometer von Berlin nach Jüterbog beeindruckende Resultate vorweisen. Dabei führten entscheidende Verbesserungen zum Erfolg. Anders als bei Marconi lag die Funken-strecke nicht in der Sendeantenne sondern in einem
Vom Funkensprung zur Radiowelle Von Ralph Burmester und Jörg Bradenahl
[3] Guglielmo Marconi in der Pose des erfolgreichen Geschäftsmanns.
[4] Geschlossener Schwingungskreis und Lufttransformator nach Ferdinand Braun von 1898.
103
mit dem Antennenkreis induktiv gekoppelten Kreis. Während Ferdinand Braun im Dienste der AEG für das Heer tätig war, arbeiteten Slaby und Graf von Arco im Auftrag von Siemens & Halske für die Kaiserliche Marine. Um die nationalen Forschungs-anstrengungen zu bündeln und ein Gegengewicht zur britischen Marconi-Gesellschaft zu bilden, kam es 1903 zur Gründung der »Telefunken, Gesellschaft für drahtlose Telegraphie« zu gleichen Teilen durch die AEG und Siemens & Halske.5 Bereits 1910 wurde der Telegrafenverkehr von Europa nach Nordame-rika durch Funkübertragung abgewickelt. Im Ersten Weltkrieg erwies sich die Funktelegrafie dann auch, wie erwartet, als Kommunikationsmittel von strate-gischer Bedeutung.
Noch während des Krieges entwickelte sich vor allem in den USA aus dem drahtlosen Funk der Rund-funk. Nach anfänglichen Musikübertragungen durch Radioamateure etablierten sich um 1920 erste Radiostationen mit regelmäßiger Programmausstrah-lung. Kommerziell gefertigte Radiogeräte wurden bald auch für den privaten Gebrauch angeboten und erfreuten sich eines rasanten Absatzes. Bereits 1924 besaßen 34,4 % der amerikanischen Haushalte ein Radio. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so dynamisch, verlief die Entwicklung in den meisten europäischen Staaten einschließlich der Sowjetunion. In Deutsch-[5] Slabys Empfangsstation mit Kohärer, Klopfer und Relais um 1900.
104
land begannen die ersten regelmäßigen Rundfunk-sendungen am 23. Oktober 1923. In wenigen Jahren entwickelte sich der Rundfunk zu einem überaus beliebten Informations- und Unterhaltungsmedium. Ende der 1930er Jahre besaßen beispielsweise etwa 80% der amerikanischen Haushalte ein Radiogerät. In Deutschland förderten seit 1933 die nationalsozi-alistischen Machthaber die Verbreitung des Radios durch den massenhaft vertriebenen und günstigen »Volksempfänger« und später den noch preiswerteren »Deutschen Kleinempfänger«. Ähnlich wie in der Sowjetunion stand dabei vor allem die Verbesserung des propagandistischen Zugriffs auf die Bevölkerung im Mittelpunkt. Bei Kriegsbeginn 1939 hatten über 50% der Haushalte im Gebiet des Deutschen Reiches
einen Rundfunkempfänger.6 Neben dem Aufstieg des Radio-Rundfunks in den 1930er Jahren begannen auch schon erste Versuche der Bildübertragung, der nächsten vielversprechenden Anwendung der elektromagnetischen Wellen. Im Laufe der 1960er Jahre stieg das Fernsehen neben Zeitungen und Radio zu einem gesellschaftlichen Leitmedium auf. Diesen Status hat es auch in Zeiten der digitalen Revolution durch das Internet noch nicht gänzlich verloren.Ohne hochfrequente, elektromagnetische Funkwellen wäre auch die heute allgegenwärtige Kommunikation mit Mobiltelefonen nicht möglich. Insofern bleiben Heinrich Hertz und seine »Strahlen elektrischer Kraft« auch 125 Jahre nach den wegweisenden Expe-rimenten im Karlsruher Hörsaal hochaktuell.
Vom Funkensprung zur Radiowelle Von Ralph Burmester und Jörg Bradenahl
[7] Antenne und erstes Betriebsgebäude der Funkstelle Nauen bei Berlin im Jahre 1906.
[8] Die zeitgenössische Zeichnung »Die Funkensender« stellt die beiden Verfahren von Marconi und Braun mit ihren jeweiligen Komponenten gegenüber.
105
Töne
Mikrofon
Schall-wellen WDR 5
SWF3
DLF
BFBS
1live
WDR5
SWF3
DLF
BFBS
elektrischesNutzsignal
SWF3
DLF
WDR5WDR5 WDR5
WDR5
Sender
Emfänger
Studioin Köln
WDR5
Radioin Bonn
BFBS
Senderauswahldrehknopf
Sendeantenne
Empfangsantenne
Modulation
Trägerwellen+ Nutzsignal
Trägerwellen
WDR 5
Radiowellen
analog
AM = Amplitudenmoduliert
digital
elektrisches Ausgangssignal (Nutzsignal)
Trägerwellen
Radiowellen
FM = Frequenzmoduliert
WDR5
WDR5
1live
WDR 5
DLF
BFBS
1live
DLF
1live
SWF3
Um dieses Nutzsignale per Funk weiterleiten zu können bedarf es der kurzwelligeren
Radiowellen als Träger. Sie transportieren die im Nutzsignal enthaltenen Toninformationen
quasi Huckepack. Die Nutzsignale modulieren dabei die Trägerwellen. Sowohl die Amplitude,
als auch die Frequenz der Trägerwelle kann dabei vom Nutzsignal in einer Reihe von Schritten
verändert werden, bevor sie über eine Antenne gesendet werden. Am Zielort werden die
Radiowellen wieder demoduliert und so die Toninformation isoliert.
Rundfunk
106
Töne
Mikrofon
Schall-wellen WDR 5
SWF3
DLF
BFBS
1live
WDR5
SWF3
DLF
BFBS
elektrischesNutzsignal
SWF3
DLF
WDR5WDR5 WDR5
WDR5
Sender
Emfänger
Studioin Köln
WDR5
Radioin Bonn
BFBS
Senderauswahldrehknopf
Sendeantenne
Empfangsantenne
Modulation
Trägerwellen+ Nutzsignal
Trägerwellen
WDR 5
Radiowellen
analog
AM = Amplitudenmoduliert
digital
elektrisches Ausgangssignal (Nutzsignal)
Trägerwellen
Radiowellen
FM = Frequenzmoduliert
WDR5
WDR5
1live
WDR 5
DLF
BFBS
1live
DLF
1live
SWF3
Nach 10 oder 1000 Kilometern empfängt eine
Antenne das Signal. Besser gesagt, sie empfängt
eine Unmenge von Radiowellen unterschiedlicher
Frequenz. Sie werden dort alle in elektrische
Signale umgewandelt. Diese Signale werden
im Radio durch einen elektrischen Schwingkreis
mit Spule und Kondensator geleitet, der als
Filter wirkt. Mit dem Senderauswahldrehknopf,
einem Drehkondensator, kann der Schwingkreis
so eingestellt werde, dass nur Trägerwellen mit
einer definierten Signalfrequenz duchgelassen
werden. Zum Beispiel in Bonn der WDR 5 bei
88 Mhz.
Anschließend wird das Signal demoduliert. Das Nutzsignal wird aus der
hochfrequenten Trägerwelle technisch extrahiert und an den Lautsprecher
weitergeleitet. Dort entstehen wieder die gleichen Schallwellen, die zu Beginn
im Studio auf das Mikrofon trafen.
107
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
Warum dieses Thema?Der Rundfunk ist wohl ein Bereich der Technik, in dem viele Menschen unmittelbar mit einem Anwen-dungsbereich elektromagnetischer Wellen in Berüh-rung kommen, und das nun schon seit fast 90 Jahren, nimmt man den Beginn des Rundfunksendebetriebs durch die Funkstunde AG in Berlin als Startpunkt. Es ist also naheliegend, sich in diesem Band auch mit der Rundfunkgeschichte zu befassen. Allein, es ist ein schwieriges Unterfangen, auf den zur Verfügung stehenden Zeilen einen Abriss der Rundfunkentwick-lung allein in Deutschland darstellen zu wollen, wenn man nicht in der bloßen Auflistung von Ereignissen stehen bleiben möchte. Dafür ist die Thematik aber zu vielschichtig, abwechslungsreich und spannend. Neben der technischen Entwicklung bei den Sende-anlagen, den Rundfunkempfängern und der Studio-technik waren es immer wieder Ereignisse, Hand-lungen von Personen und andere Randbedingungen, die der Rundfunkentwicklung die Richtung gegeben haben, die zum heutigen Rundfunk in seiner Vielfalt geführt haben. Einen Blick auf diese Randsetzungen der Technik zu werfen, ist das Motiv dieses Textes, der sich mit einer Episode der Rundfunkgeschichte beschäftigt, von der unter den ganz spezifischen Bedingungen in Deutschland Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre ein sehr wesentlicher Impuls für die Rundfunk-
entwicklung nicht nur in Deutschland ausging. Das genauere Hinsehen auf diesen Prozess zeigt Verallge-meinerbares für die Rundfunkgeschichte als Ganzes auf, mehr als es eine Zusammenfassung der Gesamt-
entwicklung erlauben würde. Die Darstellung der UKW-Einführung beleuchtet deren rundfunkpoliti-sche und technische Hintergründe und skizziert den Ausbau der Sender-Netze sowie die Entwicklung der Akzeptanz für die neue Technik bei den Hörern.
Wie verlief die Neuordnung der Rundfunkland-schaft in Deutschland nach 1945?Nach dem Ende der NS-Diktatur wurde der Sende-betrieb unter der Regie der Besatzungsmächte neu aufgebaut. Eigentlich sollte eine gemeinsame Rund-funkpolitik aller vier Mächte entwickelt und umge-setzt werden. Da es dazu aus verschiedenen Gründen nicht kam, orientierte sich jede Besatzungsmacht am Rundfunkmodell des eigenen Landes.1
In der Britischen Besatzungszone wurde mit dem Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg ein zentral gestaltetes Rundfunkprogramm für die ganze Zone aufgebaut. Das Funkhaus Köln lieferte Regio-nalbeiträge aus dem Land Nordrhein-Westfalen zu. Ähnliche Lösungen fand die Militärregierung der Französischen Besatzungszone. Das Programm des Südwestfunks wurde in Baden-Baden produziert; Studios in Koblenz und Kaiserslautern produzierten regionale Beiträge. In der Amerikanischen Besat-zungszone wurden hingegen mehrere Programme, jeweils für die einzelnen Länder der Zone, einge-richtet.
Bremer-haven
Hamburg
Hannover
Dortmund
Düsseldorf
Köln
Bonn
Koblenz
Wiesbaden
Karlsruhe
Stuttgart
Tübingen
München
Funkhaus
Studio
RIAS
BR
RB
NWDR
SWF
SWF
SDR
HR
NWDR
Baden-Baden
Baden-Baden
Kaisers-lautern
HeidelbergMannheim
Frankfurt/Main
Nürnberg
Kassel
Oldenburg Bremen
[1] Die Rundfunksender in den drei westlichen Besatzungszonen.
111
An dieser Grundkonstellation in den Westzonen änderte sich auch später nichts mehr. Bis 1948 blieben alle Programme unter Kontrolle der Besat-zungsmächte. Dann begannen zuerst die Briten und Amerikaner mit Vorbereitungen, den Rundfunk in deutsche Verantwortung abzugeben. Als Reaktion auf die Instrumentalisierung des Rundfunks durch die Nationalsozialisten bestimmten die Besatzungs-mächte als zentrales Prinzip einen möglichst geringen Einfluss des Staates auf die Tätigkeit des Rundfunks zu sichern. So entstand in Westdeutschland ab 1948 der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dessen Programm-auftrag mit Information, Bildung und Unterhaltung für alle Bevölkerungsgruppen festgelegt wurde. Als erstes wurde der NWDR in eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt umgewandelt. In der Folge entstanden auch aus den Programmen in den beiden anderen Westzonen öffentlich-recht-liche Anstalten: der Bayrische Rundfunk, der Hessi-sche Rundfunk, Radio Bremen und der Süddeutsche Rundfunk aus den Sendern der Amerikanischen Besatzungszone und der Südwestfunk im Gebiet der Französischen Zone.2
Mit dem Ausbau des Berliner NWDR-Studios zum Sender Freies Berlin 1953, der Gründung des Saar-ländischen Rundfunk 1955 und der Aufspaltung des NWDR in den Norddeutschen Rundfunk und den Westdeutschen Rundfunk 1956 war die öffentlich- [2] Der Kopenhagener Wellenplan.
112
rechtliche Rundfunklandschaft der Bundesrepublik in ihren wesentlichen Zügen ausgestaltet.3
Für die Sowjetische Besatzungszone begann der Sendebetrieb auf Anweisung der Sowjetischen Mili-täradministration für Deutschland (SMAD) bereits wenige Tage nach Ende der Kämpfe in Berlin. Die Militärverwaltungen der Länder und Provinzen erteilten bald darauf ebenfalls Befehle, Rundfunkan-lagen instand zu setzen und einen Programmbetrieb aufzubauen.4 Praktisch entstanden zwei Sendebezirke: ein südlicher, der die Länder Sachsen und Thüringen sowie die frühere preußische Provinz Sachsen (später das Land Sachsen-Anhalt) umfasste und ein nörd-licher mit Brandenburg, Mecklenburg und Berlin. Hinzu kam das Programm des Deutschlandsenders.5
Für die Programmgestaltung war seit Dezember 1945 die Zentralverwaltung für Volksbildung zuständig. Im Sommer 1946 wurde eine Generalintendanz für den Rundfunk eingerichtet, der fortan die Landes-funkhäuser unterstellt waren. Zumindest formal ging damit die Verantwortung für den Rundfunk in der SBZ wesentlich früher wieder auf Deutsche über, als in den Westzonen. Die starke Präsenz kommunisti-scher Funktionäre gerade in den politisch und ideo-logisch brisanten Bereichen der Verwaltung sicherte aber prinzipiell eine Tätigkeit im Sinne der SMAD.6
Nach der Gründung der DDR blieb diese Rund-
funkstruktur bestehen. Erst mit der Bildung des Staatlichen Rundfunkkomitees im Jahre 1952 wurde auch eine Neuorganisation des DDR-Rundfunks in Angriff genommen. Die bis dahin im Wesentlichen regionalisierte Programmstruktur wurde abgeschafft.7 Sie wurde durch die Programme Berlin I, II und III ersetzt, deren Namensgebung schon auf ein ausgeprägt zent-ralisiertes Programmkonzept hinwies.8 Bei dieser Reorganisation gingen die spezifischen Profile der bisherigen Programme völlig verloren, die neuen konnten aber kein eigenständiges entwickeln.9 Ab 1954 wurde die Reform daher schrittweise wieder zurückgenommen. Dieser Prozess zog sich bis zum September 1955 hin. Von dieser Zeit an gab es die Programme Deutschlandsender (Berlin I), Berliner Rundfunk (Berlin II) und Radio DDR (Berlin III).10
Welche Gründe führten zur Einführung des UKW-Rundfunks in Deutschland?Die außerordentlich rasche Entwicklung des Rund-funks im Europa der 1920er Jahre machte bald inter-nationale Vereinbarungen über die Verteilung der Frequenzen für die verschiedenen Sender notwendig, um gegenseitige Störungen weitgehend zu vermeiden. Die ersten Bemühungen dieser Art datieren aus dem Jahre 1926, als in Genf ein erster Wellenplan für Europa erarbeitet wurde.11
Besonders ungeordnete Verhältnisse waren in Folge des Zweiten Weltkrieges entstanden, da in dessen Verlauf praktisch alle europäischen Staaten die Sende-frequenzen und Strahlungsleistungen ihrer Rund-funkanstalten nach ihren eigenen Vorstellungen fest-legten und so die formal noch gültigen Wellenpläne von 1933 bzw. 1939 faktisch außer Kraft setzten.12 Das führte dazu, dass die Kanalbreite nicht mehr, wie ursprünglich vereinbart, 9MHz betrug, sondern effektiv »im Durchschnitt nur etwas über 7kHz«.13 Damit verschlechterte sich die Empfangsqualität, da der eigentlich eingestellte Sender gestört war. Zudem arbeiteten eine Reihe von Sendern mit sehr instabilen Frequenzen, so dass sich mitunter sehr große Abwei-chungen von der Nennfrequenz ergaben. Vor diesem Hintergrund gab es neue Bemühungen, für Europa eine brauchbare Wellenverteilung zu finden. Im Sommer 1948 fand in Kopenhagen eine europäische Wellenkonferenz statt, auf der Deutsch-land aber nur durch die Delegationen der Besatzungs-mächte vertreten war, von denen die der USA nur einen Beobachterstatus hatte.14 Infolgedessen ermög-lichten die den vier Besatzungszonen in Deutschland auf dieser Konferenz zugewiesenen Mittelwellenfre-quenzen nur eine Rundfunkversorgung, die sehr in die Nähe des von einigen Ländern für Deutschland geforderten »technischen Minimums« kam.15
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
113
Zwar trat der Kopenhagener Wellenplan, wie vorge-sehen, am 15. März 1950 in Kraft, doch wurden sehr rasch von verschiedenen Rundfunkstationen auch andere als die zugewiesenen Frequenzen benutzt, da der Plan doch nicht alle Erwartungen und Anforde-rungen der Länder erfüllte. Formalen Anlass bot dazu die Ignorierung des Wellenplans durch Luxemburg, das jedoch den Vertrag nicht unterzeichnet hatte.16 Die Schuld an der Verletzung der Vereinbarungen von Kopenhagen schoben sich die Länder der beiden Machtblöcke wechselseitig zu. Recht bald sendeten die Rundfunkanstalten in Deutschland zusätzlich zu den von ihnen regulär zu nutzenden acht Frequenzen noch auf zehn weiteren. Ein Jahr später benutzten allein die Rundfunkanstalten in der Bundesrepu-blik insgesamt 18 außerplanmäßige Mittelwellen-frequenzen.17 Die Rundfunkversorgung in diesem Frequenzbereich konnte auch damit nicht verbes-sert werden. Sie blieb unzureichend, »insbesondere abends, wenn die Wirkung der Raumwellen einsetzte und weit entfernte Gleichkanalsender den Empfang des eigenen Programms störten«.18 Schließlich kam es so weit, dass 1954 schon wieder »in Europa 45% aller Mittelwellen in Abweichung vom Wellenplan genutzt« wurden.19 Mit der Neuverteilung der Mittel- und Langwellenfre-quenzen konnte also keine dauerhafte Lösung für die Rundfunkversorgung in Europa gefunden werden, da
praktisch die Situation vor Inkrafttreten des Wellen-plans erhalten blieb bzw. wiederhergestellt wurde.
Wie verlief der Aufbau des UKW-Rundfunks in der Bundesrepublik?Zur Aufrechterhaltung der Rundfunkversorgung in Deutschland standen verschiedene Varianten zur Debatte. Eine davon war der hochfrequente Drahtfunk. Die Programme wurden bei diesem Verfahren auf einer Frequenz im Langwellenbereich in das Telefonnetz eingespeist und konnten vom Hörer empfangen werden, wenn er über einen Tele-fonanschluss verfügte. Das Signal wurde dazu am Empfänger über eine Frequenzweiche ausgekoppelt und in den Antenneneingang des Rundfunkempfän-gers eingespeist. Eine abgewandelte Variante sah vor, die Sendungen nicht über das Telefonnetz, sondern über die des Lichtnetzes zu übertragen und dazu das Rundfunksignal in den Umspannwerken einzu-speisen. Zwar wären damit, im Gegensatz zum Draht-funk über das Telefonnetz, prinzipiell alle Haushalte zu erreichen gewesen, ungelöst blieb aber die Frage, wie die Sendungen von den Funkhäusern an die Einspeisepunkte hätten übertragen werden sollen.20
Ein weiteres Konzept sah vor, die Sendegebiete mit einem Netz von »Mittelwellenkleinstsendern unter 20kW« zu versorgen.21 Bei dieser geringen Leistung waren zwar kaum Störungen anderer Stationen zu
[3] Professor Werner Nestel gehörte in den Jahren von 1947 bis 1956 als technischer Direktor der Leitung des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) an.
114
erwarten, die Reichweite wäre aber so gering gewesen, »daß Tausende dieser kleinen Sender hätten aufgestellt werden müssen, wenn man sich nicht auf die Versor-gung der Bevölkerungsschwerpunkte beschränken wollte. Auch bei diesem Vorschlag war die Frage der Programmzubringung zu den einzelnen Kleinstsen-dern noch ungeklärt«.22 Aus funktechnischer Sicht bot der Aufbau eines UKW-Rundfunknetzes die beste Aussicht, die durch den Kopenhagener Wellenplan entstandenen Prob-leme zu lösen und sogar Verbesserungen gegenüber den bisher üblichen Übertragungen zu erreichen, erst recht, wenn man statt der Amplitudenmodula-tion (AM) die Frequenzmodulation (FM) verwen-dete. Damit wurde eine Verbesserung der Klangqua-lität möglich, weil ein breitbandigeres Niederfre-quenz-Signal gesendet werden konnte. Zudem ist ein frequenzmoduliertes Signal weniger anfällig gegen atmosphärische Störungen, die hauptsäch-lich amplitudenmodulierend wirken.23 Der UKW-Bereich wurde in Deutschland schon vor dem Krieg, vor allem bei den Fernsehversuchssendungen, benutzt, ohne dass ihm für die Rundfunkversorgung eine Perspektive eingeräumt wurde, nicht zuletzt, weil »die Rundfunkversorgung der Hörer [...] damals durch die Sender auf Mittel- und Langwelle gesichert« schien.24 Dennoch war der Bereich hinsichtlich seiner Ausbrei-tungseigenschaften weitgehend erforscht, da während
des Krieges der UKW-Sprechfunk durch das Militär stark genutzt wurde. Vor allem die relativ kurze Reich-weite von UKW-Sendern stellte sich für die notwen-digen Versorgungsaufgaben als Vorteil dar. Damit war es nämlich möglich, vergleichsweise viele Sender zu betreiben, ohne dass die Gefahr bestand, dass sie sich gegenseitig störten.25 Eine besondere Rolle bei der Entscheidung, ein UKW-Netz in Deutschland aufzubauen, spielte Professor Werner Nestel, der zu dieser Zeit als tech-nischer Direktor des Nordwestdeutschen Rundfunks tätig war. Er war einer der engagiertesten Verfechter dieser Idee, die er schon sehr früh verfolgte, und ohne Zweifel ist es zu einem großen Teil sein Verdienst, dass es überhaupt zur Einführung des UKW-Rund-funks kam.26
Der Aufbau von UKW-Sendern wurde vor allem beim Nordwestdeutschen Rundfunk und beim Bayrischen Rundfunk forciert. Beide Rundfunkanstalten hatten sehr große Sendegebiete zu versorgen, die entweder teil-weise geographisch komplizierte Bedingungen aufwiesen (BR) oder politisch und demographisch sehr inhomogen waren, so dass Forderungen nach einer Regionalisierung der Programme bestanden (NWDR).27
Die ersten zwei Sender mit Leistungen von 250W auf 90,1MHz (München) sowie 100W auf 88,9MHz (Hannover) begannen im Februar/März 1949 zu arbeiten, es folgten bis zum Juni 1949 noch vier weitere. Je ein zweiter strahlte das Programm des BR
(Nürnberg 88,1MHz) und des NWDR (Hamburg 89,6MHz) aus. Beim Hessischen Rundfunk arbeitete ein Sender in Frankfurt/M. auf 94,1MHz und bei Radio Stuttgart, dem späteren SDR, ein Sender auf 89,1MHz. Die Leistungen der neuen Sender betrugen
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
[4] Auf dem Dach der Pädagogischen Hochschule in Hannover wurde 1949 die Antenne des ersten UKW-Senders im Bereich des NWDR errichtet.
[5] Eröffnung des ersten UKW-Senders des NWDR am 1.3.1949 in Hannover. Werner Nestel bei der Pressevorführung.
115
100W (Hamburg), 160W (Frankfurt/M.) bzw. 250W (Nürnberg und Stuttgart).28
Allerdings konnten die Probesendungen vorerst von den Hörern kaum empfangen werden, da praktisch noch keine UKW-fähigen Empfänger zu kaufen waren. Diese Übertragungen dienten vor allem den Entwicklungs-abteilungen der Hersteller als praxis-nahe Hilfsmittel, um neukonstruierte UKW-Empfänger zu testen. So konnten die vom Sender in Hannover ausge-strahlten Programme von den TELE-FUNKEN und der C. LORENZ AG, die in Hannover ansässig waren und von den BLAUPUNKT-Werken in Hildesheim genutzt werden.29 Ebenso war im Raum Nürnberg eine Reihe von Rundfunkunternehmen ansässig, wie GRUNDIG in Fürth und LOEWE-OPTA in Kronach. Besonders intensiv wurde der weitere Sendernetzaufbau im Gebiet des NWDR betrieben. So wurde die Errichtung von insgesamt fünf Sendern mit je 10kW Leistung in Hamburg, Langenberg, Hannover, Oldenburg und Detmold sowie eines Senders in Köln mit 1kW Leistung vorbereitet. Starttermin des zweiten Programms war der 30. April 1950. Zur gleichen Zeit waren die süddeutschen Stationen noch zurückhal-
tender mit ihren Plänen, die sich vorerst auch nicht auf ein baldiges zweites Programm orientierten.30
In dem Maße, wie sich die Empfangsmöglichkeiten im Mittelwellen-Band nach Inkrafttreten des Kopen-
hagener Wellenplanes nicht besserten, wurde für die Rundfunkanstalten die Alternative UKW immer mehr zur einzig sinnvollen Lösung des Problems.Daher begannen die Rundfunkanstalten in der Bundes-republik ab 1951 den »Ausbau des UKW-Netzes«
voranzutreiben.31 Dieser Senderaufbau erfolgte ziemlich stetig. Gleichzeitig verlängerten sich die Sendezeiten. So erweiterte ab Anfang 1951 der NWDR die Sendezeit seines UKW-Programms auf täglich zwölf Stunden.
Das hatte für den Handel den Vorteil, daß nun »UKW während der Hauptgeschäftszeit« in den Läden vorgeführt werden konnte.32 Auch die Rundfunkanstalten im Süden Deutschlands bereiteten ein zweites Rundfunkprogramm vor. Anfang 1951 konnten etwa 600.000 Hörer mit UKW-Sendungen versorgt werden. Von diesen potentiellen Hörern waren aber die wenigsten wirklich im Besitz eines entsprechenden Empfängers, da die Radioindustrie erst in der zweiten Jahreshälfte 1950 begonnen hatte, in größerem Umfang FM-Empfänger auf den Markt zu bringen. Wie verlief die Entwicklung der Rundfunk-empfängertechnik?Auf die von den Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik sehr früh getroffene Entschei-
dung zum Aufbau eines UKW-Rundfunknetzes reagierten die Rundfunkgerätehersteller anfangs mit großer Skepsis. Die Ursachen für die abwartende bis ablehnende Haltung der Unternehmen lagen in der wirtschaftlichen Lage der Branche im Jahr 1949.Infolge der Währungsreform hatte der Absatz an
[6] 10 kW-FM-UKW-Rundfunksender von Telefunken.
116
Rundfunkempfängern zwischen Juli und November 1948 stark zugenommen. Alles in allem entsprach die Produktionsmenge von rund 80.000 Geräten Ende des Jahres bereits wieder der Monatsproduktion von 1936 in ganz Deutschland. Solche Stückzahlen waren aber vor dem Hintergrund der Erwerbs- und Einkommens-situation der privaten Haushalte nicht zu verkaufen, und es entstand ab Januar 1949 eine bis Mitte des Jahres anhaltende Absatzkrise.33 Hauptsächlich waren die Preise für Rundfunkgeräte vor dem Hintergrund eines großen Bedarfs an nahezu allen langlebigen Konsumgütern deutlich zu hoch. Sie lagen Anfang 1949 noch bei etwa 200% des Niveaus von 1936, während die Löhne nur auf etwa 120% gegenüber 1936 gestiegen waren. Da in den Jahren 1949/50 nur ca. 6% des Budgets von privaten Haushalten zur Anschaffung von Hausrat und Ähnlichem zur Verfügung standen, waren für eine Mehrheit von Haushalten die Kosten von bis zu 500,- DM für einen Rundfunkempfänger kaum aufzubringen.34 Der Beginn der UKW-Einführung fiel genau in diesen Zeitraum der krisenhaften Situation in der Branche und wurde deshalb von den Herstellern und den Händlern zuerst eher abgelehnt als begrüßt. In dieser Situation boten die Hersteller 1949 noch keine UKW-Empfänger an, obwohl in einigen Gebieten bereits Empfangs-möglichkeiten für UKW-Sendungen bestanden. Erst um die Jahreswende 1949/50 nahmen einige Unter-
nehmen Vorschaltgeräte in ihr Produktionsprogramm auf, mit denen herkömmliche Rundfunkgeräte für den UKW-Empfang erweitert werden konnten.35 Ange-sichts der anfänglichen Zurückhaltung der Rundfunk-gerätehersteller forcierten die Rundfunkanstalten die
Werbung für den UKW-Rundfunk unter anderem mit einem an die Radiobastler gerichteten Wettbewerb für UKW-Empfänger.36 Zugleich begann eine syste-matische Informationsarbeit der Rundfunkanstalten, um in Zusammenarbeit mit der Presse die Hörer über die Vorteile des UKW-Rundfunks und Neuerungen bei den Empfängern zu informieren. Vorreiter war die Programmzeitschrift »Hör zu«, deren Chefredakteur Eduard Rhein den Begriff »Welle der Freude« für den UKW-Rundfunk prägte.37
Bei der Markteinführung von UKW-Empfängern durch die Unternehmen wurden zwei verschiedene Wege beschritten. Es wurden sowohl kombinierte AM/FM-Empfänger als auch spezielle Vorschaltgeräte und Module angeboten, die vorhandene AM-Geräte für den UKW-Empfang erweitern konnten. Vorschalt-geräte waren im Prinzip universal anzuwenden, da sie über den Tonabnehmeranschluss des Empfängers mit diesem verbunden wurden, während die Module zur Nachrüstung speziell dafür vorgesehener Geräte dienten. Damit war es den Kunden möglich, zuerst, solange in ihrer Nähe noch kein UKW-Sender arbei-tete, einen herkömmlichen Empfänger zu erwerben und diesen später bei Bedarf zu erweitern. Während das Sendernetz ausgebaut wurde, konnten die Rundfunkgerätehersteller den anfänglichen Rück-stand bei der Empfängerproduktion aufholen. Ab dem Jahrgang 1951/52 hatte sich der UKW-Bereich
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
[7] Karte der UKW-Sender in beiden deutschen Staaten 1959.
117
im Angebot an Heimempfängern weitgehend durchgesetzt, wobei die Preise der kombinierten Geräte nur geringfügig über denen für Nur-AM-Empfänger lagen.38
Wie nahmen die Hörer den UKW-Rundfunk und die zweiten Programme an?Der UKW-Rundfunk konnte nur dann erfolgreich eingeführt werden, wenn sich die Hörer UKW-fähige Empfänger anschafften und die Geräte auch auf die zusätzlichen Programme abstimmten. In den Jahren 1950/51 verlief der Absatz von UKW-Geräten relativ zöger-lich, was in erster Linie auf die noch nicht flächen-deckende Senderdichte zurückzuführen ist. Konnten die Händler aber die Geräte bei guten Empfangsbe-dingungen vorführen, beschleunigte dies den Absatz wesentlich39. Vor allem war aber in der Anfangszeit »das Programm der UKW-Sender [...] nicht anziehend genug«40, solange im Grunde nur das Mittelwellenprogramm, zum Teil zeitversetzt, gesendet wurde. Die Ausstrah-lung eines eigenständigen zweiten Programms bildete daher oft einen entscheidenden Grund für die
Kunden, sich schon sehr früh einen UKW-Empfänger anzuschaffen. »Es gibt Kunden, für die das zweite Programm so wichtig ist, daß es den Kauf eines Empfängers mit UKW entscheidet«.41 Das war umso mehr der Fall, wenn sowohl UKW- als auch Mittel-wellensendungen gut empfangen werden konnten. Das belegen demoskopische Untersuchungen, die zur Rezeptionsentwicklung bei den UKW-Programmen vom Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach
vornehmlich für den Süddeut-schen Rundfunk (SDR) ange-stellt wurden.42
Die über den Zeitraum von 1951 bis 1959 durchgeführten Befra-gungen belegen eine relativ große Bereitschaft, sich einen UKW-Empfänger anzuschaffen und ein stetiges Anwachsen der Zahl der UKW-Empfänger in den Haushalten. Zwischen 1951 und 1954 planten jährlich 12 bis 14% der Haushalte, sich innerhalb eines Jahres ein solches Gerät zu kaufen.43 Andererseits zeigte sich, dass anfänglich, obwohl das UKW-Programm zu empfangen
war, ein relativ großer Teil der Hörer, die einen UKW-fähigen Empfänger besaßen, den SDR »nur auf Mittel-welle« hörten.44 Zwischen März 1951 und Dezember 1952 waren das bei insgesamt drei Befragungen jeweils zusammen 60%, 47% beziehungsweise 41%.45 In dem Maße, wie sich die Empfangsbedingungen im UKW-Bereich verbesserten, die Hörer mit der Bedie-nung der neuen Geräte vertrauter wurden und sich an das durch die größere NF-Bandbreite veränderte Klangbild gewöhnten, wurde es ab 1956 kaum noch registriert, »daß die Besitzer von UKW-Geräten nur
118
[8] Grundig Radioempfänger 298W von 1950/1951. Der Apparat besitzt einen nachgerüsteten UKW-Empfänger.
auf Mittelwelle« hörten.46
Da es bei der UKW-Einführung den Rundfunkan-stalten nicht nur darum gegangen war, das bisherige Programm besser zu verbreiten, sondern auch noch ein zusätzliches anzubieten, war es für die Anstalten von Interesse, zu erfahren, wie dieses Angebot ange-nommen wurde. Die Umfrageergebnisse zeigten, daß dies gleichfalls sehr zögernd begann. Für 1952 ermit-telte das IfD, dass nur 5% der Hörer auch das Zweite Programm des SDR einschalteten. Danach erhöhte sich der Prozentsatz aber stetig, und 1954 hörten 69% der Hörer mit einem UKW-Empfänger irgend-wann am Tage auch einmal das Zweite Programm. 42% nutzen es täglich oder fast täglich.47 Im Zuge dieser Befragungen wurde deutlich, dass ein erheblicher Teil der Hörer des SDR anfänglich das Zweite Programm für zweitklassig, also weniger gut gehalten hat. Daraufhin änderte die Rundfunkanstalt die Bezeichnungen »Erstes Programm« und »Zweites Programm« in »Mittelwellenprogramm« und »UKW-Programm«.48 Hier wurde deutlich, dass eine wesent-liche Voraussetzung für die UKW-Akzeptanz die Existenz eines (für die Hörer ansprechend gestal-teten) zweiten Programms war. Dies unterstreicht eine bundesweite Stichtagbefragung, die das IfD
1953 durchgeführt hatte. Zu dieser Zeit »hatten im Bereich des Nordwestdeutschen Rundfunks zwei Drittel und im Bereich des Bayerischen Rundfunks und des Südwestfunks rund drei Fünftel aller Hörer mit UKW-Empfangsmöglichkeit auch UKW gehört. Im Bereich des Hessischen Rundfunks hatte jeder zweite Besitzer eines Apparates mit UKW-Empfang sein Gerät irgendwann auf UKW eingestellt. Im Bereich des Süddeutschen Rundfunks aber hatte sich nur weniger als ein Drittel derjenigen Hörer, die dazu die Möglichkeit hatten, zum Empfang entschlossen«.49 Zu diesem Zeitpunkt strahlten der NWDR und das
SWF ihr zweites Programm bereits tagsüber aus. Der BR, der SDR und der HR sendeten nur abends ein spezielles zweites Programm. Des Weiteren wurde deutlich, dass die zweiten Programme nur als attraktiv wahr-genommen wurden, wenn sie unterhaltenden Charakter hatten. Ihre anfängliche Ausrich-tung als Kulturprogramme »(nach Art des Dritten Programms der BBC)« entsprach dem Publikumsinteresse weniger.50
Diese Erkenntnisse wurden von späteren Untersu-chungen im Jahr 1955 untermauert, nach denen von den Hörern des Zweiten Programms des SDR beson-ders in den Abendstunden die leichte Musik bevor-zugt wurde. Aus verschiedenen Stichtagsbefragungen in jenem Jahr leitete das Institut eine Reihe von
Bedingungen ab, die dazu führten, dass die Hörbetei-ligung am Zweiten gegenüber dem Ersten Programm überwog:»1. Die erfolgreichen Sendungen sind leicht und unter-
haltend gewesen.2. Sie kontrastierten mit dem Ersten Programm des
Süddeutschen Rundfunks.3. Programme anderer Sender waren für Hörer
anscheinend nicht sehr verlockend.4. Diese Sendungen waren alle von längerer Dauer
(mindestens eine Stunde). Andere Programme, die lediglich diese letzte Bediengungen nicht erfüllen, scheinen in der Regel geringeres Publikum zu haben.«51
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
[9] Kaiser UKW-Spezial W1131. Kompakter Radioempfänger der ausschließlich für den UKW-Empfang konzipiert wurde.
119
Für den Erfolg der neuen Programmangebote, die mit dem UKW-Rundfunk entstanden, war der Umstand, dass die Programme möglichst flächendeckend ausge-strahlt wurden und die Hörer einen UKW-fähigen Empfänger besaßen, nicht allein ausschlaggebend. Entscheidend war, dass die neuen Programme den inhaltlichen Erwartungen der Hörer gerecht wurden. Das von Eduard Rhein formulierte Motto »Die Welle der Freude« wollten die Hörer in den Programmbei-trägen bestätigt finden.Welchen Weg der Einführung des UKW-Rundfunks
ging man in der DDR?In der DDR wurde nach Ende der Kopenhagener Wellenkonferenz in allen zuständigen Gremien, zumindest offiziell, die These vertreten, die neue Frequenzverteilung würde nicht in Kraft treten. Anlass zu dieser Annahme boten sowohl die Position der UdSSR zum Kopenhagener Wellenplan, als auch die in mehreren Ländern geführten Diskussionen über die Umsetzung des Planes.52 Folglich wurden in der DDR auch keine Vorkehrungen getroffen, um ab März 1950 eine Unterversorgung des Landes im Rundfunkbe-reich zu vermeiden, sieht man von der Bitte der DDR-Regierung an die der UdSSR ab, eine Langwellenfre-quenz zur Verfügung zu stellen. Die damit verfolgte Absicht war es, die Ausstrahlung des Programms des Deutschlandsenders in die BRD sicherzustellen.53 Alle übrigen Maßnahmen zum Auf- und Ausbau von Sendeanlagen des Rundfunks waren in der DDR Anfang der 1950er Jahre in erster Linie auf das Ziel ausgerichtet, die Empfangs-möglichkeiten westdeutscher Sender und besonders des RIAS, auszuschließen oder wenigstens zu minimieren. Dafür wurden erhebliche Produktionskapazitäten sowie materielle und finanzielle Mittel verbraucht, die für andere Projekte fehlten.54
Dadurch verzögerte sich der Aufbau von UKW-Sendernetzen für die Programme des DDR-
Rundfunks. Mitte 1953, als in der Bundesrepublik bereits eine weitgehend flächendeckende Versorgung mit UKW-Sendungen möglich war, arbeiteten in der DDR erst fünf Sender mit jeweils einer Sendeleistung von 250Watt. Vom Brocken wurde auf 94,5MHz, vom Inselsberg auf 94,0MHz, in Berlin auf 92,5MHz, in Schwerin auf 89,2MHz und in Leipzig auf 88,0MHz gesendet.55 Auch in den folgenden Jahren änderte sich an dieser Situation wenig, nicht zuletzt, weil die begonnenen Bauprojekte immer wieder durch tech-nische Schwierigkeiten und Produktionsrückstände der bauausführenden und Liefer-Betriebe verzögert wurden.56
Eine vorübergehende Intensivierung des UKW-Aufbaus trat ein, nachdem im Mai 1952 im Ministe-rium für Post- und Fernmeldewesen eine Hauptver-
waltung Funkwesen gebildet worden war, der die gesamte Planung, Koordi-nierung und Realisierung der Sender-bauprogramme übertragen wurde.57 Bis 1956 wurden acht zusätzliche Sender in Betrieb genommen, danach stagnierte der Aufbau erneut und wurde erst ab 1958 wieder forciert. Die Verzögerungen der Jahre 1956/57 fielen zusammen mit einer neuerlichen Umstrukturierung im Minis-terium für Post- und Fernmeldewesen,
die auf einem Ministerratsbeschluss vom 23. Februar
[10] UKW ULEI 52/IV W: Nachrüstmodul für den UKW-Empfang
120
1956 beruhte. Das Ziel dieser Reorganisation war die »schnelle Überwindung der technischen Rückständig-keit auf dem Gebiete des Hörrundfunks und Fernse-hens ... und [die] Koordinierung aller Maßnahmen auf diesem Gebiet«.58 Dazu wurde unter anderem ein
spezieller Bereich Rundfunk und Fernsehen formiert, der aber einige Zeit benötigte, um wirksam handeln zu können.Die Standortwahl für die bis 1956 aufgestellten Sender war nur teilweise nach funktechnischen Gesichts-
punkten erfolgt. Lediglich die beiden Anlagen auf dem Brocken und dem Inselsberg hatten eine Lage, von der aus ein relativ großes Gebiet versorgt werden konnte. Insbesondere die Aufstellung von Sendeanlagen in Berlin und Leipzig erfolgte hingegen mehr anhand politischer Prämissen. Ein Gesamtplan für den Netz-aufbau wurde erst nach Bildung des Bereiches Rund-funk und Fernsehen ausgearbeitet.59 Vor allem auf Grund der an funktechnischen Kriterien ausgerichteten Senderaufstellung verbesserte sich die Versorgung mit UKW-Programmen erheblich, wenngleich auch 1960 noch immer kein flächendeckendes Angebot sicherge-stellt werden konnte. Der Deutschlandsender war auf 65% der Fläche der DDR auf UKW zu empfangen, das Programm Radio DDR I auf nur 15%, Radio DDR II auf 50% und der Berliner Rundfunk auf 60% der Fläche, vor allem aber im Berliner Umland. Ergänzt wurde diese Abdeckung noch durch Mittelwellen-sender.60
Die Verzögerungen beim Bau der Sender waren häufig auf Lieferprobleme bei Technik und Material zurück-zuführen. Durch die Einbindung der Betriebe aller Wirtschaftszweige in das Plansystem war es nur schwer möglich, auf solche Störungen zu reagieren. Zwar entstand mit den Jahren in der DDR ein ausge-prägtes informelles System der Kompensation von Engpässen; bei solch komplexen Investitionsobjekten wie dem Aufbau eines flächendeckenden Sendernetztes
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
[12] Radioempfänger »Türkis« vom VEB Stern Radio Rochlitz (1961/1962).
121
war es aber kaum wirksam, da damit nur punktuelle Schwierigkeiten zu lösen waren. Eine Alternative für den Verlauf der Entwicklung hätte nur bestanden, wenn die Einführung des UKW-Rundfunks mit einer hohen Priorität von Seiten der Führung der SED betrieben worden wäre. Das war aber nicht der Fall. Die Aufmerksamkeit der Parteispitze lag weitaus stärker zum einen bei den Projekten zur Einschrän-kung der Empfangsmöglichkeiten westdeutscher Sender und zum anderen bei der inhaltlichen Gestal-tung der Rundfunkprogramme der DDR.61
Erst als Ende der fünfziger Jahre immer deutlicher wurde, dass die Rundfunktechnik in der DDR weit hinter der internationalen Entwicklung (den Vergleichsmaßstab lieferte hier in erster Linie die Bundesrepublik) zurückgeblieben war, beschäftigte sich auch die Parteiführung intensiver mit der Rund-funktechnik. Frühere Berichte aus dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen und dem für die Rundfunkempfängerproduktion zuständigen Minis-terium für Maschinenbau waren weitgehend folgenlos geblieben.62
Wie wurde die Produktion von Rundfunkemp-fängern in der DDR umgestellt?Demgegenüber verlief die Umstellung der Produk-tionspalette auf UKW-Empfänger rascher als der Senderaufbau und damit fast unabhängig von
diesem. Schon 1951 wurden einige UKW-Empfänger auf der Leipziger Messe ausgestellt. Zwischen 1951 und 1955 nahm der Anteil UKW-fähiger Empfänger stetig zu, zugleich wurden auch Vorschaltgeräte und Einbaumodule entwickelt. Waren 1951 nur 10% der im Handel angebotenen Modelle in der Lage, UKW-Programme zu empfangen, machten diese Geräte ein Jahr später 38% des Modellangebotes aus, 1953 sogar schon 70%.63
Der Anteil der vom Handel bei den Herstellern geor-derten Mengen an AM/FM-Empfängern war indes in diesem Zeitraum etwa gleich groß wie der Anteil an reinen AM-Empfängern.64 Dieser Widerspruch zwischen dem Modellspektrum und den georderten Mengen deutet auf eine geringere Nachfrage nach UKW-Empfängern hin. Diese muss als Folge der unzureichenden und langsamen Verbreitung des UKW-Rundfunks angesehen werden. Gleichwohl kann die Einführung der UKW-Technik bei Rund-funkempfängen in der DDR im Jahr 1955 als abge-schlossen angesehen werden. Ab diesem Zeitpunkt waren 90% der angebotenen Empfänger mit einem UKW-Teil ausgestattet.65
Allerdings stellte sich der für die DDR-Wirtschaft häufig festzustellende Umstand ein, dass sich eine Schere zwischen der Entwicklung und Produktions-planung neuer Erzeugnisse auf der einen Seite und ihrer tatsächlichen Fertigung und Verfügbarkeit für
die Kunden auf der anderen Seite auftat, weil die Produktion nicht wie vorgesehen anlief. Die Ursache dafür lag häufig in Lieferschwierigkeiten der Zulie-ferbetriebe. In der Rundfunkgeräteindustrie traten solche Krisensituationen nahezu permanent bei Röhren, Lautsprechern und Gehäusen auf.66
Die Aufstellung von UKW-Sendern und die Umstel-lung der Rundfunkempfängerproduktion auf UKW-fähige Geräte verliefen also in der DDR im umge-kehrten Verhältnis zueinander als in der Bundesrepu-blik. Während im Westen Deutschlands der Senderbau und damit das Programmangebot im UKW-Bereich der Empfängerproduktion voraus liefen, blieb der Aufbau von UKW-Sendern in derDDR in der Einführungsphase des UKW-Rundfunks bis Mitte der 1950er Jahre hinter den Veränderungen im Angebot an Rundfunkempfängern zurück.
Was ist an der Einführung des UKW-Rundfunks verallgemeinerbar?Die hier skizzierte Einführung des UKW-Rundfunks in Deutschland zeigt recht deutlich, dass die Entwick-lung des Rundfunks sehr häufig nicht in erster Linie durch Impulse aus Naturwissenschaft und Technik beeinflusst wurde. Politische Gegebenheiten, wirt-schaftliche und soziokulturelle Faktoren bildeten stattdessen oft die prägenden Randsetzungen.Es war eine Folge der politischen Verhältnisse
122
in Deutschland und Europa nach dem Ende der NS-Diktatur, dass einerseits ein stark ausdifferen-ziertes Rundfunksystem mit vielen Programmen in Deutschland entstanden war und andererseits im Kopenhagener Wellenplan diesen Gegebenheiten nicht Rechnung getragen wurde. Den Ausweg aus dem damit entstandenen Dilemma bot die UKW-Funktechnik, die zu etablieren aber erhebliche wirt-schaftliche Probleme für die Programmanbieter, die Rundfunkgerätehersteller und die Käufer nach sich zogen. Konnten diese nicht bewältigt werden, verzö-gerte sich die UKW-Einführung, wie Mitte der 1950er Jahre in der DDR. Und schließlich mussten die Hörer das neue Angebot auch akzeptieren, sollte es ein Erfolg werden.Erfindungen und Entdeckungen, wie die von Hein-rich Hertz allein sind keine Garant dafür, dass aus ihnen etwas Nützliches entsteht. Andererseits gäbe es ohne Hertz und alle, die seine Forschungsergebnisse weiter entwickelten, auch keinen Rundfunk.
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
[13] Senderskala des Kaiser UKW-Spezial W1131.
123
Bildnachweise
Umschlag außen:Titelbild: magoodesign – markus kahlenberg
Übrige Bilder: Deutsches Museum
Umschlag innen: Karten – Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn
Heinrich Hertz – Eine biographische SkizzeTitelbild: Deutsches Museum (Heinrich Hertz) und Karl-Heinz Althoff (Briefmotiv)Deutsches Museum: Abb. 1 – 7, 9, 10, 11 – 14 – 20, 22, 23.Zeichnung von Torsten Klockenbring: Abb. 8, 16, 21. Zeichnung von Heinrich Hertz: Abb. 15.
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Vom öffentlichen Umgang mit Heinrich Hertz und seiner Familie im NationalsozialismusTitelbild: Deutsches Museum (Heinrich Hertz) und Markus KahlenbergDeutsches Museum: Abb. 1 – 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Das neue Noraghaus Hamburg, Berlin u. a. 1930, nicht paginiert: Abb. 5. Dr. Karl Mey zum 60. Geburtstage, in: Zeitschrift für technische Physik 20 (1939): Abb. 8. Deutsches Rundfunk Archiv: Abb. 6.Eve, A. und Cedwick, J.: Orbituary Notice: Lord Rutherford, in: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1938: Abb. 14.
»Originale Kopien« Hertz‘ Bonner VermächtnisTitelbild: Deutsches MuseumDeutsches Museum: Abb. 1, 3, 8, 9, 11, 13 – 16, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30. Ralph Syttkus: Abb. 2 und 4.Karl-Heinz Althoff: Abb. 10, 12, 25, 26, 31.
127
Michael Kortmann: Abb. 17, 19. Marc Jumpers: Abb. 5. Fritz Milkau: Abb. 6.Zeichnung von Torsten Klockenbring: Abb. 7.Jörg Bradenahl: Abb. 22 und 23. Physikalisches Institut der Universität Bonn: Abb. 24.
Exkurs: Alles StrahltGrafiken von Jörg Bradenahl
Der lange Weg zu Hertz Titelbild: Jörg BradenahlDeutsches Museum: 1 – 4, 6 – 8, 10 – 15, 20, 21. Jörg Bradenahl: Abb. 5, 9a und 9b, 16, Schwingkreis-Grafik und Grafik des Versuchsaufbaus von Heinrich Hertz.Karl-Heinz Althoff: Abb. 18. Markus Kahlenberg: Thomsonsche Schwingungsgleichung. Zeichnung von Torsten Klockenbring: Abb. 22. Zeichnung von Heinrich Hertz: Abb. 23.
Vom Funkensprung zur RadiowelleTitelbild: Deutsches MuseumDeutsches Museum: Abb. 1 – 7.Jörg Bradenahl: Radio-Grafik
128
Bildnachweise
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kamTitelbild: Markus KahlenbergMarkus Kahlenberg: Abb. 1.Deutsches Museum: Abb. 6Heinz Schulz: Abb. 7 NDR: Abb. 3, 4, 5.Funktechnik Nr. 24 (1948): Abb. 2 .Eddy Nußbaum, Privates Radiomuseum Bonn: Abb. 8 – 13.
129
Anmerkungen
So beispielsweise noch das ZDF 2007 auf der inzwischen nicht 1
mehr abrufbaren Internetseite http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/20/0,1872,7000468,00.html-26. Dazu auch: Wenkel, Simone: Jewish Scientists in German Speaking Academia in Charpa, Ullrich und Deichmann, Ute (Hg.): Jews and Sciences in German Contexts, Tübingen 2007, S. 265-295, hier: S. 280. 2 Volkov vertrat die gegenteilige These: Volkov, Shulamit: Soziale Ursachen des Erfolgs in der Wissenschaft. Juden im Kaiserreich, Historische Zeitschrift, 245 (1987), S. 315-342 bzw. in Idem, Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert, München 1990, S. 146-165. Später hat die Autorin dies wieder relativiert: Volkov, Shulamit: Juden als wissenschaftliche Mandarine in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik, Archiv für Sozialgeschichte, 37 (1997), S. 1-18. Laut jüdischem Religionsgesetz ist das Kind einer jüdischen Mutter 3
Jude. Das traf zuletzt auf den Vater von Heinrich Hertz bis zu dessen Taufe zu. Die später erwähnten Nürnberger Gesetze als Ausdruck des staatlichen Antisemitismus hätten ihn zu einem „Mischling“ gemacht. Siehe zu der Familiengeschichte mit Angabe von Quellen: 4
Wolff, Stefan L.: Die Familie Hertz – eine nichtjüdische Wissenschaftlerfamilie mit jüdischem Namen, in G. Wolfschmidt (Hg.), Heinrich Hertz (1857-1894) – Life an Impact, Norderstedt 2008, S. 252-273. Fölsing, Albrecht: Heinrich Hertz. Hamburg 1997, S. 21-22.5
Ebd., S. 33.6
Ebd., S. 55-57.7
„Jüdische Deutsche“ als Begriff des Selbstverständnisses von 8
Deutschen, die dem Judentum angehörten. Ende des 19. Jahrhunderts kam es vor diesem Hintergrund zu der Gründung einer Interessenvertretung unter der Bezeichnung „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.“ Messerschmidt, Manfred: Juden im preußisch-deutschen 9
Heer, in: Nägler, Frank (Hg.): Deutsche jüdische Soldaten. Hamburg u. a. 1996, S. 39- 62, hier: S. 47.
Oskar von Miller (Deutsches Museum) an Reichsrat Ferdinand 10
Freiherr v. Miller, Direktor der Akademie der bildenden Künste, 23.3.1916; Blohm an Deutsches Museum, 11.5.1916. Blohm hatte als Spender anonym bleiben wollen und war aber, wie er selbst erwähnt, von Edmund Siemers als solcher genannt worden, beide DMA VA 2165. Hoepke, Klaus-Peter: Die Universität Fridericiana Karlsruhe 11
und Hertz, Fridericiana Zeitschrift der Universität Karlsruhe 41 (1988), S. 59-79, hier: S. 61-62. Bredow, Strecker und Wolff (Gründungsausschuss), 12
Gründungsaufruf, 15.5.1924, DMA VA 144/2, siehe auch Bredow (Staatssekretär im Reichspostministerium) an Oskar von Miller, 6.5.1924, ebd. Burstyn, W.: Aus der Großen Deutschen Funkausstellung 1928 13
in Elektrotechnische Zeitschrift 49 (1928), S. 1504-1507, hier: S. 1504. Abbildung des Raumes in Puls und Richter: Das neue Noraghaus 14
Hamburg. Berlin u. a. 1930., nicht paginiert. Der Künstler war Ludwig Kunstmann. Hinweis aus Wagner, Hans-Ulrich: Gehirn einer Stadt. Vor 80 Jahren wurde das neue Funkhaus in Hamburg seiner Bestimmung übergeben in Rundfunk und Geschichte 37.1-2 (2011), S. 53-55. Siehe auch Puls und Richter an das Deutsche Museum, 18.12.1929, DMA VA 0144/1. Kohut, Adolph: Berühmte Israelitische Männer und Frauen in der 15
Kulturgeschichte der Menschheit. Lebens- und Charakterbilder aus Vergangenheit und Gegenwart. Ein Handbuch f. Haus u. Familie. Zwei Bände. Leipzig-Reudnitz 1900/1901, Band 2, S. 234. Heppner, Ernst: Juden als Erfinder und Entdecker. Berlin-16
Wilmersdorf 1913, S. 46. Auch Wininger, Salomon: Große jüdische National-Biographie mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter jüdischer Männer und Frauen aller Zeiten und Länder. Ein Nachschlagewerk für das jüdische Volk und dessen Freunde, 7 Bände. Czernowitz 1925-1936, Band 3, S. 70.
Grunwald, Max: Juden als Erfinder und Entdecker, Ost und 17
West, 13 (1913), Nr. 9 Sp. 703-712 und 743-758; Nr. 10, Sp. 809-812; Nr. 11, Sp. 875-884, hier: Nr. 11, Sp. 877. Das ist mitunter als Akt des „Widerstands“ missverstanden 18
worden. Hoepke, S. 65, beispielsweise würdigt in diesem Sinn zwei Autoren von entsprechenden Zeitschriftenbeiträgen über Hertz. Hadamovsky, Eugen: Dein Rundfunk. Das Rundfunkbuch für alle 19
Volksgenossen. München 1934, S. 111. Die Gesellschaftsberichte wurden in der Zeitschrift für 20
Elektrische Nachrichtentechnik abgedruckt. Zuletzt in 11 (1934), S. 67-73 vom November 1933. Danach gab es nur noch eine kurze Vorstandsnotiz in 12 (1935), S. 36, wobei der Name von Heinrich Hertz fortgefallen war: „Gesellschaft zur Förderung der Funkwesens e. V.“ Aber in den folgenden Jahresbänden taucht sie gar nicht mehr auf. Hoepke, S. 76.21
Das wird durch Erwähnungen in den Katalogen belegt. So z. B in: 22
Rundgang durch die Sammlungen, 7. Auflage 1942, S. 115. Der Direktor des Museums Bäßler antwortete Laue auf die Anfrage vom 7.2.1956, ob die Büste noch existiere, am 10.2.1956, sie sei unversehrt durch den Bombenkrieg gekommen, DMA VA 2165. Zenneck an Matschoß, 3.2.1938, DMA VA 959/2.23
Physikalisches Institut der TH Karlsruhe an die Bibliothek des 24
Deutschen Museums, 24.1.1938, DMA VA 959/2. Hoepke, S. 73-74.25
Mey an Debye zur Kenntnisnahme, 6.7.1938, MPGA, III. Abt., Rep. 26
19, NL Debye, Nr. 1006, Bl. 13. REM an Deutsche Gesellschaft für technische Physik, Abschrift für Zenneck, 19.7.1938, DMA NL Zenneck 013/7. Hoepke, S. 75. Bei dem (NS-)Dozentenbund handelte es sich 27
um eine offizielle Parteigliederung an den Hochschulen und Universitäten.
Jüdische oder nichtjüdische Deutsche? Von Stefan L. Wolff
133
Damit sind die „Deutsche Physikalische Gesellschaft“ und die 28
„Deutsche Gesellschaft für technische Physik“ gemeint. Zeitschrift für technische Physik 19 (1938), S. 614.29
Zusatz für Zenneck in Anschrift von REM an Deutsche Gesellschaft 30
für technische Physik, Abschrift für Zenneck, 19.7.1938, DMA NL Zenneck 013/7. Zenneck vermutete, das Ministerium sei dabei einer Empfehlung von 31
Dr. Claus Hubmann, dem technischen Direktor der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, gefolgt: Zenneck an Esau, 22.8.1938, DMA NL Zenneck 012/14. REM (Dames) an Zenneck, 18.8.1938, DMA NL Zenneck 013/7. Später 32
erwähnte Zenneck noch, dass er dies mit ausdrücklichem Auftrag des REM tun sollte: Zenneck an Matschoß, 16.9.1940, DMA VA 959/3. Zenneck, Bericht über die 6. Generalversammlung der Union Radio-33
Scientifique Internationale, DMA NL Zenneck 013/7. Ebd., vgl auch Schmucker, Georg: Jonathan Zenneck 1871-1959, 34
Stuttgart 1999, S. 454-455. Hoepke S. 68-71.35
Hublow, W.: Heinrich Hertz in seinem Wirken und Schaffen unter 36
besonderer Berücksichtigung seiner rassischen Gebundenheit, Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft, 4.1 (1938), S. 386-388, hier: S. 387. Kubach, Fritz: Philipp Lenard der deutsche Naturforscher. Sein Kampf 37
um nordische Forschung, München/Berlin Lehmanns 1937, S. 26-28. Lenard, Philipp: Große Naturforscher, München 1941, S. 330.38
Walk, Joseph (Hg.): Das Sonderrecht für Juden im NS-Staat, 39
Heidelberg 1981, S. 235. Laue an Elisabeth Hertz, September 1937, Privatarchiv Christa 40
Hertz, nach Jaeger, Siegfried: Vom erklärbaren, doch ungeklärten Abbruch einer Karriere – Die Tierpsychologin und Sinnesphysiologin Mathilde Hertz (1891-1975), in: Gundlach, Horst: Untersuchungen zur Geschichte der Psychologie und der Psychotechnik. München 1996, S. 229-262, hier: S. 255. Hilscher, Hans-G.: Kieler Straßenlexikon, Kiel 2011, S. 83.41
h t t p : //s t a d t p l a n . b o n n . d e /s t r a s s e n _ a u s k u n f t .42
php?strasse=1010736.http://w3.siemens.de/siemens-stadt/grammst0.htm43
Zu der Person Gönningen siehe Schlitzer Bote vom 2.1.2007, 44
Gegen das große Vergessen. Eine Nachbetrachtung zum Jahre 2006. Der Beitrag beruht auf Unterlagen aus dem Nachlass von Gönningen.Gönningen an Reichspropagandaministerium zu Händen Dr. 45
Ziegler, 19.9.1938, BA NS 14/51 Nr. 81. Hinweis auf die Firma Lorenz verdanke ich F. Kumpf, Schlitz, 46
auch: Gönningen, Der Papier-Kondensator, 1956. Köhns, Reichshauptstellenleiter des Hauptamts für Technik, an 47
Dr. Lühr von der Fachgruppe „Elektrotechnik, Gas und Wasser“, 21.10.1938, BA NS 14/51 Nr. 81. VDE an Dr. Lühr, 7.11.1938, ebd.48
Ebd.49
Dr. Lühr an Hauptamt für Technik, 15.11.1938, ebd.50
Propagandaministerium an Hauptamt für Technik, 26.10.1938 51
und 11.1.1939, ebd. Streck vom Hauptamt für Technik an den Stellvertreter des 52
Führers im Braunen Haus, 25.1.1939, ebd. Übernahme der Anfrage im Antwortschreiben: VDE an 53
Hauptamt für Technik, 8.11.1939, ebd. Streck vom Hauptamt für Technik an den Stab des Stellvertreters 54
des Führers im Braunen Haus, 20.11.1939, ebd. Ebd.55
Debye an die Vorstandsmitglieder der DPG (17 Anfragen), 56
29.11.1939, MPGA, III. Abt., Rep. 19, NL Debye, Nr. 1017, Bl. 35; Zusammenstellung von Auszügen aus elf Antworten, ebd., Bl. 36-39, undatiert. Auf Blatt 37 steht dagegen, dass nur vier Anfragen unbeantwortet geblieben seien. Vollständige Antwort von Zenneck: Zenneck an Debye, 7. 12. 1939, DMA NL Zenneck 12/29. MPGA, III. Abt., Rep. 19, NL Debye, Nr. 1017, Bl. 37.57
Tießler an Stab der Stellvertreter des Führers, 26.3.1941, BA 58
NS 18 alt/776. Witt an Tießler, 15.8.1941, BA NS 18 alt/776. Vorherige 59
Anfragen: Tießler an Witt, 24.4, 28.5. 26.6., und 26.7.1941; Tießler an Bühler, 10.7.1941, Aktenvermerk, 11.7. 1941; Notiz für Tießler, 5.8.1941; ebd.
VDE an Hauptamt für Technik, 17.12.1941, BA NS 14/51 Nr. 60
81. Jaeger, S. 240.61
M. Hertz an ihren unmittelbaren Vorgesetzten R. Goldschmidt, 62
19.7.1933, MPGA, KWI für Biologie. Abt. R. Goldschmidt, I. Abt. Rep 1A, Nr. 534; nach Jaeger, S. 243. Planck an den Reichsminister des Inneren, 21.7.1933, nach 63
Jaeger, S. 244, auch Schüring, Michael: Minervas verstoßene Kinder. Göttingen 2006, S. 56. Planck an den Reichsminister des Inneren, 21.11.1933, MPGA,, 64
nach Jaeger S. 244-245.Jaeger, S. 245.65
Adams (Academic Assistance Council) an Whitehall, 22.1.1936, 66
Archive SPSL Bodleian Library Oxford, 432/2, 329; nach Jaeger, S. 250-251.Rutherford an Adams, 15.11.1935, nach Jaeger, S. 250.67
Elisabeth Hertz an Laue, 3.10.1937, DMA HS 1937/12. Elisabeth 68
Hertz schildert darin noch ihre Erinnerung an die Entdeckung ihres Mannes. Laue betrachtete dies als ein wichtiges „tiefergreifendes“ Dokument und überantwortete es bald darauf dem Deutschen Museum. Wegen der Erwähnung der Emigration betrachtete Laue diesen Brief – anders als Zenneck – als problematisch und vergewisserte sich, dass er erst nach Ablauf einer 30jährigen Sperrfrist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfte. Laue an Zenneck, 17.10.37; Zenneck an Laue, 26.10.1937; beide DMA NL Zenneck 40/3. Jaeger, S. 251-253.69
Hertz, Mathilde und Susskind, Charles (Hg.): Erinnerungen, 70
Briefe, Tagebücher, 2. Auflage. Weinheim 1977.Es existiert eine Biographie: Kuczera, Josef: Gustav Hertz. 71
Leipzig 1985.Zenneck an Himstedt am 4.4.1927, DMA, NL Zenneck, Kasten 72
38. Stark an Deutsche Dozentenschaft, 8.11.1934 nach Schröder, 73
Reinald: Die schöne deutsche Physik von Gustav Hertz und der weiße Jude Heisenberg – Johannes Starks ideologischer Antisemitismus, in Albrecht, Helmut (Hg.): Naturwissenschaft
134
Anmerkungenund Technik in der Geschichte. Stuttgart 1993, S. 327-342, hier: S. 333 und Swinne, Edgar: Richard Gans. Hochschullehrer in Deutschland und Argentinien. Berlin 1992, S. 93.Vertragsunterlagen, Siemens Archiv. Für die Einsicht in diese von 74
ihm selbst zusammengetragenen Materialien danke ich Dieter Hoffmann, Berlin.Entlassungsschreiben vom 11.6.1935, Hoover Institutions; 75
das Dokument wurde mir dankenswerter Weise von Dieter Hoffmann, Berlin, zur Verfügung gestellt. Vgl. auch Cassidy, David: Gustav Hertz, Hans Geiger und das Physikalische Institut der Technischen Hochschule Berlin in den Jahren 1933-1945, in: Rürup, Reinhard (Hg.): Wissenschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte der Technischen Universität Berlin 1879-1979. Berlin 1979, S. 373-387, hier: S. 378.Durchschlag mit Hinweis auf ein Verzeichnis der am 1. Januar 76
1938 noch im Dienst befindlichen Hochschullehrer, die Mischlinge oder jüdisch versippt oder mit Mischlingen verheiratet sind. Mit Vermerk vom 11.6.1938 über sechs unklare Fälle, darunter Hertz. Notiz für den Referenten vom 11.7.1938, BA R 4901 13306, Akte Hertz.G. Hertz an REM, 30.4.1939, ebd.77
Rektor der TH Berlin an REM, 6.7.1939; Regierungsrat Dames an 78
Oberregierungsrat Kasper, 19.7.1939, ebd. Vorlage „Nennung des Namens von Professor Hertz“ für die 79
Parteikanzlei, 15.6.1942, Notiz für Dr. Rosemarie Fritz, „Nennung des Namens von Professor Hertz“, 3.8.1942; beide BA NS 18 alt/776.Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 80
1957, S. 366. Herbert Fröhlich, Heinrich Hertz Centenary, in AJR Information 81
12 (1957) Nr. 4, April 1957, S. 5.
135
Hertz, Heinrich: Erinnerungen, Briefe, Tagebücher, hrsg. von 1
Johanna Hertz, 2. erw. Aufl., Weinheim und San Francisco 1977, S. 288. Weiterhin zitiert als Hertz, Erinnerungen.Siehe: Möller, Sarah: Neuplanungen und Weiterbau unter 2
Kurfürst Joseph Clemens und Robert de Cotte 1713 – 23, in: Satzinger, Georg (Hg.): Das Kurfürstliche Schloss in Bonn, München und Berlin 2007, S. 54. Reinganum, Maximilian: Rudolf Clausius, in ADB, Band 55 (1910), 3
S. 720. Vgl. Herz, Erinnerungen, S. 272ff.4
Ebd., S. 288. 5
Siehe auch Schnabel, Franz: Friedrich Theodor Althoff, in NDB, 6
Band 1 (1953), S. 222.Hertz, Erinnerungen, S. 274.7
Ebd., S. 276. 8
Der Kurator der Universität Bonn an Althoff vom 30. Juni 1889. 9
Zitiert nach: Fölsing, Albrecht: Heinrich Hertz – Eine Biographie, Hamburg 1997, S. 408. Weiterhin zitiert als: Fölsing, Hertz. Ebd.10
Hertz, Erinnerungen, S. 274. Brief an die Eltern vom 16. 11
Dezember 1888.Ebd., S. 288. Brief an die Eltern vom 14. April 1889. 12
Hertz an Amman vom 28. Oktober 1889, Copirbuch von Heinrich 13
Hertz im Physikalischen Institut der Universität Bonn. Hertz, Heinrich: Untersuchungen über die Ausbreitung der 14
elektrischen Kraft, Leipzig 1892, S. 2.»Lieber Ammann, die übersandten Spiralen sind hier gut und 15
auch glücklich angekommen und ganz in Ordnung.« Hertz an Amman vom 19. Dezember 1889, Copirbuch von Heinrich Hertz im Physikalischen Institut der Universität Bonn. Hertz an Édouard Sarasin vom 16. September 1889, NL Hertz, 16
Archiv des Deutschen Museums, HS-Nr. 03138. Hertz an Édouard Sarasin vom 2. Mai 1890, NL Hertz, Archiv 17
des Deutschen Museums, HS-Nr. 03134. Siehe dazu: Bjerknes, Vilhelm: Über die Dämpfung schneller 18
electrischer Schwingungen, In: Annalen der Physik und Chemie Nr. 280 (1891), S. 76f..Vgl. Fölsing, Hertz, S. 464. 19
Hertz an Hermann von Helmholtz vom 8. Dezember 1887, NL 20
Hertz, Archiv des Deutschen Museums, HS-Nr. 3119. Zum Funktionsprinzip siehe auch den Beitrag von Michael 21
Eckert.Hertz an Keiser & Schmidt vom 4. Oktober 1890, Copirbuch von 22
Heinrich Hertz im Physikalischen Institut der Universität Bonn, S. 117.»Als Induktorium verwandte ich nicht mehr den großen 23
Rühmkorffschen Apparat, sondern mit Vorteil einen kleineren Funkengeber von Keiser und Schmidt (...)«. Hertz, Heinrich: Über Strahlen elektrischer Kraft, in: Annalen der Physik und Chemie Nr. 272 (1889), S. 770«. Paul, Wolfgang: Experimentelle Vorführungen über die 24
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen mit Originalapparaten von Heinrich Hertz, in: In Memoriam Heinrich Hertz (= Beiträge zur Geschichte der Universität Bonn, Nr. 7), Bonn 1958, S. 39f.Siehe Bjerknes, Vilhelm: Über die Dämpfung schneller 25
electrischer Schwingungen, In: Annalen der Physik und Chemie Nr. 280 (1891), S. 76f.Hertz, Heinrich: Über Strahlen elektrischer Kraft, in: Annalen 26
der Physik 272 (1889).Zitiert nach Fölsing, Hertz, S. 440.27
Hertz, Heinrich: Über Strahlen elektrischer Kraft, in: Annalen 28
der Physik 272 (1889).Ebd. 29
Ebd. 30
Fölsing: Hertz, S. 406. 31
Ebd., S. 492.32
Kayser, Heinrich: Erinnerungen, zitiert nach Fölsing, Hertz, S. 33
493.Siehe Nägelke; Hans-Dieter: Hochschulbauten im Kaiserreich, 34
Kiel 2000, S. 258 f.
Hertz am Dr. Rudolph König vom 20. Oktober 1889, Copirbuch 35
von Heinrich Hertz im Physikalischen Institut der Universität Bonn, S. 19. Ebd, S. 39.36
Sein Grab befindet sich auf dem »Alten Friedhof« zu Bonn.37
Vgl. Fölsing: Hertz, S. 485.38
»Originale Kopien« – Hertz Bonner Vermächtnis Von Ralph Burmester und Karl-Heinz Althoff
136
Anmerkungen
Dazu ausführlich: Fölsing, Albrecht: Heinrich Hertz, Hamburg 1
1997, S. 469ff.Gorokhov, Vitaly G.: Die Entstehung der Radiotechnik als eine 2
technikwissenschaftliche Disziplin, in: Wolfschmidt, Gudrun: Heinrich Hertz (1857 – 1894) and the Development of Communication, Hamburg 2008, S. 360. Siehe: König, Wolfgang: Massenproduktion und Technikkonsum, 3
Entwicklungslinien und Triebkräfte der Technik zwischen 1880 und 1914, in: Propyläen Technikgeschichte, hrsg. von Wolfgang König, Band 4, Netzwerke, Stahl und Strom 1840 – 1914, Berlin 1997, S. 511 – 513.Wolfschmidt, Gudrun: Von Hertz zum Handy – 4
Elektromagnetismus, Hertzsche Wellen und die Entwicklung der Telekommunikation, in: dies. (Hg.): Von Hertz zum Handy – Entwicklung der Kommunikation, Hamburg 2007, S. 33. Gorokhov, Vitaly G.: Die Entstehung der Radiotechnik als eine 5
technikwissenschaftliche Disziplin, in: Wolfschmidt, Gudrun: Heinrich Hertz (1857 – 1894) and the Development of Communication, Hamburg 2008, S. 362.Siehe: Braun, Hans-Joachim: Konstruktion, Destruktion und 6
der Ausbau technischer Systeme zwischen 1914 und 1945, in: Propyläen Technikgeschichte, hrsg. von Wolfgang König, Band 5, Energiewirtschaft, Automatisierung, Information seit 1914, Berlin 1997, S. 154 – 158.
Vom Funkensprung zur Radiowelle Von Ralph Burmester und Jörg Bradenahl
137
Bausch, H.: Rundfunkpolitik nach 1945, Erster Teil 1945 – 1962, 1
(Rundfunk in Deutschland, Hg. von H. Bausch, Bd. 3.) München 1980, S. 15 - 17a.a.O., S. 13 - 1482
a.a.O., S. 187 - 2383
Mosgraber, K.-H: Chronik der Regionalsender (Landessender) 4
1945 1949. In: Spielhagen, E. (Hrsg.): So durften wir glauben zu kämpfen... Erfahrungen mit DDR-Medien. Berlin, 1993, S. 69 – 71Lieberwirth, St.; Pfau, H.: Mitteldeutscher Rundfunk. Radiogeschichte(n). 5
Altenburg, 2000: S. 210 – 211Mosgraber, K.-H.: Chronik der Regionalsender (Landessender) 6
1945 1949. In: Spielhagen, E. (Hrsg.): So durften wir glauben zu kämpfen... Erfahrungen mit DDR-Medien. Berlin, 1993, S. 69 – 71 Dussel, K.: Deutsche Rundfunkgeschichte. Eine Einführung. Konstanz, 1999, S. 128 – 129Dussel, K.: Deutsche Rundfunkgeschichte. Eine Einführung. Konstanz, 7
1999, S. 129 - 132Hermann, S.; Kahle, W.; Kniestedt, J.: Der deutsche Rundfunk. 8
Faszination einer technischen Entwicklung. Heidelberg, 1994, S. 208Dussel, K.: Deutsche Rundfunkgeschichte. Eine Einführung. Konstanz, 9
1999, S. 134 – 135Hermann, S.; Kahle, W.; Kniestedt, J.: Der deutsche Rundfunk. 10
Faszination einer technischen Entwicklung. Heidelberg, 1994, S. 208Bredow, H. (Hrsg.): Aus meinem Archiv. Heidelberg, 195011
Büscher, G.: Wellenchaos im Äthermeer, In: Funk-Technik 3 (1948), 12
H. 10, S. 233 Hermann, S.: Kahle, W.: Kniestedt, J.: Der deutsche Rundfunk. Faszination einer technischen Entwicklung. Heidelberg, 1994, S. 78Büscher, G.: Wellenchaos im Äthermeer, In: Funk-Technik 3 (1948), H. 13
10, S. 233Schuster, F.; Pressler, H.: Deutschland und der Kopenhagener 14
Wellenplan. In: Archiv für das Post- und Fernmeldewesen 10 (1954), S. 683Kommentare zum Kopenhagener Plan. Bericht der Sachverständigen 15
der UIR. Übersetzt in: Rundfunk und Fernsehen (Hamburg) 1949,
Folge 5/6, S. 19 - 20. Der Kopenhagener Wellenplan. In: Funk-Technik 3 (1948), H. 24, S. 604Schuster, F.; Pressler, H.: Deutschland und der Kopenhagener 16
Wellenplan. In: Archiv für das Post- und Fernmeldewesen 10 (1954), S. 670Senderverzeichnis ab dem 15. März 1950. In: Funk-Technik 5 (1950), 17
H. 6, S. 162Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 18
UKW-Rundfunks, Berlin, 1989, S. 20Glowczewski, G. v.: Der Kopenhagener Wellenplan von 1948. Seine 19
politischen, rechtlichen und technischen Folgen für die ARD. In: Lerg, W. B.; Steiniger, R. (Hrsg.): Rundfunk und Politik 1923 bis 1973 (Rundfunkforschung Bd. 3). Berlin, 1973, S. 390Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 20
UKW-Rundfunks. Berlin, 1989, S. 35 - 40. Deutsch, K. H.: Das Drahtfunknetz in Berlin und seine technische Ausrüstung. Funk-Technik 3(1948) H. 5, S. 106 u. 109 - 110 Was ist bei Benutzung des Drahtfunks zu hören? Funk-Technik 4(1949) H. 2, S. 50Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 21
UKW-Rundfunks. Berlin, 1989, S. 21a.a.O., S. 2222
Deutsch, k. H.: UKW – Ausweg aus Deutschlands Wellennot? In: 23
Funk-Technik 4 (1949), H. 2, S. 33Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 24
UKW-Rundfunks. Berlin, 1989, S. 23Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 25
UKW-Rundfunks. Berlin, 1989, S. 42Glowczewski, G. v.: Der Kopenhagener Wellenplan von 1948. 26
Seine politischen, rechtlichen und technischen Folgen für die ARD. In: Lerg, W. B.; Steiniger, R. (Hg.): Rundfunk und Politik 1923 - 1973 (Rundfunkforschung Band 3). Berlin, 1973, S. 391 Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des UKW-Rundfunks. Berlin, 1989, S. 68 - 69. Was bedeutet die ultrakurze Welle? In: epd - Kirche und Rundfunk. Nr. 1 vom 21.1.1949Bausch, H.: Rundfunkpolitik nach 1945, Erster Teil 1945 – 1962, 27
(Rundfunk in Deutschland, Hg. von H. Bausch, Bd. 3.) München 1980, S. 204 - 212Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 28
UKW-Rundfunks, Berlin, 1989, S. 60 - 79a.a.O., S. 65 - 6629
Tetzner, K.: Ultra-Kurz-Wellen. In: Funktechnik 5 (1950), H. 3, S. 6730
Tetzner, K.: Nachträgliche Rechtfertigung. In: Funktechnik 5 (1950), 31
H. 21, S. 635Tetzner, K.: Rundfunktechnik und -wirtschaft. In: Funktechnik 7 (1952), 32
H. 9, S. 231Tetzner, K.: Rundfunkwirtschaft im Fegefeuer. Funktechnik 4(1949) H. 33
9, S. 247 f.Wildt, M.: Am Beginn der Konsumgesellschaft. Mangelerfahrung, 34
Lebenshaltung, Wohlstandshoffnung in Westdeutschland in den fünfziger Jahren (Forum Zeitgeschichte Bd. 3). Hamburg 1994, S. 394Brauns, H.: Radioschau in Hannover. Bericht von der technischen 35
Exportmesse. Funkschau 21(1949), H.7, S. 119 - 120 Tetzner, K.: Gedämpfter Optimismus in Hannover. Funktechnik 4(1949) H. 11, S. 309 Tetzner, K.: Rundgang durch die Messehallen. Funktechnik 4 (1949) H. 11, S. 310 - 319Schneider, R.: Die UKW-Story. Zur Entstehungsgeschichte des 36
UKW-Rundfunks. Berlin, 1989. S. 45 - 49Eberhardt, F.: Der Rundfunkhörer und sein Programm. Ein Beitrag 37
zur empirischen Sozialforschung, Berlin, 1962, S. 36- 37. Rhein, E.: Die Welle der Freude. In: Hör zu 5 (1950), H. 18, S. 3Tetzner, K.: Neue UKW-Geräte. Teil 2. Funktechnik 5(1950) H. 13, S. 38
386. Reuber, C.: Die deutschen Empfänger 1950/51. Radiomentor 16(1950) H. 8, S. 419 - 422d. Rundfunkempfänger 1951/52. Funktechnik 6(1951) H. 14, S. 372 – 377. Höchste Eisenbahn. In: Radiohändler 1950, Nr. 23 + 24, S. 536Kappelmeyer, O.: Die deutsche Radioindustrie hat wieder Weltgeltung 39
erreicht. In: Radiohändler 1951, Nr. 8, S. 304 - 318Weinrebe, K.: UKW – Neue Aufgaben für den Radiohandel. In: 40
Funkschau 22 (1950), H. 9, S. 135
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
138
Anmerkungen
Höchste Eisenbahn. In: Radiohändler 1950, Nr. 23 + 24, S. 53641
Eberhardt, F.: Der Rundfunkhörer und sein Programm. Ein Beitrag zur 42
empirischen Sozialforschung, Berlin, 1962, S. 64a.a.O., S. 35 - 3643
a.a.O., S. 3744
a.a.O., S. 3745
a.a.O., S. 3846
a.a.O., S. 9047
a.a.O., S. 89 - 9048
a.a.O., S. 4149
a.a.O., S. 4150
a.a.O., S. 94 - 9551
Brief des Ministers für Post- und Fernmeldewesen an den 52
Staatspräsidenten der DDR vom 15. Februar 1950. Bundesarchiv, DM 3, BRF II/1306Brief des Staatspräsidenten der DDR an die Sowjetische 53
Kontrollkommission vom 9. Februar 1950. Bundesarchiv, DM 3, BRF II/1306Bundesarchiv, DM 3, BRF II/5854
a.a.O.55
Situationsbericht zur Technik beim Rundfunk und Fernsehen. 56
Bundesarchiv, DM 3, BRF I/128 (rot)Bundesarchiv, DM 3, BRF II/5857
Einschätzung der Entwicklung des Funkwesens der Deutschen Post 58
auf der Grundlage des Beschlusses des Präsidiums des Ministerrates vom 23.02.1956 und des dazu ergangenen Ergänzungsbeschlusses v. 28.09.1961. Bundesarchiv Berlin, DM 3, 14050a.a.O.59
Herrmann, S.; Kahle, W.; Kniestedt, J.: Der deutsche Rundfunk. 60
Faszination einer technischen Entwicklung. Heidelberg, 1994, S. 78Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 61
Bundesarchiv, DY 30/IV 2/2/319Situationsbericht zur Technik beim Rundfunk und Fernsehen. 62
Bundesarchiv, DM 3, BRF I/128 (rot)
Die Welle der Freude – Wie Deutschland zum UKW-Rundfunk kam Von Andreas Vogel
Tetzner, K.: Verbesserte Qualität in Leipzig. Funktechnik 6(1951) H. 63
7, S. 174 - 177. Leipziger Messe 1952 - Radio. Deutsche Funktechnik 1(1952) H. 4, S. 101 -107. Leipziger Messenotizen. Funktechnik 8(1953) H. 18, S. 577 Technische Messe Leipzig 1954. Funktechnik 9(1954) H. 20, S. 559 – 566Bundesarchiv, G 3, Nr. 541664
Rundfunk auf der Leipziger Messe. Funktechnik 10(1955) H. 19, S. 65
554 – 555 Bundesarchiv, G 3, Nr. 5416Bundesarchiv, G 3, Nr. 499366
139
Autorenverzeichnis
Prof. em. Dr. Karl-Heinz Althoff – Physiker.1965 Professor für Physik an der Universität Bonn. Forschungsschwerpunkt: Elementarteilchenphysik. Passio-nierter Experimentalphysiker und Wissenschaftsvermittler.
Ralph Burmester M.A. – Historiker. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Museum Bonn. Arbeitsschwerpunkte: Konzeption und Reali-sierung von Vortragsveranstaltungen und Sonderausstellungen, sowie Forschungen und Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte.
Jörg Bradenahl – Dipl. Biologe.Führt seit 2011 gemeinsam mit Dr. Torsten Klockenbring »Kapierkonzept«. Arbeitsschwerpunkte: Wissen-schaftsvermittlung und Ausstellungsgestaltung, im Besonderen Textredaktion, Grafikdesign und die Konzep-tion interaktiver Ausstellungsmodule.
Dr. Michael Eckert – Physikhistoriker.Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsinstitut des Deutschen Museums in München.Arbeitsschwerpunkte: Geschichte der theoretischen Physik; Geschichte der Strömungsforschung.
Dr. Andreas Vogel – Technikhistoriker.Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentralinstitut für Bildung der TU Ilmenau. Arbeitsschwerpunkte: Konzeption und Organisation des Studium generale, Lehrtätigkeit in den Gebieten Medien- und Innovationsgeschichte sowie Wissenschaftstheorie und –methodik.
Dr. Stefan L. Wolff – Wissenschaftshistoriker.Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut des Deutschen Museums München, Lehrbeauftragter für Physikgeschichte an der Universität München. Forschungsschwerpunkte: Physikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Wissenschaftsemigration in der Zeit des Nationalsozialismus.
143
Impressum
Begleitpublikation zur Sonderausstellung »Heinrich Hertz – vom Funkensprung zur Radiowelle«. Die Ausstellung ist vom 26. April 2012 bis zum 13. Januar 2013 im Deutschen Museum Bonn zu sehen.
Herausgegeben von Ralph Burmester und Andrea Niehaus©2012 Deutsches Museum Bonn, Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-940396-33-4
Gestaltung und Realisation: magoodesign, Markus Kahlenberg
Lektorat: Yorck Bertrams
Die Ausstellung
Idee: Ralph Burmester
Konzeption: Ralph Burmester und Jörg Bradenahl
Inhaltliche Mitarbeit: Karl-Heinz Althoff, Tobias Jungk, Michael Kortmann (Physikalisches Institut der Universität Bonn)Richard Herder
Illustrationen: Torsten Klockenbring
Ausstellungstechnik: Thomas Weiß
Die Ausstellung wird bereichert durch Demonstrationen von:
147