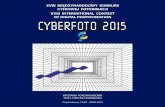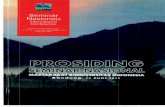Die latènezeitlichen Funde vom Dünsberg. Berichte der Kommission für archäologische...
-
Upload
grossenhain -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die latènezeitlichen Funde vom Dünsberg. Berichte der Kommission für archäologische...
VORWORT
I. EINLEITUNG Standortwahl und Topographie Forschungen und Funde Strukturen und Befunde: Wälle – Podien – Holzbecken
II. DAS FUNDMATERIAL
1. Kleidungszubehör und Schmuck A. Fibeln B. Gürtel C. Ringschmuck D. Anhänger und Amulette2. Pferdegeschirr A. Trensen B. Riemenbeschläge und -verteiler C. Besatzstücke und Phaleren D. Anhänger3. Wagen4. Waffen A. Schwert B. Schild C. Kettenpanzer, Helm? D. Lanzen-, Speer- und Geschossspitzen5. Gefäße aus Holz und Metall6. Werkzeug und Gerät7. Niete und Nägel8. Kleinplastik9. Münzen Münzliste A. Gold B. Silber C. Kupfer D. Mediterrane Prägungen10. Keramik
Inhalt
9
11121317
27
27506064
6873757782
8589898998
104109110
112121125133137140
III. AUSWERTUNG
1. Der Fundkomplex am Tor 4 2. Die latènezeitliche Besiedlung des Dünsbergs
IV. LITERATUR
V. FUNDLISTEN
VI. KATALOG
1. Metallfunde2. Keramik
Tafeln Metallfunde Taf. 1–49 Münzen Taf. M1–15 Keramik Taf. K1–57
149158
175
192
204
228
253303319
9
Die Zeitläufte haben der 1906 einsetzenden Erforschung des Dünsbergs ein ständiges Auf und Ab beschert. Auf Phasen intensiver Tätigkeit folgte immer wieder anhaltende Stagnation. Funde und Befunde blieben zum größten Teil unpubliziert. Einen neuen Anlauf unternahm die vorliegende Marburger Dissertationsschrift. Sie sollte die zahlreichen Detektorfunde der 1980er Jahre als auch die Keramik und die Befunde der Altgrabungen 1906/1912 aufarbeiten. Es war dabei noch nicht abzusehen, dass sie neue Ausgrabungen nach sich ziehen würde.Es ist nicht möglich, alle Personen zu würdigen, die zum Erfolg der Untersuchung beigetragen haben. J. Heinrichs, N. Roymans, K.-F. Rittershofer, H. Schubert, D. Wigg, B. Ziegaus und U. Zwicker stellten mir großzügig ihre Materialsammlungen zur Verfügung. Bei der Fundaufnahme in über 50 Museen und Sammlungen haben mich T. Bechert, G. Bender, I. Damm, K.-V. Decker, H. Füll, A. Hänsel, F.J. Hassel, P. Ilisch, J. Junk, H. Junker, C. Klages, H. Laumann, B. Overbeck, B. Pinsker und H. Schmidt intensiv betreut. Auch 10 Privatsammler machten mir ihre Funde bereitwillig zugänglich. O. Buchsenschutz, C. Dobiat, A. Haffner, J. Heinrichs, F. Maier, F. Müller, R. Müller, K. Peschel, N. Roymans, S. Sievers und Th. Völling verdanke ich wesentliche Einblicke in die aktuelle Forschung, Diskussion, aber auch viele praktische Hilfestellungen. Dasselbe gilt für den Austausch mit den Marburger Kommilitonen M. Meyer, A. Schäfer, M. Schönfelder und M. Seidel.Mein Doktorvater O.-H. Frey hat das Promotionsthema weitsichtig auf den Dünsberg und die frühe hessische Landesgeschichte gelenkt. Sein Vertrauen war Ansporn, die Quellen umfassend aufzuarbeiten und eine neue Synthese zur Rolle des Dünsbergs in der Übergangszeit (Stichwort: „Kelten, Germanen, Römer“) vorzulegen.Die Arbeit ist 2009/2014 leicht überarbeitet, der neuen Rechtschreibung angepasst und um ausgewählte jüngere Literatur ergänzt worden. Auch die Fundlisten wurden aktualisiert. Der Inhalt ist bis auf einige nuancierende Hinweise unverändert.Wenn die 2002 eingereichte Dissertation nun gedruckt vorliegt, ist dies das Verdienst von C. Dobiat. Er besorgte die Veröffentlichung in den Berichten der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen, wofür ich ihm außerordentlich dankbar bin. Die Studienstiftung des deutschen Volkes förderte die Arbeit mit einem Stipendium und finanzierte die Ausrichtung eines Forschungskolloquiums.In Dankbarkeit für die großzügige Unterstützung meiner Ausbildung widme ich diese Arbeit meinen Eltern.
VORWORT und DANK
10
Abb. 1. Blick über das Gießener Lahntal. Im Hintergrund der Dünsberg, davor die Burgen Vetzberg und Gleiberg. Aqua-rell aus einem Studenten-Stammbuch, um 1785 (Universitätsbibliothek Gießen).
„Ubi in nostris heic Giessae regionibus Mons Dini ille trans Lanum fluvium situs, inter Hassiacos ob antiquitatis aeque monumenta, & altidudinem, nulli secundus conspicitur.“
J. G. Liebknecht, Hassiae subterraneae specimen (Gießen/Frankfurt)
11
Seit langem sichern die beherrschende Lage und die gewaltigen, ca. 90 ha umfassenden Befestigungen dem Dünsberg eine Sonderstellung unter den hessischen Ringwällen. Bereits 1723 erschien eine erste Untersu-chung, die am Dünsberg keinen geringeren Ort als das bei Tacitus erwähnte Drusus-Kastell „in monte Tauno“ lokalisierte. Heute gilt der Dünsberg allgemein als nörd-licher Ausläufer der spätkeltischen Oppidakultur1. Der Vergleich mit den großen Zentren der keltischen Kernzo-ne wird dem Dünsberg jedoch nur bedingt gerecht, weil er die Anlage zu einer Randerscheinung nivelliert, aber zu wenig nach den besonderen historischen Bedingun-gen der Spätlatènekultur in Mittelhessen fragt. Schon die komplizierte Wallführung weist auf die regionale Färbung und die Einbindung in die lokale Siedlungsge-schichte hin. Hier gilt es, an ältere Regionalstudien, vor allem H. Behaghels grundlegende Arbeit zur Eisenzeit im Rechtsrheinischen Schiefergebirge anzuknüpfen. Erst auf solider archäologischer Grundlage lässt sich das mehr als 200 Jahre umfassende Phänomen des Düns-bergs im Spannungsfeld lokaler Siedlungsgeschichte und überregionaler Entwicklungen bewerten. Die moderne Forschung hat mit der allenthalben beteuerten Bedeutung des Dünsbergs nicht Schritt halten kön-nen. Nach 1912 ließen die Zeitläufte keine Forschungsinitiativen mehr gedeihen. Die Untersuchungen des Museums Wiesbaden zwischen 1906 und 1912 blieben unpubliziert. Die Dünsberg-Forschung stünde unter keinem guten Stern, resümierte W. Dehn 19582. Mit einer völlig neuen Situation hat das Zeitalter der Sondengänger die Archäologie des Dünsbergs konfrontiert. Eine unerwartete Zahl von Metallfunden hat den Fundstoff beträchtlich erweitert und bildet mit den älteren Arbeiten von Jacobi (1977) und Schlott (1984) das Rückgrat unseres Wissensstandes. Dagegen kann sich die Dünsberg-Archäologie bis heute auf keinen einzigen aussagekräftigen Baubefund stützen. Fragen zur Ent-wicklung und Struktur der Siedlung sind hier enge Grenzen gesetzt. Sie bleiben zukünftigen Flächengrabungen vor-behalten3. Diese Grenzen kann auch die vorliegende Arbeit nicht sprengen, aber in verschiedenen Bereichen doch neu defi-nieren. Ein entscheidender Fortschritt resultiert aus dem Materialzuwachs (Tab. 1). Bei vielen Fundgattungen liegt mittlerweile ein repräsentatives Typenspektrum vor. Neben den Fibeln sind hier vor allem die Münzen hervorzuhe-ben, die eine ganz neue Perspektive bieten. Wesentliche Grundzüge des Dünsbergs, vor allem seine zeitliche Ent-
I. EINLEITUNG
1 MAIER 1997.2 DEHN 1958, 71.3 Die 1999 begonnen Untersuchungen haben bis 2003 im Innenraum nur kleinere Flächen mit dem schon von den Altgrabungen bekannten Gewirr zahlreicher Ein-
Abb. 2. Die erste Untersuchung (disquisitio) zum Dünsberg, vorgelegt von J. G. Kuhn (Gießen 1723).
Tab. 1. Quellenentwicklung am Dünsberg.
Fibeln (bestimmbar)
Gürtelzubehör
Münzen
Waffen
Jacobi 1977
13
11
-
29
Schlott 1984
67
20
6
112
gesamt 2002
235
76
289
250
tiefungen, aber nach wie vor keine sicheren Hausbefunde geliefert (vgl. RITTERSHOFER 2004, 14 ff.). Zur Nachweisproblematik von Baustrukturen auf den Höhensiedlungen des Mittelgebirgsraumes SCHULZE-FORSTER 2007, 125 ff.