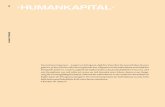Korrespondenz und Atmosphäre
-
Upload
udk-berlin -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Korrespondenz und Atmosphäre
Reinhard Knodt
Korrespondenz und Atmosphäre
Für eine pragmatische Philosophie derKorrespondenz im Zeitalter der Kommunikation
I. Ein Hinweis vorab
Meine Philosophie der „ästhetischen Korrespondenzen“wie sie der Reclam-Verlag im Jahr 1993 publizierte,war keine Theorie über gewisse Zusammenhänge, sonderneine Praxis des Auslegens und Beschreibens vonPhänomenen. Was dabei den damals neuen Begriff derAtmosphäre anbelangt, so gibt es inzwischenhochinteressante Arbeiten, die sich allerdings imWesentlichen auf den Bereich der Kunst beschränken.Eine ist der für die Gartenphilosophie und dieArchitektur nutzbar gemachte Atmosphärenbegriff
1
Gernot Böhmes.1 Einen viel weiteren Begriff schlägtHermann Schmitz vor.2
Für Gernot Böhme war Atmosphäre ein „quasi-objektiverGegenstand,“ den man auch herstellen oder wie ineiner Gartenlandschaft gestalten könne. HermannSchmitz verlegte dagegen die Atmosphäre in einenvorsprachlichen „Leibraum“ aus dessen Erfahrungendann etwa die Dichtung schöpft, wie er mir selberschrieb.3 Böhme verlegt die Atmosphäre also sehr weitins „objektive“ Außen, Schmitz verlegt sie sehr weitin ein psychisches Innen, bzw. in den Bereich der„Gefühle“ eines „Leibes“, den er aber nichtphysikalisch naturwissenschaftlich begrenzt auffasst,sondern in den fließenden Grenzen unsererWahrnehmung. Der Clou ist allerdings, dass Atmosphäre weder ein„Gegenstand“ noch ein (Leib-) „Gefühl“ ist, sondern ebenein Geschehen – genauer: ein Korrespondenzgeschehen, daseine Subjekt-Objekt Spaltung, wie auch eine Spaltung1 Böhme, Gernot: Atmosphäre als Grundbegriff einer neuen Ästhetik“, in Kunstforum International 120, 1992, S. 247-255). Und ders.: Essays zur neuen Ästhetik, Suhrk. 2013. 2 Schmitz, Hermann: 2010 Jenseits des Naturalismus, (Alber, München) S.235, 236. Atmosphären sind für Schmitz, der eine poietische Darstellung oder ästhetische Denkweisen meidet, „flächenlose Räume“,wie etwa der „Raum der Stille“, „des Schalls“ oder „der Gefühle als Atmosphären“ (a.a.O. S. 236).3 Schmitz, Hermann: 2009, Der Leib, der Raum und die Gefühle. S. 84 ff (Hier sind Atmosphären „ergreifende Mächte“, die „unter die Haut“gehen. In einem Brief an den Verfasser v. 7. Juli 2013 (im Besitz d.Verf.) auf Atmosphären bezogen. (S.u.)
2
zwischen Erfahren und Verstehen (etwa einer Umgebung)gerade verhindern will. Der Begriff der Korrespondenzals einem unablässigen Prozess der Schwingung oderauch Resonanz des einen mit dem anderen wäre hier dasbeste Beispiel für die Lösung von Problemen, die imzeitgenössischen Nachdenken über das Phänomen derAtmosphären auftauchen. Nun aber zunächst zumUrsprungspunkt des Korrespondenzbegriffs selbst unddamit zu einem weiteren Zusammenhang.
II. Das Motiv für eine Philosophie derKorrespondenzen
Wollte man ein wesentliches Motiv derKorrespondenzphilosophie bestimmen, so könnte man vonder Notwendigkeit eines Brückenbaus zwischen zweiprominenten Denkstilen des 20. Jh. sprechen – dienach wie vor nicht miteinander versöhnt sind. - Aufder einen Seite steht der von Habermas inaugurierteStil des Diskursiven mit seinem von Hegel herentwickelten politischen Anspruch und dem damitverbundenen, aus der Informationstheorie dervierziger Jahre hergeleiteten Modell von Sender,Empfänger und „Message“, die ja mittlerweile alsDiskursorganisation zum Projekt der Moderne
3
ausgerufen wurde. Man könnte hier poetisch von einerArt Dombau der Vernunft sprechen, an dem sich alle imvorgeblich „herrschaftsfreien“ Diskurs beteiligen –sozusagen vom philosophischen Seminar bis zumEuropaparlament. Auf der anderen Seite – ein wenig altertümlich, aberauch erstaunlich dauerhaft – Heideggers alteSchwarzwaldhütte, bzw. die ganz andere Auffassung vomDenken als einem Weg zur „Aisthesis“, mit ihrenwichtigen methodischen Ausdrücken Entbergung undSeinserfahrung, womit schon gesagt ist, dass man dasWichtigste sowieso nicht „verstehen“ kann, sondern„erfahren“ muss und daher eben nicht diskursivorganisieren, sondern nur im Wechsel von Erfahrungund Dichten gewissermaßen herausarbeiten kann.Heidegger war Schüler Husserls, hatte sich aberzunehmend von dessen allgemeiner Phänomenologie derSachen entfernt und schließlich mit der Kunstverbündet. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, dasssich die letzten fünfzig Jahre philosophischenNachdenkens im 20. Jh. – und zwar auch der„Postmoderne“ – im unterschwelligen Streit zwischender analytisch aufgerüsteten Diskursphilosophie vonJürgen Habermas einerseits und den gewissermaßenunbelehrbar erscheinenden Heidegger-Adepten (von der
4
Ontologie bis zur existenzialistischen Postmoderne)abspielte.4 Beide Seiten machen sich dabei bis heute dietypischen Vorwürfe ihrer jeweiligen Positionen. Sowird den Erben Heideggers bis heute gern eine Artontologischer Tiefenrausch vorgeworfen, eineirrationale Sehnsucht nach dem „Sein des Seienden“das im „Ge-stell“ der Technik und denninstitutionalisierten Diskursen „vergessen“ sei undnur gelegentlich in den „Lichtungen“ großer Kunstoder Philosophie aufblitze, weswegen das Bemühenphilosophischen Sprechens – am besten im Verbund mitder Kunstauch in diese Richtung gehen sollte(Grundüberzeugung: „Die Sprache spricht und nicht derMensch“), statt sich in denWirklichkeitskonstruktionen des sekundären Geredes –etwa der Erkenntnistheorie oder – schlimmer noch –der Soziologie zu verlieren.5
4 Ein früher Gipfelpunkt der Auseinandersetzung war der „Hermeneutikstreit“, in dem das Arbeitsfeld des Verstehens von Gadamer methodisch zwar befestigt, aber damit auch innerhalb der Kunst weiter begrenzt wurde. Das Buch über die wissenschaftliche Fundierung des hermeneutischen Prinzips als Wissenschaft als Terrainverlust (gegenüber dem diskursiven Modell) ist noch nicht geschrieben.5 Heidegger, Martin 1935, 1956, 1960, 1982...ff. Der Ursprung des Kunstwerkes; Vgl. etwa d. Begriff der Lichtung und die Auffassung von Schaffen, Verbergen, verstellen und Ins- Werk-setzen der Wahrheit.
5
Habermas wird von seinen Gegnern im Gegenzug dazueine Art diskursiver Höhenrausch attestiert, einfragwürdiger Glaube an die Konstruierbarkeit undpolitisch rationale Steuerbarkeit immer abstraktersich türmender (oder eben auch verlierender)„Diskurse“ einer Vernunft, die dem einzelnen garnicht mehr fassbar ist und deren Institutionen undnach dem platonisch angehauchten Motto: „Gottesbürokratische Mühlen mahlen langsam aber gerecht“eher geglaubt als erfahren werden können. Die Kunstist in den Augen der Kommunikationstheoretikernatürlich selbst auch ein „Diskurs“ oder sie wirdaktiv zum Arbeitsfeld verschiedener Diskurseumgestaltet – etwa als eine Form politisch sozialerTätigkeit im öffentlichen Raum. (Die Grundüberzeugunghier: Die Menschen sprechen und nicht die Sprache).
Man könnte nun versuchen, die beiden Positionen durchAbschwächung der Vorwürfe anzunähern oder zuintegrieren. Einerseits wird man Habermas keineplatte politische Vereinnahmung der Kunst vorwerfenkönnen, und auf der anderen Seite hat sich auchHeidegger von der Metaphysik verabschiedet, die er,wie es schon in den Nietzsche-Vorlesungen von 1940hieß, „verwinden“ wollte. Habermas hat sich auchöffentlich zu dem Weberschen Dictum bekannt, dass er„religiös unmusikalisch“ sei, ein Sachverhalt, den er
6
auf den mitunter herrschenden Gestus der Kunst alseiner potentiellen Metaphysik (bzw. Religionsersatz)des Alltags sicher übertragen dürfte, denn Kunbstkündet ihm nichts. Sie ist ein Diskurs bestenfallsals dieser dann auch als „Erkenntnisart“ wieSchopnehauer noch formulierte. –Und auch Heideggers legendäre „Verwindung derMetaphysik“ die er im Anschluss an seine Nietzsche-Vorlesungen propagierte, dürfte eine der Lebenslügender Ontologie sein, denn mit Heidegger lauschen zwarnicht mehr auf die Botschaften eines fernen Gottes,aber doch bis heute noch auf das niemals ganz zu sichkommende, bzw. sich nur zögernd entbergende Sein,welches nur Taoisten kein Problem ist, undtatsächlich spiegelt sich bei Heidegger und seinenSchülern – schon von Nietzsche her – so manchesÖstliche, an das von Nishitani bis in zeitgenössischeEssays heute gern angeknüpft wird.6
Eine pragmatische Relativierung von Vorwürfen, bzw.prinzipiellen Unterschieden des Erkenntnisgestus der
6 Etwa bei Byul Chul Han in dem Buch Abwesen, Berlin, Merve 2007, das gerade dort Schwächen hat, wo es sich auf Heidegger bezieht. Heidegger ist eine Art signifikanter Ankerpunkt für Han, wenn an sich seine durchaus wichtige gesellschaftskritische Positionen, sei es die Kritik der Technik oder die der Medien, durch unnötige Rückgriffe auf ontologische Formeln daherkommt. Es ist ein ungünstiger Schematismus, wenn Sein und Nichts als Anwesen und Abwesen dem Westen und dem Osten zugerechnet werden.
7
beiden Grundrichtungen (Kommunikationstheorie versusOntologie) dürfte also nicht erfolgversprechend sein.Zu gegensätzlich liegen die Grundüberzeugungen –wobei der Gegensatz übrigens um so schärferhervortritt, als er sich strukturell gleichartiggebärdet. Beides sind ja Entwürfe, dieErkenntnisgewinn und Prozessualität verknüpfen, beidegeradezu Augustinisch „christlich“ auf einem „Weg“,der, wenn schon nicht zum Reich Gottes, dann aberdoch wenigstens vom Dunkel ins Licht führen soll ,wenn auch auf sehr gegensätzlich Weise - Exakt hierliegt nun das intellektuelle Motiv des hiervorgeschlagenen Korrespondenzbegriffs, von dem ichdamit behaupte, dass er nicht nur eine beliebige Ideeoder ein anderer Begriff für Kommunikation ist,sondern eine wirklich wichtige, wenn nicht garnotwendige Folge im eben referierten Streit des 20.Jh. Die Philosophie der Korrespondenz(en) geht von einemgemeinsamen Defizit der eben referierten Positionenaus. So fundamental sich Heidegger und das rationaleDiskursmodell nämlich unterscheiden, so ähneln siesich doch auch in einer Hinsicht, insofern sich beiihnen – sowohl für den Weltprozess der Kommunikationund seine Diskursinstitutionen, (die ja heute vorallem politisch definiert sind) wie auch für das sichaisthetisch entbergende Seinsgeschick – zunächst
8
einmal vor allem eine fundamentale Distanz zwischenDenkbemühung und den sich ihm immer wiederentziehenden Erkenntnisgegenständen dieses Denkensaufwirft. Wir fühlen uns unwichtig, abgeschlagen, jagar nicht mehr in Betracht kommend, angesichts derausufernden Aufgaben, die sich vor uns türmen. Wirhaben irgendwie den entmutigenden Eindruck, wirbräuchten gar nicht erst anfangen, in denVerstrebungen der Habermasschen Domes derDiskursvernunft umherzusteigen, (der immer mehr demKonferenzgetürm der europäischen Gemeinschaftähnelt), und auch Heideggers endlose Fragekettenbringen uns nur quälend langsam und zentimeterweitvorwärts auf einem unendlich langen Weg, wenn sich imfragenden Suchen nicht überhaupt alles auflöst injenes seit Hölderlin gern zitierte „Gespräch das wirsind“, ein Geschehen eben, das uns aber auch nichtzufriedener macht, es sei denn, wir wollen selber garnichts mehr außer hören - etwa auf die Sprache, wasbei meinem Lehrer Manfred Riedel zum Beispiel zueinem Buch über die „akroamatische“ Dimension derPhilosophie führte, also ins „hörend Sprechen“ und„sprechend Hören“ – eine Ausarbeitung der bekanntenWendung Schlegels, den literarischen Prozessbetreffend.
9
Habermas würde also dem eventuell noch auffindbarenfrivolen Selbstdenker mit Weltperspektive zu bedenkengeben, dass der „Philosoph“ im emphatischen Sinnesowieso erledigt sei, eine zeitabgewandte Figur desromantischen Subjektivismus, der vermessen an irgendeinem Randgebiet der Milchstraße der Diskurseoperierend nach einem Zentrum sucht, während dergroße Welt-Diskurs für ihn in Wirklichkeit dochbestenfalls eine Arbeitsstelle bereithält - alsUniversitätsbeamter, Soziologe, Statistiker, Europa-beamter, Redakteur oder künstlerischerSozialarbeiter. Die Erben Heideggers dagegen, die ja schonprinzipiell erhaben sind gegenüber dem „sekundärenGeschwätz“ der Diskurse geben sich auf ihre Weiseganz ähnlich. Vor ihrem Blick – wir ahnen es – werdenwir gar nicht mehr alt genug, um jemals den Horizontzu erblicken, vor dem sich das Seins-Verstehenwirklich entfaltet. „Nähern“ mögen wir uns – gewiss,aber doch wohl eher wie Moses dem gelobten Land, alsoohne es zu betreten und in einem „stets vergeblichen“Begreifen, das zugleich das „Begreifen derVergeblichkeit“ ist und sich uns in den „Näherungen“sogar „ganz besonders entschieden“ entzieht, undsomit im Ganzen keineswegs zufällig an jenen Prozesserinnert, den Elias Canetti einst im Hinblick auf dieGeschichte der römisch-katholischen Kirche
10
beschreibt, einem Prozess der ritualisiertenVerlangsamung, dessen Priesterschaft im Lauf derJahrhunderte das jüngste Gericht, die Erlösung bzw.den Trost des Ankommens unendlich weit hinausschob,um die Zwischenzeit mit den Ritualen der Macht (bzw.der Macht des Rituals) zu füllen.
III Die Philosophie der Korrespondenzen
Die „Ästhetischen Korrespondenzen“ die mittlerweilezwanzig Jahre alt sind, waren ein Entwurf, der -eine Grundlegung nur skizzierend - acht möglicheAnwendungen einer Philosophie der Korrespondenzlieferte, die tatsächlich im philosophischenHochgespräch ankamen, (Sloterdijk etwa stelle sie ineine Linie mit Schmitz’ und Bollnow),7 die aber alsEinzelerscheinung nicht ausreichten, einen Trend inGang zu setzen. Sie erschienen entweder alsinteressante Alltagsphänomenologie und Rückkehr zuHusserl oder gar als Variante derKommunikationstheorie, wurden als „geistreich“ in derPresse gelobt, wenn sie überhaupt eingeordnet werdenkonnten. Damit ging es ihnen ganz ähnlich wie dem„ästhetischen Denken,“ das Wolfgang Welsch zur selben7 Sloterdijk, Peter, Sphären II (Globen) Ffm. 1998 - 2004 Bd. 2; S. 145/46.
11
Zeit entwickelte. Auch daraus wurde, wie man weiß,kein echter Trend, sondern eher schon wurden seineBemühungen als eine Kommunikationstheorie mit Kunst-Schwergewicht gelesen, d.h. als Versuch,Kommunikation selber von einem auf Kunsteingeschränkten „ästhetischen“ Standpunkt aus zubetreiben. Das „ästhetische Denken“ selber erhieltalso zwar seinen Platz – aber letztlich eben doch nuran den Kunstakademien.
Was unterscheidet nun eine „Philosophie derKorrespondenzen“ vom Denken in Kategorien derKommunikation einerseits oder der traditionellenOntologie andererseits? Genauer: Was unterscheidetden Horizont der Stimmungen, Näherungen, Differenzenund Atmosphären vom Horizont der Diskurse oder desVerstehens in der neueren Hermeneutik? Ist„Korrespondenz“ nicht doch bloß wieder ein neuerName, um das ästhetische Defizit desKommunikationsbegriffes zu beheben? Ist eineKorrespondenzphilosophie also wirklich ein neuerSchritt? Die nächsten Überlegungen sollen dieserläutern.
a. Nicht zwingend, nicht beliebig - Näherungen:
12
Das Wort Korrespondenz hat seine Wurzeln imlateinischen „respondere“, das heißt erwidern. Co-respondere ist Zusammenstimmen zur Erwiderung,genauer, Gewichte (auch Stimmen im gerichtsprozess)zusammentragen, um ein Gegengewicht zu erzeugen. Esist ein Begriff, der sowohl die Verbindung selber(franz. les correspondances) als auch eine Praxisbezeichnet (etwa das Briefeschreiben). Die„Korrespondenzen“ – etwa Geschäftskorrespondenzenoder der Austausch von Gesellschaftsklatsch in den„Korrespondenzblättern“, den Vorläufern derBildungszeitschriften – waren zunächst Sammlungen vonBriefen, Rezensionen oder gesellschaftlichenMitteilungen in Zeitschriftenform. Man konnte durchdie Lektüre der „Korrespondenzen“ erfahren, wie gutoder schlecht ein Theaterstück vom Publikumaufgenommen wurde, wie die politische Stimmung ineiner Fraktion des englischen Unterhauses war, (Mandenke an die ersten Korrespondenzdrucke Walpoles, andie Organisation der „Presse“, an Rezensionsblätter,etwa die „Nürnberger Blätter“ des 18 Jh. anEinblattdrucke als Flugschriften usw. usf) wie dasHandelsklima, die politische Lage hier oder da waren,und was sonst noch in einem Milieu eingeschätzt,werden sollte, in dem man sich z. B. in der gutenGesellschaft mehrmals täglich Briefe von Ost- nach
13
Westlondon schrieb, d.h. in einer Zeit, in der einegemeinsame Atmosphäre des politischen Zusammenseins(„Öffentlichkeit“) überhaupt nur durch ständige,aktive „Korrespondenz“ aufrechtzuhalten war).
Korrespondenz ist also seinem Grundverständnis nachein Zusammenstimmen und eine dauernd durch gewisseaufeinander zu laufende Korrespondenz-Tätigkeiterzeugte Beziehung, eine Art Atmosphäre im Sinneeines unabgeschlossenen Geschehens-Prozess, des „Hinund Her“ von Mitteilungen vor dem Horizont dergemeinsamen Situation. Es ist ein Prozess, in demdiese Situation nicht nur beschrieben oderinterpretiert wird, sondern auch gleichzeitig erzeugtund mitgestaltet.
In diesem einfachen Sinn ist KorrespondenzGemeinschaft als Geschehen ein Sich-Verhalten unddauerndes Abstimmen angesichts einer Lage oderSituation, die dadurch in ihrer Vielschichtigkeitmitgestaltet und verändert wird. Korrespondenz stehtalso in einem poietischen (poiesis = Hervorbringung)Verhältnis zur Atmosphäre „in“ der sie scheinbarstattfindet, die sie aber tatsächlich gestaltet. Dasist ein Geschehen, das man sich nicht intensiv genugvorstellen kann und das auch seine historischenHöhepunkte hatte, man denke nur an die Rolle der
14
Musik und des Theaters im Zeitalter des Barock oderan die Druckerpresse im Zeitalter der entstehendenpolitischen „Öffentlichkeit“ in England. – Publicity(und das heißt ja publizierte Schriften) und auchunsere heutige „Öffentlichkeit“, die man mit demunscharfen Begriff der Medienöffentlichkeit zu fassensucht, ist ja nichts anderes als die Atmosphäre derständigen Korrespondenz, also eines Geschehens, andem man als gebildeter Zeitgenosse überall und immerteilhat und andere teilhaben lässt. Wer die sog.Sozialen Medien des Internets nicht als kindischeSurrogate einer anderen Wirklichkeit unterschätzt,weiß was gesagt ist.
Versuchen wir das „Geschehen“ der Korrespondenz zucharakterisieren, so können wir sagen:Korrespondenzen sind Verbindungen, die nicht beliebig, aberauch nicht notwendig sind und dabei dennoch einenbedeutsamen Zusammenhang herstellen, indem vieledaran teilnehmen. Das Netz einer Untergrundbahn etwawäre ein ganz spezielles Reich der Korrespondenzen,aber auch die sogenannte „Zeitungslandschaft“ oderein festlicher Ball oder ein bürgerlicher Salon des19. Jh. und seine Weiterungsformen in unserer ZeitWenn man will, ist jede Verbindung in diesenZusammenhängen eine „Korrespondenz“, soweit sienämlich nicht bloß kausal oder nur logisch ist,
15
soweit sie also eine gewisse Willkür hat, d.h.genommen benutzt werden kann oder auch nicht.Facebook ist eine computergestützteKorrespondenzmaschine unserer Zeit. Wer „Facebook“benutzt weiß, dass er damit schlecht„kommunizieren,“ d.h. sich verlässliche Nachrichtensichicken kann. Doch kann er damit ben sehr gut„korrespondieren“ kann. Der Unterschied zwischenKommunikation und Korrespondenz ist natürlichgewaltig. Ja er ist eventuell heute einentscheidender Faktor des gelingenden Miteinanders!Der wichtigste Unterschied dürfte sein, dassKorrespondenz nicht nach notwendigen, sondern nachrelativ willkürlichen wenn auch nicht ungeordnetenoder zufälligen Prinzipien vonstatten geht. DieseWillkürlichkeit – die ja dennoch gewisseVoraussetzungen und Regeln hat - könnte man als topo-logisch bezeichnen. Man könnte Korrespondenzen also alstopologische Verbindungen bezeichnen, alsVerbindungen einer „logik“ zweiter, schwächererKonsequenz, die aber urchaus ihre Gesetze hat.Denken wir hier etwa an die Aristotelische Topik, dieeine Logigk der Gerichtssprache ist, so zeigt sich,dass sich Gesprächsansätze nicht etwa aus logischemZwang ergeben, sondern meist durch Parallelität, durchKontrast oder Ähnlichkeit, durch das Verhältnis vom Teil undGanzem, durch der Kombinationen von Bekannten mit
16
strukturell gleichen unbekannten Dingen, durchProzessformen des Miteinander die also nicht kausalvorgegeben oder logisch zwingend, aber auch nichtvöllig beliebig, sondern sich eher durch unserealltäglichen Umgang mit den Dingen und mit andereneinschleifen.
Diese „topischen“ Umgangsweisen führen zu denverschiedensten Reaktionen, zu einem „Hineingeben“von „input“ in eine Gesamtatmosphäre, die vom Inputzugleich hergestellt wie auch auch in einem weitenSinn gesteuert wird, so dass ein einzelnerkommunikations-Vorgang im einen Fall durchaus„zwingend“ sein kann, und im anderen beliebigerscheint, so wie auch die Benutzung derKorrespondenzmaschine (etwa facebook) genauso ständigÜberraschungen oder Aha-Erlebnisse bergen. Korrespondenzbeziehungen sind also (das müsste ineiner eigenen Arbeit dargelegt werden) als topischeBeziehungen zu charakterisieren. Es sind Beziehungen,die gewissermaßen einen flüssigen, unbestimmten Teilhaben, die - wie korrespondierende Tänzer auch nieaufhören, sich gegenseitig zu neuem Einsatz zureizen, die eine erstaunliche Phantasie entwickelnohne jedoch ganz von einem Grundmuster der möglichenVerbindungen ihrer Bewegungen abzuweichen – (Ein guteBeispiel wäre der Tango oder das Tanzen überhaupt).
17
In einem erweiterten Sinne könnte man auch von einem(offenen) Gespräch oder von der Liebe als typischenKorrespondenzbeziehung sprechen, so wie ja auch z. Beine entstehende Liebesbeziehung nichts Zwingendes,aber eben auch nichts Beliebiges hat.
Die Beziehung der Korrespondenz kommt gewissermaßenzwischen Zufall und Notwendigkeit zustande – in dieserForm aber regelmäßig und in vielen Fällen ganzähnlich einem allgemeinen Gesetz, dem wir unterworfensind. Ja wir müssen zugeben, dass die allermeistenBeziehungen zwischen Menschen solche derKorrespondenz sind, dass es sich dabei umschöpferische, lebendige Beziehungen handelt, dierational nie ganz eingeholt werden können, da immerVieles mit-spielt, und die in ihrem Zusammenspielzugleich den Horizont miterzeugen vor dem sie gültigsind, so wie sie sich auch wieder verlieren. Ichmöchte behaupten, dass ist der wahre Gang dersogenannten „Kommunikation“ während das von denheutigen Kommunikationsspezialisten bearbeitete Feldeinen vergleichsweise bescheidenen Teil derWirklichkeit ausmacht, den wissenschaftlichengewissermaßen, was es aber noch gründlicher zubedenken gilt.
18
b. „Den gleichen Gott anbeten“: Das Modell:
In einem strukturellen Modell, mit dessen Hilfe manden Sachverhalt versuchsweise vomKommunikationskonzept unterscheiden kann, könnte manvorschlagsweise sagen, Korrespondenz ist einedreiwertige Relation. Im Unterschied zur bipolaren Relationdes Kommunikationsmodells, in der ein Sprecher(Proponent, Sender) A – mit einem Hörer (Opponent,Empfänger) B kommuniziert um zu einem Verständnis,einem „Ergebnis“, einer Abmachung, einem Beschluss ineiner Kommunikationsgemeinschaft zu kommen – (und auchim Unterschied zum sich offenbarenden oder verbergendenWesentlichen bei Heidegger, (und ob nun im An- oderim Abwesen ist dabei auch völlig gleichgültig –soweit zu B.U. Han), sagen wir im Sinne derKorrespondenzphilosophie: Der Korrespondent (A)korrespondiert mit einem Korrespondenten B angesichtseines gemeinsamen Horizontes H, der in dieserKorrespondenz nach und nach „aufscheint“, bzw.erzeugt und aufrechterhalten wird oder auch wiederniedergeht oder schwindet. - „Aufscheinen“ undSchwinden, „Horizont“ usw. ist eine Sprechweise, dienicht ohne Absicht auf die Sprechweise derHermeneutik anspielt, etwa Gadamers „Wahrheit undMethode“.
19
Sie besagt, dass Korrespondenz nicht willkürlichherstellbar ist. (wie auch Atmosphäre eben gerade nichtso einfach als „quasi-objektiver Gegenstand“hergestellt werden kann) vielmehr „scheint“ sie aufoder entwickelt sich, etwa wie ein Hellwerden, indemdie Beteiligten dazutun. Dieses „Dazutun“ ist keinSprach-Handeln angesichts eines „Leibgefühls“ undauch keine diskursive Verhandlung mit konkretem Ziel,jedenfalls ist es nicht etwas so Einfaches, wie eineEinigung oder eine Abmachung. Stattdessen könnte manviel besser von einem werdenden und auch wiedervergehenden „Kunstwerk“ sprechen, einem Kunstwerk austastendem Beginn, einstimmendem Zeichengeben,eventuellem Zögern, den Gesten der gegenseitigenAchtsamkeit und somit des tastend spielerischenErzeugens einer produktiven Spannung – einesGeschehen zwischen „Erfahren“ (aisthesis) undmiteinander im „Diskurs“ sein.
„Korrespondenz“ ist also das begriffliche Mittelglied zwischen Diskursund Erfahrung. Korrespondenzbeziehungen sind nichtbestimmt, aber auch nicht willkürlich, sondern dasGeschehen „dazwischen“, das im Gegensatz zu Diskursund Entbergen keinen Fortschritt außer Intensivierungkennt und keinen Prozess irgendwohin markiert,sondern immerwährend geschehen, angeknüpft,
20
verstärkt, abgeschwächt aufgelassen, oder abgebrochenwerden kann.
„Korrespondenzdenken“ ist das Fruchtbar-Machen einerSituation im Sinne des Miteinanders – einesGeschehens, das um uns herrscht und an dem wirzugleich verstärkend oder abschwächend mitwirken.Kommunikation ist im Unterschied dazu eindiskursiver, auf eine Abmachung oder Einigunghinarbeitender Verlauf gegenseitiger Erläuterungen,eventuell auch „Angriffen“ und „Verteidigungen“ von„Proponenten“ und „Opponenten“ mit ihren jeweiligenZielen. Korrespondenz hat kein bestimmtes Ziel außerdem des fruchtbaren Miteinanders selber, es greiftnicht fundamental an und es insistiert nicht - undvieles, was heute Diskurs genannt wird, wäre längstbesser als Korrespondenzgeschehen bezeichnet.Korrespondierendes Sprechen etwa beansprucht –stärker oder schwächer und von Moment zu Momentvariierend – die gelingende Gemeinsamkeit im Vollzug,im idealen Fall Festlichkeit!
Der „Diskurs“ hat im Unterschied dazu das Ziel einerEntschließung. Er beansprucht ein Ergebnis, ein Sich-Einrichten und Resignieren im Beschluss. Andersausgedrückt - wenn „Kommunikation“ an ihrem Ziel ist,ist ein Abschnitt erreicht. Es drohen gewisse Folgen
21
oder die Folgenlosigkeit; und es muss schleunigsteine neue „Kommunikation“ begonnen werden um dieFolgen der ersten Kommunikation zu kontrolleiren.Wenn Korrespondenz an ihrem „Ziel“ ist, wird esglückhaft oder zumindest glücksversprechend. Dassdies eine idealtypische Konstruktion ist, verstehtsich, aber es zeigt auch, dass beides zugleich derFall sein kann – Kommunikation und Korrespondenz.Diskurs setzt glückende Korrespondenz sozusagenvoraus – andernfalls verhandelt man wie kriegerischeParteien - und dabei kommt erfahrungsgemäß meistnicht viel heraus. Die Änderung der kommunikativenProzesse beginnt meist auf der Ebene derKorrespondenzen – etwa bei der Atmosphäre.
c. Konsequenzen
Hier wird klar, dass Kommunikation, die Welt derDiskurse und ihre Institutionalisierung (etwa eineAbrüstungkonferenz oer ein Vertrag) viel „stärker“sind als die Verhältnisse, die durch den AusdruckKorrespondenz bestimmt sind. Korrespondenz ist„schwach“, aber sie ist allgegenwärtig und diemeisten unserer Verhaltens- und Handlungsbeziehungen
22
sind offenbar „nur“ korrespondierenderArt. Das „Dazu“im Dazutun zu einer gemeinsamen Situation machtdeutlich, dass man in Fragen der Korrespondenz nichtswirklich „wollen“ kann, man kann nur mit einemallgemeinen ungefährem Ziel – sich dabei weitoffenhaltend - verstärken oder abschwächen,verbinden, kombinieren, aufgreifen, spannen,entspannen, subtil drängen oder vorsichtig zögern,aber nie einfach „sich verstehen“, sich „einigen“oder gar einen „Vertrag schließen“ kann.Korrespondenz könnte, begrifflich genommen, auch dieideale Beschreibung der Form des zeitgenössischenpolitischen Engagements der Masse „für“ oder „gegen“eine politische Position sein. Nicht dieEntschiedenheit, scheint es, zählt heute politisch,sondern die sich verstärkende oder abschwächende,gewissermaßen wogende Bereitschaft zurÜbereinstimmung d.h. zum Beitrag an die gemeinsameSituation. Es ist wie bei der Liebe. Jeder wirdeinsehen, dass man in Fragen der Liebe alsSpezialfall glückender Korrespondenz nicht einfachetwas herstellen kann, denn Liebe ist keinGegenstand, sondern ein geschehen. – Sie ist vielmehrein gegenseitiges Erfahrungs-Geschehen, also etwas,das man zwar wollen, das aber dennoch glücken oderverunglücken kann. Liebe ergibt sich und wirdverstärkt oder sie schwächt sich im Prozess
23
derKorrespondenten wieder ab - wie ja auch Hass oderKrieg nicht einfach begonnen oder beendet werden,sondern sich gewissermaßen „einschleichen“.
Die Verhältnisse der Korrespondenz „schaukeln“ sichauf, wie die Liebe oder auch der Streit der sichehemals Liebenden. Irgend etwas – ein Keim – istimmer schon da. Vielleicht fehlt auch etwas, dessenFehlen sich mit der Zeit als Grund schwindenderKorrespondenz oder gar sich hochschaukelnderFeindschaft herausstellt. Eine Philosophie derKorrespondenzen will jedenfalls darauf hinaus, dasswir in vielen und womöglich sogar den wichtigstenFällen des Miteinander nur mit-tun oder dazu-tun,verstärken oder im Zögern abschwächen können, dasswir also prinzipiell Korrespondenz suchen oder meidenund sie in diesem Sinne durch Teilnahme oderAbseitsstehen als ein Beziehungsgeschehen für unsfruchtbar machen oder es eben lassen. In den meistenwichtigen Fällen des Lebens „einigen“ wir uns nämlichnicht und wir „verstehen“ uns auch nicht. Wirkorrespondieren aber trotzdem gut - und dies scheintsogar unser ganz besonderes Glück zu sein.
Korrespondenz scheint gegenüber den Fällendiskursiver Prozesse (man denke an politische überJahrzehnte sich erstreckende oder
24
institutionalisierte Verhandlungs-Prozesse,) einVerzicht auf Freiheit und Selbst-Setzung.Orientierung an Korrespondenz scheint fast eineErgebung in den Gestus der blossen Teilhabe. Dochunterscheidet es sich auch davon, denn Korrespondenzbeschränkt sich nicht auf Teilhabe und Erfahrung,sondern ist immer auch zugleich Gestalten undBeitragen. Ansonsten behaupte ich, dass wir erstdurch gelingende Korrespondenz wirklich glücklich seinkönnen, während wir durch die Kommunikation und ihreDiskurse nur erfolgreich sein können und eben nieglücklich, selbst wenn wir erfolgreich wären – unddass uns Heideggers „Entbergung des Seins“ am Endeder Tage nicht glücklicher macht ist hierbeivorausgesetzt. Anders ausgedrückt: Glück ist nichtder Vertragsabschluss mit der Welt, sondern Gelingen. Insofern gibt es für den Philosophen derKorrespondenz auch keine Gegnerschaft oder endgültigePolarität, sondern nur das Aufbauen oder dasAbschwächen von Korrespondenz. Korrespondenz ist oderist nicht, so wie in jenem Lied Bert Brechts in derDreigroschenoper, wo es heißt, „die Liebe dauert oderdauert nicht, an diesem oder jenem Ort.“ Sie kannnicht eingefordert werden, und „verstehen“ werde ichden anderen sowieso nie. Ich kann einem produktivenMissverständnis unterliegen und glauben, ihn zuverstehen. Ich kann mich auch mit ihm einigen – doch
25
wer weiß, welche Irrtümer meiner Einigung zugrundeliegen und wie lange die Abmachung hält, ob also meinGlaube nicht irgendwann durch (wieder geglaubte!)neue Klarsicht enttäuscht wird und ich inWirklichkeit nur wieder neu betrogen bin. Statt aufEinigung und Durchschauen zu zielen, geht diePhilosophie der Korrespondenz also davon aus, dassdie Dinge der Wirklichkeit selber „verkettet,verfädelt und verliebt“ sind, dass wir in dieseVerhältnisse eingewoben sind, auch und gerade inunseren naturwissenschaftlichen und technologischenErkenntnisprozessen, die oft genug von technischenProzessen gar nicht zu trennen sind. –
Die Philosophie der Korrespondenz ist alsopragmatisch. Sie ist - auch auf dem Gebiet derErkenntnis - weniger interessiert an der Differenzzwischen den Systemen unseres „Verstandes“ und der„Welt“. Es geht ihr nicht um Wahr und Falsch. Siebetrachtet sich stattdessen als schon immerinvolviert in das, was sie selber ist - dieBeschreibung und das Veranstalten von Korrespondenzals einem nie abschließbaren Geschehen, in dem wirnur eines wollen - Gelingen. – „Erkennen“,„Verstehen“ oder „Verändern“ von „Wirklichkeit“ sindnur Varianten dieses Involviert-Seins bzw. derKorrespondenz, und ob in Liebe oder Krieg, das ist
26
letztlich nur eine Frage des jeweiligenTäuschungsgrades über den Sinn unseres „In-der-Welt-Seins“, womit gern ein wenigstens abstraktes Votumfür die Bemühung um durchaus auch abstrakteRationalität abgegeben sei. Mehr als erkennen zuwollen, geht aber nicht und die höchste Form der„Erkenntnis“ ist nicht das schonungslose Bild desanderen, sondern der Liebesakt und ohne diesenwenigstens die möglichste Schonung! Korrespondenz istalso der schöne und in jedem Lächeln gelingendeVersuch, unseren produktiven Täuschungen wenigstenseine gemeinsame Läuterungsabsicht entgegenzuhaltenund – platonisch - das Wahre mit dem Guten zuversöhnen.
IV Atmosphäre
Und nun zuletzt nochmals zurück zur Atmosphäre, dasie inzwischen ein ja oft behandelter Topos gewordenist: Von den „quasi-objektiven“ Gegenständen Böhmeswar bereits die Rede. Für Böhme scheinen Atmosphärengewissermaßen Gegenstände zu sein an denen wirmanipulativ tätig werden können. Diese Ansichtentspricht mir zwar mehr als die Formulierung, wirseien ihnen als „Mächten“ unterworfen (Schmitz),andererseits kommt er mir trotzdem einseitig vor undich schlage daher nunvor,
27
„korrespondenzphilosophisch“ auf ein Zugleich zuzielen: - In direkter Übersetzung aus dem Griechischensprechen wir ja metaphorisch vom „Atem der Dinge.“ –Räume, Gegenstände, Menschen, Geschehnisse, derAuftritt eines Menschen in Gesellschaft, eineFußballweltmeisterschaft, all dies kann in einemübertragenen Sinne tatsächlich so beschrieben werden,als ginge davon ein „Hauch“ aus oder gar einebannende Macht. Andererseits tragen wir zu diesenDingen aber auch selber bei, ja die Tatsache, dassunsere Tätigkeit in den „Atem“ eines Gegenstandeswesentlich eingeht und in Spuren sichtbar oderwenigstens denkbar bleibt, ist für die Atmosphäresogar entscheidend. Von einem gut gebundenen altenBuch, in das also auch handwerklich viel Müheeingegangen ist, geht in diesem Sinne ein anderer„Atem“ aus als von einer ÖTV-Broschüre gleichenInhalts. Von einer Buddha-Figur geht ein andererHauch aus als von einem Hydranten und auf einemFußballplatz herrscht eine andere Atmosphäre als ineinem Dom. Dies hat aber weniger damit zu tun, dasswir der Atmosphäre „unterworfen“ sind und angesichtsihrer poetisch um Sprache ringen, wie Schmitz sagt,8
8 In einem Brief an den Verfasser v. 7. Juli 2013 (im Besitz d.Verf.) heißt es: „Der Inhalt von Atmosphären ist nichtnumerisches Mannigfaltiges. Atmosphären können zwar durchArrangement...heraufbeschworen werden aber in ihnen gibt es keine Berührungen und daher keine Korrespondenzen. Mit dem
28
sondern eher damit, dass sie uns als unser eigenesgesellschaftliches Tun und Treiben nun plötzlich vonaußen entgegenzutreten scheint! – Was uns alsogelegentlich anrührt, ist keine Macht, sondern eherschon unsere eigene Machtlosigkeit angesichts derNatur oder der Ergebnisse kollektiven Tuns, die unsals gesammelte Atmosphäre entgegentreten und unsmitreißen, insofern wir ja korrespondierender Teilderselben sind. – Wir empfinden diese Situations-Atmosphäre in einem Stadion wie in einem Dom und auchin einem fremden Land, dessen Religion wir nicht oderkaum kennen.
Unsere Sensibilität für das Atmosphärische istimmens. Aber unsere Vorlieben sind im historischenund persönlichen Fluss. Im Lauf der Zeiten wandelnsich die Schwerpunkte unseres Verlangens und auch dieatmosphärischen Kerne unserer Wahrnehmung. So wurdeim frühen Mittelalter durch ein Loch im Sarkophageines Heiligen, dessen „Atmos“ für die Andächtigenzugänglich gemacht. Man konnte, die Hand konkret indie Nähe des Verwesenden bringen. – Später übernahmdie Reliquie die Rolle des atmosphärischen Trägers. -Sie hatte den Vorteil der Transportabilität, war aber
Betroffensein von Atmosphären gehen wir in den Bereich zurück,aus dem Einzelheit in Kraft satzförmiger Rede erst geschöpft werden kann. Das ist namentlich die Leistung des Dichters....“(Brief i. Bes. d. V.)
29
noch ein Gegenstand mit mehr als nur symbolischerAnwesenheitsatmosphäre. Mit der Reliquie wurde der„Atmos“ des Heiligen am neuen Ort implantiert. Um dieReliquie entstand die Kirche, drum herum das Kloster.Um das Kloster entstand die Gemeinde, die der Kultusregierte und ohne diesen atmosphärischen Kult ist dieGeschichte des Christentums schlecht denkbar. - Der„Hauch des Paradieses“, von dem im Mittelalter überJahrhunderte die Rede ist und der Leichenduft, denman schon in den römischen Katakomben mit Myrreüberdeckte, haben unsere atmosphärischen Organe hiersozusagen über zwei Jahrtausende gebildet. Alte kühleMauern, Schimmelpilze, Verwesung, Brandurnen undMyrre, das erschien uns bisher „heilig“. - Heute korrespondieren wir – sehr viel nervöser undsensibel für Alles und Jedes mit einer Vielzahl vonatmosphärischen Signaturen von der Architektur biszum Hit aus dem Autoradio. Unsere Städteplanerrichten hochsublime Umgebungen her – schaffen alsoganz im Sinne Böhmes Korrespondenzbühnen fürflanierende Massen, ob sie nun Einkaufs- oderKunstmeilen heißen. (Ich habe dazu unter demStichwort „Das Prinzip Mall“ einen Aufsatzveröffentlicht, der das Flanieren als dasatmosphärische Kunstwerk Benjamins aufnimmt) sowieauch Kunsttempel für die Anspruchsvollen, während dieKünstler zugleich die atmosphärischen Wüsten
30
beziehen, welche entstehen, weil unseregeschmacklichen Präferenzen für diese oder jeneAtmosphäre nicht mehr ausreichen. Ein Einkaufszentrumder 70iger Jahre, alte Fabrikhallen, aufgelasseneWarenhäuser, das finden wir atmosphärisch heute nichtmehr befriedigend, aber dafür eben vielleicht„spannend“, in einem neuen Sinn! D.h. wir verweigerndie alten Korrespondenzen. Wir siedeln Künstler insolchen Quartieren an, denn wir hoffen, dass sie neueKorrespondenzen herstellen und vermitteln.
- So leben wir – scheinbar in einer Welt derwechselnden Atmosphären und im Atem der Dinge,tatsächlich aber wohl besser in einer Welt derKorrespondenzen – der gelingenden oder misslingenden,der alten und neuen, der aufgenommenen und deraufgegebenen Korrespondenzen, welche in ihrem Spieleben Atmosphären hervorbringen – ja wer weiß sogareine Welt-Atmosphäre. - Der atmosphärische „Atem“der Skyline von New York, das mediale Geschehen, dasuns in der Vorhalle eines großen Ausstellungsgebäudeszu umfluten scheint, eine Kerze, die man entzündet umder Atmosphäre der Nähe und Gemeinsamkeit einesSitzens am Restlagerfeuer unserer Zivilisationzuzuarbeiten, erzeugen den Eindruck, hier oder da„geborgen“ zu sein. Die Pfleglosigkeit und mangelnde
31
Korrespondenz gewisser Areale erzeugt den Eindruckhier oder dort nicht geborgen, bzw. verloren zu sein.
Diese Atmosphären herrschen „dort“ nicht unabhängigvon uns, vielmehr entspringen sie dem Fluss derKorrespondenzen, einem „poietischen“ Geschehen desInnenaußen, das uns mal „zuhause“ sein lässt, wenn wirbeginnen, die Grenzen zwischen „außen“ und „innen“aufzulösen, und das uns ein anderes Mal entlässt odergar verstößt, wenn wir die Korrespondenzen nicht mehrherstellen wollen, aufkündigen oder schlicht beendenmüssen. Warum fühlen sich ältere Menschengelegentlich „verloren“ und warum ist die Atmosphäreder ängstlichen Verlorenheit oder das Unheimlicheihnen näher als den Jüngeren? Es ist die bei ihnendrohende oder mitunter gespürte Auflösung und dasUnsicher-werden aller Korrespondenzen – diealtersbedingte Abschließung der Welt, die doch eineAbschließung ihres Leib-Ichs ist, während den jungenMenschen die Welt bekanntlich zu umarmen scheint. -Im großen Feld der Korrespondenzen ist die Atmosphärealso ein aufschlussreiches Phänomen, das vielfachzutreffend beschrieben ist, der Grundbegriff scheintmir aber auch hier nicht Atmosphäre, sondern ebenKorrespondenz zu sein.
32
Literatur
Böhme, Gernot: Atmosphäre als Grundbegriff einer neuen Ästhetik“, in Kunstforum International 120, 1992.//Ders.: Essays zur neuen Ästhetik, Suhrk. 2013.//Han, Byul Chul, Abwesen, Berlin, Merve 2007.Heidegger, Martin 1935, 1956, 1960, 1982...ff. Der Ursprung des Kunstwerkes//Knodt, Reinhard (1994) Ästhetische Korrespondenzen, Reclam UB 8986 Stuttgart.//Schmitz, Hermann: 2009, Der Leib, der Raum und die Gefühle. // Schmitz Hermann, Brief an den Verfasser v. 7. Juli 2013 (im Besitz d. Verf.)//Sloterdijk, Peter, Sphären II (Globen) Ffm. 1998 - 2004 Bd. 2; S. 145/46.
33