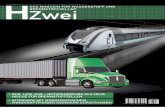Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und...
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und...
Nervenarzt 2009 · 80:875–886DOI 10.1007/s00115-009-2812-3Online publiziert: 12. August 2009© Springer Medizin Verlag 2009
T. Brandt1 · A. Zwergal2 · K. Jahn2 · M. Strupp2
1 Institut für Klinische Neurowissenschaften, Klinikum Großhadern, Universität München2 Neurologische Klinik, Universität München
Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomotorikstörungen
Leitthema
Mit der Förderung krankheitsgebiets-bezogener klinischer Forschungs-zentren möchte das Bundesminis-terium für Bildung und Forschung (BMBF) geeignete Initiativen an den medizinischen Fakultäten und Uni-versitätsklinika im Rahmen des Pro-gramms der Bundesregierung „Ge-sundheitsforschung: Forschung für den Menschen“ unterstützen. Vor-gesehen ist die Förderung innova-tiver Forschungs- und Behandlungs-zentren, in denen die klinische Spit-zenforschung zu spezifischen Krank-heitsgebieten durch ein integra-tives Miteinander von klinischer For-schung und Krankenversorgung auf höchstem Niveau befördert wird. Mit den Integrierten Forschungs- und Behandlungszentren (IFB) soll die wissenschaftliche Wettbewerbs-fähigkeit erhöht, eine stärkere Nut-zung der vorhandenen Ressourcen für leistungsstarke Bereiche und zu-gleich ein effektiver Transfer von For-schungsergebnissen in das Versor-gungsgeschehen befördert werden.
Wissenschaftliches und strukturelles Gesamtkonzept des IFBLMU
Schwindel ist eines der häufigsten Leit-symptome in der Medizin (Lebenszeit-prävalenz ca. 30%). Dennoch besteht na-
tional und international eine Unter- und Fehlversorgung dieser Patienten. Dies führt dazu, dass Betroffene nacheinander Ärzte unterschiedlicher Disziplinen (z. B. Neurologie, HNO, Innere Medizin, Or-thopädie, Psychiatrie) aufsuchen mit un-nötiger apparativer Diagnostik, Zuord-nung zu falschen Diagnosen und mangel-hafter Therapie. Häufig resultieren dar-aus lange Phasen von Arbeits-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeit mit beträchtlichen psychosozialen und ökonomischen Fol-gen. Interdisziplinär ausgebildete Spezia-listen können die verschiedenen Schwin-delformen jedoch in der Regel zuverläs-sig diagnostizieren und wirkungsvoll the-rapieren.
Folgende Defizite der derzeitigen aka-demischen Medizin, Ausbildung und kli-nischen Forschung beeinträchtigen die kli-nische und wissenschaftliche Arbeit zum Thema:Feinseitiger Blickwinkel jeweils nur
auf Teilaspekte der Schwindeler-krankungen durch die bestehenden Fächergrenzen,
Funeinheitliche fächerspezifische Leit-linien zu Diagnose und Therapie,
Fmangelhafter methodischer und in-haltlicher Austausch zwischen Grundlagenwissenschaften und kli-nischer Forschung,
Funzureichende Einbindung experi-menteller Kompetenz aus dem Be-reich der Ingenieurswissenschaften,
Informatik, funktionellen Bildgebung, Quality-of-life-Forschung und Psy-chosomatik,
Ferschwerte Patientenrekrutierung für die klinische Forschung durch fach-lich und örtlich getrennte klinische Versorgung,
FMängel in der Erforschung und Be-handlung chronischer Schwindel-formen und Gangstörungen in den verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Stürze im Alter).
Hinzu kommen allgemeine strukturelle Probleme der akademischen Medizin:FMehrfachbelastung der klinischen
Wissenschaftler durch administrative, klinische Aufgaben und Lehre,
Fmangelnde Karriereoptionen für in-terdisziplinäre Spezialisten (Mangel an attraktiven Positionen),
Funzureichende Vergütung der not-wendigen umfassenden interdiszip-linären Diagnostik und Therapie am-bulanter Patienten.
Strukturelle Ziele und Mehrwert
Das Integrierte Forschungs- und Behand-lungszentrum für Schwindel, Gleich-gewichts- und Okulomotorikstörun-gen der Ludwig-Maximilians-Universität (IFBLMU) soll diese Schwächen durch fol-gende Maßnahmen überwinden:
875Der Nervenarzt 8 · 2009 |
Zusammenfassung · Summary
Nervenarzt 2009 · 80:875–886 DOI 10.1007/s00115-009-2812-3© Springer Medizin Verlag 2009
T. Brandt · A. Zwergal · K. Jahn · M. Strupp
Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomotorikstörungen
ZusammenfassungDas Bundesministerium für Bildung und For-schung (BMBF) wird 2010 in München ein Inte-griertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomoto-rikstörungen (IFBLMU) einrichten. Nach einer För-derung über die ersten 10 Jahre planen die Me-dizinische Fakultät und das Klinikum der Lud-wig-Maximilians-Universität (LMU) eine Verste-tigung der Einrichtung.
Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymp-tome in der Medizin. Trotz der hohen Prävalenz besteht eine eklatante Unter- und Fehlversor-gung der Betroffenen. Diese unbefriedigende Situation ist international gut bekannt. Die Ur-sachen hierfür sind unzureichende interdiszip-linäre Kooperation, fehlende Standardisierung von Diagnostik und Therapie, mangelnde Trans-lation von Grundlagenforschung in die klinische Anwendung und das Fehlen multizentrischer klinischer Studien zur Diagnose und Therapie.
Das IFBLMU ist ein geeignetes Instrument zur Überwindung dieser strukturellen, klinischen und wissenschaftlichen Defizite und bietet die Möglichkeit zur nachhaltigen Etablierung eines internationalen fächerübergreifenden Referenz-zentrums. Zum Thema Schwindel, Gleichge-wichts- und Okulomotorikstörungen gibt es in München eine weltweit einmalige Konzentra-tion führender Experten in Klinik und Grundla-
genforschung. Es bestehen bereits horizontale interdisziplinäre Vernetzungen mit strukturier-ten vertikalen akademischen Karrierepfaden. Diese laufen über neurowissenschaftliche Bache- lor- und Masterstudiengänge, die Graduate School of Systemic Neuroscience bis hin zum Mu-nich Center for Neuroscience „Brain and Mind“.
Strukturelle und inhaltliche Ziele des IFBLM:F Schaffung eines eigenständigen patien-
tenorientierten Forschungszentrums unter dem Dach der Fakultät mit autonomer Lei-tungsstruktur und eigenem Budget,
F modellhafte Überwindung bisheriger kli-nischer und akademischer Fächergrenzen,
F Etablierung eines standardisierten, interdis-ziplinären, longitudinalen und transversa-len Netzwerkes für betroffene Patienten an einem Ort zur Professionalisierung der kli-nischen Versorgung und überregionalen Patientenrekrutierung (integrierte Versor-gung, Telemedizin),
F Aufbau einer Studieninfrastruktur zur Durchführung prospektiver multizent-rischer klinischer Studien und Entlastung der Forscher von administrativen Aufgaben,
F Förderung translationaler Forschungsbe-reiche mit Fokussierung auf die Innova-tionsfelder molekulare, funktionelle und strukturelle Bildgebung, experimentelle
und klinische Pharmakotherapie, klinische Krankheitsforschung, mathematische Mo-dellbildung, Interaktion biologischer und technischer Systeme (Robotics) sowie For-schung zu Funktionsfähigkeit und „quality of life“,
F Einrichtung neuer attraktiver Ausbildungs-wege und Berufsbilder für Ärzte, Natur-wissenschaftler und Ingenieure in der kli-nischen Forschung und damit Überwin-dung bisheriger akademischer, hierar-chischer Strukturen und Förderung des Leistungs- und Eigenständigkeitsprinzips,
F Etablierung von 8 Nachwuchswissenschaft-lergruppen und zunächst 6 W2-Professuren („tenure track“) zur Komplettierung der vor-handenen Exzellenz und als Anreiz für her-ausragende Wissenschaftler,
F Einbindung bestehender und sich entwi-ckelnder Kompetenz in die medizinischen und biologischen Studiengänge sowie Gra-duiertenschulen- und Kollegs.
Das IFBLMU ist ein international einmaliges Referenzzentrum.
SchlüsselwörterSchwindel · Gleichgewichtsstörungen · Okulo-motorikstörungen · Lokomotion · Integrierte Versorgung
Integrated Center for Research and Treatment of Vertigo, Balance and Ocular Motor Disorders
SummaryThe German BMBF (German Ministry of Educa-tion and Research) has decided to establish an Integrated Center for Research and Treatment of Vertigo, Balance and Ocular Motor Disorders (IFBLMU) in Munich in 2010. After funding over a 10-year period, the long-term continuation of the IFBLMU by the medical faculty and the hospi-tal is envisioned.
Vertigo is one of the most common com-plaints in medicine. Despite its high prevalence patients with vertigo generally receive either in-appropriate or inadequate treatment. This de-plorable situation is internationally well known and its causes are multiple: insufficient interdis-ciplinary cooperation, no standardized diagnos-tics and therapy, the failure to translate findings of basic science into clinical applications and the scarcity of clinical multicenter studies. The IFBLMU will constitute a suitable tool with which these structural, clinical, and scientific def-icits can be overcome. It will also make possible the establishment of an international interdisci-plinary referral center. Munich has become the site of a unique concentration of leading experts on vertigo, balance and ocular motor disorders, both in the clinical and basic sciences. Academic structures have paved the way for the creation of
an interdisciplinary horizontal network that also allows structured, vertical academic career paths via the Bachelor’s and Master’s degree pro-grams in neuroscience, a Graduate School of Sys-temic Neurosciences, and the Munich Center for Neuroscience “Brain and Mind”.
The IFBLMU has the following objectives with regard to structure and content:Fto create an independent patient-oriented
clinical research center under the auspices of the Medical Faculty but with autonomic ad-ministration and budget;
Fto overcome existing clinical and academic barriers separating traditional specializations,
Fto establish a standardized interdisciplinary longitudinal and transversal network at one site for the management of patients. This should professionalize both the manage-ment and the international recruitment of patients (integrated care, telemedicine);
Fto organize the study infrastructure for pro-spective multicenter clinical studies as well as to free clinical scientists from administra-tive tasks;
Fto promote translational research with a fo-cus on the innovative topics of molecular functional and structural imaging, experi-
mental and clinical pharmacotherapy, cli-nical research of vertigo and balance disor-ders, mathematical modelling, interaction between biological and technical systems (robotics) and research on functionality and the quality of life;
Fto offer new attractive educational paths and career images for medical doctors, stu-dents of the natural sciences and engineers in clinical research in order to overcome tra-ditional hierarchical structures. This should promote the principles of efficiency and self-reliance;
Fto supplement the existing excellence with up to eight groups of young scientists and up to eight professorships (tenure track). This should also be seen as an incentive that will attract the best young scientists;
Fto incorporate IFBLMU competence into the competence into the existing medical and biological graduate schools.The IFBLMU is a unique reference center
worldwide.
KeywordsVertigo · Dizziness · Postural imbalance · Ocular motor disorders · Integrated medical care
876 | Der Nervenarzt 8 · 2009
FSchaffung eines eigenständigen, pa-tientenorientierten Forschungs- und Behandlungszentrums unter dem Dach der Fakultät mit autonomer Lei-tungsstruktur und eigenem Budget,
Fmodellhafte Überwindung bisheriger klinischer und akademischer Fächer-grenzen,
FEtablierung eines standardisierten, in-terdisziplinären longitudinalen und transversalen Versorgungsnetzwerkes für betroffene Patienten an einem Ort zur Professionalisierung der kli-nischen Versorgung und überregio-nalen Patientenrekrutierung (inte-grierte Versorgung, Telemedizin),
FAufbau einer Studieninfrastruktur zur Durchführung prospektiver mul-tizentrischer klinischer Studien unter gleichzeitiger Entlastung klinischer Forscher von administrativen Aufga-ben,
FFörderung translationaler For-schungsbereiche mit Fokussierung auf die Innovationsfelder molekulare, funktionelle und strukturelle Bildge-bung, experimentelle und klinische Pharmakotherapie, klinische Krank-heitsforschung, mathematische Mo-dellbildung pathophysiologischer Me-chanismen, gegenseitige Inspiration biologischer und technischer senso-motorischer Systeme (Robotics) so-wie Forschung zu Funktionsfähigkeit und „quality of life“,
FEinrichtung neuer attraktiver Aus-bildungswege und Berufsbilder für Ärzte, Naturwissenschaftler und In-genieure in der klinischen Forschung zur Überwindung hierarchischer aka-demischer Gliederungen und damit auch Förderung des Eigenständig-keits- und Leistungsprinzips,
FEtablierung von 8 Nachwuchswissen-schaftlergruppen und 6 W2-Profes-suren („tenure track“) zur Erweite-rung der vorhandenen Exzellenz und als Anreiz für herausragende Wissen-schaftler,
FEinbindung bestehender Kompetenz in die verschiedenen Studiengänge, Graduiertenschulen und -kollegs.
Ein solches Kompetenzzentrum ist bis-lang trotz der klinischen Relevanz welt-weit nicht realisiert. München bietet im internationalen Vergleich beste Voraus-setzungen einen IFB mit einem translatio-nalen Forschungsnetzwerk für Schwin-del, Gleichgewichts- und Okulomotorik-störungen einzurichten (.Abb. 1).
EDieses Forschungsnetzwerk ist attraktiv für Patienten und Wissenschaftler.
Patienten kommen aus dem In- und Aus-land zur adäquaten Behandlung ihrer Er-krankung mit Schwindel, Gleichgewichts- oder Augenbewegungsstörungen und
nehmen an klinischen (diagnostischen und oder therapeutischen) Studien teil. Ärzte und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland erfahren eine strukturierte klinische und wissenschaftliche Ausbil-dung mit Kooperation in gemeinsamen wissenschaftlichen Projekten und Studien (INPUT). Der OUTPUT des IFBLMU be-deutet für die Patienten Versorgung mit klinischer Kompetenz auf der Grundlage evidenzbasierter diagnostischer und the-rapeutischer Prozeduren. Der OUTPUT für die Ärzte und Wissenschaftler ist die themenbezogene Karriere als klinischer Wissenschaftler und die Einbindung in internationale kooperative Forschungs-projekte.
Thematische Ausrichtung, Voraussetzungen und Entwicklungsziele
Langfristiges Ziel des IFB ist der Aufbau eines vernetzten patientenorientierten Forschungszentrums, in dem interdis-ziplinär mit unterschiedlichen Methoden (vom Molekül bis zur Systemanalyse und mathematischen Modellbildung) die fol-genden Forschungsfelder bearbeitet wer-den sollen.
Translationale Forschungsfelder
Die einzelnen Ziele lassen sich in 6 Kate-gorien ordnen:1. Diagnostische Verfahren und
Kriterien:1 Entwicklung neuer apparativer Ver-
fahren mit Hilfe neurophysiolo-gischer Methoden (z. B. Augenbe-wegungsregistrierungen, Posturo-graphie, evozierte Potenziale) so-wie bildgebender Techniken (struk-turelle, funktionelle und molekulare Bildgebung),
1 Suche nach spezifischen diagnosti-schen Markern und sog. Surrogat-Markern,
1 Entwicklung biometrischer dia-gnostischer Verfahren (Modellbil-dung und Mustererkennung durch Einsatz künstlicher neuronaler Netze) und
1 Validierung diagnostischer Kriterien.
Grundlagenwissenschaften Klinische Forschung
Patientennational/international
ManagementKlinische Studien
Postgraduierte / Wissenschaftlernational/international
Ausbildung
Forschung
Karrierepfad fürklinischeWissenschaftler
Internationale Kooperation
KlinischeKompetenz
Leitlinien für Diagnostik und Therapie
INPUT
OUTPUT
Lokales translationales Forschungsnetzwerk
Kompetenz
Abb. 1 8 Translationales Forschungsnetzwerk des IFBLMU (s. Text)
878 | Der Nervenarzt 8 · 2009
Leitthema
2. Pathophysiologie und Therapiekon-zepte:
1 experimentelle Neurobiologie und klinische Pharmakologie,
1 systemische Neurophysiologie/Struktur-Funktions-Bezug und physikalische/rehabilitative Thera-piekonzepte,
1 von der Phänotypisierung zur The-rapie – German Mouse Clinic,
1 Psychopathologie/psychosoma-tische Wechselwirkungen und symp-tomorientierte Psychotherapie.
3. Prospektive klinische Studien:1 Therapiestudien,1 Verlaufsstudien,1 epidemiologische Studien.4. Funktionsfähigkeit und „quality of life“
(Kooperation mit der WHO):1 Entwicklung internationaler Stan-
dards für Patienten mit Schwindel,
Gleichgewichts- und Okulomoto-rikstörungen zur Klassifikation und Beschreibung der Funktionsfähig-keit betroffener Patienten in For-schung und Praxis (International Classification of Functioning, Dis-ability and Health [ICF] Core Sets),
1 Entwicklung spezifischer Mess-verfahren zu Aspekten der Funkti-onsfähigkeit für verschiedene Ziele (z. B. Evaluierung der Behandlung) basierend auf diesen internationa-len Standards,
1 Modellierung der Funktionsfähig-keit von Patienten mit Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomoto-rikstörungen auf Basis der ICF.
5. Spezifische audiovestibuläre Probleme und Gangstörungen bei Kindern und im Alter:
1 Untersuchung vestibulärer Stö-rungen im Alter,
1 Erforschung peripherer und zen-traler audiologischer Defizite,
1 Diagnostik und Therapie bei Gangstörungen und Stürzen im Al-ter,
1 kardiovaskuläre Ursachen von Schwindel und Synkopen.
6. Mensch und Maschine (Kooperation mit der TU-München):
1 mathematische Modellierung ana-tomischer und neurophysiolo-gischer Wirkungszusammenhän-ge in vestibulären und okulomoto-rischen Systemen sowie bei Loko-motion und Gleichgewichtsregula-tion,
1 biometrische Modellbildung in bio-logischen Systemen zur Selektion unabhängiger klinischer Beurtei-
Kliniken
DiagnostikPatho-physiologie
TherapieundVerlauf
TranslationaleForschungNachwuchs-wissenschaftler-gruppenW2-Professuren
Funktion/Quality of life
Epidemiologie/Versorgungsforschung
Grundlagenwissenschaftliche Institute
Rotationen
Integrierte Versorgung
Leitung
KlinischesStudienzentrum
Interdisziplinäre Schwindelambulanz
StationäreDizziness UnitsAusbildung
Curriculum“Klinischer Forscher”Zusatz-Weiterbildung“Schwindel”
GSN MeCuM IMPRS
Nachsorge-netzwerkSchwindel
Telemedizin
Rekrutierung
Fakultät für Medizin der LMU München
Abb. 2 8 Organisationsstruktur des IFBLMU als eigenständige Institution an der medizinischen Fakultät. Kernmodule des IFB sind die interdisziplinäre Schwindelambulanz, die stationären Dizziness-Units, das klinisches Studienzentrum und die wissen-schaftlich-medizinischen Ausbildungsorgane. Diese Module sind vernetzt mit den kooperierenden grundlagenwissenschaft-lichen Institutionen und Kliniken durch wechselseitige Zusammenarbeit und Rotation. Die translationale Forschung von den Grundlagenfächern bis zur Klinik (vertikale Balken) umfasst die Bearbeitung von Fragestellungen zur Pathophysiologie, Dia-gnostik und Therapie und wird durch Nachwuchsgruppen und W2-Professuren verstärkt. Die Patientenrekrutierung erfolgt durch ein internationales Rekrutierungsnetzwerk und durch Telemedizin. Die Patientenbetreuung wird durch integrierte Ver-sorgungskonzepte innerhalb einer longitudinalen Struktur gewährleistet. Die integrierte Versorgung stellt eine Brücke zum Nachsorgenetzwerk Schwindel her. Das IFBLMU hat eine eigene unabhängige Leitung. Die weiß unterlegten Anteile zeigen die bestehenden Strukturen, die grau unterlegten Blöcke zeigen die mit der Errichtung des IFBLMU neu zu schaffenden Module MeCuM, Medizinisches Curriculum München, IMRS International Max Planck Research School, ESN Graduate School for Syste-matic Neuroscience
879Der Nervenarzt 8 · 2009 |
lungskriterien und deren Einord-nung in ein pathogenetisches Ver-ständnis,
1 biologische Inspiration technischer sensomotorischer Systeme (blickge-steuerte bewegliche Kopfkamera),
1 Entwicklung technischer Assistenz-systeme bei alters- oder krankheits-bedingten Funktionsstörungen.
Die Projekte zeigen die bereits existieren-de interdisziplinäre Basis und das Spek-trum des Forschungsprogramms mit dem Anspruch, die grundlagenorientierte For-schung mit der Klinik und der patienten-orientierten Forschung zu integrieren.
Geplante Strukturmaßnahmen
Die Gründung des hier beantragten IFBLMU erfolgt als Einrichtung der Medizi-nischen Fakultät der LMU in Kooperation mit der TU München, dem Max-Planck-Institut für Neurobiologie, dem Helm-holtz-Zentrum und der German Mouse Clinic. Damit öffnet sich das IFBLMU für alle Fächer, die sich mit dem Ver-ständnis der Pathophysiologie, der Dia-gnostik und Therapie der relevanten Er-krankungen zum übergeordneten The-ma befassen. Die geplanten Struktur-maßnahmen orientieren sich an der Be-hebung bestehender Mängel des akade-mischen Systems. Es sollen Qualitätsver-luste durch die Doppelbelastung mit Kli-nik und Forschung behoben werden und eine Professionalisierung, Ökonomisie-rung und Qualitätssteigerung in der Ver-sorgung und Forschung erreicht werden. Dies soll durch folgende Kernmodule um-gesetzt werden:
Das IFBLMU wird durch eine eigen-ständige Leitungsstruktur (bestehend aus einem wissenschaftlichen Vorstand und einem Geschäftsführer) geführt. Die Kernmodule im Bereich der Patienten-versorgung werden eine interdisziplinäre Schwindelambulanz sowie stationäre Dizzi-ness-Units sein (standardisierte longitudi-nale Versorgungskette im IFBLMU). Hier erfolgt die Behandlung der Patienten nach gemeinsamen Leitlinien zu Diagnose und Therapie unter den Aspekten Qualitätssi-cherung und Wirtschaftlichkeit. Gleich-zeitig ermöglicht die fächerübergreifen-de Bündelung der Patientenbetreuung im
IFBLMU eine Optimierung der Patienten-rekrutierung. Nach dem Modell der be-reits bestehenden integrierten Versor-gung Schwindel kann dabei auf ein Netz-werk ausgewählter zuweisender nieder-gelassener Kollegen (Rekrutierungsnetz-werk Schwindel) zurückgegriffen werden (.Abb. 2).
Die klinische Forschung wird durch Ein-richtung eines eigenständigen klinischen Studienzentrums im IFB verstärkt. Ziel ist die Etablierung einer Studieninfrastruktur (Studienmanagement, Studienschwestern und Studienärzte, Profilbildung mit Au-ßenwirkung, verbesserte Patientenpfade, erhöhte Rekrutierung etc.), durch die ei-ne umfassende Betreuung klinischer Stu-dien erfolgt.
Die translationale Forschung im IFB soll durch Einrichtung von zunächst 8 Nach-wuchswissenschaftlergruppen (.Abb. 3) und 6 W2-Professuren (.Abb. 4) verstärkt werden. Drei der W2 Professuren sollen bei Einrichtung des IFB besetzt werden. Die 3 weiteren sollen als Karrierepfade für die erfolgreichsten Nachwuchsgrup-penleiter dienen und in der zweiten Pha-se der ersten Förderperiode besetzt wer-den. Die Nachwuchsforscher arbeiten im IFBLMU mit größtmöglicher Eigenständig-keit. Der Zugang zu Patienten und Metho-den wird durch Kooperationsverträge der beteiligten Kliniken und Institute mit dem IFBLMU gewährleistet.
Die Ausbildung im IFBLMU soll unter Einbindung bestehender wissenschaft-licher Ausbildungsorgane (Graduate School of Systemic Neurosciences; Bern-stein Center for Computational Neuro-science etc.) erfolgen. Zudem ist die Ein-richtung eines Kurrikulums „Klinischer Forscher“ im IFB geplant. Die klinische Weiterbildung wird durch Rotationsstel-len gesichert.
Modul Management
Die Leitungsorgane des IFB sind der wis-senschaftliche Vorstand und der Ge-schäftsführer. Der wissenschaftliche Vor-stand setzt sich aus 10 gewählten Reprä-sentanten der Generalversammlung zu-sammen, wobei 2 Mitglieder Nachwuchs-wissenschaftlergruppen repräsentieren sollen. Der Vorstand wählt den Spre-cher und den stellvertretenden Sprecher.
Hauptaufgaben sind die strategische Ko-ordination der Bereiche Forschung, Lehre und Patientenversorgung, Entscheidung in Personalfragen, Entscheidung über Mittelvergabe (flexible Funds). Förder-mittel werden bevorzugt an Projekte ver-geben, welche zu einer interdisziplinären bzw. translationalen Vernetzung im Zen-trum bzw. nach außen führen. Anschub-finanzierungen, exzellente Hochrisiko-projekte sowie Überbrückungsfinanzie-rungen werden berücksichtigt.
> Klinische Forscher werden von administrativen Aufgaben entlastet
Ein hauptamtlicher Geschäftsführer soll dafür sorgen, dass die Wissenschaftler des IFB sich voll auf die Forschungsaufga-ben konzentrieren können. Dieser küm-mert sich um die Verwaltung der Mittel (Grundausstattung, IFB-Fördermittel, an-dere Drittmittel), die Kommunikation mit dem wissenschaftlichen Beirat (z. B. Orga-nisation der Ortsbegehungen, Projektbe-gutachtungen etc.) sowie die Öffentlich-keitsarbeit (in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Koordinationsstellen). Im Leitungsbereich angesiedelt sind auch das Controlling (interne klinische und ex-perimentelle Qualitätskontrolle), das Li-aison-Management (stellt Kontakte her und strukturiert Kooperationen vor, hilft bei Patentverwertung, in Kooperation mit dem Institut für Medizinische Informati-onsverarbeitung, Biometrie und Epide-miologie [IBE] der LMU). Als externes Instrument zur Beratung und Qualitäts-kontrolle dient ein wissenschaftlicher Bei-rat (aus BMBF-Gutachtern und interna-tionalen Experten zum Thema). Das ex-terne administrative und finanzielle Con-trolling erfolgt durch die Verwaltung des Klinikums.
Modul Patientenversorgung
Die Versorgung von Patienten mit Schwindel, Gleichgewichts- und Okulo-motorikstörungen muss in besonderem Maße folgenden Ansprüchen genügen: Multidisziplinarität muss aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsursachen und Nachhaltigkeit aufgrund der Chroni-fizierungstendenz gewährleistet sein. Im
880 | Der Nervenarzt 8 · 2009
Leitthema
IFBLMU Forschungsgruppen
2009 2010 2011 2012/2013 2015-2019
Start IFBErste Förderperiode
ZweiteFörderperiode
NachwuchsgruppeNachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Nachwuchsgruppe
Spezialisierungabhängig von derEntwicklung derIFB-Schwerpunkte
Künstliche neuronaleNetze zur Diagnostik
oder
oder
oder
oder
oder
Vestibuläre und lokomot.Rehabilitation
Vestibuläre und lokomot.Rehabilitation
Lebensqualität beivestib. Erkrakungen
Ausweitung einesStart-up Projekts
Virale Infektionen imvestibulären System
Aminopyridine beiKleinhirnerkrankungen
Mitochondriale Störungenbei vestibulärem Altern
Räumliche Orientierungund vestibuläre Funktion
Augenbewegungen undHaltungskontrolle
Künstliche neuronaleNetze zur Diagnostik
Ausweitung einesStart-up Projekts
Lebensqualität beivestib. Erkrankungen
Nac
hwuc
hsw
isse
nsch
aftle
r
Abb. 3 8 Nachwuchswissenschaftlergruppen: geplante thematische Schwerpunkte der Gruppen, die je nach Entwicklung des IFBLMU sequenziell während der ersten und zweiten Förderphase eingerichtet werden
IFBLMU Forschungsgruppen
Start IFBErste Förderperiode
ZweiteFörderperiode
2009 2010 2011 2012/2013 2015-2019
W3 Professur
W2 Professur
W2 Professur W2 Professur
W2 Professur
W2 Professur
W2/W3 Professur
Prof
essu
ren
W2 Professur
W2 Professur
Epidemiologie
MultimodaleBildgebung
Innenohr-erkrankungen
Spezialisierungabhängig von derEntwicklung derIFB-Schwerpunkte
oder
oder
oder
oder
oder
oder
SomatoformeStörungen
Genetik
SystemischeNeurophysiologieund mathematischeModellbildung
SystemischeNeurophysiologieund mathematischeModellbildung
Translationaleund KlinischePharmakologie
Aufwertung einerNachwuchsgruppe
Aufwertung einerNachwuchsgruppe
Translationaleund klinischePharmakologie
Immunologie undMolekularbiologie
Funkt. Bildgebungsensorischer undkogn. Funtionen
Abb. 4 9 W2-Professuren („tenure track“): geplante thematische Schwerpunkte der Professuren, die je nach Entwicklung des IFBLMU se-quenziell während der ers-ten und zweiten Förder-phase eingerichtet werden
882 | Der Nervenarzt 8 · 2009
Leitthema
geplanten IFB soll ein transversales und longitudinales Versorgungsnetzwerk für betroffene Patienten mit Modellcharakter geschaffen werden. Das „Herzstück“ ist dabei die geplante interdisziplinäre Am-bulanz für Schwindel, Gleichgewichts- und Augenbewegungsstörungen, die per-sonell von den relevanten Fächern (Neu-rologie, HNO, Kardiologie, Augenheil-kunde, Psychiatrie, Psychosomatik, Pädia-trie) gebildet wird. Darin sollen die be-reits bestehenden Ambulanzen personell und räumlich interdisziplinär an einem Ort gebündelt werden. In dieser Einheit sollen die ambulante Rekrutierung von Patienten und die Erstdiagnostik durch-geführt werden, Therapiekonzepte erar-beitet werden und Verlaufskontrollen er-folgen. Zur Behandlung komplexer Er-krankungen werden stationäre Dizziness-Units an den kooperierenden Kliniken eingerichtet. Für die Nachsorge spielt die integrierte Versorgung unter Anbindung spezialisierter niedergelassener Kollegen sowie der Kontakt zu dezentralen Reha-Einrichtungen (z. B. zum Thema speziali-sierte Neurologische Klinik Bad Aibling) eine entscheidende Rolle (Nachsorgenetz-werk Schwindel).
Modul Klinisches Studienzentrum
In Kooperation mit dem Clinical Study Center der LMU (CSCLMU) und dem Ins-titut für Medizinische Informationsver-arbeitung, Biometrie und Epidemiologie (IBE) wird ein eigenständiges klinisches Studienzentrum im IFB aufgebaut. Dieses wird durch ein Leitungsteam (Leiter, Stu-dienkoordinatoren, Lt. Studienschwester) geführt. Die Studieninfrastruktur des kli-nischen Studienzentrums erleichtert den Wissenschaftlern des IFB die patienten-orientierte Forschung. Dort werden u.a.Fder Zugang zu Patienten koordiniert,Feine qualitätsgesicherte Studieninfra-
struktur aufgebaut,FStudienmanager und Studienschwes-
tern zum Studienablauf bereit gestellt,Fstudienrelevante Meldeverfahren etab-
liert,Fklinische Leistungen im Rahmen von
Studien vermittelt (Labor, Bildge-bung) und deren Abrechnung organi-siert,
Fexternes Qualitätsmanagement orga-nisiert (Monitoring etc.),
Fder Kontakt zu externen Studienzent-ren koordiniert.
Generische Dienstleitungen zur Studien-regulatorik, dem Datenmanagement, der biometrischen Betreuung und Arzneimit-telsicherheit werden in Kooperation mit dem CSCLMU organisiert (.Abb. 5).
Diese Leistungen werden im Wesent-lichen durch eine vom Leitungsteam des klinischen Studienzentrums für jede Stu-die zusammengestellte Gruppe von spezi-ell ausgebildeten und auf das Themenfeld Schwindel, Gleichgewichts- und Okulo-motorikstörungen spezialisierten Studi-enmanagern, Studienärzten und Studi-enschwestern erbracht, welche mit dem Leiter der Studie zusammenarbeiten. An-spruch des Studienteams ist eine professi-onelle Durchführung von Studien. Hier-durch kann sich der Wissenschaftler auf die wesentlichen wissenschaftlichen und klinischen Aspekte der Studie konzent-rieren, und es wird sichergestellt, dass die Studien auf höchstem Niveau durchge-führt werden.
Modul Translationale Forschergruppen
Wissenschaftlicher Erfolg erfordert die besten Köpfe für innovative Ideen, d.h. es werden v.a. auch attraktive akademische
Fakultäten der LMU München
Grundlagenwissenschaftliche Institutionen Klinische Institutionen
WissenschaftlicheQualitätskontrolle
Wis
sens
chaf
tlich
er B
eira
t3
BMBF
Vert
rete
r7
inte
rnat
iona
leEx
pert
en
StrategischeEntwicklung des IFB
WissenschaftlicheRessourcensteuerung
Vorstand
VerwaltungsleiterWiss. Vorstand(10 Mitglieder:
Sprecher, Stellvertreter,Nachwuchswissenschaftler)
AdministrativeQualitätskontrolle
FinanzielleAdministration
Öffentlichkeits-arbeit
Wahl des Vorstands
Entscheidung über Kooperationspartner
Abstimmung über Projektvorschläge/klinische Studien (>€100,000)
Umsetzung derRessourcenverteilungnach Plan
Bericht an dieGeneralversammlung
Generalversammlung(Repräsentanten der beteiligten Einheiten, Forschungsgruppenleiter)
Abb. 5 8 Organigramm der Leitungsstrukturen des IFBLMU. Die Generalversammlung wählt den wissenschaftlichen Vorstand, schlägt neue wissenschaftliche Projekte vor und berichtet über den Verlauf laufender Projekte. Der wissenschaftliche Vor-stand beschließt über die Einsetzung der Nachwuchsforschergruppen, die Verwendung der finanziellen Ressourcen, die Fest-legung der Forschungsschwerpunkte (in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Beirat und der Mitgliederversammlung). Es werden interne und externe Kontrollmechanismen (wissenschaftlich und administrativ) eingeführt. Dies ist eingehend in der Satzung des IFBLMU festgelegt
883Der Nervenarzt 8 · 2009 |
Positionen in Form von Tenure-track-Professuren benötigt. Garant für Exzellenz und Nachhaltigkeit im IFB sind Nach-wuchsforschergruppen und W2-Profes-suren (.Abb. 3, 4), die nach internatio-naler Ausschreibung besetzt werden. Die-se Forscher erhalten eine weitgehende Un-abhängigkeit, den freien Zugriff auf Me-thoden und Ressourcen (Bildgebung, ex-perimentelle Modelle und Methoden, Stu-dienteam, Patienten etc.) sowie finanziel-le Unterstützung durch flexible, projektge-bundene Forschungsgelder. Im Rahmen des IFB sollen 8 Nachwuchswissenschaft-lergruppen aufgebaut werden.
> Garant für Exzellenz und Nachhaltigkeit sind attraktive akademische Positionen
Die Arbeit der Nachwuchswissenschaft-lergruppen wird jährlich durch eine in-terne und dreijährlich durch eine externe Evaluation begleitet. Die jährliche Eva-luation dient der Qualitätskontrolle und konstruktiven Kritik der wissenschaft-lichen Arbeit, die externe Evaluation ent-scheidet nach 3 Jahren über die Weiterfi-nanzierung.
In Hinblick auf attraktive Karrie-repfade können die erfolgreichsten Nach-wuchsgruppenleiter in W2-Professuren überführt werden. Drei W2-Professuren sollen bereits bei Gründung des IFB be-setzt werden. Am IFB angesiedelte Pro-fessuren und Nachwuchswissenschaft-lergruppen unterstehen dem interdiszi- plinären wissenschaftlichen Vorstand und sind damit unabhängig von den Instituten und Kliniken der beteiligten Einheiten. Die Mitglieder der Nachwuchsforscher-
gruppen und W2-Professuren können an den Rotationen in Grundlagenfächer und Klinik teilnehmen. Dies soll einerseits den Horizont der translationalen Sicht erwei-tern und andererseits die für auswärtige Bewerbungen notwendige Erfahrungs-breite sichern. Über die Kooperations-vereinbarungen mit den patientenversor-genden Kliniken wird der Zugang zu den Patienten im Rahmen von klinischen Stu-dien gesichert. Für die zweite Förderpha-se ist im Rahmen eines attraktiven Karri-erepfades die Einrichtung einer W3-Pro-fessur als Möglichkeit vorgesehen, um die Wegberufung eines für die Struktur des IFB unerlässlichen W2-Professors zu ver-meiden.
Modul Lehre und Ausbildung
An der LMU gibt es etablierte Programme für die Ausbildung des wissenschaftlichen und klinischen Nachwuchses im Themen-bereich des geplanten IFB. In der medi-zinischen Fakultät der LMU wurde 2003 ein modularisiertes Ausbildungskon-zept, Medizinisches Curriculum Mün-chen (MeCuM), unter Berücksichtigung interdisziplinärer und translationaler As-pekte eingeführt. Krankheitsfelder wie die Schwindelerkrankungen werden dabei in Modul IV „Nervensystem und Sensori-um“ interdisziplinär behandelt.
Weiterhin wurden im Rahmen der Elitenetzwerke Bayern 2005 und 2006 mehrere fächerübergreifende Masterstu-diengänge geschaffen. Mit der Einrich-tung der Graduate School of Systemic Neuroscience im Rahmen der Exzellenz-initiative des Bundes und der Länder wur-de 2006 ein für die horizontale und verti-
kale Vernetzung der Ausbildungssysteme zentrales Bindeglied geschaffen, das un-ter dem gemeinsamen Dach des Neuro-wissenschaftlichen Zentrums Brain and Mind (gegründet ebenfalls 2006 im Rah-men LMU Innovativ) die Ausbildung von Studierenden und Graduierten aus un-terschiedlichen Fächern ermöglicht. Die Graduate School hat das fakultätsüber-greifende Recht innerhalb einer 3- bis 5-jährigen hochstrukturierten Ausbildung und wissenschaftlichen Qualifizierung den Titel des PhD oder den Titel des MD/PhD zu vergeben.
Weiterhin kann das IFB zur Ausbil-dung von klinischen Forschern auf Mo-dule der Masterstudiengänge MSc Clini-cal Epidemiology und MSc Human Func-tioning Sciences zurückgreifen.
Darauf aufbauend kann im IFB ein Modul zur wissenschaftlichen Ausbildung mit drei Hauptschwerpunkten entstehen:FEinbringung der Expertise des ge-
planten IFB in die Ausbildung von Studenten und wissenschaftlichem Nachwuchs innerhalb der bestehen-den vertikalen und horizontalen Strukturen (s. oben),
FSchaffung eines für das IFB spezi-fischen mehrjährigen zertifizierten Kurrikulums „Klinischer Forscher“ mit den Hauptaspekten klinische For-schung zu Diagnose und Therapie von Schwindel, Gleichgewichts- und Okulomotorikstörungen. Dies könnte auch im Rahmen des Programms Master of Science erfolgen.
Modul Öffentlichkeitsarbeit
Das IFB hat ein eigenes Konzept zur Öf-fentlichkeitsarbeit. Eine Koordinations-stelle für Öffentlichkeitsarbeit optimiert die Außendarstellung des IFB (.Abb. 6). Dabei werden die exzellenten Pressever-bindungen der PR-Abteilung des Klini-kums genutzt. Eine auf die Bedürfnisse des IFB zugeschnittene Öffentlichkeitsar-beit ist besonders wichtig, weil bislang der Transport von Informationen zum Thema Schwindel, Gleichgewichts- und Okulo-motorikstörungen von den Spezialisten zum medizinischen Laien mangelhaft ist. In der Bevölkerung besteht für das Leit-symptom ein verzerrtes Kausalitätsver-ständnis. Daraus resultieren Konsultati-
KommunikationKrankenkassen
Information zu Aus-und Weiterbildung
Verbreitung von Leitlinien zuDiagnostik und Therapie
Koordinationsstellefür Öffentlichkeitsarbeit
Patienteninformation/Selbsthilfegruppen
MedienauftrittInternet/Presse/
Rundfunk/TV
KontaktLandesärztekammer
Abb. 6 8 Öffentlichkeitsarbeit am IFB
884 | Der Nervenarzt 8 · 2009
Leitthema
onen bei Ärzten aus Fächern, die auf die Versorgung von Schwindel nicht speziali-siert sind. Vom IFB wird mediale Aufklä-rung über Ursache, Diagnose und Thera-pie von Schwindel durchgeführt werden. Die Koordinationsstelle für Öffentlich-keitsarbeit soll durch Kontaktaufnahme mit Krankenkassen und Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens Multipli-katoren für die Verbreitung relevanter In-formationen zum Thema gewinnen.
Neben der Patienteninformation liegt ein zweiter Schwerpunkt der Öffentlich-keitsarbeit in der Informationsvermitt-lung an medizinisches Fachpersonal (Phy-siotherapeuten, Ärzte). Dazu sollen die an der Klinik der Universität München be-stehenden Aus- und Weiterbildungsmög-lichkeiten zum Thema Schwindel (Semi-nar Vertigo, Hospitationen in der Schwin-delambulanz) in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften und den Land-ärztekammern ausgebaut werden.
KorrespondenzadresseProf. Dr. T. BrandtInstitut für Klinische Neurowissenschaften, Klinikum Großhadern, Universität MünchenMarchioninistraße 15, 81377 Mü[email protected]
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Brandt T (1999) Vertigo, its multisensory syndro-mes. 2. Aufl. Springer, London
2. Brandt T, Dieterich M, Strupp M (2009) Vertigo, Leitsymptom Schwindel. 2. Aufl. Steinkopff, Darm-stadt
3. Bronstein AM, Brandt T, Woollacott ME, Nutt IG (eds) (2004) Clinical disorders of balance, posture and gait. 2. Aufl. Arnold, London
4. Bronstein AM, Lempert T (2007) Dizziness, a practi-cal approach to diagnosis and management. Univ Press, Cambridge
5. Herdman SJ (2007) Vestibular Rehabilitation. 3. Aufl. Davis, Philadelphia
6. Leigh RJ, Zee DS (2006) The neurology of eye mo-vements. 4. Aufl. Oxford Univ Press, New York
7. Luxon L (ed) (2003) Audiological medicine: clinical aspects of hearing & balance. Martin Dunitz, Lon-don
Die Menopause – Bremse fürs Gedächtnis
Sechzig Prozent der Frauen berichten von Gedächtnisschwierigkeiten während der Wechseljahre. Diese Selbsteinschätzung wird jetzt durch eine Studie amerika-nischer Wissenschaftler unterstützt. Un-mittelbar vor Einsetzen der Wechseljahren können Frauen schlechter lernen als in an-deren Phasen ihres Lebens, so das Ergebnis der Studie. Die gute Nachricht: Dieser Ef-fekt ist nur vorübergehend. Zu einem spä-teren Zeitpunkt der Wechseljahre waren die Frauen wieder genauso leistungsfähig wie vor der Menopause. Für diese Unter-suchung hatte das Forscherteam mehr als zweitausend Frauen vor, während und nach der Menopause untersucht und ihre Lernfähigkeit während vier verschiedener Phasen der Wechseljahre überprüft. Die Forscher testeten dazu das Wortgedächt-nis, das Arbeitsgedächtnis und die Zeit, in der die Frauen Informationen verar-beiteten. Die Probandinnen verbesserten ihre Leistungen in jeder Phase, je öfter sie die Tests wiederholten. Kurz vor der Menopause war ihre Verbesserung jedoch in allen Testbereichen messbar geringer ausgeprägt.
Eine Hormontherapie während der Wechseljahre verhalf den behandelten Frauen zu einem besseren Gedächtnis. Allerdings nahmen die Leistungen dieser Frauen nach den Wechseljahren im Gegen-satz zu den unbehandelten nicht mehr zu. Möglicherweise profitierten daher Frauen vor allem kurz vor der Menopause von Hormonpräparaten.
Originalpublikation: G A Greendale, M-H Huang, R G Wight et al. (2009) Effects of the menopause transition and hormone use on cognitive performance in midlife women. Neurology 72: 1850-1857
Fachnachrichten