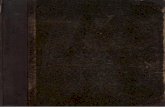"Der Erzbischof liebte Rot" - Der Bergfried der Fürstenberg. Oder: Über das Anmalen von Architektur.
H. İşkan Işık - W. Eck - H. Engelmann, "Der Leuchtturm von Patara und Sex. Marcius Priscus als...
Transcript of H. İşkan Işık - W. Eck - H. Engelmann, "Der Leuchtturm von Patara und Sex. Marcius Priscus als...
1
DER LEUCHTTURM VON PATARA UND SEX. MARCIUS PRISCUS ALS STATTHALTER DER PROVINZ LYCIA VON NERO BIS VESPASIAN
Das Pfeilermonument mit dem lykischen Stadiasmos1 war ein außergewöhnliches Monument, das die Altertumswissenschaft der lykischen Hauptstadt Patara verdankt. Nunmehr hat der Boden der Stadt erneut einen außergewöhnlichen Bau ans Licht treten lassen, einen Leuchtturm, der hier in einer ersten, kurzen Zusammenfassung vorgestellt wird. Der neue Pharos ist nach unserem derzeitigen Wissensstand in der antiken Literatur nicht belegt und auch bildlich nicht auf archäologischem Material dargestellt. Erstmals in der Neuzeit wird der Bau im Jahre 1811 erwähnt, als die Society of Dilettanti den dritten Band ihrer Antiquities of Jonia herausgab.2 Weitere Lykien-Forscher wie Ch. Fellows3, O. Benndorf4, A. W. van Buren5 und E. Kalinka6 haben den Bau aufgesucht und Inschriftenfragmente aufgenommen, die an der Oberfl äche zu sehen waren. In den letzten Jahrzehnten widmete G. E. Bean7 dem Bau einige Zeilen, seine endgültige Bezeichnung als Leuchtturm bekam er aber erst von F. Işık, dem Leiter der 1988 begonnenen Ausgrabungen in Patara, der in seinem Patara-Führer die erste ausführliche Beschreibung des Vorhandenen gibt.8 Seinem Entschluß, mit der Freilegung des Leuchtturmes trotz seiner unzugänglichen Lage und aller sonstigen Schwierigkeiten, die mit dem Unternehmen verbunden waren, zu beginnen, verdanken wir heute einen der aufregendsten Bauten der antiken Architektur.
Im August 2004 wurde begonnen, den Leuchtturm freizulegen. Die erste Campagne ging über fünf Wochen, ihr Ziel war es, die Berge von Sand, unter denen der Leuchtturm begraben war, beiseite zu schaf-fen und einen ersten Steinplan zu fertigen. Eine zweite Campagne begann im Juli 2005 und erstreckte sich in drei Abschnitten über sechs Monate. Von Anfang an betrachteten wir es als unsere wichtigste Aufgabe, die Grabung zeichnerisch präzise zu erfassen und zu dokumentieren. Weil es sich bei unserem Leuchtturm um einen typologisch einzigartigen Bau handelt, sind wir in allererster Linie auf die Erkenntnisse ange-wiesen, die sich aus der Bauaufnahme ergeben. Die Aufnahme, die im Jahre 2008 abgeschlossen wird, ist breit angelegt und arbeitet mit verschiedenen Methoden. Nicht zuletzt von ihrem Ergebnis hängen die Maßnahmen ab, die im weiteren Verlauf zur Denkmalpfl ege und zur Restaurierung ergriffen werden sollen.
Der Hafen von Patara liegt in einer tief eingeschnittenen, weiträumigen Bucht; über diesen Naturha-fen lief der Handel mit dem bergigen Hochland Lykiens. Bei den gefürchteten Südstürmen, die in dieser Region häufi g auftreten, bot er Schiffen, die auf der vielbefahrenen Route von Rhodos nach Alexandria und Syrien unterwegs waren, eine sichere Zufl ucht. Heute noch steht an der Westseite des Hafens ein geräumiger Getreidespeicher, den Kaiser Hadrian hatte errichten lassen.9 Zwei Leuchttürme markierten die Zufahrt zu diesem Hafen, der durch die Ausgrabungen bekannte Leuchtturm und ein Antipharos, der zusammen mit dem nun bekannten Turm in der Inschrift genannt ist, die unter einer Ehrenstatue für den Statthalter Sex. Marcius Priscus stand und unmittelbar vor dem Turm gefunden wurde. Von diesem zwei-
1 F. Işık, H. İşkan, N. Çevik, Miliarium Lyciae. Das Wegweisermonument von Patara, Antalya 2001; S. Şahin – M. Adak, Stadiasmus Patarensis. Itinera Romana Provinciae Lyciae, Istanbul 2007.
2 Antiquities of Ionia III (1811), 87. 3 Ch. Fellows, Ein Ausfl ug nach Kleinasien und Entdeckungen in Lycien, Leipzig 1853, 404 Nr. 174–180. 4 O. Benndorf – G. Niemann, Reisen im südwestlichen Kleinasien I: Reisen in Lykien und Karien, Wien 1884, 114 ff.,
117, Nr. 88.5 A. W. van Buren, Inscriptions from Asia Minor, Cyprus and Cyrenaica, JHS 28, 1908, 183 f.6 TAM II 2, 399 (7).7 G. E. Bean, Kleinasien 4: Lykien, Stuttgart 1986, 89. 8 F. Işık, Patara. The History and Ruins of the Capital City of Lycian League, Antalya 2000, 141 f. 9 TAM II 2, 397.
2 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
ten Leuchtturm, dem Antipharos, fehlt bisher jede Spur, auch die frühen Reisenden sprechen nicht von seiner Existenz.
Der Leuchtturm ist auf felsigem Klippengelände errichtet. Die Anlage besteht aus einem quadrati-schen Podium, dessen Seitenlängen 20 m betragen; der anstehende Fels wurde allenthalben in das Mauer-werk des Podiums miteinbezogen. Ein runder Turm erhebt sich auf dem Podium, der aus zwei ineinander greifenden zylindrischen Baukörpern aufgeführt ist. Der äußere Zylinder hat einen Durchmesser von 6 m und war doppelschalig aus leicht gebogenen Blöcken gebaut, seine Mauerdicke beträgt 1,2 m. In der Mitte des Turmes erhebt sich ein zweiter kompakter Zylinder von 1,2 m Durchmesser. Eine Wendeltreppe führt zwischen beiden Zylindern nach oben, ihre Stufen, die 80–90 cm breit sind, binden wie ein Reißver-schluß beidseitig ein. Der Zugang zum Turm befi ndet sich an der Westseite und wurde mit einer Holztüre verschlossen. Einige Blöcke, die in situ auf dem Fundamentniveau erhalten sind, lassen vermuten, daß man das Podium von der Nordseite her betrat; nach Osten sieht das Podium zur Hafeneinfahrt, an seiner Südseite lag das offene Meer.
Der Leuchtturm von Patara ist ein ausgeprägt schlichter Bau, Verzierungselemente wie Ornamen-tik oder detailreiche Profi le fehlen, nur drei Blöcke weisen Reliefs auf. Eine monumentale Bauinschrift Kaiser Neros war mit Bronzelettern an der Ostseite des Turmes angebracht; genau unter ihr wurde eine Statue des Statthalters Marcius Priscus aufgestellt, auf deren Basis eine Inschrift den Anlaß für die Ehrung nannte. Diese beiden wichtigen epigraphischen Dokumente bilden das Hauptanliegen dieses Beitrages.
Aus dem Altertum sind insgesamt über dreißig Leuchttürme bekannt, die sowohl in der antiken Lite-ratur erwähnt wie auch in archäologischen Resten erhalten sind.10 Am Beginn steht der Leuchtturm von Alexandria, der auf der Insel mit Namen Pharos stand und zu den sieben Weltwundern zählte. Leucht-türme, die dem Pharos von Patara zeitlich nahestehen, sind von folgenden Orten bekannt: Messina (erbaut von Sextus Pompeius um 40 v. Chr., durch Münzbild gesichert); zwei Leuchttürme in Caesarea Maritima (erbaut von Herodes, augusteisch, keine gesicherte Darstellung);11 von der Insel Capri (eingestürzt kurz vor dem Tode des Tiberius, keine Darstellung); Boulogne (erbaut von Caligula, rekonstruierbar); Ostia (erbaut von Claudius, mehrere Darstellungen). Die Leuchttürme von Dover und La Coruna stammen wohl aus dem beginnenden zweiten Jahrhundert, der Bau bei Lepcis Magna gehört in severische Zeit. Wenn man diese Leuchttürme miteinander vergleicht, wird ersichtlich, daß es eine feststehende Typologie bei diesen Bauten nicht gab.
Was Hermann Thiersch im Jahre 190912 festgestellt hat, bleibt trotz zahlreicher neuer Publikationen bestehen: „Zu einer Geschichte der antiken Leuchttürme fehlt es überhaupt noch zu sehr an Vorarbeiten und Einzeluntersuchungen.“ Die Entdeckung eines neuen und gut erhaltenen Pharos möchten wir daher als Gelegenheit betrachten, die archäologische Forschung zu ermuntern, dieses Desiderat endlich in die Hand zu nehmen.
10 H. Thiersch, Pharos, Antike, Islam und Occident. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte, Leipzig 1909.11 Zu einem dieser Leuchttürme gehört die berühmte Inschrift, die Pontius Pilatus als praefectus Iudaeae nennt. Der Text
bezeugt, daß Pontius Pilatus den einen der Türme hat wiederherstellen lassen; zu dieser Interpretation der nicht vollständig erhaltenen Inschrift mit allen Details G. Alföldy, Pontius Pilatus und das Tiberieum von Caesarea Maritima, SCI 18, 1999, 85 ff.; ders., Nochmals: Pontius Pilatus und das Tiberieum von Caesarea Maritima, SCI 21, 2002, 133–148; vgl. AE 1999, 1681 = 2002, 1556.
12 Siehe Thiersch, Pharos (Anm. 10) 19.
4 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
Die Inschrift des Leuchtturms
An der Hafeneinfahrt von Patara hat Kaiser Nero zwei Leuchttürme „zur Sicherheit der Seefahrenden“ errichten lassen. Der Turm, der auf dem Landvorsprung liegt, der für die in den Hafen einfahrenden Seeleute auf ihrer linken Seite lag, wurde bei den Ausgrabungen freigelegt (s. Buchstabe C auf dem Stadtplan). Er trägt eine monumentale Bauinschrift, die zur Hafeneinfahrt blickt. Die Inschrift, deren Buchstaben aus vergoldeter Bronze hergestellt waren, erstreckt sich über sechs Quaderschichten des Bauwerks. Auf welcher Höhe die Inschrift genau begonnen hat, läßt sich im Augenblick noch nicht sagen. Die Inschrift selbst war, wenn man sie nach den Quaderschichten berechnet, mindestens 370 cm hoch, bot also einen monumentalen Anblick. In der ersten Schicht ist der Name des Kaisers deutlich hervorgehoben: in dieser Quaderreihe steht nur eine einzige Zeile mit deutlich höheren Lettern als in den übrigen Zeilen (hier 30, sonst nur 20 cm hoch). Die Genealogie des Kaisers folgt in der zweiten Quaderschicht, die als einzige drei Zeilen aufweist. Auf allen nachfolgenden Schichten wurde der Text auf zwei Zeilen verteilt. Ab der zweiten Schicht wird die Inschrift beidseitig von einer Leiste eingerahmt; die Schrift ist linksbündig, gelegentlich mit Flatterrand rechts. Wegen der Größe der Buchstaben und deren goldenem Glanz war sie wohl sogar von den Schiffen aus sichtbar.
Ursprünglich bestand die Inschrift aus Bronzebuchstaben, die jedoch nicht nur mit Dübeln auf den Quadern befestigt, sondern, wie auch in vielen anderen Fällen, in den Stein eingetieft waren. Diese Vertie-fungen sowie die Dübellöcher für die Fixierung der Bronzelettern sind heute noch erhalten, die Metall-buchstaben selbst sind verloren. Vermutlich sind, als Neros Andenken im Juni 68 damniert wurde, einfach Bronzebuchstaben entfernt worden, um die memoria damnata auf diese Weise anzuzeigen. Das läßt sich heute im Detail nicht mehr feststellen, weil ohnehin alle Bronzebuchstaben verloren gegangen sind. Sie wurden in späteren metallarmen Zeiten vermutlich alle herausgebrochen und eingeschmolzen. Möglicher-weise war es im Jahre 68 ausreichend, am Anfang des Textes die Bronzebuchstaben mit dem Namensteil Nero zu entfernen, um dem Senatsbeschluß über die hostis-Erklärung Genüge zu tun, während die ande-ren Teile der Kaisertitulatur erhalten blieben.13
Für die Lesung schafft der Verlust der Bronzelettern kein Problem, weil die Eintiefungen in den einzelnen Quaderreihen einen vollwertigen Ersatz darstellen. Teilweise ist man beim Entfernen der Bron-zebuchstaben sehr sorgfältig verfahren und hat auch die Dübel mitsamt den Bleibefestigungen besei-tigt, teilweise blieben Dübel und das fi xierende Blei aber auch in den Löchern erhalten, ein Befund, der ähnlich auch auf einer großen Inschriftenplatte von einem Stadttor in Scythopolis in der Provinz Iudaea bekannt ist.14 Auffällig ist, mit wie vielen Dübeln in Patara die Lettern im Stein fi xiert wurden. Beim ersten Buchstaben des Kaisernamens, dem N, wurden insgesamt fünf Dübel verwendet, beim nachfolgen-den E waren es zwar offensichtlich nur zwei, beim R dagegen drei. Die Abbildungen lassen die jeweilige Zahl fast stets recht klar erkennen. Die Beobachtungen, die sich daraus gewinnen lassen, sind methodisch sehr wichtig, weil hier durch die Verbindung von Vertiefung im Stein und Dübellöchern deutlich wird, wo die Dübel bei den einzelnen Buchstaben angebracht waren. Das könnte für die Lesung von Inschriften, bei denen zwar Bronzebuchstaben verwendet, die aber nicht in den Stein eingetieft, sondern nur mit Dübeln befestigt wurden, eine Hilfe sein, um über die Dübellöcher die früheren Buchstaben zu identifi zieren. In dieser Inschrift sind die Dübel und damit die Dübellöcher zumeist sehr regelmäßig angebracht, nur in der zweiten Quaderlage ist dies nicht der Fall; hier sind die Dübellöcher unregelmäßiger gesetzt als sonst.
13 Ähnliche Beobachtungen kann man auch bei anderen Inschriften Neros machen, siehe dazu W. Eck, Die Vernichtung der memoria Neros: Inschriften der neronischen Zeit aus Rom, in: Nero nia VI, Rome à l’époque néronienne. Actes du VIe Colloque international de la So ciété internationale d’études néroniennes, Rome, 19–23 mai 1999, hg. J.-M. Croisille – Y. Perrin, Brüssel 2002, 285 ff.
14 Persönliche Kenntnis von Werner Eck, der diese Torbauinschrift bearbeiten wird.
Der Leuchtturm von Patara 5
Katalog der beschrifteten Blöcke des Leuchtturms
Der folgende Katalog bringt acht verschiedene Informationen zu jedem einzelnen Block der Inschrift: Spalte 1 enthält die Nummern, welche die beschrifteten Blöcke in dieser Publikation tragen. Spalte 2 gibt die Höhe des jeweiligen Blockes in Zentimetern an.Spalte 3 bringt den Text, der auf einem Block eingetragen ist. Wo ein Omikron auf den nächsten Block übergreift, ist eine runde Klammer in die Abschrift eingefügt, um hierauf hinzuweisen; eine spitze Klam-mer, wo andere Lettern übergreifen. Spalte 4 gibt an, wie hoch die Buchstaben sind, die auf einem Block stehen.Spalte 5 vermerkt, wieviele Zeilen auf einem Block eingetragen sind. Spalte 6 hier ist ersichtlich, ob eine Randleiste auf einem Block angebracht ist. Spalte 7 gibt an, welcher Schicht ein Block zugewiesen wurde. Spalte 8 vermerkt, welche Nummer die Ausgräber den Blöcken gegeben hatten, und wo diese gefunden worden waren. Großbuchstaben bezeichnen die Himmelsrichtung, S = Süden; O = Osten; N = Norden. Die meisten Blöcke der Inschrift waren nach Osten, in Richtung Hafeneinfahrt, gefallen. Dreizehn beschriebene Blöcke waren nach Süden gestürzt; sie ließen sich Zeilenanfängen zuweisen: es sind erste, zweite oder dritte Blöcke einer Schicht, spätestens ab dem vierten Block ging die Fallrichtung nach Osten. Der letzte Block der ersten Schicht lag als einziger an der Nordost-Ecke des Leuchtturms.
Mit den Bezeichnungen „rot“, „blau“ oder „grün“ wird angegeben, wo die Blöcke geborgen wurden. rot: sie lagen auf der Oberfl äche des Schuttberges; blau: sie waren verschüttet; grün: sie fanden sich unter dem Schuttberg, zumeist in Spalten des anstehenden Riffs.
Frühere Reisende haben acht der neununddreißig beschrifteten Blöcke gesehen und aufgenommen (Ch. Fellows; G. Niemann; E. Hula; E. Kalinka; W. van Buren); ihre Abschriften sind in den Tituli Asiae Minoris II 2 (Wien 1930) unter der Nummer 399 angeführt: Nr. 3 = TAM II 399 (1)Nr. 5 = TAM II 399 (7)Nr. 15 = TAM II 399 (5)Nr. 20 = TAM II 399 (6); als Fellows diesen Block kopierte, war das J am Ende der ersten Zeile noch
besser zu sehen als heute. Nr. 22 = TAM II 399 (2)Nr. 24 = TAM II 399 (3)Nr. 26 = TAM II 399 (4)Nr. 39 = TAM II 399 (8)
6 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
SCHICHT I
BlockNr.
hochcm
Inschrift Bh cm Zeilen Randleiste Schicht FundlageFundnummer
1 44 N [ 30 1 1 S 161 blau
2 44 ] E R V N K [ 30 1 1 S 30 rot
3 44 ] L A U D [ 30 1 1 S 90 rot
4 44 ] O S Y E [ 30 1 1 O 92 blau
5 44 ] < O U K [ 30 1 1 O 89 rot
6 44 ] L A U D [ 30 1 1 O 25 rot
7 44 ] I O U U [ 30 1 1 O 84 grün
8 44 ] I O S 30 1 1 N 149 rot
Minuskeltext
Schicht I N°rvn KlaÊd[i]ow yeoË Klaud¤ou uflÒw,
Drei Blöcke aus Schicht I, am Fundort zusammengestellt
8 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
SCHICHT II
BlockNr.
hochcm
Inschrift Bh cm Zeilen Randleiste Schicht FundlageFundnummer
9 75 T I B [ 20 3 links 2 S 169 blau
K A I [A P [
10 75 ] E R I O U I [ 20 3 2 S 43 rot
] S A R ( [] O G O N [
11 75 ] < A I S A R [ 20 3 2 O 102 blau
] ) S E K G [] O S K A I [
12 75 ] O S S E . [ 20 3 2 O 90 blau
] O N O S [] S A R S . [
13 75 ] A S T O U K [ 20 3 2 grün B
] Y E O U . [ ] < B A S T O [
14 75 ] A N I [ 20 3 2 O 52 grün
] T O [] A N [
Die Klammerlöcher sind in Schicht II nicht so regelmäßig gesetzt wie in den anderen Schichten.
Block 9: Die Lettern sind zum Teil vom Block abgesplittert, ihre Lesung jedoch sicher.
Block 13, Zeile 2: vor YEOU ein Fehlschlag; möglicherweise war zunächst AUGOUSTOU vorgezeichnet gewesen.
Minuskeltext
Schicht II Z. 2 Tiber¤ou Ka¤sarow Se[b]astoË k[a‹ Germ]ani[koË] Z. 3 Ka¤sarow ¶kgonow, yeoË [Sebas]to[Ë] Z. 4 épÒgonow, Ka›sar SebastÚ[w Germ]an[ikÒw],
10 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
SCHICHT III
BlockNr.
hoch cm
Inschrift Bh cm Zeilen Randleiste Schicht FundlageFundnummer
15 57 A R [ 20 2 links 3 S X 44 rot
A S [
16 57 ] X I E I [ 20 2 3 S X 38 rot
] < T ( [
17 60 ] E U S I [ 20 2 3 S 41 rot
] ) I A U [
18 60 ]<I E G I S [ 20 2 3 O 87 rot
] P A T O [
19 58 ] T O S D [ 20 2 3 O 96 blau
] S T O [
20 58 ] S E J [ 20 2 3 O 32 rot
] . A T V [
21 58 ] S I 20 2 rechts 3 O 51 blau
] H S
Minuskeltext
Schicht III Z. 5 érxiereÁw m°gistow, d[hmarxik∞]w §j[ou]s¤- Z. 6 aw tÚ iaÄ , Ïpatow tÚ [ dÄ, aÈtokr]ãtv[r g]∞w
12 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
SCHICHT IV
BlockNr.
hochcm
Inschrift Bh cm Zeilen Randleiste Schicht FundlageFundnummer
22 60 K A I Y [ 20 2 links 4 S X 46 rot
T O N [
23 58 ] < A L [ 20 2 4 S 39 rot
] < F A R [
24 58 ] A S S H S [ 20 2 4 O 14 rot
] O N K A T E [
25 58 ] T O [ 20 2 4 O 125 blau
] S K E [
26 58 ] O P A T [ 20 2 4 O 58 rot
] U A S E N [
27 ] H R P A [ 20 2 4 O 86 grün
] P R O [
28 56 ] O S 20 2 rechts 4 O 58 blau
] F A
Minuskeltext
Schicht IV Z. 7 ka‹ yalãsshw tÚ [ . ], ı patØr pa[tr¤d]ow, Z. 8 tÚn fãron kateskeÊasen prÚ[w és]fã-
14 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
SCHICHT V
BlockNr.
hochcm
Inschrift Bh cm Zeilen Randleiste Schicht FundlageFundnummer
29 62 L [ 20 2 links 5 S X 23 rot
S [
30 60 ] A N [ 20 2 5 S X 60 rot
] J S T [
31 60 ] N P L O I [ 20 2 5 grün A
] O U M A R K I [
32 67 ] N D I [ 20 2 5 O 76 rot
] K O U P [
33 66 ] A [ 20 2 5 O 53 blau
] R E [
34 67 vac. 20 1 rechts 5 O 71 rot
] S
Minuskeltext
Schicht V Z. 9 l[ei]an [t«]n ploÛ[zom°nv]n diå Z. 10 S[°]jstou Mark¤[ou Pre¤s]kou pres-
16 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
SCHICHT VI
BlockNr.
hochcm
Inschrift Bh cm Zeilen Randleiste Schicht FundlageFundnummer
35 76 B [ 20 2 links 6 S X 22 rot
[
36 70 ] O U [ 20 2 6 O 46 grün
] O S [
37 70 ] A N T [ 20 2 6 O 45 grün
] S A . [
38 68 ] A T H G [ 20 2 6 O 52 rot
] O E R G [
39 68 ] O U 20 2 rechts 6 O 53 rot
] O N
Minuskeltext
Schicht VI Z. 11 b[eut]oË [ka‹] ént[istr]atÆgou Z. 12 [Ka¤sar]ow [kti]sa[m°nou t]Ú ¶rgon
18 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
Minuskeltext
Schicht I N°rvn KlaÊd[i]ow yeoË Klaud¤ou uflÒw,Schicht II Z. 2 Tiber¤ou Ka¤sarow Se[b]astoË k[a‹ Germ]ani[koË] Z. 3 Ka¤sarow ¶kgonow, yeoË [Sebas]to[Ë] Z. 4 épÒgonow, Ka›sar SebastÚ[w Germ]an[ikÒw],Schicht III Z. 5 érxiereÁw m°gistow, d[hmarxik∞]w §j[ou]s¤- Z. 6 aw tÚ iaÄ, Ïpatow tÚ [dÄ, aÈtokr]ãtv[r g]∞wSchicht IV Z. 7 ka‹ yalãsshw tÚ [ . ], ı patØr pa[tr¤d]ow, Z. 8 tÚn fãron kateskeÊasen prÚ[w és]fã-Schicht V Z. 9 l[ei]an [t«]n ploÛ[zom°nv]n diå Z. 10 S[°]jstou Mark¤[ou Pre¤s]kou pres-Schicht VI Z. 11 b[eut]oË [ka‹] ént[istr]atÆgou Z. 12 [Ka¤sar]ow [kti]sa[m°nou t]Ú ¶rgon
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, Sohn des vergöttlichten Claudius, Enkel des Tiberius Caesar Augustus und des Germanicus Caesar, Urenkel des vergöttlichten Augustus, oberster Priester, Inhaber der tribunizischen Gewalt zum elften Male, Konsul zum vierten Male, Herrscher/Sieger über die Erde und das Meer zum [x.] Male, Vater des Vaterlandes, hat diesen Leuchtturm zum Schutz der Seefahrenden errichten lassen durch Sextus Marcius Priscus, den kaiserlichen Legaten in propraetorischem Rang, der das Bauwerk hat ausführen lassen.
Patara ehrt den Statthalter Sextus Marcius Priscus
Unter der Inschrift des Leuchtturms hat die Stadt Patara später, nämlich erst in der Zeit Vespasians, rund fünf Jahre nach Fertigstellung des Leuchtturms, eine Statue des Statthalters Sextus Marcius Priscus aufgestellt:
Die Basis aus Kalkstein ist ca. 140 cm hoch, ca. 68 cm tief, unten ca. 80, oben ca. 73 cm breit; sie steht auf mehrfach gegliedertem Sockel, der eine Gesamthöhe von ca. 102 cm erreicht und an der Oberseite ca. 80 cm breit und ca. 71 cm tief ist. Die Rückseiten beider Werkstücke sind so bearbeitet, daß sie sich der Rundung des Leuchtturms anpaßten und nahtlos vor den Turm setzen ließen. Die Lettern der Inschrift, die unter den Witterungseinfl üssen stark gelitten hat, sind ca. 2,5–3 cm hoch; unter der Inschrift sind ca. 80 cm der Vorderseite unbeschrieben geblieben. Nach den erhaltenen Maßen der Basis hat darauf eine statua pedestris gestanden, also eine Statue der Art, wie sie bei normalen Statuenehrungen üblich war. Der Sockel der Basis ist auf der Abbildung, die den Leuchtturm von oben zeigt, gut zu erkennen.
Die Deckplatte der Basis, auf der die ersten Zeilen der Ehrung standen, wurde bisher nicht gefunden; der fehlende Beginn des Textes läßt sich aber aus einer Inschrift übernehmen, welche die Stadt Lydai unter einer Statue des Marcius Priscus gesetzt hatte.15 Da diese Texte bestimmte Eigenheiten enthalten, die nur durch eine gemeinsame Quelle erklärlich sind, darf man davon ausgehen, daß diese Quelle der Statthalter selbst war. Daß der Geehrte Einfl uß nahm auf den Text, der unter seiner Statue stand, ist nur in wenigen Ausnahmefällen belegt, ist aber, wie sich zeigen läßt, ganz üblich gewesen, war im Allgemeinen sogar nötig.16 Entsprechend dem Text aus Lydai kann der fehlende Anfang der Inschrift in Patara ergänzt werden.
15 S°jston Mãrkio[n] / Pre›skon, presbeut[Øn] / AÈtokrãtorow Ka¤sar[ow] / OÈespasianoË Seb[a]/stoË ka‹ pãntvn [AÈ/t]okratÒrvn épÚ T[i]/ber¤ou Ka¤sarow / tÚn dikaiodÒthn / Ludat«n ı d∞mow (TAM II 1, 131).
16 Vgl. dazu W. Eck, „Tituli honorarii“, curriculum vitae und Selbstdarstellung in der Hohen Kaiserzeit, in: Acta colloquii epigraphici Latini Helsingiae 3.–6. sept. 1991 habiti (= Comm. hum. litt. 104), Helsinki 1995, 211 ff.
Der Leuchtturm von Patara 19
0 [S°jston Mãrkion Pre›skon, presbeutØn AÈtokrãtorow OÈespasianoË Ka¤sa-]1 row SebasstoË, éntistrã- thgon ka‹ pãntvn aÈtokra- [t]Òrvn épÚ Tiber¤ou Ka¤sa-4 row Patar°vn ≤ boulØ ka‹ ı d∞mow dikaiodotÆsanta tÚ ¶ynow Ùktet¤an ègn«w ka‹ dika¤[v]w, kosmÆsanta tØn8 pÒlin ¶rgoiw perikallestã- toiw, kataskeuãsanta d¢ fã- ron ka‹ ént¤faron prÚw ésfãlei- an t«n ploÛzom°nvn, tÚn sv-
t∞ra ka‹ eÈerg°thn12
Der Rat und das Volk von Patara ehren Sextus Marcius Priscus, den kaiserlichen Legaten in propraeto-rischem Rang des Imperator Vespasianus Caesar Augustus und aller Imperatoren seit Tiberius Caesar, weil er acht Jahre lang dem Volk der Lykier auf unbestechliche und gerechte Weise Recht gesprochen hat, und weil er unsere Stadt mit den schönsten Bauwerken geschmückt hat, und weil er den Pharos und den Antipharos zur Sicherheit der Seefahrenden errichtet hat, unseren Retter und Wohltäter.
20 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
Kommentar zu den Inschriften
1. Der LeuchtturmDie beiden neuen Inschriften hängen nicht nur über den Fundort, sondern vor allem inhaltlich eng zusam-men. Zum einen wird von der Erbauung eines Pharos, eines Leuchtturms, und eines Antipharos, also gewissermaßen eines Gegenleuchtturms, berichtet, zum andern wird der römische Statthalter, der daran wesentlich beteiligt war, am Ende seiner Statthalterschaft mit einer Statue an dem Ort geehrt, wo das wichtigste Zeugnis für sein Wirken stand, der Leuchtturm.
Die beiden Türme sind wohl in der Absicht errichtet worden, daß durch sie die Einfahrt zum Hafen markiert und dadurch sicherer würde. Auf diese Zusammenhänge wird in der Publikation des Bauwerkes selbst im Detail eingegangen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß wir in Caesarea Maritima wohl eine vergleichbare Situation haben, da Herodes offensichtlich zwei Leuchttürme auf den beiden Molen, die die Einfahrt zu dem von ihm neu erbauten Hafen von Caesarea sicherten, hat erbauen lassen, von denen er den einen nach Iosephus Drouse›on nannte,17 während der andere, der bei dem jüdischen Historiker nicht erscheint, über die Pilatusinschrift mit dem Namen Tiberieum bekannt ist.18
Nach dem Text der Inschrift wurde der Leuchtturm von Kaiser Nero erbaut. Der Kaiser wird hier mit seiner Genealogie zurück bis zu Augustus im Nominativ genannt. Als Motiv wird angeführt, er habe durch den Bau der beiden Türme für die Sicherheit der Seeleute sorgen wollen. Dieses Motiv, das von der Sache her unmittelbar nahe liegt, wird auch bei anderen Bauten dieser Art expressis verbis erwähnt, vor allem bei dem alexandrinischen Leuchtturm, dem Pharos par excellence, von dem sich die Bezeichnung überhaupt herleitet. Nach Strabon und Lukian lautete die Inschrift auf dem alexandrinischen Leuchtturm: S≈stratow Dejifãnou Kn¤diow yeo›w Svt∞rsin Íp¢r t«n ploÛzom°nvn.19 Und völlig zutreffend hat G. Alföldy in der Inschrift, die Pontius Pilatus in Caesarea Maritima an einem der herodianischen Leucht-türme an der Einfahrt zum Hafen hat anbringen lassen, am Anfang des Textes [Naut]is ergänzt, „für die Seeleute“, für deren Sicherheit der Turm errichtet worden war.20 In Patara hat man wie auch in Caesarea sicherlich nicht einfachhin nur an die sachliche Notwendigkeit für den Bau des Leuchtturms gedacht, sondern wollte wohl auch an das große Vorbild in Alexandria erinnern.
Nero wird als Bauherr genannt, wie der Nominativ zeigt. Die Frage ist allerdings, was dies konkret bedeutet. In irgendeiner Weise muß der Kaiser involviert gewesen sein, sonst wäre der Nominativ nicht zu erklären, vielmehr hätte es dann genügt, ihn in der Inschrift schlicht im Dativ zu nennen, was im Osten sehr häufi g das Äquivalent für den Ablativ in einer lateinischen Inschrift war, d.h. eine Angabe, daß etwas unter diesem Kaiser erbaut war. Da dies hier nicht geschah, sondern der Nominativ gewählt wurde, sollte er eine aktive Rolle gespielt haben. Das kann freilich nicht heißen, der Kaiser habe den Bau fi nanziert, woran man zunächst denken könnte, denn das wäre in klarer Form auch gesagt worden.21 Damit könnte die Involvierung des Kaisers am ehesten an den Beginn des Bauunternehmens gehören, als über die Baumaßnahme entschieden wurde. Dabei wären verschiedene Szenarien möglich, entweder Genehmi-gung der Maßnahme, weil es in Patara selbst vielleicht zwei Parteien gab, die darüber unterschiedlich dachten, und von denen die eine das Bauwerk verhindern wollte. Denkbar wäre auch, daß der Statthalter z.B. beim Kaiser anfragte, um bestimmte fi nanzielle Mittel der Stadt, die unter Umständen zweckgebun-den waren, für den Bau verwenden zu dürfen. Ein solches Szenario liegt vielleicht deshalb nahe, weil am Ende der Inschrift, wenn dort das Partizip richtig ergänzt ist, vom Statthalter gesagt wird, er sei der Ktistes des Pharos. Das läßt auf eine aktive Rolle des kaiserlichen Legaten schließen. Dennoch: Entscheiden läßt
17 Iosephus, bell. Iudaicum 1, 412.18 Siehe oben Anm. 11 die Beiträge von G. Alföldy.19 Strabon 17, 1, 6 (C 791); Lukian, Quomodo historia scribenda sit 62.20 Siehe Anm. 11.21 Siehe zu dem Problem der Nennung des Kaisers in Bauinschriften M. Horster, Bauinschriften römischer Kaiser. Unter-
suchungen zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in der Zeit des Prinzipats, Stuttgart 2001.
Der Leuchtturm von Patara 21
es sich nicht, in welcher Weise der Kaiser und der Statthalter im Detail eingebunden waren. Man muß nur klar sehen, daß der Nominativ beim Kaisernamen keineswegs einfach darauf hindeutet, die Finanzmittel seien aus dem kaiserlichen Fiskus gekommen. Das ist zwar nicht ausgeschlossen, doch auch nicht sehr wahrscheinlich.
Am naheliegendsten ist es vielmehr, daß der Leuchtturm von der Bevölkerung Pataras (und vielleicht des Koinon) bezahlt wurde. Eine solche Finanzierungsform fi ndet sich z. B. in der im Anhang nochmals publizierten Bauinschrift für einen Aquädukt nach Patara, obwohl dort eine wohl eher exzeptionelle Form der Mischfi nanzierung vorliegt, nämlich unter Verwendung von Fiskalgeldern. Dort erscheint ebenfalls Vespasian im Nominativ, der, wie es heißt, den Bau errichten und das Wasser in die Stadt führen ließ. Konkret wurde dies durch seinen Legaten Marcius Priscus durchgeführt. Bezahlt aber wurde die Baumaß-nahme in außerordentlicher Weise ohne neuerliche Umlage auf die Bevölkerung, aus der Kopfsteuer, die auf die Bevölkerung von Patara entfi el und durch eine Kontribution des Koinons; faktisch haben freilich dennoch auch in diesem Fall die Bewohner der Stadt bezahlt (siehe den Anhang).
In der Bauinschrift wird nur der Pharos erwähnt, an dem die Inschrift angebracht war, nicht aber der Antipharos, der nach dem Text unter der Statue des Marcius Priscus durch die Bemühung dieses Statthal-ters errichtet wurde, genauso wie der Pharos selbst. Daß der Antipharos in der Bauinschrift des Pharos nicht erscheint, darf allerdings nicht zu der Ansicht verleiten, dieser Antipharos sei später, nach der Regie-rungszeit Neros, erbaut worden. Denn von der Sache her sollte man erwarten, daß beide Bauwerke zu der Maßnahme gehörten, die Einfahrt in den Hafen sicher zu machen. Da der Hafen durch eine Einfahrt zu erreichen war, die zwischen einer ins Meer vorragenden Landzuge und den Klippen führte, die vor dem Berg lagen, an welchem das Theater errichtet war, ist es fast zwingend, daß beide Türme gleichzeitig konzipiert und erbaut wurden. Das würde dann heißen, daß an dem Antipharos ebenfalls eine Inschrift angebracht wurde, die der uns nunmehr bekannten vermutlich recht ähnlich gewesen ist oder sogar fast gleich gelautet hat.
2. Der Statthalter und die Provinz LyciaNero führt in seiner Titulatur die 11. tribunicia potestas. Das ergibt den Zeitraum zwischen Oktober 64 und Oktober 65. In dieser Zeit dürfte der Pharos bereits fertig gewesen sein; denn die Bauinschrift mit der Aussage: tÚn fãron kateskeÊasen, konnte notwendigerweise erst angebracht werden, wenn der Bau vollendet war. Das, was Nero im Zusammenhang mit dem Bau der beiden Leuchttürme veranlaßte, ließ er durch seinen legatus Augusti pro praetore Sextus Marcius Priscus erledigen, der, wie bereits erwähnt, mit der Partizipialverbindung [kti]sa[m°nou t]Ú ¶rgon sehr massiv mit dem Bauwerk verbunden erscheint. Das wird in der Inschrift unter seiner Ehrenstatue an der Front des Leuchtturms noch verstärkt, da dort der Bau sowohl von Pharos als von Antipharos als sein Werk erscheint. Er sollte deshalb ganz wesentlich an der Entscheidung, diese Türme zu errichten, beteiligt gewesen sein; vielleicht hat er sogar die Anregung überhaupt dazu gegeben und dann auch bei der Finanzierung geholfen, nicht etwa durch eigene Mittel oder durch Mittel aus der kaiserlichen Kasse, sondern auf andere, nicht mehr rekonstruierbare Weise. Denn eine unmittelbare Finanzierung aus dem Fiskus oder gar durch ihn selbst wäre, wie oben bereits betont, deutlich anders formuliert worden. Statthalter haben im Übrigen nie in der ihnen anvertrauten Provinz eigene Mittel investiert.
Wenn Marcius Priscus so entscheidend war für die Erbauung des Leuchtturms, dann war er bereits einige Zeit vor dem Jahr 64/5 in der Provinz. Denn andernfalls hätte er keine entscheidende Rolle spielen können, da der Pharos vor Ende Oktober des Jahres 65 bereits vollendet war. Seine Statthalterschaft muß somit aus sachlichen Gründen spätestens im Jahr 64 begonnen haben.
Dieser Statthalter war bereits lange durch verschiedene Zeugnisse aus Lykien bekannt, die sich jüngst noch deutlich vermehrt haben. Insgesamt sind es folgende, hier zeitlich geordnete Inschriften unterschied-licher Funktion, in denen er als Statthalter der Provinz Lycia erscheint:22
22 Alle diese Zeugnisse sind eben auch von B. İplikçioğlu, Die Provinz Lycia unter Galba und die Gründung der Doppel-provinz Lycia et Pamphylia unter Vespasian, Veröffentlichungen der Kleinasiatischen Kommission Nr. 25, zusammengestellt
22 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
1. Bauinschrift des Leuchtturms von Patara, 64/65 n. Chr.2. Bauinschrift für ein Bad in Patara, unter Nero, dessen Name später durch den Vespasians ersetzt
wurde: CIL III 14189 = IGR III 659 = TAM II 396.3. Bauinschrift aus Rhodiapolis unter Kaiser Galba: B. İplikçioğlu (siehe Anm. 22).Alle weiteren Texte stammen, ohne weitere genauere Präzisierung, aus der Zeit Vespasians:4. Ehrung des Marcius Priscus durch Rat und Volk von Lydai: IGR III 522 = TAM II 131.5. Wiederaufbau eines Teilstücks der Wasserleitung in Patara, siehe den Anhang zu diesem Aufsatz.6. Bauinschrift aus Xanthos: TAM II 270. 7. Bauinschrift aus Xanthos: Balland 1981, 29 ff. Nr. 12. 8. Statuenehrung für Marcius Priscus durch Rat und Volk von Xanthos: IGR III 609 = TAM II 275.9. Statuenehrung für Marcius Priscus in Patara, siehe oben den neuen Text 2.10. Bauinschrift für ein Thermengebäude in Olympos: B. İplikçioğlu, AnzWien 141/2, 2006, 76.11. Grabinschrift, die der a manu des Sex. Marcius Priscus am Grab für seine Tochter in Patara
anbringen ließ: CIL III 14181 = IGR III 678 = TAM II 461; da Patara Statthaltersitz war, kann der Tod der Tochter des persönlichen Sekretärs des Statthalters während der gesamten Zeit der Statthalterschaft erfolgt sein.
Vor der Auffi ndung der Bauinschrift für den Leuchtturm in Patara und dem eben von B. İplikçioğlu publizierten Text aus Rhodiapolis aus der kurzen Regierungszeit Galbas stammten nach weitgehender Meinung der Forschung23 alle Inschriften, in denen Marcius Priscus als Statthalter genannt wurde, aus der Zeit Vespasians, oder besser: sie schienen alle aus dieser Zeit zu stammen. Tatsächlich aber war bei logischer Interpretation des Befundes die Bauinschrift des Bades in Patara (oben Nr. 2) in neronischer Zeit eingemeißelt worden.24 Zwar steht am Anfang dieses Textes in jeder Edition der Inschrift richtiger-weise der Name Vespasians, da dieser dort heute noch zu lesen ist, aber ebenso ist überall erwähnt, daß dessen Name auf Rasur steht, wobei noch auffällt, daß der kurze Name Vespasians nur eineinhalb Zeilen einnimmt, während aber insgesamt vier Zeilen eradiert worden waren. Das aber heißt, daß der eradierte Kaisername, der durch den Vespasians ersetzt wurde, wesentlich mehr einzelne Elemente umfaßt haben muß als der Name Vespasians. Das trifft bei dessen Vorgängern nur auf Nero zu. Gerade sein Name aber ist nach der Löschung der Erinnerung an ihn in vielen Fällen ausgemeißelt worden, wenn man eine Inschrift nicht völlig beseitigen konnte. Es ist also klar, daß die Bauinschrift des Bades in Patara aus der Zeit Neros stammt. Entscheidend ist aber, daß in diesem Text auch Sextus Marcius Priscus als amtierender Statthalter erscheint, und zwar im ursprünglichen Teil der Inschrift, also nicht etwa auf Rasur wie der Name Vespa-sians. Damit hätte eigentlich, seit man diese Inschrift kannte, klar sein müssen, daß dieser bereits vor dem Ende der Regierungszeit Neros Legat von Lycia war, der aber, wie mehrere andere Inschriften zeigten (oben Nr. 4–11), auch unter Vespasian im Amt war. Dies aber schien für fast alle, die sich mit diesem Statt-halter befaßten, ausgeschlossen. Denn, wiederum nach fast allgemeiner Auffassung in der Forschung, war Lykien von einem nicht genau zu bestimmenden Zeitpunkt unter Nero bis in die ersten Jahre Vespasians
worden, und zwar dort im Wortlaut; deshalb ist es nicht nötig, dies hier zu wiederholen. Ihm waren auch die neuen, hier publi-zierten Dokumente schon bekannt, ebenso wie er uns seine neuen Texte schon vor der Veröffentlichung zugänglich machte.
23 Einen Teil der Forschungsmeinungen zu diesem Problem fi ndet man in der klugen Behandlung des Problems durch M. Adak, in: Stadiasmus Patarensis (Anm. 1) 85 ff.
24 Dies hat noch zuletzt S. Şahin in zwei Beiträgen wieder bestritten, zum einen in einem Beitrag: Die Bauinschrift auf dem Druckrohraquädukt von Delikkemer bei Patara, in: Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz, hg. Chr. Schuler, Denkschriften Akademie Wien 354. Band, Wien 2007, 99 ff., bes. 104 ff., zum andern in Gephyra 3, 2006, 42 Anm. 35. Es ist schon erstaunlich, welche teilweise absurden statt logischen Argumente hier erscheinen. Dabei sollte eigentlich klar sein, daß chronologische Argumente, die sich aus dem konkreten Befund einer Inschrift ergeben, zwingend sind, und nicht durch willkürliche Überlegungen über den Haufen geworfen werden können. Ebenso wenig gilt dies für das Argument, daß das Gentile Flavius im Namen Vespasians zwingend auf dessen allerfrüheste Zeit deutet, nämlich auf die ersten Monate seiner Herrschaft im Jahr 69, in denen noch nicht klar war, wie er seinen Namen gestalten wolle. Diese Entscheidung aber ist Anfang des Jahres 70 (Februar–März) bereits der Fall gewesen, wie mehrere Militärdiplome mit der offi ziellen Titulatur zeigen: CIL XVI 10 f.; RMD IV 203; dort erscheint Flavius nicht mehr. Şahin hätte sich seine Argumente sparen können, wenn er das, was in der Literatur bisher gesagt worden war, in ihrem Gewicht verstanden hätte.
Der Leuchtturm von Patara 23
aus der direkten Herrschaft Roms entlassen, also ohne Statthalter. Denn nach einer Nachricht in der vita Vespasiani Suetons hat Vespasian Lykien die Freiheit wieder genommen.25 Ergo mußte Lykien vorher in die Freiheit entlassen worden sein, denn Claudius hatte die Region ja provinzialisiert. Die Sachlage wurde noch dadurch kompliziert, weil man zumeist davon ausging, daß Lycia von Anfang an mit Pamphylia zusammen eine „Doppel“provinz bildete.26 Pamphylia aber war ganz sicher nicht in die Freiheit entlassen worden, da diese Region zusammen mit Galatia unter Galba von einem Statthalter geleitet wurde.27
Bereits im Jahr 1970 wurde in einem Aufsatz in der ZPE gezeigt,28 wie die Bauinschrift des Bades von Patara zu verstehen sei und daß sie somit in die neronische Zeit gehöre. Denn der Name Vespasians habe nur später den Namen Neros ersetzt, Marcius Priscus aber sei dort als Legat Neros genannt und nicht als Legat Vespasians. Wie aber mußte man unter diesen Umständen den Status der Provinz Lycia in der Zeit zwischen Nero und Vespasian verstehen? Wurde Marcius Priscus, wenn die Provinz für eine bestimmte Zeit in die Freiheit entlassen worden war und damit nicht mehr statthalterlichem Befehl unter-stand, später unter Vespasian wieder dorthin gesandt und amtierte dann erneut als Legat der Provinz? Das wäre absolut ungewöhnlich gewesen, die zweimalige Übertragung ein und derselben Provinz an einen Senator wäre ein absolutes Unikum gewesen. Deshalb wurde ebenfalls in dem genannten Aufsatz der ZPE vorgeschlagen, von der Meinung abzugehen, Lycia sei aus der Befehlsgewalt eines römischen Statthalters entlassen worden, vielmehr müsse man, wenn die Nachricht bei Sueton nicht einfachhin falsch war, den Inhalt dessen, was die von Vespasian den Lykiern wieder entzogene libertas meinte, anders bestimmen, nicht jedoch als Freiheit von einem Statthalter; denn Marcius Priscus war, wie Inschriften dieser Zeit-spanne zeigen, als Statthalter kontinuierlich von Nero bis Vespasian als Statthalter für Lycia zuständig. Dafür wurde auch noch als Beweis eine Inschrift herangezogen, die aus dem lykischen Lydai stammte und unter einer Ehrenstatue des Marcius Priscus eingemeißelt worden war (oben Nr. 4). Darin wird dieser in folgender Weise charakterisiert: presbeut[Øn] AÈtokrãtorow Ka¤sar[ow] OÈespasianoË Seb[a]stoË ka‹ pãntvn [AÈt]okratÒrvn épÚ T[i]ber¤ou Ka¤sarow. Da es natürlich unmöglich war, daß Marcius Priscus seit Tiberius, der im Jahr 37 n. Chr. starb, Lykien geleitet hatte, wurde vorgeschlagen, damit solle gesagt werden, Marcius Priscus sei von der Zeit Neros über das Vierkaiserjahr hinweg unter allen Herr-schern bis zu Vespasian Legat in dieser Provinz gewesen. Da der Name Neros nach dessen hostis-Erklä-rung nicht mehr genannt werden durfte, habe man – in Wirklichkeit wohl der Statthalter selbst – einen unverfänglichen Namen gewählt, der aber dennoch für jeden politisch denkenden Menschen erkennen ließ, wer hier gemeint war. Schließlich gehörte Nero zur claudischen Familie, in der das Praenomen Tibe-rius ganz üblich war. Durch diese Formulierung sollte gezeigt werden, wie dieser Statthalter die gesamte schwierige Zeit von Nero bis zur vespasianischen Zeit in derselben Stellung überdauert hatte.
Diese Interpretation wurde nirgends akzeptiert.29 Nun aber beweisen die neuen Texte mit großem Nachdruck, daß gerade diese Interpretation zutrifft. Denn zum einen zeigt die Bauinschrift für den Leucht-turm von Patara, daß Marcius Priscus spätestens im Jahr 64 in Lykien als Statthalter amtierte. Zum andern weist die Inschrift unter seiner Statue eben in Patara genau dieselbe Formulierung auf wie die Inschrift aus Lydai: [presbeutØn AÈtokrãtorow OÈespasianoË Ka¤sa]row SebasstoË éntistrãthgon ka‹ pãntvn
25 Sueton, Vesp. 8, 4: Achaiam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum, libertate adempta, item Thraciam, Ciliciam et Commagenen, ditionis regiae usque ad id tempus, in provinciarum formam redegit. Cappadociae propter adsiduos barbar-orum incursus legiones addidit, consularemque rectorem imposuit pro eq. R.
26 Zuletzt dazu H. Brandt – F. Kolb, Lycia et Pamphylia. Eine römische Provinz im Südwesten Kleinasiens, Mainz 2005, 22 ff.; H. Brandt war in seinem Buch: Gesellschaft und Wirtschaft Pamphyliens und Pisidiens im Altertum, Bonn 1992, 97 ff. noch von einer Provinz Lycia-Pamphylia erst ab Vespasian ausgegangen. Vgl. auch Adak (Anm. 1).
27 Tacitus, hist. 2, 9, 1: Galatiam ac Pamphyliam provincias Calpurnio Asprenati regendas Galba permiserat.28 W. Eck, Die Legaten von Lykien und Pamphylien unter Vespasian, ZPE 6, 1970, 65 ff.; vor kurzem ders., Die politisch-
administrative Struktur der kleinasiatischen Provinzen während der hohen Kaiserzeit, in: Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 28–30 settembre 2006, hg. G. Urso, Pisa 2007, 189 ff.
29 Siehe z. B. C. P. Jones, Gnomon 1973, 690 f.; B. Kreiler, Die Statthalter Kleinasiens unter den Flaviern, Diss. München 1975, 103 ff.; Brandt–Kolb (Anm. 26) 22 ff. Angenommen wurde die Interpretation im Wesentlichen von A. Balland, Fouilles de Xanthos, tome 7, Paris 1981, 2 ff.; B. E. Thomasson, Laterculi praesidum I, Göteborg 1984, 276.
24 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
aÈtokra[t]Òrvn épÚ Tiber¤ou Ka¤sarow. Derselbe Wortlaut in zwei Inschriftentexten, jedesmal zu dem Zweck, die Gestalt des Marcius Priscus in ihrer Besonderheit herauszustellen, läßt keinen Zweifel daran, daß dieser Text auf den Senator selbst zurückgeht; denn er wollte das Exzeptionelle betonen, das seine Statthalterschaft in Lycia auszeichnete. In dem Text in Patara aber ging er noch einen Schritt weiter, indem er hinzusetzen ließ, daß diese Statthalterschaft acht Jahre gedauert habe, was bedeutet, daß sie von Nero bis zu Vespasian, je nach dem Beginn im Jahr 63 oder 64, bis zum Jahr 70 oder 71 ohne jede Unter-brechung verlief. Bei den heftigen inneren Konfl ikten zwischen den einzelnen Kaisern und Mitgliedern der senatorischen Führungsschicht kann allein diese lange Dauer durchaus als eine große Leistung des Marcius Priscus angesehen werden.
Und wie wenn es noch eines abschließenden Beweises für die lange, ungebrochene Kontinuität der Statthalterschaft des Marcius Priscus bedurft hätte, hat B. İplikçioğlu auch noch eine Bauinschrift aus Rhodiapolis publiziert, die aus der Zeit Galbas stammt, also aus dem Jahr 68 oder dem Anfang von 69, und natürlich Marcius Priscus als Legaten von Lycia bezeugt (Nr. 3). Eine Unterbrechung seiner Statthalterschaft hat es also nicht gegeben, die Provinz Lycia hat weiter bestanden und eine libertas, die eine Freiheit vom statthalterlichen Regiment bedeutet und die Vespasian den Lykiern wieder genommen, indem er sie erneut einem Legaten unterstellt hätte, kann Lycia damals nicht besessen haben. Dies ist die zwingende logische Folge des inschriftlichen Befundes, für die jedoch allein die Bauinschrift des Bades in Patara genügt hätte, hätte man nur der Logik freien Raum gegeben.
Angesichts dieses Ergebnisses ist zu fragen, was dann die Bemerkung über die libertas der Lykier bei Sueton bedeutet haben kann. Das Einfachste wäre, die Notiz als falsch anzusehen. Das ist nicht völlig ausgeschlossen, da es auch irrige Mitteilungen in den Viten Suetons gibt.30 So behauptet Sueton im selben Satz, in dem er davon spricht, Lykien sei von Vespasian die Freiheit genommen worden, Thracia sei damals zu einer Provinz gemacht worden; dies trifft evident nicht zu, da bereits Claudius das vorher von Klientelkönigen regierte Land in eine Provinz umgewandelt hatte. Doch sinnvoller erscheint es, den Hinweis Suetons grundsätzlich ernst zu nehmen, aber inhaltlich anders zu verstehen.
Nun ist es unbestritten, daß die von Rom einzelnen politischen Einheiten gewährte libertas inhaltlich nicht immer dieselbe war, sondern je nach Situation, in der sie verliehen wurde, und den Verdiensten, die dafür die Ursache waren, variieren konnte.31 Möglicherweise verblieben manchen politischen Einheiten, gleichgültig ob es sich dabei um Städte oder ganze Provinzen handelte, einzelne Elemente der früheren libertas, während sie anderen genommen wurden. So wäre es im Fall der Provinz Lycia denkbar, daß Claudius nicht all das, was üblicherweise bei der Provinzialisierung eines Gebiets von Rom verordnet wurde, durchsetzte, was dann andererseits als (partielle) libertas angesehen werden konnte, eben als ein Privileg, als ein Sonderrecht. Nun wissen wir, daß Vespasian daran gelegen sein mußte, die Staatsfi nanzen nach der neronischen Verschwendung und den massiven fi nanziellen Verlusten während der Bürgerkriege zu sanieren. Auch deshalb hat er der Provinz Griechenland die Freiheit wieder genommen, weshalb die Provinz von da an wieder einem Prokonsul unterstand. Eine Freiheit des Inhalts wie Achaia hatte Lycia zu Beginn der vespasianischen Zeit nicht, da, anders als in Achaia, stets ein Statthalter vorhanden war. Aber es wäre denkbar, daß Claudius im Jahr 43 bei der Provinzialisierung Lykiens den Bewohnern keine Kopf-steuer, tributum capitis oder kefãlaion, auferlegt hatte. Gerade die Kopfsteuer, die die einzelne Person traf, konnte man als ein besonderes Zeichen der Unfreiheit deuten: umgekehrt war es dann möglich, beim Fehlen dieser Steuer von libertas zu sprechen. Ein solches Szenario wäre in Lycia sehr wohl vorstellbar.
Das erhält eine Stütze durch eine Beobachtung in der Inschrift, die von der Wiederherstellung eines Aquädukts durch Vespasian unter dem Statthalter Marcius Priscus berichtet, die hier als Anhang nochmals publiziert wird. Die Bezahlung der den Wasserleitungsstrang tragenden Mauer wäre unter Normalumstän-den offensichtlich durch eine Sonderumlage von der Bevölkerung bezahlt worden. Das wird ausdrücklich
30 D. Flach, Zum Quellenwert der Kaiserbiographien Suetons, Gymnasium 79, 1972, 273 ff.; vgl. W. Eck, Chiron 12, 1982, 284 mit Anm. 16.
31 R. Bernhardt, Imperium und Eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städten des griechischen Ostens, Diss. Hamburg 1971.
Der Leuchtturm von Patara 25
in diesem Fall in der Inschrift als unnötig hingestellt, dagegen wird betont, die Bezahlung sei zum Teil aus der Kopfsteuer erfolgt, die auf die Stadt entfallen war. Das würde bedeuten, daß einerseits zwar das tribu-tum capitis nunmehr erhoben wurde, daß aber andererseits diese im vorliegenden Fall für eine dringende Reparaturmaßnahme verwendet wurde.
Wie auch immer der Inhalt der libertas, die Vespasian den Lykiern genommen hat, verstanden werden muß, die Freiheit hatte nicht darin bestanden, keinem Statthalter unterworfen zu sein. Vielmehr blieb seit der Umwandlung von Lycia in eine Provinz unter Claudius dieser Status erhalten, Vespasian hat vermut-lich nur ein Privileg, das Claudius den Lykiern noch belassen hatte, genommen. Das aber konnte dann, vor allem von Seiten der Provinzialen, als Verlust der Freiheit interpretiert und auch von Sueton so verstanden werden.
Marcius Priscus tritt uns in zahlreichen Inschriften als Statthalter von Lycia entgegen. Die Mehrzahl dieser Texte bilden Bauinschriften: zwei in Patara und in Xanthos, je eine in Olympus und in Rhodiapolis. Warum es zu dieser starken Bautätigkeit in Lycia gekommen ist, kann hier nicht im Detail erörtert werden, zum Teil sind sie die Folgen von Erdbebenschäden, wie dies in einem Text aus Xanthos sowie in der Aquä-duktbauinschrift aus Patara direkt gesagt wird.32 Patara hatte jedenfalls sehr gute Gründe, Marcius Priscus als besonderen Förderer der Stadt zu ehren und von ihm zu sagen, er habe „unsere Stadt mit den schönsten Bauwerken geschmückt“. Denn sowohl Pharos und Antipharos als auch das Bad wurden von ihm noch in neronischer Zeit erbaut, unter Vespasian wurde auch die Wasserleitung, die bereits auf die claudische Zeit zurückging, erneuert, wobei man besondere Sicherheitsmaßnahmen für den Fall einer erneuten Unterbre-chung des über den Aquädukt herangeführten Wassers getroffen hat. All dies und möglicherweise noch weitere Bauten in Patara, die uns aber noch nicht bekannt wurden, sind mit diesem Statthalter verbunden, nicht anders als die Thermen in Olympos oder die nicht näher zu identifi zierenden Bauten in Xanthos und Rhodiapolis. Doch darüber hinaus hat er sich zumindest bei manchen Teilen der Bevölkerung auch den Ruf eines kompetenten Richters erwoben, weshalb ihn Patara auch ehrt, „weil er acht Jahre lang dem Volk der Lykier auf unbestechliche und gerechte Weise Recht gesprochen hat“.33 Das drückt sich auch in dem Epitheton dikaiodÒthw aus, das in der Inschrift aus Lydai erscheint, ein „Ehrentitel“, der in Lykien(-Pamphylien) fast zu einer titularen Bezeichnung für den Statthalter geworden ist. Vielleicht war die Benennung eine Folge der zu Beginn der Provinz so massiv vorhandenen inneren Spannungen, die sich auch im öffentlichen Leben der Städte und der Bürger auswirkten und in welche sogleich die ersten Statthalter Recht fi ndend eingreifen mußten. Auch Marcius Priscus gehört in diese Reihe.
AnhangZur Wasserleitung von Patara
Unter Kaiser Claudius erhielt Patara, die Hauptstadt der neuen Provinz Lykien, eine große Fernwasserlei-tung. Das Wasser wurde von den Quellen, die bei Islamlarköy noch heute überreich sprudeln, in die Stadt geleitet. Die Leitung überquerte in ihrem Verlauf eine Senke auf einer bis zu neun Meter hohen Mauer. Als diese Mauer durch Erdbeben beschädigt und die Wasserversorgung der Stadt unterbrochen war, gelang es der Tatkraft des Statthalters Marcius Priscus, der das Erdbeben in der Provinz selbst miterlebt hatte, die Leitung in vier Monaten zu reparieren. Er ließ die Mauer neu errichten und eine zusätzliche Druckleitung aus Tonrohren anlegen. Die Versorgung der Hauptstadt war jetzt auch nicht mehr gefährdet, wenn die Leitung an dieser kritischen Stelle der Wartung bedurfte, da man auf eine Ersatzleitung umstellen konnte.
Zwei gleichlautende Bauinschriften sind über den beiden Durchgängen am Fuß der Mauer ange-bracht, von denen eine in östliche, die andere in westliche Richtung blickt. S. Şahin hat beide Inschriften
32 Balland (Anm. 29) 29 ff. Nr. 12.33 Auch diese Betonung, er habe dem Volk der Lykier Recht gesprochen, weist darauf hin, daß allein Lycia ihm unterstan-
den hat, nicht auch Pamphylia.
26 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
vor kurzem vorgelegt.34 Sein Text beruht auf Photographien, welche ihm K. Grewe zur Verfügung gestellt hatte. Einiges war auf den Photographien nicht klar zu erkennen, so das Ende der fünften Zeile, die Zeit-angabe in der siebten und eine Stelle in der neunten Zeile. Viele Lettern sind unterpunktet, d.h. nicht mit Sicherheit gelesen, was bei der starken Versinterung der Inschriften nicht verwundert.
Die Abschrift, die Şahin von den Photographien gewonnen hatte, wurde vor Ort am Original revi-diert und zwar wurde sie mit jener Inschrift verglichen, die nach Westen schaut. Dabei ließ es sich Fahri Işık, der Leiter der Ausgrabung Patara, nicht nehmen, selbst mit Hand anzulegen. Der Sinter wurde an manchen Stellen ganz entfernt, an anderen ließen sich einige Schichten abheben. Das Sonnenlicht tat ein übriges, indem es so günstig einfi el, daß die Buchstaben, selbst unter dem Sinter, gut zu lesen waren. Die Überprüfung ergab folgenden Text:
AÈtokrãtvr Ka›sar Flãouiow OÈespasianÚw SebastÚw tÚ toË Ídragvg¤ou énãlhmma sumpesÚn seismo›w §k yemel¤vn épokat°sthse sÁn to›w §pÉ aÈt“ liy¤noiw §k tetrap°dou l¤you svl∞si prostey°ntow ka‹ •t°rou parå tÚ4 énãlhmma yleimmatikoË Ídragvg¤ou diå trist¤xvn svlÆnvn Ùstrakin«n palaisti- a¤vn Àste due›n ˆntvn efi yãteron §piskeu∞w dehye¤˙, mØ §npod¤zesyai tÚn drÒmon édiale¤ptou menoÊshw t∞w xrÆsevw. §peskeÊase d¢ ka‹ tå loipå toË Ídragvg¤ou ka‹ tÚ Ïdvr metå m∞naw dÄ parapese›n efisÆgagen diå S°jtou Mark¤ou Pre¤skou presbeu-8 toË aÈtoË éntistratÆgou §k t«n sunthrhy°ntvn tª pÒlei xrhmãt[v]n épÚ kefala¤vn ka‹ tÚ ¶ynow sunÆnenke X , mhdemiçw katÉ êndra §pigraf∞w genom°nhw. toË ¶rgou katarx- y°ntow m¢n ÍpÚ OÈil¤ou Flãkkou presbeutoË Klaud¤ou Ka¤sarow SebastoË éntistratÆgou sunteleivy°ntow d¢ ka‹ efisaxy°ntow toË Ïdatow §p‹ ÉEpr¤ou Mark°llou presbeutoË Klaud¤ou12 Ka¤sarow SebastoË éntistratÆgou
Nachdem Erdbeben die Mauer der Wasserleitung zum Einsturz gebracht hatten, ließ der Imperator Caesar Flavius Vespasianus Augustus diese zusammen mit der Leitung aus Quadersteinen, die auf ihr verläuft, von Grund auf neu errichten und zusätzlich eine Druckleitung aus Tonröhren von einer Handbreite der Mauer entlang in drei Reihen legen, was zur Folge hatte, daß der Wasserlauf nicht behindert ist, wenn die Leitung der Wartung bedarf, und die Nutzung dann nicht unterbrochen wird, weil es zwei Leitungen gibt.
Auch die übrige Leitung ließ er überholen und das Wasser, das vier Monate ausgelaufen war, durch Sextus Marcius Priscus, seinen Legaten im propraetorischen Rang, (in die Stadt) bringen. (Bezahlt wurde alles), ohne daß ein Steuerpfl ichtiger35 von einer Sonderumlage belastet worden wäre, von den Geldern, die für die Stadt von der Kopfsteuer verwahrt wurden, und auch der Bund steuerte xx Denare bei.
Vilius Flaccus, Legat des Claudius Caesar Augustus im propraetorischen Rang, hatte mit dem Bau der Leitung begonnen, vollendet wurde er und das Wasser in die Stadt gebracht unter Eprius Marcellus, Legaten des Claudius Caesar Augustus im propraetorischen Rang.
2 énãlhmma sumpesÚn seismo›w: Ein Erdbeben, das mit mehreren Nachbeben einherging, ließ die Mauer, auf der die Wasserleitung verlief, einstürzen. Es war wohl dasselbe Beben, das auch in Xanthos Schäden verursacht hatte, die ebenfalls von Marcius Priscus behoben wurden.36 Der Leuchtturm von Patara scheint dieses Beben unbeschädigt überstanden zu haben; andernfalls hätte die Inschrift, die unter der Statue für Marcius Priscus am Leuchtturm angebracht wurde, wohl von den Schäden des Bebens und ihrer Behebung gesprochen. Beim großen Beben, das in den ersten Jahren des Kaisers Antoninus Pius das südwestliche
34 S. oben unter Anm. 24. 35 Şahin, Die Bauinschrift auf dem Druckrohraquädukt von Delikkemer bei Patara (Anm. 24) hatte, wie sich aus einem
Zusatz auf S. 109 dieses Bandes ergibt, für die Stelle vom Herausgeber den richtigen Hinweis für die Lesung und damit die Interpretation erhalten, hat ihn aber unbegreifl icherweise nicht akzeptiert, obwohl der Gesamtsinn diese Lesung zwingend verlangt.
36 S. A. Balland (Anm. 29) 29 ff. Nr. 12.
28 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
Kleinasien heimsuchte,37 scheint die Stadt Patara ebenfalls glimpfl ich davon gekommen zu sein. Weder der hadrianische Getreidespeicher,38 noch der Ehrenbogen, noch das Theater39 scheinen damals in größerem Umfang beschädigt worden zu sein, und im Opramoas-Dossier fehlen Angaben zu Zahlungen, mit deren Hilfe Schäden des „kosmischen“ Erdbebens40 in der Stadt behoben werden sollten.41
8 f. Die Kopfsteuer, die Patara zu bezahlen hatte, war angespart worden (sunthrhy°nta xrhmãta), und aus diesem Fundus wurden die Baumaßnahmen bezahlt. Es wurden weder Schulden aufgenommen noch eine Sonderabgabe von den Bürgern der Stadt erhoben; dabei klingt die Aussage, „ohne daß ein Steuerpfl ichtiger von einer Sonderumlage belastet worden wäre“ (mhdemiçw katÉ êndra §pigraf∞w geno-m°nhw), fast wie eine Rechtfertigung der vermutlich eben erst neu eingeführten Kopfsteuer. Der lykische Bund beteiligte sich ebenfalls an den Baukosten und steuerte einen gewissen Anteil bei. Als die Inschrift angebracht wurde, stand sein Beitrag noch nicht fest; die Ziffer, die nach dem Drachmenzeichen in Zeile 9 fehlt, konnte später mit Farbe nachgetragen werden.
Als unter Kaiser Nero eine Therme in Patara errichtet wurde – es war wohl der erste derartige Bau in der Stadt –, trifft man auf eine ähnliche Formulierung: das Bad wurde fi nanziert §k t«n sunthrhy°ntvn xrhmãtvn ¶k [te t]oË ßynouw dhn vacat ka‹ t«n épÚ t∞w Patar°vn pÒleow (TAM II 396). Auch für diesen Bau wurden weder Schulden aufgenommen noch eine Umlage erhoben; auch er wurde aus ange-spartem Geld fi nanziert. Auch hier hatte sich der lykische Bund an den Kosten beteiligt.
Es wäre verlockend, weitergehende Folgerungen aus diesen beiden Stellen zu ziehen, nämlich derart, daß öffentliche Bauten in der Provinz Lycia mit pecunia praesens zu bezahlen waren und der lykische Bund sich an Maßnahmen, die die Infrastruktur verbesserten, beteiligt hat. Vielleicht kommen eines Tages Quellen zutage, die diese Hypothesen bestätigen.
10 Vilius Flaccus: auf ihn werden sich die Vertreter der gens Vilia in Patara zurückführen lassen.42 10 f. Bei längeren Bauvorhaben ist es wohl nicht unüblich gewesen, daß mehr als ein Statthalter in der
einen oder anderen Form an einem Bauvorhaben beteiligt war, vor allem, wenn die Baumaßnahme erst gegen Ende einer Statthalterschaft begonnen wurde. Wie weit solch doppelte Zuständigkeit in Inschriften vermerkt wurde, ist nicht zu erkennen. Doch gibt es vergleichbare Formulierungen für den Beginn und die Vollendung eines Bauwerks durch zwei verschiedene Statthalter auch sonst: siehe z.B. einen Text aus Lambaesis in der Provinz Numidia: aedem [a Lep]ido Tertullo incohatam p[er]fi ci curavit Cl(audius) Gallus [leg(atus)] Augustor(um) pr(o) pr(aetore).43 Aus der Provinz Tripolitania stammt der folgende Text: Centenarium Tibubuci quod Valerius Vibianus v(ir) p(erfectissimus) initiari <iusserat?>, Aurelius Quintianus v(ir) p(erfectissimus) praeses provinciae Tripolitanae perfi ci curavit.44
Antalya Havva İşkan-IşıkKöln Werner EckHöhr-Grenzhausen Helmut Engelmann
37 D. Magie, Roman Rule in Asia Minor (Princeton 1950) I 631–2; II 1491–2. L. Robert, Documents d’Asie Mineure (Paris 1987) 96 ff.
38 Zur Lage der genannten Gebäude s. den beigefügten Stadtplan.39 Freundlicher Hinweis von H. Alanyali und J. Ganzert, die das Theater seit einigen Jahren aufnehmen.40 gegonÒtow kosmikoË seismoË, Opramoas-Dossier (TAM II 3, Nr. 905, XIII D 4).41 Opramoas ließ in Patara eine Halle am Hafen errichten und gab Geld für das Heiligtum des Apoll, in dem man das
Orakel, das über einen längeren Zeitraum eingestellt war, wieder hatte aufl eben lassen (TAM II 905, XVII E–F).42 S. zuletzt H. Engelmann bei T. Korkut – G. Grosche, Das Bouleuterion von Patara (= Patara II 1, Istanbul 2007) 163 ff.
Nr. 6.43 AE 1957, 123.44 CIL VIII 22763 = Dessau 9352 (die Ergänzung des Verbums <iusserat> nach Dessau). Auch bei kaiserlichen Bauin-
schriften kann auf die Abfolge zweier Kaiser verwiesen werden; siehe z.B. CIL X 6926 ff. (Meilensteine an der via Appia).
Der Leuchtturm von Patara 29
Die Mauer der Wasserleitung mit Durchgang, oben die Steine der Druckleitung
Tonröhren von „einer Handbreite“ Zwei Steine der Druckrohrleitung mit den Verbindungsmuffen
30 H. İşkan-Işık – W. Eck – H. Engelmann
Blick auf den freigelegten Leuchtturm
Der Leuchtturm, vom Sande befreit