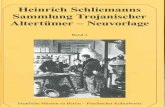Performances in Moskau: Von der Recherche bis zur Intervention. 2000-2012.
Von der Dominanz zur Chancengleichheit
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Von der Dominanz zur Chancengleichheit
Dokumentation der Tagung
Von der Dominanz zur Chancengleichheit
Interkulturelle Öffnung und Diversity Management in
Österreich
Graz, 19. Oktober 2004
.
... ... Dokumentation der Tagung
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´
Inhaltsverzeichnis
Tagungsbericht................................................................................................................................Seite 3 Interkulturelle Öffnung: Kompass für die Zukunft Referat von Wolfgang Hinz-Rommel...............................................................................................Seite 6 Vom Nutzen der Vielfalt Diversity Management als Aufgabe betrieblicher Politik Das Referat von Christine Mattl und Dominik Sandner...................................................................Seite 8 Die Pilotprojekte Kärnten: Kurbad Eisenkappel .........................................................................................................Seite 10 Steiermark: Steirermärkische Gebietskrankenkasse........................................................................Seite 11 Tirol: SOS – Clearing-House Salzburg...........................................................................................Seite 12 Berichte zu den Arbeitskreisen Sesam öffnet sich. Bad Eisenkappel................................................................................................Seite 13 Interkulturelle Öffnung in Institutionen. Steiermärkische Gebietskrankenkasse............................Seite 14 SOS – Clearing-House Salzburg.....................................................................................................Seite 15 Podiumsgespräch...........................................................................................................................Seite 17 Die Coaches....................................................................................................................................Seite 19 Die ReferentInnen .........................................................................................................................Seite 26 Die TeilnehmerInnen am Podiumsgespräch ..............................................................................Seite 30
Impressum: Medieninhaber: ZEBRA – Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen u. kulturellen Betreuung von Ausländern u. Ausländerinnen in Österreich Herausgeberin: Edith Glanzer, Redaktion: Wolfgang Gulis (Leitung), Helga Moser Alle 8010 Graz, Pestalozzistraße 59/II, Tel: 0316/ 90 80 70, Fax: 0316/ 90 80 70 –25 Mail: [email protected], Web : www.zebra.or.at MitarbeiterInnen an dieser Nummer: Inge Frei, Wolfgang Gulis, Josefa Molitor-Ruckenbauer Helga Moser, Abderrahim Rachdi, Julia Schönwiese, Snjezana Topic-Zivanic Fotos: Helga Moser, Barbara Schmut Gesamtherstellung: Zebra Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht unbedingt der Meinung der Herausgeberin oder Redaktion entsprechen. Textnachdruck mit Quellenangaben gestattet. ZEBRA-Mitgliedsbeitrag 2004: € 30,- / Ermäßigung: € 15,- (SchülerInnen, Studierende und Arbeitslose) / Fördermitglieder u. Organisationen: € 73,-
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
2
Tagungsbericht Was hat ein Teppich mit Interkultureller Öffnung zu tun?
Von der Dominanz zur Chancengleichheit Im Rahmen des MIDAS Projektes, welches von der Europäischen Förderrichtlinie EQUAL finanziert worden ist, fand am 19. Oktober 2004 die Tagung „Von der Dominanz zur Chancengleichheit. Interkulturelle Öffnung und Diversity Management in Österreich“ in Graz statt. 15 Monate lang hatten sich 14 Personen mit Hilfe eines theoretischen Schulungspro-gramms, einem einwöchigen Praktikum und schließlich einem 1-jährigen Pilotprojektpro-gramm zu „interkulturell kompetente Coaches“ schulen lassen. Die Tagung bildete den Abschluss des Programms. Ein Bericht von Helga Moser.
Europa verändert sich, wird heterogener, durchmischter und multikultureller. Migration ist Gegenwart, stellt neue Heraus-forderungen an die Politik, an die Verwaltung und an die Wirt-schaft; braucht neue Regeln und Konzepte. Die Suche nach Aus-wegen an nicht diskriminieren-der Arbeitsmarkt-, Beschäfti-gungs- und Personalpolitik ist ein Gebot der unmittelbaren und nahen Zukunft.
Das MIDAS Projekt, das durch die europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL seit Herbst 2002 finanziert wurde, ist eine solche Suche und Gele-genheit, Neues auszupro-bieren. Im Rahmen eines MIDAS Teil-Projektes, das den Titel „Interkul-turelle Öffnung“ trug, wurden vom Grazer Verein ZEBRA mit Unterstützung der Tiroler Stelle ZEMIT und der Kärntner MigrantInnen-beratungsstelle Beispiele entwickelt, wie ein sol-cher institutioneller Umbau eine Öffnung erfolgen köndurchgeführt werden sollte.
14 Personen mit Migratihintergrund wurden zu interturell kompetenten Coaches
gebildet. Diese setzten daraufhin ihr Wissen in drei sogenannten Pilotprojekten, bei der Steier-märkischen Gebietskrankenkas-se/Graz, dem Kurbad Eisenkap-pel/ Kärnten und im SOS Clea-ring House/Salzburg um. In diesen Einrichtungen waren sie als externe Coaches tätig und analysierten die Durchlässigkeit und Zugänglichkeit der Einrich-tungen für MigrantInnen und er-arbeiteten Verbesserungsvorsch-läge.
zum Thema Interkulturelle Öff-nung) konnten dafür ebenso ge-wonnen werden, wie die beiden Sozial- und Wirtschaftswissen-schaftlerInnen Christine Mattl und Dominik Sandner von der WU-Wien, die sich national wie international mit dem Thema des Diversity Managements (DM) befasst haben. Auffallende inhaltliche Über-
einstimmungen Trotz der unterschiedlichen
`Von deD
und nte/
ons-kul-aus-
Das Experiment - die Pilot-projekte - wurde im Rahmen der Tagung präsentiert und disku-tiert. Internationale Experten wie Wolfgang Hinz-Rommel (Ver-fasser von mehreren Büchern
ideologischen Ausrichtung und der verschiedenen Einsatzfelder der beiden Konzepte, gibt es einige inhaltliche Übereinstim-mungen. Sowohl Herr Hinz-Rommel als auch Frau Mattl und
r Dominanz zur Chancengleichheit´ okumentation der Tagung
3
Herr Sandner betonten in ihren Referaten, dass die Verankerung von Interkultureller Öffnung bzw. Diversity Management in den Strukturen essentiell ist. Da-mit liegt die Verantwortung von derartigen Prozessen vor allem einmal bei der Leitungs- und Führungsebene. Nur Trainings auf der MitarbeiterInnenebene wären eben nicht ausreichend.
Veränderungsprozesse auf allen innerbetrieblichen Ebenen und eine strukturelle Veran-kerung sind notwendig und durch mittel- bis langfristige Konzeptionen zu sichern - sollen derartige Konzepte auch langfristig erfolgreich sein. Deutlich wurde auch, dass beide Konzepte die MitarbeiterInnen-orientierung ebenso ins Zentrum rücken - also die VertreterInnen der Mehrheitsbevölkerung in die Betrachtung einschließen bzw. diese haben von den Vor-schlägen ebenso zu profitieren, wie die MigrantInnen auch.
Ein Beispiel, das dies gut il-lustrierte, brachte Hinz-Rommel aus seiner reichhaltigen prak-tischen Erfahrung mit Interkul-tureller Öffnung in Organisatio-nen im Sozialbereich ein: Er berichtete von seiner Arbeit in einem Altenpflegeheim. In das Haus zog ein neuer Patient ein. Bei der Aufnahme äußerte der ältere Herr den Wunsch, einen Teppich in seinem Zimmer auf-zulegen. Dies widersprach je-doch der Hausordnung. Da es sich bei dem Patienten um einen Türken handelte, wurde es ihm jedoch gewährt. Das Haus be-fand sich im Prozess der inter-kulturellen Öffnung und die Mit-arbeiterInnen waren dadurch für unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen mit verschiede-nem kulturellen Hintergrund sensibilisiert worden. Das An-liegen wurde als Wunsch nach einem Gebetsteppich interpre-tiert. Dass der neue Patient je-doch nie auf dem Teppich be-
tete, sondern ihn als Verschöne-rung seines Zimmers betrach-tete, stellte sich erst später her-aus. Der Fall hat jedoch dazu geführt, dass die Hausregeln
geändert wurden und alle Pa-tientInnen bei Wunsch einen Teppich in ihren Zimmern auf-legen durften.
3 Pilotprojekte auf dem
Prüfstand Breiten Raum bei der Tagung wurde den Präsentationen der Arbeit der Coaches in den Pilot-projekten gewidmet, mit an-schließender Möglichkeit die gemachten Erfahrungen in drei Arbeitskreisen ausführlicher zu diskutieren. Die Projektgruppen beurteilten ihre Erfahrungen im Projekt und die erreichten Er-gebnisse unterschiedlich. Einige hätten sich eine konkretere Um-setzung aller von ihnen vorge-schlagenen Maßnahmen erwartet und sahen sich gescheitert, da innerhalb der kurzen Zeit „nur einige Vorschläge“ umgesetzt wurden. Oder wie im Falle der Coaches, die in der Steier-märkischen Gebietskrankenkas-se aktiv waren und die keine Umsetzungsmaßnahmen erwir-ken konnten.
Jedoch löste gerade dieses Pilotprojekt einen internen Dis-kussionsprozess in der Institu-tion aus, der zwar keine unmit-telbaren Ergebnisse hervorge-bracht hatte. Es wurden aber die Grundlagen für einen um-
fassenden Veränderungsprozess in einer derart großen Organisa-tion geschaffen.
Den TeilnehmerInnen wurde dies im Zuge von Diskussionen
im Arbeitskreis erst deutlich. Der rege Austausch zwischen den Coaches, Vertretern der Pi-lotprojekte, Herrn Kotnik von der Bildungsabteilung der St-GKK, Herrn Svager, Leiter des SOS Clearing Hauses in Salz-burg und den Tagungsteil-neh-merInnen führte dazu, dass das Projekt als solches wieder mit einem größeren politischen und strukturellen Rahmen in Bezie-hung gesetzt wurde.
Praktische Umsetzungen In der abschließenden Po-
diumsdiskussion nahmen Ex-pertInnen teil, die sich in ihrer Arbeit mit der Umsetzung von interkultureller Öffnung auf kommunaler Ebene beschäfti-gen. Sie diskutierten über poli-tische Rahmenbedingungen und Umsetzungsstrategien.
Annette Sprung, die im Jahre 2001/2002 eine Expertise für ein Integrationskonzept im Auftrag der Stadt Graz erstellte, konstatierte, dass eine Um-setzung von interkulturelle Öff-nung seither noch nicht stattge-funden hat.
Ursula Struppe konnte da-gegen von einer Umorientie-rung im Verständnis der Stadt Wien berichten. Dort ist sie mit dem Entwicklungsprozess des
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
4
Diversitäts-Managements inner-halb der Stadtverwaltung be-fasst. Sie betonte zwar wie die anderen PodiumsteilnehmerIn-nen, dass interkulturelle Öffnung ein Querschnittsthema für die gesamte Verwaltung sei, dass die Stadt Wien den Weg dorthin jedoch über die Einrichtung einer eigenen Magistratsabtei-lung für Integrations- und Diver-sitätsangelegenheiten gewählt
habe.
Edith Glanzer, Geschäfts-
führerin von ZEBRA mit reich-haltigen praktischen und theore-
tischen Erfahrungen in der Bildungsarbeit und der Bera-tungstätigkeit von Organisatio-nen ausgestattet, berichtete auch über den Prozess der inter-kulturellen Öffnung in der ober-steirischen Stadt Kapfenberg, mit dem sie sich in ihrer Dip-lomarbeit befasste. Sie betonte die Wichtigkeit von struk-turellen Maßnahmen, die für einen solchen Prozess erfor-
derlich sind, der Bedeutung der Unterstützung von der Leitungs-ebene, gleichzeitig aber auch die individuellen, auf die jeweilige Organisation abgestimmten Pro-
gramme. Dass dabei externe Beratungsleistungen und Expert-Innen herangezogen werden, unterstützt den positiven Lauf der Dinge nachhaltig.
Der Sozialwissenschafter Kenan Güngör, externer Berater von Leitbildprozessen in einigen Kommunen, warnte vor einer Kulturalisierung der Thematik und wies darauf hin, dass da-durch andere Problemfelder verdeckt würden. Es müsse hinterfragt werden, so Güngör, ob es sich bei auftretenden Problemen bei „interkulturellen“ Begegnungen tatsächlich um kulturelle Konflikte handle, oder ob dadurch nicht strukturelle und sozial-politische Rahmen-bedingungen, die zu einer Be-nachteilung von MigrantInnen führten, unhinterfragt bleiben. Handelt es sich z.B. wirklich um einen „kulturellen“ Konflikt, wenn Missverständnisse durch Sprach- oder Informations-defizite auftreten; oder habe dies nicht vielmehr mit einem Kompetenzproblem auf beiden Seiten zu tun?
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
5
Referate
Wolfgang Hinz-Rommel Interkulturelle Öffnung: Kompass für die Zukunft
Mit „Interkultureller Öffnung“ wird der Prozess bezeichnet, der das Ziel hat, angebotene Dienstleistungen allen Kunden, ent-sprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen und ihre unterschied-lichen Voraussetzungen berücksichtigend, zugute kommen zu lassen.
Jede/r Akteur/in, der einen solchen Prozess startet, ver-bindet in der Regel weitere Ziele damit:
Die Verbesserung der Ver-sorgung von Migrantinnen und Migranten. Die Professionalisie-rung der Erbringung der Dienst-leistungen. Die Steigerung von Effizienz und Effektivität. Die Sicherung des Absatzmarkts. Die bessere Nutzung der Poten-ziale der vorhandenen Arbeits-kräfte.
Dies soll in den folgenden acht Thesen weiter ausgeführt werden. 1. Das Thema „Interkulturel-le Öffnung“ hat Bedeutung gewonnen.
Es ist in Politik, Wirtschaft und Sozialarbeit gleichermaßen aktuell. Hierfür gibt es eine Rei-he von Indizien. Einige wenige seien genannt: Banken werben z. B. mit der Tatsache, dass sie Migrantinnen und Migranten be-schäftigen und Beratung in meh-reren Sprachen anbieten. Die Polizei hat große Anstrengun-gen unternommen, um Polizei-anwärter/innen mit Migrations-hintergrund zu gewinnen. In München wurden interkul-turelle Leitlinien für das Jugend-amt beschlossen. Viele Förder-
programme des Bunds und der Länder beinhalten interkulturelle Aspekte. 2. Interkulturelle Kompetenz durchdringt professionelle Handlungskompetenz.
Für alle Bereiche professio-neller Handlungskompetenz las-sen sich interkulturelle Heraus-forderungen formulieren. Einige Beispiele:
Fachwissen - Wissen über Feste, Ess- und Trinkgewohn-heiten, Zeitverständnis, Reli-gion, Schamgrenzen in verschie-denen Kulturen und Ländern. Wissen um die Konsequenzen eines befristeten Aufenthalts-status auf das individuelle Ver-halten.
Methodenwissen - Wissen um die Kulturgebundenheit von Methoden. Unterschiedliche Re-zeption von direktiven bzw. nondirektiven Beratungssettings.
Kommunikationsfähigkeit –Sprachkenntnisse. Die Grenzen der Kommunikation in einer Fremdsprache einschätzen kön-nen. Bedeutung nonverbaler Kommunikation. Unterschied-liche Bedeutung der per-sönlichen Beziehung in der Be-ratung. Selbstreflexionsfähigkeit –
Bewrelle
Wisscheschiweg 3. Whantureja, aoft n besokultallenMigbleisionwernen odermacgesenichfragnom 4. scheheit
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
usstsein der eigenen kultu-n Prägung. Beteiligungskompetenz – sen um die Bedeutung ethni-r Vereine. Kenntnis unter-edlicher Kommunikations-e.
er professionell handelt, delt immer auch interkul-ll kompetent? Im Prinzip ber in der Praxis dennoch icht.
Die Leitung trägt deshalb ndere Verantwortung. Inter-
urelles Arbeiten muss auf Ebenen verankert werden.
rantinnen und Migranten ben oft außerhalb des profes-ellen Blicks. MigrantInnen den oft zu RepräsentantIn-einer vermeintlichen Kultur ihres Herkunftslands ge-ht und nicht als Individuen hen. Ihre Interessen werden t immer ausreichend abge-t, sondern lediglich ange-men.
Benachteiligungen ethni-r und kultureller Minder-en verweisen in aller Regel
6
auf ein Problem „im Allge-meinen“.
Wenn Lösungen für „inter-kulturelle Probleme“ gefunden werden, kommen diese allen zu Gute.
Beispiele: Die Zulassung sprachlicher Vielfalt im Kinder-garten ermöglicht allen Kindern den Zugang zu interkulturellen Erfahrungen. Die Berücksich-tigung von Sonderwünschen beim Essen im Altenheim fördert die Vielfalt des Speise-plans für alle. Schlüsselprozesse müssen identifiziert und modi-fiziert werden. Dies setzt aller-dings den Willen zur Verän-derung und Handlungsspiel-räume voraus.
5. Die Suche nach einer nicht diskriminierenden Praxis ist schwierig.
Es ist im interkulturellen Be-reich besonders wichtig, die Ba-lance zwischen Bevormundung und Überforderung der Klient-Innen zu halten. Die Gleichbe-handlung aller führt nicht zu Gerechtigkeit. Die unterschied-lichen Ausgangsbedingungen müssen berücksichtigt werden. Benachteiligte zu bevorteilen, kann diskriminierend sein, weil ihnen Wege verstellt werden oder Potenziale missachtet wer-den. Jeweils geht es darum, die individuellen Spielräume zu ver-größern.
6. Interkulturell zu handeln bedeutet nach außen zu gehen.
Es ist für Einrichtungen elementar wichtig, interkulture-lle Netzwerke aufzubauen. Diese Netzwerke brauchen Pflege. Oft sind Problemlösungskompeten-zen außerhalb der Einrichtun-gen zu finden, z. B. bei eth-nischen Vereinen, Einzelper-sonen, bei Nachbarn und Ver-wandten. Um sie auszumachen und nutzen zu können, sind re-gelmäßige Außenkontakte unab-dingbar. Eigene Ressourcen wie z. B. Räume können als „Gegen-leistung“ zur Verfügung gestellt werden. 7. Migrant/innen äußern ihre Bedürfnisse (immer noch) erst zögerlich.
Es besteht in den meisten Einrichtungen noch keine Not-wendigkeit, sich ein interkul-turelles Profil zu geben. Kun-denorientierung ernst zu neh-men, bedeutet deshalb auch, auf die Migrant/innen zuzugehen. Bisher besteht nur geringer Druck auf die Anbieter (so-zialer) Dienstleistungen, ihre Angebote anzupassen. Die Kun-denorientierung bleibt unvoll-kommen, auch weil die Mig-rant/innen kaum über eine Lobby verfügen. Um dem abzu-helfen, müssen Einrichtungen die Organisationsformen von Migrant/innen erkennen können
und zu ihren in Beziehung treten.
8. Alle Mittel der Professio-nalisierung sind für die inter-kulturelle Orientierung nutz-bar zu machen!
Interkulturelle Fragestellun-gen müssen explizit bei Super-vision, Organisationsentwick-lung, Qualitätsentwicklung u. a. berücksichtigt und in den Struk-turen verankert werden.
Hierbei kann an vielen Stel-len angesetzt werden. Um z. B. an der Basis tätig zu werden, bedarf es nicht der vorherigen Grundsatzentscheidung der Lei-tung. Der Prozess kann top-down und bottom-up organisiert werden. Wichtig ist es aller-dings, stets „Stolperfallen“ in die alltägliche Praxis einzubauen und so die „übliche Routine“ zu durchbrechen.
Interkulturelle Öffnung – ein Kompass für die Zukunft? Ja, aber mehr als nur ein Instrument zur Richtungsbestimmung. Glei-chzeitig ist sie ein praktisches Werkzeug, die der nachhaltigen Weiterentwicklung der Qualität (sozialer) Dienstleistungen be-fördert.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
7
Referate
Dr.in Christine Mattl und Mag. Dominik Sandner
Vom möglichen Nutzen der Vielfalt. Diversity Management als Aufgabe für betriebliche Politik!?
Diversity Management (DM)
kann als „die Einbeziehung aller Gruppen auf allen Hierarchie-stufen des Unternehmens“ (Bryan, J. H. 1999) definiert werden. Christine Mattl betonte, dass ein Leitmotiv darin besteht, die kulturelle Vielfalt am Ar-beitsplatz zu nutzen; mit dem übergeordneten Ziel der Inte-gration der gesamten Beleg-schaft. Kultur und ethnische Herkunft können dabei als zwei von mehreren Dimensionen von „Diversity“ (Diversität, Vielfalt) gesehen werden. Diversity Ma-nagement kommt aus den USA, wo es als Antwort auf gesetz-liche Regelungen und den Er-fahrungen mit Affirmative Ac-tion entstand, um möglichen Klagen wegen Diskriminierung zuvorzukommen.
Auch für österreichische Unternehmen gibt es mittler-weile rechtliche aber auch zahl-reiche interne und externe wirt-schaftliche sowie demografische und ethische Gründe DM einzu-führen.
Als externe wirtschaftliche Gründe sind u.a. Globalisierung, Änderung der Unternehmens-umwelt, Mergers & Aquisitions,
Druck zur Kostensenkung und Produktivitätssteigerung zu nen-nen. Interne Wettbewerbsvor-teile durch DM sind Erhaltung von Humanressourcen, Know-how Gewinn, Kreativität bei Problemlösung, Qualität von Entscheidungsfindung und Erhö-hung der organisationalen Flexi-bilität. Wichtige betriebwirt-schaftliche Gründe für DM sind Vermeidung von unnötigen Kos-ten und volles Ausnutzen des Humankapitals einer Organi-sation mittels DM.
Entwicklungsphasen von Diversity Management
Auf einer Metaebene be-schrieb Christine Mattl mehrere Entwicklungsphasen von DM. Die Phasen beziehen sich einer-seits auf generelle Herangehens-weisen an DM wie Philosophie, Gründe und Ziele insgesamt (etwa wo steht Österreich in bezug auf DM in Vergleich mit den USA). Andererseits stellte sie die verschiedenen Stadien des Umgangs mit DM innerhalb eines Unternehmens dar.
In der ersten Phase „Fair-ness und Antidiskriminierung“ wird auf gesetzlichen und mora-
lischen Druck reagiert, Poten-ziale aller MitarbeiterInnen wer-den jedoch nicht aktiv genutzt. Eine typische Aussage dazu ist: „GastarbeiterInnen können ge-nauso effektiv und effizient ar-beiten wie Einheimische, wenn sie sich nur anpassen.“
In der Phase „Marktzutritts-ansatz“ wird aufgrund der Not-wendigkeit Marktsegmente aktiv zu bearbeiten, das Potenzial von MigrantInnen vor allem für das Marketing genutzt („Migrant-Innen sind besonders gut ge-eignet für den internationalen HR Bereich, da sie viele Kom-petenzen im Bereich Akkul-turation mitbringen“).
In der dritten Phase „Lern- und Effektivitätsansatz“ herrscht ein ganzheitliches Verständnis von DM vor, eine ressour-cenorientierte Betrachtungswei-se der einzelnen Mitarbeiter-Innen und es kommt zu einer In-tegration ins strategisches Mana-gement („Heterogene Arbeits-gruppe sind in einem sich schnell wandelnden Umfeld bei kreativen Aufgabenstellungen besonders erfolgreich.“).
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
8
Umsetzung von Diversity Ma-nagement auf betrieblicher Ebene
Christine Mattl betonte die Wichtigkeit der Einbeziehung aller Ebenen in der Organisation bei der Einführung von DM. So-wohl ein Top-down als auch ein Bottom-up Approach ist dabei das Ideal. Nach einer Ist-Soll Analyse sind folgende Umsetz-ungsschritte wichtig: Erarbei-tung und Implementierung eines strategischen Diversity Plans, die Bestellung einer verantwort-lichen Arbeitsgruppe, eine Maß-nahmenplanung unter Einbe-ziehung von bereits im Betrieb Vorhandenem, Trainings für alle ManagerInnen und alle Mitar-beiterInnen, Überprüfung der in-ternen und externen Kommuni-kation, ein professionelles Pro-jektmanagement und Evaluation und Monitoring des gesamten Prozesses.
Kritische Punkte bei der Umsetzung sieht Frau Mattl in der Art der Kommunikation und dem Umgang mit Konflikten in einem Unternehmen. Es sollte analysiert werden, welche Kom-munikationsmuster in einer Or-ganisation auftreten, ob es eine dominante Form gibt, der andere
untergeordnet werden müssen (Sprache, Mythen, Regeln, Hie-rarchien) und ob es gelingt, neue Formen zu zulassen/zu fördern /zu integrieren.
Zu beachten ist weiters der Umgang mit Konflikten. Kon-
troversen treten bei Verän-derungsprozessen unweigerlich auf. Werden sie negiert oder un-terdrückt, kommt es zu einer Harmonisierung und Ohnmäch-tige geben nach, Mächtigere setzen sich durch, werden Kom-promisse oder Konsens ge-sucht? Barrieren und Widerstände in der Praxis
Dominik Sandner ging in seinem Teil des Referats auf die Barrieren und Widerstände bei der Umsetzung von DM in der Praxis ein. Er betonte, dass die Unterstützung der Führungs-kräfte bei DM-Prozessen unab-dingbar ist und dass Ver-fügungsgewalt für die DM-Verantwortlichen über zeitliche, finanzielle und technische Res-sourcen bestehen muss. In Österreich geht die Initiativen oft vom Betriebsrat aus.
Widerstände der Führungs-ebene führt er u.a. auf Angst vor Machtverlust, persönliche Fakt-oren (Sensibilität der Führungs-kräfte) und finanzielle Bedenken zurück. VertreterInnen des ho-mogenen Ideals haben außerdem oft Angst vor Schuldzu-weisungen. Herr Sandner
betonte, dass DM kein Nullsum-menspiel sei, sondern ein inklu-dierendes Konzept, das auch VertreterInnen des homogenen Ideals miteinschließe. Diversity ManagerInnen, falls vorhanden, sind hauptsächlich
im Personalbereich angesiedelt und selten ins strategische Ma-nagement inkludiert, eine Aus-nahme stellt hier Ford dar. DM sollte sämtliche funktionale so-wie hierarchische Ebenen erfassen, der HR-Bereich hat hingegen wenig innerbe-trieblichen Machteinfluss (Bsp. Verteilung von Ressourcen).
EEiinn wweeiitteerreess PPrroobblleemm ssaahh DDoommiinniikk SSaannddnneerr iinn ddeerr AAbbhhäännggiiggkkeeiitt ddeerr DDMM--IImmppllee--mmeennttiieerruunngg vvoonn ddeenn KKoonnjjuunnkk--ttuurrzzyykklleenn.. BBeeii eeiinneerr Personal-reduktion sollte unter dem DM Aspekt gefragt werden, wer auf-grund welcher Kriterien ent-lassen wird. Ist Diversity Management klein- und mittelbetriebstaug-lich?
Sowohl als PPrroobblleemm aallss aauucchh aallss CChhaannccee sstteellllttee eerr DDMM bbeeii KKlleeiinn-- uunndd MMiitttteellbbeettrriieebbeenn ddaarr ((KKMMUU)).. DDiiee Literatur und For-schung zu Diversity Mana-gement konzentriert sich haupt-sächlich auf große Unterneh-mensstrukturen. Die österrei-chische Realität sieht jedoch anders aus. 97% aller Betriebe beschäftigen weniger als 50 Mit-arbeiterInnen, 69% aller unselb-ständig Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit weniger als 300 MitarbeiterInnen. Probleme stel-len dabei die personelle und fin-anzielle Restriktionen (keine Stabstellen) dar. Ein großer Vor-teil ist aber die höhere Flexi-bilität von Klein- und Mittel-betrieben und die kürzere Top-Down und Bottom-Up Distanz. Fehlende Evaluation
OOfftt wwiirrdd ddiiee kkoommmmeerrzziieellllee PPrrooffiittaabbiilliittäätt vvoonn DDMM aannggee--zzwweeiiffeelltt uunndd als Sozialarbeit missverstanden. Laut einer Un-tersuchung des Center for Stra-tegy and Evaluation Services im Jahr 2003 sehen rund 70 % der befragten privatwirtschaftlichen Unternehmen einen Zusammen-
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
9
hang zwischen ihrem gesamtbe-trieblichen Erfolg und der Durchführung von DM-Akti-vitäten. Bei Organisationen im öffentlichen Bereich sind es so-gar fast 90 %. Im Gegensatz dazu gibt es kaum Hinweise auf systematische und allumfas-sende Kosten/Nutzen-Messung und auch in den USA findet wissenschaftliche sowie be-triebsinterne Evaluation kaum statt.
Dominik Sandner betonte allerdings die Wichtigkeit und NNoottwweennddiiggkkeeiitt vvoonn EEvvaalluuaattiioonn.. DM basiert auf der „Diversity Dividende“ (weniger ethische, moralische und soziale Beweg-gründe) und 79% der Führungs-kräfte bevorzugen eine wirt-schaftliche Argumentation ge-genüber einer ethischen oder moralischen.
Schwierigkeiten bei der Eva-luierung von DM sieht Sandner in der Quantifizierung von Kos-ten und Nutzen. Faktoren sind dabei die schwer einschätzbaren strategische Effekte, die langfri-stige Auswirkungen, die „wie-chen“ Faktoren und die Proble-matik der Zurechenbarkeit von Erfolg und Misserfolg.
Weiters gestaltet sich die Messung von Vielfalt schwierig
und die Übertragbarkeit von Un-ternehmensvergleichen. Nutzen ist oft kontextspezifisch und schwer auf andere Unternehmen übertragbar. Die Balanced Scorecard
Dominik Sandner stellte in seinem Referat die Balanced Scorecard.als eine Möglichkeit der Evaluierung vor. Dies ist eine Methode zur Leis-tungsmessung und ein strategi-sches Managementsystem; durch dieses Plan- und Messinstrument ist die Ermittlung der oft zitierten "Diversity Dividende" zumindest teilweise möglich. Die Balanced Scorecard dient der generellen Strategieent-wicklung, der Ableitung von operationalisierbaren Zielen und der betriebswirtschaftlichen Evaluation der Maßnahmen. Finanzielle und nicht finanzielle Ziele werden gemischt, die Messung ist zukunftsorientiert, Strategie und Vision werden in operationalisier- und über-prüfbare Ziele abgeleitet.
Weiters findet dadurch eine Planung, Kontrolle der Umset-zung und Evaluation der Fort-schritte statt. Mehrere Perspek-tiven werden miteinbezogen: die Finanzperspektive (Einnahmen,
Produktivität/Kosten), die Ge-schäftsprozessperspektive (Inno-vation, Geschäftsablauf), die MitarbeiterInnenperspektive (Fähigkeiten, Motivation, Fort-bildung, Zufriedenheit) und die KundInnenperspektive (Markt-anteil, Zufriedenheit, Treue, Image). Politisches vs. ökonomisches Konzept
Zuletzt wurden in einem kri-tischen Fazit auch einige Prä-missen von DM hinterfragt. So besteht etwa die Gefahr, dass es durch DM, zu einer verstärkten Ökonomisierung der Antidiskri-minierungsbemühungen kom-men könnte, wenn die betriebs-wirtschaftliche Argumentation zu sehr im Vordergrund steht. DM kann als aufwändiger und ganzheitlicher Prozess der Un-ternehmensentwicklung gesehen werden, der bestimmter Voraus-setzungen innerhalb der Organi-sation bedarf (wie Commitment auch von Top und mittlerem Management) der professionell auf allen Ebenen und quer durch alle Funktionsbereiche mit den entsprechenden Tools einge-führt, konsequent verfolgt und evaluiert werden muss.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´
Dokumentation der Tagung
10
Die Pilotprojekte
Kärnten: Kurbad Eisenkappel
Die Infrastruktur des Kurzentrums Bad Eisenkappel
Einige Zahlen und Fakten:
• 1975 wurde das Kurbad Eisenkappel errichtet.
• Ein großzügiger Wellnessbereich mit zwei Hallenbädern, mit einem angeschlossenen Freibad, Sauna, Whirlpool, Dampfbad, Biosauna, Kosmetik und Fußpflege sorgt für das Wohlbefinden und steht allen ambulanten und stationären Kurgästen zur Verfügung.
• Hoteleinrichtungen a) 139 moderne Zimmer, 240 Betten b) Restaurant mit 250 Sitzplätzen c) F.X. Mayr Restaurant d) Freizeitraum e) Leseraum f) Kurpark (20.000 m2 groß)
• Nächtigungszahlen 2002: 60.000
• 80 MitarbeiterInnen, davon 3 ÄrztInnen, 28 TherapeutInnen, 16 Angestellte mit Migrationshintergrund – hauptsächlich im Hotelbereich.
• Kurzentren unter einem Dach: a) Bad Eisenkappel (Kärnten) b) Bad Häring (Tirol) c) Bad Schönau (Niederösterreich)
• Das Kurzentrum ist eine GmbH & KG, die Zentrale der Gesellschaft und die Verwaltung befinden sich in Kufstein. In Eisenkappel werden die operativen Geschäfte abgewickelt.
• Betriebsorganisation: o GF, Direktion, Controlling o Administration o Therapie Abteilung o Medizinische Abteilung o Hotel: Technik, Küche, Zimmer, Service
• 80% der Gäste sind Privatpersonen (Österreich, Schweiz, England, Italien, Deutschland, Slowenien).
• 20% KurpatientInnen der Pensions- oder Krankenversicherung.
• Eisenkappel liegt im zweisprachigen Gebiet (deutsch-slowenisch).
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
11
Steiermark: Steiermärkische Gebietskrankenkasse
Hauptkasse Graz
Die Infrastruktur des Steiermärkischen Gebietskrankenkasse Einige Zahlen und Fakten:
• Aufgaben der sozialen Krankenversicherung
o die Früherkennung von Krankheiten und die Erhaltung der Volksgesundheit o die Versicherungsfälle
der Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit sowie der Mutterschaft
o für die Zahnbehandlung und den Zahnersatz o für die Hilfe bei körperlichen Gebrechen o für die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation o für die Gesundheitsförderung
• Aufbau der STGKK o Kasse (Hauptstelle in Graz)
- 21 Außenstellen - 5 chefärztliche Dienststellen - 7 Zahn- und 2 Physikalische Ambulatorien
o 21 Außenstellen o Meldestellen
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
12
Tirol:
SOS – Clearing-House
Die Infrastruktur des SOS Kinderdorfes. Einige Zahlen und Fakten:
• Hermann Gmeiner initiierte im Jahr 1949 den Bau des ersten SOS-Kinderdorfes in der
Tiroler Kleinstadt Imst. • Im Zentrum von SOS-Kinderdorf steht das Bemühen, Kindern, die ihre Eltern verloren
haben oder nicht mehr bei ihnen leben können, ein dauerhaftes sowie langfristiges Zuhause und ein stabiles Umfeld zu geben.
• Diese familiennahe Struktur eines SOS-Kinderdorfes wird von vier wesentlichen
Elementen bestimmt: der SOS-Kinderdorf-Mutter, den Geschwistern, dem Haus und dem Dorf.
• Jedes Kind bekommt eine SOS-Kinderdorf-Mutter. Sie lebt mit durchschnittlich fünf bis
sieben Kindern in einem eigenen Haus, wie eine Familie zusammen. Jedes SOS-Kinderdorf besteht aus durchschnittlich 10 bis 15 Familienhäusern.
• Wichtig ist die Förderung der Selbstständigkeit. • Das „Clearing-House“ betreut unbegleitete minderjährige Flüchtlinge • Bis zu 12 Jugendliche erhalten während der Zeit des dreimonatigen „Clearings“ die
notwendige Grundversorgung, sozialpädagogische und medizinische Betreuung sowie psychologische Hilfe, um ihre Traumata aufzuarbeiten und um sich in ihrer schwierigen Lebenslage besser zurechtfinden zu können.
• Während des Aufenthaltes in „Clearing-House“ lernen die jungen Menschen Deutsch und
werden in der Alltagsbewältigung durch eine jugendgerechte Tagesstruktur (Beschäfti-gungsprojekte) unterstützt.
• Der Schwerpunkt der Arbeit vor allem im Abklären der asyl- bzw. aufenthalts-
rechtlichen Situation und im Finden von Zukunftsperspektiven. • Neben SOS-Kinderdörfern und SOS-Jugendwohneinrichtungen gibt es SOS-Kinder-
gärten, SOS-Hermann-Gmeiner-Schulen, SOS-Berufsbildungs- und Sozialzentren sowie Medizinische Zentren und SOS-Emergency Relief Programs.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
13
Berichte zu den Arbeitskreisen
„Sesam öffnet sich“. Arbeitskreis des Pilotprojektes in Bad Eisenkappel
Von Snjezana Topic-Zivanic
Im Arbeitskreis berichteten die Coaches über ihre Erfahrun-gen und Versuche den Nutzen des Projektes für den Betrieb Bad Eisenkappel darzustellen. Weiters wurde auf die Frage eingegangen wie gewährleistet wird, dass sich alle Mitarbei-terInnen an dem Projekt betei-ligen.
Zu Beginn des Arbeitskrei-ses wurde festgehalten, dass es sich bei dem Projekt in Bad Eisenkappel um ein Pilotprojekt handelte. Die Geschäftsleitung erklärte sich bereit, die Coaches im Betrieb im Rahmen der Aus-bildung zum interkulturell kom-petenten Coach ihre Kenntnisse erproben zu lassen. Ein konkre-ter Auftrag von Seiten des Un-ternehmens an die Coaches fehlte jedoch. Grundsätzlich wä-re es wünschenswert, wenn für ein solches Projekt die Initiative vom Unternehmen ausgehen würde.
Zur Frage, welchen Nutzen Interkulturelle Öffnung und Di-
versity Management (DM) für ein profitorientiertes Unterneh-men bringt und wie dieser dargestellt werden kann, wurden verschiedene Argumentationsli-nien diskutiert. Es wurden Grün-de erörtert, die ein Unterneh-men dazu bewegen könnten ein solches Projekt durchzuführen.
Für Interkulturelle Öffnung und DM wird von betrieblicher Seite oft kein Kosten-Nutzen-Kalkül wahrgenommen, bzw. der Vorteil für das Unternehmen kann oft nicht so einfach darge-stellt werden. Der Nutzen könn-te jedoch in der Vielfalt der MitarbeiterInnen liegen. Vor-handene ungenutzte Ressourcen oder Qualifikationen der Mitar-beiterInnen könnten erkannt und eingesetzt werden. Ein Betrieb hätte motiviertere Mitarbei-terInnen, die ihre Arbeit bessere verrichten würden. Es entstün-den weniger Konflikte, bzw. Konflikte, Mißverständnisse und Fehler in Arbeitsabläufen wür-den vermieden werden können.
Damit würde in weiterer Folge die Effizienz, die Mitarbei-terInnenzufriedenheit und die Identifiktation mit dem Betrieb steigen. Ein solches Projekt könnte das Bild eines Unterneh-mens nachhaltig verändern so-wohl aus der Sicht der Kund-Innen als auch aus der Sicht der MitarbeiterInnen (Image, Wer-bung). In weiterer Folge wären das auch in Zahlen ausdrückbare Vorteile der Konkurrenz gegen-über, vor allem wenn es um internationale Geschäftsbezie-hungen und GeschäftspartnerIn-nen geht.
Eine Teilnehmerin warnte vor dem Versuch die Arbeit eines interkulturellen Coaches rechnerisch zu rechtfertigen. Es sollte nicht vergessen werden, worum es tatsächlich geht; um soziale Arbeit und Anerkennung von kulturellen Unterschieden, nicht um die Profitsteigerung von Unternehmen. Einige andere TeilnehmerInnen vertraten je-doch den Standpunkt, die Wirt-schaftlichkeit eines solchen Pro-jektes als „trojanisches Pferd“ zu verwenden, wäre legitim. (Anm. der Redaktion: Den Begriff des Trojanischen Pferdes halten wir in den Zusammenhang für unpassend. Die Aufgabe eines externen Coaches ist es, mög-lichst viele Aspekte des Betrie-bes mit einzubeziehen und das sind eben nicht nur soziale, bzw. Sichtweisen der MigrantInnen, sondern auch betriebswirtschaft-liche. Migration hat neben ande-ren Gründen auch seine
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
14
Ursachen in wirtschaftspoli-tischen Aspekten).
Der zweite wesentliche Dis-kussionspunkt war der Auftritt der Coaches und die Arbeit im Unternehmen. Die Coaches be-richteten über ihr erstes Treffen mit der Belegschaft. Es wäre sehr wichtig, das Projekt gleich zu Beginn transparent machen zu können und gut zu erklären. Es wäre notwendig, möglichst viele MitarbeiterInnen von dem Projekt zu überzeugen und zur Mitarbeit zu bewegen, so die Kernaussage der Coaches.
Aus den Erfahrungen im Pi-lotprojekt wurde darauf ge-schlossen, dass die Umsetzung von DM vor allem eine Top-down Strategie haben muss. Um den Auftrag effektiv umsetzen zu können, muss der Auftrag
vom Topmanagement kommen. Weiters müssen die Mitar-beiterInnen mehr in die Um-setzung miteinbezogen werden. Die Coaches berichteten über Schwierigkeiten im Projektab-lauf, wenn Personen, die das Projekt ablehnen, in Schlüssel-funktionen sitzen.
(Anm. d. Red.: Aus der Sicht des Pilotprojektes verständlich, ist die Aussage jedoch in der Praxis hinlänglich widerlegt. Wie auch im Beitrag von Mattl/Sandner wird darauf hin-gewiesen, dass beide Strateien – von oben nach unten und von unten nach oben – für den Erfolg notwendig sind.)
Die Coaches wurden zu ihren Erfahrungen im Unter-nehmen befragt. Zu dem Pilot-projekt selbst wurde festge-
halten, dass alleine die Anwe-senheit der Coaches im Unter-nehmen bereits als Erfolg angesehen wird. Interkulturelle Öffnung und DM wurde zum Thema gemacht. In den Coa-chingstunden gaben die Mitar-beiterInnen ein positives Feed-back.
Eine Schwierigkeit in dem konkreten Projekt lag in der geografischen Entfernung der Coaches von dem Unternehmen und auch von einander. Die Coaches wiesen daraufhin, dass bei solchen Projekten das Ver-trauen zwischen Coaches und MitarbeiterInnen eine wesent-liche Rolle spiele. Es müsse ge-währleistet sein, dass der/die Coach oft und regelmäßig als Ansprechperson zur Verfügung stehe.
„Interkulturelle Öffnung in Institutionen“ Am Beispiel der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse
Von Helga Moser
Im Vortrag von Wolfgang Hinz-Rommel lautete die erste These „Das Thema Inter-kulturelle Öffnung habe Be-deutung gewonnen“. Dies hat auch die Steiermärkische Ge-bietskrankenkasse erkannt. Auf Anfrage der Projektleitung von ZEBRA hat sie sich im Jahre 2003 zu einer Zusammenarbeit im MIDAS-Projekt bereit erklärt und sich als Pilotprojektpartner zur Verfügung gestellt.
Dadurch konnten dort fünf der im Rahmen des MIDAS-Projekts ausgebildeten interkul-turell kompetenten Coaches - Daniel Diakiese, Afsaneh Gäch-ter, Dorota Lubandy, David Pasek und Mimoza Shema-Kastrati - als externe Berater-Innen arbeiten. Sie beobachteten während des einjährigen Pilot-projektes die KlientInnenkon-
takte verschiedener Abteilungen, führten Interviews und Ge-spräche mit MitarbeiterInnen, AbteilungsleiterInnen, Personal-vertretung und KlientInnen durch.
Aus dem gesammelten Material wurde ein Bericht erstellt und den Verantwort-lichen in der StGKK im Sommer 2004 präsentiert. In dem Bericht machten sich die Coachs u.a.
15 `Von der Dominanz zur Chancengleichheit´
Dokumentation der Tagung
Gedanken über konkrete Verbesserungsmöglichkeiten in der StGKK und schlugen Lö-sungsansätze für von ihnen er-kannte Probleme vor. Zum Zeit-punkt des Workshops (Oktober 2004) waren die internen Bera-tungen der Verantwortlichen noch im Gange.
Dieter Kotnik von der Bildungsabteilung und für das Projekt innerhalb der GKK zu-ständig, betonte im Workshop dass die Arbeit der Coaches in der Einrichtung einen wichtigen Diskussionsprozess ausgelöst hat. Auch wenn im Projektzeit-raum von einem Jahr der Pro-zess langsamer als geplant vor-anschritt. So wurde den Verant-wortlichen der StGKK zwar ein Bericht vorgelegt, der auch konkrete Umsetzungsmaßnah-men enthielt, diese Maßnahmen konnten jedoch bis zum Ende des Projektzeitraumes nicht in
Gang gesetzt werden. So bestehe der Erfolg des Projektes, laut Dieter Kotnik, wohl darin, dass auf den Leitungsebenen der GKK darüber beraten wird.
Auslöser innerhalb der StGKK waren einige Mitar-beiterInnen, die sich mit der Bitte um Unterstützung im Kontakt mit ausländischen KlientInnen an die Bildungs-abteilung gewandt hatten. Durch die Arbeit der Coaches und ihrem Bericht wurde in der gesamten Organisation Bewusst-sein für das Thema geschaffen und beschäftigt nunmehr die höchsten Entscheidungsgremien.
Dadurch kommt es nicht zur schnellen Umsetzung von punk-tuellen Maßnahmen, sondern der Ausgangspunkt für einen umfas-senden Veränderungsprozess wurde geschaffen. Wann und in welcher Form dieser Weg be-schritten wird, sei noch unklar.
Herr Kotnik gab zu bedenken, dass es sich bei der GKK um eine große Organisation handle, die in einem gesellschafts-politischen Rahmen eingebettet sei.
Mehrere TeilnehmerInnen des Workshops zeigten sich über die Ergebnisse des Pilot-projektes beeindruckt. Das Thema der interkulturellen Öff-nung gewänne in der öf-fentlichen Diskussion nur lang-sam an Stellenwert – so die Ein-schätzung - und daher sei der aus-gelöste Sensibilisierungs-prozess bereits ein wichtiger Schritt. Wenngleich die im Prozess involvierten Coaches den Fortschritt unterschiedlich wahrnahmen und gerne an den Umsetzungsmaßnahmen gear-beitet hätten.
SOS Clearing-House Salzburg Arbeitskreis zum Tiroler Pilotprojekt
Von Inge Frei, Abderrahim Rachdi, Julia Schönwiese
Die Coaches berichteten über ihre Vorgangsweise bei der Erhebung der Daten für ihre Statistiken. Für diesen Zweck wurde ein Fragenkatalog ausge-arbeitet. Die Fragen umfassten u.a. die Situation der Asyl-werberInnen, die Situation der Unterbringung, des Bildungs-angebotes, Ziele für die Zukunft, Veränderungs- und Verbesserungsmöglichkeiten.
Zur Diskussion kamen diesbezüglich Partizipations-hemen:
16`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
• Wie weit können die Asyl-werberInnen selbst mitge-stalten?
• Wie empfinden sie ihre Situation und welche Lö-sungsansätze kommen von ihnen selbst?
• Wo liegen Grenzen in den Angeboten und wo muss selbstverantwortliches Han-deln und Selbstbestimmung einsetzen (unterstützen, dele-gieren, Verantwortung überge-ben).
Dabei wurde festgestellt, dass
die befragten AsylwerberInnen eine eher geringe Kompetenz im Bereich der Selbstreflexion und Eigenverantwortung aufwiesen. Vielmehr handelte es sich bei ihren Rückmeldungen um Kritik an der aktuellen Situation und an bestehenden Regeln und
Normen, z.B. bezüglich der Unterbringung, des Umgangs zwischen BetreuerInnen und AsylwerberInnen. Im Sinne von Widerstand, Auflehnung und Trotz. Dabei wurde auch deut-lich, dass Spannungen im Team der Clearingstelle auch für die AsylwerberInnen spürbar waren und dementsprechend ausge-spielt wurden (Lieblingsbetreu-erIn und „die Bösen“). Weiters wurden in diesem Zusammen-hang auftretende Autoritäts-probleme zwischen weiblichen Betreuerinnen und männlichen Jugendlichen angesprochen.
Diese Diskussion weitete sich aus, in dem die Partizipation von AsylwerberInnen und Migrant-Innen generell diskutiert wurde: • Warum gibt es kaum Mi-
grantInnen auf der Ge-schäftsführerInnenebene?
• Was bedeutet Qualifikation? • Wo ist die Grenze zwischen
Macht und Kompetenz? • Wo liegen die Grenzen der
leistbaren Unterstützung? • Was empfinden wir als Un-
terstützung und was bedeutet Unterstützung für die Ziel-gruppe?
Zum Thema Empowerment und Selbstorganisationsgruppen be-richtete ein Teilnehmer aus Innsbruck, der das positive Ge-
lingen einer konstruktiv ar-beitenden nigerianischen Or-ganisation beschrieb.
Gemeinsam wurde versucht zu diskutieren, aus welchen Gründen selbstorganisierte Mig-rantInnenorganisationen gelin-gen oder scheitern könnten (spe-ziell die Situation afrikanischer Communities in Graz). Weitere Diskussionsthemen: • Die Coaches waren in der
Einrichtung mit einem unter-schiedlichen Maß an Koopera-tion konfrontiert. Der Leiter des Clearing Stelle unter-stützte sie sehr gut. Einige der MitarbeiterInnen standen dem Projekt skeptisch gegenüber. Hier gab es bis zum Schluss eine Menge an Vorurteilen, an Uninformiertheit über die ver-
schiedenen Lebensumstände und Kulturen, aus denen die Jugendlichen stammen.
• PatInnenprogramm „Connect-
ing – People“ Schwierigkeiten PatInnen für einzelne Jugendliche zu finden Ausweitung des Connecting –
People – Programms auf erwachsene AsylwerberInnen bzw. MigrantInnen?
• Gendermainstreaming in
Equal – Projekten (einge-bracht von der Geschäfts-führung von MIDAS): Der interkulturelle Rahmen der Fragestellung zu GM wurde bisher zuwenig beachtet und muss zukünftig besser konzi-piert werden (Kontextein-bettung).
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung 17
Podiumsgespräch:
Umsetzungsstrategien und politische Dimension Ein Bericht von Mag.a Josefa Molitor-Ruckenbauer
Den Einstieg, in die Dis-kussion bildete die Analyse des Ist-Zustandes und Erfahrungen mit Integrationsprozessen in unterschiedlichen Regionen (Wien, Graz). Die Haupthinder-nisse zur erfolgreichen Integra-tion bzw. IÖ wurden gemein-sam erörtert. Den Schlusspunkt der Diskussion bildeten For-derungen an Politik und Gesell-schaft für eine erfolgreiche Inte-gration: Diese dürfe nicht auf
die Frage der Kultur reduziert werden und es gehe nicht darum Integration in einer Spezial-abteilung ‚abzuwickeln’. Inte-gration oder Interkulturelle Öff-nung sei ein Querschnittsthema und die ursächliche Aufgabe und Verantwortung von staatlichen Akteuren: Der gleichberechtigte Zuganges für alle sei dabei im Vordergrund. Interkulturelle Öf-fnung ist das große Zukunfts-thema dem sich weder staatliche
Institutionen noch Wirtschaft entziehen werden können, so die einhellige Meinung der Disku-tantInnen. Gesellschaft ist be-reits vielfältig mit anhaltend steigender Tendenz – Politik und Gesellschaft müssen Realitäten (an)erkennen: Österreich ist ein Einwanderungsland. Staatliche Institutionen müssen sich immer mehr der Frage stellen, was muss ich tun, um allen Staats-bürgerInnen gerecht zu werden.
Es diskutierten: Annette Sprung Bildungswissenschafterin am Pädagogikinstitut der Uni Graz. (Arbeitsschwerpunkt interkulturelle antirassist. Bildung.) Kurzstatement: Ein Grazer Integrationskonzept, das interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung als wichtiges Element beinhaltet, wird seit Jahren gefordert. Es mangelt weder an Ideen, engagierten Akteurinnen oder auch politischen Absichtserklärungen – daher ist zu fragen, was die Umsetzung bislang behindert. Ursula Struppe Beauftragte des Entwicklungsprozesses ‚Diversitätsmanagement’ und mit der Planung einer neuen Magistrats-abteilung für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten. Kurzstatement: Vielfalt ist heute in unserer Gesellschaft Realität und Normalität. Die wichtigste Frage ist: Sehen wir sie? Wenn die Antwort „ja“ ist, lautet die zweite Frage: Wie managen wir sie?
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ 18
.... ...
Dokumentation der Tagung
Kenan Güngör Büro für angewandte Sozialforschung und Entwicklung (BASE), Basel. Begleiter eines Prozesses der Ent-wicklung eines Integrationsleitbildes in Dornbirn, Wil (CH) und Tirol. Kurzstatement: Integration ist keine Sonderschiene sondern ein Zukunftsthema, das alle gesellschaftlichen Handlungsbereiche betrifft und somit als gesamtgesellschaftliche, ressortübergreifende Quer-schnittsaufgabe anzugehen ist. Edith Glanzer Geschäftsführerin Zebra Kurzstatement: Das in Österreich vorherrschende Grundverständnis von Integration, das eigentlich Assimilation meint, behindert Prozesse der interkulturellen Öffnung. Moderation: Josefa Molitor-Ruckenbauer
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
19
Die Coaches
Irenaueus K.C. Anyanwu Geb. 1964 in Owerri / Nigeria Ausbildung: Studium der Philosophie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
Sprachen: Deutsch, Englisch, Pidgin Englisch, mehrere afrikanische Sprachen, Französisch (Grundkenntnisse) Beruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 1996 – 1998: Forschungs- und Lehrtätigkeiten in Österreich und Nigeria, 5 Jahre lang AusländerInnenreferent an der Österreichischen Hochschüler-Innenschaft (ÖH) der Universität Innsbruck, 2001 ausgezeichnet mit dem Preis für Zivilcourage und Integration, derzeit Mitglied der Menschenrechtskommission für Tirol und Vorarlberg.
Daniel Diakiese
SD BSB
.
Geb. 1958 in Kinshasa / Demokratische Republik Kongo Ausbildung: Studium der Volkswirtschaft an der Universität von Lubumbashi/Kongo, Ausbildung im Bereich der Innenarchitektur, Ausbildung zum Integrationsassistenten beim Verein ISOP.
prachen: eutsch, Französisch, Lingala, Portugiesisch
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): eit 2003 Bildungsarbeit gegen Rassismus und Vorurteile in Kindergärten, Volks- und erufsschulen beim Verein ISOP.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ 20
... ... Dokumentation der Tagung
Seda Erarslan Geb. 1973 in Bregenz / Österreich Ausbildung: Bundeshandelsakademie für Berufstätige in Innsbruck, derzeit Studentin der Internationalen Wirtschafts-wissenschaften in Innsbruck.
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch Beruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 09/93 – 12/94 Buchhalterin und Sekretärin bei Wirtschaftstreuhänder in Innsbruck 03/96 – 02/02 Sachbearbeiterin in der Pensionsabteilung der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft, 03/02 – 12/02 Mitarbeiterin im Organisationsbereich der Eurostar - Cafe Sportwetten.
Afsaneh Gächter
SD B1
1FRsu0P
Geb. 1965 in Teheran / Iran Ausbildung: Studium der Ethnologie an der Universität Wien, Doktorat am Institut für Soziologie der Universität Wien, Dissertation zum Thema „Elitenzirkulation in Trans-formationsgesellschaften“.
prachen: eutsch, Persisch (Muttersprache)
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 995 – 1996 Mitarbeit am Projekt der Gemeinde Wien „Parkbetreuung Penzing” mit dem
Verein Kiddy & Co., 1/97 - 04/98 Wissenschaftliche Mitarbeit am Forschungsprojekt „Integration oder remdenfähigkeit – Islamischer Schulunterricht in Wien: Problempotentiale. Kulturelle elationen”,
eit 1999: In der Erwachsenenbildung freiberuflich beschäftigt, zahlreiche Vorträge nd Seminare in Deutschland und Wien sowie Publikationen, 4/03 – 07/03 Mitarbeit bei der Asylkoordination Österreich im Rahmen des SHARE-rojektes zur Einflussnahme auf die EU-Asylpolitik.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
21
SA BB1111d
TSB BTfMFPFT
Medhat Gerges Geb. 1962 in Kairo / Ägypten Ausbildung: Studium der Psychologie an der Universität in Kairo, Ausbildung zum Web-Designer.
prachen: rabisch, Deutsch, Englisch
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): erufstätigkeiten in Ägypten, Österreich und in den USA 993 Angestellter bei M-Preis, Tirol, 995 Vertreter bei der Firma MTW GesmbH, Unique-Kosmetik, 996 Arbeiter in der Lebensmittelbranche, 999 Kellner in Kaprun, erzeit Hotelportier.
Mishela Ivanova
Geb. 1972 in Sofia / Bulgarien Ausbildung: Studium der Psychologie und Pädagogik an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Ausbildung in Mediation und Konfliktmanagement, WÖRK, ARGE für Kommunikation u. Innovation Ausbildungsseminare in Rhetorik, NLP, Führen und Motivieren,
eam- und Konfliktmanagement. prachen: ulgarisch, Deutsch, Englisch, Serbokroatisch, Russisch
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): utorin von Erstsemestrigen-, DiplomandInnen-, Integrations- und Gendertutorien am Institut
ür Psychologie, Universität Innsbruck, itglied der Institutsgruppe Psychologie, Universität Innsbruck,
achtutorin in den Bereichen Testtheorie und Perssönlichkeitspsychologie am Institut der sychologie, Universität Innsbruck, reie Mitarbeiterin am Rektorat für Evaluation, Universität Innsbruck, rainerin im Rahmen verschiedener Tutoriumsausbildungen und Workshops.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
22
SD BMDTd
SD( B1s
Olesya Konovalova Geb. 1967 in Minsk / Weißrussland Ausbildung: Studium an der Polytechnischen Universität Kiew: Ingenieurs-diplom für Angewandte Mathematik, Master of Business Administration am International Management In-stitute in Kiew, derzeit Doktoratstudium an der Universität Klagenfurt.
prachen: eutsch, Englisch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch (Muttersprachen)
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): itarbeit in internationalen Firmen (Siemens AG, Cargill, Western NIS Enterprise Fund, anone, The PBN Company) und bei verschiedenen Projekten (finanziert aus USAID und ASIS), erzeit als Übersetzerin bei Vimoil GmbH, Klagenfurt tätig.
Dorota Lubandy
Geb. 1965 in Katowice / Polen Ausbildung: Studium der Pädagogik und Psychologie an der Schlesischen Universität Katowice.prachen: eutsch, Englisch (Grundkenntnisse), Italienisch (Grundkenntnisse), Russisch, Polnisch
Muttersprache)
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 993-1994 Schulpädagogin an der Grundschule 37 in Chorzow / Polen, eit 2002 Mobile Wohnbetreuerin beim AIS Jugendservice Graz.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
23
Olivia Mugabe Mitterer Geb. 1968 in Uganda Ausbildung: Makerere College für Handel in Kampala, Uganda Sprachen:
Deutsch, Englisch, Luganda, Kinyaruanda, Kiswahili Beruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 1992 - 1994 Kassiererin bei Kamu (U) Ltd. P.O. Box 87 in Luweero, 1995 - 1997 Assistentin in der Buchhaltung bei Delmira Travel und Tour Limited, seit 2001 United Colors of Benetton, Klagenfurt. Engagement im Sozialbereich und bei Projekten in Klagenfurt und Luweero/Uganda.
David Pasek
SD B2O0ssM0Sd
Geb. 1973 in Prag / Tschechien Ausbildung: Studium der Architektur an der Technischen Universität Wien.
prachen: eutsch, Englisch, Französisch (Grundkenntnisse), Tschechisch (Muttersprache)
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): /94 – 3/96 Literaturhaus Wien: Mitarbeit am Aufbau einer Dokumentation zur Rezeption steuropäischer Literatur im deutschen Sprachraum, 4/97 – 05/00 B&M Architektur Wien, eit 05/00 kopper Architektur Wien, eit 05/01 Apalaver, Architekturvermittlung im Radio, gemeinsam mit Bernhard Frodl. onatliche Radiosendung zur Architektur und weit darüber hinaus,
3/03 – 07/03 Betreuung eines Architekturprojektes mit SchülerInnen des BORG Hegelgasse, chwerpunkt Bildnerische Erziehung. Neugestaltung der Fußgängerzone „Fichtegasse“ mit erzeit laufender Realisierung.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
24
Kheder Shadman Geb. 1962 in Mahabad / Iranisch-Kurdistan Ausbildung: Derzeit Studium der Architektur mit Schwerpunkt Wohnbau und Migration.
Sprachen: Deutsch, Englisch, Farsi (Persisch), Kurdisch Beruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 1992 -1997 Mitarbeit im Multikulturellen Arbeitskreis, 1993 -1995 Vorbereitungsgruppe zur Einrichtung des AusländerInnenbeirats in Graz, seit 1996 Geschäftsführer des AusländerInnenbeirates Graz Nov. 1999 Auslandsaufenthalt in Schweden. Themenschwerpunkt: Kennenlernen von Best practice Beispiele im Bereich der Migration
Mimoza Shema Kastrati Geb. 1976 in Pristina / Kosova Ausbildung: Derzeit Studium der Medizin an der Universität Graz.
Sprachen: Albanisch, Deutsch, Englisch, Serbokroatisch Beruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): 1999-2000 Caritas Mitarbeiterin für Kosova Flüchtlinge, 2000-2001 Omega Mitarbeiterin und Dolmetscherin für albanisch – deutsch und serbokroatisch – deutsch. seit 2003 Zebra Dolmetscherin in der Psychotherapie.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
25
Anahita Shoaiyan Geb. 1962 in Teheran / Iran Ausbildung: Studium der Völkerkunde an der Universität Wien, Ausbildung zur Mediatorin bei der ARGE Bildungs-management.
Sprachen: Arabisch (Grundkenntnisse), Deutsch, Englisch, Persisch (Muttersprache) Beruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): Seit 1997 Aktives Mitglied der Gesellschaft Unabhängiger Iranischer Frauen in Österreich, 1999 Organisation der Vortragsreihe „Iranische Frau in Migration“, 2000 Übersetzungs- und Recherchenarbeit wissenschaftlicher Texte für die im Iran erscheinende Zeitschrift „Anthropology“, 2002 Wissenschaftliche Kooperation mit der Universität Tabatabai – Teheran zum neuen Studienzweig „Gender Studies“, 2003 Ethnoraphische Forschungszusammenarbeit bei „Urban Anthropology“, 2003 Mitbegründung des Vereins „Inter Mediary“.
Snjezana Topic-Zivanic
SB BBL
Geb. 1977 in Wien / Österreich Ausbildung: Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre.
prachen: osnisch, Deutsch, Englisch, Französisch
eruflicher Werdegang und relevante Tätigkeiten (Auswahl): ankangestellte änderreferentin für Bosnien und Serbien
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
26
Die ReferentInnen Wolfgang Hinz-Rommel
Lebenslauf Dipl.-Sozialarbeiter (FH) Dipl.-Pädagoge (Erwachsenenbildung) Organisationsberater und Trainer Aufbau und Leitung eines Jugend- und Gemeinwesenzentrums Projektarbeit national / international Auslandsaufenthalte in der Türkei und den USA Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Interkulturelle Öffnung/Kompetenz Referent in der Abteilung Migration des Diakonischen Werks Württemberg Interkulturelle Trainings Organisationsberatung / Teamentwicklung / Coaching Leiter der Abteilung „Soziale Dienste der Jugend“ des Diakonischen Werks Württemberg
Literaturhinweise Barwig, Klaus / Hinz-Rommel, Wolfgang: Interkulturelle Öffnung sozialer Dienste, Freiburg (Lambertus) 1995. Deutscher Caritasverband (Hg.): Brücken bauen – Fäden spinnen. Interkulturelle Öffnung der Caritas. Freiburg 2004. Handschuck, Sabine / Schröer, Hubertus: Interkulturelle Orientierung und Öffnung von Organisationen. In: Neue Praxis 5/2002. Diakonisches Werk Württemberg: Trainings- und Methodenhandbuch. Bausteine zur interkulturellen Öffnung. Stuttgart 2001. Hinz-Rommel, Wolfgang: Interkulturelle Kompetenz. Ein neues Anforderungsprofil für die soziale Arbeit. Münster/New York (Waxmann) 1994. Hinz-Rommel, Wolfgang: Soziale Dienste im interkulturellen Kontext. In: Diakonie, Heft 5/1994, Stuttgart 1994.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ 27
.... ...
Dokumentation der Tagung
Hinz-Rommel, Wolfgang: Interkulturelle Kompetenz und Qualität - Zwei Dimensionen von Professionalität in der sozialen Arbeit. In: Migration und Soziale Arbeit, Heft 3+4/1996, Frankfurt/Main 1996. Hinz-Rommel, Wolfgang: Interkulturelle Öffnung sozialer Dienste – lästige Pflicht oder neue Qualität? In: Forum für Kinder- und Jugendarbeit – Verbandskurier, Heft 4/1998. Hinz-Rommel, Wolfgang: Die Mühen einer Bergwanderung. Erfahrungen und Anregungen aus Prozessen der Interkulturellen Öffnung. In: Migration und Soziale Arbeit, Heft 2/2000, Frankfurt/Main 2000. Kalpaka, Annita: Interkulturelle Arbeit als Sonderrubrik oder die eigene Arbeit interkulturell gestalten? In: Initiative für ein internationales Kulturzentrum (Hg.): Interkulturelle Arbeit – Theorie und Praxis, Hannover 1996. Kalpaka, Annita: Wie die Elefanten auf die Bäume kommen. Villigst 2004. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hg.): Für eine kultursensible Altenpflege. Eine Handreichung. Köln 2002.
Dr.in Christine Mattl
Lebenslauf Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin (Dissertation zu interkulturellen interpersonalen Konflikten) Mediatorin Organisationsberaterin 8 Jahre Assistentin an der Wirtschaftsuniversität Wien, Abteilung für Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Management. Forschung, Lehre, Training, Beratung und Publikationstätigkeit zu Gruppen in Organisationen, Interkulturelles und Diversity Management sowie Konfliktmanagement.
Literaturhinweise Erten-Buch, Christiane/Mattl, Christine (1999): Interkulturelle Aspekte beim Auslandseinsatz. In: Eckardstein, D./Kasper, H./Mayrhofer, W. (Hrsg.): Management. Theorien-Führung-Veränderung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 321-356. Hopkins, Willie E. (1997): Ethical Dimensions of Diversity. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. Mattl, Christine/Prokop-Zischka, Andrea (2003): Mediation in Austria. In: Alexander, Nadja (Hrsg.): Global Trends in Mediation. Köln: Centrale für Mediation. 61-80.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
28
Mattl, Christine (2004): Zum Verständnis interkultureller interpersonaler Konflikte in der Mediation (unter besonderer Berücksichtigung empirischer Ergebnisse aus der kulturvergleichenden und interkulturellen Konfliktforschung). In: Mehta, Gerda/Rückert, Klaus (Hrsg.): Streiten. Kulturen? Konzepte und Methoden einer kultursensitiven Mediation. Wien, New York: Springer. 7-30. c_social/fundamental_rights/pdf/studies/costsbeneffullrep_de.pdf Cox, T. H. (1994): Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practice. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco KOBRA (Hrsg.)(1999): Managing Diversity – Ansätze zur Schaffung transkultureller Organisationen. KOBRA Werkstattpapier zur Frauenförderung Nr. 14. Berlin, Juni Ivancevich, J. M.; Gilbert, J. A. (2000): Diversity Management: Time For A New Approach. In: Public Personnel Management, Vol. 29, No. 1, S. 75-92 Kandola, R.; Fullerton, J. (1998): Diversity in Action – Managing the Mosaic. 2nd Ed., In-stitute of Personnel Development, London
ies-Krell, G. (Hrsg.)(2001): Chancengleichheit durch Personalpolitik, 3. Auflage, Gabler, Wbaden Prasad, P.; Mills, A. J.; Elmes, M.; Prasad, A. (Hrsg.)(1997): Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity, SAGE Publications, London Sepehri, P. (2002): Diversity und Managing Diversity in internationalen Organisationen: Wahrnehmungen zum Verständnis und ökonomischer Relevanz, Rainer Hampp Verlag, Mün-chen Thomas, R. R. Jr. (2001): Management of Diversity: Neue Personalstrategien für Unternehmen, Gabler, Wiesbaden
Mag. Dominik Sandner
Lebenslauf Geb. 1976 in Linz / OÖ Studium der Handelswissenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Schwerpunkt des Verhaltenswissenschaftlich Orientierten Managements (Interkulturelles Management, Gruppendynamik, Karriereforschung, Diversity Management) Jänner – Juni 2000 Auslandssemester am ITAM, Mexiko City (International Relations, International Development) Diplomarbeit zu Betriebswirtschaftlichen Begründungen für Diversity Management Projektassistent beim EQUAL Projekt InterkulturlostInnen der Volkshilfe
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
29
Derzeit AutistInnenbetreuer in der Wohnstätte Arche Noah, Strasshof
Literaturhinweise Peters, S.; Bensel, N. (Hrsg.) (2002): Frauen und Männer im Management – Diversity in Diskurs und Praxis, Gabler, Wiesbaden Centre for Strategies & Evaluation Services (2003): Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness of Diversity Policies in Enterprises. Final Report. October 2003. Online im WWW unter URL: http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/studies/costsbeneffullrep_de.pdf Cox, T. H. (1994): Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practice. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco KOBRA (Hrsg.)(1999): Managing Diversity – Ansätze zur Schaffung transkultureller Organisationen. KOBRA Werkstattpapier zur Frauenförderung Nr. 14. Berlin, Juni Ivancevich, J. M.; Gilbert, J. A. (2000): Diversity Management: Time For A New Approach. In: Public Personnel Management, Vol. 29, No. 1, S. 75-92 Kandola, R.; Fullerton, J. (1998): Diversity in Action – Managing the Mosaic. 2nd Ed., In-stitute of Personnel Development, London Krell, G. (Hrsg.)(2001): Chancengleichheit durch Personalpolitik, 3. Auflage, Gabler, Wbaden
ies-
Prasad, P.; Mills, A. J.; Elmes, M.; Prasad, A. (Hrsg.)(1997): Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity, SAGE Publications, London Sepehri, P. (2002): Diversity und Managing Diversity in internationalen Organisationen: Wahrnehmungen zum Verständnis und ökonomischer Relevanz, Rainer Hampp Verlag, Mün-chen Thomas, R. R. Jr. (2001): Management of Diversity: Neue Personalstrategien für Unternehmen, Gabler, Wiesbaden
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
30
Die TeilnehmerInnen am Podiumsgespräch Mag.a Edith Glanzer (MAS)
Lebenslauf Geb. 1964 in Hall/Tirol Studium der Soziologie. Absolventin des Lehrganges für Sozialmanagement und Organisation Sozialer Dienste (ISMOS) der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 1993 Geschäftsführerin des Vereines ZEBRA (Interdisziplinäres Beratungszentrum für MigrantInnen und Flüchtlinge) in Graz. Thematische Schwerpunktsetzungen: Soziale Arbeit im interkulturellen Kontext, Interkulturelle Öffnung von Institutionen, Asyl- und Migrationspolitik in Österreich.
Kenan Güngör
Lebenslauf Geb. 1966 in Tunceli/Türkei Aufenthalt in Deutschland seit 1981 Aufenthalt in der Schweiz seit 2000 Studium der Sozialwissenschaften an der Gesamthochschule Wuppertal Abschluss: Diplom Sozialwissenschaftler Tätigkeitsfelder in Deutschland (Auswahl): Journalistischer Mitarbeiter bei der Auslandsvertretung der türkischsprachigen Tageszeitung „Özgür Gündem“ in Köln (1991 – 1992) Mitarbeiter des Zentrums für Türkeistudien in Essen (1997-2000) Tätigkeitsfelder in der Schweiz (Auswahl): Studienleiter für die Studie „Die gesundheitlichen Netzwerke türkeistämmiger MigrantInnen“ am Schweizerischen Tropeninstitut, Basel (2000) Gründung des international arbeitenden Forschungs-, Entwicklungs-, und Beratungsbüros baseconsult Büro für Angewandte Sozialforschung und Entwicklung, Basel (2001) Schwerpunktprojekte: - Integrationsleitbild der Stadt Dornbirn, Konzept, Prozessleitung und Abfassung mit Dr.
Rebekka Ehret, Universität Basel, Laufzeit: 07.2001–07.2002 - Integrationsleitbild der Stadt Wil, Konzept, Prozessleitung und Abfassung, Laufzeit:
08.2002–06.2004 - Fachbegleitung und Konfliktmediation in der Gemeinde Buchs / St. Gallen, Laufzeit: 01-
2004-06-2004 - Integrationsleitbild des Landes Tirol, Konzept, Prozessleitung und Abfassung, Laufzeit:
01.2004–12.2005 - Leitung Modellprojekt KiS - Kundenorientierung und interkulturelle Sensibilisierung in
der Basler Verwaltung, Trägerschaft: Kanton Basel-Stadt, Laufzeit: 01.2004-06.2006
.... ...
Dokumentation der Tagung `Von der Dominanz zur Chancengleichheit´
31
Mag.a Dr.in Annette Sprung
Lebenslauf Geb. 1968 Bildungswissenschafterin und Diplom-Sozialarbeiterin. Assistentin am Institut für Erziehungswissenschaft/ Abteilung Weiterbildung der Universität Graz. Lektorin an der Universität Klagenfurt sowie an der FH Joanneum (Studiengang Sozialarbeit). Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Interkulturelle/ antirassistische Bildung, Interkulturelle Öffnung und Integrationspolitik, Modernisierung/ Individualisierung von Bildung, Gender, Differenzdiskurse in der Pädagogik. Freiberufliche Erwachsenenbildnerin im Bereich Rassismus, Integration, interkulturelle Verständigung (u.a. bei MigrantInnenorganisationen, NGOs, Bundesministerium für Justiz, Verwaltungsakademie der Stadt Graz). Berufspraxis als Sozialarbeiterin in der Beratungs- und Bildungsarbeit mit MigrantInnen, in den Bereichen Frauengesundheit, Gewaltprävention, Projektmanagement, Moderation und Training, Wissens- und Forschungsvermittlung. Zahlreiche Publikationen zum Thema interkulturelle Bildung, Expertise für ein Integrationskonzept im Auftrag der Stadt Graz 2001/2002.
Dr. in Ursula Struppe
Lebenslauf Geb. 1958 Seit 2001 freie Mitarbeiterin der Wiener Integrationsstadträtin (seit 1.7.04: Mag.a Sonja Wehsely - vorher: Mag.a Renate Brauner), u.a. befasst mit einem Entwicklungsprozess "Diversitätsmanagement" und mit der Planung der neuen, eigenen Magistratsabteilung für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten (MA 17), die derzeit aufgebaut wird. Zwischen 1999-2001 Koordinatorin der Initiative "Land der Menschen - reden wir darüber". Von 1985-1999 Leiterin einer kirchlichen Erwachsenenbildungseinrichtung.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
32
ZEBRATL Sondernummer
Sonderheft: Interkultureller Öffnung und Diversity Management und ausführlicher Berichterstattung über das MIDAS Projekt Außerdem über: Das neues Asylgesetz, rassistische Wirte in Graz und den Höchstgerichtsent-scheid gegen das Wahlrecht für Nicht-ÖsterreicherInnen.
`Von der Dominanz zur Chancengleichheit´ Dokumentation der Tagung
33