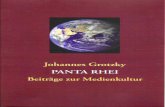Beiträge zur Thermodynamik der Gemische
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Beiträge zur Thermodynamik der Gemische
427
B e i t r ~ g e z u r T h e r m o d y n a m i k d e r G e m i s c h e .
Von V. Fischer in Frankfurt a. ~ .
M_it 2 Abbildungen. (Eingegangen am 10. ]November 1927.)
Ableitung einer allgemeinen Beziehung fiir die verschiedenen Arten yon Kon- zentrationen und der Gleiehgewiehtsbedingungen fiir ein Gemiseh aus zwei Be- standteilen. Ablei~nff der Ausdriicke fiir die Wiirmeinhalte und Entropien im Gemiscb. Anwendung auf Gold--Kupferlegierungen. Gleichgewichtsbedingungen
ftir ein Gemiseh aus drei Bestandteilen.
I. Gemische aus zwei Bestandfeilen.
A l l g e m e i n e A b l e i ~ u a g e n .
1. Wir haben an underer Stelle folgende allgemeinen Beziehungen abgeleitet* :
Zr ~ "~r~ ~rl + "% 3r~, (1)
~r ~ Xr, ~f, + xr~ ~r~, (2)
Oxr, /p, r ~ ~r~ - - ~r~, (3)
Dabei bedeutet Z r eine belieblge Zustandsgr61]e, die sieh auf ein Gemiseh aus zwei Stoffen 1 und 2 im Zustand f bezieh~, und es ist
( ozr'~ (5)
( o zr ~ , (6) ~r~ = t ~ r d ~ , ~', %
Zr 3f = (7) m& + mr2
2. Fiir
a xr,!p, T folgt unter Beaehtung, da~
xrl + xr2 = 1 (9)
ist, aus Gleichung (2) und (3)
,~f = ~rl ~ ~r~. (lO)
Zeichnen wir uns also in einem xr~ , p-Diagramm die Isothermen der ZustandsgrSl]en 3f, 3r~ und 3r~ ein, so sehneiden sieh die 3r~- und Sr2-Kurven
* Siehe S. F i s c h e r , BeitrKge zur Thermodynamik ver~inderlieher ~[assen nebst Anwendungen. ZS. F. teehn. Phys. 7, 527, 1926.
428 V. Fischer,
in einem Punkte der 3f-Kurve, der einen Hiiehst- oder Mindestwert dar- stellt. Dasselbe gilt fiir die Isobaren im xf~, T-Diagramm. Fiir einen
besonderen Fall wurde dies bereits gezeigt*. 3. In den vorhergehenden Gleichungen is[ die Gewichtskonzentration
xf~ ~ "mf~ (11) ~ft -~ ~tf2
als unabhgngige Ver~tnderliche eingefiihrt. Es ist aber oft yon Vorteil,
die Volumenkonzentration ~o:t f~
zfl -- ml (12)
als unabh~ngige Ver~nderliche zu benu~zen. Dabei bedeuten m~ und m 2
die Molekulargewiehte der Stoffe 1 und 2. Nachdem
Zr~ d- z:..~ z 1 (13 )
is[, so wird Gleichung (t2) auch err[ill[ dutch
~n/, (14)
z:2 _~ s%__. (15) ')~1, 2
Fiihren wir (t4) und (15) in Gleiehung (1) tin, so geht sie iiber in
~/. ~- ml,z:, .~:. + ~2z:2 ~f~. (16)
Wir unterseheiden die Zustandsgr(ilJe ~f durch den hochgesetzten Str ieh yon ~f. Der Zusammenhang zwischen beiden is[ nach (7) in Uberein-
stimmung mit (2) gegeben d~drch
~t ~ (t7)
Eine Verweehshng zwisehen den Konzen~rationen z und der all- gemeine~ Bezeichnung g ffir eine beliebige ZustandsgrSl]e is[ nicht zu beftirchten, da bei Anwendung der Gleiehungen g ersetzt wird dureh das Zeichen ftir die betreffende ZustandsgrS~e, z.B. i fiir den Warmeinhalt,
far die Entropie usw. 4. A1]gemein gilt unter Beaehtung yon (5) und (6)
(C)Zf~ dp -~- C ) Z f \ ' dT-~-~f~dmfl~-~f2dmff (18)
* Siehe V. Fischer , Die Berechnung der Unver~inderiichen zur Bestimmung yon Dampfspsnnungs- and Schmelzkurven. ZS. f. Phys. 48, 150, 1927.
Beitr~igo zur Thermodynamik der Gemische. 429
Fiihren wir ~f in Gleichung (18) ein, so geht sie unter Beachtung yon (13) bis (15) iiber in
Aus Gleichung (19) folgt
= ( 2 0 )
und aus Gleichung (16) unter Be~ch~ung voa (20)
+ o. (21) ml z f l \0) zf l /p, T
Die beiden Differentialgleichungen (4) und (21) sind yon grund- legender Bedeutung. Gleichung (4) mu~ fiir eine ZusiGandsgrSl]e er[iillt
sein, wena xf~ als unabhangige Veraaderliche eingefiihrt wird, und Glei- chung (21), w e n n zf~ als unabhi~ngige Ver~nderliche einge~iihrt wird.
5. Fiir
ergibt sioh aus (20) unter Beachtung yon (16)
~f : ml ~f~ = ms ~f2" ( 2 3 )
Mit Bezug auf das , z f l ,p - und zf~, T-Diagramm gilt dasselbe, was bereits ftir die Beziehung (10) mit Bezug a u[ das x f t , 2 - und xfl , T - D i a -
gramm gesagt wurde.
6. Es kommt noch eine andere Konzentration zur Anwendung, die wit mit x bezeichnen wo]len und die wir erhalten, wenn wir
mr~ ---- xm 1, (24)
mf~ ~ m~ (25)
setzen. D.h. es werden x Mol des Stories 1 mit 1 Mol des Stoffes 2 gemischt, wobei x jeden Wer~ yon 0 bis ~- c~ annehmen kann.
Fiir den Zusammenhang yon x mit den u zf~
uad zf~ folgt aus (12) uad (13)
zf~ - - x ~- 1 ' (26)
1 zf~ -~- �9 (27)
x + l Duraus fotg~ weiter
x ~-~ '~J-.~-~ �9 (28) Z f2
430 V. Fischer,
Fiihren wir x als unabhangige Veranderliche ein und bezeichnen wir eine beliebige ZustandsgrSlle in Abhangigkeit yon x mit Zf, so geht Gleiehung (18) unter Beaehtung yon (24) und (25) fiber in
\ - ~ / T , . dp -+- \-~-Tf-]p, xdT + m~f~dx. (29)
Aus Gleichung (29) ergibt sieh
: ml ~fl, (30)
Gleichung (I) geht fiber in
Zf = x~t/l, 1 ~ft "-~ mg~ 3f2' (31) und der Zusammenhang yon Zf mit ~f ist gegeben durch
& ( 3 2 ) 3~ ~ nh x + m~
Aus CTleichung (31) ergibt sich unter Beachtung yon (30)
= o. (33) % \0~/~,r + \Ox/~,r
Setzen wir mr~ ~ .% (34)
mf~ = xm~_, (35)
so erhalten wit die Ausdrfieke (26) bis (33) dutch Vertauschen der In- dizes 1 und 2.
7. Befindet sich ein Stoff in den beiden Zustanden f u n d g, so se~zen wir
und
A~I ---- ~fl-- ~gl, (36) A32 ----- ]f2-- ~g2' (37) A ~r.r ~ xr~ A ~ + xr~ A ~, (38) A'~g r ~- ,~'.q~A'~ + Xg~A]~ (39)
A~fg ~ mlzr~A h + m~zr~A~, (40)
.d3g f z mlzglA3i + m2z92A3:. (41)
Es folgt dann durch eine elnfache Rechnung unter Beachtung yon (2), (3) und (9) bzw. (16), (20) und (13):
A~,.g = ~ r - - ~ - - ( x r ~ - - x g l ) ( ~ , (42) ,T
, = - - - - x ) [ O ~ r > ~ ( 4 3 ) A~gz ~r-- 3. (xr~ ~ \Oxtl/p, r
Beitri~ge zur Thermodynamik der Gemische. 431
, , , ,a - - - [ a g ~ (44) ~ r g = ~r- - 3g - ( z r l - zg~)\O~-~Jp, r'
. 3 - ; , = ~ - ~ - ( ~ r, - ~ g O ( a~-~ ~ ) ( 4 5 ~ ~t)Zf~ /p, T
Die Funktionen (42) bis (45) dienen zur Aufstellung yon Gleich- gewlchtsbedingungen des Gemisches, wie im folgenden gezeigt wird.
8. Wir schreiben in Anlehnung an bereits vorhandene Bezeichnungen
fiir die thermodynamischen Potentiale teft, fff~, ~t, ferner fiir die Entropien ~ft, ~f2, ~f und ftir die Rauminhalte ~&, of 2, ~f" Dann gilt for das Gleichgewlcht zwisehen zwei Zustanden f und g eines Gemisches
ttr~ ~ tta~: (46) ~f2 ----- try2 �9 (47)
Damit folgt aus (38) und (39)
d ~ f g ~ d~.qf ~ 0 (48) und aus (42) und (43)
~ - ~ _ [ a ~ r ~ ( a ~ . (4~) xr~ - - xg, kc)xrJp, ~ \ 8 x g J v '
Ebenso erhalten wit aus (44) und (45)
5 _ ( a ~ ] ; a ~ . (50)
Ftir das thermodynamische Potential gilt unter beaehtung von (3)
d~t. = Atkd~v - - ~ f d T ~- (,Ur~ - - ttf2) dx&. (51) Es ist daher (t)~f_'~
\ ~ - / r , ~r, = .A ~'r, [52)
( a ! r ~ = - e,;, (53) 8 T}~ , :9,
und es folgt naeh (52) und (53) aus (38) bzw. (42)
( c)J~rq~ - - = A A V r ~ , (54)
( OA~r.r = - - A~ f~ , (55)
/ 8 t % \
---= - - (x;., - - x~, ) \a~:~,, /~, T'
k ~Xf~ /p,T, xg t
~32 V.~s~er,
Im Falle des Gloichgewichts wird nach (46), (47) und (49)
Oxa/~, r , .~- o (58) und nach (54) bls (56)
dzl~f a = A,d~fgd~ - - ,d~fgdr + (O~l~f_..___~) dxg, -~- O. (59)
Ebenso wird
( o ~ : g q ~,, , = o. (60)
In gleicher Weise erhalten wit
und
(o/~Tq r /6~ , , , (a.,q = - L " , < ~ , a ; , : ) ~ , + ""~,~ ,e ~,,,,~ T] \ - ~ g ~ lp, T, ~r~ r ,
2 ~
dd~fg ~ AJ~fgd,v - - d ~ f g d T + \ OZg--/p,T,z n
- ~-{,)A~ ~ , , ~ - - o. (63) dJ~g / ~--- A J ~ r - - z:g~gpdT-~ \ OZrl ]p,T,f~g~
9. Bezeichnen wit die Warmeinhal~e mit if,, [;2, if und die spezifi- schen Warmen bei gleichbleibendem Druck mit Cpf,, Cp, f=, cpt, so giR allgemein
L \OT/p,,f-- vf,]@ + ,O*r/~,r [r (~ I (o~,.~]
dif2 ~ Cpi2dT-- A k \ST/p ,~ f2- - D~J dp + \SsT~/p, r dz&. (65)
Gleichung (21) wird nun erfiillt dutch
\8zr/p, r = f i T ) -,zr~ (66)
( c)}f2~ = f ( T ) A t Q (67) zf2/p, r Zf2
Dabei bedeutet Adas mechanische Wgrme~quivulent, R1 und ~o sind die Gaskonstanten der Sto~fe 1 bzw. 2. f ( T ) ist dne beliebigc Tempe- raturfunkfion.
Beachten wit, dai~ mlR 1 ~ m~R~ (68)
Beitr~ge zur Thermod.ynamik der Gemisehe. 433
ist, und fiihren wir (56) und (67) in Gleichung (21) ein, so geht sie
fiber in f (T) A (m 1/~x - - m 2 R2) ~ 0. (69)
Wir iiberzeugen uns ]eicht, dad aueh die Gleiehungen (4) und (33) dutch (66) und (67) erfiillt sin&
Fiir die im naehfolgenden zu behandelnden Gemische ergibt die An-
nahme f (T) - ~ nf f (70)
eine Ubereinstimmung mit.den Versuchswerten, wobei nf eine unver~nder- liehe Gr(il~e bedeutet.
Vernach]~ssigen wlr die Veri~nderung des Raumlnhal~s im ~lfissigen und festen Zustand und fiihren wir (66), (67) und (70) in die Glei- ehungen (64) und (65) ein, so gehen sie fiber in
clifl ~ Cpfl d T -~ A Vr~ dp -~ nr A R 1 T d zfl, (71) Zfi
d[f2 ~ Cpf2 d T ~ A vr2 dp Jr nf A . R ~ f cl z[2. (72) Zfz
Naehdem (71) ebenso wie (72) ein vollst~ndiges Differential sein
mu~, so gilt (OCpr~" ] __ n fA_~, . (73)
\, (~Zfl/IT---- ZS' 1
Daraus folgt dureh Integration
cpf~ ~ nfA-RI In zf~ ~ F ( T ) . (74)
Wenn wit beaehten, dal] ftir
also fiir den Stoff i im reinen Zus~and f,
cprl ~-- cprl
werden muB, wobei Cpf I die spezifische Warme des ungemischten Stoffes 1 im Zustand f bedeutet, so ergibt sich aus Gleichung (74)
~ ( ~ r ) ~ c~n , und es wird
Cpr ~ ~ - Cpr ~ 4- nf A R~ In Zr/. (75)
Ebenso erhal~ell wir aus Gleiehung (72)
cpf 2 ~ Cpf 2 ~ n f A R 2 In zr2. (76)
Setzen wit (75) und (76) in die Gleichungen (71) und (72) eiu, so gehen sie fiber in
di A ~ cpA d T + ,t~) A dp -~ n f A l . ~ d ( f h~ zA) , (77) tiT/, 2 ~ Cpf 2 d T -~ A ~/'2 clp ~- '~9 A ~2 d (T In z/,2). (78)
434 V. Fischer,
Wir setzen voraus, dal~ in dem betrachteten Zustandsgebiet die Ver- anderlichkeit yon cpf 1 und cph mit der Temperatur vernachlassigbar ist und erhalten aus (77) und (78) dureh Integration
i h --~ CpftT 4- A ~ h p @ n f A l ~ l T l n z f ~ 4- kfl , (79)
~f2 --~ c p h T 4- AOhP 4- n f A R s T l n z f ~ ~- kh" (80)
Dabei bedeuten k h und kfu zwei Integrationskonstanten. Bezeichnen wir die Warmeinhalte tier nngemischten Stof~e 1 und2 mit i}~ und ih , so gi]t
ift ~ Cpf~ 4- A , f l p 4- kfl , (81)
ih = G h 4- Aor~P Jr kr~' (82)
und wir bekommen sehliel~lieh fiir die W~rmeinhalte der Bestandteile 1 und 2 in der Mischung vom Zustand f
i h - ~ i h 4- n r A R ~ T l n z h, (83)
i h ~ i h ~- n f A R ~ T in zf2. (84)
Es last sich auch beweisen, dal~ die Gleichungen (83)und (84) gelten, wenn wit die elnschr~nkenden Annahmen fiber die Ver~nderlichkeit der spezifischen W~rmen und der Rauminhalte nicht machen.
Wit kSnnen nun die Ausdriicke fiir die Mischungsw~rmen auistellen.
Setzen wit fiir diese qh, qh, qf, so ist naeh (83) und (84)
qh - ~ t h - - i r L ~ n r A R I T l n z h , (85)
qf2 ----- tt '~--if2 ~ n f A R s T l n z r 2 " (86)
l~[ithin ist naeh (2)
qf ~ n r A T (R 1 xft ]n zfl 4- R 2 xf2 In zh) (87)
und unter Beachtung, daft
A R l m 1 -.~ A l t 2 ~ s ~ 1,985 (88)
wird, nach (16) und (31)
qf ~ 1,98o ~ f I (zh lnz h 4- zr2 lnzh), (89) r n Qf - ~ 1 , 9 8 o n r T ( x ] z h 4- lnzr2). (90)
10. Wir gehen nun dazu fiber, die Entropien ~ft und ~f2 zu be- stimmen. Ffir die Entropiedifferentiale gilt allgemein:
d ~ = r + + .o~%]~, d~r,, (91) , 'p, zf~ T
d l ' IOVr"" dp ~- '~ ~h" = + (92)
Beit~ge zur Thermodynamik der Gemische. 435
Vernachlassigen wit wieder die Ver~ndertmg des Rauminhalts im testen und fliissigen Zustand, so gehen die Gleichungen (91) und (92) tiber in
d~ ' ---- r T - \0-~d~, d~,, (93)
d~f~ : r ~ - 4- \~ f~ /p , dzf~. (94)
Integrieren wir Gleichung (93) bei gleichbleibendem ~fl unter Be- ach~ung yon (75), so erhalten wlr
~f, = (cpf~ -~ nf A.Rl ln zs ) ln T ~- f (zfl). (95)
f(zfx ) mul~ die Bedingung erfiillen, da~ bei Geltung der Mischungs- regel fiir die Warmeinhalte, also fiir den Grenzlall unendlicher Verdiinnung des einen der beiden Stoffe in der Mischung, woIiir
n f - - - O
wird, ~f, in den bekannten Ausdruck iibergeht:
~f~ ~--- c p f l l n T Jr- k'fl - - A B l l n z f l , (96)
wobel k~ eine Integrationskonstante bedeutet. Der u yon (95) mit (96) ergibt
f(zf~) ~ k" 5 - - A B l ln zfl. (97) Somit wird
~f~ ----- cpf~ ]n T ~ k}~ - - (1 - - nf]n T) AI~ 1 in zf~ (98)
und ebenso nach Gleichung (94)
~f2 ~ cpf2 in T ~- k~ -- (1 - - n f l n T ) A R ~ In zf2. (99)
Nachdem nun fiir die Entropien sf~ und sf2 der reinen Stoffe gilt:
st1 ~ cpr ~ in T § k}l, (100) sf2 = cpf21nT ~- k}2 , (101)
k(innen wir (98) und (99) auch schreiben:
~r~ ~ sr~ - - (1 - - n p l n T ) A R ~ l n z 5 , (102) ~f~ ~ sf2 - - (1 - - n f l n T ) A t ~ l n z f ~ . (103)
Fiir die Gleiehungen (102) and (103) gilt dasselbe, was fiir (83)und (34) gesagt wurde.
11. Ffir das Gleichgewicht einer Mischung im fliissigen und festen Zustand gilt, wenn f den iliissigen und g den ~esten Zustand bedeutet, in l)bereinstimmung mit (46) und (47)
if~ - - ~g~ ~ (~f~ - - ~g~) T, (104) ir~ - - i ~ z (~r~ ~ ~ ) T. ( 105 )
Zeitschrif~ fiir Physik. Bd. 46. ~9
436 V. Fischer,
Wit ltihren in (104) und (105) die Gleichungen (79), (80) und (98), (99)ein, wobei fiir den festen Zustand der Index f durch den In- dex g vertauscht wird, fassen in A, B, C die unveranderlichen Gr(il~en zusammen und setzen
Yr ~ 1 -k nf ( 1 - - l n T ) , (106) yg -.~ 1 ~- ng(l - - lnT) . (107)
Dann erhalten wir zur Berechnung der Gleichgewichtskonzentrationen
A1 Ts B l l g T s - ~- C 1 -~-yglgzg 1 - - y f l g z f ~ ~ O, (108)
An B21gT8 ~ C a dr yg lgzg 2 - - yflg~f= ~ O. (109) T8
12. Eine allgemeine LSsung, die die Gleichungen (4), (21) und (33) eriiillt, ist gegeben durch
( 08f1~ ----- A l ~ , z f ~ f ( p , T , zfl), (110) C) Zrl/p, T
OZf~/p, T = AR2z f~ f (P ' T, zfl ). (111)
Die Funk~ion f kSnnen wlr durch die Reihe darstellen:
a f (~ , T, ~r~) + b q- c~r~zr~ q- ~ ~ ~ ~ dzf, zf2 ~- -~- .. (112) - - - - e ~ f l Zf~ ",
Z fl gf~ wobei a, b, c , . . . im allgemeinen Funktionen yon p und T sind. Im vorhergehenden haben wit den Fall behandelt, wo die Funktion f nur durch das erste Glied der Reihe dargestellt ist u n d a eine lineare Funk- tion von T allein ist. An anderer SteUe haben wir den Fall betrachtet, wo die Funktion f durch die beiden ersten Summanden der Reihe ge- geben ist *.
A n w e n d u n g e n .
Gold--Kupfer. 13. Diese Legierungen ~r yon K u r n a k o w Und Z e m c z u z n y
untersucht**. Die Schmelzk~hrven besitzen einen Mindestwert der Tem- peratur, tiir den die Konzedtration der Schmelze und der aus ihr er- starrenden Legierung gleich ~ind; denn es fo]gt ~iir
* Siehe V. F i s c h e r , Beitrgge zur Thermodynamik ver~iaderlicher Massen nebst Anwenduagem ZS. f. techn. Phys. 7, 529, 1926.
** Siehe K. B o r n e m a n n , Die bia~ren Metallegierungen, I. Tl., Halle a. d. S. 1912, Tafel 3, Fig. 23.
Beitr/~ge zur Thermodynamik der Gemisehe. 437
aus (62) und (63) unter Beachtung yon (61)
Z f l ~ Z g 1 �9
0berhalb dieses Mindestwertes bestehen [iir dieselbe Tempera~ur zwel
verschiedene Gleiehgewiehtszustand e.
Es gilt nun fiir Gold*
% s - - Cpo ~ 0,0323 - - 0,0345 ~-- - - 0,0022,
r o ~ 15,87,
Tso ~ 1337~
m ~ 197,2 uad liar Kupfer
Cps - - Cp~ ~ 0,1007 - - 0,1074 ~ - - 0,0967,
r o ~ 43,
Tso ~ 1357~
m ~ 63,57.
Zur Berechnung der Unveranderl ichen A, B und C aus diesen Werten
in den Gleichungen ( 1 0 8 ) u n d (109) haben wir an anderer Stelle die
Ausdriicke abgeleitet **.
A ~-- r o - - ( e p ~ - - c v o) T~o 2,3 A / t ' (114)
B - - c p , - - % 0 A R ' (115)
C z B l g T ~ o - - A . (116)
Au~ Grund der vorliegenden Schmelzdiagramme ist die Annahme
zulassig, dal~ man die Misehungswi~rme yon Gold-Kup~er im festen
Zustaad vernachl~tssigen kana. Fi ir die ]Kischungsw~trme im fltissigen
Zustand ergibt sich aus den Versuchswerten
n r - ~ - - 0,044. Damit folgt aus (106)
yf ~ 1 - - 0 ,044(1 - - 2 ,31gT) . (117)
Es ist dies ein im fragliehen Temperaturbereich wenig ver~tnderlicher
Wert, fiir den wit im Mittel Yr ~ 1,27
setzen ktinnen.
* Die Werte fiir die spezifischen W~trmen, die Schmelztemperaturen und die Sehmelzw~rmen sind entnommen: F. Wrist, A. Meuthen and R. Dar te r , Die Temperatur-Wi~rmeinhaltskurven der teehniseh wichtigen Metalle. Forsehungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw., Heft 204, Berlin 1918, S. 45--47.
** Siehe V. F i sche r , Die Berechnung der Unver~tnderlichen zur Bestimmung yon Dampfspannungs- und Schmelzkurven. ZS. f. Phys. 48, 143, 1927.
29*
438 V. Fischer,
Wit versehen Ierner die Zustandsgrlifen, die sich auf fliissiges Gold beziehen, mlt dem Index a, und dieienigen , die sich auf festes Gold be- ziehen, mit dem Index a, sowie in gleicher Weise die Zustandsgri~l~en des Kupfers mit den Indizes c und 7" Unter Beachtung, daft
zg ~ - 1 - - Za and zy = 1 - - z~
ist, erhalten wlr nun aus (108) und (109) zur Berechnung der Gleich- gewichtskonzentrationen der Gold-Knpferlegierungen
812,62 0,21851gT8+ 1,291 + l g z a - 1,27 lgz~ = 0, (118)
r . 725,41
0,2145 lg T8 + 1,2065 +lg (1 -z~) - 1,27 lg (1 - z~) = 0. (119) r . Der bessercn (~bersichtlichkeit halber fassen wit in den Gleichungen
(118) und (119) die yon der Temperatur abhangigen Glieder in den Ausdriicken a a u n d a e zusammen und schreiben:
aa w 1,27 lg z~ : - - lg z~. (120)
ae - - 1,27 lg(1 - -za) : - - l g ( 1 --z~). (121)
Berechnen wir aa fiir eine bestimmte Temperatur und fiihren wir ltir za in Gleiehung (120) einen Wert ein, so k(innen wir aus (120) den
zugehiirigen Wert yon za be-
Z~x •d
Fig. 1. Isothermenpaar yon Gold--Kupfer .
Z ~ rechnen. Auf diese Weise lafi~ sich in einem Diagramm mit za als Abszissen und z~ als Ordinaten die durch (120) ge- gebene Isotherme aufzeichnen. Ebenso eriolgt die Aufzeichnung der durch Gleichung (121) ge- gebenen Isotherme. Der Schnitt- punkt der beiden Kuven glbt dutch seine Koordinaten die gesuchten Gleichgewich~skon- zentrationen. Wit linden nun, daft sich die beiden Isothermen
in zwei Punkten sehneiden, entsprechend den zweimiiglichen Gleichgewichts- zustanden bei derselben Sicdetemperatur. ]~it abnehmender Teraperatur riicken die beiden Sehnittpunkte n~her zusammen, bis wir zu einer Temperatur gclangen, bei der sich das Isothermenpaar beriihrt. Diese Temperatur bestimmt den MJndestwert, bei dem Gleichgewicht des Ge-
Beitr~ige zur Therm0dynamik der Gemische. 439
misches im fliissigen und festen Zustand noch milglich ist. Unterhalb dieser Temperatur schneiden slch die Isothermen nlcht mehr.
Fig. 1 zeigt den Verlauf der beiden sich beriihrenden Isothermen. Sie l~l]t auch den Verlauf der iibrigen Iso~hermenpaare erkennen. ~fir den Beriihrungspunkt der beiden Isothermen wird nach (113)
Za = Z a "
Damit folgt aus (120) oder (121) durch Differentiation fiir die Richtung der Tangen~e ((~za~ __
\ O ~ a / T - - yf" (122)
Fig. 2 zeigt die aus den Gleichungen (120) und (121) auf die oben beschriebene Weise erhaltenen Schmelzkurven der Gold- Kupferlegierungen. Die gestrichelten Linien geben die aus den Ver- suchswerten yon K u r n a k o w und Z e m c z u z n y erhaltenen Schmelzkurven wieder. Durch elne geringe ~nderung der Unver~nderlichen liel]e sich zwar eine vollstandige Uberein- stimmung erzielen, doch wurde davon abgesehen, um das Er- gebnis auf Grund der derzeit bekannten Versuchswerte fest- zustellen.
14. Der Hi/chstwert der Mischungswi~rme qf yon Gold und Kupfer ergibt sich nach
r
*I056 ~\
'~176 i \
350
9DO
850
//I / t l
i / / ~ l
~u ~u
Fig. 2. $c~elz~en yon Gold--Kupf�9 (10) ~d (SS)his (S7) ~
qf = qfa = qfc = - - O , 0 4 4 A - R a T l n z a , (123)
und es folg~ daraus ftir die Bestimmung der Konzentra~ioa ~a, bei der der Hiichstwert der Mischungsw~rme qf auftritt,
R a l n ~ a = Rcln (1 -- Za). (124)
Zeichnen wir uns die belden durch (124) gegebenen logarithmischen Linien mit z a als Abszissen auf, so gibt der Schni&tpunkt derselben die gesuchte Konzentration. Wir linden sie zu
z a = 0,315.
Die zugehiirige Siedetemperatur der Mischung folgt aus dem Diagramm
(Fig. 2) zu T, = 1173~
440 V. Fischer,
Damit wird nach (123) q f ~ ---- 0,26 Cal/kg.
Es sei noch bemerkt, da~ nach (102) und (103) mit dem nega~iven Wert ~on nf bei der Mischung yon fliissigem Gold und Silber eine Entropievermehrung eintritt.
II. G e m i s c h e aus drei B e s t a n d f e i l e n .
15. Wir schreiben fiir die Konzentratlonen abgekiirzt
mr ~ (125) Xfi - - 3
1
m f i
(12c,) 3
"--~ ~'i
Dabei ist i ~ 1 bis 3 und 3 3
Xf i ---- ~ Zf i - - - - 1. ( 1 2 7 )
1 1
Mig den Bezeichnungen des ersten Abschnittes gilt nun
3
Zf -~- ~ mri 3r~, (128) 1
3
~f ~ ~ X f i ~ f i , (129) 1
_ 3
~f ~ ~ mizfi ~t'i- (130) 1
Far das Differential yon Zf schreiben wir in abg'ektirzter Form
O Zr O Zr dZf : - ~ d ~ + - ~ dT + ~ ~fid~,~fi. (131)
1
Dabei bedeut~et
OZr (132) ~fi ~ C)mfi"
Fiihren wit xt. ~ und ~f2 als unabh~ngige Ver~nderliche ein, so folgt aus (131), unter Beachtung, dab nach (127)
3
dxfi = 0 (133) 1
Beitr~ge zur Thermodynamik der Gemische. 441
wird,
O~rdp+O~r ,, d3f = ~ ~ d l + (~fl - - ;h) dxfl + (3h - - 3f:~) dxh. (134)
Mithin ist ( 03f ~ = ~f~'-- ~r:~, (135)
~O xh/v, r, ~r~
( ~ ) p = ~ , - - - ~ (136) �9 , T , x f ~
Fiir xh, x& und xf3 , x h als unabh~ngige u ergeben sich die entsprechenden Ausdriicke aus (135) und (136) dureh zyklische Ver- tauschung der Indizes.
Es ist ~erner unter Beachtung yon (133)
(0~}~ i/o) 3r'~ (137)
und es fo!gen aus (137) dureh zyklisehe Vertausehung zwei w)eitere Bezlehungen.
Aus (129) erhalten wir unter Benutzung yon (135)
/ 0 ~r~ (O]f-2) + Xra(-~h]p ' = 0 (138)
und dureh zyklisehe Vertausehung der unteren Indizes in (138) fiinf weitere Ausdriicke.
Ebenso fo]gt aus (130)
= o . (139) ml zh \ 0 Zh/p, T, zf2 ~0 zh.]p, T, z h z h
16. Fiir ein Gemisch in den Zustanden f u n d g ftihren wir wieder die Bezeichnungen eln
und
3
1
3
d~gr ~ ~ x g ~ d ~ 1
3
z J ~ f g ~ ~ i Z f i Z ~ i , 1
3
d~g f = ~ miZgtd~i . 1
(14o)
(141)
(142)
(143)
(144)
442 V. Fischer,
Es wird dann
~--- (Xfa--Xgu) \'~Xg~lp, T, Zg 1' (145)
(O~r~ . c x x ) I/c)~f~ (146) d~g t ---- ~r -~g- (x f l -xgl ) \Oxr jp ' r, % ~ r2- g~ \ - j ~ ) p , r, ~rl
Durch zyklische Ver~auschung ergeben sich aus (145) und (146) vier weitere Gleichungen tiir x2, x~ und xs, x 1 als unabhiiagige Ver- itnderliche. Mit aaderen Worten, wir kSanen in die Gleichungen (145) trod (146) beliebig zwei yon den drei Konzentrationea x als unabh~ngige Ver~nderliche einfiihren.
Gleichlautende Beziehungen wie (145)und (146) erhalten wir fiir ~d 3fa und J 3gf mit den Konzentrationen z als unabhiingige Veranderliche.
Fiir das Gleichgewlcht zwischen den Zustanden f tmd g des Ge-
misches gilt #ri ~ ggi. (147)
Damit folgt aus (141) und (142)
d ~ f g ~ ZJ~gf ~ - O, (148) und es ist
dzJ~fg ~-- A z : l O f g d p - J ~ f g d T + 6)J~fg- ~ , + OJ- ~fgdxg2 ~ - - O. (149) G)Xg 1 aX~gt (~X,g 2
Dabei wird
O d ~ r g _ _ ~ x r ~ O # g ~ _ _ _ [ ( x r -xgl) 0~g 0~g ], (150) O Xgl. 1 0 Zg 1
C ) ~ g ~ [ 0~g 0 ~ ' ] (151) 0 xg~ ~ 0 xg~ c) xa~ 0 xg~ '
c)A~fa OA~fa = O. (152)
Ebenso wlrd
gzl~gf ~--- A ,dOgfd~- ,J~grd l ' +-~-fff~ a x f t t - ~ x f ~ f~ : O. (153)
Entsprecheade Ausdrticke erhalten wir fiir ~/~fg and z/~gf. 17. Wir gehen nun zur Aufstellung der Ausdriicke fiir die Warme-
inhalte in der Mischung fiber. Gleichung (139) ist ftir diese er~llt, wenn wir setzen:
ir~ ~__ f (p, T, zr~ ) (154) und
O~fi/p, T ~ f (T ) ~f~ �9 (155)
Beitrage zur Thermodynamik der Gemische. 443
Dies 1N]~ sich beweisen, indem wir beachten, dal] nach (127)
( c) ira ~ - - - - (0it3 ~ (156)
a % / v , Y, ~'r= - - \ a *r3/v, ~', *h is~. Es folgt dann aus (139) and (155)
A f ( T ) ( / 1 A ~ I - - m$.~8) ~ O. (157)
M_it (70) erhalten wit aus (155) in gleicher Weise wie wit (83) und (102) geflmden haben
tri = i f i ~- n f A R t T lnzr i , (158)
~fi -~- s r t - ( 1 - - n f l n T ) A R ~ l n z r i . (159)
Fiir das Gleichgewicht der Mischung im fliissigen Zustand f mid festen Zustund g erhalten wir daraus ebenso wie (108) und (109)
At - - Bt lg T, ~- Ci @ Yalg'zgi - - y f lg zfi ~ O. (160)
Fiir den fliissigen Zustand f und den gasfiirmigen Zustand g ergibt sich aus (158) und (159)
Ai - - B i l g T , -]- Ci -~- y f l g z f i - - lgze i z lgfl. (161)
Die vorausgehenden Ausfiihrangen 1assert slch ohne weiteres auf ein Gemisch in zwei Zustanden trod aus n Bestandteilen erweitern, wenn
i ~ 1 bis n gesetzt wird.