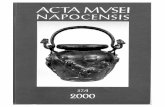Beiträge zur Kenntnis der Gymnophionen I. Über das Schlundspaltengebiet
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Beiträge zur Kenntnis der Gymnophionen I. Über das Schlundspaltengebiet
695
Aus dem zoologischen Institut in ~Iiinchen.
geitr/ige zur Kenntnis der Gymnophionen. I. Uber das Schlundspaltengebiet.
~on
Dr. Harry Marcus.
ttierzu .Tafel XLVII--L und 12 Textfiguren.
I n h a l t . Einleitung.
I. Spezieller Tell. 1. Anlage der Schlundtaschen. 2. Entwicklung der Kiemen und ihre l:tiickbildung. 3. Ultimobranchialer KSrper. 4. Erste Anlage der Lungen. 5. Thyreoidea. 6. Thymus.
II. Allgemeiner Tell. 1. Systematische Stellung tier Gymnophionen. ~ , ~ , 2. Homolo~e der Kiemen. 3. Thymuszellen und Sexualzellen.
Literatur verzeichnis. Tafelerkl~rung.
Das Material, dem diese Arbeit als erste einer Reihe yon Studien iiber Gymnophionen seine Entstehung verdankt, s tammt von B r a u e r . Dieser schenkte es Her rn Prof. R. H e r t w i g , der es mir zur Bearbei tung anbot, was ich mit Freuden annahm und wofiir ich ihm auch hier bestens danken mSchte. He r r Prof. B r a u e r hatte die ausserordentliche Liebenswfirdigkeit, mir ausser dem unverarbeiteten Material noch seine s;tmtlichen Schnittserien, die er yon Gymnophionen fiir seine bekannten Arbeiten angefert igt hatte, zu iibersende/u I)adurch konnte das Material sehr geschont werden und ich konnte mir vieles Schneiden ersparen. Ffir die Erlaubnis zur freien Benutzung seiner Serien m~chte ich Herrn B r a u e r auch an dieser Stelle meinen herz- lichsten Dank sagen.
696 H a r r y M a r c u s :
Das Material besteht aus zwei Spezies einer und derselben Gattung, namlich aus Hypogeophis rostratus und H. alternans. Dieselben unterscheiden sich durch ganz unwesentliche Merkmale.
B o u l e n g e r (95) charakterisiert sie folgendermal~en: ,.Hypogeophis rostratus: Tentacle much nearer the nostril than the eye; 105--130 folds.
Hypogeophis alternans: Tentacle not, or but little nearer the nostril than the eye; 175 folds.':
Die letztere Form ist kleiner als die erste, deren langstes bekanntes Exemplar 28 cm misst.
In der Ontogenese verhalten sich diese beiden Arten v(illig gleich und sind nut durch die Gr•sse und in spateren Stadien eventuell dutch die Segmentzabl zu unterscheiden. Ich werde daher im Laufe der folgenden Arbeit die beiden Arten bei der Beschreibung nicht scharf trennen, sondern gerade das deutlichste Bild auswahlen, unbekiimmert um die Spezies.
]J'ber die Gewinnung des Materials, seine Fixierung etc. verweise ich auf B r a u e r s erste Arbeit (97). Die Benennung der Stadien erfolgt nach B r a u e r s Muster: Die Zahlen, mit denen ich die verschiedenen Stadien bezeichne, entsprechen den Nummern der Figuren in B r a u e r s Arbeit: ,lJber die ausseren K0rperformen" (99).
So wfinschenswert es ware, dass alle Fragen, die sich bei diesem seltenen und so vorztiglichen Material aufwerfen lassen, gleichmassig eingehend untersucht wiirden, so muss ich doch gestehen, dass sich gewisse Probleme vordrangten und so gewisse Ungleichmassigkeiten in der Bearbeitung entstanden sind. Manches yon dem, was ich unberticksichtigt gelassen habe, hoffe ich in einer spateren Studie nachholen zu kSnnen, z. B. die weitere Entwicklung des Hyoid und Kieferbogens, die Beteiligung des Mesoderms etc.
Die Probleme, welche ich in dieser ersten Studie behandeln will, sind folgende:
Das erste Problem behandelt die Frage, ob die Kiemen ektodermal oder entodermal seien, ob also Haut- oder Darm- atmung existiere.
Ersteres war die allgemeine Auffassung, letzteres wurde yon G r e il vertreten.
Beitri~ge zur Kenntnis der CTymnophionen. 697
Die zweite Frage, die reich besonders interessierte, galt tier Thymus. In einem Vortrage beim Anatomen-Kongress in Wiirzburg (1907) ftihrte ich die Hauptgedankengange aus, die hier niiher begrfindet werden soUen.
In der Gesellschaft ftir Morphologie und Physiologie in Mtinchen demonstrierte ich einen Fall yon paar iger Thyreoi.dea- Anlage, der trotz seines atypischen Vorkommens, glaube ich, yon weitgehender Bedeutung ist.
Angesichts der zahlreichen zusammenfassenden Arbeiten tier letzten Jahre bin ich nicht erschSpfend auf die L i t e ra tu r eingegangen. Im Verzeichnis steheu also nur die direkt zit ierten Arbeiten, doch werde ich in dell einzelnen Abschnitten auf die zusammenfassenden Arbeite~ verweisen.
Ich beginue mit der
E n t w i c k l u n g d e r S c h l u n d t a s c h e n .
Eine Literaturtibersicht findet sich bei P e t e r (01) und M a u r e r (02).
Vou den Gymnophionen speziell ist wenig bekannt. Die Vettern S a r a s i n geben an. dass sich fiinf Schlundtaschen auf die gewohnte Weise aulegen. Ferner gibt B r a u e r (99) eine vortrefliiche Schiiderung der Kiemenbogenbildung nach Ober- iiachenbildern. Ich werde dieselbe hier wiedergeben und durch Schnittbilder vervollstandigen. Wegen der Oberflachenbilder muss ich freilich auf die Originalarbeit verweisen. B r a u e r schildert die Bildung der Hyomandibulartasche folgendermal~en Seite 490 :
Wie tier innere kleinere Hof, welcher den Embryo umgibt, es anzeigt, erstreckt sich das )[esoderm seitlieh tier Chorda. Anfangs in Form zweier hinten breiter, nach vorn sieh verschmi~lernder Platten his in den vorderen Abschnitt des Embryos. Wi~hrend yon tier hinteren Grenze des letzteren an, etwas kaudalwi~rts das Mesoderm in die Ursegmente geteilt wird, bleibt es vorn unsegmentiert. Aber wenn die Sonderung der Hirnabsehnitte be- gonnen hat und der Embryo sich vorn yon dem Dotter abzuheben anf~ngt, tritt auch in diesem Mesoderm eine Anordnung in hintereinander liegenden Abselmitten auf. Der Teil des Urdarms, weleher in den vorderen Absehnitt des Embryos als Divertikel eindringt, tier spi~tere Vorderdarm, beginnt seit- liehe Aussackungen zu treiben : Anfangs nur eine, die erste Schlundfalte. Indem diese sich in alas )[esoderm einkeilt und his zur Epidermis vordringt, wird die Kontinuiti~t des ersteren unterbrochen. Dieser u mit dem zugleich eine Vermehrung des Mesoderms eintritt, tritt i~usserlich in der
698 H a r r y Mar cus :
Weise hervor, dass seitlicb am Kopfteil die vorderste Pattie des Mesoderms wulstartig erhoben wird und durch eine Einsenkung von der tibrigen ]~Iesodermmasse getrennt wird. Dieser ~Vulst bezeichnet die Anlage des )Iandibularbogens, die Einsenlcang entsprieht der Stelle, wo die erste Aus- sackung des Vorderdarms die Epidermis beriihrt."
Fig. 1 zeigt ein Querschnittbild dieses Stadiums. Es ist ein Embryo yon vier abgeschnt~rten Urwirbeln, dessen Neural- rohr noch welt often steht. Die Mesodermschicht ist noch sehr wenig mitchtig, sodass nur eine geringe Ausbuchtung des Entoderms geniigt, um das ~ussere Blatt zu bertihren. Freilich sehen wit auch eine leichte Einbuchtung des Ektoderms, sodass dieses nicht ganz passiv bei der Schlundtaschenbildung erscheint. Ein '.thntiches Verhalten finden ~vir bei eiuem etwas ';dtereu Embryo, dessen Neuralrohr fast geschlossen ist (Fig. 2) und ebenfalls bei schon geschlossenem Neuralrohr (Fig. 3). Das 5[esoderm ist etwas, aber unwesentlich, vermehrt. Der Embryo, yon dem Fig. 3 stammt, hat auch nut ~ier his ftinf Segmente. Dies zeigt, dass die Entwicklung der einzelnen Teile nicht vOlli@' gleichm:~ssig erfolgt, dass die Urwirbelzahl kein absolutes Kriterium fiir das Alter ist, was ja schon oft hervorgehobel~ worden ist. Ich fahre fort, B r a u e r s Schilderung zu zitieren:
,Bald nachher wiederholt sich derselbe Vorgang und es bildet sich eine zweite Einsenkung im Mesoderm, die yon tier ersten dutch eineu zweiten Wulst, die Anlage des Hyoidbogens getrennt ist. Anfangs liegcn diese Bogenanlagen ziemlich flaeh dem Dotter auf, dann .aber erheben sie sich tells dutch eigene Verdiekung, tells durch Erhebung des Embryos iiber den Dotter und kommen so allmi~hlich mehr und mehr in eine schrSge I~age zum Kopfteil.
Und zwar ist der Winkel, den der Hyoidbogen mit der Langsachse des Embryos kranialwarts bildet, spitzer als der des Mandibularbogens und daher ist es mOglich, auf einem Quersclmitt ausser der ersten der Mandibulartaschen auch die Hyoidfalte zu treften, wie es Fig. 4 zeigt. Es ist dies yon efllem Embryo yore Stadium 7 mit 16 Segmenten. Die ursprtmglich so minimale Bertihrungsflache der beiden Blatter bei der ersten Schlundtasclle ist sehr vergrOssert; wir sehen wie das jetzt stark gebuchtete Eutoderm breit dem gestreekten Ektoderm aniiegt. Die seitliche kleinere Falte im Entoderm ist die Hyoidtasche, die welter kaudal verfolgt bis an das Ektoderm gelangt (Fig. 5). In den zwischeu Fig. 4 und 5 liegenden Schnitten hat sich die entodermale Mandibularfalte vom Ektoderm losgel~st und die beiden Mesoderm-
Beitr~ge zur Kenntnis der Gym~ophionen. 699
abschnitte sich vereinigt. In dem seitlichen Mesoderm haben
sich die Zelien epithelial angeordnet nnd umschliessen eine were HShle : das Schlundbogencoelom.
Nun erfolgen tiet~reifende Lagever~tnderungen dureh die Anlage und Ausbildung des Perieardialraumes und des Herzens.
,Die den Bogenanlagen seitlieh anliegenden Teile des inneren Holes, welehe zuerst wie jene (Sehlundbogen) finch auf dem Dotter ausgebreitet waren, beginnen sieh ebenfalls yore Dotter abzulSsen, aufzuriehten, median- w~rts einzukrammen und zu ether Bitdtmg sie]~ zu vereinigen. Sie erscheint dann als eine bruchsaekartige, zentrale Vortreibung des Embryos. Dureh ihre Entwicklung sind aueh die Viseeralbogen yore Dotter getrennt und welter aus der sehrggen Lage in eine fast vertikale zum Embryo fibergefiihrt, sodass, yon oben gesehen, sie nut als zwei seitliche Wulste noch erseheinen und ihre weitere Entwicklung nut in Profilansichten verfolgt werden kann. Was die Form der beiden Bogenanlagen betrifft, so maeht auch sie manche Ver~nderung (lurch. Did Anlage des Mandibularbogens erseheint yon Anfang an breiter als diejenige des Hyoidbogens. Beide sind medianw~rts am starksten ver- dickt und am sehS.rfsten umschrieben, seitlich verschwinden sie anfangs in das tibrige Nesoderm; erst allmS~hlich bildet sich fiir beide eine sch~rfere Form aus, besonders nachdem am Hinterrand des 3[andibularbogens die Anlage der hinteren Portion des Trigeminusganglions und am Hyoidbogen diejenige des Geh5rorgans sich ausgebildet; sie erscheinen dann als ziemlicb plumpe, fast gleich breite Wulste. Auch ihre Ste'llung gndert sich im Laufe der Entwicklung. Auf den frtihesten sind sie fast parallel schr~g yon hinten nach vorn gestellt, dann bemerkt man, dass allm~thlich die Anlage des hIandibularbogens in die entgegengesetzge, yon vorn nach hinten zeigende Stellung iibergeht, sodass bald die beiden Bogen gegeneinander mit ihren zentralen Enden konvergieren. Sp~ter verlagert sich aber auch der Hyoid- bogen etwas und zwar in ~hnlicher Weise wie das erste, und dadurch kommen beide wieder einander fast parallel zu liegen." (Brauer S. 492.)
Aus den Oberflachenbildern geht also hervor, dass die beiden ersten Visceralbogen zweierlei Bewegungen ausftihren; erstens
medianwarts dutch die Erhebung des Embryos, zweitens yon vorn nach hinten. Diese letztere Verlagerung k5nnen wir auf
das Wachstum des Embryos nach vorne zurtickffihren, wahrend die distalen Enden der Bogen auf dem Dotter tixiert sind. Fails diese unsere Annahme richtig ist, massen wir, glaube ich, not- wendigerweise eine dritte Bewegung tier Bogen postulieren, namlich eine Rotation um ihre L~tngSachse. Der Stamm des
Embryos ist nach vorn und oben yore Dotter verschoben. Stature
und Dotter sind die im ganzen stabilen Elemente, wahrend die sie verbindenden Bogen als die leicht modifizierbaren Gebilde erscheinen, an denen die Bewegung ihre Spuren hinterlassen
Archly f. mikrosk. Anat. Bd. 71. 46
700 H a r r y M a r c u s :
wird. Da die Bogen auf beiden Seiten, distal auf dem Dotter, wenigstens anfangs, fixiert sind, muss bei der Vorwarts- und Aufwartsbewegung des Stammes auf dem passiven Dotter eine Rotation der Schlundbogen eintreten. Es fragt sich nun, nach welcher Richtung diese Rotation verlauft; finder eine Pronation oder eine Supination statt, wean ich den $chlundbogen mit einer Extremitht in Analogie setze und die ffir letztere gebrhuchlichen Termini verwende? Leider ist diese Frage mit Bestimmtheit nicht zu entscheiden~ da noch kein Nerv differenziert ist, an dessen gewundenem Verlauf man einen R[lckschluss hhtte machen kSnnen. Es bleibt daher nur der unsicherere Verlauf der Gefasse zur Beurteilung dieser wichtigen Frage. Und da will ich vor- greifend auf Figg. 6 und 7 verweisen; wir sehen in Fig. t; iEmbryo-Stadium 12; 29 Segmente) das Gef~ss im Mandibular- bogen seitlich oben, w~thrend es in Fig. 7 (44 Segmente) in der Mitre oben verl;tuff. Beide Schnitte gehen dutch die Mitre der GehSranlage. Wir sind bier, glaubeich, berechtigt, eine Supination des Bogens anzunehmen, weniger auf den Gef~tssverlauf als auf die tibrigen Verh~tltnisse gestfitzt. Denn bei Verkfirzung des V~rbindungsstranges zwischen den beiden "Bogem wie es die beiden Figuren zeigen~ erfolgt ausser tier Ann~therung eine Drehung um die L~tngsachse des Mandibularbogens.
Aus der schragen seitliehen Stellung gelangt er in die ventrale horizontale. Die gleichen Prozesse tinden wit beim Hyoidbogen.
Eine Drehung um die Langsachse ist ffir die Schlundbogen schon beschrieben worden, besonders yon D o h r n ffir Petromyzon und Selachier. Bei letzteren tritt es ~usserst deutlich zutage, wie ich mich selbst habe ~iberzeugen kSnnen. Die ersten Kiemen- knospen entstehen namlich am unteren Rand der Bogen und treten im Lauf der Entwicklung mehr nach aussen. Hier besteht also eine ~tussere Marke und man kann mit Bestimmtheit behaupten~ dass eine Pronationsbewegung stattgefunden hat. Diese Rotation verlhuft in entgegengesetzter Richtung wie die oben f~ir Gymnophionen geschilderte. Das wesentliche ist, dass ilber- haupt eine Rotation stattfindet. Die Pronationsbewegung bei den Selachiern tritt ja nach der Kiemenbildung auf (ist also garnicht mit der yon mir bei Hypogeophis beschriebenen Supination vergleichbar) und es ist mir sehr wahrscheinlich, dass ihr eine
Beitrage zur Kenntnis der Gymnophionen. 701
$upinatiou der Bogen vorhergeht, da diese bei Selachiern eben- falls ganz i~hnliche Lageverhnderungen durchmachen wie die beiden ersten Bogen der Gymnophionen.
Es ware sicher mOglich, dutch experimentelle Eingriffe auch bei Amphibien nachzuweisen, ob eine Drehung s t a t t f i n d e t . - Auf diese Frage werde ich spater zurfickkommen und mSchte hier in der Schilderuug der Schlundtaschenaalage weiter fort- fahren.
~'achdem die beiden ersten Schlundtaschen gebildet sind. tritt eine Pause in der Sehlundtaschenbildung ein. In Fig. 8 ist die erste Schlundtasche, in Fig. 9 die zweite eines Embryos mit 19 Segmenten dargestellt; erstere ist schon im Bereich des geschlossenen Darms, letztere nicht. Der Embryo erhebt sich von der Unterlage und der Darm schliesst sich in craniocaudaler Richtung. Die Schlundtaschen sind bei diesem Prozess vSllig unbeteiligL ein Beweis, dass sie durch lokale st~rkere Zell- teilung (P e t e r), nicht durch eine Faltenbildung (His) zustande gekommen sind. Das Entoderm zeigt sich kaudal noeh weit often und hat demgem~tss einen langgestreckten geraden Verlauf: cranialwarts gelange~ wir an eine Stelle, ~tie sich deutlich absetzt. Es kommt zu einer Knickung des Entoderms (Fig. 9), wobei der Winkel zwischen den Entodermschenkeln immer spitzer wird. Wenn diese Abknickung erfolgt ist, kam] durch einseitiges Waehstum des auf dem Dotter liegenden Entoderms der mittlere schon gew61bte Darmabschnitt zum geschlossenen Darmrohr werden. Daf~ir spricht auch, dass man haufig Mitosen im Dotterentoderm fin~det. Dieser Prozess der Faltung und Abschniirung des Darmes k0nnte auch das urs~tchliche Moment ffir die Erhebung des Embryos sein. Denn gerade, dass die Schlundtaschen garnicht yon diesem Faltungsprozess beeintiusst werden, spricht f~ir eine gewisse Starre inuerhalb des Zellverbandes des Entoderms, dessert Zellen auch wie in einem Gew01be gelagert sind. Die Seitenplattea und das Ektoderm scheinen mir viel weniger starre Verb~nde zu sein, die sich den Formen des Entoderms anschmiegen.
,Erst nachdem di~ GehSrgruben sich fast geschlossen haben, beginnen neue Darmfalten sich zu bilden und damit neue Bogen, die eigentlichen Kiemenbogen, sich anzulegen. W~hrend die .~nlage der beiden ersten ziemlich langsam erfol~e, treten die Kiemenbogen rasch nacheinander auf; tier Embryo der Fig. 13a zeigt den ersten, der in Fig.-14 dargestellte den zweiten, weiter nach einer kleinen Pause tritt tier dritte und aUerdings im
46*
702 H a r r y M a r c u s :
Oberfl~chenbild wenig scharf abgesetzt auch der vierte hervor. Die Gestalt der vier Bogen ist die gleiche, schlank, zylindrisch, mit ihren ventralen Enden n~hern sie sich einander, sie sind im Vergleich mit den ersten beiden Bogen etwas tiefer gelagert und hinten dutch eine bogenfSrmig yon der GehSrgegend zum Perikardialsack herabziehende Leiste begrenzt, welche auf alteren Stadien wieder verschwindet. Die weitere Umbildung der Kiemenbogen ist ~usserlich wenig zu verfolgen, man sieht nur, dass sie zentralwarts sich einkr~immen und einander entgegenwachsen."
Wie wir sehen, hat B r a u e r im Gegensatz zu S a r a s i n . die nur fiinf Schlundtaschen angeben, sechs gesehen. Die drit te Schlundtasche fand ich zuerst bei einem Embryo vom Stadium 12
/ i f i / L
I, ,' / / I '-.~/ \,,
.~
Fig. A. Fig. B. Fig. C.
mit 29 ~e~,menten angelegt. Fig. 6 zeigt die erste, Fig. 10 die Hyoid-, Fig. 11 die dritto Schlundtasche yon diesem Embryo. Letztere wird also erst nach Schluss des Darmes angelegt. Die i n l a ge der vierten Schlundtasche sehen wir auf dem Horizontal- schnitt, Textfigur A, Stadium 18. Auch sehen wir hier sehr deuttich eine ektodermale Tasche. In Textfigur B, Stadium 25, hat die ffinfte Tasche das Ektoderm erreicht, wahrend wir die erste Anlage der sechsten erblicken. Auch bei dieser Tasche verhalt sich das Ektoderm nicht ganz passiv, wie wir aus Text- figur C~ Stadium 30, ersehen.
Beitrgge zur Kenntnis tier Gymnophionen. 703
Diese sechste Tasche bricht eben noch durch. Es wird zwar keine klaffende Spalte sichtbar, aber die Zellen sind in den EpithelYerband des Kiemenbogens eingetreten, sodass die Trennung offenbar, wenn auch nur auf kurze Zeit, stattfindet iFig. 17, Stadium 39). Auf der Figur 16 sehen wir endlich iloch die siebente Schlundtasche nur auf der einen Seite angelegt, da es kein ganz exakter Horizontalschnitt ist. Diese entodermale Tasche kommt nicht mehr in Bert~hrung mit dem Ektoderm. sondern bildet sich um zum ultimobranchialen KSrper, dessert Entwicklung wir spater verfolgen werden. Dass es in der Tat
Fig. D.
eme Schlundspalte ist, kaun kein Zweifel sein, denn sie kommt konstant vor und zeigt die gleichen Eigenschaften wie die t~brigen Taschen.
Eit~ D u r c h b r u c h d e r S c h l u n d t a s c h e n erfolgt bei den ersten sechs. Ein Spritzloch ist also geraume Zeit geOffnet, wie Br au e r schon hervorgehoben hat. Bei der sechsten Tasche tritt eine sehr enge u der beiden Blatter start, die Epithelien des Ektoderms gehen in die des Entoderms in zwei Reihen tlber, und wenn man auch einen deutlichen Spalt nicht beobachten kann, muss ich doch auf Grund eines Praparates vom Stadium 39, alas auf Fig. 17 dargestellt ist, annehmen, das.s sie vort~bergehend doch zum Durchbruch kommt.
Das Spritzloch bricht ungef'~hr w~,~hrend der Stadien 24--35 dutch. Es fiaden mancherlei Schwankungen hierbei start. Die ()ffnung ist im dorsalen Tell der Mandibulartasche (Textfig. D, Stadium 25).
704 H a r r y M a r c u s :
Bemerkenswert ftir die Gymnophionen und charakteristiscb ftir ihr primitives Verhalten ist also ersteas die Bildung eine~ Spritzloches und zweitens die ZahI der Schluudtaschen, die sieben betragt, wahrend bisher nur fiinf bis sechs bei ihnen, sowie den ~ibrigen Amphibien beschrieben wurden.
Die Gefasse des Kopfes wird Herr Prof. Tan d le r (Wieu). bearbeiten; ich beschr~mke reich hier daher nut auf das ftir die Kiemen notwendigste.
Besonders interessant und wichtig ist die Tatsache. dass eia deutlicher zweiter Aortenbogen i~ den Hyoidbogen ziel~t.
Fig. E.
In Fig. 12, Stadium 17, sieht man die drei ersten Aortenbogen kaudal yon der zentralen Mesodermmasse verlaufen. Die ~'ierten Schlund- taschen sind noch nicht in Be- r~hrung gekommen. Auch bier sehen wit eine deutliche ekto- dermale Tasche.
Textfig. E ist durch graphische Rekonstruktioti aus acht Horizon tal- schnitten eines Mteren Embryos, Stadium 23, gewonnen. Hier sehen wir vier Aortenbogen aus- gebildet. Die Hyoidarterie ist frei- lich schwacher als die ~brigea Aortenbogen, aber doch deutlic5 nachweisbar. Der ftlnfte Kiemen- bogen ist noch nicht gebildet. Auf Fig. 17 sehen wit den vierten, f~nften und sechsten Aorteu- bogen. Durch die Schnittf[ihrung ist die zweite und dritte Kieme
abgetrennt. Es werden also sechs Aortenboget~ angelegt, ein Verh.alten, das wiederum die primitive Stellung der Gymnophionen bezeugt. Bei den ilbrigeli Amphibien soll der zweite Bogen nach, M a u r e r s Angaben fehlen. Dagegen wird yon M a r s h a l 1 und B I e s behauptet, class er zwar angelegt, aber sehr bald wieder rudi- mentar wird. Die Anlage dieses zweiten Aortenbogens ist auch ft~r die Frage nach der Abstammung der Columella yon Wichtigkeit.
Beitr~ge zur Kenntnis tier Gymnophionen. 705
Der Stapes wird yon einer Arterie durchbohrt. Gelingt es, die- selbe auf diesen zweiten Bogen zurttckzuftihren, so ist damit endgtiltig bewiesen, dass die Columella vom Hyoidbogen ihren Ursprung nimmt. Doch gelange ich hier auf Fragen, die ausser- halb des R~hmens meiner Arbeit liegen, und die dem Arbeits- gebiete des Herrn Tan d l e r angeh6ren. Ich beschranke reich daher auf diese etwas aphoristischen Mitteilungen t~ber die Gefasse.
Auf das Mesoderm der Visceralbogen kann in diesem Zu- s~mmenhang noch nicht eingegangen werden.
D i e E n t w i c k l u n g d e r K i e m e n .
Bis vor wenigen ,lahren herrschte eine fast einheitliche Auffassung in bezug der Kiemen: Die inneren Kiemen der Batracbier wurden frtther den Fischkiemen homologisiert, doch ist diese Auffassung wohl fast allgemein nach den Untersuchungen yon M a u r e r aufgegeben worden~ der ihre Abstammung ~-on der Hautkieme darlegte. Im Gegensatz zu den ,,]nneren" euto- dermalen Kiemen der Fische standen die ,,ausseren" der Am- phibien als ektodermale Bildungen (Ra t hk e). Und zwar sollten diese Hautkiemen der Amphibien einen ~euen Erwerb darstellen; sie sollten in gar keinem Zusammenhang mit den Darmkiemen der Fische stehen. Am sch~tri'sten vcrtrat wohl G eg e n b a u r und G o e t t e diese Auffassung. .Nun ist es ja yon vornherein nnwahrscheinlich, dass die Fischkieme v611ig zurttckgebildet werden sollte, um einer neuen vSllig analogen Bildung Platz zu machen.. Und dieser angenommene Dualismus tier Kiemen wurde noch unwahrscheinlicher als man Ubergangsformen land bei den Dipnoern. Die akzessorische Aussenldeme wurde nun der Amphibienkieme homologisiert, wahrend die innere Kieme einer entodermalen Fischkieme gleich gesetzt wurde (C l e m e n s und Wie d e r sh eim). Die Gegensatze waren auf ein Tier vereinigt, die Kluft zwischen Darmatmung der Fische und Hautatmung der Amphibien blieb bestehen. Diese zu tiberbrticken, gibt es zwei MSglichkeiten, die auch beide vertreten wurden : G o e t t e halt die Kieme der Gnathostomen fttr eine ektodermale Bildung; G r e i l die Amphibienkieme ftir entodermal.
Somit war die Homologie in der Anamnierreihe hergestellt, vollstandig yon G r e i l , der tiberall entodermale Kiemen beschrieb, unvollsthndig yon G o e t t e (1875, 1901). Denn dass Amphioxus
706 H a r r y ~ Ia rcus :
und Cyclostome Darmkiemen besitzen, steht fest. Bei Selachiern sollte nur die Spritzlochkieme der der Cyclostomen homolog sein, wlihrend Go e t t e ftir die tibrigen eine ektodermale Abkunft beschrieb. Bei Ganoiden und Teleostiern sind nach G o e t t e die Kiemen ebenfalls samtlich Hautkiemen. Die Befunde Go e t t e s bei Knochenfischen wurden yon Mo r o f f (02) bestatigt. Letzterer wandte sich jedoch gegen die Auffassung Go e t t es in bezug tier Spritzlochkieme tier Selachier, ftir deren ektodermale Ab- stammung er in einer zweiten Arbeit eintrat ( M o r o f f [04J). G r e i l (06) pflichtet M o r o f f bei, class bei Selachiern das Epithe! der Spritzlochkieme dieselbe Herkunft haben muss, wie das der tibrige~ Kiemen; flit ihn ist es aber ausser Zweifel, dass alle $elachierkiemen Darmkiemen sind (pag. 268). Wie kann G r e i l jedoch die el~todermale Natur der AmphibieHkieme vertreten. da diese sich nach aussea hin anlegt, wahrend die ,,Verschluss- membran" der Schlundtaschen noch erhaltea ist? G r e i l behauptet, dass die Entodermzellen yon den Seitea her sich ,a~ der Innenseite des Ektoderms vorschieben, wobei sie dessen Innenschicht verdrlingen. Die Entodermzellen kommen so un- mittelbar unter die Deckschichte des Ektodernis zu liegen ~. Wenn jetzt also der iiussere Teil des Kiemenbogens die Kiemen bildet, sind es Darmkiemen, denn die ektodermale Deckschicht ist sehr dtinn und kommt daher nicht in Betracht, die ektodermale Sinnes- schicht ist verdrangt, die eigentlichen Kiemenbildner sind die vorgeschobenen Entodermzellen.
Die gleiche Auffassur~g vertritt G r e i l fiir die Teleostier, sowie fttr Ceratodus.
Ehe wir unsere Befurlde mitteilen und zu dieser Streitfrage $tellung nehmen, mtissen wir erSrtern, ob diese Gegensatze auch t~ts~tchlich so schroff existieren. Dass die Frage, ob Haut-, ob Darmatmung vorliegt, von fundamentaler Bedeutung ist, dartiber kann kein Zweifel sein. Es handelt sich vielmehr um die Frage, ob die Zellen der beiden Keimblgttter nicht vSllig gleichwertig sind, wenn sie zum einheitlichen Epithel eines Kiemenbogens vereinigt sind? 0der anders ausgedrtickt: Besitzen die Epithel- zellen eines Kiemenbogens nicht gleichmassig die Fahigkeit zu Kiemen auszuwachsen, oder ist diese ,prospektive Potenz" nut de~l Zellen ektodermaler oder entodermaler Provenienz eigen?
Diese Fragen kann man aufwerfen; ihre Beantwortung wird
Beitr:~ige zur Kenntnis der Gymnophionen. 707
je nach der allgemeinen Auffassung jedes Einzelnen verschieden sein. Eine positive Entscheidung ist heute nicht m0glich.
Wit kSnnen nut konstatieren, dass wit keine Unterschiede i~l den einzelnen Epithelzellen nach ihrer Abstammung wahr- nehme~ k0nnen.
Ferner wissen wir durch experimentelle Eingriffe, dass die Zellen viele M0glichkeiten in sich tragen; ich erinnere nur a~ die Linsellregelleratioll V011 der Iris aus.
In der Tat findet bei der Kiemenbildung eine so pedantische Treunung in die Keimblatter nicht statt. So z. B schreibt C l e m e n s : ,,Was die Herkunft dieser sogenannten ausseren Kiemen anbelangt (bei Selachiern), so ist es ja von vornherein zweifellos, dass sie dieselbe ist, wie die der inneren Kiemen. Diese letzteren r~u~ werden allgemein it~r rein entodermale Bildungen gehalten -- nicht ganz mit Recht, wie ich sehe. Aus Praparaten geht zweifellos hervo5 dass auch das Ektoderm zum Epithel der periphersten Partien der Kiemenregion einen Beitrag liefert." (pag. 59). Ebenso mfissen bei der Amphibienkieme auch nach G r e i l s Auffassung einige Ektodermzellen beteiligt sein.
Um eineJl Einblick in die tatsachlichen Befunde zu gewinnen, habe ich einige Horizontalserien durch Selachierembryonen in Kiemet~bildm~g gemacht und ich muss gestehen, dass ich bei den ersten Anfangen mir nicht getraue mit Bestimmtheit zu sagen, die Anlage sei ektodermal oder entodermal, so sehr befindet sie sich an der Grenze. Spaterhin findet eine Prouationsbewegung des Bogens statt und dann entstehea Bilder, die sehr ffir die Anschauung Go e t t es und M o r o f f s sprechen.
So extrem und fundamental auch die Gegens~ttze Haut- und Darmatmung sind, so kann doch die Frage aufgeworfel~ werden, ob nicht die eine aus der anderen sich entwickelt haben kann. Denn die alte Auffassung, dass die Kiemen der Fische zugrunde geben und die Amphibien ihre Kiemen neu erwerben, ist nach den Arbeiten yon G o e t t ' e und M o r o f f und G r e i l zum mi~desten unwahrscheinlich. Ehe ich zu dieser Frage Stellung nehme~ will ich tiber meine B e f u n d e berichten. Die ausseren Kiemen bei Gymuophionen wurden von S a ras in zuerst beobachtet.
Eine eingehende Schilderung der ausseren Form gibt B r a u e r, den ich wiederum zitiere. Bei Ichtyophis sind die Kiemen sthrker entwickelt als bei Hypogeophis. Drei Paar Kiemen kommen zur
708 H ~ r r y M a r c u s :
Ausbildung. ,Die ersten zwei Kiemen erscheinen kurz nach- einander (Fig. 20), die dritte dagegen viel sp~ter (Fig. 34). Der Angabe der beiden Forscher (Sa ra s in ) , dass die Kiemen als direkte Verlangerung des Bogens anzusehen sind, kann ich nicht- beistimmen. Wie die Figg. 20, 22 zeigen, entstehen sie als knopf- f6rmige Wucherungen seitlich auf den Bogen. Die erste Kieme ist entsprechend der frtiheren Anlage etwas st~trker als die zweite (Figg. 22--26), indessen nut auf den ersten Stadien, sphter holt infolge rascheren Wachstums die zweite die erste nicht nur ein (Figg. 27--30), sondern es tritt sogar das umgekehrte Verhaltnis in bezug auf die Lhnge ein: die zweite wird die langste, die erste ist etwas k(irzer. AIs die grSsste L~tnge habe ich gefunden,..bei einem 4 cm lange~ Embryo ftir die zweite 7 mm und ffir die erste 5 ram. Die dritte Kieme entsteht~ wie schon erwahnt wurde, sehr viel sp~tter. Meist ist sie yon de~ beiden ersten bedeckt, so dass mall diese erst entfernen muss~ um sie zu erkennen. Sie entsteht auch als kleiner Aus~vuchs am dritten Kiemenbogen. Sie macht vouAnfang au einen rudiment~rel~ Eindruck, sie erfithrt nur eine sehr geringe Weiterentwicldung und selbst im Stadium der gr6sste~l Entwicldung fitllt sie im Gesamtbild weuig auf. Iu bezug auf die Ausbilduug der Form ist folgendes zu bemerken. Bei ihrer Anlage sind es kleine. knopff6rmige Anschwellunge)~, die zweite Kieme scheint durcb eine Furche in zwei geteilt, so dass man bei flfichtiger Betrachtuug" zu der Ansicht kommen kann, dass auch die dritte Kieme scho~ angelegt sei; die Furche schneidet indessen nur wenig tief ein und verstreicht friih wieder und die Oberfl~che erscheint dam1 gtatt wie die erstere."
Der Knoten, der die erste Entwicklungsstufe einer Kieme darstellt, kommt zur Anlage ehe die Schlundspalten durchgebrochel~ sin& Wir wollen, nun untersuchen, aus was fiir Zellel~ dieses itussere. Kiemenbogenepithel gebildet wird: sind es die ur- sprfinglichen Ektodermzellen oder sind diese von vorgeschobeneu Entodermzenen verdrangt ?
Zuvor muss ich einige Bemerkungen tiber die Formelemente machen. Die Zellen und Kerne bei Hypogeophis sind sehr gross. Sie sind mit Dottermaterial beladen, aber nicht in dem Mal3e wie bei den Anuren. Bei meinem Objekt sind die Zellgrenze,~ scharf sichtbar und die Zellverbande sehr klar und deutlich.
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 709
Dagegen hat G r e i l seine Beobachtungen an einem Material angestellt, bei dem der Darm ~ibermhssig mit Dotterpartikeln beladen ist. Nur durch Anwendung elektiver F~rbungen (z. B. Parakarmin-Bleu de Lyon) bestimmte er die Grenze zwischen den entodermalen und ektodermalen Zellschichten. G r e i l gelangt zu seiner Auffassung yon der entodermalen iNatur der Amphibien- kieme auf Grund folgender Beobachtungen: Er findet ursprilng- lich eiu Stadium, bei dem der Dotter gleichm~tssig in beiden Keim- blhttern verteilt ist; in einem hlteren Stadium weist das Ektoderm weniger Dotterk6rner auf.. Schliesslich finden sich am ausseren Kiemenbogenepithel wieder stark dotterhaltige Zellen. G r e i l schliesst daraus, dass die urspr~inglichen ektodermaleu Zellen yon den dotterreichen Darmzelten verdrangt seien. Als Stfitze ftlr seine Auffassung f(ihrt er noch einige Teilungsfiguren und die Pigmentverteilung an. Ich kann ihm hierin nicht folgen. An seinen tats~chlichen Befuuden kann kein Zweifel herrscheu ; diese zu deuten, will ich sparer versuchen 1) (siehe Seite 718).
Ich habe die entscheidenden Stadien der Kiemenentwiclduug bei Rana esculenta gerade zur Kontrolle dieser Streitfrage i~1 Horizontalserien zerlegt und muss gestehen, dass ich dort dasselbe fand wie bei Hypogeophis, freilich war es dort viel undeutlicher.
In dieser Frage muss das Hauptgewicht auf die Zell- verbande gelegt werden, denu der Dottergehalt kann ebensogut durch physiologische Vorg~mge innerhalb der Zelle modifiziert werden. Wit k6nnen aber mit absoluter Sicherheit eine Zelle als entodermale ansprechen, wenn sie noch deutlich im Entoderm- verband sich befiudet; dagegen ist es nur eine Wahrscheinlichkeits- annahme, aus dem Dottergehalt auf die Zugeh6rigkeit zum Darm zu schliessen.
Bei dieser Frage kommen ausschliesslich Horizontalschnitte in Betracht und ich beginne mit einem sehr jungen Embryo yon Hypogeophis rostratus. Wir sehen in Fig. 27 drei Schlundtaschen auf jeder Seite getroffen. Sowohl an der ersten wie auch der dritten Schlundtasche ist eine scharfe Trennung der beiden Blatter
~) Herr Kollege Greil und ich haben uns gegenseitig unsere Pr~parate gezeigt; dabei ~tusserten wir beide die Ansicht, dass die tatsachlichen Be- funde bei tier Entwicklung der Kiemen die gleichen w~ren sowohl bei Ceratodus wie bei s~mtlichen Amphibien. Uber die Deutung dieser iiberall im Prinzip gleichen Tatsachen konnten wir uns freilich nicht einigen.
710 H a r r y M a r c u s :
m(iglich, dagegen bei der zweiten Schlundtascl~e gehen die Zelleu des Entoderms in die des Ektoderms fiber. Dies Verhaltnis bleibt bis unmittelbar vor der Kiemenbildung und dem Durch- bruch der Spalten bestehen. Auf Fig. 18 ist der vierte und ftinfte Kiemenbogen yon einem Embryo des Stadium 22 dar- gestellt. Samtliche Kerne sind mittels der Camera lucida bei starker VergrSsserung eingetragen. Der dritte Bogen, der deutlich schon die Kiemenaulage zeigt, ist nicht mitgezeichnet, da es bier ,~usschliesslich auf den vierteu Bogen ankommt. Dieser zeigt nun ein ffir die uns hier beschaftigende Frage entscheidendes Verhalten, wie ich glaube. Denn kranialwarts gehen die Zellen des Entoderms in die des Ektoderms ohne jede Grenze fiber, wahrend an der kaudalen Seite die Entodermzellen noch absolut scharf dem Verbande des Darmes angeh0ren, ich muss hervor- heben, dass die Zeichnung die Wirklichkeit nicht tibertreibt, sondern dass die Trennung yon Ektoderm und Entoderm absolut sicher-eriblgen kann. Die Entwicklung erfolgt bekanntlich in kraniokaudaler Richtung; wir sehen aber auf der oralen Seite des Kiemenbogens e i n d e r kaudalen folgendes, alteres Stadium.
Und zwar muss die Weiterentwicklung'der kaudalen Seite so erfolgen~ dass der entodermale Verband aufgel(ist wird und die Zellen mit den Ektodermzellen in innige Beziehung treten, wie dies schon auf der kranialen Seite des Bogens der Fall ist. Ich glaube, diese Annahme ist zwingend. Dann aber muss das ttussere Epithel des Kiemenbogens ektodermal sein, denn die Annahme, dass vonde r kranialen Seite das Entoderm einseitig vorw~tchst und das Ektoderm verdrangt, ist wohl aus- geschlossen.
Bei unvoreingenommener Wfirdigung der Tatsachen muss notwendigerweise bei unserem Objekt das aussere Epithel, wo die Kiemen sich bilden, als ektodermal angesprochen werden. Das Verhalten, wie es Fig. 18 zeigt, wiederholt sich regelmassig bei jedem t~emenbogen und bei jedem Individuum (Fig. 27). In dem unmittelbar darauf folgenden Stadium kommt es zur Kiemenbildung und dem Durchbruch der Schlundspalten. Diesen letzteren Vorgang wollen wit nun beschreiben.
Bei der Verschmelzung der beiden Blurter kommen viele kieine Varianten vor, je nachdem das Entoderm sich zum Ektoderm lagert. Manchmal finden wir statt der geraden breiten ~r
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 711
dass das Darmepithel schief nach der einen oder der anderen 8eite sich vordr~tngt. Das Ektoderm ffillt dann die Liicken ein. So kommt es auch vor, dass es seitlich an dem Entoderm etwas herabreicht und so das Oval an der Innenseite des Kiemenbogen- epithels zur Vollendung bringt.
Bis zum Durchbruch verlaufen dann zwei Prozesse neben- einander. Einmal l~st sich der Keimschichtenverband; die Zellen des Ektoderms und Entoderms sind dann nut durch die gew~hn- lichen Zetlgrenzen getrennt und beeintiussen sich gegenseitig. da sie nun gemeinsam eine Einheit darstellen; und zweitens ordnen sich die Zellen an der Durchbruchsstelle, parallel zu dieser mit ihrer L~ngsachse sich richtend, an (Fig. 29).
Manchmal, glaube ich, war der erste Prozess noch nicht vollendet, als der zweite einsetzte. In Fig. 29 glaube ich noch die Zellen ihrem ursprtinglichen Verband zuordnen zu kSnnen. w~ihrend die Stelle, wo der Durchbruch erfolgen wird, schon sehr deutlich ist. Doch gebe ich gerne zu, dass hier ein subjektives Moment mit hineinspielt und dass ich vielleicht nut bei der Lagerung der Zellen eine Trennungslinie for die Keim- blhtter herauskonstruiert babe, die kurz vorher, es ist dasselbe Stadium 18, noch mit aller Bestimmtheit zu erkennen ist (Fig. 28). Van diesem eben geschilderten Haupttypus kommen, wie schon oben erw~thnt, kleine Abweichungen vor. Das Entoderm spaltet sich vorher und ragt dann wie zwei Keile in das Ektoderm (Fig. 12). Oder der Zwickel, der das Oval des Bogens beschliesst, ist yore Entoderm gebildet. Diesen Befund verwel:tet Gr e l l bei seiner Unterwachsungshypothese. Meiner Ansicht ist es nur eine der vielen Variantem wie zwei Gruppen yon Zellen sich bei ihrer Verschmelzung zu einem Verband lagern kSnnen.
Was den Durchbruch bei der Spaltenbildung betrifft, so ist mir der Vorgang mechanisch vSllig unerkl~rlich. Dass eil~ grober mechanischer Zug das Kausalmoment abgeben soll, ist, wie P e t e r schon angibt, ausgeschlossen. -- Ebensowenig wird eine ektodermale Lamelle wie ein Keil eingetrieben bei meinem Objekt. Bei Ceratodus und Anuren soll dieser nach G r e i l die Trennung bewirken. ,,Die Schlundtasche wird durch eine keil- fSrmig eindringende Ektodermfalte gewissermassen entzwei- geteilt" (pag. 468 [05]). Das mechanische Moment ist mir durch diese Komplikation ebensowenig verstandlich. Ich glaube, wir
712 H a r r y l~[ar cus :
haben einen bis jetzt unerklarlichen Vorgang vor uns, wie wir ihn hhufig finden. Als Analogie mSchte ich z.B. die Mesenchym- zellen yon Seeigeleiern anfiihren, die sich in bestimmte Gruppea anordnen und das Kalkskelett bilden. Auch hier kSnnen wir nicht einmal eine Vermutung, wie dies mechanisch geschieht, ausfindig machen. Ich halte es ffir richtiger, unsere Unkenntnis zu erklaren und dadurch die Probleme zu prazisieren, als mit Schweigen dar[iber hinwegzugehen.
Nachdem wir nun eine Beteiligung des Entoderms im Sinne r e i 1 s in der ausseren Kiemenbogenwand ausschliessen konnten,
wollen wir das Heranwachsen der Kieme betrachten. Wie wir schon oben sahen, schildert B r a u e r das erste
Auftreten der Kieme als eine knopffSrmige Anschwellung, die dutch eine F~u'che geteilt ist.
Wir sehen nun beim Horizontalschnitt, dass diese Furche dadureh entsteht, dass zuerst zwei Kn~tchen kranial und kaudal am Bogen- sich bilden. Es findet also nicht einfach eine Vor- wOlbung start, die welter zur Kieme auswachst, sondern es entwickeln sich prim~tr paarige Ausbuchtungen seitlich am Kiemen- bogen (Fig. 19), aus denen erst sekund~tr eine st~hchenf0rmige Kieme (Fig. 22) herauswachst. Ob dann die Kuppe der spatere~ Kieme nur einer dieser primaren Anlagen entspricht, wie es Figg. 21 und 22 wahrscheinlich machen, wage ich nicht mit Be- stimmtheit zu entscheiden. Diese Frage ist auch nicht welter yon Belang. Dagegen erscheint mir diese doppelte primare Kiemen- anlage yon Wichtigkeit zu sein.
Gr e l l hat (pag. 267, 06) ein Schema gegeben, in dem er die phylogenetische Umwandlung der Kiemen demonstrieren will. Er zeigt, wie das Kiemenseptum allm~hlich unterdr(ickt wird und leitet die stabfSrmige Tritonkieme yon tier paarigen des Polypterus und Chondrotus ab ,durch eine sehr weitgehende, totale Verschmelzung und nachherige Verlhngerung der dorsalsten Kiemenfaden". G r e l l selbst glaubte nicht auf eine Bestatigung durch die Entwicklungsgeschichte hoffen zu kOnnen und doch spielt sich ein Tell dieses phylogenetischen Prozesses in der Ontogenese wieder. Diese erste Kiemenanlage bei Gymnophionen entspricht einem primitiveren Zustand, wie er dauernd bei Polypterus angetroffen wird. Dass ich in bezug auf den Anteil, den die Keimbl~tter bei der Kiemenbildung nehmen, anderer
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 713
Ausicht als G r e i l bin, ist ftir diese Frage belanglos, da es sich hier um vergleichend-anatomische u handelt, ohne Rilck- sicht auf embryologische Entstehung.
Diese paarige primhre Kiemenanlage bildet sich besonders deutlich bei der zweiten Kieme aus, ist aber auch bei der ersten nachweisbar, wie ja auch dort die Furche am Oberflachen- bild zeitweilig zu erkennen ist. Die Kieme wachst dann in die Lhn~e und zw~r sowohl nach aussen als nach innen, was sehr klar aus dem Vergleich der Figg. 19 und 22 hervorgeht.
Das Mesoderm ist gleichm~tssig als ganz lockeres Gewebe im Innera des Bogens verteilt. Dieses kann sicherlich nicht das prim~tre Moment beim Wachstum darstellen, ebensowenig wie die Gefttsse.
Doch ehe wir welter die feineren histologischen Details bei dem Kiemenwachstum verfolgea, wollen wir unser Augenmerk auf eiuzelne KnStchen auf den beiden ersten Visceralbogen richten. B r a u e r beschreibt sie folgendermassen : ,Au~ser dea drei bespr0chenen Kiemen findet man noch kleine Bildungen an deu beiden ersten Visceralbogen, welehe meiner Ansicht nach nur als.Kiemenanlagell aufzufassen sind.. Zu derselben Zei L in welcher die Anh~age der defiaitiven Kiemen sichtbar werden (S. 20--25, 30), bemerkt man am hinteren Rande des Hyoid- bogens'und etwas sp;tter, ~mchdem das $pritzloch sich gebildet ha L auch an gleicher Stelle am Mandibularbogen einen kleinen Auswuchs. Derjenige des Kieferbogeas bleibt nur unbedeutend und verschwindet friih wieder, der andere dagegen wird so gross, dass er schon bei schwacher Vergr0sserung in die Augeu f~llt. Er wachst nach hinten etwas aus, lagert sich der Anlage der detinitiven Kieme eng an uud wahrscheinlich infolgedessen bildet sich zuweilen zwischen beiden eine schmale Brficke aus."
Eine solche Brticke ist in Fig. 13 ersichtlich. Ich vermute, sie ist dadurch entstanden, dass nach der Verschmelzung die erste Kieme sehr viel schneller gewachsen ist, als die rudiment~re Hyoidbogenkieme. Dass es sich tats~tchlich um eine Kiemen- bildung handelt, daf[ir spricht, wie B r a u e r schon hervorhob, Zeit and Ort der Anlage. Und nach dem histologischen Befund muss ich seine u bestatigen. Es handelt sich, wie Fig. 23 zeigt; beim Hyoidbogen um eine Aussttilpung des Epithels, in die sowohl das Mesoderm, a l s auch ein Gefassast hineinreicht.
714 H a r r y ~ a r c u s :
An der Kiemennatur dieses Auswuchses kann man hiernach, glaube ich, nicht zweifeln. Sehr bald werden die Zellen dieser rudiment~tren Kieme blasig und entwickeln sich nicht weiter. Doch bleiben sie, wie ich glaube, noch lunge erhalten: lii nger als das Oberflachenbild es vermuten l~isst. 1)er Hyoidbogen whchst namlich ungleichmassig und zwar so, dass in der Aussen- seite die ektodermalen Zellen sich stark vermehren. Wenn alas Ektoderm nun stationar bleibt, muss eine Verschiebu~lg des ganzen Bogens stattfinden, die sich in einer Supinationsbewegung ausdrticken wird. Wenn nun der itussere Kieme~lstummel an
r " O" den beiden ersten ~Isceralb%en verschwunden ist. time ich konstant eine tranenfSrmige Epithelperle an der Innenseite des Hyoid- sowie Mandibularbogens (Fig. 24). Dass es sich nicht um eine gewSbnlizhe Falte im Epithel handelt, geht aus dem Charakter der Zellen deutlich hervor. Die Zellen des Anhanges sind heller, konzentrisch angeordnet uM zeigen manchmal Vakuolen als Einlagerung. Wen n es auch bei dem geringen dabei beteiligte~ Zellmaterial nicht mSglich ist, mit absoluter Sicherheit diesen Anhang im Innern des Hyoidbogens yon der ausseren rudiment~tren Kieme abzuleiten, besonders da dieser Bogen wegen seiaer Schief- stellung sich so eng an die erste wahre Kieme driingt, so ist mir doch die Identitat dieser beiden Gebilde ausserst wahr- scheinlich. Ers tens herrscht eine zeitliche t)bereinstimmung. - - d a s innere Gebilde kommt stets zum Vorschem sowie das ~tussere verschwunden -- und dann zweitens findet tatsltchlich ein sehr viel starkeres Wachstum der ektodermalen Seite statt. wie es ja allbekannt ist bei der Kiemendeckelbildung yon Knochenfischen und Dipnoern. So stark ist das Heranwachsen in unserem Falle nicht, aber doch gentigend, um eine Verlagerung der , , ausseren" Kieme in eine " '~ ,~nnere zu bewirken.
Und hierin liegt die Bedeutung dieses Befundes. I)enn wir ersehe~ daraus, dass der Ort tier Anlage auch durch die Zeit bestimmt wird. Das heisst, die gleichen Zellen, die im Stadium 26 die ,,aussere ~ Kieme bilden, wtirden, weml die Anlage erst im Stadium 34 einsetzte, eine " " ,,inhere Kieme produzieren. Die weitere Ausftihrung dieser Gesichtspunkte gehOrt in den allgemeinen Tell.
Hier muss ich nur noch nachholend bemerken, dass der Unterschied in der Anlage der definitiven und der rudimentareu
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 715
Kiemen. der darin besteht, dass erstere auf der Seite, letztere dagegen am Hinterrande des Bogens entstehen, nicht ins Gewicht f'~llt. Denn die Bogen sind ganz anders orientiert, wie man auch aus Figg. 12 und 13, 16, 21, 24 ersehen kann. Das Mesoderm kenn uns die Richtung angeben, stellen wir dies in den beiden ersten Bogen parallel zu den Kiemen, so mfissen wir die beiden ersten Bogen pronieren u n d e s gelangt dann die Kiemenanlage genau in die Mitte seitlich wie bei den iibrigen Bogen.
Bemerkenswert ist die Analogie mit der Selachierkiemen- Anlage, die schon B r a u e r hervorgehoben hat. Bei den Selachiern sind die Kiemenbogen ebenfalls stark nach hinten gerichtet, sodass aus der verschiedenen Richtung der Bogen tier Unter- schied der Kiemenanlage yon Selachiern (unteu am Rand) und yon Amphibien (in der Mitte des Bogens) eine Erkl~rung finden kann.
Nachdem wir also die Existenz einer Spritzloch-, wie auch Kiemendeckelkieme, wenn auch in rudimentarem Zustand. kon- statieren konuten, kehren wir zu den definitiven Kiemen zuriick, deren weitere Entwickhmg wir zu verfolgen haben.
�9 Ich zitiere wiederum B r a u e r : ,,~Nachdem die Kiemen- anlagen auszuwachsen begonnen haben, treten in zwei paralleleu Langsreihen neue KnStctlen auf, welche die Anlagen der Fiedern tier Kiemen bezeichnen (S. 26--28, 30). Sie bilden sich dutch ,~llm'hhliches Auswachsen in schlauke Aste um, deren Enden abgerundet sind ($. 34--45). Am auswachsendeu Ende der Kiemen bilden sich successive neue, sodass die distalen die jtingsten, die proximalen d i e ~ltesten sind. Ihre Zahl variiert nicht nur bei verschiedenen Embryonen desselben Alters, sondern auch bei den Kiemen desselben Embryos, und sogar in den zwei L~tngsreihen derselben Kieme. Auch an der dritten Kieme treten Fiedern in derselben Weise als kleine Kn5tchen auf, doch bleiben sie wie der Schaft nut klein, und ihre Zahl bleibt nur gering; fiber vier habe ich nicht gefunden."
Nach dieser ersch0pfenden Darstellung B r ~ u e rs brauche ich nur noch wenige Bemerkungen zu machen, uud zwar fiber die Gefhsse und das Mesoderm und dann fiber das Wachstum der Kieme.
In die Kieme ftthrt eine ziemlich starke Arterie, die an der Kuppe umbiegt und in ein ungefahr ebenso machtiges, abfiihrendes Gefass ilbergeht. Von diesem Hauptstamm gehe~l
A r o h i v f. m i k r o s k . A n a t . Bd. 71. 47
716 H a r r y M a r c u s :
Nebenaste in die Kiemenfieder, die sich analog verhalten- Ausserdem gehen von diesen Stammgefassen feinere Aste ab, die als Kapillaren an der Peripherie der Kieme verlaufen; diese treten durch nicht fiberm~'~ssig zahlreiche Anastomosen miteinander in Verbindung. In dem peripheren Kapillarnetz verlaufen die BlutkSrperchen in e i n e r Reihe. Da das Kiemen- epithel aus sehr platten Zellen besteht, sind ~tusserst giinstige Bedingungen ftir den Gasaustausch vorhanden. Aus diesem morphologischen Befund muss man die Hauptfunktion der Kieme ohne Zweifel in der Respiration erblicken. Ob die Kiemen auch Resorptionsorgaue sind; wie die S a r a s i n es fiir Ichtyophis angeben, erscheint mir sehr zweifelhaft. Nach den S a r a s i n sollen die Kiemen zur Resorption yon Nghrstofl'en dienen, die das brfitendeWeibchen als Sekret ihrer Hautdriisen aussondert. Dass die Kiemen in der Eifl[issigkeit sich bin- und herbewegen, spricht ebensogut for ihre respiratorische Funktion. Dutch die Bewegung. wird dasselbe erzielt, wie bei anderen Formen durch eine Bewimperung, die hier fehlt. - - Auch alas Heranwachsen des Eies auf den doppelten Durchmesser sowie das vervierfachte Gewicht im Lauf tier Embryonalentwicklung beweist diese Hypothese nicht- Denn durch Wasseraufnahme, Dotterzersetzung und Respiration sind so komplizierte Vorgange gegeben, dass man ohne weiteres nichts aussagen kann. Zum Beweise ihrer Behauptung h~tte~l diese Forscher eine Whgung der Trockensubstanz vor und nach der Entwicklung machen mfissen, sowie eine Anal],se des eventuell getrockneten Driisensekrets des Muttertieres. Ich habe im Kiemenblut gesucht, ob ich eventuell durch die Fixation gef~tllte Nahrstoffe sehen k0nnte, doch land ich nichts der~rtiges. Dass so zarten Geweben, wie es die Kiemen sind, die F~higkeit zur Aufnahme yon gel0sten Stoffen zukommt, ist sehr verstandlich, aber ehe wir Resorptionsorgane in ihnen erblicken, muss die Existenz yon Nahrstoffen in der Eiflilssigkeit nachgewiesen sein. Ihrer morpho!ogischen Struktur nach scheinen sie nut typische Respirationsorgane zu sein.
Das Mesoderm in den Kiemen bilde~ ein zartes, lockeres Gewebe, alas desto sparlicher ist, je welter die Kieme heran- w~tchst. Auf dem HShepunkt ihrer Entwicklung ist es fast vSllig verschwunden. Dieses zeigt ein B!ick auf die Figg. 31 und 32, welche die ausserste Kuppe einer Kiemenspitze darstellen. In
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 717
Fig. 31 ist es die wachsende Kieme eines Embryos yore Stadium 41 ; in Fig. 32 hat die Kieme ihren H0hepunkt der Entwicklung erreicht (Stadium 48). Im ersten Fall sehen wir lockeres, mesenchymatSses Gewebe zwischen der Gefassschlinge, das beim alteren Stadium verschwunden ist. Beide Zeichnungen sind nach gef~rbten Totalpraparaten gemacht, an denen man ~le Verh~tltnisse sehr deutlich sehen kann. Wir beobachten also, wie die roll ausgebildete Kieme ausschliesslich aus Blutr~umen und dtlnuem Plattenepithel besteht, also fiir die Respiration ~usserst gfiustige Formverhhltnisse.
Wenn wir nun auf das Kiemenepithel eingehen, so haben wir eine bemerkenswerte Tatsache zu registrieren, die uns ffir das Verst~tndnis des Wachstums der Kieme yon Wichtigkeit erscheint.
In der roll ausgewachseneu Kieme, wie sie Fig. 32 zeigt, sehen wir ein sehr plattes, einschiehtiges Epithel ganz gleich- massig die Kieme begrenzen. H0chstens erblieken wir an ein- zelneu Spitzen den ,Schatten" eines Kernes; wie er in Fig. 32 zwischen dem ausseren Epithel und dem Gefitss sichtbar ist. Solange dagegen die Kieme im Wachstum begriffen ist, finder man ganz regelm~tssig auf der Kuppe jeder Kiemenfieder eine dunkle, halbmondf5rmige Kappe unter dem Epithel (Fig. 30). Diese Kappe ist im gefitrbten Praparat durch dieht aneinander gelagerte Kerne vorget~uscht, wie man sich dureh starkere Ver- grSsserung leicht iiberzeugt. In Fig. 31 ist eine solche wachsende Kieme vom Stadium 41 dargestellt. Uber der Gef~ssschlinge und unter dem EpitheL erblicken wit eine Reihe yon dicht neben- einander gepressten Kernen. Ihre L'angsachsen treffen verl~tngert alle in einem Punkt zusammen. Ein Zellleib ist seitlich bei der eageu Lagerung der Kerne kaum vorhanden; er muss an die beiden Enden der Zelle in der L~ngsachse des Kerns ausgewichen sein. Wenn wir uun bedenken, dass diese Zellenkappe stets und ausschliesslich bei der wachsenden Kiemenspitze sich findet, so wird es nicht zu gewagt erscheinen, wenn wir diesem gew0lbe- artigen Komplex dichtgedrhngter Zellen eine Expansionsfhhigkeit zuschreiben, die ihren Ausdruek im Lhngenwachstum der Kieme findet. Wir erblicken also nicht im Mesoderm oder in den Gefassen, sondern in dieser ,Wachstumskuppe" des Epithels das kausale morphologische Moment zum Kiemenwachstum. Diese
47*
718 H a r r y Mar c~us:
Verh~Itnisse scheinen ganz allgemein giiltige zu sein, denn G o e t t e schildert die erste Kiemenentwicklung als eine Epithel- falte ohne Gefassbeteiligung sowohl bei Selachiern als Teleostiern.
Woher stammt nun diese .,Wachstumskuppe"? Sie ist tier letzte Rest der sog. Sinnesschicht des Ektoderms, die in jungen E~twicklungsstadien der Kieme dieselbe gleichm~tssig (iberdeckt; dort wo eine Kiemenknospe entsteht, sehen wir diese Sinnesschicht starker ausgebildet, zweischichtig, die Kerne dicht nebeneinander liegend (Fig. 30). Sind s~mtliche Fiedern entstanden, finden wit diese Zellen nur jeweils an der Spitze jeder wacbsenden Kieme und wenn diese den H6hepunkt ihrer Entwicklung erreicht hat, treffen wir hSchstens vereinzelte Kernschatten (Fig. 32).
Das Auswachsen tier Kiemenfieder ist sehr unregelmassig und daher die' yon B ra u e r hervorgehobene Inkonstanz der Zahl teicht erldarlich. Ein Blick auf Fig. 30 gen~igt, um sich davon zu tiberzeugen. Da ist z. B. die vierte Fieder. links yon der Spitze aus ~gerechnet , ganz unverhhltnism~ssig schwach, nur eine feinste-Capillare ffihrt in sie hinein. Aus diesem Befund kann man schliessen, dass die distalen Sprossen nicht immer die j~ingsten sein mtissen. Auf der entgegengesetzten Seite sieht man eine dicke Fieder, die nachtraglich in zwei geteilt wird. Uberall an den Spitzen bemerkt man das verdickte Epithel..
AIs Wachstumskuppe deute ich auch die dotterhaltigen Zellen am ausseren Rand des Kiemenbogens der Anureu, die Gr e l l als Entodermzellen anspricht. Wenn diese Zellen tat- sachlich das Wachstum der Kieme zu leisten haben, so ist eine Nahrungsaufnahme in Gestalt yon Dotter leicht einzusehen. W~thrend also im ~ibrigen Ektoderm das Dottermaterial verbraucht ist, nehmen nur diejenigen Ektodermzellen neuen Dotter in sich auf, die zur ,,Wachstumskuppe ~' gehSren.
Nachdem wir so die Entwicklung der Kiemen vertblgt haben, wollen wir die R a c k b il d u n g derselben betrachten. Es ist dies ein ausserst interessantes Gebiet, doch verbietet der Rahmen dieser Arbeit, sowie eine kleine Liicke im Material die detaillierte Ausfiihrung dieses Problems. B r a u e r hat gezeigt, wie yore Stadium 47 an die Kiemen wieder karzer werden: ,,Die Lhnge der zweiten Kieme betr~gt beim Embryo der Figur r welcher eine Lange von 6 cm hat, 6 mm, bei dem 6,5 cm langen Embryo der Fig. 49 4,5 mm. Die dritte Kieme wird zuerst rfiekgebildet,
Beitr~tge zur Kenntnis der Gymnophionen. 719
bei dem Embryo der Fig. 49, welcher die zwei ersten Kiemen noch stark entwickelt zeigt, war yon der dritten Kieme keine Spur mehr zu finden. Wenn ich auch nicht die allerletzten Stadien der Rfickbildung tier Kiemen erhalten habe, so glaube ich doch, dass kein Zweifel aufkommen kann, dass die Reste nicht abgeworfen (wie die Sa r a s i n angegeben hattea), sondern successive resorbiert werden." Diese Annahme B r a u e r s kann ich wiederum durch den histologisehen Befund bestgtigen.
Es sind die jOngsten distalen Kiemenfiedern, die zuerst die regressive Metamorphose eingehen. Die frtiher so sehlanken
zarten Fiedern werden zu knolligen,
~ unregelmassigen, derben Auswtichsen einer vom Figur F zeigt die Umrisse der Spitze
,~ solcheu Kieme Stadium 49. Wahrend die proximalen Fiedern kaum
\\ ~/I eine Vergmderung zeigen (sie sind nicht
I mitgezeichnet), sehen wir an der Spitze statt der eleganten zierlichen Fiedern ganz verkrtippelte, derbe, durch die Verktirzung dic'ht aneinander gelagerte Knoten und knollige Stabe.
~(usserst interessant sind die cyto- I logischen Veranderungen bei dieser
Rtickbildung. Die ursprtinglich so platten, lang-
gestreckten Epithelzellen sind blasig aufgetrieben und weisen einen grossen Kern bei machtigem Protoplasmaleib Fig. F. auf (Fig. 32). Offenbar existiert eine
itussere formgebende Schicht, welche dutch ihre Starre die glatte Oberflache der Kiemenfieder bewirkt. Ist diese Lamelle nun bei der regressiven Metamorphose zerst0rt, so wird die Zelle die einer Fliissigkeit entspreehende Gestalt annehmen: sie wird mit ihrer freien Oberfiache sich der Kugelform nahern. Diese aussere Grenzschicht scheint bei dem Kiemenepithel yon Ascidienlarven und zum Teil auch von Cyclostomen zu fehlen, wie ich gelegent- lich beobachten koante. In diesen Fallen sah ich die Begrenzung als eine Wellenlinie. Diese Zellen waren also nur an der proxi- malen Wand dureh eine starre Lamelle zu einem Epithel vereinigt,
720 H a r r y M a r c u s :
wogegen das distale Ende der Zelle eine Kuppelform zeigte. Zur Veranschaulichung kSnnte man vielleicht die MaiskSrner am Maiskolben als Vergleich anftihren. Ausser diesen grossen blasigen Epithelzellen in der aussersten Spitze finden wir dort ausser dem Detritus zerfallener Zellen und zerbrSckelter Kerne ein System yon Blutlakunen. In diesen findeu sich die Blut- k0rperchen in allen Stadien der Degeneration. Bei der Verk~irzung der Kieme muss der Blutkreislauf natiirlich ununterbrochen yon statten gehen; die Hauptgefasse dilrfen nicht arrodiert werden. Dies wird dadurch bewerkstelligt, dass proximal yon der Umbiege- stelle des Gefasses eine Anastomose sich bildet. Ist diese zu- stande gekommen, so wachsen seitlich Zellen der Wand gegen die Mitte hin zu und schliessen so das distale Kiemenende yon der Blutzufuhr ab; die eingeschlossenen Gefasse und Blutelemente gehen dana zu Grunde, wie es Fig. 33 zeigt.
In dem Stadium der Rfickbildung yon Figm' F i s t die Degeneration so weit fortgeschritten, dass man die Formelemente gar nicht mehr erkennen kann. Dunkle Massea wechseln mit helleren, k6rnigen ab, letzte Stadien der KernzerstSrung kann man wahrnehmen (Fig. 3,1). Fettartige Substanzen scheinen beim Zerfall gebildet worden zu sein. Naher kann ich hier auf diese Prozesse nicht eingehen; nur eines ist absolut sicher: Die Kiemen werden aicht abgestreift, sondern resorbiert.
Wit hatten nun die ~usseren Kiemen von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende verfolgt. Bei Hypogeophis schliesst das Spiraculum sehr fr~hzeitig. Dagegen haben die S a r a s i n bei Ichtyophis ,,innere:' Kiemen bescbrieben und ,,neigen trotz mancher Bedenken zu der Ansieht, dass diese an den Knorpelbogen sitzenden Fltigelchen als Rudimente echter innerer Fischkiemen aufzufassen seien" (pag. 236). Da diese Forscher wie damals allgemein die Fischkieme ftir entodermal hielten, setzten sie die inneren Ichtyophiskiemen in einen schroffen Gegensatz zu den ttusseren. Gegen ihre Auffassung wandte sich C l e m e n s (94), der diese inneren Kiemen den Kiemenplatten der Salamander- larven gleichsetzte, nur dass sie nie ein Kiemendeckel bedecke. Diesem Forscher muss ich reich anschliessen. Ich halte es aus- geschlossen, dass nachtraglich sich noch entodermale Kiemen bilden. u glaube ich, dass diese inneren Kiemen durch
Beitri~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 721
seitliehe Sprossung aus den ursprtinglichen ausseren Kiemen entstehen. Eine solche seitliche Wucherung konnte ich bei einem i~lteren Embryo vom Stadium 49, dessert aussere Kiemen in Rtiek- bildung begriffen waren, beobaehten (Fig. G). Ich halte dies fiir ein Rudiment einer inneren Kieme. Beweisen kann ieh das nattirlieh nieht, doch liesse sieh bei Ichtyophis die Entstehung der inneren Kieme sieher leicht feststellen.
Fig. G.
Wir wollen nun die Umwandlung der siebenten Schlund- tasche in den
u l t i m o b r a n c h i a l e n K 0 r p e r verfolgen.
v. B e m m e 1 e n hat als erster dieses Gebitde bei Selachiern entdeckt und Suprapericardial-KOrper benannt und ftir ein Produkt der letzten siebenten Schlundtasche erklart. Diese Bezeichnung wurde yon M a u r e r in ,postbranchialer KSrper ~ umgeandert, da die topographischen Bezeichnungen bei Amphibien und Amnioten so verandert sind, dass der ursprtingliche Name nicht mehr an- gewandt werden konnte. M a u r e r h~tt dies Gehilde fiir ein hinter tier Schlundspaltenregion auftretendes selbstandiges Organ. Dass in diesen K6rpern Colloid gefunden wird [Maurer bei Echidna; L iv in i [02] bei Salamandra), bestarkt ihn in seiner Auffassung, class es kein Schlundspaltenderivat sei. G r e i l (05) hat die alte Auffassung van B e m m el ens wieder sich angeeignet und auf Grund yon Plattenmodellen, wie ich glaube einwandsfrei nach- gewiesen, wie aus der sechsten Schlundtasche, der tetzten, der anuren Amphibien die ,ultimobranchialen ~ K0rper hervorgehen.
722 H a r r y M a r c u s :
Bei Ceratodus leitet G r e i l (06) diesen K(irper you der siebenten Schlundtasche ab. Ktirzlich hat H. R a b l (07) die Ansicht v. B e m m e l e n - G r e i l bei VOgeln bestatigt. Hier ist es eben- falls die letzte Schlundtasche. die sechste, welche den ultimo- branchialen K(irper bildet.
Bei ttypogeophis sahen wir oben. dass die sechste Schlund- tasche eben noch durchbrach, dass dagegen die siebente das Ektoderm nicht mehr erreichte (Stadium 34). In einem spi'tteren Stadium 36 sehen wir die Taschen zu beiden Seiten des Larynx medialw~rts verlaufen (Fig. H). Sie wachsen dann zu einem immer langeren Schlauch aus. trennen sich yore Mutterboden ab
Fig. H.
und zerfalleu schliesslich in kleine Blascheu. So gewiunen sie t~tsachlich e i n d e r Thyreoidea ahnliches Aussehen. besonders da im Inneren der Blaschen eine Sekretmasse sich vorfindet, die vielleicht Colloid ist. Ich babe die dafttr typischen Reaktiouen nicht angesteIlt, well mir die Serien daftir zu kostbar erschienen. Denn wenn diese ultimobranchialen K0rper auch tatsfichlich die gleiche Funktion wie die Thyreoidea besitzen, so ist ftir die Homologisierung nichts gewonnen. Diese analoge Funktion scheint nicht allgemein gfiltig zu sein und ist dieselbe bei diesem winzigen K6rperchen wohl kaum yon Belang. Die ~i.hnlichkeit mit der Thyreoidea scheint mir vielmehr auf eine Gesetzmassigkeit hin- zu~veisen, dass gr0ssere epitheliale Schlauche und Hohlkugeln bei wachsendem Alter in kleinere Blaschen zerfallen, wie ich es bei der Thyreoidea, der Paraphyse und den ultimobranchialen K0rpern bei meinem Objekt beobachten konnte.
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 723
Ich traf die ultimobranchialen K0rper konstant und stets pa~trig an, auch bei ganz alten ausgewachsenen Individuen. Dass sie aus der siebenten und nicht der sechsten Schlundtasche ent- stehen, kann ich mit Sicherheit behaupten, denn ich habe die ~erien daraufhin sehr genau untersucht und dann vor diesen ultimobranchialen K0rpern die sechste Schlundtasche nachweisen k~nnen.
Die sechste Schlundtasche scheint vOllig riickgebildet zu werden.
Dadurch, dass bei Gymnophionen die siebente Tasctm zu dell ultimobranchialen KSrpern wird, wird wiederum ihre primi- tive Steliung dokumentiert, denn sie stehen in einer Reihe mit dell Selachiern und dem Ceratodus und im Gegensatz zu dell tibrigen Amphibien, bei denen diese KSrper aus der sechsten Tasche entstehen.
Ob hinter dell ultimobranchialen KSrpern noch Rudimente yon Schlundtaschen auge[egt werden, erscheint mir denkbar, doch m0chte ich es nicht wagen, einige Schleimhautfalten, die ich beobachtete, als achte Schhmdtasche zu deuten.
In diesem Zusammenhang wollen wit auch die
L u n g e n a n l a g e
kurz skizzieren, da ja bekanntlich G o e t t e und darauf Spe n g e l, dieser freilich ohne eigene Untersuchungen, die Lungen als $chlundtaschenderivate auffasst.
G o e t t e (75) hatte ursprtinglich gesagt, die Lungen ent- sttindeu aus hinteren Kiementaschen, spater prazisierte er (05) seine Angabe und behauptete, die Lunge der Amphibien ent- spreche dem sechsten Schlundtaschenpaare yon Petromyzon. Gegen diese Behauptung im speziellen, sowie gegen die Theorie im all- gemeinen wandte sich G r e i l (05). Er wies eine sechste Schlund- tasche nach und ihre Umbildung zu den ultimobranchialen K0rpern : damit war die spezielle Behauptung G o e t t e s widerlegt. Damit ist der Hypothese nattirlich kein Abbruch getan, wie O pp el schon hervorhob, da die Lungen ja aus den achten oder neunten Schlundtaschenpaaren gebildet sein k0nnen. Gegen die Hypothese der branchialen Natur der Lunge bringt G r e i l folgende Tat- sachen noch heran : Die Lungenanlagen haben eine andere Stellung als die Schlundtaschen: sie treten vor der Anlage der vierten und
724 H a r r y M a r c u s :
ffinften Schlundtasche auf, und drittens die Intervalle zwische~ der sechsten Schluudtasche und der Lungenanlage sind bedeutend gr0sser, als zwischen je zwei Schlundtaschell. Diese Grfinde, einzeln betrachtet, halte ich nicht ffir stichhaltig; denn die frtihere Anlage einer Tasche, die ein wichtiges Organ zu bilden ~iber- nommen hat, ist sehr wahrscheinlich. Dass der Abstand der Lungen grSsser ist als die Intervalle zwischen den Schlundtaschen, erklart sich leicht aus dem Ausfall yon Taschen. Wie wit sahen, haben wir bei Gymnophionen eine siebente Tasche, die bei den Anuren ausgefallen ist . Die topographische Lagerung ist schliess- lich auch nicht yon so fundamentaler Bedeutung, denn die ultimobranchialen KSrper sind ebenfalls sp~ter anders zum Darm
J
Figuren J und K.
orientiert. Ich glaube, dass durch keinen dieser Momente die Hypothese Go e t t e s widerlegt sei. Freilich durch die Summierung dieser kleinen Abweichungen wird der Charakter der Lungen- anlage ein von den Schlundtaschen etwas verschiedener, und wenn man dann im Auge behalt, zu was alles die Schlundtaschen haben herhalten mfissen, so ist eine gewisse Skepsis sicherlich angebracht.
Die erste Lungenanlage tritt bei Hypogeophis nicht ~iber- massig frfihzeitig auf. Wir finden sie zuerst im Stadium 22, in dem schon die fiinfte Schlundtasche angelegt ist. Die Lungen- anlage zeigt nichts bemerkenswertes. Wir treffeu zwei seitliche Aussackungen ventral am Darm: die ,Lungenrinnen ~'. Diese schnfiren sich spater kaudalw~trts ab und zwar als unpaarer Schlauch, der sich spaterhin gabelt. Bei diesem Prozess spielt
b
Beitr~tge zur Kenntnis der Gymnophionen. 725
die Kaenogenese eine grosse l~olle. Die linke Lunge ist namlich bei Gymnophionen rudimentar. 1)
Nun sehen wir in der Ontogenese sehr sch6n den Einfluss dieses sicherlich sekundaren Verhaltens darin sich ausdrtlcken, dass man oft statt tier paarigen Aussackungen nur eine rechts- seitige Lungenanlage antrifft (Fig. J). Auf tier linken Seite ist eine deutliche Lungenrinne bei diesem Embryo yore Stadium 22 nicht nachweisbar. Sehr schwach ist sie auch bei einem Individuum yore Stadium 23 ausgepragt, yon dem Fig. K drei Querschnitts- bilder zeigt (der Abstand yon a zu b ist 30 t~; yon b zu c 20 t0. aus denen hervorgeht, dass die rechte Lunge auch zeitlich un- geheuer im Vorsprung ist.
Das typischere Bild gibt Fig. L (Stadium 22) wieder. Die erste Anlage ist gleichmassig pa-arig, gleich nach der Abschntirung
60 !e ~ b 30 ,, Fig. L.
(b) h0rt die linke Anlage auf und nur die rechte setzt sich kaudalw~rts fort (c). Der Abstand zwischen Schnitt a und b betragt 60 t*, der zwischen b und c 30 ,ee. Diese rechte Lungen- anlage setzt sich noch filr 70 t~ weiter fort. Auf spater6n Stadien sehen wir dann aueh die linke Lungenanlage (Fig. M). Die drei
(2 C
Figur 1~I.
~) In Gegenbaur (Vergleichende Anatomie, Bd. II~ S. 302) ist rechts und links vertauscht.
726 H a r r y Marcus :
Zeichnungen illustrieren die Verhaltnisse bei einem Embryo yore Stadium 26.
In a sehen wir im Gebiet der sechsten Schlundtasche die ventrale Aussttilpung, die sich zur Trachea (b) abschntirt und kaudalwarts in die beiden Lungensacke sich teilt. Der linke ist kleiner und bedeutend k0rzer als der rechte. Histologische Differenzierungen des Darmepithels haben noch nicht stattgefunden. Der Abstand yon a zu b betragt 375 t~, yon b zu c 210 tL.
Diese kurzen Angaben mSgen hier gentigen, da die aus- fiihrliche Lungenentwicklung besser mit dem Darm abgehandelt wird.
Hier wollte ich nur die Daten der ersten Anlage geben. um zu sehen, ob durch die Befunde bei Gymnophionen die Frage nach' tier phylogenetischen Entstehung tier Lunge geklart werden kSnnte. G r e i l hatte, wie oben erw~ihnt, die Ansicht Go e t t e s widerlegt, dass die Lungen aus der sechsten Schlund- tasche bei Amphibien hervorgehen. Vorher hatte Goe t t e jedoch ,,bei ~eunaugen beschrieben und durch Abbildungen illustriert, dass bei ganz jungen Ammocoeten auf .beiden Seiten eine Ausbuchtung der letzten (achten) [!] Kiementasche anfangs frei ill das CSlom hineinragt, andererseits mit dem Anfang der Speiser0hre breit zusammenh~ngt, also durchaus mit der jungen Lungenanlage der Amphibien tibereinstimmt und ihr im allge- meinen homolog erscheint. Allerdings gingen die beiderlei Befunde darin auseinander, dass im erste,i Fall (Amphibien) eine sechste Darmkiementasche, im anderen Fall (Neunaugen) bloss eine Aus- sackung der achten Tasche als Vorl~ufer der Lunge erscheint." Dieser letztere Satz erscheint nach meinen Befunden tiberfltissi~'. Wir sahen bei Hypogeophis sieben deutliche Schlundtaschenpaare, also wtirde auch bei diesen primitiven Amphibien die Lunge aus der achtea Schlundtasche hervorgehen. Wir h~ttten somit eine vollsti~ndige Homologie auch in bezug der Zahl der Kiemen- taschen. Der gr0ssere Abstand der Lungenanlage yon der sechsten letzten Kiementasche bei Anuren wird durch den Ausfall der siebenten Kiementasche leicht verst~tndlich.
Von entwicklungsgeschichtlicher Seite kann nunmehr tier Hypothese G o e t t e s kaum Abbruch geschehen. Freilich werden die Befunde bei Ceratodus dagegen angefiihrt. Wie ich glaube
Beitrgge zur Kenntnis der Gymnophionen. 727
mit Unrecht. Die Lunge yon Ceratodus wird als unpaare Aus- stiilpung ventral am Darm schrltg yon links nach rechts hin verlaufend angelegt (N e u m a y e r [04], K e I I i c o t [05], Gr e i l [06]). Dieser schrage Verlauf der Anlage kann, wie aus G r e il s Abbildung F (Seite 130) hervorgeht, sicher nicht durch grob- mechanische Ursachen (z. B. Leber) erkli~rt werden. HOchstens kSnnte als Moment der Schiefstellung der Anlage die zu- kiinftige Wanderung der Lunge auf die Dovsalseite herangezogen werden.
Viel plausibeler erscheint mir fotgende Deutung der Tat- sachem Ich erinnere an meine Figuren J und K. Dort sahen wir bei Hypogeophis ebenfalis eine rechtsseitige Lungenanlage, die ihre Erklarung in der schwachen Entwicklung der linken Lunge beiGymnophionen ungezwungen land. Das Gleiche tritt, meiner Ansicht nach, bei Ceratodus ein. Freilich findet hier keine paarige prim~tre Lungenanlage start, da die Ontogenie caenogenetisch zu sehr abgehndert, d. h. abgektirzt ist. Abet ein Rudiment einer linken Lunge ist deutlich vorhanden. Ich zitiere N e u m a y e r (pag. 407): ,ein Rudiment eines linken (sekundaren Lungenganges) k0nnte in del: nach links gelegenen Aussackung des zu einer kleinen Ampulle erweiterten primitiven Lungenganges gesehen werden." Durch die Liebenswfirdigkeit des Herrn KoUegen ~ N e u m a y e r konnte ich mich an seinem ~[odell yon diesem ansehnlichen Gebilde fiberzeugen. Ich z(igere daher nicht, es ausznsprechen: D ie C e r a t o d u s l u n g e i s t n u r d e r r e c h t e n L u n g e h o m o l o g . $ i e i s t s e k u n d a r u n p a a r , d a d u r c h , c lass d i e l i n k e L u n g e rudiment~i r g e w o r d e n i s t. Diesen Rtickbildungsprozess der linken Lunge k5nnen wir in alien Stadien bei Gymnophionen verfolgen. ,Bei Ichtyophis, Siphonops und Coecilia ist die linke Lunge nur wenige Millimeter; die rechte dagegen 6 ~ 8 cm fang; bei Siphonops in- distinctus ist die rechte Lunge 10 cm und bei Coecilia lumbricoides gar 23 cm lang." (Wiede r she im, pag. 84 [79]). Bei Ceratodus ist dieser Rtickbildungsprozess der Lunge noch welter fort- geschritten. Sie ist beim erwachsenen Tier fiberhaupt ver- schwunden. Nur in der Ontogenie lltsst sich eine bald vergang- fiche linke Lunge nachweisen. --
Ftir diese meine Auffassung sprechen auch die Verhaltnisse bei Protopterus, der bekanntlich paarige, dorsal vom Darm gelegene
728 H a r r y M a r c u s :
Lunge besitzt, die sich vorn zu einem gemeinsamen Abschnitt vereinigen, der ventral in den Vorderdarm mtindet. Im Gegen- satz zu G e g e n b a u r (01).[pag. 267] und N e u m a y e r halte ich diese Verhhltnisse ftir primitiver als die beim Ceratodus. Denn erstens ist bei Protopterus noch die ventrale Einmtindungstelle vorhanden, wie sie N e u m a y e r ja zuerst als primitive Lungen- anlage bei Ceratodus geschildert hat, die sekundar dorsalwarts verlagert wird. Zweitens hat Protopterus noch paarige Lungen, wahrend Ceratodus nur vortibergehend ein Rudiment einer linken Lunge zeigt. Protopterus ist also weniger modifiziert als Ceratodus. Beide jedoch weisen, wie G e g en b a u r schon hervorgehoben hat, keinen primitiven Zustand auf wegen des Verhalten des Luftganges, d. h. der dorsalen Verlagerung der Lunge.
Die Befunde bei Dipnoern sind also, wie wir gesehen haben, sehr wohl mit der Hypothese Go e t t e s yon tier branchialen Natur der Lunge in Einklang zu bringen, da wir eine urspriinglich paar~ge, ~ventrale Lungenanlage annehmen dtirfen. Die Entwick- lungSgeschichte yon Protopterus wird hier wohl Aufschluss geben k0nnen.
D ie T h y r e o i d e a .
Auch dieses Organ wurde yon Kiementaschen abgeleitet und zwar sollte es eine zwischen der ersten und zweiten gelegenen Kiementaschenpaar sein, das median vereinigt, die Thyreoidea bilden sollte (Dohrn). Diese Hypothese hat sich als unhaltbar erwiesen und bleibt es trotz der Befunde S t o c k a r d s bei Bdellostoma, der den husfall yon zwei Kiementaschen vorne beschreibt.
Zuerst ist die Thyreoidea bei Gymnophionen yon L ey d i g (53) gefunden worden bei Coecilia annulata. ~,Die Thyreoidea ist stark stecknadelkopfgross, liegt hinter dem hinteren Zungenbeinhorn an den die Lunge versorgenden Blutgefiissen, und wie sie schon dem freien Auge ein k0rniges Aussehen darbietet, so zeigt sie sich auch mikroskopisch aus geschlossenen Blasen bestehend in einem gemeinsamen Bindegewebsstratum ~' (pag. 63).
Dieses Organ hat W i e d e r s h e i m (79) in der Monographie kurz erwlthnt und abgebildet. Er sagt nur, die Glandula thyreoidea sei ,,aus zahlreichen kleinen Blaschen komponiert"
Beitriige zur Kenntnis der Gymnophionen. 729
und ihre Lage sei am u des Musc. Levator arcuum branchiale. ~,Bei Siphonops annulatus liegt dieses Organ genau an der Kreuzungsstelle des Hypoglossus mit dem Vagus" (pag. 69).
Die erste Anlage der Thyreoidea ist sehr frfihzeitig schon im Stadium 1'4 erkennbar. Wie [iberall~ finden wit auch bei Hypogeophis eine unpaare ventrale Anlage am Vorderdarm fiber dem Herzen. Die Textfigur N m0ge dies Verhalten illustrieren. Es ist ein nicht ganz medialer Sagittalschnitt dutch einen Embryo
. / ( ' , 7"
/ . , ; ::-k:.(,';,.Y~:~,-'../. , / i ':~:~;..;~*,'~,,~.~:,,.'.,::: ,.
_ . ~ . . . ; - ' : ~ - : ~ ~ / , ~ ' : ~ : ~ , ~ : ~ _ 2 ~ ' ~ ~.-,,-..
Fig. lg.
oa S , ~ J
Fig. O.
vom Stadium 17. Man sieht die Ausbuchtung der Thyreoidea- anlage an der ventralen Darmwand. Es entspricht diese Lage auf dem Querschnitt der Teilungsstelle des Truncus arter. Die ventrale Darmw~nd ist fiberall gleich stark. An der kranialen Umschlagstelle ist sie dagegen stark verdickt. Es ist dies der ,praeor~le Darm", die dorsale Wand ist dagegen sehr schmal. Die Chorda endigt spitz aus. Im Rtickenmark ist eine gewisse Segmentation erkennbar. Die Hypophysenanlage ist sehr deutlich. Unter der Thyreoidea ist das Herz, an dem schon zwei Schichten
730 H a r r y M a r c u s :
als Endo- und Myocard getrennt werden k0nnen. Um das Herz herum sehen wir das Pericard.
Die Thyreoidea w~chst als hohler Schlauch nach hinte~ (Textfig. 0). W~hrend bei den fibrigen Amphibieu eine solide Thyreoideaanlage besteht (de M e u r o n [86], M a u r e r L sehen wir bei Hypogeophis sehr lange eine Lichtung (Fig. 35. Stadium 22). Freilieh die Mtesteu Untersucher, W. Mtil ler (71) und G o e t t e (75), geben aueh ftir Frosch und Unke eine hohle Anlage an. Ein direkt kompaktes solides Gebilde wird die Thyreoidea beiHypo- geophis hie, wenn aueh in sp~teren Stadien nur ein Spalt oder auch nur die Kernanordnung auf die urspr~ingliche R6hrenform hinweist. Eine histologische Differenzierung findet erst ~p~ter statt. Die Zellen werden da,m blasig aufgetriebe,1. Die Thyreoidea w~ehst verh~itnism~ssig schwach. Im Stadium 22 sehen wir (auf der Fig. 35), dass die Muskeln sich heraus zu differenzieren beginnen. Ftir die Thyreoidea sind sie, sowie die Bildung des Zungenbeins wegen der Lageverschiebung yon Bedeutung. Dem~ wenn der K6rper des Zungenbeins sich aulegt, wird die Thyreoidea zwischen diesem massigen Vorknorpelgewebe und dem Musculus mylohyoideus eingepresst. Dieses zeigt Fig~r 36, Stadium 3t;. Zwei Schnitte weiter kaudalw~rts stosseu wir auf eine paarige Thyreoidea, w~hrend sie or~hv~rts immer weniger abgeplattet erscheint. Dass es sich um eiue sekund~re Teilung, bedingt durch ~ussere meehanische Momente, handelL erscheiut mir sehr wahrscheinlich, da das rapide Wachstum des Zungenbeines einen Druek ausfibt, der sich auch in der Hervorw61bung des Darmepithels dokumentiert. Nach D o h r n (86) soll die paarige Amphibien-Thyreoidea for eine primhr paarige Anlage aus zwei Kiementaschen sprechen. Naehdem die Thyreoidea einmal paarig geworden ist, wandert sie seitlich und naeh oben. Wir k6nnen sie in allen diesen Perioden verfolgen; zwischeu den beidet~ Thyreoidea ist der Mylohyoideus eingeschaltet und man bekommt unwillk~irlich den Eindruck, dass durch dessen Wachstum die beiden Thyreoidea auseinander geschoben werden. Deun auch beim erwachsenen Tier liegen diese Gebilde auf dem oberen Rand dieses Muskels, wie aus der Figur 37 und der Abbildung vol~ W i e d e r s h e i m (76), Taf. VII, hervorgeht. Figur 37 ist yon einem 7 cm langen Tier, das jedoch in dieser Beziehung genau (lie gleiche Topographie aufweist wie ein erwachsenes Tier yon
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 731
25 cm Lange. Letzteres habe ich, um Platz zu sparell, nicht zur Zeichnung gew~thlt, da schon Figur 37 mit dem Sucher- objektiv a 2 gezeichnet werden musste. Die VerknScherung ist beim ausgewachsenen Tier nati~rlich eine ungemein viel st~rkere.
Wir sehen die Thyreoidea also in Fig. 37 in ihrer definitiven Lage zu beiden Seiten des Darmes, etwas dorsaler als dessert seitlicher Rand. Bis an sie heran reicht yon unten der Mylohyoideus, nach aussen hin ist sie vom Iutermaxillaris bedeckt. Ventral und etwas medial unter dem Darm sehen wir den Knorpel des Hyoids. In der Mitte unter dem Darm dell Larynx mit seinen Knorpeln. Das Him ist durch den Schnitt in der Rautengrube getroffen. Seitlich sehen wir das GehSr- organ, unter welchem der Vagus heraustritt. Nachdem er sein Ganglion'gebildet hat, verl~uft er nach einem scharfen Knie ab- warts zur Thyreoidea zu. Ferner ist auf dem Schnitt jederseits eine der vier Thymusknoten getroffen, auf die wir spater zuriick- kommen werden. Bei dem ausgewachsenen Tier yon 25 cm Lange konnte ich die Thyreoidea auf 50 Schnitten verfolgen, was bei einer Schnittdicke yon 15 p ftir das Organ 0,75 mm ausmacht. Bei dem 7 cm langen Tier, auf welches'sich die Zeichnung be- zieht, mal~ ich sie mit 0,3 mm. Diese Mal~e gelten jedoch nut ffir fixiertes und eingebettetes Material.
Die histologische Differenzierung zeigt nichts Bemerkens- wertes. Es bilden sich Komplexe von Bl~schen, nachdem die Zellen ein blasiges Aussehen bekommen haben. Innerhalb dieser Blasen wird Colloid abgesondert. Bei Pikrokarmin- oder Delafield- H~'tmatoxylin- und Eosin-Doppelfftrbung leuchtet das Colloid grell heraus.
Bei einem abnormen Embryo traf ich einmal eine paarige Thyroidea-Anlage. In Fig. 14 sehen wir. wie ventral am Darm tiber dem Herzen, gerade an der Gabehmg der horten, zwei Ausbuchtungen erfolgen. Einige Schnitte welter kaudal sehen wit die beiden hnlagen als abgeschnfirte Rohre unter dem Darm liegen (Fig. 15). Es ist durch den Querschnitt der kaudale Tell der GehOranlage getroffen; auf beiden Abbildungen sehen wir durcb die schiefe Schnittffihrung alternierend die zweite Schlund- spalte. Es handelt sich um einen Embryo vom Stadium 20, der auch sonst manche Missbildungen zeigt, z.B. eine grosse Cyste links anstatt der Urniere und ganz hinten eine unvollstandige
/krchiv f. mik rosk . A n a t . Bd. 71. 4 8
732 H a r r y M a r c u s :
Spina bifida. Im Vorderdarmgebiete fand ich jedoch keine weitere Abnormit~t als die paarige Thyreoidea. Dass es sich bei der beschriebenen Anomalie um eine prim~re paarige Thyreoidea- Anlage handelt, kann keinem Zweifel unterliegen. Ich habe meine samtlichen Praparate daraufhin durchgemustert, habe aber keinen weiteren Fall gefunden. Es ist also sicher eine Aaomalie. Man k0nnte diese ~[issbildung als Atavismus auffassen und im Sinne D o h r n s fiir eine paarige Kiementaschen-Abstammung verwerten. Ich halte es ft~r wahrscheinlicher, dass hier ein Fall vorliegt, der in analoger Weise wie bei der Spina bifida zu einer Verdoppelung eines primer unpaaren Organs ffihrt:
Whhrend man im letzteren Fall eine Anomalie der Gastru- lation als Ursache kennt, ist be i der Thyreoidea eine solche Ursache nic~t ersichtlich.
Ob es sich um Spaltung der primSren Anlage oder um vereitelte Verschmelzung urspr~inglich paariger Anlagen im Sinne der Concrescenztheorie handelt, mSge dahin gestellt bleiben.
Seit W. M ~ i l l e r (73) ist man gewohnt, die Thyreoidea mit der Hypobranchialrinne des Amphioxus und dem Endostyl der Tunikaten zu homologisieren. D o h r~ vertrat dann be- sonders diese Auffassung und baute sie noch welter aus, indem er die ,,Thyreoidea" des Ammocoetes yon einer Schlundtasche zwischea der Mandibular- und Hyoidspalte ableitete. Diese letztere Auffassung erwies sich als unhaltbar. Die erste Hypothese stfitzt sich haupts[~chlich auf die Verh~dtnisse bei Ammocoetes. Dort entsteht das Endostyl aus einer unpaaren Ausstt'flpung des Vorderdarms. Es steht im weiten Zusammenhang mit dem Darm. Geisselzellen am Grunde der Rinne weisen auf die fortbewegende Funktior~ dieses Organs hin. Ausserdem wurde seitens Ca lb e r i a eine Schleimsekretion angenommen und kiirzlich yon G o e t t e (0 I) best~tigt. Somit w~tre es eine Drt~se und leichter mit der Thyreoidea der fibrigen Wirbeltiere zu vergleichen, wahrend die Geisselzellen und die Schleimsekretion die Ableitung vom Endo- styl der Tunikaten sicherten. Die Angaben yon C a l b e r l a sind ausserst d~irftige. E r hat Farbstofffi~tterungen gemact~t und dann einen gefarbten Schleimfaden sich bewegen sehen. D,~s ist ebensowenig ein Beweis ft~r die Schleimsekretion der Thyreoidea, wie die Notiz yon G o e t t e, dass junge Ammocoeten sich yon Protozoen nahren, die sie, in Schleimballeu umhfillen. Nach
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 733
neuen Untersuchungen yon R e n a u t und P o l i c a r d (05) kommt dem Gebitde ausschliesslich eine motorisehe Funktion zu. Es seien keine Drtisenzellen vorhanden, was daffir angesprochen ~vurde, sei Artefakt durch schlechte Fixation bedingt, in Wahrheit waren es Geschmacks- oder Geftihlsknospen. Es ist mir vSllig unverst~tndlich, wie aus dieser Rinne mit stark differenzierten Zellen die typische bl;tschenf0rmige Thyreoidea der erwachsenen Petromyzonten hervorgehen kann, ohne dass erstere zu Grunde gehen.
Auch D o h r n, der ja Amphioxus und Tunikaten yon den Cyclostomen ableitet, schreibt in Studie VIII, pag. 74: ,,Und dann mSge man bedenken, wie viel Wahrscheinlichkeit fiir die Behauptung bestehe, die Hypobranchialrinne, diese hOchst spezialisierte Einrichtung des Tunikaten-Organismus, habe sich in dem Amphioxus fortgesetzt, sei bei Cyclostomen im Ammo- coetes-Stadium noch vorhanden und werde in der Thyreoidea der hOheren Tiere noch heute aufbewahrt!"
Wenn also die Doppelfunktion des Endostyls der Ammo- coeten nicht besteht, so bleibt for die ttqmologie der Thyreoidea resp. Endostyl in der Chordatenreihe so gut wie nichts bestehen. Denn die Lagebeziehungen und die Art des Wachstums sind so wenig t~bereinstimmend, dass daraufhin G o 1 d s c h m i d t vor der Homologie warnt.
,,In der Entwicklung des Amphioxus treffen wir ja das Endostyl zuerst als einen Flimmerdrt~senstreifen, der der rechten Darmwand angeh0rt und sich hier yon der Ventral- zur Dorsal- seite erstreckt. Den gleichen Zustand fanden wir bei Amphioxides vor, wo wir auch das Verstandnis ftlr diese Anordnung in Beziehung zur seitlichen Lage des Mundes und der Sonderung einer dorsalen Pars nutritoria des Darmes finden konnten. Von einem derartigen Endostyl k6nnen wir aber die Thyreoidea der Cyclostomen nur schlecht ableiten. Und bedenken wir weiterhin die Umbildung dieses Streifens zur Hypobranchialrinne des Amphioxus. Die Rinne ist durch den ventral zwischen den beiden Kiemenspaltreihen frei bleibenden Raum gegeben, und in diesem wachst dann der Dr0senstreifen nach hinten aus. Auch bei den Tunikaten entsteht das Endostyl als ein senkrecht stehender Drfisenstreifen, der erst nachtraglich seine ventrale Lage erlangt und nach hinten w~chst" (pag. 77).
48*
734 H a r r y M a r c u s :
Also sind 1. die topographischen und morphologischen Verhaltnisse
der Entstehung und des Wachstums sehr verschiedene bei Tunikaten, Amphioxus und Cyclostomen andererseits.
2. Die physiologische Bedeutung des fraglichen Gebildes scheint bei Tunikaten, Amphioxus und Cyclostomen grundverschieden zu sein.
Bei Tunikaten sondert das Endostyl Schleim ab, mit dem die bTahl-ung eingehtillt und festgehalten wird; die im Schleimfaden eingeballten Tierchen werden durch Flimmerbewegung dorsal zum verdauenden Darm fort- geschafft (Fol u. a.).
Beim Amphioxus ist die Hypobranchialrinne offenbar ebenso wie die Epibranchialrinne der verdauende Darm- abschnitt.
Beim Ammocoetes soil nach neuesten Angaben tiber- haupt kein Schleim produziert werden. Die als Drtisen- zellen angesprochenen Gebilde sollen sensoriellen Charakters sein ( R e n a u t und P o l i c a r d ) .
Beim erwachsenen Petromyzon sowie dell tibrigen Cranioten finden wir die typische blitschenfSrmige Thyreoidea mit ihrem Colloidsekret.
�9 q. Sowohl in morphologischer wie in physiologischer Hin- sicht ist zwischen dem Organ des Ammocoetes und des erwachsenen Petromyzon ein so gewaltiger Unterschied, dass ein direkter T3bergang schwer verstandlich ist.
Die spariichen diesbeztiglichen Angaben W. Mii 11 e rs machen eine erneute Untersuchung bei Petromyzo!l sehr erwfinscht, denn auch wenn die definitive Thyreoidea des Petromyzon sich yon dem fl'aglichen Gebilde des Ammocoetes ableiten l~tsst, so muss die histologische Umwandlung sehr interessant sein.
D ie T h y m u s .
Auch dieses Organ ~hat L e y d i g (53) als erster bei Gym- nophionen und zwar ebenfalls bei demselben Exemplar yon Qoecilia annulata beschrieben und abgebildet. ,,Die Thymus erscheint nach Wegnahme der ausseren Haut im Nacken an derselben Stelle, wo sie bei allen vorausgegangenen BatrachiertL
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 735
ruhte, hinter und ober dem Unterkieferwinkel. Sie ist dann noch umhtillt yon einer etwas pigmentierten Bindegewebsschicht, welche auch die zunachst gelegenen Muskelgruppen ~iberzieht. Die Drfise war braun-gelblich und bestand aus vier hintereinander liegemen Blasen, mit kSrniger Masse geftillt, die in der Mitte jedes Follikels intensiv gelb gefarbt war." (pag. 63.)
Auch tiber die histologischen wichtigsten Daten der Thymus gibt dieser geniale Forscher vollkommen richtigen Aufschluss ~md trotz der gewaltigeu Literatur nnd den technischen Hilfs- mitteln sind wit in tiber 50 Jahren nicht um vieles welter gekommen.
Nachdem L ey d i g nttmlich die dicht gedr~lngten kleinen Thymuszelleu beschrieben hat~ sagt er pag. 63: ,,Zwischen diesen die Hauptmasse darstellenden KSrpern waren andere, wenn auch ~veit minder zahlreich eingestreute Gebilde, Welche meist gr6sser als die vorhergehenden, um ein helles Zentrum Schichten einer klaren Substanz hatten." Es sind dies unzweifelhaft die sogenannten H a s s a 11 schen K6rperchen.
(Eiuige l~'orscher halten es aus formalen Grt~nden fiir unstatthaft, diese Bezeichnung auch auf-die morphologisch etwas abweichenden Degenerationsprodukte der Fische und Amphibien anzuwenden. Aber da Ubergange tier morphologischen Struktur vorhandeu sind und die Gebilde bei allen Formen wesensgleich sind, finde ich es praktischer, den Begriff , H a s s a t t s c h e K6rper" umfassender zu verstehen, sodass auch die einzelligeu Gebilde mit gr0ssem meist hyalinem Protoplasma und oft einer kon- zentrischen Schichtung darin eingeschlossen werden. Dass diese iutrazetlulare Schichtung mit der dutch umlagernde Zetlen be- dingteu bei den ,,echten" H a s s a 11 schen K6rpern nichts gemein- sames hat ist wohi selbstverstandlich.)
Wi e d e r s h e i m (79) geht in seiner Monographie nur auf die Topographie und Zahl der Thymusknoten ein. Sie liegen in einer Art yon Bucht zwischen dem Musculus Omo-humero- maxillaris und dem Levator arcuum branchialium. ,,Die Gestalt tier Thymus wechselt bei den verschiedenen Gattungen und Ar t ende r Gymnophionen sehr bedeutend. So stellt sie z.B. bei Epicrium (---Ichtyophis) eine einzige grosse, an ihren Randern sehr stark gelappte Masse dar. Bei Coecilia lumbricoides wird sie - - ebenso wie bei unserer Hypogeophis - - durch vier ziem-
736 H a r r y M a r c u s :
lich gleichm',tssig gestaltete Kugeln reprasentiert. Bei Siphonops annulatus besteht sie aus ftinfbis sieben grt}sseren oder kleinere~l birnf6rmigen Lhppchen " (pug. 68). Bei ttypogeophis konnte ich nachweisen, dass die vier Thymuskaoten aus den Thymus- knospen der zweiten bis ftinften Schlundtasche abzuleiten sind, die also dauernd selbstandig bleiben. Dies ist natiirlich das primitive Verhalten, wahrend bei Ichtyophis die Vereinigung der Thymuskn0spea ein sekundares Verhalten ist. Es ware interessant~ zu untersuchen, ob die fiinf bis sieben Lappchen yon Siphonops yon ftinf bis sieben Schlundtaschen abzuleiten w~tren. Ich halte dies fiir ~usserst unwahrscheinlich, vielmehr wird es sich um eine Parzellierung der ursprtinglichen vier Knospen handelu. Dies ist mir um so wahrscheinlicher, als ich 5fters eine Furche in einer der vier Thymusknoten beobachten konnte, die durch~ geftihrt die eine Kugel ill zwei geteilt h~tte. Es wtirde also Coecilia und HvPogeophis in bezug auf die Thymus alas primitivste Verhalten zeigen~ wahrend Ichtvophis und Siphonops in zwei divergenten Richtungen abgeleitet w~tren. Diese Aufl'assung wird durch die Angabe yon B o 1 a u bestatigt, tier bei Siphouops aunu- latus vier Thymuspakete beschreibt und ~lf einem Holzschnitt abbildet.
Bei der O r g a n o g e n i e der Thymus kann ich reich kurz fassen. An jeder dorsalen Wand tier entodermalen Schlundtasche ordnen sich die Zellen halbkreisf6rmig an. Dieser Buckel ist die erste Anlage der Thymus. Sp~tter w/~lbt sich die Ausbuchtung immer mehr, bis ein Hohlbl~tschen entsteht, das noch geraume Zeit mit dem Darmepithel im Zusammenhang bleibt (bis zum Stadium 39/40), wt~hrend die erste Anlage schon sehr bald nach Durch- bruch tier Schlundtaschen erfolgte. Wahrend dieser langen Zeit wachsen die Thvmusknospen also fast gar nicht. Die Abschniirung yon richtigen Thymusknospen findet nur an der zweiten bis fiinften Schlundtasche statt, an der ersten und sechsten finder lokale Zellwucherung schon statt, aber diese entwickelt sich nicht weiter, sondern die Zellen werden bald blasig und diese Rudi- mente werden dann bald zurtick gebildet. Ahnliches beobachtete d e M e u r o n (86) bei Acanthias vulgaris : la cinqui~me fente ne pr~sente qu'un simple 6paississement de son ~pithelium; cet ~paississement s'arr~te bient6t et n'aboutit pus h la s~paration de la partie ~paissie. In Fig. 26 habe ich eine solche rudiment~tre
Beitri~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 737
Thymusanlage der. sechsten Schlundtasche gezeichnet. Sehr gut sieht man bier auch die ektodermale Tasche. Ebenso verhalt sich die Thymusanlage bei der ersten Tasche. Es werden also sechs Thymusanlagen an den sechs ersten Schlundtaschen gebildet, die erste und letzte bleiben ru.dimentar und werden rasch riick- gebildet, die "tier mittleren dagegen entwickeln sich welter und bleiben dauernd voneinander getrennt und selbstandig. Sie wandern nach oben und oralwhrts. In letzterer Beziehung also entgegengesetzt wie die Thyreoidea, die, wie wit oben sahen. freilich auch dorsal ~om Darm zu tiegen kommt, abet die kaudal- warts verlagert ist, so dass auf e in e m QuerschnitL wie l;ig. 42 zeigt, Thymus wie Thyreoidea sehliesslieh zusammen getroffen werden. Durch ihre Verlagerung und ihr Wachstum n~thern sich die ei~zeli~en Thymusknoten so sear, dass sie sich beri~hren und nur durch ihre bindegewebige Htille voneinander getrennt sind. Wenu man die Haut yon einem Mediaschnitt aus abw~rts pra- pariert, sieht man sie wie vier aufgereihte weisse Perlen sich yon den oben bezeichneten Muskeln abheben.
Wenn ich auf die H i s t o g e n es e dieses Organs nun ein- gehe, so muss ich weite~" ausgreifen und auf rein cytologische Probleme eingehen. Den Grundgedanken habe ich schon beim Anatomenkongress in Wtirzburg ausgeftihrt und ich verweise da- her auf die Verhandlungen (07). Hier muss ich die damaligen Behauptungen mit Abbildungen belegen. Wiederholungeu werden sich dabei nicht vermeiden lassen. Ieh werde den Lebenslauf einer Thymuszelle schiidern. NatOrlich ist die Reihenfolge der Stadien nur durch das Alter resp. die Ausbildung der Embryonen gegeben. Denn man kann eine Thymuszelle nicht wie ein lebendes Protozoon in seinen Entwicklungsphasen unter dem Mikroskop verfolgen. Daher kann der ,Lebenslauf" meiner Thymuszelle keinen Anspruch auf absolute Exaktheit machen, aber ich glaube, dass meine Ableitung, da in Harmonie mit der zeitlichen Folge, sich ungezwungen als tatsachlich bestehend ergeben wird.
Zuerst will ich als ~Jberblick eine kurze Schilderung der Veranderungen in der Thymus geben. Im Stadium 39 10sen sich die Thymusblaschen yon der Darmwand los und werden bald zu kompakten Gebilden, die rasch heranwachsen und zwar so lunge his die larvale Entwicklung dauert, also bis zum Verlust der Kiemen im Stadium 50. Bis zu dieser Zeit (oder bis kurz vor-
738 H a r r y M a r c u s :
her; individuelle Verschiedenheiten kommen vor) finden wir nut ei n e Art Thymuszellen und zwar sind dieselben mit zunehmendem Alter immer kleiner geworden. Dabei hat das Plasma in viel starkerem Hal~e abgenommen als die Kerne. Wenn Hypogeophis rostratus das Spiraculum schliesst, ist es etwa 7 cm lang. Bei jungen Tieren yon 9--12 cm findet man das typische Bild der Thymus: grosse Zellen mit dunklen und hellen Kernen; kleine ,lymphoYde" Zellel~ und H a s s a I I sche K0rper in starkster Aus- bildung.
Einzelne Thymusknoten dieses Stadiums zeigen ausserst zahtreiche mehr oder minder pathologische Mitosen und Kern- zerfallsbilder und gerade in diesen sind erst verhaltnismassig sparliche grosse ,,epitheloYde" Zellea sowie tt a s s a l 1 sche KSrper. Die Chromosoinen haben ganz bestimmte Veranderungen im Laufe der Entwicklung gemacht, wie ein Blick auf Tar. L, Fig. 61--65 zeigt, sie sind ktirzer, breiter und plumper geworden.
Bei ausgewachseneren Tieren yon 17--25 cm Lhnge finder man die Thymus noch prall mit ,,lymphoYden ~' Zellen erftillt, daneben die ,epithelo~den ~' Zellen und wenige H a s s a l l s c h e KOrper. Noch ist keine Vaskularisation eing'etreten. Eine Ein- wanderung oder Auswandemng yon Zellen findet nicht statt, dean wenn eine solche in nennenswerter Weise erfolgte, k6nnte sie mir bei ltickenlosen Serien durch den Kopf in allen Stadie~ nicht entgangen sein, da ich eifrig danach gesucht habe. Bei sehr dicken Individuen yon 25 cm, die ich als die altesten be- trachte, fanden sich kaum H a s s al 1 sche K5rper, die grossen Zelleu waren ebenfalls erst nach langem Suchen hier und da zu finden, die kleinen ,lymphoYden ~ Zellen waren nicht mehr so dicht gedr~tngt wie bei jtingeren Individuen. Eine richtige Vaskularisation war auch hier nicht zu beobachten. Doch war die bindegewebige Htille verdickt und einzelne Ztige und mit ihnen kleine Gefasse zogen ins Innere. Der erste Charakter den ich bekam: war. dass ich nicht die Thymus: sondern aus Versehen ein Gefass herausprapariert und geschnitten hatte. Selbstverst~tnd- lich tiberzeugte ich reich bald, dass ich die Thymus vor mir hatte und erhielt yon einem zweiten Individuum analoge Bilder. Ich muss noch erwahnen, dass bei diesen alten Individuen die Fixation nicht so gut war wie bei den jungen; aber ffir meine Zwecke vOllig ausreichend.
Beitr~,ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 739
Bei der ersten Anlage der Thymus kann ein Unterschied z~ischen ihren Zellen und denen des benachbarten Darmes nicht nachgewiesen werden: Es ist ein hohes einschichtiges zylind- risches Epithel, dessen langgestreckte Zellen einen ovalen Kern ,~ufweisen. Fig. 38 zeigt einen Abschnitt einer sotchen Thymus- anlage bei einem Embryo yore Stadium 23.
Histologische Details der Zellen habe ich in der Zeichnung nicht ausgeftihrt; ich mSchte nur auf das Verhhltnis der Kerne zum Protoplasma aufmerksam machen. Die ,Kernplasmarelation "~' (R. H e r t w i g ) , d.h. der Quotient yon Kern dutch Protoplasma, ist klein. W~hrend langer Zeit w~tchst die Thymus sehr wenig und langsam. Ill Fig. 39 sehen wir wiederum einen Thymus- abschnitt yon einem Embryo des Stadiums 30. Noch ist das Blhschenf'nicht abgeschutirt. Die Kerne sind nicht kleiner geworden, sondern eher grSsser; das Plasma dagegen hat schon gewaltig abgenommen. Das Zylinderepithel ist niedriger geworden, es ist nicht mehr rein einzeilig. Das Verh~dtnis zwischen Kern und Plasma hat sich zu Ungunsten des letzteren verschoben. Sehr bald im Stadium 3',t 15sen sich die Thymusblaschen vom Darmepithel los und nun begimlt ein ungemein intensives Waehs- turn, wie es sich durch fiberaus httufige Mitosen und rasche Vergr6sserung des Organs ergibt. Sehr bald sind die Blaschen zu kompakten Zellhaufen geworden, die an Gr6sse sehr stark zunehmen und im Verhhltnis zu den fibrigen Organen fibermassig schnell wachsen. Dieses Wachstum erfolgt durch rasch aufein- ander folgende Zellteilungen. Es fitllt dabei das Ruhestadium der Zellen fort, sodass das Heranwachsen der Tochterzelle zur Gr6sse tier Mutterzelle nicht erreicht wird, sondern die Zellen sehr bald betntchtlich kleiner werden. Aber nicht nur an Gr6sse sind diese Zellen verschieden, auch ihre Kernplasmarelation hat sich ver;mdert. Wahrend die Kerne am Ende der rapiden Zell- teilungen etwa die halbe Oberfl~tche des Anfangsstadiums besitzen, i s t die Verminderung des Plasmas eine viel gewaltigere, eine fast u n e n d l i c h e im wahrsten Sinne des Wortes, denn meist k6nnen wir in den kleinen Thymuszetlen iiberhaupt kein Proto- plasma mehr nachweisen, mussten also den Anfangswert durch O dividieren. In einigeu gfinstigen Fallen kann man einel~ Zipfel Protoplasma nachweisen wie in Fig. 40, doch ist das ein Ausnahmefall. In frt~heren Zeiten glaubte man ,,freie Kerne"
740 H ~ r r y ~ a r c u s :
vor sich zu haben. Auch ohne exakte Mal3e, die hier leider nicht durchfahrbar sind, lehrt der blosse Augenschein, dass im Laufe der Entwicklung die Kernplasmarelation sich zu Ul~gunsten des Plasmas verschoben hat. Ist die Verschiebung tibermrtssig, wird der Kern allzu gross im Verh~tltnis zum Protoplasma, so tritt eine ,,Depression ~' (Calkins) der Zelle ein. Protozoen in diesem Zustand zeigen bei diesem Missverhttltnis yon Kern und Plasma ein trtibes, dunkleres Aussehen; sie ziehen die Pseudo- podien ein, die oft verdickt und verldumpt sind; sie nehmen keine Nahrung auf, vermehren sich nicht. In der Depressions- kultur der Infusorien gehen viele Individuen zu Grunde, die tibrigen erholen sich wieder und werden wieder ganz normale Tiere, bis sie einer neuen Depression anheimfallen. Von den Ursachen, die" zur Depression ftihren, interessiert uns vor allen besom ers die der ,ununterbroehen en Funktion", die R. H e r t w i g (05) an die Spitze dei- Einfltisse setzt, die imstande sind, die Kern- plasmarelation zu versehieben. Bei unausgesetzter Ftttterung einer Protozoen- resp. Hydrakultur erzielt man dutch die ununter- broehene assimilatorisehe Tatigkeit ein solches Anwaehsen des Kernes auf Kosten des Protoplasma, dass die ~lSere in ,..Depression '~ verfallen; sie sind unf~thig zu assimilieren und sieh zu teilen.
Aueh bei der Thymuszelle ist eine iibermassige Funktion bei dem rapiden Zeltwaehstum gegeben und ~Yir sehen aueh hier die Kernplasmarelation so sehr zu Gunsten des Kernes versehoben, dass die Zelle his auf weiteres nieht mehr teilfahig ist. Das rapide Waehstum hat plStzlieh ein Ende: ~ir haben in dieser Zelle den einen Bestandteil der Thymus vor uns, die sogenannte , lymphoide" Zelle (Fig. 40) der Autoren.
Nieht nut die Gr0sse der Kerne hat im Verhttltuis zu- genommen im Laufe der Entwieklung, sondern aueh die Farb- barkeit. Wahrend in den jungen Stadien die Kerne btass waren, speichern die endgtiltigen Thymuszellen ~tusserst intensiv die Kernfarbstoffe auf. Wenn man z. B. einen in toto gefarbten Kopf mit blossem Auge in der Serie betraehten, so fallen die Thymus- ballen dureh ihre intensive Farbung sofort besonders auf. Das hgngt nieht nut yon tier Diehtigkeit der Kerne, sondern aueh yon ihrer Hyperehromasie ab. Auch ein Vergleieh der Figuren 38, 39 und 40, sowie tier Figuren 59 und 60 zeigt diese Intensit~tts- untersehiede in der Farbe. Man k0nnte die Ursaehe davon in
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 741
einem verschiedenen Flfissigkeitsgehalt der Kerne annehmen. Doch ist, glaube ich, eine andere Erklarung vorhanden. Die GrSsse der Kerue ist yon der Zahl der Chromosome abhangig, wie B o v e r i (05) fiberzeugend nachgewiesen hat. Wir sahen, wie die Kerne allmahlich an absoluter Gr~sse abnahmen, daraus folgt, dass auch das Volumen tier Chromosome abgenommen haben muss. Das kann man auch direkt beobachten und messen (Figg. 61 u. 62). Ich babe schon in einer frflheren Arbeit (06a) darauf hingewiesen, class es die Unfahigkeit eines schnellen Wachstums der Chromosome ware (die bei so komplizierten Gebilden ja nicht verwunderlich), die einerseits bei der Furchung einen sofortigen Ausgleich der Kernplasmaspannung verhindere, ~tndererseits eine Verkleinerung tier Kerne bei rasch folgender Teilung bewirken mfisse. Denn die Masse der Chromosome ist direkt proportional der Kernoberiiache. Diese ist bei der Thymus- zelle infolge der rapiden Teilungen auf die Halfte herabgesunken, also mtissen wit auch annehmen, dass das Volumen des Chromosoms auf die Halfte reduziert sei. Dass dies tatsachlich der Fall ist, lehrt der Vergleich der Figuren 61 und 62, die bei gleicher VergrSsserung Mitosen yon Thymuszellen vom Stadium 34 und 45 zeigen. Das Tochterchromosom wachst also bier nicht auf die Gr6sse des Mutterchromosoms heran, wie B o v e r i annimmt und wie es im allgemeinen bei gleichbleibender Zellgr6sse auch sein wird. Es kann daher auch das Anwachsen des Chromosoms auf die doppelte urspr~ingliche GrSsse nicht das zur Teilung auslSsende Moment sein. Dieses liegt viel frfiher in der ,,Kern- plasmaspannung" (R. H e r t w i g ) , d. h. eine Kernplasmarelation, bei tier der Kern iibermassig klein im Verhaltnis zum Plasma ist, was durch Assimilation yon Nahrung bewirkt sein kann. Ich kann hier auf diese Momente nicht naher eingehen und verweise auf die Originalarbeiten yon R. H e r t w i g und Popof f . Hier wollte ich nut den Standpunkt prazisieren, dass die Kern- verkleinerung ihre Ursache in der Verkleinerung der Chromosomen hat, die bei rasch aufeinander folgenden Teilungen nicht auf ihre urspr~ingliche GrSsse heranwachsen k~nnen. Freilich k6nnte der Einwand erhoben werden, dass bei der Thymus nicht ahnlich wie bei der Furchung die grosse Kernplasmaspannung als treibendes Moment angesprochen werden k6nnte. Denn die ur- sprfinglichen Thymuszellen unterscheiden sich in nichts yon den
~'42 H a r r y ~ [a rcus :
iibrigen Darmzellen. Ffir die rasch folgenden Teilungen muss also eine andere Ursache vorhaaden sein, die wir nicht kennen. Ffir die F o l g e e r s c h e i n u n g e n aber, die wir hier ja nur besprochen haben, ist das urs~tchliche Moment der Zellteilung ohne Belang.
Haben wit die Gr~sse des Keraes nun vonde r Masse der Chromosome abgeleitet, so wollen wir nun versuchen, die Farb- barkeit ersterer ebenfalls auf Veranderungen innerhalb der Chromosome zurfickzufiihren.
Wem~ wit eiue Mitose der Thymuszelle beim Stadium 45 betrachten, so kSnnen wir zierliche schlanke Stabe als Chromosome bewundern (Fig. 62). Dieselben sind scharf voneinander zu treunen, da s ie gleichm~ssig gebaut sind. Sie sind abet schon bedeutend ]~lefiler als die vom Stadium 34 (Figg. 6] a und b). Die $pindel zeigt ihr gewohntes Aussehen, Centrosome an den Polen aufweisead. Die Aquatoria]platte gewahrt ein klares, helles Bild. ~ach diesem Stadium setzt die geschwulstartige Proliferation tier Zellen ein und sehr bald (Stadium 48) haben die Chromosome ihre schlanke Stabform eingebfisst (Fig. 63). Zwar sind sie noch scharf voneinander zu trennen, aber sie zeigen eine ver- quollene, in der Mitte leicht tonnenfi~rmig anfgetriebene Gestalt. Im Laufe der Entwicklung werden diese Charaktere immer aus- gesprochener, sodass wir entsprechend der Entwicklung tier Reihe ~ach alle t)bergange antreffen bis zu einem Punkte, wo die stabf0rmigen Chromosome zu plumpen Vierecken und KugehL geworden sind (Fig. 64). Fast der ganze Plasmaleib ist erftillt yon diesen stark cbromatischen Gebilden. Ein Vergleich zwischen Figg. 61--65 zeigt besser als viele Worte die ungeheure Ver- ~mderung, die zwischen den Chromosomen einer jungen und einer alten Thymuszelle besteht.
Diese Formveranderung innerhalb des Chromosoms muss auf die unharmonische Vermehrung einer der aufbauenden Substanzen zurtickgeftihrt werden, da eine Aufnahme eines fremden KSrpers, z. B. Wasser, zur vollen Erklarung des Bildes nicht ausreicht.
Die Chromosome sind nun kompliziert organisierte Gebilde. Wir k~innen sie welter analysieren und beobachten, dass sie aus Chromatink6rnern, den ,Chromiolen", bestehen, welche durch eine
Beitr:,tge zur Kenntnis der Gymnophionen. 74:~
schwach farbbare Kittmasse, d i e , ~Nucleoarsubstan z ~' (R. H e r t w i g) zur Chromosomeneinheit verbunden werden.
Diese Nucleoarsubstanz (auch Plastin genannt) ,,steht in sehr nahen Beziehungen zum Chromatin ~. Meist ist es mit diesem vereinigt, d. h. in ihm enthalten; doch kommt es auch einzeln vor, z.B. in den echten blassen ~Nucleolen oder als Teii der Doppelnucleolen, die ein blasses Zentrum und einen chromatischen Ring aufweisen. Ferner sieht man sie bei gewissen Tetraden, die eine achromatische Brticke im Chromosom auf- weisen.
Diese Substanz schwindet bei der Bildung der Chromosome und daher spricht ihr R. H e r t w i g eine formative Funktion fiir die Chromosome zu; andererseits kSnnen die Chromosome aber di6 Nucleolarsubstanz im Tochterkern produzieren. Es bestehen also sehr nahe Wechselbeziehungen zwischen Chromatin und bTucleolarsubstanz; ihr tIauptunterschied besteht wohl in tier Reaktion Farbstoffen gegentiber. Die Nucleolarsubstanz entspricht einer Art Vorstufe des Chromatins und ist so nahe verwandt mit ihm, dass wir sie als Einheit hier behandeln wollen. Als drittes Substrat der Chromosome kommt" (oder als zweites, wenn man die vorhergehenden nicht trennt), das ,Liningerilst" dec Autoren in Betracht. Dies ist nichts anderes, als die eventuell verdickten und solidifizierten Wabenwttnde des allgemeinen Zell- protoplasmas, welches ich als das formgebende Element, das auch die GrOsse des Chromosoms bestimmt, auffassen mSchte. Es ist das Element, auf das H a ck e r seine Achromatin-Hypothese aufgebaut hat.
Dieses Liningertist scheint auch mir das speziell organisierte Gebilde zu sein, wahrend Chromatin und Nucleolarsubstanz mehr den Eindruck einer ungeformten Substanz machen. I)as organisierte Liningertist braucht mehr Zeit zum Heranwachsen, als ihm bei der raschen Proliferation der Thymuszellen gewahrt wird, daher nimmt es ab und wird absolut kleiner im Laufe der Entwicklung. Man vergleiche die mit gleicher Vergr6sserung gezeichneten Chromosome yon Figg. 61 und 62. - - Durch lebhafte Funktion wird der Chromatingehalt erh6ht und zwar unbeschr~tnkt ( G 0 l d s c h m i d t [05]). Es vermehrt sich ~tlso im Laufe der Entwicklung Chromatin (mit bTucleolarsubstanz?) im ~'bermat~. Diese zahfliissige Substanz speichert sich auf dem mehr festen_
744 H a r r y M a r c u s :
formgebenden Liningeriist auf, das im Verhi~ltnis zum Chromatin zwischen zwei Teilungen nur wenig gewachsen ist. Durch dieses MissverhMtnis yon chromatischer und achromatischer Substanz verliert das Chromosom seine schlanke Stabform (Fig. 63) und gewinnt schliesslich die Kugelform (Fig. 64). Dieselbe Form- veranderung entsteht, wenn um ein solides, stabfSrmiges Gerfist ein Fltissigkeitstropfen wachst.
Wir sehen also, wie die Hyperchromasie der Kerne einer , , H y p e r c h r o m a s i e '~ der Chromosome bei der Mitose entspricht. Das , , f i b e r s c h f i s s i g e '~ Chromatin bildet nattirlich einen Teil des Volumens des Chromosoms, hat jedoch keinen Einfluss auf die KerngrSsse. Es ist also das Volumen der Chromosome----Ober- flache der Kerne nicht absolut richtig, sondern es gilt nur ffir normale FMl~. Wenn dagegen abnorme Zustande innerhalb des Chromosoma herrschen, wenn die ,,Chromolinin-Relation" ver- schoben ist, so ist das massgebende ftir die Kernoberfiache das formgebende Liningertist, wahrend das Chromatin nut die Intensitat der Farbreaktion beeinflusst, also hier die Hyper- chromasie bewirkt.
Wenn die eben geschilderten Vorg~nge durch die stetig anhaltende gesteigerte Funktion eine gewisse Grenze erreicht haben, muss eine Stockung eintreten. Durch die Verschiebung der Kernplasmarelation zugunsten der Kerne trat. wie wir oben sahen, ein Depressionszustand der Zelle ein, der dieselbe bis auf weiteres teilunfithig macht: ruhende ,,lymphoide c', kleine Thymuszellen. Durch die iibermassigeVermehruug yon Chromatin resp. Nucleolarsubstanz verkleben und verklumpen die Chromosome untereinauder (Fig. 65). Tritt dieser Prozess vor Eintritt der Depression ein, so wird die AuslCisung zur Zellteilung noch erfolgen. Die zu unf0rmigen Klumpen geballten Chromosome sind aber einer exakten Teilung nicht mehr i~hig: daraus resultiert notwendigerweise eine pathologische Mitose, die nicht zu einer vollkommenen Zellteilung ffihren kann. Und in der Tat wimmelt es in diesem Stadium der Thymusentwicklung yon pathologischen Kernteilungsfiguren. Man sieht yon den noch einigermassen normalen (Fig. 64) alle Ubergange bis zu richtigen Kern- degenerationsbildern: Heteropole Teilungen, einzelne verklumpte Chromosome (Fig. 65) bis zu einheitlichen Chromatinballen.
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 7~5
Bisher in der Thymus trafen wir nut e i n e Art yon Zellen an: Das Organ ist rein epithelial. Nun finden wir unmittelbar nach diesen pathologischen Mitosen ausser den kleinen Thymus- zellen grosse ,,epitheio~de ~' Zellen an (Fig. 41). Wie khnnen wit uns ihr pl~)tzliches zahlreiches Auftreten in diesem Stadium erkl}tren ?
Eine Einwanderung yon aussen kann ich mit aller Be- stimmtheit aus meinen zahlreichen Serien dutch ganze Khpfe ausschliessen.
Um zu einer befriedigenden Erklarung dieser Tatsachen zu gelangen, muss ich etwas welter ausholen und auf die Zellteilung eingehen. R. H e r t w i g hat zuerst ein funktionelles Kern- wachstum yon einem Teilungswachstum unterschieden. Ein frisch geteiltes :Infusor assimiliert aus der ~Nahrung Protoplasma und zwar wachst der Zellleib auf das Doppelte, wahrend der Kern nur minimal sich vergrhssert (Funktionswachstum). Dutch dieses ungleichmassige Wachstum hat sich die Kernplasmarelation so sehr zu Gunsten des Plasmas verschoben, bis die ,Kernplasma- spannung" eintritt, welche die Zellteilung auslhst. Dieser letztere Prozess beginnt mit dem Teilungswachstum des Kernes, der rapide auf seine doppelte Gr~sse heran~v',~chst. ~'~ir die exakte Begrtindung dieser eben angedeutete,l Prozesse verweise ich auf P o p o f f~) der diese Auffassung auch experimentell gesttitzt hat. Hier interessiert uns nut das Faktum: Bei Auslhsung tier Zellteilung setzt das Teilungswachstum des Kernes ein, oder anders ausgedr[~ckt, wachsen die Chromosome auf das Doppelte heran. Diese Auffassung steht im Gegensatz zu der yon B o v e r i (05), tier im beendeten Wachstum (,Reifen ~) des Chromosoms auf die doppelte Grhsse den Auslhsungsprozess der Zellteilung erblickt. Wenn also, um zu unserer Thymuszelle zuri}ckzukehren, die Ausl~sung zur Zellteilung erfolgt, wenn die Veranderungen innerhalb der Chromosome schon welt fort- geschrittene sind, so wird zwar noch ein T e i l u n g s w a c h s t u m e i n t r e t e n ~ a b e r e i n e T r e n n u n g d e r v e r q u o l l e n e n C h r o m o s o m e d u r c h d e n L h n g s s p a l t f i n d e t n i c h t m e h r s t a t t .
1) Diese Arbeit erscheint im neuen Archly fiir Zellenlehre, her~us- gegeben yon R. Goldschmidt.
746 H a r r y M a r c u s :
Nach der Rekonstruktion des Kernes ist dieser ein Diplo- karyon (B o v e.ri) : er hat die doppelte Masse yon Chromosomen als normal; die Kernoberfl~che hat sich verdoppelt.
Dies entspricht den tatsachlichen Befunden bei der Thymus g~nz genau. Der durchschnittliche Durchmesser der kleinen Zellen 5,25 ~, zu dem der grossen 7,5 l~ verh~tlt sich wie 7 : 1 0 ; die Oberflache also im Quadrat dieser Werte wie 1:2. D e r Vergleich yon Figg. 40 und 41 zeigt auf den ersten Blick diese Verh~dtnisse am deutliehsten.
Diese ,~diplokaryotischen" Zellen der Thymus, wie ich die ,,epitheloiden" der Autoren nennen werde, sind also Abk0mmlinge der ursprtinglichen Epithelzellen. Sie sind aber keine ,:Mutter- zellen" flit die kleinen Thymuszellen; sondern aus diesen durch eine unvollsthndige Kernteilung e~ltstanden.
Diese diplokaryotischen Zellen unterscheiden sich unmittel- bar nach der Rekonstruktion der Kerne n~r dutch die doppette Or0sse yon den kleinen Thymuszellen. Die F~irbbarkeit und die Struktur der Kerne ist die gleiche geblieben. Einen Zellleib. sieht man meistens nicht oder nur in schmalen S~iumen und Fetzen wie in Fig. 4:1.
Durch die ,,unvollkommene "~ Teilung ist die Zelle in ganz abnorme Bedingungen gekommen; sie ist nicht mehr teilfi~hig; es treten aber verschiedene Prozesse auf, die das Gleichgewicht in der Zelle wieder herzustellen streben. So erhalten wir eine grosse Mannigfaltigkeit yon Bildern, die schliesslich alle zur Degeneration ffihren, da die Veriinderungen yon der Norm zu tiefgreifende waren.
Unter den Reparationsprozessen nimmt die erste SteHung die Chromidienbildung ein. Unter diesem Begriff versteht man nach R. t t e r t wi g mit den gew(ihnlichen Kernfarbstoffen sich fitrbende Gebilde im Plasma. Ihre Herkunft aus dem Kern er- scheint ftir Protozoen gesichert, da man einerseits Kerne sich in Chromidien auflSsen sah, anderseits die Bildung yon Kernen aus dem Chromidialnetz beobachtete. Ausserdem werden oft in der Literatur Chromidien beim Passieren tier Kernmembran geschildert und abgebildet, eine Tatsache, die freitich auch oft vorgetliuscht sein kann~ die aber in gewissen Fallen nicht zu bezweifeln ist (z. B. bei Depressionszustanden yon Aktinosphaerium). Eine solche Chromidienbildung findet man. nun sehr reichlich in den
Beitri~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 747
diplokaryotischen Thymuszellen. Einmal konnte ich einen chroma- tischen Strang yore Nucleolus ins Plasma hinein verfolgen (Fig. 42a). Dasselbe Verhalten ist yon Z w e i g e r (06) und W a s s i t i e f f (07) bei Spermatogenesen yon Insekten beobachtet worden. Meistens findet man jedoch die Chromidien als grSssere oder kleinere Brocken und Klumpen im Protoplasma liegen (Fig. 42b und 43). Durch diese Chromatinausscheidung aus dem Kern wird dieser bedeutend blasser, so dass er in scharfen Gegensatz zu den kleinen Thymuszellen tritt (Fig. 59).
Ferner se t z t nun ein machtiges Anwachsen des Zellleibes ein. Wahrend frtiher nur ein schmaler, kaum erkennbarer Plasmasaum auch bei den diplokaryotischen Zeilen zu erkennen war (Fig. 41), sehen wit nun bei den blasseren Kernen einen grossen deutlichen Zellleib (Fig. 55).
Ebenso wie Protozoen in Depression durch Chromidien- bildung sich zu normalea Tieren erholen, analog gewinnt die Thymuszelle dadurch ihre Funktionsfahigkeit zum Tell wieder: sie ist nun imstande zu assimilieren.
Durch das Heranwaehsen des Protoplasmas einerseits, sowie durch die Kernverminderung durch Chroinidienbildung anderer- seits, wird die normale Kernplasmarelation wieder herzustellen versucht, aber die unvoilkommene Teilung hat so grosse Ver- imderungen bewirkt, dass eine normale Weiterentwicklung nicht m6gtich ist. Ich halte es aber nicht ffir ausgeschlossen, dass bei anderen Objekten die Zellen sich so welt erholen, dass noch- mals eine Zellteilung ausgel(ist wird. Diese wird wahrscheinlich ebenfalls nicht zu einer vollkommenen Teilung, sondern zu einem vierfachen Kern ftihren. Vielleicht lassen sich auf diese Weise gewisse Riesenkerne erklaren.
Die oben geschilderten Prozesse gehen dabei, da es zur Zellteilung nicht kommt, immer welter nebeneinander fort. Der Kern wird immer blasser, oft wird er viillig achromatisch (Fig. 44). der Zellleib w~tchst immer starker heran und auch der Kern wird bedeutend grSsser. Diese Erscheinungen k5nnen wit so deuten, dass die Zelle in Depression durch Chromidienbildung die Kernplasmarelation erhalt, die zur Assimilation und Bildang yon Cytoplasma befahigt. Durch diese Funktion wachst wiederum der Kern. Da durch die Chromosomenveranderung die Zellteilung als Regulativ ausgeschaltet ist, steigern sich Kern und Proto~
A r c h i v f. m i k r o s k . Ana t . Bd, 71. 4 9
748 H a r r y Marcus :
plasma gegenseitig zu immer grSsseren Gebilden. Schliesslich haben wir ganz grosse blasse Kerue mit machtigem Zellleib vor uns. Abet beide zeigen sehon Spuren tier Degeneration (Fig. 56). Der Kern weist kaum noch Chromatin auf, seine Nucleolen haben nur noch einen feinen Chromatinring, w~thrend ihr Zentrum sich intensiv mit Eosin farbt. In anderen FMlen ist der Kern frag- mentiert in 2--6 Teile zerfalleu (Fig. 50a uud b).
Drittens sehen wir um den Kern eine meist halbmond- fSrmige, aber oft unregelmassige helle Substanz. Nattlrlich ist das keine durch Schrumpfung entstandene Lichtung, soudern diese stark lichtbrechende Masse scheint vom Kern ausgeschwitzt zu sein (Figg. 48 u. 49). Ganz analoge und viel deu~lichere Bilder zeige~ degenerierende Seestern- oder Seeigeleier. Wahr- scheinlich h~tndelt es sich hier um ein Herausschaffen you tiber- massig gebildeter Nucleolarsubstanz.
Endlich m(ichte ich noch eine merkwtirdige Kernform an- ftihren, die bei. verhaltnismassig sehr kleinen Zellen, also vor der unvollkommenen Teilung, zur Beobachtung gelangt (Fig. 51a, welche bei gleicher VergrOsserung wie Fig. 40 gezeichnet ist. zeigt dies sehr deutlich). Das Chromatin "ist ganz auf einer Seite am Rande angesammelt, nicht in nucleolenartiger homogener Masse, sondern unregelmassig hellere und dunklere Streifen er- kennen lassend. Von dieser Hauptchromatinansammlung ziehen einzelne oft doppelte Fsden zur eutgegengesetzten Peripherie. Der Rand des Kernes ist ebenfalls chromatisch. Der grSsste Tell des Kernes ist dagegen hell, v611ig frei yon Chromatin. Aus dieser Schilderung, sowie den Bildern Figg. 51 u. 52 geht die Ahnlichkeit dieser Kerne mit denen yore Synapsisstadium der Geschlechtszellen zur Gentige hervor. Freilich will ich nicht verhehlen, dass in manchen dieser Kerne die hellen Partien vakuolenartigen Eindruck machten, auch der dicke chromatische Rand erinnert an pyknotische Kerne, bei anderen dagegen glichen sie v011ig der typischen Synapsis. Bei dem Vergleich yon Thymus- und Sexualzellen werden wir auf die Bedeutung dieser Tatsachen eingehen.
Ehe wit auf die degenerativen Ver,~tnderungen eingehen, wollen wir kurz ein biologisches Moment der diplokaryotischen Thymuszellen erSrtern. Die grossen Zellen vereinigen sich mit ihrem Zellleib zu zweit oder zu mehr miteinander (Fig. 58).
Beitriige zur Kenntnis tier Gymnophionen. 749
Dann sieht man einen grossen Protoplasmaleib mit zwei oder mehr Kernen. Die Zellgrenzen sind vi)llig verschwunden. Haufig verschmelzen die Zellen nicht breit miteinander, sondern nur mit einem Zellfortsatz. Dies ist leicht erklarlich wenn man berficksichtigt, class zu der Vereinigungstendenz die kleinen Thymuszellen als zwischen den grossen Zellen eingelagerte hindernde Massen in Betracht kommen.
Die nahe beieinander liegenden diplokaryotischen Zellen werden also einen einheitlichen Protoplasmaballen mit so viel Kernen ats Zellen verschmolzen sind, bilden; die welter getrennt voneinander liegenden Zellen vereinigen sich abel" wegen der dazwischen liegenden iibrigen Zellen nur mit ihren Fortsatzen und bilden somit ein Reticulum.
Dass diese Verschmelzungstendenz besteht, ist ein Beweis mehr, dass hier Depressionszellen vorliegen. Bei Protozoen ist es eine alltagliche Erscheinung, dass in der Depression ,,Plasmo- gamie ~ eintritt. Diese Vereinigung zweier Zellen kann nur durch die abnorme Veranderung der Oberfl'~chenschichte zustande kommen, die nunmehr unfithig geworden )st, die Setbstandigkeit des Individuums zu wahren. [Jber die Bedeutung dieser Er- scheinung weiss man so gut wie nichts. Man kann sich vorstellen, dass es eine analoge, wenn auch weit geringere Bedeutung hat, wie die Amphimixis der Kerne. Durch letztere wird das kon- jugierende Tier wieder ,,verjfingt" ; vielleicht ist die Vermischung "~on Plasma eines artgleichen Individuums ebenfalls :~on einem gewissen Nutzen ftir die Zelle.
Von den Veranderungen des Protoplasma wollen wir nut Einzelheiten herausgreifen, um nicht gar zu tief in die Pathologie der Zelle hineinzugeraten. Wir wollen nur die ftir die Thymus charakteristischen Gebilde betrachten.
Da kommt nun in erster Linie die konzentrische Streifen- bildung im Protoplasma in Betracht (Figg. 55 u. 56). Unmittelbar um den Kern ist meist ein bellerer Streifen, der yon einem dunkleren ]~and umgeben ist. Dann finden sich konzentrisch um den Kern dunklere Bander im Protoplasma. Eine Struktur konnte ich darin nicht wahrnehmen, da der gesamte Zellleib ein eigenttimlich hyalines Aussehen zeigt. Die konzentrischen und homogenen dunklen Kreise haben denselben Charakter, wie die bei einer eintrocknenden SalzlSsung entstandenen. Sie werden wohl eine
49*
750 H a r r y M a r c u s :
Ausfaltung aus dem langsam absterbenden Protoplasma sein. Diese K0rper hat, wie aus obigem Zitat hervorgeht schon L ey d ig gesehen und beschrieben. Diese , ,Has sa l l s chen KOrper" sind bei den niedrigen Wirbeltieren allgemein zu finden; wahrend bei h0heren die Degenerationserscheinungen etwas modifiziert sind-
Ausser diesen einzelligen konzentrischen KSrperchen kommen Konglomerate aus vielen verschmolzenen Zellen vor (Fig. 59). Es siud dies die typischen allbekannten H a s s a l l schen K0rpercbem ])as Zentrum ist in der Degeneration am meisten fortgeschritten. yon aussen lagern sich immer neue diplokariotische Zellen am die somit einen Ring bilden. Wenn das Zentrum degenerativ zerbr0ckelt, entsteht dadurch ein hohler Ring, der eine verdickte Gefitsswand vort',tuschen kann, besonders da haufig noch im Detritus degenerierende, aber eben durch den Zerfall der anderen freie Zellen (eventuell mit allem Chromatin zu einem Ballen ver- klumpt) als Blutzellen gedeutet werden k($nnen. ( N u s b a u m und M ' a c h o w s k y , Fig. 60).
Ein weiteres konzentrisches Gebilde sieht man auf den Figuren 45 und 46 abgebildet. Das Ganze ist ganz achromatisch- Das Zentrum dunkel, etwas unregelmassig in Form und auch anscheinend schwach strukturiert, wahrend der helle und dann der dunkle Ring v011ig homogen erscheinen. Mit Bestimmtheit kann ich diesen K6rper nicht ableiten. Wahrscheinlich geht ein Stadium wie in Figur 47 vorher, wo sich um einen grossen Mittelpunkt eine chromatische Zone sich ausbreitet. Auf tier einen Seite sehen wir einen chromatisehen Punkt, auf tier anderen eine helle Zone. Es ist nun die Frage, ob dies das Degenerations- produkt eines Kernes oder aber eines Chromidiums wie yon Figur 4:3 sei. Ich halte ersteres ftir wahrscheinlicher, doch ist letztere MiSglichkeit nicht ausgeschlossen. Dieses Gebilde erscheiut mir deshalb so interessant, well es morphologisch eine so grosse Ahnlichkeit mit den Dotterkernen gewisser Spinneneier aufweist.
Hierher geh0rt auch ein Gebilde, das Figur 57 darstellt. Um eine helle Vakuole ist geschichtetes Plasma gelagert, der Kern ist metachromatisch rot (bei Hamatoxylinfarbung nach D e 1 a f i e I d). Das Ganze ist yon einer diplokaryotischen Zelle umschlossen.
Zum Schluss m0chte ich noch eine eosinophile Zelle schildern. Am Rande des Zellleibes treten grSssere Brocken auf, die sich mit Plasmafarben also Eosin, Pikrinsaure, Bleu de Lyon etc.
Beitri~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 751
intensiv farben (Fig. 53). Allmahlich nimmt diese KOrnelung zu, bis die ganze Zelle mit diesen Brocken erftillt ist (Fig. 54). (In der Zeichnung sind die leuchtend roten Brocken in grauer Farbe eingetragen). Diese Zellen stammen sicherlich nicht aus dem Blute, da das Organ noch nicht vascularisiert ist. Wahr- scheinlich haben sie mit dem Blute absolut nichts zu tun. Ich halte dies vielmehr ff~r einen neuen Beweis ftir den Depressions- zustand der Thymuszellen: sie sind unfahig zu assimilieren und speichern daher ebenso wie die Geschlechtszellen im gleichen Zustand die Nahrungsstoffe als Dottermaterial auf, da sie es nicht verarbeiten k0nnen. Wahrscheinlich sind die eosinophilen Leukozyten ebenfalls Zellen in Depression, woftir auch ihr gelappter Kern spricht, abet mit unseren Thymuszellen brauchen sie auch dann nur diesen Depressionszustand gemein zu haben.
Alle diese geschilderteu Vorgange spielen sich am inten- sivsten bei jungen Tieren yon 9--12 cm Lange ab. Spater bei alten ausgewachsenen Tieren finden sich nut sparlichere H a s s a l l s c h e KSrper, aber ganz fehlen sie hie. Rudimentar fand ich die Thymus fast nie, dean bei den vSllig ausgewachsenen alteu Exemplaren yon 24 cm Lange finden "sich die vier grossen Thymusknoten roll yon kleinen Thymuszellen und ~ie gesagt sparliche diplokaryotische Kerne und sonstige Degenerations- produkte. Nach der Periode der intensiven Proliferation trat eben das Depressionsstadium ftir die kleinen Zellen ein, wodurch die Teilung gehemmt wurde. Spater erholte sich der iiberwiegende Tell und beim gemi~ssigten Wachstum, das jetzt einsetzt, bleiben sie v611ig funktionsfahig, teilen sich normal uud nut ein ga~z geringer Prozentsatz kommt in Depression und Degeneration. Die H a s s a II schen KSrper, die nach der intensiven Wachstums- periode und dutch die darauf folgende tiefe Depression entstanden waren, sind degenerativ zerfallen ohne Spuren zu hinterlasse~l.
Wir mtissen nun auch auf das Bindegewebe und die Yas- cularisation der Thymus eingehen, nachdem wit si~mtliche eigent- liche Thymuselemente einheitlich yon ursprtinglichen Epithelzellen abgeleitet haben.
Jeder der vier Thymusknoten hat eine bindegewebige Htille, in dieser verlaufen zahlreiche Kapillaren. Solange das Tier wachst, also bis zu Individuen yon 24 cm Lttnge~ ist kein Binde- gewebe, kein Gefass ins Innere der Thymus gedrungen. Bei
752 H a r r y ~ a r c u s :
einem der Ntesten Exemplare (ich schliesse auf das Alter roll der Dicke des Tieres, denn die Lange schwankt stets um 25 cm, bei ausgewachsenen Tieren, dagegen ist der Querdurchmesser ein wechselnder), fand ich eine schwache Bindegewebseinwucherun~ und hier war die Thymus auch etwas kleiner als gewOhnlich, doch immerhin ganz stattlich und vott yon kteinen Thymuszellen. Ein eigentliches Rudimentarwerden war dies nicht, hSchstens eine senile Atrophie, wie sie in so manchen Organen vorkommen kann. Dass also meine diplokaryotischen Zellen nicht yore N[esoderm her eingewandert sind, kann ich mit Sicherheit behaupten.
Ebensowenig waudern, meiner Ansicht nach, die Thymus- zelleu aus und werden zu Blutelementen. Die -4hnlichkeit yon Lymphozytenund Thymuszellen sowie das Rhtsel der Lymphozyten- quelle hat manchen Morphologen veranlasst, sie zu identifizieren, abet keinem ist der Beweis gegliickt. Es lassen sich gegen diese Auffassung sehr gewichtige Bedenken erheben und ich verweise auf die Arbeit S~)hrs hierft~r. Unbedingt widerlegt erscheint mir diese Hypothese schon durch die vortreffliche Arbeit yon W a t n e y (82) zu sein, der die GrOssenverht~ltnisse yon Thymus- und Blutzellen vergleicht. Die Unterschiede sind bei Sauge- tieren freilich kaum gegeben, bei Rochen aber ganz gewaltige. Auch bei FrSschen und V0geln ist ein merklicher Unterschied in der Gr0sse vorhanden, wenn auch nicht so in die Augen springend wie beim Rochen, bei dem die weisse Blutzelle einen zweieinhalb real so grossen Durchmesser als die Thymuszelle hat, also kann dutch eine blosse Wanderung aus letzteren kein Blur- element werden. Bei Hypogeophis sind die Gr0ssenunterschiede unerheblicher und daher nicht beweisend. Eine Auswanderung oder Verminderung yon Thymuszellen konnte ich niemals beobachten. Uber die Funktion tier Thymus kann ich nichts angeben ; diese Frage muss auf physiologischem Wege durch das Experiment gel~st werden. Mit tier Blutbildung hat sie, glaube ich, nichts zu tun. Die funktionierenden Elemente werden die kleinen Thymuszellen sein, nicht die diplokaryotischen oder gar die Degenerationsprodukte, die H a s s all schen KSrperchen. Dutch vergleichende Studien tlberzeugte ich mich, dass die oben filr Hypogeophis geschilderten Vorgange nicht auf diese beschrankt werden, sondern eine allgemeinere Gfiltigkeit beanspruchen d~irfen.
Beitr~ge zur Kenntnis tier Gymnophionen. 753
Ich untersuchte andere Amphibien (Frosch, KrOte), Sauge- tiere (Schafembryo) und Selachier (Cephaloscyllium umbratile). 1)
t2berall fand ich die gleichen Bilder mit geringen Modifikationen, die sich samtlich mit meiner Auflhssung in Einklang bringen liessen. Freilich bei S:,mgetieren ist alas ganze Bild viel undeutlicher und komplizierter dutch die Vascularisation. Ich m(ichte nochmals hervorheben, das ich auch bei Selachiern diplokaryotische Zelien mit grossem Kern und konzentlisch gestreiftem Zellleib angetroffen, trotz tier gegenteiligen Behauptung yon B e a r d (02), dass keine H a s sal lschen KSrper oder ahnliches vorkame, was schon yon P r i m a k (02) bestritten wurde. Wie B e a r d die Thymus ,als die erste und einzige Quelle der Leukozyten" bei Raja batis ansehen kann, ist mir unverstandlich, da bei demselbea Objekt nach W a t n e y (82) die enormen Gr0ssen- unterschiede zwischen Leukozyt und Thymuszelle bestehen.
Es wtirde wenig Zweck haben, wollte ich eingehend anf die Literatur eingehen. Ich verweise auf die Arbeiten yon H a m m a r (05) und St~ihr (06). Die Fragen, welche die Forscher beschitftigten, waren hauptshchlic.h:
1. Ist die Thymus epithelial oder 'sind die grossen oder kleinen Zellen yore Mesoderm eingewandert?
2. Ist die Thymus ein blutbildendes Organ? 3. Woher stammen die H a s s a l l s c h e n K6rperchen, was ist
ihre Bedeutung, ihr Schicksal? Meine Stellungnahme zu diesen Fragen ergibt sich zur
Gentige aus den obigen Ausftthrungen. ~qur auf einige Angaben muss ich eingehen: die im Wider-
spruch mit meiner Schilderung sind. Falls die Thymus nicht epithelial ist, sondern die kleinen
oder grossen Zellen mesodermale Eindringlinge, so fallt meine ganze ,,Hypothese ~ zusammen.
Ftir diese Immigration sind in letzter Zeit nur wenige Forscher eingetreten. C a p o b i a n c o (92) schreibt: ,on peut surprendre cette migration in actu." G u l l a r d (91) sagt yon den Leukozyten: ,they beginn to invade the epithelium. ~ Die-
~) Die Thymus dieses 80 cm langen Tieres stammt vom Dofleinschen Material aus ffapan und wurde yon Dr. L u t h e r bei einer Bearbeitung dieses Tieres gewonnen. Fiir die gtitige Lrberlassung sage ich beiden Herren auch hier meinen besten Dank.
754 H a r r y M a r c u s :
selbe Ansicht vertritt Ver E e c k e (99) ftir den Froseh. Der Fehler dieser sonst sehr exakten Arbeit liegt, glaube ich, daran, dass dieser Forscher mit einem zu alten Stadium begonnen hat Er beginnt mit einem in Metamorphose begriffenen Frosch, der noch einen Schwanz hat. ,A ce moment duns la substance mSdullaire encore pour ainsi dire exclusivement @ith~liale, se remarquent d6jh bon hombre de corpuscules de Hassa l l typiques. '~ (pag. 68.) H~tte Ver E e c k e ein etwas jiingeres Stadium untersucht, so wtirde er nur kleine ,,lymphoide ~ Zellen gefunden haben. Dagegen sind seine Beobachtungen und Bilder tiber die Bildung der H a s s a l l s c h e n KSrper und ihr Zerfall sehr gut. ~)
Die iiberwiegende Mehrzahl der neueren Forscher ist fiir einen rein epithelialen Aufbau der Thymus; freilich wird dann meist angenommen, dass die grossea Kerne Reste des urspriing- lichen Epithels sind, aus denen die Lymphozyten entstehen.
P r y m a k (02) hat ,nie das Eindringen der lymphoiden Zellen aus dem umgebenden Bindegewebe in den ThymuskOrper gesehen." Freilich daftir auch ein ,massenhaftes Auswandern yon Leukozyten". Letzteres vertritt auch M a u r e r , I q u s b a u m und M a c h o w s k y (02) und besonders B e n rd und viele andere.
1) A n m e r k u n g bei de r K o r r e k t u r . Inzwischen ist eine krb~it yon A. ~ [ a x i m o w in Folia haematologica, IV. Jahrgang, Nr. 5, 1907 erschienen. Der Verfasser behauptet, dass , in Umgebung der noch rein epithelialen Thymusl~ppehen kleine histiogene Wanderzellen im 1Kesenehym e n t s t e h e n . - Sie dringen in alas Epithel Gin und verwandeln sich dabei in typische gr0SSG Lymphozyten, die sieh in den Epithelzellen in immer wachsender Menge an- sammeln. Dadureh wird hier also auf die unzweideutigste Weise die Identit~t tier histiogenen Wanderzellen und der Lymphozyten bewiesen. ~ Ich kann diesen 0ptimismus nicht teilen und sehe mit Spannung der definitiven Arbeit entgegen, in der M a x i m o w seine Auffassung yon der Einwandcrung und Verwandlung belegen wird. ~Die grossen Lymphozyten in den Thymus- l~ppchen ~ - - heisst es weiter .-- ~vermehren sich mit der Zeit so ausser- ordentlieh, class sie alas Epithel, besonders in der Rinde, ganz zuriiekdr~ngen und als Resultat bekommen wir dann Massen yon typischen kleinen Lympho- zyten, die . . . . aus den L~ppchen austreten und in alas umgebende Gevcebe gelangen. Die Thymuslymphozyten sind also echte Lymphozyten und alas EpitheI dieses Organs stelIt flit sie bloss einen sehr giinstigen, die Vermehrung ausserordentlich fSrdernden zeitweiligen Aufenthaltsort vor. ~ Die ausser- ordentliche Vermehrung der grossen Lymphozyten kann nur dureh zahlreiche normale Mitosen derselben vor Vaskularisation der Thymus wahrscheinlich gemacht werden und naeh meinen bisherigen Erfahrungen muss ich an ihrem Vorkommen zweifeln.
Beitrage zur Kenntnis der Gymnophionen. 755
'Gegen diese Auffassung, dass die Thymus ein blutbildendes Organ sei, ist S t 5 h r (06) sehr energisch eingetreten. ,Die kleinen Zellen sind keine ,lymphoiden Elemente ", keine Lympho- oder Leukozyten. sie sind AbkSmmiinge yon Epithelzellen und bleiben Epithelzellen, solange sie bestehen. Die Thymus ist und bleibt ein epithetiales Organ, das mit der Bildung yon Leukozyten niehts zu tun hat." Dies untersehreibe ieh vollstandig, nieht abet folgenden Satz, class ,,ira Mark viele, aber keirreswegs alle ursprfmgliehen Epithelzellen zu grossen typisehen, mit einem deutliehen KernkSrperehen "~ersehenen Epithelzellen heran- gewaehsen sind". Naeh S t S h r tritt also eine zwiefaehe Entwieklung der Epithelzellen ein; zum Tell ,,wandeln sie sieh dureh wiederholte mitotisehe Teilung in sehr kleine um, w'ahrend die zentralen Epithetzellen allmahlieh gr~sser werden und so .die Marksubstanz bilden". Der Grund tttr dieses divergente Verhalten bleibt uneriSrtert. - - Im Gegensatz zu dieser Meinung glaube ieh, dass ein Stadium existiert, bei dem es t~berhaupt keine grossen Zellen gibt, sondern nur kleine ,,lympho~de", aus denen dann p l 6 t z l i e h ohne Ubergange die grossen hervor- gehen.
~;ber die Bildung der H a s s a I 1 sehen K0rperehen sind die meisten Autoren einig, dass sie ~on den grossen Zellen stammen. Eine davon abweiehende Auffassung vertreten A f a n a s s i e w (77) (tier die H a s s a l l schen KiSrperchen injiziert zu haben glaubte und sie aus dem Endothel der Blutgefrtsse ableitet), und in neuester Zeit Nu sb a u m und M aeh o w s k y (02). Diese letzteren Forseher halten die H a s s a l l sehen K0rper ft~r umgebildete versehlossene Gefasse, bei denen die Endothelzellen und die Membrana aeeessoria gewuehert ist. Ich zweifele keinen Augenbliek an der Exaktheit ihrer Bilder, doch ist meine Deutung eine grundversehiedene, wie ieh es oben aaf Seite 750 sehon angeNhrt habe: ieh hare diese Gebilde Nr H a s s a l l s e h e KSrper yon welt fortgesehrittener Degeneration im zentralen Tell. Degenerierende Zellen seheinen Blutzelien zu sein und ihre Unterseheidung ist um so sehwieriger, als aueh letztere Zerfalls- .erseheinungen aufweisen sollen. Ieh verweise noehmals auf meine Figg. 62 und 63 und bitte sie mit denen der genannten Forseher zu vergleiehen.
Nun mSehte ieh Nr einige Tatsaehen, die ft~r meine Aus-
756 H a r r y ~ I a r c u s :
f~hrungen yon besonderer Wichtigkeit sind, einige Bestatigunge~ und Belege aus der Literatur anffihren.
Dass die Thymus rasch w~chst und dass sie ursprt~nglich aus einer einzigen Zellart besteht, ist allbekannt.
Ich kann es mir nicht versagen, P r e n a n t auch hier aun- filhrlich zu zitieren, well ich mir keinen bessereu Beleg ffir meine Ausffihrungeu denken kann. P r e n a n t (94) sagt Seite 40: I1 est'hors de doute que les dF~gantes cinSses que l'on trouve dans les premiers temps du ddveloppement du thymus appar- tiennent ;t des cellules dpithdliales~ puisque la structure de l'organe est encore ,t cette dpoque compldtement dpithdliale. Di's les premiers indices de la transformation lympho~de, et lorsque plus tard cette transformation est centrale, surgit une difficultd. Que sont les divisions cindtique que l'on h sous les yeux et dont les earact~res sont du reste autres que ceux des cin~,ses observdes prdcddemment? Doit-on les attribuer exclusivement it des lyml)ho- c ytes? P i ' e n a n t hat das Problem nicht 10sen k0nnen, aber die Tatsachen hat er ausserst exakt beobachtet, wie aus folgendem Zitat hervorgeht (Seite 14:1), in dem er die zweierlei Mitosen schildert. Sie besitzeu bei den ,,Lymphozyteu ~" nach dem ,,Trans- formationsstadium" ,,caract~res nSgatih: ainsi l'absence de l'aurSole claire, la br~vetd, l'dpaisseur des chromosomes et leur agglo- mdration en une masse compacte h d(~tails le plus souvent indistincts, l'absence de fuseau. Les mitoses des cellules dpi- thdliales darts le thymus plus jeune avaient des caract~res inverses: prdsence d'un fuseau, le plus souvent court, mais net; chromosomes distincts, frdquemment tortueux et alors coupds en plusieurs tron(ions; aurdole claire; corpuscules centraux et corpus- cules polaires, les premiers reprdseutds par deux ou m~me trois grains juxtaposds (ces corpuscules n'dtant pas visible dans les mitoses du thymus lympho~de)". Von den Tatsachen hat P r e n a n t im wesentlichen nur den allm~hlichen lJ~bergang der einen Mitose in die andere tibersehen. P r e n a n t deutet seine Befunde folgendermai~en: Die Epithelzellen werden ausschliess]ich zum Gertist; die kleinen Mitosen geh0ren den Lymphozyten an, die eingewandert sind. Dass nach meiner Ansicht diese patholo- gischen Mitosen zu den diplokaryotischen Zellen ftihren, brauche ich wohl kaum zu erw~hnen.
Die pathologischen Mitosen, der Angelpunkt unserer Aus-"
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 757
ftihrungen, sind noch yon einer Reihe you Forschern beobachtet worden. Schon Schedel (85) konnte in der Thymus die Mitosen nur zum Tell in ihre Phasen aufl0sen. H a m m a r (05) schreibt: ,,Von dem ersten Auftreten der Lymphozyten an kann man im Drtisenparenchym zwei Arten yon Mitosen unterscheiden":
1. grosse Mitosen mit relativ langen undicht liegenden Chromosomen ;
2. kleinere und dunkler gefiirbte Mitosen; ,,sie zeigen kurze und dicke gew(ihnlich miteinander verklebte Chromosome u. Auch die Chromidienbildung hat dieser Forscher. wie auch mancher andere, beschrieben; er schreibt Seite 52: ,Mit einer vorhergehenden Hyperchromatose oder ohne eine solche werden dabei Chromatinktigelchen nicht selten in grosser Menge in das Protoplasma ausgestossen."
S t 0 h r sah ebenfalls die unvollkommenen Teilungen gerade im Stadium vor der Bildung der H a s s a l l s c h e n KSrperchen. ,Bei einem viermonatlichen Fi~tus sind die Kerne fragmentiert. Haufig liegen die Fragmente so dicht beieinander, dass man im ersten Augenblick Mitosen vor sich zu haben vermeint; erst Anwendung starkerer Objektive (Immdrsion) und der Befund einzelner klarer Bilder ftihren zu einer richtigen Auffassung. Es handelt sich um einen Zerfall der Kerne, um Rtickbildungsvor- gange ira epithelialen Mark, die schon in diesem frtiheren Stadium gar nicht selten -- oft ist das ganze Gesichtsfeld mit solchetl Bildern fibersttt - - auftreten. H a s s a l l s c h e KOrpeI" fehlten in diesem Stadium [!]. Sie erscheinen erst bei 41/2--5 Monate alteu FOten und sind sehr klein" (S. 440).
Es ist selbstverstandlich: dass viele Zellen bei der patho- logischeu Teilung auch ganz zugrunde gehen und nut ein Tell sich zum Diplokaryon rekonstruiert.
B e l l (05) unterscheidet richtig die drei Kernarten: large pale nuclei, large dark nuclei and small dark nuclei. Freilich behauptet er, es seien Ubergangsformen vorhanden, was vielleicht durch Variabilitat in der GrCisse der kleinen Zellen bedingt sein mag. The large dark nuclei are intermediale forms between the pale nuclei and the lymphoblasts. Dabei nimmt B e l l den entgegengesetzten Entwicklungsgang als ich an.
Schliesslich sei noch L e w i s (05) erwahnt, der den Zerfall und die Resorption des zentralen Teiles des H a s s a l l s c h e n
758 H a r r y M a r c u s :
KSrpers ausftihrlich beschreibt. Der somit entstandene Hohlraum mit Resten der zentralen Triimmer wiirde nach meiner Aus- legung den verdickten Gef}tssen yon Nusbaum und Machowsky , wie oben schon erwhhnt, entsprechen.
Diese Literaturausweise werden gentigen~ um die Allgemein- gfiltigkeit meiner tats/~chlichen Befunde zu belegen. In diesen ist nut wenig Neues: Die a l l m a h l i c h e Veranderung der Chromosome und das p lS tz l iche Auftreten der diplokaryotische,~ Zellen unmittelbar nach der pathologischen Teilung. Dass diese eine unvollkommene Teilung sei, die zur diplokaryotischen Zelle ftihrt, ist sicherlich kein gewagter Schluss. Und so daft ich wohl hoffen, durch meine Ausf~ihrungen die Fragen, die fiber die Natur der Thymuselemente schwebten, einer einheitlichen LSsung zugef{ihrt zu haben.
Allgemeiner Teil.
D i e s y s t e m a t i s c h e S t e l I u n g der Gymnophionen ist neuerdings strittig geworden. Wahrend friiher die lebenden Amphibien in drei Ordnungen, die Urodelen, Anuren und Apoden, geteilt wurden, hat Cope die Gymnophione~ mit den Urodelen vereinigt. Die Vetter S a r a s i n gehen einen Schritt welter, indem sie die Gymnophionen mit den Amphiumiden zu einer Unterordnung Caeciloidea vereinigen, die mit der Salamandroidea die Ordnung Urodela bildet. Somit waren die Gymnophionen zu einer Familie herabgesetzt; sie waren sehr stark modifizierte Formen, die ftir die Phylogenie nicht in Betracht k~tmen. ,Wfirde Amphiuma sich verwandeln, so bekamen wir ein in der Erde wiihlendes GeschSpf wie Ichtyophis" (S. 241). Amphiuma wird als neotenische Form der Caeciliiden aufgefasst, wfirde es sich vbllig entwickeln, so hhtten wit ,einen Repr,~.sentanten der Caeciliiden etwa aus der Tertiarzeit vor uns". Gegen diese Auffassung wendet sich B o u l e n g e r (95): , I still think it desirabie to reclaim the Apoda as an order distinct from the caud~.ta, in spite of views exposed by Prof. Cope and the Drs. S a r a s i n . If the absence of limbs and the reduction of the tail were the only characteristics of the group, I should not hesitate to unite the Caecilians with the Urodeles; but to say nothing of the scales, the Caecilians skull presents features, which are not shared by any of the tailed Batrachians, and the. order
Beitri~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 759
can be defined by the cranial characters alone". Ferner bezeichnet er die J(hnlichkeit yon Amphiuma und larvaler Ichtyophis als eine oberflachliche.
B r a u e r hat in allen seinen ,,Beitragen" die gleiche Stellungnahme wie die vorhergehende vertreten. Er hatte die Absicht, nach Bearbeitung einer Reihe von Organsystemen aus- ftihrlich auf die Frage einzugehen. Auch ich halte es nicht zweckmassig, vor der Bearbeitung des Sch~tdels n',ther diese Frage zu eri~rtern~ mSchte nur betonen, dass ich mit B o ul e n g e r und B r a u e r die Gymnophionen ftir die primitivsten lebenden Am- phibien halte, die wahrscheinlich yon den Stegocephalen ableitbar sind. Von diesen ki~men nattirlich nicht die grossen Formen in Betracht, sondern am ehesten z. B. das Dolichosoma Frictch, ein schlangenahnliches 40 cm grosses Amphibium, das keine Extre- mitaten besitzen soll.
Ich verspare mir, wie gesagt, die n~theren Ausftihrungen auf einen sp[tteren Beitrag und mOchte hier nur alle die in dieser Arbeit gefundenen Momente aufzahlen, die ftir das primitive Verhalten tier Gymnophionen sprechen.
1. Es werden sieben Schlundtaschen gebildet, bei den tibrigen Amphibien sechs. Der ultimobranchiale K0rper, der sich aus der letzten entwickelt, ist also nut bei den Gymno- phionen direkt homolog mit dem der $elachier und des Ceratodus.
2. Durch diese Zahl ist es mSglich, im Sinne der G o e t t e - schen Hypothese die Lungenanlage bei Hypogeophis direkt mit der Aussackung der achten Schlundtasche yon Petro- myzon zu vergleichen.
3. Der zweite Aortenbogen wird angelegt.
4. Das Spritzloch bricht dutch und bleibt eine geraume Zeit often.
5. Die erste Anlage der Kiemen besteht aus paarigen Vor- treibungen, ein Zustand, wie er bei Polypterus gefunden wird.
6. Sowohl ein Spritzloch wie eine Kiemendeckelkieme werden als Rudimente angelegt.
7. Wie bei Selachiern, bildet jede Schlundtasche eine Thymus- anlage; freilich nut die zweite bis ftinfte Spalte bringt
760 " H a r r y N a r c u s :
wie bei Lepidosiren ( B r y c e [05]) es zu abgeschntirten Thymusknoten, die andauernd selbstandig bleiben, walirend sonst bei den Amphibien weniger Anlagen vorhanden sind und diese sekundar verschmelzen.
DieStreitfrage nach der H o m o l o g i e d e r K i e m e n ist dutch die Arbeiten yon G o e t t e , M o r o f f und G r e i I wieder entfacht. Gegen G r e i l habe ich schon im speziellen Tell in dieser Frage Stellung genommen: Ich halte die Amphibienkieme, entsprechend meinen Befunden bei Hypogeophis, filr rein ekto- dermale Bildungen. Damit ist die Homologie der Kiemen als Darmkiemen hinfNlig in tier Anamnierreihe.
Wenn wir nun die Amphibienkieme nach abwttrts in der Wirbeltierreihe verfolgen, so erscheint ihre Homologisierung mit tier Teleostier- uud Selachierkieme auf guter Grundlage zu stehen. Naeh den ~ tibereinstimmenden, exakten Arbeiten yon Go e t t e und M o r o f f ist ein Zweifel tibet" die ektodermale Natur tier Teleostierkieme nicht gestattet ohne eine eingehende Widerlegung tier yon ihnen geschilderten und abgebildetdn Vorgange. Das- selbe gilt ftir die Selachierkieme im allgemeinen. Freilich diver- gieren diese beiden Forscher in bezug auf die Spritzlochkieme. G o et t e beschreibt diese Spritzlochkieme als -einen medianwarts gerichteten Auswuchs. dessen entodermale Natur nach den drei abgebildeten Schnitten unzweifelhaft ist, da man einem so gefibten Beobachter eine Tauschung durch schiefe Schnittfiihrung nicht zumuten daft (wie Moroff, pag. 195, es tut). Morof f (04) hat nun gegen Goe t t e polemisiert und gezeigt, dass die Spritzlochkieme ebenso wie die tibrigen also ektodermal entsteht. Diese Behauptung ist ebenfalls durch eine Abbildung fiberzeugend belegt. Morof f hebt ferner mit Recht hervor, dass eine verschiedenartige Ent- wicklung der an verschiedenen Visceralbogen sitzenden Kiemen bei einem Tier unwahrscheinlich ware; er sieht darin eine St~itze ftir seine Auffassung yon der ektodermalen Abstammung der Spritzlochkieme. Diese Argumentation greift G r e i l auf und yon der entodermalen Spritzlochkieme Go e t t e s ausgehend, sagt er, alle tibrigen mfissten auch Darmkiemen sein. Meiner Ansicht nach stehen die Beobachtungen yon G o e t t e und M o r o f f nur in einem scheinbaren Widerspruch; sie lassen sich, glaube ich, un-
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 761
gezwungen vereinigen, sodass beide Angaben zu Recht bestehen bleiben. D ie S p r i t z l o c h k i e m e d e r S e l a c h i e r w i r d w i e d i e t ~ b r i g e n e k t o d e r m a l a n g e l e g t ( M o r o f f ) u n d g e l a n g t s p h t e r h i n d u t c h V e r l a g e r u n g im L a u f e d e r E n t w i c k l u n g in e i n e so v e r h n d e r t e P o s i t i o n , d a s s s i e a l s e n t o d e r m a l e s G e b i t d e impon ie r t (Goette). Diese Vermutung gewinnt an Wahr- scheinlichkeit durch den analogen Fall, den ich bei ttypogeophis beschriebeu babe. Den Epithelfortsatz meiner Figur 24 muss jeder Unbefangene als rein entodermales Gebilde ansprechen, w;d~rend ich es yon dem Rudiment der ektodermalen Kieme yon Figur 23 ableiten konnte. Die gleichen Prozesse werden sich bei Selachiern abspielen nnd ich bitte zu beachten, dass M o r o f f die jtmgste Anlage besci~reibt, wahrend G o e t t e yon einem 5lteren Stadium seine Abbildung gibt.
Meiner Deutung zufolge werden also die Selachierkiemen al|e nach gleichem Prinzip angelegt. Dadurch fitllt die yon G o e t t e versuchte Homolisierung der Spritzlochkieme der Selachier mit denen der Cyclostome, und es fitllt was mir noch viel Wesent- licher erscheit, jedes Moment hinweg, fins flit ein zu (~runde gehen einer Kiemenart spricht. Amphioxus und Cyclostome haben bekam~tlich Darmatmung. Diese war also die ursprtingliche, folgert G o e t t e ; s i eg ing bei den Gnathostomen zu Gruude und nut bei den Selachiern erhielt sie sich in der Spritzlochkieme und dann bei den Amphibien iu den Lungen. Die Hautkiemen waren ein neuer Erwerb. Die Selachier wt~rden ALSO das Uber- gangsstadium yon der Darm- zur Hautatmung darstellen. Diese Mfffassung G o e t t e s kanu ich nicht teilen. Dadurch dass ich mit M o r o f f , freilich unter Respektierung yon G o e t t e s Befund, die Spritzlochkieme mit den ttbrigen Kiemen der Selachier gleich setze, fehlt jegliches Faktum, das die Hypothese sttitzen k~nnte, dass Darmkiemen zu Grunde gegangen seien und als Ersatz und Neuerwerb die Hautatmung aufgetreten sei.
Wit haben einfach die nakten Tatsacl~en: Amphioxus und Cyciostome haben Darmatmung, die iibrigen Wirbeltiere Haut- atmung. KSnnen wir nun letztere yon ersterer ableiten? Diese Frage mtissen wit mit ,,bTein" beantworten. Und da wir nicht mit D o h r n Cyclostome uud Amphioxus als yon Proselachiern abgeleitet ansehen wollen, scheint die Kluft bei der Kiemen-
762 H a r r y M a r c u s :
ableitung in der Anamnierreihe untiberbriickbar zu bestehen. Trotzdem glaube ich nicht an einen allzu schroffen Gegensatz zwischen der Selachier- und Cyclostomenkieme, sondern m~chte ahnlich wie D o h r n eine mehr vermittelnde Stellung einnehmem Freilich ging D o h r n yon ganz anderen Gesichtspunkten aus_ Er hielt das Mesoderm mit den Blutgefassen ftir das Weseutliche bei der Kiemenbildung, wobei es also gleichgtiltig sei, ob gerade- ektodermales oder entodermales Epithel vorgesttilpt wfirde. Die gleiche Ansicht vertritt M o r o f f (04)~ Ich bin dagegen im speziellen Teil der Ansicht Goe t t e s gefolgL dass alas Primare bei der Kiemenbildung die Epithelvorsttilpung sei, der die Gef'asse folgen. Aber ich finale, dass der Befund, dass eine ektodermale Kieme durch ungleichmassiges Wachstum ihrer Umgebung zu: einem scheinbar rein entodermalen Gebilde werden kann, muss zu denken geben, ob nicht durch gewissermassen rein mechanische Ursachen wahrend der Entwicklung solche divergente Bildungen wie Haut- und Darmkiemen erklhrt werden kSnnten. Und so mbchte ich die Vermutung aussprechen, dass die Kiemen roll Amphioxus und Cyclostomen durch analoge Vorghnge, wie wir sie bei der Kiemendeckel- und Spritzlochkieme der Gymnophionen resp. letzterer der Selachier geschildert haben, aus ursprtmglichen Hautkiemen Darmkiemen entstanden sind.
Freilich ontogenetisch wird dieser Prozess sich nicht mehr ausdriicken, well die Gruppe Amphioxus, Cyclostome sehr stark caenogmetisch modifizierte Tiere sind.
Die Hautatmung Mite ich aus folgenden Griinden ftir die Primare.
Bei den Wirbellosen tibernimmt iiberall das Integument die Funktion des Atmens. Bei Wfirmern, Crustaceen und Mollusken finden wir tiberall Hautkiemen. Bei Coelenteraten tibernimmt die fiussere Zellreihe den Gasaustausch mit dem itusseren Medium~ wie bei Protozoen das Exoplasma.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass bei der Gruppe. die Darmatmung aufweist (Balanoglossus, Tunicaten, Amphioxus und Cyclostome) sehr starke Modifikationen eingetreten sind.. Ich erinnere nur an die Kiemen yon Myxine, an den Peri- branchialraum yon Amphioxus. Bei den Ascidienlarven findet man alle Ubergange bei der Kiemenspaltbildung. In einigen Falleu ist fast ausschliesslich das Ektoderm, in anderen das Entoderm
Bei t r~ge zur K e n n t n i s der Gymnopl l ionen. 763
daran beteiligt. So schreibt F e c h n e r (07) von Polycyclus renieri pag. 545 ,,an der Bildung der Spalten ist das Ektoderm f;tst ausschliesslich beteiligt, whhrend dem Entoderm ein nahezu verschwindender Anteil zuerkannt werden kann". Meistens ist das Ektoderm der aktive Teil: ,,Den ersten Anstoss zur Falten- bildung gibt auch hier (bei Polycyclus renieri) eine Faltenbildung im Ektoderm, die gegen das sich v011ig passiv verhaltende Entoderm vorw~tehst." (pag. 543.) Im Gegensatz hierzu wird bei Ecteinascidia turbinata ( H e r d m a n n) ;,die Spaltenanlage ausschliesslich dutch die Vorstfilpung des Entoderms bedingt, w~thrend das Ektoderm platt fiber die Kuppe dieser Vorstfilpung hinwegzieht ~ (pag. 531). Bei diesen Ascidien kommt es nicht zur eigentlichen Kiemenbildung; doch das ist gleichgfiltig, ob das Epithel in glatter Lage ausreicht oder zur Oberflhchen- vergrSsserung zur Kieme auswhchst, um seiner Funktion der Atmung zu genfigen. Bei tier einen Ascidie hatten wird fast ausschliesslich Darmatmung, bei der nahen Verwandten fast reine Hautatmung. Hier existiert tats~tchlich kein Gegensatz: Haut- und Darmatmung beweisen durch alle b~bergangsformen, dass sie aus einer gemeinsamen Quelle stamn~en.
Cnd als solche fassen wit" das Ektoderm auf, weil es das physiologisch gegebene ist und weil w i r e s fast ausschliesslich bei Wirbellosen so antreffen.
V e r g l e i c h d e r T h y m u s u n d d e r S e x u a l z e l l e n .
Zum Schluss m0chte ich noch einen Vergleich der eigen- tfimlichen Zellvorg~,tnge in der Entwicklung der Thymus mit den Vorghngen bei der Entwicklung der Geschlechtszellen geben.
Durch die Lehre yon der ,,Kontinuitttt des Keimplasma ~' und ihrer Spezialisierung der ,,Individualitat der Chromosome" sind die t}eschlechtszellen in einen solchen Gegensatz zu den Soma- zellen gesetzt worden, dass sie kaum noch zum Individiuum zuzugeh0ren scheinefi. Der Vorteil dieser Hypothesen war zweifellos eine sehr genaue Durchforschung der cytologischen Veranderungen, welche die Sexualzellen durchzumachen haben. Es wurden eine Menge Tatsachen entdeckt, aber meistens wurden diese als spezielle Eigenschaften der Geschlechtszellen aul'gefasst
Archiv f. mikrosk. A~at. Bd. 71. ~')0
76~ H a r r y M a r c u s :
denell eine allgemeine Verbreitung nicht zukomme. Aber auch wenn in den KSrperzelien eine an Masse geringere (Ascaris) oder auch qualitativ verschiedene Substanz als in den Geschleehts- zellen angenommen wird, so darf man nicht aus dem Auge ver- lieren, dass letztere doch in erster Linie Zellen sind und den gleichen Gesetzen wie die tibrigen Zellen unterworfen sind. Es ist daher gar nicht einzusehen, weshalb nicht unter gleichen Bedingungen K6rperzellen Ver~tnderungen eingehen kSnnten, die bisher als charakteristisch ftlr Sexualzellen angesprochen wurden. also z. B. das Synapsisstadium. Und in der Tat sah ich ent- sprechende Bilder in der Thymus, freilich nicht so deutlich als in den klarsten Bildern der Sexualzellen. aber sicherlich nicht undeutlicher als in vielen anderen Geschlechtszellen.
Wir ~vollen nun betrachten, ob nicht in beiden Fallen eine g[eiche Ursache vorliegen kauu. Die Reifuug der Gesehlechts- zellen geschieht in drei Perioden. In der Vermehrungsperiode nehmen die Ovogonien dutch rasche Teilungeu an Zahl stark zu, an (~rSsse ab~ Dann kommt die Wachstumsperiode, auf welche die zwei Reifeteilungen folgen. R. H e r t w i g hat einmal im Gesprach mit nns, seinen Schiilern, die Ansicht ausgesprochen. dass durch unterdrfickte unvollsthndige Teilungen das Heran- wachsen des Kernes w~ii~rend der Wachstumsperiode zum Keim- bli'tschen erkl;trt werden k6nnte. Man kSnnte die stets beobachtete L;tngsspaltung in den chromatischen Schleifen :im Leptot(~le - und ])iplot~ne-Stadium als Teilungsversuch deuten. Auf diese Anregung hin hat Po p o f f (lie geifeerscheinungen nrther studiert und ist zu Resultaten gelangt, die ein vbllig neues Licht auf diese VorgSnge werfen. In seiner noch unver(~ffentlichten Arbeit ffihrt P o p o f f etwa folgendes aus. Am Schluss der Vermehrungs- periode ist die Ovogonie in starker Depression, der Kern sehr gross und chromatinreich. Das Chromatin ist stark osmotisch wirkend und dadurc.h ist eine starke Wasserauinahme in den Kern bedingt. Das Resultat dieser dutch die osmotischeu Druckunterschiede entstandenen WirbelstrSmungen ist die Synapsis. Nach dem ersten stiirmischen Verlauf gelangt tier Prozess i~ ruhigere Bahnen. Die Synapsis 15st sieh. Doch ist alas Anwachseu des Kernes so gross, dass ihr die Kernmembran nicht folgen kann: sie reisst an einer Stelle ein. Ein Teil des Kerninhaltes str~mt heraus: Chromidien-(Mitochondrien-)Bildung. Dutch die
Beitr~ige zur Kenntnis der Gymnophionen. 765
dabei entstehenden Str~mungen werden die Chromatinschleifen in der ftir das ,,Bouquetstadium" cMrakteristisehen Weise angeordnet. Es stimmt in der Tat fiberein, dass die Chromatin- sehleifen immer auf einen Punkt gerichtet sind, wo ausserhalb des Kernes die chromatischen Massen liegen. Beobachten kann man alas Loch in der Kernmembran natiirlich nicht. -- Durch den Austritt yon Kernsubstanz ist das Verhaltnis yon Kern und Plasma wieder der ~Norm gen[thert und es erfolgt die AuslSsung zur Teihmg. P o p o f f hat zwei unvollkommene Teilungen bei der Reifung der Geschlechtszellen naehweisen kSnnen. Nach dieser Auffassung zeigen die $exualzellen Erscheinungen. die wir im gewShnlichen Zellleben als pathologisch aufzufassen gewohnt sind~ die aber ft~r sie typisch und normal sind. P o p o f f ver- gleicht sie mit Protozoen in Depression. die j,n auch nut in diesem Zustande sich geschlechtlich fortpflanzen.
Ich mSchte nun noch einen Schritt weitergehen und die zwei Reifeteilungen yon diesem Gesiehtspunkt aus beleuchten. Vor den Reifeteilungen treten die Tetraden auf. Die Chromosome sind durch die zwei unvollkommenen Teilungen ebenfalls stark yon der Norm verSndert; sie sind paarweise'vereinigt und so ist die Iteduktion der Zahl eingetreten. Wo diese Vereinigung stattfindet. ist in diesem Zusammenhange nicht yon Belang; dass sie tiber- haupt stattfindet, kann auch als ein Depressionszeichen gedeutet werden, dass die Chromosome eben miteinander verkleben oder sich nicht wie normal trennen kSnnen. Der Anblick der Tetraden best;ttigt unsere Auffassung. Meistens sind es runde, unfOrmliche Chromatinkugeln, wahrend in jt~ngeren Stadien die Chromosome schlanke Stabe waren. Die Zelle selbst weist vor den Reife- teilungen eine hohe Kernplasmaspannung auf; eine geringer Reiz genfigt, um elsie Zellteilung zur AuslSsung zu bringen. Erfolgt dieser~ so setzt die Reifeteilung ein. Die Chromosome sind vor allem so modifiziert, dass sie unft~hig sind, wie sonst auf ihre doppelte GrSsse heranzuwachsen, dadurch werden bei der trotzdem erfolgenden Teilung ganze Chromosome auf die beiden Tochter- zellen verteilt. Genau der gleiche Prozess findet auch in der zweiten Reifeteilung statt. Mit anderen Worten: Die beiden Reifeteilungen vollenden das, was die beiden unterdrtiekten, unvollkommenen Teilungen wahrend der W,xchstumsperiode ver- saumt hatten. Wahrend der ersten unvollkommenen Teilung
50*
766 H a r r y M a r c u s :
hatte jedes Chromosom sich verdoppelt, bei der zweiten jedes dieser Tochterchromosome wiederum, sodass aus dem einen nun vier geworden sind. Die Ovozyte erster Ordnung ist somit eine tetrakaryotische, die zweiter Ordnung eine diplokaryotische Zelle!
Definitive Ei- und Samenzelle dagegen sind wieder normale Zellen. Die Reduktion der Zahl hat, wie schon oben erwahnt. mit dieser Frage gar nichts zu tun, wo es sich nur um Massen handelt, deren Anordnung in Verb~tnde unwesentlich ist. Ich kann also auch hier die sehon frtiher von mir (06b) vertretene Ansicht, dass beide Reifeteilungen wesensgleich w~tren, aufrecht erhalten. Mag man nun diesen ganzen Chromosomen, die bei de~l Reifeteilungen an die Tochterzellen verteilt werden: eine Bedeutung im Sinne W e i s m a n n s zumessen oder nicht, jeden- falls, gl~mbe ich, kann man diese mehr physikalisch-ehemische Deutung der Reifeerscheinungen nicht gegen We i s m a n n aus- spielen.
Wenn wir nun nach dieser Abschweifung zur Thymus zurtickkehren, so k0nnen wir leicht einen Vergleich mit den Geschlechtszellen durchftihren. In beiden F~dlen kommt zuerst eine Vermehrungszone, durch welche die ursprtmglich sehr sparlichen Zellen an Zahl ungeheuer zunehmen. Durch die rapide Proliferation gelangen beide Zellarten in Depression.
Beide Zellarten wachsen durch unvollkommene Zellteilung heran. Die Ursache ist die gleiche. In beiden FMlen kommt es zur Dotterbildung. aus Unf~thigkeit, zu assimilieren. Ein dotterkernartiges Gebilde fanden wir in der Thymus, das dem vieler Eizellen vSllig entsprach. Es ist selbstverstandlich, dass gleiche Ursachen auch gleiche Wirkung haben werden; daher sehen wit bei der Thymuszelle vor der unterdrfickten Teilung ein Sypnasisstadium. Wegeu der Erkl~trung verweise ich auf das oben gesagte und besonders auf die Arbeit P o p o f f s , doch m0chte ich nochmals betonen, d a s s e s sich bei diesen Zellen vielleicht nut um pyknotische Kerne handelt.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Zellarten liegt darin, class die Sexualzelle durch die zwei Reifeteilungen sich zur Norm erholt, dass dagegen bei tier Thymuszelle eine solche Kompensation nicht eintritt. Dadurch ist letztere dem Unter- gange geweiht, trotz mannigfacher Restitutionsversuche. Verwandt mit diesen sind auch die Metaplasien der Zellen. Ahnlich wie
Beitr[ige zur Kenntnis der Gymnophionen. 767
bei Embryomen oder Dermoidzysten das pathologische Gewebe alle mbglichen histologischen Differenzierungen aufweist, wie z. B. Knochen, Haare, Zithne, Sinnesorgane etc., so werden ebenfalls ftir die Thymus Schleimzellen und besonders quer- gestreifte Muskelzellen, ja sogar Ganglienzellen beschrieben. Letztere Angabe yon F l e i s c h l (69) bedarf freilich der Bestatigung, doch sind die Befunde fiber 5iuskelzellen tiber jeden Zweifel erhaben. Ein Eindringen dieser Muskelzellen yon aussen ist in den meisten F~tllen auszuschliessen (We i s s e n b e r g) und diese 5fetaplasie der Thymuszellen hat nichts wunderbareres als die yon Geschwulstzellen. denn beide sind abnorm.
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s .
A f a n a s s i e w (77) : l~ber die konzentrisehen KSrper der Thymus. Arch. f. mikr. Anat., Bd. X1V.
A m m a n n (82): Beitr[tge zur Anatomic der Thymus. Basel. B e a r d (94): The development and p:obal)le flmction of the thymus. Anat.
Ariz., Bd. 9. Derselbe (00): Thymus elemeuts of the Spiracle in Raja. Am~t. Anz., Bd. 18. Derselbe (02): The Origin and Histogenesis of the Thymus in Raja batis.
Zool. Jahrb. Anat., Bd. XVII B e l l (05) : The development of the thymus. Amer. Journ. Anat., Vol. 5. B o l a u (99): Glandula thyreoidea und Glandula Thymus bei den Amphibien.
Zool. Jahrb. Anat., Bd. XII. B o r n (83): ['~ber die Derivate der embryonalen Schlundbogen und Schlund-
spalten bei S:,tugetieren. Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXII. B o u l e n g e r (95,: A Synopsis of the Genera and Species of Apodal
Batrachians etc. Proceedings Zool. Soc. London. B o ve r i (05) : Zellstudien Y. Jena. B r a u e r (97): Beitr~ige zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte und der
Anatomic der Gymnophionen I. Zool. Jahrb. Anat., Bd. X. Derselbe (99): Beitrag II. b'ber die :,iussere K0rperform. Ebenda, Bd. XII. B r y c e (05): A contribution on the origin of the embryonian leucocytes.
72nd annual meeting, Brit. reed. Asoc. of Anat. Brit. med. Journ. Ref. Centralblatt f. Anat. und mikr. Teehnik ill. Nov. 1904.
C a l b e r l a (77): Zur Entwicklungsgeschichte des Petremyzon. Berichte Deutseher Naturforscher und i~rzte, 50. Vers. in Ntinchen , S. 188.
C 1 e m e n s (95) : Die ~tusseren Kiemen der Wirbeltiere. Anat. Hefte, Abt. I, Bd. V.
C a p o b i a n c o (92): Contribution i~ la morphologie du thymus. Arch. de biologie ital. Bd. XVII.
768 H a r r y ~ [ a r c u s :
C o p e (86): On the structure and affinities of the Amphiumidea. Prec. Amer. Philos. Soc. Philadelphia, Bd. 23.
D oh r n (84--87): Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkhrpers IV- -XI I . Mitteil. d. Zool. Station Neapel, Bd. V--VII .
D r i i n e r (01): Studien zur Anatomie der Zungenbein-, Kiemenb,~gen- un~I Kehlkopfmuskeln bei Ur~delen. Tell I. Zool. Jahrb. Anat.. Bd. XV
Derselbe (04): Tell II. Ebenda, Bd. XIX.
F a u s s e c k (02): Beitrage zur Histologie der Kiemen bei Fischen und Amphibien. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 60.
F e c h n e r (07): Beitr~ge zur Kenntnis der Kiemenspaltbildung der Ascidien. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 86.
F i s c h e l i s (85): Beitrhge zur Kenntnis der Entwieldung der Glandula thyreoidea und Glandula thymus. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 25.
F l e i s c h l (69): Uber den Bau einiger sogen. Driisen ohne Ausfiihrghnge. Sitzungsber. Wiener Akad.. Bd. 60, II. Abt.
F o l , A. (76): 0ber die Schleimdrfisen oder den Endostyl der Tunic~ttcn. Morph. /lahrb., Bd. I.
G e g e n b a u r (01): Vergleich. Anat. d. Wirbeltiere. Bd. II.
G b e t t'e (75): Die Entwicklungsgeschichte der l 'nke.
Derselbe (90): Entwicklungsgesehichte des Flnssncmlauges. tIambnrg un(I Leipzig.
Derselbe (01): Ubcr Kiemen der Fische. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 69. Derselbe (05): Uber den Ursprnng der Lungen. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat.,
Bd. 21. G o 1 d s e h mi d t [04) : Der ChromidiMapparat lebhaft funktioniercnder G ewebs-
zellen. Zool. Jahrb. Anat., Bd. XXI. Derselbe (06): Amphioxides. Deutsche Tiefsee-Exped., Bd. XII. Go o d a l l (05): The postnatal changes in the thymus of Guinea-pigs, and
the effect of castration on thymus structure. Journ. Phys:, Cambridge, Vol. 32.
G r e i l (05, a): Uber die Anlage der Lungen, sowie tier ultinlobranchialen. Khrper bei anuren Ampbibien. Anat. Hefte, Bd. 29.
Derselbe (05, b): Uber die Genese dcr NundhtihIenschIeimhaut der Urodelen. Yerhdl. Anat. Gesellsch. 19. Vers. in Genf.
Derselbe (06, a) : Uber die Entstehung der Kiemendarmderivate yon Cerat.dus F. Ebend. 20. Vers. in Restock.
Derselbe (06, b): Uber die Homologie der Anamnierkiemen. Anat. Anz., Bd. 28. G u 11 a n d (91) : The development of Adenoid Tissue etc. Laboratory Reports,
iss. by Royal Coll. of Physicians. Edinburgh, Vol. III. H a m m a r (05): Zur Histogenese und Involution der Thymusdriise. Anat.
Anz., Bd. 27. Derselbe (07): Uber Gewicht, Involution und Persistenz der Thymus. Arch.
f. Anat. u. Phys., Anat. Abt. Suppl. H a s s a l l (52): Mikroskopische Anatomie. Deutsche tJbersetznng yon Kohl-
schfitter. Leipzig.
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 769
H e r t w i g ~ R. (98): Uber Kernteilung, Richtungsk~rperbildung und Be- fruchtung yon Actinosph~rium Eichhorni. Abhandlg. k. bayr. Akad. d. Wiss., II. Cl., Bd. XIX, III. Abt.
Dersclbe (05): t~ber alas Problem der sexuellen Differenzierung. Verhdl. der zoolog. Gesellsch.
H i s (89): Schlundspalte und Thynmsanlage. H o f f m all n (86) : Weitere Untersuchtmgen zur Entwicklungsgeschichte tier
t~eptilien. Morph. Jahrb.~ Bd. XI. Derselhe (90): Reptilien. Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs. K a t s e h e n k o (87): Das Schicksal der embryonalen SchlundspMten bei
g~ugetieren. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 30. K e 11 i c o t (95): The development of the vascular and respiratory system~
r Ceratodus. ~New-York Academy of Sciences Mere., Vol. 2. K e r r (00) : The external features in the development of Lepidosira paradoxa
Fitz. Philos. Trans. R. Society London, Ser. B., Vol. 192. L e w i s (05): The avian thymus. Journ. Phys., Cambridge, Proc. Vol. 32. L e y d i g (53): Untersuehungen iiber F[sche und Reptilien. Berlin. L i e s s n e r (88): Ein Beitrag zur Kenntnis der Kiemenspalten und ihrer
Anlagen bei amnioten Wirbeltieren. Morph. XIII. L i v i n i (02): Organi del sistemo timo, tireoideo nella Salamandrina perspi-
eillata. Arch. ital. Anat. e Embriol., Vol. I. ~I a l 1 (87): b:ntwicklung der Branchialbogen und -Spalten des Hiihnchens.
Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abt. M a r c u s (I)~}a): [Tber die Wirkung der Tempe~atur auf die Furchung bei
Seeigeleiern. Arch. f. Entw.-Mech., Bd. 22. Derselbe (07): [~ber die Thymus. Verhdl. d. anat. Gesellseh. in Wilrzburg. Derselbe i06b): E~ und Samenreife bei Ascaris. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 68. M a r s h a l l und B l e s (90): The development of the blood vessels in the
frog. Studies biol. Labor. Owens College. (Zitiert nach H o c h s t e t t e r in O. g e r t w i g s Handbuch der Entwicklungsgeschichte.)
M a u r e r (86): Schild~h'iise und Thymus der Teleostier. ]~[orph. 5ahrb., Bd. XI. Derselbe t88): Schilddriise, Thymus und Kiemenreste bei Amphibien. Ebenda,
Bd. XIII. l~crselbe (88): Die I(iemen und ihre Gef~sse bei anuren und urodelen Am-
phibien. Ebenda, Bd. XIV. Derselbe (99): Die Kiemen, ihre Gef~sse und andere Sehlundspaltenderivate
bei der Eidechse. Ebenda, Bd. XXVII. l)erselbe (99): Die Kiemen, ihre Gef~sse und sonstige Schlundspaltenderivate
bei Echidna III. Jenaisehe Denkschr. VI, Semon, Zool. Forschungsreisen. Derselbe (02): Handbueh yon O. H e r t w i g . ~[ a y e r. 8. I88): Zur Lehre yon der Schilddrtise und Thymus hei den Am-
phibien. Anat. Anz., Bd. III. d e ~ [ e u r o n (86): Reeherches sur le developpement du thymus et de la
glande thyreoide. Receuil Zool. Suisse III. ~I o r o f f (02): Uber die Entwieklung der Kiemen bei Knochenfischen. Arch.
f. mikr. Anat., Bd. 60. Derselhe (04): Uber die Entwicklung der Kiemen bei Fischen. Ebenda, Bd. 64.
770 H a r r y ~ I a r c u s :
5[ o s e r (02) : Beitrag zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Wh'bel- tierlunge etc. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 60.
M ii l l e r , W. (71): Uber die Entwieklung der Schilddriise. Jenaische Zeit- schrift, Bd. VI.
Derselbe (73): l)ber die Hypobranchialrinne der Tunicaten m~d deren Vor- handensein bei Amphioxus und den Cyclostomen. Ebenda. Bd. Vii.
N u s b a u m und N a c h o w s k y (02): Die Bildung der konzentrischen KSrperehen etc. Anat. Anz., Bd. 21.
N e u m a y e r (04): Die Entwicklung des Darmkanals yon Lunge. Leber. 5[ilz und Pankreas bei Ceratodus Forsteri. Semon, Zool. Forscbungs- reisen.
0 P p e 1 (05): Ergebnisse der Anatomie und Entwk'khmgsgcsehichte ( M e r k e l und Bonne t ) . Bd. XIV, 1904.
P e n s a (05): Osservazioni sulla struttura del timo. Anat. Anz.. Bd. 27. P e t e r (01): Die Entwieklung der Schlundspalten bei der Eidechs~,. Arch.
f. mikr. Anat., Bd. 57. P i e r s o l (88): Uber die Entwieklung der embryonalen Sehlundspalten und
ibre Derivate bei S'~ugetieren. Zeitsehr. f. wiss. Zool., Bd. 47. P l a t t (94): Ontogenetiscbe Differenzierung des Ektoderms in Necturus.
�9 Arch. f..mikr. Anat., Bd. 49. Dieselbe (96): The development of the thyreoid gland and of the supraperi-
cardial body in Necturus. Anat. Anz., Bd. XI. P r e n a n t (94): Contribution iL l'6tude du d6velpppement organique et histo-
Iogique du thymus, de la glande thyreoide et de la glande carotidienne. La Cellule Tom. X.
P r y m a k (02): Beitr~ge zur Kenntnis des feineren Baues der Involution der Tbymusdr~ise bei den Teleostiern. Anat. Anz., Bd. 21.
R a b l (89): Theorie des l~[esoderms I. Morph. Jallrb., Bd. XV. R a t h ke (32) : Anatomisch-pbilosophische Untersuehungen [iber den Kiemen-
apparat und das Zungenbein der Wirbeltiere. Dorpat. R e e s e (02): Structure and development in Thyreoid gland in Petromyzon
Proo. Aead. natur. Sciences Philadelphia. Bd. 54.
R e n a n t und P o l i c a r d (05): Etude histologique et cytologique sommaire de l'organe de Ammocoetes brancbialis, improprement nomm6 corps Thyr~oide. Compt. Rend. Assoc. d. An,~tom. 7 R~v. G6n6ve.
R o u d (00) : Contribution '~ l'~tude de l'origine et de l'6volution de la tyro'ide laterale et du thymus chez le campagnol. Bull. Soci~t6 Vaudoise d Sciences nat., Vol. XXXVI, No. 137, Lausanne.
S a r a s i n (87--90): Zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie der ceylo- nesischen Blindwiible lchtyophis glutinosus L. Ergebn. naturw. Forschungen auf Ceylon. Bd. II.
S c h a f f e r (93): LTber den feineren Bau der Thymus und deren Beziehung zur Blutbildung. Sitzungsb. Akad. Wissensch. Matb.-natm~v Klasse. Wien. Bd. 102, Abt. III.
Derselbe (94): Uber die Thymusanlage bei Petromyzon Planeri. Ebend~ Bd. 109.
Beitr~ge zur Kenntnis der Gymnophionen. 771
Schede l (85): Studien fiber die Regeneration der Gewebe. Zellvermehrung in der Thymus. Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXIV.
S e e s s e l (77): Zur Entwicklungsgeschiehte des Vorderdarms. Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abt.
S p e n g e l (04): Uber Schwimmblasen-, Lungen- und Kiementaschen der Wirbeltiere. Festschrift f. Weismann. Zool. 5ahrb., Suppl. VII.
S t o c k a r d (06): Development of the mouth et gills in Bdellostoma stouti Amer. Journ. of Anat. Vol. II.
S tSh r (06): Uber die Natur der Thymuselemente. Anat. Hefte. 1. Abt. Bd. 3L S c h w a l b e , E. (07): Die Morphologie tier Missbildungen des ~Ienschen und
der Tiere. II. Teil. Die Doppelbitdungen. Jena. S u l t a n (96): Beitrag zur Involution der Thymusdrfise. Virchows Archiv~
Bd. 144. V e r d u n (98): Derives branehiaux chez les vertebras sup~rieurs Toulouse. V a n B e m m e l e n (85): Uber vermutliche rudiment:~tre Kiemenspalten be[
Elasmobranchiern. ~[itt. a. d. Zool. Station I~eapel. Bd. u Derselbe (89): [~ber die SuprapericardialkSrper. Anat. Anz., Bd. 4. V a n W i y h e (83): i~bcr die Mesodermsegmente und die Entwicklung der
Nerven des Selachierkopfes. Verh. d. Akad. Wetensehappen Amsterdam. Bd. XII.
V e t E e c k e (99): Structure et modification fonctiouelles du Thynms de la grenouille. Bull Acad. roy. reed. Belgique.
W a l d e y e r (90): Die Rfickbildung der Thymus. Sitzungsber. Akad. d. Wiss. Berlin. Nr. 25.
Wa l l i s : ch (04): ZurBedeutung der Hassa l l s cheu KSrperchen. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 63.
W a t n e y (82): On the minute anatomy of the Thymus, Philos. Transactions Roy. Society. Par t III, Vol. 173.
W e b e r u. B u v i g n i e r (03): L'origine des @branches pulmonaires ehez quel- ques vert@br@s sup6rieurs. Bibliogr. anat. Tom 12.
W eys s e (95): Uber die ersten Anlagen der Hauptanhangsorgane des Darm- kanals beim Frosch. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 46.
W a s s i t i e f f (07) : Die Spermatogenese yon Blatta germanica. Arch. f. mikr. :knat., Bd. 70.
W e i s s e n b e r g (07): [)ber die quergestreiften Zellen der Thymus. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 70.
W i e d e r s h e i m (79): Die Anatomie der Gymnophionen. Jena. Derselbe (04): Uber das Vorkommen eines Kehlkopfes bei Ganoiden un(I
Dipnoern. Zool. :lahrb., Festschr. W e i s m a n n . Z i e g l e r , E. u. F. (92): Beitr~ge znr Entwicklungsgeschichte yon Torpedo-
Arch. f. mikr. Anat., Bd. 39. Z w e i g e r (06): Die Spermatogenese yon Forficula auricularia. Zool. Ariz..
Bd. XXX, Nr. 7.
772 H a r r y M a r c u s :
Erklarung der Abbildungen auf Tafe l X L V I I - - L . Samtliche Figuren sind mit ttilfe des A bbesehen Zeiehenapparat entworfen
T a f e l X L V I I .
VergrSss. 106fach. Ok. 2, Obj. AA, yon Z e i s s auf 2/a verkleinert.
Figg. 1--3. Erste 1VIandibular-Sehlundtasche. Querschnitt durch Embryonen
Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. IO. Fig. 11. Fig. 12.
yon 4--5 Segmenten. Erste Schlundtasche. Quersclmitt. 1(; Segmente. Stud. 7. Zweite :, Dasselbe Pr~parat weiter kaudal. Erste Querschnitt. 29 Segmente. Stud. 12.
, , , 44 19 Stud. 11. r ~ r r,
Zweite ~ Dasseibe Priiparat kaudalw~rts.
Dasselbe Pri~parat wie Fig. 6. Dritte ~ , ) Die ersten vier Schlundtaschen. Bei der vierten haben sich die entodermale und ektodermale noch nicht erreicht. Bei der ersten und dritten ist der epitheliale Verbund des Entoderms ununter- brochen, scharf abgrenzbar vom Ektoderm. Bei der zweiten reicht dagegen das Entoderm wie zwei Keile in das Ektoderm. Drei Aortenbogen; der im Hyoidbogen ist ebenfalls ein starker Stamm. Horizontalschnitt. Stud. 17.
Fig. 13. Zellbrfieke zwischen Hyoidbogen und erster Kieme. Horizontal- schnitt. Stud. 30.
Fig. 14. Paarige ~_nlage der Thyreoidea (abnorm). Zweite Sehlundtaschen- region. Querschnitt. Stud. 20.
Fig. 15. Dasselbe Pr~parat kaudulw~rts.
T a f e l X L V I I I .
Fig. 16. Links zweite his sechstc Sehlundspalte; rechts auch siebente Sehlundtasche. Durch die starke Kopfkrfimmung zweimal Nerven- system getroffen. Itorizontalschnitt. Verg~Sss. 35fach. Ok. ,,9 Obj. a-'.
Fig. 17. Sechste Schlundspalte (6 Ksp). Zweite und dritte Kieme durctl Schnittrichtung abgetrennt. Horizontalschnitt. VergrSss. 106fach. Ok. 2, Obj. Ah.
Fig. 18. Vierter und ftinfter Kiemenbogen. Rechts (oral), Entoderm und �9 Ektoderm gehen ineinander fiber, links (kaudal) sind sie seharf
getrennt. VergrSss. 450fach. Ok. 2, Obj. DD auf ~/"~ verkleinert. Figg. 19--22. Entwicklung der ersten Kieme. VergrSss. 106 fach. Ok. 2,
Obj. AA. Horizontalschnitte. Fig. 19. Jiingste paarige Anlage der ersten Kieme. Stud. 20. Figg. 20 u. 21. Stad. 22. Fig. 22. Stud. 25.
Fig. 23. Rudiment~tre Kiemendeckelkieme (r K). Stad. 26. ttorizontalschnitt. Vergr~iss. 106faeh. Ok. 2, Obj. A A .
Beitritge zur Kenntnis der Gymnophionen. 77:-~
Fig. 24. Anhang am Hyoidbogen. Horizontalschnitt. Stad. 34. VergrSss. 106 fach. Hb ~ Hyoidbogen; 1 Brb ~ erster Branchialbogen.
Fig. 25. Dasselbe Pr~parat weiter ventral, auf der anderen Seite. Fig. 26. Anlage der sechsten Thymus an der sechsten Schlundtasche. Stad. 38.
Vergriiss. 450fach. Ok. 2, Obj. DD auf 1/:~ verkleinert.
T a f e l L X I X . Alle Bilder a~ff ~/.., verkleinert.
Fig. 27. Die drei ersten Sehlundtaschen: Beziehungen des Ektoderm und Entoderm zueinander. Horizontalschnitt. Ok. 2, Obj. AA auf ~, verkleinert. VergrSss. 106faeh
:Figg. 28 u. 2!1. Vorbereitung zum Durchbrueh der Schlundspalten. Stad. 18. Horizontalsehnitte. Vergr. 450fach. Ok. 2, Obj. DD.
Fig. 30. Distales Ende einer Kieme. Totalpraparat. Stad. 39. Embry, 2,6 cm. VergrSss. 35fach. Ok. 2, Obj. a -~.
Figg. 31--34. Spitzcn einerKiemcnfieder. Totalpr~,tparate. VergrSss. 450fach. Ok. 2, Obj. DD. Fig. 31. Stad. 41. Fig. 32. Stad. 48. Fig. 33. Stad. 49. Embryo 6:2 era. Fig. 34. Spitze yon Textfig. F.
Fig. 35. Thyreoidea unter dem Darm. Stad. 22. VergrSss. 106fach. Ok. 2, Obj. AA. Querschnitt durch GehSranlage; auf 1/~ verkleinert.
Fig. 36. Thyreoidea hanteifSrnfig zwischen M. mylohyoideus (m) und Ketfl- kopf M. intermaxillaris l i!. VergrSss. 106fach; auf ~/~ verkleinert.
Fig. 37. Querschnitt durch den Kopf eines 7 cm langen jungen Tieres. Thymus (tin); tr (Thyreoidea); muse. intermaxiltaris (i); X Vagus : muse. mylohyoideus (m); Zungenbein (z). ~[uskeln insoweit schema- tisiert, als die Fas('rrichtnng unberiicksichtigt ist. Vergrsss. 35 fach. ~.~ verkleiner~.
T a f e l L. Thymuszellen bei ]070facher VergrSsserung, wenn nichts anderes
angegcben ist. Fig. 38. Stad. 23. Fig. 39. Stad. "~6. Figg. 40 u. 41. 12,2 cm langes Tier. :Fig. 42. 10.2 cm langes Tier. Fig. 43. Stad. 49. 6,8 cm langes Tier. Vig. 44. 10,2 cm langes Tier. :Fig. 45. 10,2 ~ , Fig. 46. 10,2 , .~ ~ Vergriiss. [9(X)fach. Fig. 47. 1 0 , 2 , ,~ .,
Fig. 48. 9,(; .~ , :Fig. 49. 9.(; .. ~ , Fig. 50. 10;2 , Fig. 51a. 25 cm langes Tier gleich 5tb. Figg. 51b u. 52. 25 cm langes Tier. VergrSss. 1900fach.
774 H a r l ' y ~ [ a r c u s : Beitr'~ge zur Kenntnis der Gymnophionen.
Figg. 53 u. 54. 12 cm langes Tier. Die grau gezeiehneten KSrner si~d illl Priiparat intensiv mit Eosin gefiirbt.
Figg. 55--58. 10,2 em langes Tier. Fig. 59. 9I/.~ cm langes Tier. Hassa l l s che r K5rper und bem~chl)arte Thymus-
zelle zum Vergleich yon Fiirbung und GrSsse. Fig. 60. 12 cm langes Tier. Figg. 61--65. -~[quatorialplatten bei 19()0facher VergrSsserung.
Figg. 61a u. b. Stad. 34. Fig. 62. Stad. 45. Fig. 63. Stad. 48. Figg. (il u. 65. 9,6 em langes Tier.
Die Farbe der Zeichnungen entspricht nicht der F~rbullg d(.r Pr@arat% doeh ist die Intensit3t mSglichst entsprechend.