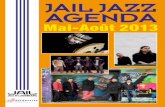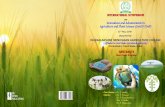Symposium über den Unabhängigkeitstag von Georgien am 26. Mai
Transcript of Symposium über den Unabhängigkeitstag von Georgien am 26. Mai
Heinrich-Heine-Universität Düseldorf September 2014
BEITRÄGE FÜR SYMPOSIUM
„DIE 96-JÄHRIGE
UNABHÄNGIGKEIT
GEORGIENS“ AN DER
HEINRICH-HEINE-
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF
1
Inhaltsverzeichnis
1. Ein Überblick über die Unabhängigkeitsgeschichte
Georgiens(Nino Burdiladze) ................................................................. 2
2. Geostrategische Bedeutung von fossilen Energieträgern für die
EU, Russland und Südkaukasus(Gaios Tsutsunashvili) .................... 5
3. Postsowjetischer Raum zwischen Europäischer und
Eurasischer Union. Georgiens Weg nach Europa(Mikheil
Sarjveladze) ......................................................................................... 12
„Institute for Georgian Foreign Policy“ (IGFP) hat ein Symposium an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf anlässlich der 96-jährigen Unabhängigkeitsfeier Georgiens
am 26. Mai 2014 organisiert.
„Institute for Georgian Foreign Policy“ ist eine nichtkommerzielle und unparteiische
Organisation, die 2014 gegründet wurde. Das Ziel dieser Organisation ist es, sich für die
Integration Georgiens in die euro-atlantischen Strukturen einzusetzen und den
demokratischen Werten und Prinzipien in Georgien eine bessere Geltung zu verschaffen.
IGFP versteht sich als ein Think Tank, der sich u.a. mit transnationalen, politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen befasst und die Westintegration Georgiens
mit den aktuellen analytischen Beiträgen begleitet und vorantreibt. Diesem Zweck dienen
auch Infoveranstaltungen und Podiumsdiskussionen mit Experten, Politikern und anderen
Partnerorganisationen. Dadurch erhoffen wir eine Plattform für den Meinungsaustausch zu
kreieren.
2
1. Ein Überblick über die Unabhängigkeitsgeschichte
Georgiens
Nino Burdiladze
Der 26. Mai hat für Georgier eine besondere
Bedeutung. Vor 23 Jahren genau an diesem Tag
hat die Sowjetische Sozialistische Republik
Georgien sich von der Sowjetunion losgelöst
und ihre Unabhängigkeit erklärt.
Die Tatsache, dass Freiheit für Georgien einen
besonders hohen Stellenwert annimmt, drückt
sich auch im georgischen Wort für Freiheit
„თავისუფლება“ („tavisupleba“)aus. Es lässt
sich übersetzen als das „Recht über sich selbst“.
Das heißt, dass ein georgischer Mensch die
Freiheit als den Zustand verstand, in dem man
nicht gehindert war, über eigenes Tun und
Lasseneigenständig und ungebunden
entscheiden zu können. Jegliche Art der Einschränkung seiner freien Verfügung würde als
Freiheitsberaubung empfunden. So war schon in seinem Bewusstsein vorprogrammiert,
dagegen zu rebellieren und sich wieder „zum Herrn über sich selbst“ zu machen. Die
geschichtliche Entwicklung, die geopolitischen Umstände und das religiöse Bekenntnis hat
Georgien zum östlichen Vorposten des Christentums gemacht. Das Land musste sich als
eigenständiges Volk stetig im überwiegend nicht-christlichen Umfeld behaupten bzw. ums
Überleben kämpfen. Der Kampf um die Erhaltung der Individualität und Originalität ist trotz
der komplizierten Umstände gelungen, wenn man bedenkt, dass Georgier in eigener Sprache,
dem Georgischen, sprechen, die eine eigene Sprachfamilie bildet und nicht zu anderen
Sprachfamilien gehört, die – wie beispielsweise das Indoeuropäische - räumlich weit erstreckt
sind; dass sie ihr eigenes Alphabet entwickelt haben, das eines von 14 Schriftsystemen auf der
ganzen Welt ist; und dass sie eine eigenständige Kultur hervorgebracht haben, deren Schaffen
globale Bedeutsamkeit erlangt hat. Als Beispiel seien hier nur der mittelalterliche Epos „Der
Ritter im Tigerfehl“ vom Dichter Schota Rustaweli und Dichter Washa-Pschavela erwähnt.
Nino Burdiladzeist
Doktorandin an der
rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität
zu Köln. Nach der
Absolvierung des
Studiums in Georgien an
der deutschsprachigen
Fakultät für Recht und
Wirtschaft studierte sie
weiter in Deutschland
und Frankreich im Rahmen des internationalen
LLM-Masterstudiengangs „European Legal
Practice“ als Stipendiatin des von der
Europäischen Union getragenen
ErasmusMundus-Programms. Nach dem
Abschluss arbeitete sie jahrelang in der
Bankenbranche in Georgien. Zurzeit arbeitet
sie am Institute for International Peace and
Security Law in Köln und befasst sich mit der
Forschung der friedens-sicherungsrechtlichen
Fragen und bewaffneten Konflikten.
Hoffnung auf die Wiederherstellung der Unabhängigkeit
Für eine Nation mit einem hohen Selbstwertgefühl war es nicht einfach sich als Vasall eines
anderen hegemonischen Staates zu geben und sich seit dem Ende des 18. Jahrhundert dem
russischen Zarenreich zu fügen. Deswegen kam es für die Mitglieder der georgischen
politischen Elite sehr gelegen, als es sich 1918 die Möglichkeit zur Erklärung der
Unabhängigkeit und zur Gründung eines unabhängigen Staates anbot. Das in eine
Grenzprovinz des Russischen Zarenreiches umgewandelte Land strebte an, sich von der
russischen Oberherrschaft zu lösen. Während des Ersten Weltkrieges kam schließlich
überraschende Unterstützung von Deutschland. In geheimen Verhandlungen hat der deutsche
Unterhändler General von Lossow den Georgiern dazu geraten, sich von der
Transkaukasischen Föderation abzuspalten und die Unabhängigkeit zu erklären. So könnten
sie ein separates Abkommen mit Deutschen schließen und sich unter den deutschen Schutz
stellen. Die georgische Seite hat diesen Vorschlag angenommen. Am 26. Mai 1918 wurde die
Sitzung des Georgischen Nationalrates einberufen und so wurde die Unabhängigkeit
Georgiens erklärt. Dieses Datum wurde zu einem Symbol für die Gründung einer Republik
mit demokratischer Ordnung.
Das Ende des ersten Weltkrieges hat Georgien den versprochenen Schutz durch die
Deutschen entbehrt und so war das Land allein, ohne jegliche Unterstützung den „roten“
Bolchewiki ausgesetzt, die am 25. Februar 1921 nach unerbittlichem Widerstand der kleinen
georgischen Armee die Hauptstadt des Landes, Tiflis, eingenommen haben.
Sowjetische Ära
Ab dem Zeitpunkt begann die sozialistische und kommunistische Ära für Georgien. Dieser
Zeitraum war durch gegensätzliche Entwicklungen gekennzeichnet. Auf einer Seite hat das
blutrünstige kommunistische Regime viele Opfer gefordert, die vor allem in den
Geburtsstunden des Imperiums sowie insb. 1937 durch starke staatliche Repressionen gefallen
sind. Dieser Zeitraum kennzeichnet sich besonders durch die Verfolgung und Ermordung von
Intellektuellen und Andersdenkenden. Andererseits machte sich aber auch eine industrielle,
1
wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung im Lande spürbar. Allerdings war der stille
Protest in der Gesellschaft des sowjetischen Georgiens immer präsent. Trotz starker
staatlicher Zensur war es einigen Künstlern in Bereichen der Kinematographie, Literatur und
Theater gelungen, das wahre Gesicht der kommunistischen Herrschaft in ihren Kunstwerken
darzustellen. Einige von vielen Beispielen wären die Filme vom georgischen Regisseur
Tengis Abuladse, literarische Werke von Dichtern der 30er Jahre wie Titsian Tabidze, Paolo
Iaschwili, usw.
Lang ersehnte Freiheit
Dieser stille und latente Widerstand erlangte eine erkennbare Gestalt Ende der 80er Jahre, als
die nationale Befreiungsbewegung in Georgien in Schwung gekommen war. Einige
patriotische Anführer sind hervorgegangen – unter ihnen auch der zukünftige Präsident
Georgiens, Swiad Gamsachurdia, der sich stark für die Befreiung Georgiens von der
kommunistischen Herrschaft einsetzte.
Am 31. März 1991 wurde in Georgien das allgemeine Referendum durchgeführt, in dem den
Bürgern der Georgischen SSR die Frage gestellt wurde, ob sie sich ein unabhängiges
Georgien wünschten. Das Ergebnis sprach für sich: Bei einer sehr hohen Beteiligung der
Wahlberechtigten stimmten 98% für die Unabhängigkeit. Daraufhin verabschiedete der
Oberste Rat der Georgischen SSR am 9. April 1991 einen gesetzlichen Akt über die
Wiederherstellung der Unabhängigkeit Georgiens.
Diesem Datum wurde auch ein symbolischer Wert beigemessen: Genau vor zwei Jahren, in
der Nacht vom 8. auf den 9. April 1989, waren in Tiflis junge Leute, die friedlich mit der
Forderung der Wiederherstellung der georgischen Unabhängigkeit und seiner Loslösung von
der Sowjetunion in Hungerstreik getreten waren, von den russischen Streitkräften mit
militärischen zweischneidigen Spaten niedergemetzelt und mit Giftgas vergiftet worden. 21,
überwiegend junge Bürger kamen ums Leben. Viele haben während des Tumults
Verstümmelungen erlitten. Mehrere leiden heute noch unter Folgen der schweren
Gasvergiftung. Der 9. April wurde im Bewusstsein von Georgiern als eine gesamtnationale
Tragödie geprägt und wurde als gesetzlicher Feiertag erklärt, der jedes Jahr mit Trauerfeier
zelebriert wird.
2
Nach der Verabschiedung des Aktes über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit sind die
Ergebnisse des Referendums am selben Tag von den Vereinigten Staaten anerkannt worden,
was gleichzeitig praktisch die Anerkennung der georgischen Unabhängigkeit von der
Sowjetunion bedeutete.
Am 26. Mai 1991 ging Swiad Gamsachurdia aus den ersten Präsidentschaftswahlen als Sieger
hervor. Dieser feierliche Tag wurde als das offizielle Datum der Wiedererlangung der
Unabhängigkeit Georgiens gesetzt.
Der beschwerliche Weg der Freiheit
Die Erlangung der Unabhängigkeit ist nicht glimpfig gelaufen. Georgien musste für seine
Freiheitsbestrebungen einen hohen Preis zahlen. Nur einige Monate nach der
Unabhängigkeitserklärung kam es im Dezember 1991 zu einem Militärputsch, der mit der
Vertreibung des legitim gewählten Präsidenten S. Gamsachurdia endete. Im Lande wütete der
Bürgerkrieg und Georgien versank im Chaos. Der Militärrat wurde gebildet, der bald die
Gewalt an sog. „Staatsrat“ übergab, dessen Vorsitz der gerade für diesen Zweck aus Russland
angeflogene ehemalige sowjetische Außenminister E. Schewardnadse innehatte.
Die aktivierte georgische Freiheitsbewegung rief auch scharfe Reaktionen in Kreisen der
nationalen Minderheiten hervor. Die nationalistischen Parolen der georgischen Politiker, die
hauptsächlich gegen die imperialistischen Bestrebungen Russlands gerichtet waren, wurden
von den in Georgien lebenden Minderheiten sehr negativ aufgenommen. Die verschärfte Lage
endete 1991 in einem Konflikt zwischen Georgien und der separatistischen Regierung des
südossetischen autonomen Gebiets. Im Zeitraum von 1992 bis 1994 wurde ein Konflikt in
einer anderen autonomen Region von Georgien, in der abchasischen autonomen Republik,
militärisch ausgetragen. Als Ergebnis verlor Georgien die faktische Kontrolle über diese
Regionen und Ströme von hundert Tausenden von Flüchtlingen überwiegend georgischer
Abstammung suchten Obhut im georgischen Kernland.
Seit dieser Zeit bleibt die Lösung der Konflikte aus. Die Lage wurde eingefroren, sodass sich
während dieser ganzen Jahre der Status-quo nicht geändert hat. Russland hat bei den
Friedensverhandlungen die Vermittlerrolle übernommen. E. Schewardnadse hat den Russen
3
als Zugeständnis für die Unterstützung bei der Konfliktlösung den Beitritt Georgiens an die
GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) eingeräumt, was auch vollzogen worden ist.
Hoffnung durch die „Rosenrevolution“ im Jahre 2003
Die Turbulenzen des jungen georgischen Staates im Jahr 2003 fort und kulminierten im
November desselben Jahres in einem friedlich vollzogenen Staatsstreich. Dieses historische
Ereignis hat die Bezeichnung „Rosenrevolution“ erhalten, was den friedfertigen und
wohlwollenden Charakter unterstreichen soll. Es kamen junge, im Westen ausgebildete
Politiker mit Micheil Saakaschwili an der Spitze an die Macht, die mit radikalem
Kurswechsel den georgischen Staat Richtung Westen gesteuert und eine starke Integration in
die westliche, demokratische Gemeinschaft angestrebt haben. Neben der Lösung der
Territorialitätsprobleme Georgiens bildete deren Ziel u. a. der Beitritt Georgiens in die EU
sowie seine Integration in die nordatlantische Militärallianz – NATO.
Kaukasus-Krieg – August 2008
Die Abwendung von Russland, das den postsowjetischen Raum immer noch als seinen
Einflussbereich definiert und durch den Regierungswechsel in Georgien eigene Interessen
bedroht sah, wurde für Georgien teuer. Nach der Einführung des wirtschaftlichen Embargos
auf georgische Güter und dem Abbruch diplomatischer Beziehung zwischen beiden Staaten
kulminierte die ohnehin strapazierte Lage in einem Krieg zwischen Georgien und der
Russischen Föderation im August 2008. Diese militärische Auseinandersetzung hatte fatale
Folgen für den georgischen Staat. Er verlor ca. 20% des bisherigen Territoriums. Der Krieg
brachte menschlichen Verlust mit sich, über 158 000 Einwohner sind zu Flüchtlingen (inkl.
Binnenflüchtlinge) geworden. Die Aussichten für das junge, nach Festigung demokratischer
Institutionen strebende Land verschlechterten sich. Das Problem der territorialen Einheit des
georgischen Staates dauert bis heute an!
Unnachgiebig auf dem Kurs zur Demokratie
4
Trotz aller Schwierigkeiten und sogar trotz dem Regierungswechsel im Oktober 2013, als die
„Nationale Bewegung“ von M. Saakaschwili durch die Koalition „Der Georgische Traum“,
geführt durch Tycoon Bidsina Iwanischwili, abgelöst wurde, ist der Wille der Georgier nach
Westen und damit nach der Etablierung demokratischer Werte zu streben unerschüttert. Die
neue georgische Regierung hat die Unumkehrbarkeit des Kurses des georgischen Staates
mehrmals bekundet. Es besteht eine aktive Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und Georgien im Rahmen der Östlichen Partnerschaft. Diese Kooperation hat schon ein
intensives Niveau erreicht und im Juni 2014 wurde das Assoziierungsabkommen zwischen
der EU und Georgien unterzeichnet.
Es besteht eine sehr enge Kooperation Georgiens mit der NATO. Georgische Soldaten
nahmen an militärischen Missionen in Kosovo, im Irak und in Afghanistan teil. Somit leistet
Georgien seinen bescheidenen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und Verbesserung der
globalen Sicherheit.
Der Weg Georgiens in die Freiheit und hin zu unumstößlicher Unabhängigkeit war und bleibt
mühselig.
5
2. Geostrategische Bedeutung von fossilen Energieträgern für die
EU, Russland und Südkaukasus Gaioz Tsutsunashvili
Bekanntlich gehört die EU international zu
dem wichtigsten Vorreiter auf dem Gebiet der
regenerativen Energiequellen. Dabei ist zwar
die Förderung der erneuerbaren Energien
langfristig ein Schritt in die richtige Richtung,
aber gleichzeitig ist eine völlige
Unabhängigkeit von Erdöl, Gas und Kohle
kurz- und mittelfristig nicht realistisch.
Deswegen ist die sichere Versorgung durch
fossile Energieträger lebenswichtig für den
Wohlstand der EU-Staaten. Dies erweist sich
allerdings für Europa als schwierig, denn die
EU ist aufgrund der geringeren eigenen
Reservebasis auf die Energieimporte aus dem Ausland angewiesen. Die EU-Staaten decken
ihren Energiebedarf zu 51 Prozent über die ausländischen Importe. Dabei ist insbesondere
eine zu hohe Gasimportabhängigkeit einiger Mitgliedsstaaten in Ost- und Mitteleuropa von
Russland zu erwähnen, denn 42 Prozent der Gaslieferungen stammen aus Russland. Somit ist
der östliche Nachbar das mit Abstand größte Erdgasgeberland der Union. Dabei wird
zukünftig die Gasimportabhängigkeit von Russland weiter steigen, da die europäische
Gasproduktion in der Nordsee stetig abnehmen und gleichzeitig der Gesamtbedarf hoch
bleiben wird. Zur Steigerung der Gasimporte trägt auch die positive Resonanz darüber bei,
dass Erdgas im Vergleich zu Erdöl eine „saubere“ Energiequelle ist, die weniger Emissionen
verursacht.1
Gleichzeitig ist die EU bereits heute der Tatsache konfrontiert, dass einige
energieexportierende Länder ihre Energieressourcen zur Durchsetzung ihrer machtpolitischen
Interessen instrumentalisieren. Besonders markante Beispiele sind die so genannten
1 Vgl. Westphal, Kirsten; 2006: S. 49
Gaios Tsutsunashvili promoviert als Alfred-
Töpfer-Stipendiat an der
Heinrich-Heine-Univer-
sität in Düsseldorf.
Zuvor absolvierte er
dort als Friedrich
Naumann Stipendiat
Germanistik und
Geschichte auf
Magister. Anschließend schloss er Master of
European Studies an der Bergischen Universität
in Wuppertal ab und arbeitete danach als
Lehrbeauftragter auf dem Lehrstuhl für
Politikwissenschaften. Seine akademischen
Leistungen wurden durch mehrere Preise und
Stipendien ausgezeichnet. Zurzeit arbeitet er
beim Internationalen Bund in Velbert im
Bereich der Integrationspolitik.
6
„Gaskriege“ zwischen dem Kreml und osteuropäischen Staaten. Aber auch der anschwellende
Konflikt in der Ostukraine, wo Russland seine Energieressourcen als Druckmittel gegen die
ukrainische Führung einsetzt, wird von EU-Staaten äußerst kritisch wahrgenommen.
Aufgrund dieser allzu großen Importabhängigkeit an Brennstoffen der EU von Russland gilt
die Energieversorgungssicherheit und insbesondere die Gasversorgungssicherheit als eine
Achillesferse der europäischen Energiepolitik, da Russland diese Abhängigkeit für eigene
politische Zwecke missbrauchen könnte.2 Deswegen ist die EU bestrebt,
Gasimportabhängigkeit von Russland zu verringern. Dafür müssen die EU-Staaten allerdings
ihre Gasimporte diversifizieren und eine gemeinsame europäische Energiepolitik zustande
bringen.
Ein Hindernis für den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik besteht
allerdings darin, dass die Mitgliedsländer einen diametral unterschiedlichen Energiemix
aufweisen. Während in Frankreich der Fokus auf Atomenergie liegt, prägen Kohlekraftwerke
die polnische Energieversorgung. Schließlich spielen in Deutschland die regenerativen
Energien und Erdgas eine wichtigere Rolle als in anderen EU-Ländern.Hinzu kommt noch,
dass im Falle der Energieimporte die Bezugsquellen von Land zu Land unterschiedlich sind.
Während ost- und mitteleuropäische EU-Länder zu 80 bis 100 Prozent mit dem russischen
Erdgas beliefert werden, beziehen Portugal und Spanien ihren Erdgasbedarf hauptsächlich aus
Algerien.3
Deswegen versuchen die EU-Länder eben die Energiepolitik zu betreiben, die ihren
jeweiligen Energiemix und ihre Bezugsquellen besonders berücksichtigt. Genau darin liegen
die Ursachen der unterschiedlichen nationalen Interessen der jeweiligen Mitgliedsländer, die
hinderlich für eine supranationale europäische Energiepolitik sind.
Russlands Machtwährung Energieressourcen
Brüssels Bedenken in Bezug auf die hohe Gasimportabhängigkeit von Russland sind dabei
durchaus ernst zu nehmen; denn die russische Führung und allen voran Vladimir Putin sehen
in den riesigen Energieressourcen des Landes nicht nur kommerzielle Vorteile, sondern auch
ein geopolitisches Potential der russischen Außen- und Sicherheitspolitik, denn schließlich
verfügt Russland über rund 25% der weltweiten Erdgasreserven. Daher ist Moskau bestrebt,
2 Vgl. Umbach, Frank; 2008: S. 27 3 Vgl. Geden, Oliver; Fischer, Severin; 2008: S. 19
7
Russlands verlorengegangene Großmachtstellung durch seine Erdöl- und Erdgasressourcen
wiederherzustellen. Deswegen unternimmt der Kreml Anstrengungen, sich als
Monopolversorger der EU-Staaten zu etablieren.
Zu diesem Zweck hat Putin kurz nach seiner Machtübernahme die Renationalisierung der bis
dahin marktwirtschaftlich organisierten Energiewirtschaft eingeleitet. Dabei wurden
Oligarchen, welche Putins Vorhaben im Wege standen, verfolgt oder verhaftet. Ein
Paradebeispiel ist die Verhaftung des Energiemoguls Chodorkowski, dessen Unternehmen
Yukos in der russischen Erdöl- und Gaswirtschaft mächtig mitmischte.4
Dabei wird es zunehmend offensichtlich, dass der Kreml durch seine Energieaußenpolitik die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in eine immer stärkere Importabhängigkeit bringen
möchte. Zur Realisierung dieses Vorhabens verfolgt Moskau mehrere Strategien.
Moskau führt einerseits eine aggressive Pipelinepolitik, die darauf ausgerichtet ist,
europäische Pipelineprojekte wie Nabucco zu verhindern und die europäische
Gasimportabhängigkeit von Russland zu erhöhen. Paradebeispiele sind dafür die russischen
Pipelineprojekte wie South-Stream oder Blue-Stream.
Andererseits versucht Kreml die europäischen Diversifizierungsversuche dadurch zu
unterbinden, dass es den einzelnen EU-Ländern eine bevorzugte Partnerschaft anbietet, um
diese Länder von einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik abzubringen. Die größeren
EU-Länder wie Deutschland oder Italien konnten dieser Versuchung nicht immer widerstehen
und sind bilaterale Verträge mit der russischen Föderation eingegangen, um ihre nationalen
Interessen zu sichern, anstatt eine langfristige gesamteuropäische
Energieversorgungssicherheit im Blick zu behalten. Bekannte Beispiele für solche nationale
Alleingänge sind die Nordstream-Pipeline und das geplante Pipelineprojekt South-Stream.
Gleichzeitig ist Putin bestrebt, Energieressourcen zwecks der politischen Einflussnahme in
den ehemaligen sowjetischen Staaten in Osteuropa und im Kaukasus einzusetzen. Durch die
rapide Preiserhöhung von Energieträgern und Lieferstopps hat die russische Führung
versucht, ihre nationalen Interessen in diesen Regionen durchzusetzen; denn in Putins Augen
gehören diese Länder zur russischen Einflusssphäre.
4 Vgl. Götz, Roland; 2008: S. 122
8
Georgien und kaspische Länder als alternative Energiebezugsquellen und Transitrouten
Die Energiereserven aus dem kaspischen Becken würden die Importabhängigkeit vom
russischen Gas deutlich verringern. Zu diesem Zweck engagiert sich die EU in den
zentralasiatischen Ländern und in Aserbaidschan, und versucht seit 1990-er Jahren eine
energiepolitische Partnerschaft mit diesen Ländern einzugehen. Auch die zentralasiatischen
Staaten sind daran interessiert, ihre Öl- und Gasreserven zu einem höheren Erlös auf dem
europäischen Markt zu verkaufen. Des Weiteren erhoffen sie durch die Kooperation mit der
EU ihre staatliche Souveränität gegenüber Russland zu stärken. Aber sowohl für
zentralasiatischen Staaten als auch für Aserbaidschan gibt es ein Problem in Bezug auf die
Lieferung von fossilen Energieträgern; denn diese Länder haben keine direkten Grenzen mit
der EU und sie haben außerdem keinen Meereszugang, um die Lieferungen auf dem Seeweg
zu tätigen.
Für den Transport der Energieträger aus dieser Region spielt vor allem der so genannte
südliche Korridor eine wichtige Rolle; denn er soll der EU einen freien Zugang sowohl zu
kaspischen als auch zu zentralasiatischen Erdöl- und Gasressourcen unter Umgehung des
russische Territoriums ermöglichen. Dieser Korridor liegt geografisch im Südkaukasus,
zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer sowie zwischen dem Iran, Russland und der
Türkei. Andere Routen würden entweder nördlich über das russische Territorium oder südlich
über den Iran verlaufen. Der südliche Korridor erscheint aus diesem Grund als die optimale
Route aus der geostrategischen Perspektive für die EU-Länder.
Dabei soll das zentralasiatische und aserbaidschanische Gas und Erdöl über Georgien und
weiter entweder über das Schwarze Meer oder über die Türkei in die EU geliefert werden.
Georgien hat also aufgrund seines Meereszugangs und seiner Grenze zur Türkei eine
strategische Bedeutung für den Transit von kaspischen Energieträgern nach Europa.
Die Vielzahl von Aktivitäten der EU in dieser Region hat auch zur Schaffung von konkreten
Infrastrukturprojekten geführt. Besonders bemerkenswert sind dabei folgende Pipelines: die
Baku-Supsa-Pipeline, die Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline und schließlich die Südkaukasus-
Erdgas-Pipeline. Mithilfe dieser Pipelines ist die EU in der Lage, beträchtliche Mengen vom
kaspischen Erdöl zu importieren. Brüssel ist nun bestrebt, auch die strategisch wichtigen
Erdgaslieferungen aus dieser Region zu tätigen.
9
Der Kreml betrachtet dabei das europäische Engagement und den wachsenden Einfluss des
Westens im Südkaukasus und im kaspischen Raum mit zunehmender Nervosität; denn er
deklariert diese Region als eigene Einflusszone; Zum einen fürchtet die russische Führung die
eigene Machtstellung in „ihrem Hinterhof“ zu verlieren. Des Weiteren sieht der Kreml seine
Monopolpolitik in Bezug auf die Energielieferungen in die EU in Gefahr, da die kaspischen
und zentralasiatischen Energieressourcen mehr Unabhängigkeit für die EU-Länder von
russischen Energielieferungen und Transitrouten bedeuten würden. Schließlich befürchtet
Moskau auch beträchtliche finanzielle Verluste, sollte es zur europäisch-kaspischen
Partnerschaft kommen, denn da die Länder aus dieser Region aufgrund der fehlenden
Pipelines ihre Gasexporte nicht direkt in die EU tätigen können, sind sie auf russische
Pipelines angewesen. Aus diesem Grunde kauft Gazprom zentralasiatisches Erdgas deutlich
billiger ein und verkauft es dann ebenso deutlich teurer an die EU-Staaten weiter. Ein Drittel
der russischen Gasimporte stammt somit eigentlich aus den zentralasiatischen Ländern.5 So
zahlt Gazprom für eintausend Kubikmeter Gas 50 bis 80 US-Dollar und verkauft es dann in
der EU und in postsowjetischen osteuropäischen Staaten für 180 bis 350 US-Dollar.6 Im Falle
einer europäisch-kaspischen Partnerschaft würden diese Gewinne für Gazprom natürlich
wegfallen. Aus diesen Gründen ist das westliche Engagement in südkaukasischen und
zentralasiatischen Ländern ein Dorn im Auge für Russland.
Da aber Georgien als einziges Transitland für die Lieferungen der Energieträger aus dem
kaspischen und zentralasiatischen Raum in Frage kommt, ist die Kontrolle über das Land für
den Kreml äußerst wichtig, wenn er seine Machtstellung als Monopolversorger der EU und
als Regionalmacht in postsowjetischen Ländern nicht verlieren möchte. Aus diesem Grund ist
Georgien am stärksten dem russischen Druck ausgesetzt.7 Deswegen wurden feindliche
Provokationen und die Eskalation der Lage noch vor dem georgisch-russischen Krieg von
einigen Experten thematisiert. Zu diesen feindlichen Provokationen zählen ökonomische und
politische Sanktionen Russlands gegen Georgien wie russisches Embargo auf georgische
Produkte, die Verletzung des georgischen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge, die
zeitweise Sperrung von Strom- und Gaslieferungen, Einführung des Visa-Regimes mit
Georgien sowie das Anheizen der Konflikte um die abtrünnigen Regionen Abchasien und
Südossetien.
5 Vgl. Umbach, Frank; 2008: S. 28 6 Vgl. Schaffer, Marvin Baker, 2008: S. 13 7 Tsutsunashvili, Gaios, 2014: S. 23
10
Durch diese Maßnahmen versuchte Moskau, eine kontrollierte Instabilität Georgiens zu
erzeugen. Dadurch wollte die russische Führung das westliche Engagement in Georgien in
Bezug auf den Ausbau der Energieinfrastruktur risikoreich und somit unattraktiv machen.
Gleichzeitig wollte Russland durch das Anheizen des Konfliktklimas die mögliche
Osterweiterung der NATO stoppen. Als aber der Kreml merkte, dass seine Strategie keine
Früchte trug und Georgien sich immer stärker dem russischen Einfluss entzog und dem
Westen zuwandte, zog man in Moskau die militärische Option der Problemlösung immer
stärker in Betracht.
Für diese These spricht vor allem die massenhafte Verteilung von russischen Pässen an
Osseten und Abchasier, welche nach dem geltenden internationalen Recht georgische
Staatsbürger sind. Dies wird von vielen Autoren als Indiz dafür gewertet, dass Russland den
Einmarsch in Georgien schon lange vor 2008 geplant hat,8 denn schließlich ist die russische
Armee während des russisch-georgischen Krieg tatsächlich unter dem Vorwand in Georgien
einmarschiert, dass es seine „Staatsbürger“ vor georgischer Aggression schützen wolle.
Nach Ansicht vieler Experten und Politiker hatte allerdings Moskau andere Beweggründe für
die militärische Invasion in Georgien. Die tatsächliche Motivation des russischen
Einmarsches in Georgien bestand demnach darin, dass der Kreml einerseits seine
Monopolstellung als Gaslieferant Europas verteidigen und andererseits die georgische
Führung wegen seiner politischen Westorientierung bestrafen wollte. Schließlich wollte
Moskau durch den Einmarsch in Georgien die Osterweiterung der Militärallianz stoppen.
Bilanzierend lässt sich folgendes sagen: Die Europäische Union ist bestrebt, ihre
Energiebezugsquellen und Transitrouten zu diversifizieren, um sich aus der russischen
Energieimportabhängigkeit zu befreien. Deswegen möchte sich die EU einen Zugang zu den
billigeren Energiereserven im Kaspischen Becken unter Umgehung des Russischen
Territoriums verschaffen. Zu diesem Zweck sind die Europäer bemüht, neben den
bestehenden Erdölpipelines, noch weitere Gaspipelines durch den so genannten Südlichen
Korridor zu verlegen. Auch die zentralasiatische Länder und Georgien sind an der
Partnerschaft mit der EU im Bereich der Energiepolitik interessiert, denn sie erhoffen dadurch
einerseits ihre staatliche Souveränität gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht Russland zu
stärken, andererseits erhoffen sie sich kommerzielle Vorteile, die sich daraus ergeben.
8 Kříž, Zdeněk; Shevchuk, Zinaida; 2011: S. 94
11
Russland betrachtet hingegen das westliche Engagement in der Region sehr skeptisch. Der
Kreml scheut keine Mühe und nutzt alle Mittel, um seine Monopolstellung als
Energielieferant der EU zu verteidigen. Moskau ist durchaus bewusst, dass Georgien für die
europäische Energiediversifikation eine Schlüsselrolle zukommt; denn die Energieträger aus
dem kaspischen Becken können nur über Georgien nach Europa geliefert werden. Deswegen
möchte Moskau mit allen Mitteln Georgien unter seine Kontrolle bringen sowie die Europäer
und Amerikaner aus der Region raushalten und die Osterweiterung der NATO und der EU
stoppen.
12
3. Postsowjetischer Raum zwischen Europäischer und
Eurasischer Union. Georgiens Weg nach Europa
Mikheil Sarjveladze
Zerfall der Sowjetunion und der
postsowjetische Raum
Aus dem Vielvölkerreich Sowjetunion sind
nach dessen Zerfall 15 Staaten entstanden,
von denen einige bereits Erfahrung mit der
Staatlichkeit hatten und andere zum ersten
Mal zu einem Staat geworden sind. Der
letzte Außenminister der Sowjetunion
Eduard Schewardnadse bezeichnete den
Prozess des Zusammenbruchs des einstigen
Superstaates folgenderweise: "Es zerbrach
das letzte Imperium des 20. Jahrhunderts, die
Sowjetunion, dieses blutige, utopische, gegen den Willen Gottes und die Gesetze der Natur
entstandene Reich."9 Als erste erklärten sich 1990 die baltischen Staaten und Georgien
unabhängig von der Sowjetunion, denen bald die anderen osteuropäischen, südkaukasischen
und zentralasiatischen Republiken folgten. Russische SFSR erklärte keine Unabhängigkeit,
sondern formale Souveränität und wurde damit Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Der Weg
in die Unabhängigkeit war keinesfalls friedlich und bereits die Vorereignisse wie die
Tragödien von Tbilisi 1989 oder Baku 1990, als friedliche Demonstranten von den
sowjetischen Truppen gewaltsam niedergeschlagen wurden, begleiteten neben den ethnischen
Konflikten die Auflösung des Sowjetimperiums. Fünfzehn Staaten sind auf dem Territorium
der ehemaligen Sowjetunion entstanden, die formell zwar die westlichen politischen Systeme
übernahmen, aber im Laufe der Zeit im Transformationsprozess unterschiedliche Erfolge
nachweisen konnten. Wenn man den postsowjetischen Raum im Rahmen der geographischen
Kategorien in vier Ländergruppen, in Baltikum, Osteuropäische Postsowjetstaaten (Belarus,
9 Eduard Schewardnadse: Als der Eiserne Vorhang zerriss. Begegnungen und Erinnerungen, Duisburg 2007, S. 208.
Mikheil Sarjveladze
studierte im Rahmen des
Bachelorstudiums in
Tiflis und Gießen
Germanistik und Sozial-
wissenschaften. Danach
folgte ein Master-
studium in „Geschichte
und Politik des 20.
Jahrhunderts“ an der
Friedrich-Schiller-
Universität Jena. Während des Master-studiums
in Jena war er Stipendiat der Magda und Kurt
Moellgaard-Stiftung/ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius/DAAD und absolvierte u.a. ein
Praktikum im Deutschen Bundestag
(Internationales Parlaments-stipendium). Zurzeit
promoviert er als Stipendiat der Konrad-
Adenauer-Stiftung an der a.r.t.e.s Graduate
School for the Humanities Cologne.
13
Ukraine, Moldau), Südkaukasus (Armenien, Aserbaidschan, Georgien), Zentralasien
(Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan) unterteilen würde, lassen
sich regionalen Besonderheiten in Bezug auf die politische, wirtschaftliche und kulturelle
Entwicklung nach dem Zerfall der Sowjetunion feststellen. Russland kann aufgrund seines
Status' und seiner Ansprüche als Nachfolgerstaat der Sowjetunion als eigene Kategorie
betrachtet werden.
Die baltischen Staaten wurden nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in die westlichen
Strukturen fest integriert und sind aktuell Mitglieder der EU und NATO. Weißrussland wird
oft als „letzte Diktatur Europas“10 bezeichnet. Das Land wird bereits seit 1994 vom
Präsidenten Lukaschenko regiert, dessen Herrschaft auf dem Prinzip beruht: „Die gesamte
Maschinerie des Staates ist dem Ziel des persönlichen Machterhalts untergeordnet.“11 Auf
dem Territorium Moldaus sind nach dem russischen Eingriff im Konflikt um Transnistrien,
die international nicht anerkannt ist, genauso wie in Abchasien oder Südossetien, russische
Soldaten stationiert. Moldau liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft der EU und somit im
unmittelbaren Spannungsfeld zwischen EU und Russland. Dasselbe gilt auch für die Ukraine,
die seit der Unabhängigkeit kulturell „in einen sehr russlandfreundlichen Ost- und einen (…)
europaorientierten Westteil zerrissen ist.“12 Während der Ukraine-Krise annektierte Russland
im Frühjahr 2014 die Krim und startete in der Ost-Ukraine mit dem Spaltungsprozess der
Ukraine, in dem Moskau paramilitärische Banden ins Land einschleuste und sie aktuell im
Kampf gegen den ukrainischen Staat unterstützt. Die Entwicklung der südkaukasischen
Postsowjetstaaten Armenien, Aserbaidschan und Georgien ist ebenfalls durch drei Konflikte –
um Abchasien, Südossetien und Berg-Karabach geprägt. Die sowjetische
Nationalitätenpolitik, die nach dem „Teile und Herrsche“ – Prinzip handelte, baute die
Sowjetunion als Vielvölkerstaat mit 15 Gliedstaaten und den Gliedstaaten nachgeordneten
Gebietskörperschaften (20 autonome Republiken, 16 autonome Gebiete und Kreise) auf.13
Dieses „wie Puppen in der Puppe angeordnete Matroshka-Modell“14 in dem s.g.
Titularnationen formell die ethnische Territorialhoheit besaßen, fiel nach dem Zerfall der
Sowjetunion auseinander. Im postsowjetischen Raum war der Südkaukasus der Ort, wo die
ethnisch-territorialen Konflikte am turbulentesten verlaufen sind, was die anfängliche
10 Vgl. http://www.mdr.de/kultur/inside-weissrussland100.html (Letzter Zugriff am 25.07.14) 11 Silitski, Vitali: Sonderfall Lukaschenko, in: APuZ : Ukraine und Weißrussland, 8-9/2007, S.9. 12 Vogel, Thomas/Kunze, Thomas: Von der Sowjetunion in die Unabhängigkeit, APuZ 49-50/2011, in:
http://www.bpb.de/apuz/59638/von-der-sowjetunion-in-die-unabhaengigkeit?p=all#footnodeid_1-1 (Letzter Zugriff am
27.07.14) 13 Vgl. Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, SWP-Studie, Berlin 3/10, S.10. 14 Ebenda
14
Annährung Europas an die Region verhinderte, weil Europa sich vor der Wahrnehmung als
geopolitischer Spieler im Krisenherd Kaukasus aufzutreten, fürchtete.15 Östlich vom
Südkaukasus liegen die fünf zentralasiatischen Staaten – Kasachstan, Turkmenistan,
Usbekistan, Kirgistan und Tadschikistan. An Stelle dieser Staaten gab es vor der Sowjetunion
s.g. Khanaten, auf deren Territorien die Grenzen für die zukünftigen Sowjetrepubliken im
Rahmen der Nationalitätenpolitik von Stalin willkürlich gezogen wurden. Die Nachwirkungen
sind heutzutage in existierenden ethnischen Konflikten zu sehen. Dieser zentralasiatische Teil
des postsowjetischen Raums ist durch die autoritären Regierungssysteme gekennzeichnet, die
von jeweiligen Clans gesteuert werden. Wie es an dem Beispiel der oben angeführten
postsowjetischen Staaten offensichtlich wird, ist der wirkliche Durchbruch Richtung
westlicher Demokratien nur den baltischen Staaten gelungen, die auf das Entgegenkommen
seitens der EU und NATO gestoßen sind. Die anderen Staaten litten und leiden zum Großteil
immer noch an den Nachwirkungen der Sowjetunion.
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Spricht man über den postsowjetischen Raum zwischen EU und Eurasischer Union, kommt
man an der GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten) nicht vorbei. Die GUS wurde 1991
von Russland, der Ukraine und Belarus mit dem Ziel gegründet, die geordnete Auflösung der
Sowjetunion einzuleiten und die Kooperationen zwischen den postsowjetischen Staaten
sowohl in wirtschaftlichen, als auch in sicherheitspolitischen Bereichen neu zu definieren und
auszubauen. An sich blieb die GUS aber eine Plattform, die von Russland als Instrument zur
Rückgewinnung ehemaliger Einfluss-Sphären betrachtet wurde. Die Etablierung der GUS zu
einer starken Gemeinschaft scheiterte u.a. an den russischen hegemonialen Bestrebungen, so
dass die Organisation sich in einen „Papiertiger“16 verwandelte, der weder eine
wirtschaftliche, noch eine politische Integration gelungen ist. 2006 verließ Georgien die GUS,
2014 einer der Gründerstaaten die Ukraine im Zeichen der Ukraine-Krise. Dem gestiegenen
Interesse seitens der EU gegenüber ehemaligen postsowjetischen Staaten besonders seit der
Jahrtausendwende konnte Russland mit der GUS, die seit langem an der Bedeutungsverlust
leidet, nicht entgegenkommen.
15 Vgl. Halbach, Uwe: Der Blick Europas auf die Nachbarschaftsregion Südkaukasus und ihre ungelöste Regionalkonflikte,
in: http://www.gdi.economics.tsu.ge/pdf/word/halbax.pdf (Letzter Zugriff am 27.07.14) 16 Vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13680252.html(Letzter Zugriff 26.07.14)
15
Europäische Union vs. Eurasische Union
2009 startete die EU das Programm „Östliche Partnerschaft“ als Teil der europäischen
Nachbarschaftspolitik (ENP) gegenüber sechs postsowjetischen Staaten (Belarus, Moldau,
Ukraine, Armenien, Aserbaidschan und Georgien) mit dem Ziel „die notwendigen
Voraussetzungen für die Beschleunigung der politischen Assoziierung und der weiteren
wirtschaftlichen Integration zwischen der Europäischen Union und interessierten
Partnerländern zu schaffen.“17 Die Aktivität der EU im postsowjetischen Raum ist längst ein
Dorn im russischen Auge und als Gegenspieler der EU versucht Russland statt der nicht
konkurrenzfähigen GUS die Eurasische Union zu etablieren, von deren Gründung der
russische Präsident Putin 2011 sprach. Den Kern der Eurasischen Union, die laut Putin ein
politischer und wirtschaftlicher Block zwischen der EU und China bilden sollte, stellen
Belarus, Russland und Kasachstan dar, die bereits seit 2011 in einer gemeinsamen Zollunion
vertreten sind. Obwohl die eurasische Union ihre Arbeit erst ab 2015 aufnehmen sollte, trafen
ihre „Vorbereitungsmaßnahmen“ die „Östliche Partnerschaft“ hart. Verhandlungen im
Rahmen der „Östlichen Partnerschaft“ mit Belarus liegen aufgrund der politischen Lage des
Landes längst auf Eis. Armenien verzichtete auf Druck aus Moskau auf die Unterzeichnung
des bereits ausgehandelten Assoziierungs- und Freihandelsabkommens und kündigte an, der
Eurasischen Union beizutreten. Die Verhandlungen mit Aserbaidschan werden weitergeführt.
Russlands Druck auf Kiew, das Assoziierungsabkommen nicht zu unterzeichnen, endete mit
der Revolution und dem Regierungswechsel in der Ukraine. Durch die Annexion der Krim
und Entfachung des Krieges in der Ostukraine setzte Russland bereits in Georgien (während
der Kriege um Abchasien und Südossetien) angewendete Muster zur Okkupation des
Territoriums eines souveränen Staates um. Dennoch unterzeichneten sowohl die Ukraine, als
auch Moldau und Georgien Ende Juni 2014 das Assoziierungsabkommen mit der EU. Im
Vorfeld der Unterzeichnung des Abkommens drohte Moskau Moldau mit der Eskalation der
Situation in Transnistrien. In Georgien setzte Russland seine Okkupationspolitik in Form
eines Stacheldrahtzauns fort, der entlang der Okkupationslinie und in einigen Fällen weiter ins
Innere Georgiens zwischen dem georgischen Kernland und dem Sezessionsgebiet Südossetien
errichtet wurde.
17 Gemeinsame Erklärung des Prager Gipfeltreffens zur Östlichen Partnerschaft, in:
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%208435%202009%20INIT (Letzter Zugriff 28.07.14)
16
Die Eurasische Union, deren Gründungsmitglieder grob beschrieben eine Diktatur und zwei
autoritäre Staaten sind, soll laut dem russischen Präsidenten Putin eine durch Demokratie,
Freiheit und Marktwirtschaft geprägte internationale Organisation werden. Außer der
politischen Farce über Freiheit und Demokratie, sind die wirtschaftlichen Aspekte zu nennen,
die aufgrund der hohen Ungleichheit zwischen den Mitgliedsstaaten nicht nach einer rosigen
Zukunft aussehen. Allein Russland stellt rund 85% der Bewohner sowie der
Wirtschaftsleistung der Union und an weltweiten Gas- und Erdölreserven hat Belarus keinen
Anteil, sowie Kasachstan kaum Industrie.18 Die Volkswirtschaften der drei Mitgliedsstaaten
ergänzen sich nicht, vielmehr stehen sie eher in einer Konkurrenzsituation zueinander.19 Vor
allem ist aber die Eurasische Union ein geopolitisches Projekt, in dem Russland aufgrund
seiner Große und Macht die Führungsrolle übernimmt, um den „Verlust“ der Territorien der
ehemaligen Sowjetunion an die EU zu verhindern. Die Heranführung der postsowjetischen
Staaten an die EU und deren Bestrebung nach der Mitgliedschaft in der NATO wird in
Russland als Dolchstoß ins imperiale Herzen Russlands angesehen, weil Putin vor allem die
Übertragung der demokratischen Prozesse auf Russland und andere postsowjetischen Staaten
und damit eigenen und russischen Machtverlust befürchtet.
Der Südkaukasus, der aufgrund seiner geopolitischen Lage jene Grenzen markiert, die „für
die vitalen Sicherheitsinteressen Europas und die weitere Ausdehnung des europäischen
Binnenmarktes hervorgehobene Bedeutung besitzt“20, ist für Russland Teil des s.g. „Nahen
Auslandes.“21 „Nahes Ausland“ ist die russische Bezeichnung der Territorien der ehemaligen
Sowjetunion, die von Russland wie selbstverständlich als eigene Einflusssphäre betrachtet
werden. Als der einzige von drei südkaukasischen Staaten unterschrieb Georgien das
Assoziierungsabkommen mit der EU im Juni 2014 und erklärte weiterhin die Westintegration
des Landes zum Hauptziel seiner Außenpolitik. Gleichzeitig sind 20% des georgischen
Territoriums von Russland okkupiert. Obwohl die zwei Sezessionskonflikte um Abchasien
und Südossetien einigermaßen als eingefroren gelten, beinhalten sie ein großes
Gefahrpotenzial nicht nur für Georgien, sondern auch für die Sicherheitsinteressen der EU
und selbst für die Abchasen und Osseten. Russland instrumentalisierte jene
18 Vgl. http://www.fr-online.de/ukraine/russland-ukraine-eu-eurasische-union-putin-fehlt-ein-baustein-zum-
glueck,26429068,27297020.html (Letzter Zugriff am 30.07.14) 19KAS-Auslandsinformationen: Die Eurasische Union, S.4, in: http://www.kas.de/wf/doc/kas_36785-1522-1-
30.pdf?140207133937 (Letzter Zugriff am 30.07.14) 20 Meister, Stefan: Georgienkrise und die Rolle der EU, in: DGAP,
http://aussenpolitik.net/themen/eurasien/kaukasus/die_georgienkrise_und_die_rolle_der_eu/ (Letzter Zugriff am 01.08.14) 21 Smolnik, Franziska/Halbach, Uwe: Russlands Stellung im Südkaukasus, S.1., in: http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A01_hlb_smk.pdf (Letzter Zugriff am 01.08.14)
17
Sezessionskonflikte bereits Anfang 1990-er in Georgien22 und später 2008 während des
Georgienkrieges, um sich in die politischen Prozesse des Landes einzumischen und die
Westintegration Georgiens zu verhindern. Um die Ausweitung der NATO und der EU aus der
russischen Perspektive in seinem „nahen Ausland“ zu verhindern, scheint Russland u.a. in
Berücksichtigung des offenen Krieges in der Ukraine bereit zu sein, alle möglichen Methoden
anzuwenden. Dabei verletzt Moskau nicht nur die Souveränität der postsowjetischen Staaten
wie Georgien und Ukraine, sondern möchte auch über das Schicksal dieser Staaten selbst
bestimmen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im Zeichen der gegenwärtigen Krise zwischen
dem Westen und Russland auf den Punkt angekommen ist, der nicht zu vermeiden war. Es
war zu erwarten, dass einerseits nach der schwachen Phase Russlands unter Jelzin mit dem
Aufstieg Putins verbundene russische Bestrebungen, sich wieder zu einer Supermacht, zum
Super-Imperium wie in den vergangenen Jahrhunderten aufzusteigen und andererseits die
Osterweiterung der EU, die die Interessen der EU gegenüber dem postsowjetischen Raum
deutlich erhöhte, sich irgendwann aufeinander prallen würden. Der Aufprall war vor allem
aus zwei Gründen nicht vermeidbar: 1. Die EU hat in ihrer Politik gegenüber den Staaten der
ehemaligen Sowjetunion und Russland die imperialen Ansprüche Russlands und seine
Handlungsreichweite auf den postsowjetischen Raum unterschätzt. 2. Russland sieht in der
EU, die die Beziehungen mit dem „Nahen Ausland“ ausbaut, eine tödliche Bedrohung für die
eigenen imperialen Interessen. Dabei missachtet Russland im Gegensatz zur EU die
Souveränität der Staaten des Südkaukasus oder Osteuropas und bietet denen ebenfalls im
Gegensatz zu der EU eine Art Partnerschaft, die einen formellen Charakter hat und statt
Partnerschaft zur Knechtschaft unter Russland im Rahmen der Eurasischen Union führt.
Der Ukraine-Krieg zeigt deutlich, dass Russland im Gegensatz zur EU immer noch in dem
Denkmuster des Kalten Krieges steckt und wenn es um das „russische nahe Ausland“ geht,
sich nicht davor scheut, einen Krieg gegen seine Nachbarn zu führen. Einerseits führt Putin
als roter Zar, als Macht-Piranha Russland nicht in die Zukunft, sondern zurück in die
Vergangenheit, indem er der imperialen Größe Russlands nachtrauert und dem Rest der Welt
sie neu zu beweisen versucht. Andererseits zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass es in der
Außenpolitik der EU eine allgemein funktionstüchtige Strategie gegenüber den ehemaligen
22 Vgl. Manutscharjan, Aschot: Russlands Politik im Südkaukasus, KAS-Auslandsinformationen 5/07, S.46.
18
Staaten der Sowjetunion und eine klare, einheitliche Linie diesbezüglich gegenüber Russland
fehlen. Wenn die EU sich tatsächlich als Wertegemeinschaft versteht, dann darf sie die
postsowjetischen Staaten mit ihren Hoffnungen nach Demokratie und Frieden nicht fallen
lassen. Angesichts des Krieges in der Ost-Ukraine strebt Russland die Destabilisierung der
Lage auf Dauer an, um so die Integration des Landes in die westlichen Strukturen zu
verhindern. Vor sechs Jahren zeigte Russland während des Georgienkrieges sehr deutlich,
dass es in den Staaten des postsowjetischen Raums weder die freie Wahl dieser Staaten, noch
deren Anbindung an den Westen zulassen würde. Nachdem auf dem NATO-Gipfel in
Bukarest im April 2008 zum ersten Mal verkündet wurde, dass die Ukraine und Georgien
Mitglieder der NATO werden könnten23, marschierte nach einer Serie von Provokationen die
russische Armee ins georgische Kernland ein, um die Welt im Stil der Sowjetunion daran zu
erinnern, dass Kreml eingefrorene Konflikte schnell zum Auftauen bringen kann. Aktuell
findet in der Ukraine die Verlängerung des Georgienkrieges vom August 2008 statt. Mit der
Hinnahme der russischen Aggression bzw. der Abspaltung der Ostukraine, was Putin
anscheinend beabsichtigt, wird nicht nur die Existenz der Ukraine als eines einheitlichen
Staates, sondern auch die gesamteuropäische Friedensordnung in Frage gestellt.
23 Vgl. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm(Letzter Zugriff am 02.08.14)