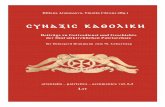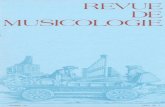A103 Demoto-Hahn Beiträge zur Überlieferung des Syamajataka FS Schlingloff
-
Upload
uni-marburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A103 Demoto-Hahn Beiträge zur Überlieferung des Syamajataka FS Schlingloff
M I T S U Y O D E M O T O U N D M I C H A E L H A H N
Ergänzungen zur Überlieferung des Śyāmajātaka Die Legende vom Brahmanensohn Śyāma, der auf das ihm angetragene Priesteramt verzichtet und statt dessen lieber seinen alten und blinden Eltern in den Wald folgt, um ihnen zu dienen, und der dabei irrtümlich vom Pfeil eines jagenden Königs töd-lich getroffen wird, ist in der buddhistischen Kunst vielfach dargestellt worden, auch in Ajanta, und daher vom Jubilar mehrfach behandelt worden, zuletzt in sei-nem monumentalen Werk Ajanta. Handbuch der Malereien. 1. Erzählende Wand-malereien.1
Wie man aus der Analyse in dem zuletzt genannten Werk ersehen kann, ist die Le-gende in zwei Fassungen überliefert, die beide auch in Ajanta dargestellt sind. Die ältere, schlichtere Version, die durch Jātaka 540 des Pāli-Kanons repräsentiert ist, findet sich in Höhle X. SCHLINGLOFF fasst ihren Inhalt so zusammen: „Der Wald-bewohner, der – von Pfeil eines jagenden Königs tödlich verwundet – von seinen blinden Eltern in das Leben zurückgerufen wird.“2 Die zweite, ausführlichere Ver-sion findet sich in Höhle XVII. Sie wird von SCHLINGLOFF so charakterisiert: „Der Sohn des Hauspriesters, der beim Wasserholen für seine als Eremiten lebenden El-tern vom Pfeil eines jagenden Königs verwundet wird.“3
Diese zuletzt genannte Fassung ist durch drei literarische Texte aus ganz unter-schiedlichen Epochen repräsentiert. Die älteste unter ihnen steht im Bhaiṣajyavastu des Vinayavastu der Mūlasarvāstivādins (MSV). Sie gehört unserer Auffassung nach zu dem Stratum, das die früheste Entwicklungsstufe der prosimetrischen Form, der campū, repräsentiert. Wir finden hier eine organische Mischung von einfacher erzählender Prosa, die immer wieder durch ebenfalls schlichte Strophen, 12 an der Zahl, aufgelockert wird. Ähnliches findet sich in den einfacheren Partien von Kumāralātas Kalpanāmaṇḍitikā Dṛṣṭāntapaṅktiḥ, und ähnlich hat vermutlich auch die älteste Fassung des Pañcatantra ausgesehen. Diese Ausgangsform ist dann kon-tinuierlich verfeinert worden: durch die stetige Hinzunahme von Kunstdichtungs-metren und die allmähliche Weiterentwicklung der Prosapartien. Das lässt sich alles
1 Wiesbaden 2000. 2 Op. cit., Vol. 1, Interpretation, No. 6 : Śyāma, S. 31-34. 3 Op. cit., Vol. 1, Interpretation, No. 32 : Śyāma, S. 145-151.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
218
innerhalb des MSV verfolgen, in dem die Behandlung der Viśvantara-Legende4 einen gewissen Abschluss darstellt.
Der Inhalt dieser Fassung der Śyāma-Legende ist in Kurzform von Jampa Losang PANGLUNG in seiner Analyse der Erzählstoffe des MSV5 und ausführlich von Dieter SCHLINGLOFF in seinem Ajanta-Buch6 vorgestellt worden. Aus Gründen der Voll-ständigkeit bieten wir im Anhang zu diesem Aufsatz eine erste deutsche Gesamt-wiedergabe dieser Version, gefolgt von einer provisorischen Ausgabe des tibeti-schen Textes. Diese Legende ist nicht im Sanskritoriginal erhalten; die entspre-chenden Blätter fehlen in der Gilgit-Handschrift. Die chinesische Übertragung des MSV fasst die Legende nur in einem Satz zusammen; sie blieb daher unberücksich-tigt.
Die zweite und zugleich anspruchsvollste Fassung der jüngeren Version der Śyāma-Legende findet sich in der Jātakamālā des Haribhaṭṭa (fortan HJM). Michael HAHN hatte sie bereits 1972 aus dem Tibetischen für eine Doktorandin des Bonner Indolo-gen Frank-Richard HAMM, Frau Ružica ČIČAK-CHAND, übersetzt, damit sie diese in ihre vergleichende Studie über die Śyāma-Legende einbeziehen konnte, mit der sie 1974 in Bonn promoviert wurde.7 Diese Bearbeitung der Legende erschien vier Jah-re später als Aufsatz in der Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens.8 Wie schon mehrfach erwähnt und illustriert, ist die tibetische Wiedergabe der HJM (fortan HJMtib) keine Meisterleistung. Sie enthält zahlreiche Übersetzungsfehler, zu denen im Lauf der Zeit noch weitere Überlieferungsfehler hinzugekommen sind. Viele Details bleiben daher trotz aller Bemühungen unverständlich, auch wenn sich der Gang der Handlung in den meisten Fällen recht gut nachvollziehen lässt. Die 1976 erschienene Bearbeitung der Śyāma-Legende endete mit dem Hinweis, dass zehn Legenden in anonymen Sanskrithandschriften aus Nepal als Auszüge aus der HJM identifiziert werden konnten. Diese sind inzwischen publiziert worden.9 Das Śyā-majātaka ist allerdings nicht darunter. Im Jahr 2004 erhielt Michael HAHN Zugang zu einer ersten, leider nur fragmentarischen Handschrift des Originalwerks.10 Diese
4 Vgl. hierzu Raniero GNOLI, The Gilgit Manuscript of the Saṅghabhedavastu, Part II, Roma 1978, S. 119-133, und Kabita DAS GUPTA, Viśvantarâvadāna. Eine buddhistische Legende, Berlin 1978 [= Phil. Diss. vom 6. Januar 1977]. 5 Jampa Losang PANGLUNG, Die Erzählstoffe des Mūlasarvāstivāda-Vinaya analysiert aufgrund der tibetischen Übersetzung, Tokyo 1981, S. 45-46. 6 S. 145. 7 Ružica ČIČAK-CHAND, Das Sāmajātaka. Kritische Ausgabe, Übersetzung und vergleichende Studie, Bonn 1974 (Phil. Diss. vom 13.2.1974). 8 „Die Haribhaṭṭajātakamālā (II). Das Śyāmajātaka“, Band XX (1976), S. 37-74. Michael HAHN hatte damals den Werktitel in der Fassung übernommen, wie er sich am Anfang der tibetischen Übertra-gung findet. Einige Jahre später machte Mahes Raj PANT ihn darauf aufmerksam, dass dies kein gutes Sanskrit sei. Darin hätte man eher Haribhaṭṭakṛtā Jātakamālā erwartet. Dem ist zuzustimmen. Es dürfte sich bei der tibetischen Fassung – wie in vielen anderen Fällen – wohl um eine Rekon-struktion der Redaktoren des tibetischen Kanons handeln, die nicht weiter zu berücksichtigen ist. 9 Vgl. hierzu Michael HAHN, Haribhaṭṭa in Nepal. Ten Legends from His Jātakamālā and the Anony-mous Śākyasiṃhajātaka, Tokyo 2007. 10 Zu den Einzelheiten vgl. Michael HAHN, „Haribhaṭṭa and the Mahābhārata“, Journal of Buddhist Studies, Vol. 3 (2005), S. 1-41. Darin findet sich die textkritische Bearbeitung und Übersetzung von HJM 26 (Jājvalin). Die Bearbeitung einer weiteren Legende aus der neuen Handschrift, nämlich von HJM 1 (Prabhāsa), enthält der Aufsatz „How it all began. The very beginning of the Buddha’s bo-
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
219
enthält auch ca. 80 % des Textes des Śyāmajātaka, so dass wir nun in der Lage sind, eine wesentlich verbesserte Fassung von Haribhaṭṭas dichterischer Bearbeitung des Stoffes vorzulegen.
Auch die dritte Fassung der jüngeren Version der Śyāma-Legende, nämlich der pallava 101 in der Bodhisattvāvadānakalpalatā des Kṣemendra, ist kürzlich neu bearbeitet worden. Sie ist Bestandteil der Arbeit von Martin STRAUBE Studien zur Bodhisattvāvadānakalpalatā. Texte und Quellen der Parallelen zu Haribhaṭṭas Jāta-kamālā.11 Bei seiner vergleichenden Analyse der drei jüngeren Fassungen kommt STRAUBE zu folgendem Fazit:
Sowohl diese Passagen als auch die Eigenheiten von Haribhaṭṭas Śyāmajātaka zeigen, daß Kṣemendras Śyāmākāvadāna der Version des Bhaiṣajyavastu deutlich näher steht als Harib-haṭṭas Bearbeitung. Eine dem Bhaiṣajyavastu ähnliche Version wird es denn auch gewesen sein, die Kṣemendra für seine Nachdichtung benutzt hat. Dabei ist jedoch festzuhalten, daß nicht zu vernachlässigende Details in Kṣemendras Śyāmākāvadāna die Existenz einer von der Bhaiṣajyavastu-Erzählung leicht abweichenden Fassung vermuten lassen. Dies scheint mir vor allem an Kṣemendras Rahmenerzählung von der Beerdigung Śuddhodanas durch den Buddha, ferner an den Av-klp 101.8 genannten Namen des Brahmanen-Ehepaares und mög-licherweise auch an der fehlenden Traum-Episode ersichtlich zu sein. (S. 335)
In inhaltlicher und entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht ist dem, was SCHLINGLOFF und STRAUBE zu den ihnen bekannten Versionen der Śyāma-Legende festgestellt haben, nichts hinzuzufügen. Wir könnten allenfalls eine Bemerkung zu den literari-schen Techniken Haribhaṭṭas und eine Detailkritik der tibetischen Übertragung im Lichte der nun verfügbaren Sanskritvorlage vorlegen. Beides versagen wir uns je-doch an dieser Stelle: zum einen aus Platzgründen, zum anderen, weil beides schon auszugsweise an anderer Stelle vorgenommen wurde und erneut nur in einem grö-ßeren Zusammenhang behandelt werden sollte.
Wir hoffen, dass die Präsentation von Haribhaṭṭas Originaltext (zumindest von fast 80 %) bei dem Jubilar auf Interesse stoßen wird, ist er doch, abgesehen von Frau ČIČAK-CHAND, bislang der einzige Gelehrte, der Haribhaṭṭas Gestaltung der Śyāma-Legende mit Gewinn für seine Forschungen verwenden konnte. Um der Vollstän-digkeit willen fügen wir auch die nur auf Tibetisch erhaltenen Partien bei (in ge-schweiften Klammern). Die in dem bereits genannten Aufsatz von 1976 publizier-ten Varianten werden hier nicht wiederholt; die deutsche Wiedergabe konnte an mehreren Stellen verbessert werden. In dem auf Sanskrit erhaltenen Teil der Le-gende wird auf die tibetische Übersetzung nur dann eingegangen, wenn sie zum Wortlaut oder Verständnis des Sanskrittextes beiträgt oder auf eine echte Variante hinweist. Ein fortlaufender detaillierter philologischer Kommentar, wie er jüngst für HJM 26 (Jājvalin) und HJM 1 (Prabhāsa) vorgelegt wurde (vgl. Anm. 10), musste aus Platzgründen unterbleiben.
dhisattva career. 1. Haribhaṭṭa’s version of the Prabhāsa legend”, Journal of Buddhist Studies, Vol. 4 (2006), S. 1-81, von Michael HAHN. 11 Wiesbaden 2009 (Veröffentlichungen der Helmuth von Glasenapp-Stiftung. Monographien 1). Dies ist die überarbeitete Fassung der am 24. Januar 2008 dem Fachbereich Fremdsprachliche Phi-lologien der Philipps-Universität Marburg vorgelegten Dissertation von Martin STRAUBE.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
220
XIV. ŚYĀMAJĀTAKAM12
{pha ma źes bya dge ba'i lo tog bskyed || phan gdags bya ba'i źiṅ ni 'di yin te || gaṅ la 'di yi blo gros 'byuṅ ba ni || de ñid de dag la ni rten par byed || 1||} {Āryā}
{«Eltern» – so heißt das Feld, auf dem man sich in nützlicher Weise betätigen soll und das als Ernte das Heil hervorbringt; derjenige, der diese Einsicht gewonnen hat, dient den [Eltern] mit Hingabe.}
{tadyathānuśrūya}(31a)te
sakalapṛthivīsaṃpadīvaikasthāyāṃ vārāṇasyāṃ nayapratāpaprathitaparākramaḥ samyagavalokitaprajāhitāhito brahmadatto nāma rājā babhūva | tasya ca śrutismṛti-tattvāvabodhī svadharmānuṣṭhānaprakāśayaśāḥ sarvaśāstrapāragaḥ suragurur ivā-marapateḥ
bahumānād iva brāhmyā śāntayāliṅgitaḥ śriyā | purohito ’bhavaj jyāyān pariṇatyā śrutena ca || 2 || Anuṣṭubh
{Folgendermaßen wird es erzä}hlt:
In Benares, wo sich das Glück und Wohlergehen der gesamten Erde an einem Platz versammelt zu haben schien, lebte einst König Brahmadatta, dessen Kraft sich durch seine kluge Politik und seine Majestät entfaltete13 und der Nutzen und Scha-den seiner Untertanen einer gründlichen Abwägung unterzog. Er hatte nun [einen Priester], der den Gehalt der Veden und der darauf basierenden Texte verstand, des-sen Ruhm durch die Ausübung seiner Aufgaben hell erstrahlte, der sämtliche Wis-senschaften völlig durchdrungen hatte, der für ihn dasselbe bedeutete wie Bṛhaspati für Indra, den Herrscher der Unsterblichen14;
der gleichsam aus Hochachtung von dem abgeklärten Glanz der Heiligkeit umarmt wurde – einen durch seine Reife und Gelehrsamkeit hervorragenden Priester.
atiśīghram ayaṃ nīto mṛtyor a(2)ntikam etayā | ity apaśyad iva krodhād brāhmī śrīs tasya tāṃ jarām || 3 || Anuṣṭubh
12 Verwendete Zeichen: {...} Nur auf Tibetisch erhaltener Text bzw. dessen deutsche Übersetzung (Zahl) Folien- und Zeilenanfänge in der Sanskrithandschrift (Text) Erläuterungen bzw. Sanskrittermini in der deutschen Übersetzung [Text] Zusätze in der Übersetzung (ohne Entsprechung im Sanskrit bzw. Tibetischen *.....(*) Emendierter bzw. rekonstruierter Text <Tibetischer Text> Ergänzte Buchstaben 13 Das Kompositum ist nicht ganz einfach zu interpretieren. Man vgl. den klareren Ausdruck naya-pratāpavijitasarvasāmantena HJM 2.1+. Bemerkenswerterweise übersetzt HJMtib nayapratāpa- beide Male als Tatpuruṣa-Kompositum: tshul gyi rab tu gduṅ bas bzw. tshul gyi rab tu tsha bas. 14 Zum Verhältnis beider Götter vgl. H.-P. SCHMIDT, Bṛhaspati und Indra, Wiesbaden 1968, insbes. S. 79-87 u. 94-122.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
221
„Allzu schnell hat es ihn in die Nähe des Todes gebracht!“ Als ob er dies dächte, blickte der Glanz der Heiligkeit voller Zorn auf sein Alter.
bodhisattvo ’bhavat tasya tanayas tanayārthinaḥ | nāmnā śyāmakaḥ khyātaḥ sthiraśīlavibhūṣaṇaḥ || 4 || Anuṣṭubh
Der Bodhisattva wurde [nun] als Sohn von ihm geboren, der sich [so sehr] einen Sohn gewünscht hatte. Dieser erhielt den Namen Śyāmaka und galt als eine Zierde unverbrüchlicher Sittlichkeit.
paṭvīṃ ajanitakṣobhāṃ capalair indriyormibhiḥ || so ’bhūd dhīnāvam āruhya vidyājaladhipāragaḥ || 5 || Anuṣṭubh
Er bestieg das wendige Schiff des Geistes, das nicht von den beweglichen Wellen der Sinnesorgane zum Schwanken gebracht werden kann, und gelangte mit ihm zum anderen Ufer des Ozeans des Wissens.
tasyendukamanīyasya prakṛtyā priyavādinaḥ | sarvatra mitrapakṣo ’bhūn nāstāṃ madhyasthavairiṇau || 6 || Anuṣṭubh
Er, der so liebenswert war wie der Mond und von Natur aus freundlich redete, hatte überall nur Freunde; Indifferente und Feinde gab es für ihn nicht.
dhīraṃ vinayadharmāṇaṃ sarveṣāṃ guṇavādinam | tyajya(3)*m eva hi* paśyan*ti taṃ* dviṣanto dviṣattayā || 7 || Anuṣṭubh
Weil sie von Hass erfüllt sind, sehen die feindlich Gesinnten gerade ihn als einen zu Meidenden an, der fest und weise ist, das Prinzip der Bescheidenheit verkörpert und von allen nur Gutes sagt.15
atha tasya mahātmano jarāparicayadurbalāṅgayor mātāpitroḥ *prabalena16 timira-paṭalena darśanasāmarthyam antaradhīyata | tataḥ purohito rājānam upagamyovā-ca ||
Nunmehr verloren die Eltern dieses Hochherzigen, deren Körper, dem Alter Tribut zollend, schwach geworden waren, infolge einer sehr starken Augentrübung ihr Augenlicht. Darauf begab sich der Priester zum König und sagte:
vipannadṛṣṭiḥ saha deva bhāryayā tapovanaṃ gantum ahaṃ samudyataḥ | ato mamāyaṃ guṇaratnasāgaraḥ purohitatve tanayo ’bhiṣicyatām || 8 || Vaṃśastha
15 Wie in den Anmerkungen zum Text erläutert, wurde der Wortlaut der zweiten Strophenhälfte nach der tibetischen Übersetzung hergestellt. Die in der Strophe enthaltene allgemeine Aussage ist zwar für sich genommen sinnvoll, aber hier ist uns der inhaltliche Bezug zur vorangehenden Strophe nicht ganz klar. 16 Hier folgen wir der tibetischen Übersetzung (śin tu stobs daṅ ldan pa’i), nicht dem Manuskript, das praviralena liest! Letzteres erscheint uns in diesem Kontext nicht sinnvoll interpretierbar.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
222
„Meines Augenlichtes beraubt, o Herr, bin ich gewillt, mit meiner Frau in den Asketenwald zu gehen. Daher soll jetzt mein Sohn, der ein Ozean voller Tugendjuwelen ist, zum Priester geweiht werden.“
pramādahe(4)tau prathame ’pi yauvane na yujyate buddhimato gṛhāśramaḥ | kim u smṛtidhvaṃsini cittabādhane jarāripāv indriyapāṭavacchidi || 9 || Vaṃśastha
Für einen Klugen ist das Leben als Familienvater nicht einmal in der allerersten Jugend passend, die die Ursache der Sorglosigkeit ist. Um wie viel weniger also dann, wenn der Feind «Alter» die Achtsamkeit vernichtet, den Geist quält und die Schärfe der Sinnesorgane beeinträchtigt!
na ca devena mama tapaḥ sisādhayiṣor antarāyaḥ karaṇīyaḥ | paśyatu devaḥ ||
Daher darf seine Majestät mir kein Hindernis in den Weg legen, wenn ich [jetzt] Askese üben möchte. Seht, Majestät:
malīmasaṃ karma yadā samīhate niṣedhanīyaḥ suhṛdā tadā pumān | yadā tu dharmyām avalambati kriyāṃ pracodanīyaḥ sa tadā hitaiṣiṇā || 10 || Vaṃśastha
Wenn ein Mensch eine Handlung ausführen möchte, durch die er sich besudeln könnte, dann sollte ein Freund ihn daran hindern; wenn er sich aber eine rechtmäßige Tat vorgenommen hat, dann sollte der, der sein Heil wünscht, ihn dazu ermutigen.“
atha sa rājā (5) pitarīva tatra purodhasi tapovanaṃ jigamiṣati viṣādasaṃbhūtāśru-salilapariplutākṣaḥ śyāmam āhūyāvocad ayaṃ te gurujanaḥ tapovanaṃ gantumanās tataḥ pratīcchatu bhavān asmattaḥ paurohityam iti | atha śyāmaḥ kṣaṇam adhomu-khaḥ sthitvātmagatam iti cittānuśāsanam akārṣīt ||
Der König war darüber, dass der Priester in den Asketenwald ziehen wollte, so be-stürzt, als wenn es sich um seinen eigenen Vater handelte. Mit Tränen in den Augen rief er Śyāma herbei und sagte zu ihm: „Deine Eltern haben vor, in den Asketen-wald zu ziehen; empfange daher von uns die [Weihe zur königlichen] Priester-schaft.“ Śyāma verharrte darauf einen Augenblick lang mit gesenktem Kopf, in sei-nem Herzen die folgende Belehrung seines Geistes vornehmend:
cetaḥkarīndra kim imāṃ sukhaleśalubdha tṛṣṇākareṇum anuga(6)cchasi duḥkhahetum | saṃtoṣaśailavirahād asatāṃ sakāśāt tvāṃ duḥkhayiṣyati nikāramayaḥ pratodaḥ || 11 || Vasantatilaka
„O Elefant «Geist», weshalb verfolgst du in deinem Verlangen nach einem Bisschen Glück diese Elefantenfrau «Gier», die die Ursache für Leid ist?
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
223
Fern vom Berg «Zufriedenheit» wird dich in der Nähe von Schlechten der Stachelstab «Demütigung» peinigen.
vyājṛmbhamāṇaguṇatāmarasāvakīrṇāṃ vidvatkathāṃ kamalinīm avagāhya śāntām | kiṃ nāma vāñchasi duruttaradoṣapaṅkāṃ sevānadīm avagāḍhum agādhabhīmām || 12 || Vasantatilaka
Warum auf Erden möchtest du in den tiefen und schrecklichen Strom «Dienstbarkeit» eintauchen, der nur schwer zu durchwaten ist wegen des Schlammes «Fehler» [auf seinem Grund], nachdem du zuvor in den ruhigen Lotusteich «Belehrungen der Klugen» eingetaucht bist, der bedeckt ist mit den sich öffnenden Taglotussen «Tugenden»?
etat tvayā balavatā paripālyate ced unmārgagaṃ capalam indriyanāgayūtham | doṣāṅkuśavraṇavidhāyibhir ity anāryair ābādhyase viṣayahastipakair na jātu || 13 || Vasantatilaka
Wenn du mit deiner Stärke die unruhige Schar der Elefanten «Sinnesorgane» vor Abwegen beschützt, dann17 wirst du gar nicht von den niedrigen Elefantentreibern «Sinnesobjekte» gepeinigt, die [dich] mit den Stachelstäben «Fehlern» verletzen.
saṃsāramārgagamanaśramabhaṅgahetau sādhūpadeśasalile ’tiśayaprasanne | snātvā kim ātmani vimūḍha kukāryasaṅga- pāṃsuṃ samākirasi varjitam ātmakāmaiḥ || 14 || Vasantatilaka
Verblendeter, nachdem du zuvor im überaus klaren Wasser «Unterweisungen guter Menschen» gebadet hast, das die Erschöpfungen vom Wandern auf den Wegen des Daseinskreislaufes beseitigt, weshalb bewirfst du dich jetzt mit dem Staub «Hängen an schlechten Taten», der von denen gemieden wird, denen ihr Selbst lieb ist?
kiṃ cittadvipa bhāṣitena bahunā saṃsāravicchittaye bhoktuṃ vāñchasi cet tapovanasukhaṃ bhuktaṃ ciraṃ sūribhiḥ | chittvā janmanibandhanīṃ balavatīm āśāmayīṃ *śṛṅkhalāṃ bhogāsaṅgamayaṃ *dhṛticchidam a(31b)taḥ stambhaṃ samunmūlaya || 15 || Śārdūlavikrīḍita
Genug nun des vielen Geredes, o Elefant «Geist»!18 Wenn du das Glück des Asketenwaldes genießen möchtest, das von den Heiligen schon lange genossen wurde,
17 Hier scheint iti im Sinne von tadā zu stehen! 18 Dass cittadvipa hier Vokativ und nicht Kompositumsvorderglied ist, ergibt sich zwingend aus dem Kontext dieser Selbstbelehrung, in der der mit einem Elefanten verglichene Geist direkt angeredet wird. Vgl. auch den Vokativ cetaḥkarīndra (11a) zu Beginn der Selbstbelehrung.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
224
um den Kreislauf der Existenzen zu beenden, dann musst du die starke eiserne Fessel «Erwartungen» zerschneiden, die einen an die nächste Geburt bindet und den Pfosten «Genusssucht» herausreißen, der die Festigkeit raubt.
iti cittānuśāsanaṃ kṛtvā rājānam uvāca | mahārāja | gṛhavāso nāmāyaṃ kalivigra-havairāṇām āspado naikeṣāṃ duritabhujaṅgamānāṃ valmīkaḥ | svajanasnehāva-bandhāt tapovanagamanāntarāyo mithyāvacasām ākaraḥ | sevākārpaṇyasyotpāday-itā śreyomārgapratipakṣaḥ | samudra iva salilaughair mahadbhir api vibhavair āpūryamāṇo na tṛptim upayāti | viṣayapāśair alpacetasāṃ (2) hṛdayam ābadhnāti | bhogyaparikṣayāc ca kṣīṇasamṛddhir avasāne malinapaṭaccaraprāvṛtagṛhapatiḥ kṣutkṣāmapraruditaḍimbhakāvalokyamānamātṛjano dhānyaśūnyakoṣṭhāgāratayā vi-ṣaṇṇaparijano ’tithibhir anākrāntadvāraḥ kasya sacetaso na hṛdayam udvejayati | yady api ca nāmātyantasukhahetur eva gṛhasthatā syāt tathāpi na yujyate tapo-vanābhimukhāv andhau pitarau parityajya mama paurohi(3)tyam avalambitum iti ||
Nachdem er so seinen Geist belehrt hatte, sprach er zum König: „Majestät, das Le-ben als sogenannter Familienvater ist der Grund von Streit, Kampf und Feindschaft, der Ameisenhaufen für die zahlreichen Schlangen «böse Taten». Aufgrund der Bin-dung, die durch die Liebe zu den Angehörigen entsteht, hindert es einen daran, in den Asketenwald zu gehen, und es ist der Ursprungsort falscher Rede. Weiter bringt es Dienstbarkeit und Knauserigkeit hervor und ist dem Weg zum Heil entgegenge-setzt. So wie der Ozean nicht satt wird an Wassermassen, so stellt sich auch dann keine Zufriedenheit ein, wenn es von den allergrößten Besitztümern begleitet ist. Mit den Schlinge der Sinnesobjekte fesselt es die Herzen der Beschränkten. Und wenn nach dem Dahinschwinden der Reichtümer der Familienvater seines Wohler-gehens beraubt und schließlich in schmutzige Lumpen gehüllt ist, wenn seine Frau von vor Hunger ausgemergelten und weinenden Kindern angeschaut wird, wenn sein Gefolge ganz niedergedrückt ist, weil es in den Kornkammern kein Getreide mehr gibt, wenn seine Tür nicht mehr von bittenden Gästen aufgesucht wird – wel-cher fühlende Mensch ist dann nicht in seinem Herzen erschüttert? Und selbst wenn der Stand eines Familienvaters die Ursache grenzenlosen Glücks wäre, so wäre es dennoch nicht recht, wenn ich meine dem Asketenwald zugewandten blinden Eltern im Stich ließe und mich dem Priesteramt widmete.
ābhyāṃ pitṛbhyām avilocanābhyāṃ tṛṣā kṣudhā ca pratanūkṛtābhyām | mayā vinā dāsyati kaḥ *prasṛtyā vane sthitābhyāṃ salilaṃ phalaṃ vā || 16 || Upajāti
Wer wird diesen beiden blinden Eltern, deren Leiber vor Hunger und Durst ganz dünn geworden sind, mit ausgestreckter Hand Wasser und Früchte reichen, wenn sie im Walde weilen, wenn nicht ich?
iyaṃ pratyāsannā vahati sarid acchācchasalilā ghanacchāyo mārge pathikajanasevyas tarur ayam | samāśvāsaṃ kurvann iti gamanakhedaglapitayor bhaviṣyaty ākhyātā ka iva mama pitroḥ sakaruṇaḥ || 17 || Śikhariṇī
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
225
‚Hier fließt doch ganz in der Nähe ein Fluss mit kristallklarem Wasser, und am Wegrand steht dieser Baum mit seinem dichten Schatten, der von Wanderern aufgesucht wird!’ Welches mitleidsvolle Wesen wird denn meine Eltern mit diesen Worten beruhigen, wenn sie vom Gehen erschöpft sind?
pau(4)rohityasukhāśayā yadi gṛhe tiṣṭhan kutaś cid gurū śroṣyāmy adhvaparicyutau nipatitau kūpe girer vā *taṭe | dehāgāranibandhanaṃ katham idaṃ vakṣyāmy ahaṃ jīvitaṃ tasmān mā sma ruṇaḥ kṣitīśavara māṃ yāntaṃ pitṛbhyāṃ saha || 18 || Śārdūlavikrīḍita
Falls ich in der Hoffnung auf das Glück des Priesteramtes im Hause bleiben und dann von irgend jemand hören sollte, dass meine beide Eltern vom Weg abgekommen und in eine Grube hinein oder den Abhang eines Berges hinabgefallen sind, wie werde ich dann imstande sein, dieses Leben zu ertragen, das in die Behausung «Körper» eingeschlossen ist? Deshalb hindert mich nicht, o edelster König, wenn ich zusammen mit meinen Eltern fortgehe.
atha tena rājñābhyanujñātagamanaḥ śyāmaḥ samavalambya pitarau virahasaṃbhū-taduḥkhopacitabāṣpāvilalocanam anugāminaṃ vinivartya bāndhava(5)suhṛjjanaṃ mṛgadaśanacchinnaviṣamakuśatṛṇāṅkuraśyāmabhūmitalam aruṇasārathikiraṇa-saṃtāpajanitaśvāsacalitakaṇṭhaiḥ śikhibhir adhyāsitaviṭapicchāyaṃ varāha*proth-otkhātamustānicitapalvalataṭāvalīnasārasamithunonnāditam *elābhaṅgasurabhiṇā *kuñjaramadagandhenādhivāsitāntaram anilapreritavividhakusumitalatādolādhiro-hi(6)madhukarakulopagītaṃ śāntam araṇyaṃ śanaiḥ śanaiḥ prapede ||
Als nun Śyāma vom König die Erlaubnis erhalten hatte zu gehen, da nahm er seine Eltern, schickte die ihm folgenden Verwandten und Freunde zurück, deren Augen vom Leid der [bevorstehenden] Trennung tränengetrübt waren, und gelangte [mit ihnen] ganz allmählich in eine ruhige Wald[gegend], wo der Boden dunkel war von den Kuśagrasschösslingen, die von den Zähnen der Gazellen ungleichmäßig abge-nagt worden waren; wo der Schatten der Bäume von Pfauen aufgesucht wurde, de-ren Hälse sich beim schnaufenden Atmen hin und her bewegten, welches von der Hitze der Sonnenstrahlen bewirkt worden war; die von Sārasa-Pärchen durchtönt wurde, die am Ufer kleiner Tümpel hockten, [Ufer, die] mit Mustāgras bedeckt wa-ren, das die Eber mit ihren Schnauzen ausgegraben hatten; deren Inneres vom Duft des Brunstsaftes der Elefanten durchzogen war, so wohlriechend wie zerbrochener Kardamum; die durchsummt war von Bienenschwärmen, die sich auf den schaukel-gleichen, mit vielen Blüten versehenen und vom Wind bewegten Ranken niederge-lassen hatten.
tau yatra yatra paricaskhalatuḥ prayāntāv andhau vanādhvani gurū viṣamāśmaruddhe | duḥkhaṃ dayāmṛduni cetasi tatra tatra tasyātitīkṣṇam aruṣīva viṣaṃ papāta || 19 || Vasantatilaka
Wo immer seine beiden blinden Eltern stolperten, als sie auf den Waldwegen einhergingen,
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
226
die durch unebene Steine beeinträchtigt waren, dort drang Schmerz in sein von Mitgefühl weiches Herz ein, als wäre ein ganz scharfes Gift in eine Wunde gelangt.
viṣame ca bhūbhāge skandhena nītvā bodhisattvaḥ kva cit tarumūle pitarau bhoja-yitvā punar utthāyāparāhnasamaye panthānaṃ prapadya kaṃ cid eva saṃgatyā (7) samupagataṃ palāśataruparṇāvacchāditalalāṭam alaghudarśanaṃ dhanuṣmantam ubhayaskandhāvabaddhasaśaratūṇīram atinimnanayanakapolam āparuṣakapilavi-ralakeśaśmaśrujālaṃ racitaśikhicandrakakarṇapūram ayaḥstambhanīlavarmāṇam aparokṣavanavṛttāntaṃ vanacarakam apṛcchat | bhadramukha katamasmin punaḥ pradeśe tapovanam iti | sa kṛtābhivādanasatkāras tasmai (32a) dhanuṣkoṭyā nirdi-deśa | draṣṭum arhaty āryo yasminn ayaṃ
Nachdem er seine Eltern an unebenen Stellen auf der Schulter getragen hatte, gab der Bodhisattva ihnen am Fuß irgendeines Baumes zu essen. Nachdem sie sich wie-der erhoben hatten, gelangten sie am Nachmittag zu einem Weg, auf dem ihnen zufällig ein Waldbewohner entgegenkam. Seine Stirn war mit Blättern von Palāśa-Baum bedeckt, weswegen er nicht leicht zu erkennen war19. Er trug einen Bogen, und auf beiden Schultern hatte er Köcher für die Pfeile befestigt. Seine Augen und Wangen waren tief eingesunken, die Haare am Körper und im Gesicht waren ziem-lich grob, gelblichrot und spärlich. Aus den Schwanzfedern eines Pfaus hatte er sich einen Ohrschmuck angefertigt, und er trug einen Schutzpanzer, der so schwarz war wie eine eiserne Säule. Ihm entging nichts von dem, was im Wald geschah.20 Ihn fragte der Bodhisattva: „Guter Mann, in welcher Richtung gibt es hier einen Aske-tenwald?“ Der Jäger begrüßte ihn höflich und zeigte es ihm mit der Spitze seines Bogens: „Ehrwürdiger, schaut:
vinyasyeṅgudam ardhabhinnam upale pākena piṅgīkṛtaṃ sāṣāḍhaṃ karam unnamayya śanakair utthāya vetrāsanāt | naivāraṃ kaṇiśaṃ harantam udarapraśliṣṭapādadvayaṃ mātus tāpasaputrakaḥ kathayati protkṣiptavaktraḥ śukam || 20 || Śārdūlavikrīḍita
atra pradeśe tapovanam | tad gacchatv āryaḥ sagurujanaḥ tapovṛddhaye | tatheti śyāmas tasmai vanacarakāya dattvāśīrvādaṃ tapovanaṃ prāviśat | (2)
Wo das Söhnchen des Asketen die in zwei Hälften geteilte Iṅgudī-Frucht, die reif ist und deshalb gelb aussieht, auf einen Stein niederlegt; wo es die Hand mit dem Palāśa-Stab hebt und langsam von seinem Schilfrohrsitz aufsteht; wo es seinen Kopf emporrichtet und seine Mutter auf den Papagei hinweist, der Nīvārareiskörner aufsammelt, wobei dessen Beine unter dem Bauch verschwinden —
19 Der Ausdruck alaghudarśanaṃ ist mehrdeutig. Mögliche Alternativübersetzungen wäre: „er sah ernsthaft, bedeutend; massig, schwerfällig; gefährlich, gewalt[tät]ig aus“, vgl. etwa APTE: „alaghu … 4. intense, violent, very great“. Aber gerade für die zuletzt genannten negativen Eigenschaften bietet der Kontext keinen Anhaltspunkt. 20 Dies ist wohl auch der Sinn der tibetischen Übersetzung: nags kyi gtam dbaṅ po las ma ’das pa „die Nachrichten des Waldes entgingen nicht seinen Sinnen“.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
227
in der Gegend ist ein Asketenwald. Deshalb geht mit euren Eltern dorthin, um eure Askese zu vervollkommnen.“ „Das wollen wir tun,“ entgegnete dem Waldbewoh-ner Śyāma, segnete ihn und betrat den Asketenwald.
kaś cit tapodhanas toyam anyaḥ svādurasaṃ phalam | kaś cit svāgatam ity uktvā tasmai kṛṣṇājinaṃ dade || 21 || Anuṣtubh
Ein Asket bot ihm Wasser, ein anderer süß schmeckende Früchte an, ein dritter hieß sie willkommen und gab ihm ein Antilopenfell.
vane vā bhavane vāpi cirāya vasatā satā | yathāvibhavam ātithyaṃ kartavyaṃ dharmam icchatā || 22 || Anuṣṭubh
Ganz gleich, ob er für längere Zeit im Wald oder im Hause lebt, muss ein Guter, der rechtmäßig handeln möchte, stets mit dem, was er gerade hat, Gastfreundschaft erweisen.
kadalīgulmakaśyāmaṃ śyāmasyāśyāmacetasaḥ | tam āśramam athālokya manasy evam abhūt spṛhā || 23 || Anuṣṭubh
Als er nun die Einsiedelei betrachtete, die dunkel von den Bananenstaudengebüschen war da entstand im Herzen Śyāmas, dessen Gesinnung alles andere als finster war, dieses Verlangen:
upāntasaṃrūḍhamṛṇālinīvanaṃ trisaṃdhyam ājyāhutidhūmavāsitam | kva cin niviṣṭotthitasaṃcaranmṛgaṃ nimittam utkhātabha(3)vasya vartmanaḥ || 24 || Vaṃśastha
idaṃ praśāntair bhavabhaṅgakāṅkṣibhiḥ tapovanaṃ yogibhir āśritoṭajam | viśed anaṅgo ’pi vihāya kārmukaṃ śamābhilāṣī kiṃ batottamo janaḥ || 25 || Vaṃśastha
„In diesen Asketenwald, an dessen Saum ganze Wälder von Lotussen wachsen, der zu allen drei Tageszeiten nach dem Rauch von Butteropferspenden riecht, wo überall Gazellen sich [gerade] hingelegt haben, aufgestanden sind oder herumlaufen, der die Ursache dafür ist, dass der Weg des Werdens vernichtet ist,
wo in Laubhütten abgeklärte Yogis wohnen, die das Werden vernichten möchten, dürfte selbst der Liebesgott Anaṅga in dem Wunsch nach Seelenruhe eintreten wollen, nachdem er zuvor seinen Bogen beiseite gelegt hat – um wieviel mehr ein edler Mensch!“
taiś ca tapodhanaiḥ sahaikāṃ rajanīṃ tatroṣitvā prabhātasamaye bodhisattvaḥ pra-vivekasukham icchan pṛthak tasmāt tapovanān mahatīṃ ramaṇīyāṃ parṇaśālāṃ cakāra ||
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
228
Und nachdem er eine einzige Nacht dort zusammen mit den Asketen verbracht hat-te, errichtete sich der Bodhisattva am nächsten Morgen in dem Wunsch nach dem Glück der Abgeschiedenheit eine große und schöne Laubhütte, [etwas] abgesondert vom Asketenwald.
bhaktyā gurū paricaran sa guru(4)svabhāvo juhvat kṛśānum akṛśasthiratuṅgabuddhiḥ | bahvīḥ samāḥ *samamanāḥ svajane jane ca tatrāśrame ’gamayad āgamayaṃs tapāṃsi || 26 || Vasantatilaka
Selbst über ein ehrwürdiges Wesen gebietend diente er voller Hingabe seinen beiden ehrwürdigen Eltern; mit einem großen, festen und hochgesinnten Herzen ausgestattet brachte er die Feueropfer dar, und indem er sich mit der Askese vertraut machte, brachte er in jener Einsiedelei viele Jahre zu, wobei er Angehörigen wie Fremden gegenüber gleich gesinnt war.
atha kadā cit sa mahātmā girivanāntarāt puṣpaphalasamiddarbhān ānīya mṛdupa-lepanam uṭajabhūmeḥ kṛtvā prakṣālitapāṇipādaḥ kalaśam ādāya hariṇaśiśubhir abhigamyamānaḥ pracuravetasalatāpratā(5)nasaṃbaddhataṭāṃ sitamaṇicchedavi-malaśiśirasvādasalilavāhinīṃ saritam āgamya ||
Einstmals brachte der Hochgesinnte Blumen, Früchte, Brennholz und Darbhagras aus dem Inneren eines Bergwaldes herbei, bestrich den Boden der Laubhütte mit Lehm, wusch sich Hände und Füße, nahm einen Wassertopf und begab sich, gefolgt von jungen Gazellen, zum Fluss, dessen Ufer dicht mit einem Geflecht von zahlrei-chen Rotangranken bedeckt war und der kühles und wohlschmeckendes Wasser führte, das so rein war wie ein Stück von einem Kristall.
ajinaṃ cākṣamālāṃ ca śākhāyāṃ nyasya śākhinaḥ | snātaḥ śītajale śuddhe hlādāyāmbu vyagāhata || 27 || Anuṣṭubh
Er hängte sein Fell und den Rosenkranz an den Zweig eines Baumes, wusch sich in dem kühlen reinen Wasser und tauchte zur Erquickung ins Wasser.21
haritaṃ tṛṇam ādaśya pītvā ca vimalaṃ jalam | pratyapālayad āsīnaḥ taṃ snāntaṃ mṛgaśāvakaḥ || 28 || Anuṣṭubh
Während er sich wusch, wartete ein Gazellenjunges auf ihn, das sich hingesetzt hatte, nachdem es grünes Gras gefressen und klares Wasser getrunken hatte.
atha brahmadatto rājā śabdavedhī mṛgayāvinodam anubhavan druta(6)gāminā tu-rageṇākṛṣyamāṇas taṃ nadītīram āgamya bodhisattvāvagāhanajanitam udakaśab-
21 HJMtib übersetzt bde phyir chu ni 'dzin par gyur „und nahm zur Erquickung Wasser.“ Lasen die Übersetzer fälschlich *vyagra(b)hata?
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
229
dam ākarṇya taṭatarulatāntaradṛṣṭiviṣayo niyatam imāṃ nadīṃ varāho mṛgo vāva-tīrṇa iti vicintya yataḥ śabdas tena22 śaraṃ cikṣepa ||
Nun kam König Brahmadatta, der nach dem Gehör zu schießen verstand, von sei-nem schnellen Pferd getragen zu jenem Flussufer, als er sich dem Jagdvergnügen hingab. Er hörte das Geräusch, das der Bodhisattva beim Eintauchen ins Wasser verursachte, und weil ihm die Sicht durch die Ranken der Uferbäume versperrt war, dachte er: „Gewisslich ist ein Eber oder eine Gazelle ins Wasser gestiegen“ und schoss in die Richtung, aus der das Geräusch kam.
bāṇena tenātha mahāphalena vakṣaḥsthale ’sau bibhide mahātmā | tatpātaśabdavyathitāntarātmā kūlād udasthān mṛgaśā(7)vakaś ca || 29 || Indravajrā
Da wurde der Hochherzige von dem Pfeil mit seiner scharfen Spitze mitten in der Brust getroffen. Vom Geräusch seines Falles beunruhigt erhob sich das Gazellenjunge vom Ufer.
kenāsmi viddha iti vācam imāṃ niśamya tasya kṣiter adhipatiḥ karuṇātmakasya | ko ’yaṃ bhaved iti harer avatīrya tūrṇaṃ śyāmaṃ vyalokayad uraḥsthalalagnabāṇam || 30 || Vasantatilaka
„Wer hat mich getroffen?“ Als der König diese Worte des seinem Wesen nach mitleidigen [Śyāma] vernommen hatte, dachte er: „Wer ist das?“, stieg schnell vom Pferd herab und erblickte Śyāma, in dessen Brust ein Pfeil steckte.
taṃ pratyabhijñāya cirāt sa rājā śyāmo ’yam ity āgatabāṣpanetraḥ | idaṃ babhāṣe tarujālarūḍho mṛgo ’yam ity atra mayā nividdhaḥ || 31 || Upajāti
Nach einer Weile erkannte er ihn: „Das ist ja Śyāma“, und Tränen stiegen in seinen Augen empor. Er sprach: „Ich dachte, es sei hier eine Gazelle hinter den dichten Bäumen verborgen. Deshalb habe ich dich durchbohrt.“
vyasanaṃ capalaiḥ pramādadoṣāt kriyate yatra satām apīdṛśānām | (32b)
22 Die durch das Tibetische gesicherte Verwendung des Instrumentals in direktiver Funktion ist für das Sanskrit recht ungewöhnlich. Herrn Kollegen VON HINÜBER verdanken wir den Hinweis auf eine Stelle mit spezifisch direktivem Charakter, der sich von dem Gebrauch der bekannten yena ... te-na ...-Formel abhebt: ito otarāhīti tena otaranto ..., Vin III 82,12 „komm hierher herunter! Dorthin hinabsteigend ....“.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
230
mṛgayāvyasanāt tato narāṇāṃ vyasanaṃ kaṣṭatamaṃ23 hi nānyad asti || 32 || Mālabhāriṇī
Es gibt kein schlimmeres Laster unter den Menschen als diese Jagdleidenschaft, die es mit sich bringt, dass sogar solch guten Menschen von Leichtfertigen aus Achtlosigkeit Leid zugefügt wird.
nṛpaśabdamadāvalepamūḍhaṃ vinipātābhimukhaṃ pramādabhājam | karuṇām avalambya śāntamūrte kaṭunā śāpaśareṇa mā vadhīr mām || 33 || Mālabhāriṇī
„O du, der du von abgeklärtem Wesen bist, sei mitleidig und töte mich nicht mit dem scharfen Pfeil deines Fluches, der ich verblendet bin durch den Stolz und den Dünkel, der auf dem Wort «König» beruht, der ich achtlos bin und bestimmt zu fallen!“
atha bodhisattvas tam avanipatim evam ātmanindāparāyaṇam anutāpaparigatamā-nasaṃ śāpāgamāśaṅkitam adhīrayad alam alaṃ mahārāja mattaḥ śāpābhiśaṅkayā ||
Darauf richtete der Bodhisattva den König, der sich solchermaßen der Selbst-zerfleischung hingab und dessen Herz ganz von Reue und von der Furcht durch-drungen war, es könne ihn ein Fluch treffen, mit diesen Worten auf: „Lasst ab, lasst ab, großer König, von der Befürchtung, es könne von mir ein Fluch ausgehen.
atiroṣavaśād api tvayā prahitaḥ syān ma(2)yi cec chilīmukhaḥ | na tathāpi mamānyathā bhavet tvayi cetaḥ kim u doṣavarjite || 34 || Viyoginī
Wenn sich mein Herz Euch gegenüber selbst dann nicht ändern würde, wenn Ihr in übergroßem Zorn einen Pfeil auf mich abschösset, um wie viel weniger jetzt, da Ihr frei von [diesem] Fehler seid!“
nanu pūrvakṛtena karmaṇā śararūpeṇa hato ’smi vakṣasi | iti kātra tavāparādhitā nṛpate śāpabhayaṃ parityaja || 35 || Viyoginī
Ich bin doch nur von meinen früher begangenen Taten in Gestalt dieses Pfeils in der Brust getroffen worden; wie könntet Ihr also daran schuld sein, Majestät? Deshalb braucht Ihr keine Angst vor einem Fluch zu haben.
sati janmani kiṃ na bhaṅguraṃ maraṇāt tan na bhayaṃ mamāṇv api |
23 Man erwartet einen Komparativ, aber auch HJMtib śin tu dka’ ba scheint den Superlativ zu bestä-tigen. Die Akṣaras sind an der Stelle zusammengequetscht, was auf eine Korrektur hinweist.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
231
pitarau tu ca me vicakṣuṣau paricintyāham upāgato vyathām || 36 || Viyoginī
Da es Entstehen gibt, wieso sollte es da kein Vergehen geben? Daher habe ich auch nicht die geringste Angst vor dem Tod. Wenn ich aber an meine beiden blinden Eltern denke, dann befällt mich doch Schmerz.
mayi kālavaśād bhavāntaraṃ gatavaty adya samākulākulau | jananī jana(3)kaś ca duḥkhitau kim ihāndhau gahane kariṣyataḥ || 37 || Viyoginī
Wenn ich nun gestorben und in ein anderes Dasein gegangen sein werde, was werden dann Mutter und Vater, beide völlig verwirrt und leidend, blind in diesem Waldesdickicht tun?
mama yāvad idaṃ mahīpate na samujjhanty asavaḥ śarīrakaṃ | samudānaya tāvad āturau pitarau me tvaritaṃ tapovanāt || 38 || Viyoginī
Majestät, bringt bitte schnell meine leidenden Eltern aus dem Asketenwald hierher, solange meine Lebensgeister diesen elenden Leib noch nicht verlassen haben.
kiṃ cij jarāparicayāc calitāṅgulīkair mlānāravindaparipāṇḍubhir agrahastaiḥ | pitros tayoḥ sakaruṇaṃ parimṛśyamāṇas tyakṣyāmi jīvitam ahaṃ sukhaṃ adya dhanyaḥ || 39 || Vasantatilaka
Wenn meine Eltern mich beide voller Mitleid mit ihren Händen streicheln, die so ausgebleicht sind wie welke Aravinda-Lotusse und deren Finger unter der Last24 des Alters schon ein wenig zittern, kann ich glücklich und leicht aus dem Leben scheiden.
evaṃ ca madvacanāt pita(4)rau vijñāpanīyau |
Und so sollt Ihr an meiner Stelle zu ihnen sprechen:
snehāmbhasā yuvābhyāṃ yaḥ siktaḥ putravṛkṣako vṛddhyai | abhivādanakusumam idaṃ paścimam ādīyatāṃ tasmāt || 40 || Āryā
‚Nehmt von dem Sohnesbäumchen, das ihr mit dem Wasser der Liebe getränkt habt, damit es gedeihe, als letztes diese Blume eines [Abschieds]grußes entgegen.’“
24 Wörtlich: „Anhäufung“.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
232
atha sa rājā katham aham idam apriyaṃ tayor īdṛśaṃ nivedayiṣyāmīti vicintya bo-dhisattvam uvāca ||
Da dachte der König bei sich: „Wie kann ich den beiden etwas derartig Unerfreuli-ches mitteilen?“ Er sprach zum Bodhisattva:
śareṇānena viddhas tvaṃ mayā durgatigāminā | apriyākhyānabāṇena kathaṃ vyatsyāmi tāv api || 41 || Anuṣṭubh
„Ich habe dich mit diesem Pfeil durchbohrt, wodurch ich [nun] einer schlechten Wiedergeburt vorbestimmt bin; wie kann ich da auch noch diese beiden mit dem Pfeil einer unerfreulichen Nachricht durchbohren?“
bodhisattva uvāca || ala(5)m alaṃ mahārāja kālātikrameṇa viṣamūrcchāparigatam iva me śarīraṃ pariklāmyati | atha sa rājātyayikam idaṃ kṛtyam ity avadhārya tatheti pratipadya tatraiva tam aśvaṃ latāyām ābadhya suśiṣya iva gṛhītavinayaṃ tapovanābhimukhaḥ pratasthe ||
Der Bodhisattva sagte: „Majestät, nun genug der Zeitverschwendung! Mein Körper ist so schwach, weil sich die Taubheit des Giftes schon irgendwie bemerkbar macht.“ Da kam der König zu dem Schluss, dass diese Handlung keinen Aufschub duldete.25 Mit den Worten „So sei es!“ willigte er ein, band sein Pferd genau dort an einer Schlingpflanze fest und brach, gehorsam wie ein folgsamer Schüler, in Rich-tung des Asketenwaldes auf.
śrutvā tataḥ kṣitipateḥ padaśabdam ārāt saṃśuṣkapādapapalāśanipīḍanottham | śyāmo ’yam āvrajati nūnam upātta(6)toyas tatra sthitāv iti parasparam ūcatus tau || 42 || Vasantatilaka
Als sie von fern das Geräusch der Füße des Königs vernahmen, hervorgerufen vom Zerdrücken der vertrockneten Blätter der Bäume, da sprachen die beiden dort gebliebenen Eltern zueinander: „Da kommt bestimmt Śyāma mit dem Wasser herbei.“
sa ca rājā samupagamya tad apriyam aśaknuvann ākhyātuṃ duḥkhāyamānahṛdayaḥ parṇaśālāṅgaṇam upetya tūṣṇīm evāvatasthe | tato bodhisattvajananī śyāmo ’yam āgata iti manyamānovāca ||
Als nun der König herbeikam, nicht imstande, die unerfreuliche Nachricht zu über-bringen, da begab er mit gepeinigtem Herzen in den Hof der Laubhütte und blieb dort ganz stumm stehen. Da nahm die Mutter des Bodhisattva an, dass Śyāma ge-kommen sei, und sagte:
ādāya kumbham udakāya nadīm upetya kiṃ tv adya putraka cirāt samupāgato ’si | hutvāgnim ānaya phalāni bisāni caiva vinyasya parṇapuṭake kṣudhitaḥ pi(7)tā te || 43 || Vasantatilaka
„Du bist mit dem Topf zum Fluss gegangen, um Wasser zu holen, aber nun bist du endlich wieder zurückgekehrt, Söhnchen.
25 Nebenbedeutung: „... schrecklich war“ (ātyayika).
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
233
Nachdem du das Feueropfer ausgeführt hast, bring Früchte und Wurzeln herbei und leg sie in ein Tellerchen aus Blättern, denn dein Vater ist hungrig.“
atha brahmadatto ’bhivādya kṛtātmanivedanaṃ tayos tad akāmakṛtam ātmaduścari-tam cacakṣe | śrutvā ca tau bodhisattvavyasanaṃ kaṣṭam ity uktvā moham upajag-matuḥ | cireṇāgatasaṃjñau tad tad vilapyocatuḥ ||
Darauf entbot Brahmadatta seinen Gruß, und nachdem er sich vorgestellt hatte, be-richtete er ihnen von seiner eigenen schlechten Tat, die er unwillentlich begangen hatte. Als die beiden gehört hatten, welches Unglück dem Bodhisattva widerfahren war, riefen sie „Wie schrecklich!“ und fielen in Ohnmacht. Nachdem sie ihr Be-wusstsein wieder erlangt hatten, klagten sie auf diese und jene Weise und sagten:
śarīrakaṃ tasya na yāvad ujjhitaṃ vayaḥśṛgālaiḥ kriyate vijarjaram | nareśvarāvāṃ kṛpaṇau tadantikaṃ tvam āśu tāvan naya duḥkhabhāginau || 44 || Vaṃśastha
„Majestät, führt uns Unglückliche und Elende jetzt schnell hin zu ihm, solange sein zurückgelassener bedauernswerter Körper noch nicht von Vögeln und Schakalen ganz zerfleischt ist!“
atha sa rājā tāv upagṛhya bāṇābhighāta(33a) {ab hier Textverlust}
{de nas rgyal po de dag ñe bar bzuṅ nas mda'i rma las skyes pa'i <b>rgyal bas rnam par btsums pa'i mig can byaṅ chub sems dpa'i gan du 'oṅs par gyur to || de nas ma bu kye ma bu źes zer źiṅ sdug bsṅal gyi dbaṅ gis byaṅ chub sems dpa' la 'khyud nas brgyal bar ñe bar soṅ bar gyur to || mdun na 'don pa des kyaṅ sñiṅ rje daṅ bcas par smre sṅags 'don pa'i phyir brtsams te |
Darauf gelangte der König mit den beiden {zum Bodhisattva, dessen Augen infolge der} durch die Pfeilwunde {hervorgerufenen Ohnmacht geschlossen waren. Hierauf rief die Mutter „Sohn, o Sohn!“, umarmte den Bodhisattva und fiel dann vor Schmerz in Ohnmacht. Der Priester begann ebenfalls jämmerliche Klagerufe auszu-stoßen:
stegs bu sas ni ñer byugs nas || me tog mchod pa yaṅ byas te || de riṅ sṅags ni ster bźin du || me la bud śiṅ ltuṅ bar gyur || 45 ||
„Nachdem das Opferbett mit Erde26 bestrichen und auch die Blumenspende dargebracht worden ist, sollte jetzt das Brennholz unter der Rezitation von Opfersprüchen ins Feuer hineinfallen.
rgas pa'i mdas ni phog pas bya ba rnam bral ba || dka' thub rnams kyis 'od med ñam chuṅ yan lag gi || dka' thub nags 'dir gnas pa yun riṅ du ni byuṅ || mig med dag daṅ kho bo cag gi khyod ni mig || 46 ||
26 sas ni ñer byugs nas dürfte auf upalipya mṛdā zurückgehen, wie wir es in HJM 6.6a finden. Vgl. auch mṛdupalepanam oben in 26+, was dort aber fälschlich wie mṛdūpalepanam übersetzt wurde.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
234
Vom Pfeil «Alter» getroffen, sind wir gar nicht [mehr] imstande, die Opferhandlungen (karman) zu vollziehen; infolge von Askese sind wir glanzlos und gliederschwach geworden; während unseres langen Aufenthalts in diesem Asketenhain wurdest du für uns Blinde27 zu unserem Auge.28
'di ni bu yi raṅ bźin mig ni chen po ste || mun pa daṅ bral skyon ni med pas [!] 'phrog byed pas || khyod kyis brtse ba dor ba da ltar bdag cag la || gśin rje gñis su 'gyur la loṅ ba ñid 'di byas || 47 ||
O mitleidloser Todesgott! Indem du uns nun dieses große Auge in Gestalt unseres Sohnes raubst, 29 das frei von Finsternis und ohne Makel ist, hast du uns nun zum zweiten Mal blind gemacht!
brtse ba'i chu yis bde byas 'jig rten yid dag ni || yon tan che ba'i chu skye gnas kyis ñer mdzes pa || gśin rje khyod kyis ci phyir bdag cag la ni 'di || bu yi raṅ bźin chu [82a] yi rten ni rnam par 'joms || 48 ||
O Todesgott, warum hast du uns diesen Teich in Gestalt unseres Sohnes zerstört, der die Herzen der Menschen mit dem Wasser der Liebe erquickte30 und mit den Lotussen großer Tugenden geschmückt war?
śin tu bdag cag 'di ltar mya ṅan gyis gnod pa || de riṅ bu *kye ci phyir mṅon par smra ba min || brtse ba can źes [!] bya ba dam pas [[83b]] de ltar ni || khyod kyis yun riṅ brtse med 'di ni gsal bar byas || 49 ||
O Sohn31, weshalb sprichst du jetzt nicht zu uns, die wir so sehr von Kummer überwältigt sind? So hast du Guter, der du doch als «liebevoll» bekannt bist, [deine] langwährende Lieblosigkeit offenbart!“
(79a) | de nas ma yun riṅ po nas 'du śes rñed pa<s> smre sṅags 'di ltar byas par gyur te |
Als die Mutter nach langer Zeit ihr Bewusstsein wieder erlangt hatte, wehklagte sie mit diesen Worten:
27 Das daṅ nach mig med dag fasse ich als Wiedergabe eines ca nach dem letzten Glied der Aufzäh-lung (der verschiedenen Attribute zu kho bo cag gi) auf. 28 Wiederum extrem untibetische Wortstellung. byuṅ ist das Prädikat zu mig, und in yan lag gi (End-glied eines Bahuvrīhi-Kompositums!) ist die Kasusendung des Bezugswortes (kho bo cag gi) vor-weggenommen. 29 Sehr befremdende Kasusrektion von ’phrog pa – falls der überlieferte Text korrekt ist. 30 Im ersten Stollen ist offenbar die Wortfolge des zugrundeliegenden Bahuvrīhi-Kompositums – etwa snehajalasukhitalokamanas – beibehalten worden. 31 Die Blockdrucke lesen bu skye statt bu *kye. Aus dieser falschen Lesart waren seinerzeit weitrei-chende Schlussfolgerungen gezogen worden (vgl. HAHN 1976, S. 61, Anm. 46), die sich nunmehr erübrigen.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
235
cuṅ zad dal gyis smra ba byis pa ñid kyis dbyig pa'i rta la źon par byed pa ni || cuṅ zad bskyod pa'i gtsug phud rtse mo ñe 'khor la ni rol pas rnam bskyod mig ldan pa || gaṅ źig phrad 'dod bdag gis 'gegs par byed pa bdag ñid kyis ni khyim na ((69b)) 'gro bźin pa || lag pa gñis kyis 'khyud pa yaṅ ni btsan thabs kyis ni bu khyod bdag la<s> ci phyir 'gro || 50 ||
„O Sohn, der du nur stockend gesprochen hast, als du kleiner Junge warst,- der du auf einem Steckenpferd geritten bist, dessen Scheitelspitze [beim Laufen] ein wenig zitterte, dessen Augen kokett aus den Augenwinkeln blitzten,32 der du von mir voller Sorge33 zurückgehalten wurdest, wenn du im Haus herumliefst – warum gehst du [jetzt] von mir fort, obwohl ich dich mit beiden Händen fest umarme?34
śin tu ñin rer khyod ni gaṅ gis mchod pa ste || gsum ldan me khyod de riṅ bdag gi bu de skyoṅ || gaṅ yaṅ nags ri 'di la gnas pa de rnams kyaṅ || lha mo bdag gi bu la srog ni rnam ster mdzod || 51 ||
Ihr heiligen drei Feuer35, rettet jetzt meinen Sohn, der euch täglich so vorbildlich geopfert hat! Und auch ihr Gottheiten, die ihr [hier] in diesen bewaldeten Bergen weilt, schenkt meinem Sohn [sein] Leben zurück!“
de ltar sñiṅ rje smra bar byed pa skad cig de || sdug bsṅal bsreg lugs za ba la źugs mthoṅ nas ni || rdo ba las lhuṅ chu las byuṅ ba'i sñiṅ rje'i sgra || der ni chu bo dag kyaṅ mya ṅan lta bur gyur || 52 ||
Im gleichen Augenblick, da er die so klagende36 und ins Feuer des Leides geratene [Mutter] erblickte, schien auch der Fluss dort sich zu grämen, [da er] klagende Laute [ausstieß], die durch das von den Steinen herabstürzende Wasser hervorgerufen wurden.
bud med daṅ ni bdag po'i mya ṅan mes ni 'phro || mñes gśin bsreg lugs kyis ni myur du laṅs pa yi || kun nas 'gro źiṅ de ni sgeg pa'i me stag ni || rgyal po'i sems ni brtan pa dor ba sreg par gyur || 53 ||
32 Die Wiedergabe ist nicht ganz sicher. ñe ’khor gibt hier sicher Skt. upānta- wieder, das auch „Au-genwinkel“ bedeutet. 33 phrad ’dod gibt in der HJMtib utsuka bzw. samutsuka wieder. Vgl. etwa HJM 11.47b in Michael HAHN und Konrad KLAUS, Das Mṛgajātaka (Haribhaṭṭajātakamālā XI). Studie, Texte, Glossar, Bonn 1983 (Indica et Tibetica. 3). 34 Vgl. die ganz ähnliche Passage HJM 6.13-15; s. Michael HAHN Haribhaṭṭa in Nepal, S. 77. 35 Dakṣiṇāgni, gārhapatya und āhavanīya. 36 Hier wurde das Adjektiv karuṇa- „jämmerlich, kläglich“ offensichtlich mechanisch durch sñiṅ rje „Mitleid“ (karuṇā) übersetzt.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
236
Das Kummerfeuer der [Priester]frau und [ihres] Gemahls, das durch die Opferbutter der Zärtlichkeit37 schnell in die Höhe schoss und aus dem die Funken der Liebe38 vereint empor stoben39, verbrannte (peinigte) das Herz des Königs, dessen Festigkeit geschwunden war.
de nas de lta bu'i gnas skabs der soṅ ba'i bdag ñid chen po de la |
'khrug pa'i rgya mtsho<s> sa ni kun nas 'khrug par 'gyur ba ste || ri rab kyaṅ ni 'gul te bskyod pas khyab pa'i bskal pa'i śiṅ40 || dro ba'i 'od zer dkyil 'khor cuṅ zad rñog ñid soṅ ba ste || phyogs rnams kyi ni sgo dag kun nas 'od med byuṅ bar gyur || 54 ||
Als sich der Hochherzige (Śyāma) in einem derartigen Zustand befand, da41
erbebte die Erde, deren Ozeane [dabei] aufgewühlt wurden42; infolge davon erbebte [auch] der [Berg] Meru, so dass die Wunschbäume [auf ihm] schwankten; die Sonnenscheibe wurde ein wenig trüb, und die Himmelsgegenden verloren überall ihren Glanz.43
de nas gser gyi ri bo'i 'gul bas byaṅ chub sems dpa'i sdug bsṅal śes pa spros pa'i cod pan gyi nor bu'i 'od kyis kun nas lhag pa'i [!] [82b] mṅon par brgyan pa'i lus rluṅ [[84a]] gis rnam par bskyod pa'i skal ba'i śiṅ las rab tu byuṅ ba'i gos kyis bsal bar byas pa'i utpal sṅon po'i 'dab ma ltar śin tu sṅo ba'i nam mkha'i dkyil la<s> 'dzegs nas ñe (79b) bar 'oṅs te | de rnams thams cad ñid dbugs phyuṅ ste byaṅ chub sems dpa' la lha las byuṅ ba'i sṅags kyis dag par byas pa'i chus chag chag mṅon par btab ste |
Da stieg, als er aus dem Beben des goldenen Meru Kenntnis vom Leid des Bodhi-sattva erlangt hatte, [der Götterherr Indra]44, dessen Körper über alle Maßen durch den von seinem Scheiteljuwel ausgestrahlten Glanz verschönt war, vom Himmels-gewölbe herab45, das von Gewändern gereinigt (oder: strahlend gemacht; *gsal) worden war, die von den im Wind schwankenden Wunschbäumen stammten, und das daher tiefblau wie die Blütenblätter der blauen Lotusse war, und kam herbei. Er tröstete sie allesamt und besprengte den Bodhisattva mit Wasser, das durch einen göttlichen Zauberspruch geheiligt war.
37 mñes gśin ist hier vermutlich die Wiedergabe von vātsalya. 38 Wir gehen davon aus, dass sgeg pa hier nicht Skt. vilāsa-, sondern śṛṅgāra- wiedergibt, was eben-falls belegt ist: cf. NEGI, Tibetan-Sanskrit Dictionary, vol. 2, Sarnath 1993, s.v. 39 Wir beziehen ’phro in a) auf me stag in c)! 40 Die Blockdrucke lesen skal ba’i śiṅ. Die Schreibweise von bskal pa (= Skt. kalpa-) schwankt sehr stark in der HJMtib. 41 Die vom Tibetischen her befremdende Konstruktion dürfte auf einen locativus absolutus der Vor-lage zurückgehen. 42 'khrug pa'i rgya mtsho geht auf ein Bahuvrīhi-Kompositum zurück. 43 Die zugrunde liegende poetische Figur ist die von Haribhaṭṭa besonders geschätzte kāraṇamālā. Vgl. hierzu Michael HAHN, Haribhaṭṭa in Nepal (siehe Anm. 9), S. 33-34. 44 Der "Götterherr" wird erst in 54c expressis verbis genannt. 45 So aus inhaltlichen Gründen (vgl. E. Chavannes, Cinq Cent Contes et Apologues, Paris 1910-1935, No. 43, Bd. I, S. 160: „Çakra, roi (des devas) descendit au personne et dit aux parents ...“) gegen das Tibetische nam mkha'i dkyil la 'dzegs nas „zum Himmelsgewölbe empor gestiegen seiend“.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
237
kun nas 'dzegs pa'i khrag gi thig pas byug pa yi || g.yo ba'i dbaṅ po sbas mtshon brag ltar rgya che ba || rnam par dag pa'i blo can de yi braṅ dkyil nas || lha yi dbaṅ pos mda' ni kun nas 'don par gyur || 55 ||
Dann zog der Götterherr Indra den Pfeil aus der Brust jenes völlig lauter Gesinnten (Śyāma) heraus, die von den [aus ihr] hervorquellenden Blutstropfen besudelt war46 und dadurch einem riesigen Felsen glich, auf dem [rote] Regenmilben (indragopaka) herumkrabbelten47.
mda' ni der ni 'don pa la || chags can rdo rje can gyis ni || utpal sṅo bsaṅs rnam pa can || sṅo bsaṅs mig dag phye bar gyur | 56 |
Als der Donnerkeilträger Indra den Pfeil liebevoll herauszog, schlug Śyāma48 seine beiden Augen auf, die wie dunkelblaue Lotusse aussahen.
rgyal po de rab tu dga' bas rab tu laṅs pa'i spu'i tshogs ka dam pa'i me tog ltar gy-ur pa'i ((70a)) yan lag 'dzin ciṅ de dag la smras par gyur pa | mya ṅan gyis chog ste sṅo bsaṅs kyi mig dag rab tu phye ba źes bya ba'o || de nas de dag gis thos te mchog tu kun nas dga' bar gyur to |
Da sprach der König, dessen Körperhaare sich vor Freude aufrichteten und dessen Glieder [vor Freude so rosig] wie Kadamba-Blüten wurden, zu den beiden [Eltern Śyāmas]: „Lasst ab von eurem Kummer, Śyāma hat die Augen aufgeschla-gen49!“ Als die beiden dies hörten, freuten sie sich über alle Maßen.
de nas raṅ gi groṅ khyer stobs kyi *dgra ni grags pa myur du 'gro ba ste || sa bdag kyaṅ ni raṅ gi pho braṅ du ni rta daṅ brten par gyur || raṅ gi khyim de ri dags gnas pa thob nas kyaṅ ni gus pa yis || slar yaṅ bla ma gtso bo dag ni byaṅ chub sems dpa' bsten par gyur || 57 ||
Darauf machte sich der als Feind Balas bekannte50 [Indra] schnell in seine Stadt auf; der König kehrte seinerseits mit seinem Pferd
46 Der erste Stollen könnte auch Attribut zu rnam par dag pa'i blo can de yi sein, was aber inhaltlich weniger befriedigt. 47 Wörtlich: „der durch sich bewegende Regenmilben markiert (lakṣita) war“. Zu den Regenmilben und ihrer Verwendung in der poetischen Literatur vgl. Siegfried LIENHARD, „Beobachtungen zu einem wenig beachteten Kāvya-Motiv“, WZKS 22 (1978), S. 57-65. – Zu der ungewöhnlichen Wie-dergabe von indragopaka durch dbaṅ po sbas pa „Indra verborgen habend“ vgl. die Parallele HJM 12.8+ indragopakābhyalaṃkṛtamarakataharitaśādvalaśyāmavanabhūmiṣu. Dort lautet die tibetische Entsprechung dbaṅ po’i sbas pa. Oder sollte man unseren Text zu dbaṅ po<s> sbas pa „von Indra verborgen“ verbessern? 48 Wiederum Wortspiel mit zweimaliger Verwendung von śyāma. 49 Wörtl. „Die Augen Śyāmas haben sich geöffnet.“ 50 Dahinter dürfte baladviṣ stecken, das wie balabhid oder balahan einer der Beinamen Indras ist. Die Blockdrucke lesen stobs kyi sgra, was nur ein Schreibfehler für stobs kyi dgra sein dürfte. In HJMtib 35.6a finden wir stobs ’byed als Wiedergabe von balabhid.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
238
zurück in seinen Palast; und sobald [Śyāma und seine Eltern] zu ihrem von Tieren bewohnten Aufenthaltsort gelangt waren, diente der Bodhisattva seinen beiden edlen Eltern weiterhin voller Hingabe.
de ltar na bcom ldan 'das des mchog tu phan pa'i źiṅ źes bya ba bsams par gyur pas pha ma dag la mi ṅal ba'i yid kyi<s> kun nas bsten par byas par gyur to || de bas rigs kyi bu 'am | rigs kyi bu mos dad pa la dmigs nas raṅ gi phan pa la bltas nas dus rtag tu pha ma dag cho ga bźin du mchod par bya źes bya ba'o ||
sṅo bsaṅs [[84b]] kyi skyes pa'i rabs ste skyes pa'i rabs bźi pa'o ||
Auf diese Weise hat der Bodhisattva seinen beiden Eltern mit unermüdlichem Her-zen gedient, weil er dachte: „Diese sind ein Feld höchsten Nutzens.“ Deshalb soll auch ein sittsamer Jüngling oder ein sittsames Mädchen, nachdem sie voller Gläu-bigkeit ihr eigenes Wohl ins Auge gefasst haben, beständig Vater und Mutter ehren, wie es sich gehört.
[Dies war] das Śyāmajātaka, das vierte Jātaka [aus der zweiten Dekade der Jātakamālā des Haribhaṭṭa].}
APPARATE ZUM SANSKRITTEXT VON HJM 14
B ist das Siglum der zugrundeliegenden Handschrift; vgl. hierzu den in Anm. 8 ge-nannten Aufsatz (HAHN 2005).
Nicht vermerkt sind:
Anusvāra statt Klassennasal Klassennasal statt Anusvāra Konsonantenverdopplung nach r Vereinfachung von -ttra- zu tra und von -ttva- zu tva Doppelter Daṇḍa statt einfachem Daṇḍa Einfacher Daṇḍa statt doppeltem Daṇḍa Fehlender Daṇḍa (falls ohne Auswirkung auf den Sandhi) Unnötig gesetzter Daṇḍa (falls ohne Auswirkung auf den Sandhi)
Ergänzte Daṇḍas: tapovanam | tad (20+); apīdṛśānām | (32b)
Überflüssige Daṇḍas: svajane jane ca | (26c)
Kleinere Schreibfehler:
1+ °prakāśayaśā sarva° statt prakāśayaśāḥ sarva° 12c °paṅkā statt °paṅkāṃ 14b tiśayaḥprasanne statt ’tiśayaprasanne 15c āsāmayīṃ statt āśāmayīṃ 15+ °prarudite statt °prarudita° 18+ anugāmina statt anugāminaṃ 19b viṣamāśmaruddheḥ statt viṣamāśmaruddhe 19+ bodhisattvenaḥ statt bodhisattvena 19+ bhājayitvā statt bhojayitvā 19+ uṇvāyāparāhnasamaye statt utthāyāparāhnasamaye 19+ °dharmmāṇam statt °varmāṇam, go cha daṅ ldan pa HJMtib
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
239
19+ kahamasmin statt katamasmin 19+ °satkāraḥ tasmai dhanuḥkoṭyā statt °satkāras tasmai dhanuṣkoṭyā 19+ ahaty āryo statt arhaty āryo 20d prokṣiptavaktraḥ statt protkṣiptavaktraḥ 20+ prāviśata statt prāviśat 25+ prabhātasamuye statt prabhātasamaye 26a paricarana statt paricaran 26+ svāda statt svādu 27a cākṣamāmālāñ ca statt cākṣamālāñ ca 28d mṛgaśrāvakaḥ statt mṛgaśāvakaḥ 28+ ākṛṣyamāṇaḥ tan nadītīram statt ākṛṣyamāṇas taṃ nadītīram 28+ vā avatīrṇa statt vāvatīrṇa 39a pitroḥ tayoḥ statt pitros tayoḥ 40a snehāmbhasā vā yuvābhyāṃ statt snehāmbhasā yuvābhyāṃ 41+ iti ’vadhārya statt ity avadhārya 43+ °nivedana statt °nivedanaṃ
Dittographien, Tilgungen, graphische Besonderheiten: [{{ x }} = getilgt im Ms. durch Markierungen]
1+ su{{ga}}ragurur statt suragurur 15+ hetur e{{tu}}va gṛhasthatā statt hetur eva gṛhasthatā 19+ bodhisatve{{na}}ḥ statt bodhisatvaḥ 36d upāgato {{gato}} 38d pitarau {{tva}}
Korrekturen im Ms:
1+ °tattvāvabodhi → °tattvāvabodhī 33d kaṭunā: Nachträgliche Längung von na zu nā durch Längungszeichen 33+ śāpāgamā°: Nachträgliche Längung von ma zu mā durch Längungszeichen
Fehler und cruces im Ms.:
2a bahumānād iva] sabahumānād iva B. sa hat keine Entsprechung in HJMtib. Als Kompositumsbestandteil wäre es metrisch überzählig, als Personal-pronomen außerhalb der Strophe lässt es sich nicht sinnvoll konstruieren.
6c nāstāṃ madhyasthavairiṇau] nastām madhyasthavairiṇai B. 7cd tyajya(3)*m eva hi* paśyan*ti taṃ* dviṣanto dviṣattayā] tyajya(3)(vādi eva)
paśyan(to) dviṣanto dviṣattayā B. HJMtib hat hier sdaṅ byed sdaṅ ba ñid kyis kyaṅ || dor bya de ñid mthoṅ ba yin || „Sogar aufgrund ihres Hasses se-hen die Hassenden gerade ihn als einen zu Meidenden an.“. Unsere Rekon-struktion folgt dem Tibetischen, an das der überlieferte Text von B mit nur geringen Änderungen angepasst werden kann.
7+ *prabalena] praviralena B, śin tu stobs daṅ ldan pa'i HJMtib. 8c *mamāyaṃ] mayāyaṃ B, bdag gi (yon tan rin chen rgya mtsho can) HJMtib 10+ cittānuśāsanam akārṣīt] cintānuśāsanam akārṣīta B; cf. 14.14+, wo richtig
cittānuśāsanaṃ steht. 11a sukhaleśalubdha] sukhaleśalubdha x ( ) B. 15c āśāmayīṃ *śṛṅkhalāṃ] āsāmayīṅ khaṅkhalāṃ B. Oder handelt es sich bei
khaṅkhalā- um ein bisher nicht bekanntes Synonym von śṛṅkhalā-? Man
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
240
beachte den Sandhi! HJMtib hat lcags sgrog „Eisenfessel“, die übliche Wiedergabe von śṛṅkhalā-.
16c *prasṛtyā] prasatyā B; ohne Entsprechung in HJMtib. 17a acchācchasalilā] ācchācchasalilā B. 18b *taṭe] taye B; ’gram nas HJMtib. 18+ *varāhaprothotkhāta°] varāhaprotakhota° B; phag pa rnams kyi (kyis NQ)
snas rlogs (slogs NQ) pa'i „von der Schnauze eines Schweins gespalten“. Der Fehler ist leicht graphisch zu erklären: zunächst ist das akṣara tho aus-gefallen, und das vorangestellte t- in der Ligatur tkhā wurde als pṛṣṭhamā-tra-Form des Vokals o gedeutet. Nachträglich wurde dann das unverständ-liche °prokhota° zu °potakhota° emendiert. Vom Schreiber beabsichtigt war sicher °potakhāta° „von [Eber]jungen ausgegraben“.
18+ elābhaṅga°] ekhalābhaṅga° B; ka ko la bcag pa „zerschnittene, zerhauene Kakkola-Beeren“ HJMtib. Die Emendation ist wegen der Parallele HJM 23.72 zwingend: sindūrāruṇakumbhānām elābhaṅgasugandhinām | madena kariṇāṃ jātāḥ stambhāḥ surabhayaḥ punaḥ ||
18+ surabhiṇā *kuñjaramadagandhenā °] surabhiṇāṅkuramadagandhenā° B; glaṅ po che’i smyon chu’i dris „durch der Brunstsaftgeruch eines Elefan-ten“ HJMtib. Kuñjara- wird häufig in der HJM verwendet. Auch dieser Fehler lässt sich leicht graphisch erklären: Ausfall des akṣara ñja und se-kundäre Einfügung eines ṅ vor ku.
23b śyāmasyāśyāmacetasaḥ] śyāmasyāmacetasaḥ B. Metrum! 26c samamanāḥ] samayanāḥ B; mñam pa’i yid ldan HJMtib. 28a *ādaśya] ādarśya B; bsten byas nas HJMtib (< bstan byas nas = B!). 29d kūlād] kulād B, 'gram las HJMtib. 40b vṛddhyai] vṛddhaḥ B; ’phel phyir HJMtib. Vgl. hierzu HJM 20.52a māṃ
*putravṛkṣakaṃ [putrakavṛkṣaṃ B] vṛddhyai.
ANHANG: DIE ŚYĀMA-LEGENDE IN DER FASSUNG DES BHAIṢAJYAVASTU DES VINAYAVASTU DER MŪLASARVĀSTIVĀDINS
Und weiter, Majestät51, sollt Ihr hören, wie ich in meinem Streben nach der Aller-höchsten Vollkommenen Erleuchtung meine blinden Eltern auf meiner Schulter getragen habe.
Majestät, früher einmal, in einer längst vergangenen Zeit, regierte in der Stadt Be-nares der König Brahmadatta. [In seinem Reich] herrschten Reichtum, Gedeihen, Glück und guten Ernten, und es war von vielen Menschen bevölkert. Es gab weder Streit, Hader, Aufruhr, Uneinigkeit noch Diebstahl und Krankheiten waren völlig verschwunden. Im Gegensatz dazu waren Reis, Zuckerrohr, Ochsen und Büffel im Überfluss vorhanden. Der rechtmäßig eingesetzte gesetzestreue König übte die Herrschaft nach Recht und Gesetz aus.52
51 Der Angeredete ist der König Prasenajit. 52 Dies ist die Wiedergabe des aus dem Avadānaśataka, Mūlasarvāstivādavinayavastu und Divyā-vadāna wohlbekannten Klischees: vārāṇasyāṃ nagaryāṃ rājā brahmadatto rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cāvakīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍa-maraṃ taskararogāpagataṃ śālīkṣugomahiṣīsaṃpannaṃ dhārmiko dharmarājo dharmeṇa rājyaṃ kārayati. Vgl. etwa Avadānaśataka ed. J. S. SPEYER, Band 1, S. 120.3-6.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
241
Sein Priester, ein Brahmane, hatte einen Sohn namens Śyāma. Dieser beherrschte gründlich die achtzehn Wissensgebiete, er war gut, gläubig, von heilvoller Gesin-nung, er widmete sich dem eigenen wie dem fremden Wohl, er war mitleidig, sei-nen Eltern gehorsam ergeben, 53 und er war der einzige Sohn. Als nun seine Eltern alt geworden waren, wurde ihre Sehfähigkeit beeinträchtigt, und als sie kurz davor standen zu erblinden, baten sie König Brahmadatta: „Majestät, bitte weiht diesen Jüngling Śyāma zum Priester. Wir – meine Frau und ich – möchten uns in den As-ketenwald begeben.“ Daraufhin sagte König Brahmadatta zu Śyāma: „Śyāma, Ihr sollt Priester sein.“ Jener erwiderte: „Majestät, ich strebe das Priesteramt nicht an. Ich möchte mich [statt dessen] [meinen Eltern]54 widmen, die alt und schwach ge-worden und ihrer Sinnesorgane beraubt sind .“
Darauf entsagte Śyāma dem Leben im Hause und der Priesterwürde, als ob es sich um einen Schleimklumpen handelte, und lebte gemeinsam mit den Eltern im Wald. Am Morgen stand er früh auf und bediente seine Eltern mit Zahnhölzern und kla-rem Wasser. Darauf55 vollzog er das Feueropfer für die Götter und machte sich dann in das Waldesinnere auf, um Früchte und Wurzeln [zu sammeln]. Er brachte Früchte, Wurzeln und klares Wasser herbei und überreichte es seinen Eltern. Da-nach begab er sich beiseite und widmete sich angestrengt der Versenkung. Auf die-se Weise verbrachte er seine Zeit.
Eines Tages erhob er sich [wieder] früh am Morgen, bekundete den Füßen seiner Eltern Verehrung und ließ sie wissen, was er im Traum gesehen hatte:
„Ich habe geträumt, dass eine schwarze Schlange meinen Leib vollständig aufgefressen hat und ich von einem schwarzen Seil gefesselt nach Süden geführt wurde.
Nachdem ich diesen Schrecken erregenden Traum geträumt habe, kam in meinem Herzen Furcht auf, und ich denke, dass mir heute die außerordentlich schlimme Trennung von meinen Eltern zuteil werden wird.“
Nachdem er seine Eltern getröstet hatte, verkündete er der Sonne zugewandt56 ein Wahrheitsgelübde. Dann machte er sich mit dem Topf auf, um Wasser zu holen.
Zu der Zeit war der König Brahmadatta auf die Jagd gegangen und dabei in jenen Asketenwald gelangt. Er beherrschte die Kunst, nach dem Gehör zu schießen57, und als er ein Geräusch wie von einer Gazelle vernahm, spannte er den Bogen bis zur Nase, schoss einen Pfeil ab und traf Śyāma ins Herz. Obwohl der Pfeil ihn lebens-gefährlich verletzt hatte und er zu Boden gefallen war, missachtete er seinen eige-nen Schmerz und empfand nur wegen seiner Eltern Schmerz. Er sagte:
53 Dies ist ebenfalls größtenteils ein wohlbekanntes Klischee, das im Avadānaśataka folgendermaßen lautet: sa ca śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśaya ātmahitaparahitapratipannaḥ kāruṇiko mahātmā dhar-makāmaḥ [prajāvatsalaḥ]. Vgl. etwa Avadānaśataka ed. J. S. SPEYER, Band 1, S. 2.3-5. 54 Hier ist anscheinend pha ma dag ausgefallen. Oder geht bdag ni auf *pha dag* ni (= pitarau) zu-rück? 55 Die Abfolge de nas de’i ’og tu ist tautologisch. 56 kha bltas te = abhimukha; cf. NEGI s.v. 57 Vgl. HJM 14.28+: rājā śabdavedhī.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
242
„Durch einen einzigen abgeschossenen Pfeil sind wir drei Menschen [hier] getötet worden: ich selbst und meine beiden Eltern, die ihrer Sinnesfähigkeit beraubt sind!“
Als der König das vernommen hatte, fragte er: „Wie ist es möglich, dass durch ei-nen einzigen Pfeil, den ich abgeschossen habe, drei Menschen getötet worden sind?“ Da weinte Śyāma kläglich und sprach zum König:
„Es werden drei Menschen sterben: sowohl meine Eltern, die viel schwächer sind als ich und zudem blind, als auch ich, der ich von dem Pfeil getroffen wurde.“
Da geriet der König in Furcht und Schrecken und sprach zu Śyāma: „Brahmanen-jüngling, ich habe eine schlechte Tat begangen! Weil ich unwissentlich einen Pfeil auf Euch abgeschossen habe, solltet [Ihr] jetzt [Eure] Eltern bitten, mich nicht zu verfluchen.“ Darauf beruhigte Śyāma den König voller Ehrerbietung mit diesen Worten: „Majestät, [auch] wenn die mir nahestehenden [Eltern] über eine gewisse Macht verfügen, so braucht Ihr Euch [dennoch] nicht vor einem Fluch zu fürchten, weil sie mitleidig und voller Liebe zu den Menschen sind und [auch] auf die jensei-tige Welt schauen.“ Und weiter sagte er:
„Bringt diesen Wassertopf dorthin, wo sich meine Eltern aufhalten. Dies wird ihre letzte Fußwaschung werden.
Erweist ihren Füßen mit meinen Worten Verehrung, indem Ihr so zu Ihnen sprecht: ‚Innerhalb kurzer Zeit werden wir schließlich gewisslich getrennt werden.“ Darauf nahm der König höchstpersönlich den Wassertopf und begab sich in den Wald. Zu jener Zeit wurden die wilden Tiere58 in allen vier Himmelsrichtungen sehr59 unruhig. Darauf sprachen die beiden Blinden zueinander: „Śyāma trödelt schon eine ganze Weile am Ufer des Sees herum60.“ Da sagte seine Mutter:
„Mein [Sohn] Śyāma spielt jetzt mit den Gazellen am See, der mit roten und blauen Lotussen bedeckt ist und auf dem die Gänse süße Laute von sich geben.“
Da gelangte der König in [ihre] Nähe, worauf die beiden Asketen aufgrund des [da-bei entstandenen] Geräusches sagten:
„O Śyāma, der du uns von Herzen lieb und schön anzusehen bist, bist du etwa herbeigekommen? Weshalb peinigst du deine Eltern, die schwach sind und von Hunger gequält werden?“
58 mi ma yin pa = vyāḍa (NEGI, S. 4353b). Dies scheint der bisher einzige Beleg für diese bemer-kenswerte Wiedergabe zu sein. Die Passage lautet nach NEGI: gtsug lag khaṅ ’di yaṅ mi ma yin pa rnams gnas pa’i phyogs śig tu brtsigs la ~ ayaṃ ca vihāro vyāḍādhyuṣite pradeśe pratiṣṭhāpitaḥ. 59 che thaṅ = mahān, adhimātram (NEGI). 60 Oder: „Śyāma ist schon [seit] eine[r] ganze[n] Weile zum Ufer des Sees gegangen.“ Vgl. hierzu die Bedeutungsangabe im ZHD (= ZHANG Yisun, Bod rgya tshig mdzod chen mo, Beijing 1985): riṅ źig lon pa | (1) yun riṅ ’gor ba | (2) yun riṅ tsam soṅ ba |.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
243
Mit schlechtem Gewissen sprach [der König] kläglich [zu ihnen]: „Ich bin nicht Śyāma, ich bin König Brahmadatta.“
„Seid willkommen, geht es Euch gut? Lasst Euch hier auf dem Sitz nieder! Śyāma wird gleich mit Wasser und Früchten hierher kommen.
O König, er, der Śyāma genannt wird, ist tugendhaft und von Natur aus liebevoll. Durch die Macht seiner Liebe weilen hier Gazellen und Vögel.“
Darauf berührte König Brahmadatta die Füße der beiden Asketen, und während seine Tränen flossen, sagte er mit zittriger61 Stimme [zu ihnen]: „Was Śyāma an-geht, so ist er hier im Wald von einem Pfeil im Herzen getroffen worden, und es bleibt ihm nur noch ein kleiner Rest an Lebenszeit. Er schickt Euch diesen Wasser-topf, gefüllt mit Wasser. Damit soll Eure letzte Fußwaschung durchgeführt wer-den.“ Als die beiden [das] vernommen hatten, fielen sie ohnmächtig zu Boden. Dar-auf besprengte König Brahmadatta sie mit Wasser und richtete sie wieder auf. Bei-de jammerten kläglich: „Majestät, wenn er stirbt, bleibt auch uns nichts anderes als zu sterben. Dennoch führt uns bitte zu ihm. Wir möchten ihn unter allen Umständen noch einmal berühren, solange er noch am Leben ist.“ Darauf geleitete der König das Ehepaar dorthin, und als sie angekommen waren, hatten die Lebensgeister [Śyāma] noch nicht ganz verlassen. Die Eltern streichelten seinen Körper und spra-chen:
„Wer hat diesen Lieben zu Fall gebracht, wer hat diesen edlen Baum gefällt?“
Darauf berührte der König [seine] Füße und sprach:
„Als ich in schlimmer Absicht62 im Wald herumstreifte, habe ich diesen Euren einzigen Sohn mit einem Pfeil getroffen.“
Darauf machte die Eltern mit kläglicher Stimme das folgende Wahrheitsgelübde:
„O Sohn, so wahr wie du deinen Eltern gedient und den Göttern das Feueropfer dargebracht hast, so wahr soll auch das Gift [des Pfeils] seine Kraft verlieren!“
Als darauf der Palast63 der Götterherrn Indra erschüttert wurde, überlegte er, was diese Erschütterung bedeuten könne. Er erkannte, dass der Bodhisattva des Bhadra-
61 So nach dem Kontext. Das Wort ’dar ’dar po ist lexikalisch nicht belegt. Die mechanische Analy-se legt die Bedeutung „stark zitternd; zittrig“ nahe. Das ZHD (s. Anm. 46) kennt ’dar ’dar, was durch yom yom paraphrasiert wird. Beides bedeutet „zitternd“, ’dar ’dar wäre damit also lediglich eine Intensivbildung von ’dar ba „zittern“. Hier ist als Vorlage aber eher gadgada zu erwarten, das nach Ausweis des Sanskrit-Tibetan Dictionary von LOKESH CHANDRA (Delhi 2007) nicht einheitlich übersetzt wird. Als tibetische Entsprechungen werden dort ’gar ’gar, ldab ldib und thigs thigs ange-geben. Zu ’gar ’gar, das nur in BAKtib 64.229d belegt ist, vgl. Martin STRAUBE, Prinz Sudhana und die Kinnarī, Marburg 2006 (Indica et Tibetica. 46), S. 174. 62 Wörtlich: „mit bösen Taten“. 63 Genauer: „der [Wohn]ort“.
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
244
kalpa-Zeitalters an einer lebenswichtigen Stelle von einem Pfeil getroffen und vom Gift durchdrungen64 war und [starke] Schmerzen litt. Darauf stieg er aus seinem Palast herab und bestrich ihn mit dem Unsterblichkeitstrank. Wegen des Wahr-heitsgelübdes der Eltern, wegen der Macht des Götterherrschers und weil der Pfeil herausgezogen worden war,65 schloss sich die Wunde, die Wirkung des Giftes ebbte ab, und Śyāma wurde all seiner Schmerzen ledig, so dass er für lange Zeit seine Eltern dienen konnte.
Der Erhabene sprach: „Majestät, was denkt Ihr? Der zu jener Zeit Śyāma war, der bin jetzt ich. Majestät, Ihr dürft nicht denken, dass ich [nur] deswegen die Aller-höchste Vollkommene Erleuchtung erlangt habe, weil ich meinen Eltern gedient habe, sondern dass dies für mich nur eine der [vielen] Ursachen, einer der [vielen] Gründe, eine der [vielen] Zurüstungen66 für die Allerhöchste Vollkommene Er-leuchtung gewesen ist.“
DER TIBETISCHE TEXT DER VERSION DER LEGENDE IM BHAIṢAJYAVASTU
Der tibetische Text ist hergestellt nach:
1) Derge Kanjur, Abteilung ’dul ba, Band kha, fol. ((250a4-252a6)); Siglum: D 2) Peking Kanjur, Abteilung ’dul ba, Band ge, fol. [[233b1-235a3]] (= The Tibetan
Tripiṭaka, Band XLI, 213-4-1 bis 214-2-3); Siglum: Q
Rein graphische Varianten wie pa/ba, du/tu oder abweichend gesetzte Śads werden nicht mitgeteilt. Davon abgesehen ist der Text in Derge und Peking nahezu iden-tisch überliefert, was bei einem Vinaya-Text auch nicht überrascht.
((250a4)) [[233b1]] rgyal po chen po gźan yaṅ ṅas bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa’i byaṅ chub don du gñer ba’i phyir pha daṅ ma loṅ ba phrag pas khyer ba gaṅ yin pa de ñon cig | rgyal po chen po sṅon byuṅ ba ’das pa’i dus na bā rā ṇa sī’i groṅ khyer du rgyal po tshaṅs sbyin źes bya ba rgyal srid byed de | ’byor pa daṅ | rgyas pa daṅ | bde ba daṅ | lo legs pa | skye bo daṅ | mi maṅ pos gaṅ ba ’thab pa daṅ | thab mo daṅ | khrag khrug daṅ | ’gyed pa daṅ | chom rkun med ciṅ nad rab tu źi bar gyur pa | ’bras daṅ | bu ram śiṅ daṅ | ba laṅ daṅ | ma he phun sum tshogs pa la chos kyi rgyal po chos daṅ ldan pa chos bźin gyis rgyal srid byed do ||
de’i mdun na ’don gyi bram ze de’i bu ljaṅ gu67 źes bya ba rig pa’i gnas bcu brgyad kyi pha rol tu phyin pa | dad pa bzaṅ ba | dge ba’i bsam pa can | bdag la phan pa daṅ gźan la phan par źugs pa | sñiṅ rje can | pha daṅ ma la sri źu byed pa yod de | bu ni gcig pu der zad la pha daṅ ma de dag kyaṅ rgas nas mig ñams te mdoṅs la thug pa daṅ | de nas de’i pha mas rgyal ((250b)) po tshaṅs sbyin la gsol pa | rgyal po chen po gźon nu ljaṅ gu ’di mdun na ’don du dbaṅ bskur du gsol | bdag cag dka’ thub kyi nags su mchi lags so || de nas rgyal po tshaṅs sbyin gyis ljaṅ gu la smras pa | ljaṅ gu khyod mdun na ’don gyis śig | des smras pa | rgyal po chen po bdag mdun na ’don pa mi ’tshal te | bdag ni rgas pa | ñam chuṅ ba | dbaṅ po ñams pa rnams kyi rim gro ’tshal ba lags so || 64 Nach NEGI ist gloṅs pa = dkrugs pa, und entsprechend werden avadhūta und saṃkula als Sanskrit-äquivalente angegeben. 65 Ich interpretiere zug rṅu als Wiedergabe von śalya „Pfeilspitze“. 66 Skt. saṃbhāra. 67 Q liest durchgängig ljaṅ ku.
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
245
de nas ljaṅ gus khyim na gnas pa daṅ | mdun na ’don mchil ma’i thal ba bźin du spaṅs nas pha ma’i grogs su nags na gnas so || de naṅ par sṅar laṅs nas pha daṅ ma gñis la so śiṅ daṅ chu gtsaṅ mas bsñen bkur byed do || de nas de’i ’og tu lha la me’i sbyin sreg gi mchod sbyin byas nas phyis ’bras bu daṅ rtsa ba’i phyir nags khrod du ’jug go || de nas ’bras bu daṅ | rtsa ba daṅ | chu bsil ba khyer te pha ma la byin nas de’i ’og tu phyogs gcig tu soṅ nas bsam gtan la brtson par gnas te rim pa de lta bus dus ’da’ bar byed do ||
ji tsam ñi ma gźan źig la naṅ par sṅar laṅs te pha daṅ ma’i rkaṅ pa gñis la phyag byas nas gsol te rmi lam du yaṅ mthoṅ ba rig par byed ciṅ smras pa |
bdag gi g.yar lam sbrul nag pos || bdag lus śin tu zos pa daṅ || bdag ni źags pa nag po yis || bciṅs nas lho phyogs khrid pa rmis || 1 ||
g.yar lam ’jigs byed mthoṅ bdag gi || sñiṅ [[234a]] la dogs pa deṅ bdag la || bla ma daṅ bral śin tu ni || mi bzad ’byuṅ bar ’gyur sñam bgyid || 2 ||
ji tsam na pha ma de gñis kyi dbugs phyuṅ nas ñi ma la kha bltas te ’dug nas bden pas gsol ba btab ste | ril ba khyer nas chu len du soṅ ṅo || de’i tshe rgyal po tshaṅs sbyin ri dags ’chor du chas te dka’ thub kyi nags der źugs pa daṅ | rgyal po de sgra grags par phog pa źig ste | des ri dags kyi sgra lta bu źig thos nas gźu rna druṅ du bkaṅ ste mda’ ((251a)) ’phaṅs pas ljaṅ gu’i sñiṅ gar68 phog par gyur to || de nas mdas gnad du phog pas sa la ’gyel kyaṅ de raṅ gi sdug bsṅal khyad du bsad nas pha ma kho na’i mya ṅan byed ciṅ smras pa |
mda’ gcig bsnun pas bdag daṅ ni || dbaṅ po ñams par gyur pa yi || pha daṅ de bźin ma dag daṅ || bdag cag skye bo gsum bsad do || 3 ||
de nas rgyal pos de thos nas ’oṅs te dris pa | ci ste ṅa’i mda’ gcig bsnun pas skye bo gsum bsad | de nas ljaṅ gu sñiṅ rje rje skad du ṅus nas rgyal po la smras pa |
bdag pas ches ni ñam chuṅ ba’i || pha ma yaṅ ni ldoṅs par gyur || bdag kyaṅ mda’ yis bsnun pas na || skye bo gsum ni ’chi bar ’gyur || 4 ||
de nas rgyal po ’jigs śiṅ skrag la sṅaṅs nas ljaṅ gu la ’di skad ces smras so || bram ze’i khye’u ṅas ñes pa byas te ma śes nas mda’ ’phaṅs kyis ṅa la dmod pa ’dor du mi gźug par pha ma la gsol ba bya ba’i rigs so || de nas ljaṅ gus gus pa daṅ bcas pas rgyal po dbugs ’byin par byed de | rgyal po chen po bdag daṅ ñe bar mchis pa rnams la dbaṅ źig mchis na sñiṅ rje can daṅ | skye bo la byams pa daṅ | ’jig rten pha rol la lta ba lags pas dmod pas ma bsñeṅs śig | yaṅ smras pa |
bdag gi bla ma gaṅ na bar || ril ba ’di ni snoms mdzod cig ||
68 sñiṅ kar Q
MITSUYO DEMOTO UND MICHAEL HAHN
246
de dag gi ni rkaṅ bkru ba || tha ma ’di ni lags par ’gyur || 5 ||
bdag gi tshig gis rkaṅ pa la phyag mdzod la ’di skad riṅ por69 mi thogs par mthar ni gdon mi za bar ’bral bar ’gyur ro źes kyaṅ gsuṅs śig | de nas rgyal po raṅ kho nas ril ba khyer te nags khrod du chas pa daṅ | de’i tshe phyogs bźir mi ma yin pa che thaṅ du ’khrugs par gyur to || de nas loṅ ba de gñis gcig la gcig smras pa | ljaṅ gu ’di ni mtsho’i ’gram du riṅ mo źig lon no || de nas de’i mas smras pa |
da ltar kho mo’i ljaṅ gu de || pad ma utpal gaṅ ba’i mtsho || ((251b)) ṅaṅ pa<s> sgra sñan ’byin pa na || ri dags lhan cig rtse bar byed || 6 ||
de nas rgyal [[234b]] pos druṅ du phyin pa daṅ | de’i rtiṅ sgra las draṅ sroṅ de dag gis smras pa |
sñiṅ du sdug ciṅ mthoṅ dga’ ba || ljaṅ gu ci ste naṅ du ’jug || pha ma ñam chuṅ bkres pa yis || ñam thag pa la ci źig gtse || 7 ||
de yid mi dga’ nas sñiṅ rje rje skad du smras pa | kho bo ni ljaṅ gu ma yin gyi kho bo rgyal po tshaṅs sbyin no ||
byon pa legs tshur khyod bde ’am || gdan ’di la ni bźugs śig daṅ || ljaṅ gu chab daṅ ’bras bu dag || thogs nas de’u re ’dir mchi’o || 8 ||
mi dbaṅ ljaṅ gu źes bgyi ba || yon tan rnams ldan raṅ bźin byams || de yi byams pa’i stobs kyis ’dir || ri dags daṅ ni bya rnams gnas || 9 ||
de nas rgyal pos draṅ sroṅ gi rkaṅ pa gñis la gtugs nas mchi ma zag ciṅ skad ’dar ’dar por smras pa | ljaṅ gu ni nags tshal ’di’i naṅ du sñiṅ la mdas phog ste srog gi lhag ma cuṅ zad cig lus śiṅ ’dug go || ril ba chus bkaṅ ba ’di ni des70 bskur te | ’dis khyed gñis kyi rkaṅ pa’i khrus tha ma mdzod cig | de gñis kyis thos nas brgyal te sa’i steṅ du ’gyel to || de nas rgyal po tshaṅs sbyin gyis chus gtor nas bslaṅ ba daṅ | de gñis sñiṅ rje rje skad du smre sṅags ’don pa | rgyal po chen po de gum71 pas bdag cag kyaṅ ’gum du bas so || de lta mod kyi de phyogs gaṅ na mchis pa der bdag cag khrid cig daṅ ci nas bu de ma gum pa la reg par bgyi’o || de nas rgyal pos khyo śug gñis ka khrid de phyogs der phyin pa daṅ | de yaṅ srog gi lhag ma chuṅ źig lus nas de nas de’i pha mas ljaṅ gu’i lus la kun tu byugs nas smras pa |
sdug pa ’di ni su yis bsgyel || ljon śiṅ dam pa su yis bcad || 10 ||
de nas rgyal pos rkaṅ pa gñis la gtugs nas smras pa |
69 riṅ po Q 70 ṅas Q 71 ’gum Q
ERGÄNZUNGEN ZUR ÜBERLIEFERUNG DES ŚYĀMAJĀTAKA
247
kho bos sdig pa’i las kyis su || nags tshal naṅ nas rgyu ba na || khyed cag gi ni bu gcig pa || ((252a)) ’di ni mda’ yis bsnun par gyur || 11 ||
de nas de’i pha ma dag sñiṅ rje rje skad du smre źiṅ bden pas gsol ba byed pa |
bu khyod kyis ni pha ma la || bsñen bkur lha la me yi ni || sbyin sreg byas pa’i bden pa gaṅ || des ni dug kyaṅ źi bar śog || 12 ||
de nas lha rnams kyi dbaṅ po brgya byin gyi gnas g.yos par gyur nas des sa72 g.yos pa ’di ci las gyur ces brtags na | bskal pa bzaṅ po’i byaṅ chub sems dpa’ gnad du mdas phog ste dug gis gloṅs73 pas sdug bsṅal bar gyur pa mthoṅ ṅo || de nas gnas nas babs nas bdud rtsis btab ste pha ma’i bden pa’i tshig [[235a]] gaṅ yin pa daṅ | lha rnams kyi dbaṅ po’i mthu gaṅ yin pa daṅ zug rṅu phyuṅ ba gaṅ yin pa des rma yaṅ rub | dug gi śugs de yaṅ źi nas ljaṅ gu sdug bsṅal de las yoṅs su thar nas yun riṅ por pha daṅ ma gñis la bsñen bkur byas so ||
bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | rgyal po chen po ji sñam du sems | de’i tshe de’i dus na ljaṅ gu źes bya bar gyur pa gaṅ yin pa de ṅa ñid yin te | rgyal po chen po ṅas pha ma gñis la bsñen bkur byas pa des bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa’i byaṅ chub thob bo sñam na khyod kyis de ltar mi blta ste | ’on kyaṅ ṅa’i de ni bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa’i byaṅ chub kyi rgyu tsam daṅ | rkyen tsam daṅ | tshogs tsam yin no ||
72 sa om. D 73 groṅs Q