Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen im Judentum. Ansätze zu einer...
Transcript of Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen im Judentum. Ansätze zu einer...
Bill Rebiger
Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierungvon magischem Wissen im Judentum:Ansätze zu einer Textpragmatik*
Einleitung
Die jüdische Magie der Spätantike und des Mittelalters, auf deren orientalischeBezeugung wir uns im folgenden weitgehend beschränken wollen, ist uns vorallem durch Texte bekannt, die in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten durchwissenschaftliche Editionen erschlossen wurden. Es seien hier vor allem dieumfangreichen Editionen von spätantiken Metallamuletten, babylonischenZauberschalen und magischen Fragmenten aus der Kairoer Geniza sowie dermagischen Makroformen H
˙arba de-Moshe, Sefer ha-Malbush, Sefer ha-Razim
und Sefer Shimmush Tehillim genannt.1 Angesichts dieser Fülle von ediertenmagischen Texten, die wiederum nur einen Bruchteil der in den erhaltenenHandschriften bezeugten Texte bilden, ist eine magische Wissenstradition im
* Dieser Artikel geht auf einen Vortrag zurück, der auf dem 31. Deutschen Orienta-listentag in Marburg am 21. 9. 2010 gehalten wurde. Mein herzlicher Dank gilt Dr.Dorothea Salzer für ihre wertvollen Ratschläge.
1 Joseph Naveh; Shaul Shaked, Amulets and Magic Bowls. Aramaic Incantations ofLate Antiquity. Jerusalem – Leiden 1985; id., Magic Spells and Formulae. AramaicIncantations of Late Antiquity. Jerusalem 1993; Lawrence H. Schiffman; Michael
D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Genizah. Selec-ted Texts from Taylor-Schechter Box K1. Sheffield 1992; Peter Schäfer; Shaul
Shaked, Magische Texte aus der Kairoer Geniza, 3 Bde. (hier: MTKG I–III). Tübin-gen 1994–1999; Yuval Harari, xrbadmwh.mhdurhxdwhumxqr . Jerusalem 1997;Judah Benzion Segal, Catalogue of the Aramaic and Mandaic Incantation Bowls inthe British Museum. London 2000; Dan Levene, A Corpus of Magic Bowls. Incan-tation Texts in Jewish Aramaic from Late Antiquity. London 2003; Irina Wandrey,»Das Buch des Gewandes« und »Das Buch des Aufrechten«. Dokumente eines magi-schen spätantiken Rituals. Tübingen 2004; Christa Müller-Kessler, Die Zauber-schalentexte in der Hilprecht-Sammlung, Jena, und weitere Nippur-Texte andererSammlungen. Wiesbaden 2005; Bill Rebiger; Peter Schäfer, Sefer ha-Razim I undII – Das Buch der Geheimnisse I und II (hier: SHR I und II), 2 Bde. Tübingen 2009;Bill Rebiger, Sefer Shimmush Tehillim. Buch vom magischen Gebrauch der Psal-men. Tübingen 2010.
32 Bill Rebiger
Judentum nicht nur evident,2 sondern auch für eine Untersuchung ausreichenddifferenziert und aussagekräftig.Bereits gegen Ende der Zeit des Zweiten Tempels ist in der jüdischen Magieeine Tendenz zur Verschriftlichung zu erkennen, die in der Spätantike signi-fikant wird.3 Diese Literarisierung der Magie führt naturgemäß zur erhebli-chen Zunahme von Textzeugen. Zugleich ist diese Literarisierung aber auchfür die Konstituierung magischen Wissens sowie neue Ausdrucksmöglich-keiten und -formen desselben verantwortlich. So können beispielsweise auseinfachen Handlungsanweisungen im Verlauf der Geschichte komplexe Ritu-alanweisungen werden oder aus losen Sammlungen willkürlich verstreutersegullot wohlgeordnete und klar strukturierte literarische Kompositionen.Beide Beispiele sind natürlich auch in umgekehrter Tendenz nachweisbar,d. h., eine eingleisige Entwicklung soll hier nicht generell behauptet werden.Die Literarizität magischer Texte zeigt sich überdies häufig in einer tiefenVertrautheit mit den Bildungstraditionen des Judentums, auf die intertextuellBezug genommen wird.4 Im Vergleich spätantiker mit mittelalterlicher Magieläßt sich häufig beobachten, daß magisches Wissen elaborierter wird.Wie allgemein in der jüdischen Literaturgeschichte auch, bewegen sich dieTexte der jüdischen Magie im Spannungsfeld von Tradition und Innovation.So finden wir auf der einen Seite eine immer wieder beeindruckende Text-treue, z. B. bei den nomina barbara oder über einen langen Zeitraum unver-änderte magische Rituale.5 Auf der anderen Seite sind deutlich Entwicklungen,Bearbeitungen und Neuerungen zu beobachten. Eine typische Entwicklungvon antiker zu mittelalterlicher jüdischer Magie ist die teilweise überbordendeAusweitung der Dämonologie, nicht zuletzt durch den Einfluß der arabischenMagie.6 Ein Ergebnis redaktioneller Bearbeitung können immer komplexereTexteinheiten sein.7 Eine Innovation ist beispielsweise seit dem Hochmittelal-ter mit der Entstehung und Verbreitung der Kabbala verbunden – jüdischeMagie wird als »praktische Kabbala« bezeichnet und verstanden.8
2 Vgl. Gideon Bohak, Ancient Jewish Magic. A History. Cambridge 2008, S. 8–69,Chapter 1: “Jewish Magic: A Contradiction in Terms?”
3 Vgl. zur “scribalization of the Jewish magical tradition in late antiquity” ibid.,S. 144–148 und S. 283–285.
4 Vgl. Schiffman; Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts, S. 51.5 Diese Beobachtung wird von Bohak vielleicht zu pointiert als “prevalent scholarly
myth” relativiert. Stattdessen heißt es bei ihm: “the processes of textual entropy anddeliberate adaptations are far more common”; vgl. Bohak, Ancient Jewish Magic,S. 147. Zu den in der Tat häufigen Belegen von Schreiberfehlern und Redigieren vonVorlagen siehe unten unter 2. Überlieferung.
6 Vgl. z. B. Gershom Scholem, Some Sources of Jewish-Arabic Demonology, in: JJS16 (1965), S. 1–13.
7 Siehe dazu unten.
33Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
Magie impliziert naturgemäß eine pragmatische Dimension. Diese Dimensionsoll im folgenden anhand der drei Aspekte Unterweisung, Überlieferung undAktualisierung von magischem Wissen herausgearbeitet werden. Dabei mußbeachtet werden, daß diese drei Aspekte eng miteinander verknüpft sind undsich gegenseitig beeinflussen. Unter dem Stichwort Unterweisung soll hierbehandelt werden, auf welche Weise magisches Wissen vermittelt wird, sei esdurch persönliche Unterweisung oder durch autodidaktisches Lernen. Wis-senstransfer wird aber nicht nur durch Unterweisung gewährleistet, sondernauch durch Überlieferung. Überlieferung meint hier die Tradierung von Tex-ten als Weitergabe, Kopieren, Redigieren oder Edieren. Unter Aktualisierungsoll hier die Umsetzung von Texten in eine tatsächliche Praxis im Sinne einerAnwendung, eines Gebrauchs, einer Handlung bzw. einer Praktik verstandenwerden. Insofern gewinnen diese Texte eine performative und ritualtheoreti-sche Dimension.Da wir anders als Feldforschung betreibende Ethnologen9 generell wenig überZeugnisse einer tatsächlichen magischen Praxis im Judentum verfügen undauch kaum Hinweise auf eine mündliche Unterweisung in magischem Wissenbesitzen,10 müssen wir uns auf die schriftliche Bezeugung magischer Textekonzentrieren. Und da wir auch hier zumeist nicht wissen, wie magischesWissen unterwiesen, überliefert und aktualisiert wurde, müssen wir uns aufdie Präsentationsformen magischen Wissens, wie sie sich in den Textzeugenselbst zeigen, konzentrieren. Welche textlichen bzw. literarischen Signale oderStrategien werden verwendet, um magisches Wissen zu vermitteln und zuüberliefern und dieses je nach Bedarf aktualisieren zu können? Auf welcheWeise wird gewährleistet, daß magische Praktiken »richtig« durchgeführt wer-den? Was verraten uns sowohl die Textzeugen als materielle Schriftträger alsauch die darauf bezeugten Texte selbst über die Art und Weise, wie magischesWissen vermittelt, überliefert und aktualisiert wird?Die moderne Linguistik und Semiotik haben für diese Fragestellungen denBegriff der Textpragmatik und entsprechend verschiedene Theorien einge-führt.11 Generell werden in der Textpragmatik Texte als intentionale kom-
8 Vgl. Gershom Scholem, Kabbalah. Jerusalem 1988, S. 183; Joshua Trachtenberg,Jewish Magic and Superstition. A Study in Folk Religion. New York 1939 (Nach-druck New York 1970), S. 18.
9 Vgl. die Klassiker dieser Disziplin Edward E. Evans-Pritchard, Hexerei, Orakelund Magie bei den Zande. Frankfurt a. M. 1978; Claude Levi-Strauss, TraurigeTropen. Frankfurt a. M. 1978; Bronislaw Malinowski, Korallengärten und ihreMagie. Bodenbestellung und bäuerliche Riten auf den Trobriand-Inseln. Frankfurta. M. 1981.
10 Vgl. Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 66: “much of the magical activity was con-ducted orally”.
34 Bill Rebiger
munikative Handlungen verstanden, die von ihren jeweiligen Verwendungs-situationen abhängig sind. Damit rückt die Funktion einer Textsorte in denVordergrund. Textinterne wie -externe Komponenten der Textproduktionund -rezeption werden dabei besonders fokussiert. Die Analyse und Inter-pretation der Texte berücksichtigt, daß die Texte in übergeordnete Hand-lungszusammenhänge eingebettet sind. Es wird also weniger nach dem Leserals nach dem Anwender eines Textes gefragt. Damit rückt die Leserlenkungund Handlungsanweisung durch den Text in den Vordergrund. Textstruktu-relle Merkmale, Textsemantik und Textgrammatik werden als abhängig vontextpragmatischen Komponenten erklärt. Welche sprachlichen Mittel werdenim Text im Sinne einer Strategie eingesetzt, um eine bestimmte Wirkung zuerzielen? Vor diesem Hintergrund soll hier gefragt werden: An welchen text-internen und -externen Merkmalen läßt sich konkret die mögliche Textinten-tion der Unterweisung, Überlieferung bzw. Aktualisierung von magischemWissen festmachen? Anders gefragt: In welcher Weise dienen Präsentations-formen magischen Wissens als Traditionsgaranten? Und: auf welche Weiseäußert sich in den magischen Texten ein theorie- bzw. handlungsorientierterCharakter? Die folgenden Beobachtungen versuchen eine Beantwortung die-ser und ähnlicher Fragen.In textpragmatischer Perspektive lassen sich die relevanten Zeugnisse der Ma-gie in direkte und in indirekte Belege einteilen.12 Zu den direkten Zeugnissen,die für den Zeitraum der Spätantike und des frühen Mittelalters im Judentumunmittelbar eine magische Praxis belegen, gehören Amulette, babylonischeZauberschalen, magische Gemmen, Ringe, Schmuckanhänger und auch einigewenige magische Schädel aus Babylonien.13 Die indirekten Zeugnisse, die z. B.in Sammelhandschriften und Handbüchern vorliegen,14 lassen dagegen nurmittelbar auf eine magische Praxis schließen. Hier stellt sich generell die Frage,
11 Als Einführung in eine nützliche Textpragmatik sei Siegfried J. Schmidt, Text-theorie. Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation. München1976, empfohlen. Vgl. auch Wilhelm Egger, Methodenlehre zum Neuen Testa-ment. Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden. Freiburg 1990,S. 133–146; Susanne Göpferich, Textsorten in Naturwissenschaft und Technik.Pragmatische Typologie – Kontrastierung – Translation. Tübingen 1995.
12 Andere, nichtkongruente Differenzierungen verwenden die termini »insider« und»outsider evidence« bzw. »primäre« und »sekundäre Quellen«; vgl. Bohak, AncientJewish Magic, S. 70.
13 Vgl. die ausführliche Darstellung und Beschreibung in: Bohak, Ancient JewishMagic, S. 143–226 (Chapter 3).
14 Es handelt sich vor allem um Handschriften aus der Kairoer Geniza; vgl. Steven M.Wasserstrom, The Magical Texts in the Cairo Genizah, in: Genizah Research afterNinety Years: The Case of Judeo-Arabic. Hrsg. von Joshua Blau; Stefan C. Reif.Cambridge 1992, S. 160–166; Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 215–221.
35Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
inwieweit eine Aktualisierung der Texte in der Praxis zumindest potentiellmöglich erscheint oder sogar nachgewiesen werden kann.Die indirekten magischen Textzeugen erlauben hinsichtlich ihrer Textfunktiondie textpragmatische Unterscheidung entweder in theoretische Texte oder aberin praxis- bzw. handlungsorientierte Texte. Die theoretischen Texte behandelnthematisch die konzeptionellen Voraussetzungen einer magischen Praxis undweisen naturgemäß einen höheren Abstraktions- und Reflexionsgrad auf. Leidersind bislang nur sehr wenige Zeugnisse theoretischer Texte in der jüdischenMagie bekannt. Fast alle bislang edierten indirekten Textzeugen jüdischerMagie sind dagegen handlungsorientierte Texte.Zu den Apriori magischer Texte und Praktiken gehören ein magisches Welt-bild und eine rituelle Einstellung, die im Idealfall von Textproduzenten wieauch Textrezipienten gleichermaßen geteilt werden.15 Zu einem magischenWeltbild gehört vor allem die Prämisse vom Wirken kausaler Beziehungenzwischen mikro- und makrokosmischen Elementen, die empirisch – und auchnaturwissenschaftlich – nicht von vornherein in Kausalzusammenhängen ste-hen. Dieses Weltbild ist in der Regel in mehr oder weniger ausdifferenziertetheologische, angelologische, dämonologische, kosmologische und astrono-misch-astrologische Vorstellungen eingebettet. Relativ häufig werden in magi-schen Texten magische Aktivitäten (zumeist Schadenzauber) »der Anderen«erwähnt, gegen die die eigene magische Praktik vorgehen soll. Eine rituelleEinstellung zeigt sich vor allem in der strikten Befolgung von Reinheitsvor-schriften und modalen Angaben zu Zeit, Ort und Wiederholung von magi-schen Handlungen.Anhand dieser terminologischen Differenzierungen werden im folgenden diedrei genannten Aspekte Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung vonmagischem Wissen untersucht.
1. Unterweisung
Eine besondere Form der möglicherweise nicht intendierten Unterweisung inmagischem Wissen ist die Polemik gegen magische Praktiken einerseits unddie Monopolisierung magischen Wissens andererseits durch die Rabbinen, diesich in den entsprechenden Belegen in der rabbinischen Literatur zeigen. EinCharakteristikum polemischer Literatur ist das kaum zu vermeidende Para-doxon, daß die Ideen, Konzepte bzw. Texte der zu bekämpfenden Gegner
15 Vgl. Caroline Humphrey; James Laidlaw, Die rituelle Einstellung, in: Ritualtheo-rien. Hrsg. von Andrea Belliger; David J. Krieger. Opladen – Wiesbaden 1998,S. 135–155.
36 Bill Rebiger
ausführlich dargestellt werden müssen, um sie zu widerlegen, aber diesendamit zugleich eine nicht intendierte affirmative Rezeption ermöglicht wird.16
Dieses Phänomen zeigt sich auch in den Polemiken gegen magisches Wissenund magische Praxis in der Bibel, bei den Rabbinen und bei den Karäern.Hinter aller Pointierung und Negativzeichnung gegnerischer Positionen inPolemiken lassen sich häufig eine bestimmte Praxis bzw. bestimmte Praktikenerkennen. Das gilt nicht nur für den modernen, kritischen Leser solcher Pole-miken, sondern bereits für die Adressaten und sonstigen Leser dieser Texte inder Vergangenheit. Auf unser Thema bezogen heißt das, daß magisches Wis-sen bereits unvermeidlich durch die Bekämpfung desselben tradiert wird unddamit potentiell aktualisierbar bleibt.Aber gerade bei den Rabbinen ist weniger ein polemisches Interesse an magi-schem Wissen zu beobachten, als ihr Bestreben, dieses zu monopolisieren.Diese Monopolisierung magischen Wissens durch die Rabbinen diente zwarvordergründig dem rabbinischen Macht- und Autoritätsanspruch gegenüberjeglichen Magiern und Zauberern, war aber letztlich für die Rezeption undTradierung spätantiken jüdischen wie paganen magischen Wissens mitverant-wortlich.17 Die gleichsam enzyklopädische Darstellung magischer Praktiken,besonders im Babylonischen Talmud, mag dies eindrücklich belegen. DieseAmbivalenz findet ihre Entsprechung im zeit- und kulturtypischen magischenWeltbild der Mehrheit der antiken Menschen, d. h. auch der Rabbinen, undder einsetzenden Kriminalisierung magischer Praktiken in der römischen wiejüdischen Spätantike.18
Zu den meistverbreiteten topoi bezüglich einer intendierten Unterweisungmagischen Wissens gehört sicherlich die selbstlegitimierende Aussage, daß die-ses Wissen von Gott, einem Engel oder einer ähnlich transzendenten Größeoffenbart bzw. gelehrt wurde.19 Beliebt ist auch das Motiv vom Fund einesBuches, einer Rolle, einer Tafel usw. als Schriftträger magischen Wissens bei-spielsweise in einer Höhle.20 Hier soll aber nicht nach literarischen Strategiender Autorisierung und Legitimierung eines Textes bzw. von Wissen, sondernnach Belegen für eine historisch evidente Unterweisung von Mensch zu
16 Beispiele finden sich zuhauf in der antignostischen Literatur der frühen Kirchenvä-ter.
17 Vgl. Giuseppe Veltri, Magie und Halakha. Ansätze zu einem empirischen Wissen-schaftsbegriff im spätantiken und frühmittelalterlichen Judentum. Tübingen 1997,S. 288f.; Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 366–370.
18 Vgl. für den römischen Diskurs Marie Theres Fögen, Die Enteignung der Wahr-sager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike. Frankfurt a. M.1993.
19 Vgl. z. B. SHR I § 2; SHR II §§ 366–371.20 Vgl. z. B. Sefer Razi el ha-Mal akh. Amsterdam 1701, fol. 2b/24f., 2b/44f., 3b/8.
37Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
Mensch gefragt werden. Das klassische Modell für die intendierte Unterwei-sung in speziellem, z. B. halakhischem, oder sogar esoterischem Wissen kannsicherlich auch für den Bereich der jüdischen Magie vermutet werden: dieFiliation von Meister zu Schüler.21 Nur finden sich für den magischen Kontextbis ins Mittelalter leider kaum explizite Belege. Zu den Ausnahmen gehöreneinige Stellen aus der rabbinischen Literatur. So wird z. B. die Existenz einerFamilientradition bei dem Wundertäter H
˙oni ha-Me agel (»der Kreiszieher«)
und seinen beiden Enkeln Abba H˙
ilqia und H˙
anan ha-Neh˙ba in bTaan 23a–b
impliziert.22
Eine weitere Ausnahme wird wahrscheinlich in einem magischen Geniza-Fragment aus dem 12. Jahrhundert bezeugt, in dem es leider nur sehr frag-mentarisch heißt:
Was wir gehört (und) gesehen haben ??? [. . .], [von] Ya aqov Mah˙iqa haben wir
aufgeschrieben [und] vokalisiert, aus seinen Büchern und von seinem Munde.Gepriesen sei ??? und glücklich sei derjenige, der (es) lernt.23
21 Zum Wissenstransfer in der nichtjüdischen Magie der Spätantike vgl. Richard Gor-don, Reporting the Marvellous: Private Divination in the Greek Magical Papyri, in:Envisioning Magic. A Princeton Seminar and Symposium. Hrsg. von Peter Schäfer;Hans G. Kippenberg. Leiden u. a. 1997, S. 68–70. Zur Unterweisung und Überlie-ferung esoterischen Wissens in der frühen Kabbala vgl. Moshe Idel, Transmissionin Thirteenth-Century Kabbalah, in: Transmitting Jewish Traditions: Orality, Tex-tuality, and Cultural Diffusion. Hrsg. von Yaakov Elman; Israel Gershoni. NewHaven – London 2000, S. 138–165; Elliot R. Wolfson, Beyond the Spoken Word:Oral Tradition and Written Transmission in Medieval Jewish Mysticism, in: ibid.,S. 166–224.
22 Vgl. Michael Becker, Wunder und Wundertäter im frührabbinischen Judentum.Studien zum Phänomen und seiner Überlieferung im Horizont von Magie undDämonismus. Tübingen 2002, S. 331–333. Die Figur des Magiers bzw. des Zaubererstritt dagegen in den spätantiken und mittelalterlichen Texten der jüdischen Magiefast durchgehend in den Hintergrund. Wenn in den magischen Texten überhauptAutoritäten genannt werden, handelt es sich stets um solche der ferneren Vergan-genheit, wie z. B. um biblische Heroen wie Adam, Noach, Abraham oder Mose, oderaber, wesentlich seltener, um einzelne Rabbinen. Sie werden allerdings ausschließlichin Traditionsketten, Offenbarungsbezügen und Analogien erwähnt. Erst in spätmit-telalterlichen und neuzeitlichen Texten wird die Figur des Wunderheilers oder Ba alha-Shem wieder greifbar; vgl. Karl-Erich Grözinger, Jüdische Wundermänner inDeutschland, in: Judentum im deutschen Sprachraum. Hrsg. von id., Frankfurt a. M.1991, S. 190–221; id., Wundermann, Helfer und Fürsprecher. Eine Typologie derFigur des Ba al Schem in aschkenasisch-jüdischen Volkserzählungen, in: Der Magus.Seine Ursprünge und seine Geschichte in verschiedenen Kulturen. Hrsg. vonAnthony Grafton; Moshe Idel. Berlin 2001, S. 169–192.
23 JTSL ENA 2643, fol. 7a/4f. (Nr. 5, MTKG I, S. 70: Edition, S. 74: Übersetzung); vgl.auch die Parallele in Westminster College Misc. 16, fol. 2a/1ff. (Nr. 55, MTKG III,S. 23), die aber erst mit dem Makarismus einsetzt.
38 Bill Rebiger
Berücksichtigt man den magischen Kontext des Fragments, handelt es sichoffensichtlich bei der genannten Person, von der wir nichts weiter wissen, umeinen Zauberkundigen. Dies wäre dann m. E. der einzige Beleg in den bislangedierten spätantiken und mittelalterlichen magischen Texten des Judentums, indem der Name eines Zauberlehrers genannt ist. Auch wenn aus dem lücken-haften Text nicht klar ist, was genau man von ihm lernen kann, erfahren wirimmerhin, daß die Unterweisung sowohl schriftlich als auch mündlich geschahund präzise – es heißt ausdrücklich »vokalisiert« – aufgeschrieben wurde.Schließlich wird auch der Lernende dieser Unterweisung gepriesen und damitdiese magische Tradition legitimiert.Auf ein Lehrer-Schüler-Verhältnis wird auch in einem weiteren magischenGeniza-Fragment Bezug genommen:
Wenn du willst, daß man dir den Fürsten der Weisheit und Geister übergibt und ermit dir sei und dir diene wie ein Schüler vor seinem Lehrer . . . ( ktlmidlpnirbu ).24
Es kann allerdings nur vermutet werden, ob mit dieser Analogie allgemein aufeine traditionelle rabbinische Lehrhaussituation25 angespielt wird oder aberspeziell auf einen Zauberlehrling und seinen Meister.Eine schriftliche Unterweisung durch einen Weisen als Beantwortung vonFragen mehrerer, nicht näher spezifizierten Personen wird in einem anderenmagischen Geniza-Fragment imaginiert. Die Übersetzung des jüdisch-arabi-schen Textes lautet:
Sie fragten den Weisen ( xkiÕ ) über den Schöpfer, und er schrieb ihnen: Gedacht undunbekannt, gesucht und gefunden (und doch) nicht erkannt.26
Diese kurze wie kryptische Passage, die in den letzten beiden Zeilen der Seiteauf einen wahrscheinlich lateinischen Text in hebräischer Transkription folgt,legt aber wohl eher einen metaphysischen oder mystischen Diskurs über dieNatur des Schöpfergottes und keinen magischen Kontext nahe.27
Auf eine Lernsituation wird auch zu Beginn eines dämonologischen Textesmit dem Titel Sefer Qevis
˙at ha-Ruh
˙ot (»Buch über die Einsammlung der
Geister«) kurz Bezug genommen:
24 JTSL ENA 2871, fol. 7a/7f. (Nr. 28, MTKG II, S. 127: Edition, S. 128: Übersetzung).Dieselbe Formulierung ist auch in H
˙arba de-Moshe (Peter Schäfer, Synopse zur
Hekhalot Literatur [hier: SHL]. Tübingen 1981, § 500 [M22]) belegt.25 Vgl. Catherine Hezser, The Social Structure of the Rabbinic Movement in Roman
Palestine. Tübingen 1997, S. 337f.26 CUL T.-S. K 1.115, fol. 1a/7f. (Nr. 31, MTKG II, S. 155: Edition, S. 156: Überset-
zung).27 So auch der Kommentar zur Stelle; ibid., S. 158.
39Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
Wenn du herrschen willst über die Dämonen, über alle bösen Geister und über diezwölf Familien, die vom Himmel herabgestiegen sind in den Tagen Satans, ihresVaters, so lerne vorher das ganze Buch und ihre Namen sowie die Namen ihrerFamilien und jede einzelne ihrer Arten.28
Hier wird mit dem Hinweis auf ein vorbereitendes Auswendiglernen desBuches in didaktisch-appellativer Weise eine offenbar autodidaktische Lern-situation als Voraussetzung für die intendierte magische Praktik vorgegeben.Eine literarische Deskription einer detaillierten mündlichen Unterweisung ineiner magischen Praktik findet sich, soweit ich sehe, nur im Kontext derHekhalot-Literatur und zwar in der Mikroform »Beschwörung des sar ha-panim« in Form eines intimen Lehrgesprächs zwischen einem Schüler undseinem Lehrer:
R. Aqiva fragte R. Eli ezer den Großen:Womit beschwört man den Fürsten des Angesichts (sar ha-panim), auf die Erdehinabzusteigen (und) dem Menschen die Geheimnisse oben und unten, die Ab-gründe der Grundlagen oben und die Abgründe der Grundlagen unten, die verbor-genen (Tiefen) der Weisheit und die Klugheit der Einsicht zu offenbaren?Er sagte zu mir:Mein Sohn, einmal habe ich (ihn) veranlaßt hinabzusteigen, da suchte er die ganzeWelt zu vernichten, denn er ist der gewaltigste Fürst in der ganzen oberen Familie.Immer steht und dient er vor dem König der Welt, in Klarheit, Absonderung, Rein-heit, Schrecken und Furcht vor der Herrlichkeit seines Schöpfers, denn die Shekhinaist bei ihm an jedem Ort.Ich sagte zu ihm:Mein Lehrer, siehe, ich verbinde mich ihm siebenmal mittels der Hoheit, die du mirzuerkannt hast, in der Stunde, da ich mich (ihm) verbinde, mich seiner zu bedienen.Er sagte zu mir:Wer sich (ihm) verbindet, sich seiner zu bedienen, faste einen Tag, (nämlich den), daer ihn hinabsteigen läßt. Vor jenem Tage aber halte er sich sieben Tage frei vonPollution, tauche unter in einem Wasserlauf und führe kein Gespräch (mit einerFrau). Am Ende der Tage seiner Reinigung, am Tag des Fastens, steige er hinab undsitze bis zum Hals im Wasser, und er spreche, bevor er beschwört:(Es folgen die eigentlichen Beschwörungstexte)29
In diesem Lehrgespräch fragt R. Aqiva zunächst seinen Lehrer R. Eli ezer,womit man den »Fürsten des Angesichts« beschwört. Dieser antwortet nichtdirekt, sondern verweist auf die Gefahren einer solchen Beschwörung. DieBedeutung der Erwiderung von R. Aqiva ist etwas unklar. Wahrscheinlich
28 CUL T.-S. K 1.1, fol. 1a/1–6 (Nr. 6, MTKG I, S. 80); vgl. zu diesem Buch Scholem,in: JJS 16 (1965), S. 1–13.
29 SHL § 623; vgl. Peter Schäfer, Die Beschwörung des sar ha-panim. Edition undÜbersetzung, in: id., Hekhalot-Studien. Tübingen 1988, S. 118–153; Rebecca M.Lesses, Ritual Practices to Gain Power. Angels, Incantations, and Revelation inEarly Jewish Mysticism. Harrisburg 1998, S. 206–219.
40 Bill Rebiger
möchte er versichern, daß er würdig genug sei für die Unterweisung. SeinLehrer erteilt dann detaillierte Anweisungen zur Vorbereitung der eigentli-chen Beschwörung, bevor er dann schließlich die zu sprechenden Beschwö-rungstexte mitteilt. Natürlich bleibt trotz aller Vorstellbarkeit dieser Szeneeine unüberbrückbare Differenz zwischen der Fiktionalität der literarischenEbene und der Historizität der Erzählung. Entscheidend für die Tradierungdieser Unterweisung ist aber, daß nicht nur R. Aqiva von seinem Lehrer,zumindest im Rahmen der Erzählung, instruiert wird, sondern vor allem jederLeser durch den Text.Wenden wir uns nun der Frage zu, was denn der Inhalt der Unterweisung sei.Für denjenigen, der sich die magische Tradition im Judentum als esoterischeDisziplin vorstellt, mag es überraschend sein, daß in den bislang edierten spät-antiken und mittelalterlichen magischen Texten orientalischer Provenienz– von wenigen literarischen Kompositionen abgesehen30 – relativ selten dasmagische Wissen als »Geheimnis« klassifiziert wird.31 Vorschriften oder War-nungen hinsichtlich einer Geheimhaltung magischen Wissens werden nichtexplizit erwähnt.Ein wesentlicher Inhalt der Unterweisung könnte sich in theoretisch-magi-schen Texten zeigen. Unter theoretisch-magischen Texten sollen hier Texteverstanden werden, in denen eine abstrakt-theoretische Systematisierungmagischen Wissens sowie seiner Prämissen, Prinzipien und Implikationen zuerkennen ist.32 Es handelt sich also nicht um Gebrauchstexte, sondern um denVersuch theoretischer Abstraktion und Reflexion. Leider sind theoretischeTexte nur relativ selten bezeugt.33 Textpragmatisch betrachtet können dieseTexte argumentative, informative, deskriptive und didaktische Textteile ent-halten.
30 Siehe vor allem die beiden Makroformen Sefer ha-Razim I und II, die bereits explizitim Titel auf ihre »Geheimnisse« verweisen; vgl. auch SHR I §§ 3, 11 und 13; SHR II§ 362.
31 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.162, fol. 1a/2 (Nr. 61, MTKG III, S. 67: Edition, S. 71: Über-setzung): »Bestimmt ist dieses Geheimnis ( rza ) für N. N., Sohn von N. N.«; CULT.-S. K 1.73, fol. 1b/1.9 (= »Geniza 6«, Naveh; Shaked, Amulets, S. 230): “Thismystery is designated for a great love”; »Bowl 6«, Zeile 1 (Naveh; Shaked, Amulets,S. 164): “Mystery. This mystery is for silencing and shutting the mouth”; Bowl»M102« (Levene, Corpus of Magic Bowls, S. 44): “This mystery is appointed foroverturning sorceries.” Ansonsten gilt, was Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 224f.,resümiert: “apparently, there was nothing esoteric about such texts, and they werenot the hidden possessions of a secretive guild of magicians, but available for all tosee.”
32 Vgl. Schäfer; Shaked, MTKG I, S. 8f.33 Ibid. werden vier Geniza-Fragmente, die in diesem Band ediert, übersetzt und kom-
mentiert werden, genannt.
41Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
Zu diesen theoretisch-magischen Texten gehört der sogenannte inyan sot˙
a-Text, in dem das biblische Ritual zur Feststellung einer des Ehebruchs ver-dächtigten Frau adaptiert wird.34 Einzelne textpragmatische Aspekte sollen andiesem Beispieltext benannt werden. So lautet das entscheidende Argumentfür die Notwendigkeit der Adaption:
Das ist die Weise, (es) einzunehmen, die wir heute praktizieren, aus dem Grund, daßwir keinen Priester, kein heiliges Wasser und kein Zeltheiligtum (mehr) haben.35
Lediglich eine Information stellt z. B. der folgende Satz dar:
Aber das bittere Wasser wurde oben nicht (erwähnt, sondern stammt) aus diesemVers, der da lautet: »Und der Priester soll heiliges Wasser nehmen« (Num 5,17) usf.36
Weiterhin werden in diesem Text deskriptiv die Annahme eines Schöpfer-gottes, der Engel, Geister, Dämonen und den Menschen geschaffen hat,sowie die Offenbarung und Tradierung geheimer Gottesnamen geschildert.37
Didaktische Appellative werden mit der typischen Formulierung »wisse undverstehe« eingeleitet und verweisen explizit auf eine Lernsituation.38 Diesertheoretisch-magische Textteil geht dann nahtlos in einen Beschwörungstextund eine Ritualanweisung über.Der rabbinische Diskurs zum Verhältnis von Magie und Halakha unterschei-det grundsätzlich zwischen tatsächlicher Magie und illusionärer Augentäu-schung.39 Diese rabbinische Terminologie wird auch in den mittelalterlichenmagischen Texten aus der Kairoer Geniza aufgegriffen, die theoretischeGrundlagen zur Magie enthalten.40 So beschreibt ein magisch-theoretischer
34 Siehe JTSL ENA 3635, fol. 17a–d (Nr. 1, MTKG I, S. 17–28); CUL T.-S. K 1.56,fol. 1b/3–23 (Nr. 2, MTKG I, S. 32); vgl. Giuseppe Veltri, Inyan Sot
˙a: Halakhische
Voraussetzungen für einen magischen Akt nach einer theoretischen Abhandlung ausder Kairoer Geniza, in: FJB 20 (1993), S. 23–48.
35 JTSL ENA 3635, fol. 17c/17–19 (Nr. 1, MTKG I, S. 20).36 Ibid., fol. 17b/8–10.37 Ibid., fol. 17a/7–10: »Und alle Namen . . . sie alle hat man aufgeschrieben aus dem
Mund R. Yishma els, des Hohenpriesters, und R. Yishma el (hat sie empfangen) ausdem Mund Met
˙at˙rons, des Fürsten des Angesichts. . . .« Vgl. CUL T.-S. K 1.56,
fol. 1b/7–9 (Nr. 2, MTKG I, S. 32).38 Ibid., fol. 17a/18–21: »Wisse und verstehe, daß man von diesen verborgenen Namen,
die den unaussprechlichen Namen (bilden), der des Ehebruchs verdächtigen Frau zutrinken gab. Durch [die Kraft] eben dieser Namen soll ihr Bauch anschwellen undihre Hüfte einfallen.« Vgl. CUL T.-S. K 1.56, fol. 1b/13–15 (Nr. 2, MTKG I, S. 32).
39 Dazu ausführlich Veltri, Magie und Halakha, S. 26–46, 54–65; Philip S. Alexan-der, The Talmudic Concept of Conjuring ( Ah
˙izat Einayim) and the Problem of the
Definition of Magic (Kishuf), in: Creation and Re-Creation in Jewish Thought.FS J. Dan. Hrsg. von Rachel Elior; Peter Schäfer. Tübingen 2005, S. 7–26.
40 Vgl. z. B. JTSL ENA 2643, fol. 6a/1f. (Nr. 5, MTKG I, S. 69); CUL T.-S. Misc. 9.57,fol. 1a/1 (Nr. 64, MTKG III, S. 112).
42 Bill Rebiger
Text mit dem Titel Arba a Yesodot vier Prinzipien, die in der Welt enthaltensind, und deren korrekte Benennung, Auslegung und Ausführung. Darin heißtes:
In deinem Namen, Gott, der Helfer, will ich beginnen, (die) vier Prinzipien aus-zulegen, die in der Welt sind, deren Benennung man kennt, aber deren Auslegungman nicht kennt. Und kein Mensch versteht, zwischen den zwei guten und den zweischlechten zu unterscheiden, deren Benennung man kennt, deren Auslegung undderen Ausführung sich (den Menschen) aber entzieht. Und es sind folgende: Siesagen »Name der Reinheit« und »Name der Unreinheit« und »Augentäuschung«und »Zauberei«. Man kennt ihre Benennung, kennt aber nicht ihr Prinzip und nichtihre Ausführung. Vielmehr wisse und verstehe,41 daß sie sich zuallererst hinsichtlichihrer Benennung irren, indem sie »Name der Reinheit« und »Name der Unreinheit«sagen. Aber die Benennung ist vielmehr: »Name in Reinheit« und »Name in Unrein-heit«; auf daß man jedes einzelne Mal vorsichtig sei. Führe (es) in Reinheit aus, undes wird dir gelingen. In Wahrheit sind es vier Benennungen. Zwei sind gut, und inihrer Ausführung liegt keinerlei Vergehen. Zwei (aber) sind schlecht. Wer sie aus-führt, ist der Ausrottung schuldig. Die zwei guten sind: »Name in Reinheit« und»Augentäuschung«. In ihr liegt keinerlei Vergehen. Die zwei schlechten sind:»Name in Unreinheit« und »Zauberei«.42
Elemente der Unterweisung lassen sich in den magischen Texten auch inbezug auf die Bildung magisch wirksamer Namen feststellen. So werden bei-spielsweise die Prinzipien der Namensbildung im Sefer Shimmush Tehillim ineinem theoretischen Text dargestellt, der aus dem Umkreis der H
˙aside Ash-
kenaz stammt:
(Merk)zeichen: Der Anfang des Anfangs und das Ende des Endes sowie das Endedes Anfangs und der Anfang des Endes.Wie (ist das zu verstehen)?Der Buchstabe, der am Anfang [des Verses] ist, der am Anfang des Psalms ist.[Und der Buchstabe, der am Ende des Verses ist, der am Ende des Psalms ist.]Und der Buchstabe, der am Ende des Verses ist, der am Anfang des Psalms ist.Und der Buchstabe, der am Anfang des Verses ist, der am Ende dieses Psalms ist.43
Der terminus technicus simñ (»Merkzeichen«) ist hier eine mnemotechnischeFormulierung, die auf eine Lernsituation verweist: Jemandem soll beigebrachtwerden, wie man sich das Verfahren der Namensbildung einprägen kann. ImAnschluß an den Merkvers wird die Namensbildung ausführlich geschildert.Für die Bildung eines magischen Namens werden der erste und/oder der letzte
41 Auch hier ein didaktischer Appellativ.42 CUL T.-S. K 1.2, fol. 1a/1–1b/7 (Nr. 3, MTKG I, S. 47f.: Edition, S. 50f.: Überset-
zung); vgl. auch die Parallele in CUL T.-S. K 1.37, fol. 1a/1–1b/16 (Nr. 4, MTKG I,S. 57f.); ferner JTSL ENA 2643 (Nr. 5, MTKG I, S. 69f.); Westminster College Misc.16, fol. 1a–b (Nr. 55, MTKG III, S. 23).
43 Ms Oxford, Bodleian Library, Hebr. 1531; ediert in: Bill Rebiger, Bildung magi-scher Namen im Sefer Shimmush Tehillim, in: FJB 26 (1999), S. 11–14.
43Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
Vers eines Psalms herangezogen und zwar jeweils der erste und/oder letzteBuchstabe des Verses.Weitere Beispiele für ein Merkzeichen in magischen Anweisungen sind ineinem Geniza-Fragment44 und in bShab 78a belegt. In der letztgenannten Tal-mudstelle wird mit diesem Begriff zugleich das zugrundeliegende Prinzip fürdie Verwendung von Blut für die Heilung von Augenkrankheiten genannt:»Als Merkzeichen diene (dir): Inneres gegen Inneres, Äußeres gegen Äuße-res.«45
2. Überlieferung
Die Überlieferung magischer Texte wird vor allem durch magische Sammel-handschriften, von denen es Hunderte, wenn nicht Tausende gibt, greif- undvorstellbar. Die relativ große Anzahl von Paralleltexten verweist auf eine Tra-dierung durch Abschreiben,46 für die aber weniger professionelle Kopisten, dieim Auftrag arbeiten, verantwortlich sind als mehr oder weniger gut ausgebil-dete Schreiber, die aber vor allem für private Zwecke schreiben. Dies wirddurch vier Beobachtungen deutlich:
1. Es gibt relativ wenige Textzeugen, die vom selben Schreiber stammen.47
2. Sehr viele magische Sammelhandschriften sind in einer Kursivschrift ge-schrieben, die teilweise schwer lesbar ist, und enthalten Streichungen,Glossen, Anmerkungen, Schreibfehler usw.
3. Es gibt zahlreiche Beispiele für fehlerhaftes und ungenaues Abschreiben.4. Es gibt zahlreiche Beispiele für flexibles und kreatives Redigieren älterer
Traditionen.48
44 CUL T.-S. K 1.3, fol. 2a/6 (Nr. 62, MTKG III, S. 92); vgl. auch Sefer Razi el, fol. 41b.45 Ähnlich auch tShab 8,8. Zu dem dort wie auch hier zugrundeliegenden Prinzip simi-
lis similia vgl. Veltri, Magie und Halakha, S. 120.46 Vgl. Trachtenberg, Jewish Magic, S. 18: “What was put in writing became the
common property of all who could read – and many who did not understand pro-fessed to be able to perform miraculous deeds by the bald repetition of what waswritten.”
47 Siehe z. B. CUL T.-S. K 1.127 (Schiffman; Swartz, Hebrew and Aramaic Incanta-tion Texts, S. 113–122) und CUL T.-S. AS 143.427 (Nr. 19, MTKG I, S. 213–218)sowie CUL T.-S. K 1.168 (Schiffman; Swartz, Hebrew and Aramaic IncantationTexts, S. 143–159) und CUL T.-S. AS 142.12 (Nr. 15, MTKG I, S. 183–191).
48 Vgl. Michael D. Swartz, Scribal Magic and Its Rhetoric: Formal Patterns in Medie-val Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Genizah, in: HThR 83
(1990), S. 166f.; Schiffman; Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts, S. 53;Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 147 und 165.
44 Bill Rebiger
Neben diesen allgemeinen Beobachtungen zum Können der Schreiber lassensich auch an der Art und Weise der metatextuellen und visuellen Aufbereitungder Texte Hinweise auf Überlieferungsintentionen und -techniken festmachen.Metatextuelle Elemente zur Gliederung in den Manuskripten sind folgender-maßen eingesetzt: Kleinere und größere Texteinheiten werden durch deutlichabgesetzte Überschriften hervorgehoben.49 Schlußformeln am Ende einerTexteinheit oder Kolophone am Ende einer Handschrift markieren nicht nurdas Ende eines Textes, sondern vermitteln dem Abschreiber bzw. dem Leserdie Gewißheit, daß nichts fehlt. Einzelne Texteinheiten beginnen mit Zweck-angaben, die jeweils auf einer neuen Zeile einsetzen und auch graphisch her-vorgehoben sein können.50
Zu den verwendeten graphischen Textbegrenzungssignalen gehören Absätze,Einrückungen usw. für den Textanfang und Interpunktionszeichen, Leerzeilenusw. für das Textende.51 Aber auch für die Gliederung der einzelnen Textteilekönnen graphische Gestaltungselemente eingesetzt werden. Die Gliederungdes Textes kann durch Absätze, Spatien, Leerzeilen, Einrückungen und gra-phische Zeichen erfolgen. Wichtig ist auch die Interpunktion des Textes, die ineinigen Textzeugen recht ausdifferenziert ist.52
Die genannten graphischen Mittel können aber auch dazu dienen, das schnelleFinden einzelner segullot für bestimmte Zwecke in den Sammelhandschriftenzu erleichtern. Graphische Hervorhebungen können einzelne Textelementemarkieren, die als besonders wichtig erachtet werden. So werden z. B. nominabarbara sehr häufig durch supralineare Balken, Umrahmungen (sogenannteKartuschen), symmetrische bzw. tabellenartige Anordnung oder sogar Verzie-rungen hervorgehoben.53 Dadurch wird nicht zuletzt auch die Überprüfungder Anzahl der Namen erleichtert.Marginalien können beispielsweise dazu verwendet werden, Zwecke oder eineliterarische Strukturierung anzuzeigen. Zur Gliederung von segullot-Samm-lungen dient auch eine Numerierung der einzelnen segullot durch hebräische54
49 CUL T.-S. K 1.162 (Nr. 61, MTKG III); CUL T.-S. AS 143.171 (Nr. 68, MTKG III).50 Siehe z. B. das 10 Folios umfassende Geniza-Fragment CUL T.-S. K 1.143 (= »Geniza
18«, Naveh; Shaked, Magic Spells, S. 189–209), das den jüdisch-arabischen Titel»Buch der Anleitung« trägt. Diese Sammlung von segullot ist in verschiedenen Spra-chen (Jüdisch-Arabisch, Hebräisch und Aramäisch) und in verschiedenen Schriftengeschrieben worden. D. h. aber nicht zwingend, daß auch verschiedene Schreiber amWerke waren, sondern es ist ebenso möglich, daß ein Schreiber über einen sehrlangen Zeitraum immer wieder etwas hinzugefügt hat.
51 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.37 (Nr. 4, MTKG I, S. 55–66).52 Vgl. z. B. CUL T.-S. NS 322.10 (Nr. 7, MTKG I, S. 83–107).53 Vgl. z. B. CUL T.-S. AS 142.39 (Nr. 16, MTKG I, S. 192–198); CUL T.-S. AS 142.192*
(Nr. 37, MTKG II, S. 206–216); CUL T.-S. NS 216.23* (Nr. 81, MTKG III, S. 285–334).
45Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
oder arabische55 Buchstaben am Rand. Im Sefer Shimmush Tehillim ist dieKapiteleinteilung mitunter als Marginalie56 oder aber zumindest durch Absatzbzw. spatium hervorgehoben.Zu den Besonderheiten magischer Texte gehören die Verwendung magischerAlphabete (Brillenbuchstaben, charakteres)57 sowie schematischer Darstellun-gen.58 Diese sind in der Überlieferung besonders stabil, was auf die Wert-schätzung dieser Elemente durch die Tradenten verweist. Diese Alphabete undSchemata sind oft für die Aura und das Faszinosum esoterischen Wissensverantwortlich.Aber nicht nur textliche Zeichen dienen der Tradierung magischen Wissens,sondern auch bildliche, d. h. die Visualisierung einzelner Elemente. BildlicheDarstellungen wecken zumindest die Aufmerksamkeit des Lesers und tragenebenfalls zur Aura magischer Texte bei. Darüber hinaus können sie Text auchinterpretieren und ergänzen. Abbildungen von Dämonen sind besonders aufden babylonischen Zauberschalen zu finden,59 aber mitunter auch in magi-schen Geniza-Fragmenten.60 Diese Darstellungen sollen offenbar Schrecken
54 Vgl. z. B. CUL T.-S. AS 143.171, fol. 1a/1.5.9, 1b/8, 2a/6, 2b/7 (Nr. 68, MTKG III,S. 136f.).
55 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.70 (»Geniza 5«, Naveh; Shaked, Amulets). Bei den arabi-schen Buchstaben in CUL T.-S. AS 142.13*, fol. 1a/6, 1b/8, 2a/4.18, 2b/11 (Nr. 69,MTKG III, S. 145–147), handelt es sich wohl um keine Kapitelzählung, da sie auchnach der von Bohak korrigierten Reihenfolge der Folios nicht alphabetisch geordnetsind; vgl. Schäfer; Shaked, MTKG III, S. 144; Gideon Bohak, ReconstructingJewish Magical Recipe Books from the Cairo Genizah, in: Ginzei Qedem 1 (2005),S. 16*, Anm. 12.
56 Vgl. z. B. CUL T.-S. NS 322.59 (Nr. 82, MTKG III, S. 337–341).57 Vgl. z. B. CUL Or. 1080.5.4, fol. 1a/11.23f.31 und 1b/4 (Nr. 11, MTKG I, S. 153f.);
CUL T.-S. K 1.162, fol. 1a/37–39, 1b/34–36, 1d/4.8 (Nr. 61, MTKG III, S. 68–70);ferner Trachtenberg, Jewish Magic, S. 141f.; Israel Weinstock, alpabitawl
mjjruñupiruwh , in: Temirin. Texts and Studies in Kabbala and Hasidism. Hrsg. vonid., Bd. 2, Jerusalem 1981, S. 51–76; John G. Gager, Curse Tablets and BindingSpells from the Ancient World. New York – Oxford 1992, S. 7–11, 56f., 170; Hans
A. Winkler, Siegel und Charaktere in der Muhammedanischen Zauberei. Berlin1930; Michael D. Swartz, The Aesthetics of Blessing and Cursing: Literary andIconographic Dimensions of Hebrew and Aramaic Blessing and Curse Texts, in:Journal of Ancient Near Eastern Religions 5 (2005), S. 198.
58 Vgl. z. B. JTSL ENA 1177, zwischen fol. 16a/21 und 16a/27 (Nr. 41, MTKG II,S. 399: Foto); Sefer Razi el, fol. 7a und 32b.
59 Vgl. z. B. »Bowl 4«, »Bowl 9«, »Bowl 12a« und »Bowl 13« (alle Naveh; Shaked,Amulets); »Bowl 14«, »Bowl 16«, »Bowl 18«, »Bowl 19« und »Bowl 27« (alleNaveh; Shaked, Magic Spells); vgl. dazu Erica C. D. Hunter, Who are theDemons? The Iconography of Incantation Bowls, in: Studi Epigrafici e Linguisticisul Vicino Oriente antico 15 (1998), S. 95–115; Swartz, in: Journal of Ancient NearEastern Religions 5 (2005), S. 199–202.
46 Bill Rebiger
und Furcht verbreiten und zwar sowohl bei den namentlich genannten Dämo-nen als auch bei dem Klienten.61 Auf einem häufig nachgedruckten Wochen-bettamulett sind die drei Engel Sanui, Sansanui und Semangelof, die gegenLilit beschworen werden, visualisiert.62 Ein Beispiel für die Verbindung vonVisualisierung und Text sind magische Schemata und Diagramme, wie z. B. dasSchwindeschema63 oder angelologische und kosmologische Diagramme.64
Eine stabilisierende Funktion für die Textüberlieferung können auch poetischeVerfahren besitzen, die aber, wie z. B. das Akrostichon oder die Reimbildung,in magischen Texten relativ selten sind.65 So ist einige Male eine Sequenz vonnomina barbara alphabetisch angeordnet.66 Ein weiteres Beispiel findet sichinnerhalb eines Amulettextes, das der Verfluchung dient, in einer Aufzählungvon passiven Verbformen, die alphabetisch nach deren Radikalen geordnetsind.67
Einen Hinweis auf den Charakter der Überlieferung und Rezeption von Tex-ten, ihrem Sitz im Leben, liefern nicht nur formkritische Fragestellungen, son-dern oft bereits die verwendeten Schriftarten. Ob ein Text in Quadratschrift,Semikursive oder Kursivschrift geschrieben ist, kann bereits seine Sakralität,Kanonizität, Autorität, Rezeption und Praxisrelevanz signalisieren. EinzelneSignalwörter, z. B. Überschriften, können sich in einigen Texten in Quadrat-schrift deutlich von dem ansonsten in Kursive geschriebenen Text abheben.68
In einigen Geniza-Fragmenten ändert sich die Schrift, so daß vermutet werdenkann, daß entweder verschiedene Schreiber die Texte geschrieben haben oderaber ein Schreiber über einen sehr langen Zeitraum.69
Ein seltsamer, aber gar nicht so seltener Befund sind Handschriften, derenSchrift so ungelenk und ungeübt sowie teilweise auch orthographisch oder
60 Siehe z. B. CUL T.-S. K 1.143, fol. 1b (= »Geniza 18«, Naveh; Shaked, Magic Spells,S. 189 und Tafel 54).
61 So Swartz, in: Journal of Ancient Near Eastern Religions 5 (2005), S. 202.62 Siehe Sefer Razi el, fol. 43b; vgl. dazu Naveh; Shaked, Amulets, S. 111–122; Theo-
dore Schrire, Hebrew Amulets. Their Decipherment and Interpretation. London1966, S. 118.
63 Vgl. Trachtenberg, Jewish Magic, S. 116f.; Schrire, Hebrew Amulets, S. 59–63.64 Siehe oben Anm. 58.65 Vgl. Swartz, in: Journal of Ancient Near Eastern Religions 5 (2005), S. 189–195.66 CUL T.-S. K 1.144*, fol. 4b/9–11 (Nr. 22, MTKG II, S. 35); CUL T.-S. NS 322.21*,
fol. 1b/10–13 (Nr. 23, MTKG II, S. 82); vgl. auch CUL T.-S. NS 324.92, fol. 1b/9–19
(Nr. 83, MTKG III, S. 360); CUL T.-S. K 1.94, fol. 1a/25–32 (Schiffman; Swartz,Hebrew and Aramaic Incantation Texts, S. 101).
67 CUL T.-S. K 1.90, fol. 12–16 (Nr. 17, MTKG I, S. 201); dazu auch Swartz, in: Journalof Ancient Near Eastern Religions 5 (2005), S. 193–195; vgl. ferner CUL T.-S.NS 252.10, fol. 1a/7–1b/2 (Nr. 70, MTKG III, S. 154f.).
68 Vgl. z. B. CUL T.-S. AS 142.192, fol. 1a/1 (Nr. 37, MTKG II, S. 207).69 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.3 (Nr. 62, MTKG III, S. 89–106); vgl. oben Anm. 50.
47Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
grammatikalisch auffällig fehlerhaft ist, daß sie unmöglich von erfahrenen odersogar professionellen Schreibern stammen kann.70 Da es sich wohl kaum umSchreibübungen im Rahmen einer Alphabetisierung oder des Erlernens desSchreibens handeln kann, da hierfür ein magischer Text als Übungstext wenigplausibel scheint, müssen wir annehmen, daß kaum literarisierte Laien für deneigenen Bedarf auf Originaltraditionen zugreifen konnten, um sie eigenhändigzu kopieren bzw. sie zu verschriftlichen. Entweder konnten sich diese Laieneinen professionellen Schreiber magischer Texte schlicht nicht leisten oderaber ein solcher war nicht verfügbar.Es gibt aber auch Hinweise, daß die Tradierung magischen Wissens unter-brochen werden sollte. So finden sich relativ häufig Fragmente in der KairoerGeniza, deren Seiten vertikal in zwei Hälften auseinandergerissen wurden,offenbar um Lesung bzw. Abschreiben zu verhindern.71 Sehr selten wurdemagischer Text auch ausradiert, bevor er in die Kairoer Geniza kam.72 Nach-trägliche Streichungen, die wahrscheinlich die Namen des Klienten betrafen,sind auf einem Amulett aus der Kairoer Geniza belegt.73
3. Aktualisierung
Die Aktualisierung von direkten Zeugnissen jüdischer Magie, wie z. B. vonAmuletten, Zauberschalen, Ringen und Gemmen, ist offensichtlich, wenn wirnicht annehmen wollen, daß diese Artefakte lediglich zu Studienzwecken oderwegen ihres ästhetischen Reizes angefertigt wurden. Evident wird die tatsäch-
70 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.18 + T.-S. K 1.30 (= »Geniza 10«, Naveh; Shaked, MagicSpells, S. 152–157 und Tafeln 35–36); CUL T.-S. K 1.42 (= »Geniza 12«, ibid., S. 164–166 und Tafel 39); CUL T.-S. K 1.80 (= »Geniza 15«, ibid., S. 172–174 und Tafeln44–45); CUL T.-S. K 1.91 + T.-S. K 1.117 (= »Geniza 16«, ibid., S. 174–181 undTafeln 46–48); CUL T.-S. 8.275 (Nr. 13, MTKG I, S. 171–175); CUL T.-S. Misc. 10.31
(Nr. 14, MTKG I, S. 176–182).71 Vgl. z. B. JTSL ENA 2397.6 (Nr. 30, MTKG II, S. 376f.: Fotos); CUL T.-S. Misc.
11.91 (Nr. 57, MTKG III, S. 388: Fotos); vgl. dazu Bohak, in: Ginzei Qedem 1
(2005), S. 9*–29*; id., Ancient Jewish Magic, S. 217.72 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.117, fol. 2b (= »Geniza 16, page 4«, Naveh; Shaked, Magic
Spells, S. 175).73 CUL T.-S. AS 142.39, fol. 1a/16f. und 1a/22 (Nr. 16, MTKG I, S. 194; ibid., S. 193,
heißt es in der Beschreibung der Herausgeber: »Diese nachträgliche Schwärzungkönnte auf Zensur zurückzuführen sein. Da von den Schwärzungen in erster Liniedie Namen der Personen betroffen sind, auf die das Amulett ausgestellt wurde, darfvermutet werden, daß hier Auftraggeber und Ziel des Liebeszaubers geheim gehaltenwerden sollten.«); vgl. auch die Schwärzungen in CUL T.-S. K 1.26, fol. 1b/8 (Nr. 45,MTKG II, S. 268: Edition, S. 406: Foto).
48 Bill Rebiger
liche magische Verwendung bei den Zauberschalen, die häufig in archäologi-schen Ausgrabungen in situ gefunden wurden.74 Aber auch das tatsächlicheTragen von Amuletten, Ringen und Gemmen ist vielfach als »outsider evi-dence« belegt, beispielsweise in der rabbinischen Literatur.75
Wesentlich schwieriger ist es aber, etwas über die tatsächliche Aktualisierungindirekter Zeugnisse magischer Texte auszusagen. Vergleichbar ist dieseSituation vielleicht mit der der Erforschung mystischer Texte, da dort daseigentliche Erfahrungserlebnis des Mystikers auch nur, wenn überhaupt, ver-mutet werden kann, ohne es allerdings teilen zu können.76 Dennoch lassen sichgerade in textpragmatischer Perspektive deutliche Hinweise auf eine Aktuali-sierung aufzeigen. So soll im folgenden der Charakter von magischen Textenals Gebrauchsliteratur herausgearbeitet werden.Häufig wird in magischen Handschriften eine lockere, zufällig erscheinendeFolge von segullot bezeugt, ohne daß irgendwelche Ordnungsprinzipienerkennbar wären. Zusammengefaßt zu Sammlungen von segullot sind sie zueinem Kodex gebunden worden. Darauf deuten textliche Kustoden, Paginie-rung der Seiten wie auch Spuren der Faltung von Bögen und Lagen und derenBindung. Nicht selten ist es den Herausgebern magischer Fragmente gelungen,solche auseinandergefallenen Kodices zu rekonstruieren.77 Ein Kodex einersolchen segullot-Sammlung erleichtert bereits den gezielten Zugriff auf einekonkrete magische Praktik. Besser noch ist natürlich die systematische Anord-nung von segullot nach ihren Zweckangaben, die in der Tat häufig belegt ist.Zweckangaben können auch im Verlauf des Gebrauchs modifiziert werden.Ein Beispiel für die Modifikation einer Zweckangabe ist in einem Schaden-zauber eines Geniza-Fragments belegt, in dem in zwei aufeinanderfolgendensegullot die Zweckangabe »zur Vernichtung« durch einen eindeutig späterenGlossator mit der Formulierung »für eine Krankheit« offenbar abgeschwächtwurde.78 Ein Beispiel für eine Gruppierung von segullot nach Adressaten fin-det sich in einem Geniza-Fragment, das eine magisch-medizinische Sammlungvon segullot für Frauen bezeugt.79 Folgende frauenspezifische Fälle werdenabgehandelt: Geburtsschwierigkeiten, Abtreibung von toten Föten, Blutun-gen, Brustkrankheiten und Schwangerschaftsabbruch. Generell werden ver-
74 Vgl. Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 184f.75 Vgl. zu Amuletten z. B. mSheq 1,2; mKel 23,1; mMiq 10,2; mShab 6,2.76 Vgl. Bernard McGinn, The Foundations of Mysticism. Origins to the Fifth Cen-
tury. New York 1991, S. XIV: “Experience as such is not a part of the historicalrecord.”
77 Vgl. z. B. Nr. 22, 23, 26, 34 und 37 in MTKG II sowie Nr. 66, 69, 78, 79, 81 und 82 inMTKG III; vgl. dazu auch Bohak, in: Ginzei Qedem 1 (2005), S. 9*–29*.
78 CUL T.-S. K 1.56, fol. 2a/6.15 (Nr. 2, MTKG I, Kommentar S. 43).79 CUL T.-S. NS 322.10 (Nr. 7, MTKG I, S. 83–107).
49Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
schiedene segullot zum selben Zweck zumeist mit der Formulierung »undnoch (ein Rezept)« ( uyud ) eingeleitet. Ein anderes Ordnungsprinzip von segul-lot richtet sich nach vorgegebenen literarischen Strukturen, wie z. B. der desSieben- und Achtzehnbittengebets in der jüdischen Liturgie.80
Ein kodikologisches Merkmal von Gebrauchsliteratur ist ein handliches For-mat. So weist z. B. ein mehrseitiges Geniza-Fragment, das eine Sammlung vonsegullot bezeugt, ein quadratisches Taschenbuchformat auf.81 Sicherlich liegtein Grund für die Verwendung handlicher Formate darin, daß Schreibmate-rialien teuer waren. Wesentlicher scheint aber die Möglichkeit zu sein, einenkleinformatigen Textträger jederzeit bei sich tragen und gegebenenfalls auchverstecken zu können. Der Nutzen einer solchen Mobilität magischen Wissensliegt in Zeiten von Verfolgung, Flucht, Vertreibung und Migration auf derHand. Verlockend ist aber auch die Vorstellung reisender Magier, wenngleiches dafür keine Belege in den Texten selbst gibt.Ein textliches Merkmal für die tatsächliche Aktualisierung magischer Anwei-sungen können standardisierte Formeln darstellen, die das praktische Erprobt-sein der magischen Handlung oder eine Bestätigung für ihren Erfolg anzeigen,wobei aber nicht völlig auszuschließen ist, daß diese Formeln lediglich stereo-typ aus Marketinggründen, etwa im Sinne eines Garantieversprechens, ver-wendet wurden. Zu diesen sehr häufig belegten Formeln gehören z. B.:»Erprobt.«, »Das ist geprüft.«, »Das ist geprüft und erprobt.«, »Das istwahr.«, »Das ist wahr und geprüft.«, »Das ist ein großes Wunder.«, »Das istwahr und erwiesen.«, »Mit dem Namen des Herrn werden wir (es) ausführenund erfolgreich sein.«82
Makarismen, also Glücks- bzw. Heilsversprechen für die Nutzer magischerTexte, sind einige Male belegt und lassen sich als Legitimation, Autorisationund Aufforderung zur Aktualisierung verstehen.83
Des weiteren deuten Abnutzungserscheinungen auf den tatsächlichen Ge-brauch hin. So sind viele der magischen Geniza-Fragmente regelrecht zerfled-dert, was zumindest auf eine wiederholte Lektüre deutet. Auch sekundäreNotizen oder Bemerkungen des Eigners der Textzeugen und Anwenders dermagischen Anweisungen gehören zu den Gebrauchsspuren.
80 Vgl. die Nr. 22–31 in MTKG II.81 CUL T.-S. K 1.143 (= »Geniza 18«, Naveh; Shaked, Magic Spells); vgl. auch CUL
T.-S. NS 160.18 (Nr. 47, MTKG II, S. 278–284); CUL T.-S. K 1.169 (Schiffman;Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts, S. 160–164).
82 Vgl. Trachtenberg, Jewish Magic, S. 115; Veltri, Magie und Halakha, S. 260;Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 282.
83 JTSL ENA 2643, fol. 7a/5 (Nr. 5, MTKG I, S. 70); CUL T.-S. K 1.74, fol. 2b/11ff.(Nr. 27, MTKG II, S. 121); Westminster College Misc. 16, fol. 2a/1 und 2b/18
(Nr. 55, MTKG III, S. 23f.); SHR I § 14 und SHR II § 398.
50 Bill Rebiger
Ein wesentlicher Hinweis auf intendierte Aktualisierung sind Formulare, beidenen es sich um standardisierte Mustertexte handelt. Die Intention vonMustertexten ist es, Vorbild zu sein für zu aktualisierende bzw. zu adaptie-rende Texte. In der jüdischen Magie sind vor allem Formulare für Amulette,Bannungen und Verfluchungen bekannt.84 Amulettformulare sind wenigerAnleitungen zur Herstellung eines Amulettes als eher vorformulierte Amulett-texte, die auf ein zu fertigendes Amulett übertragen werden können. Typi-sches Merkmal dieser Formulare sind Platzhalterformeln. Sie dienen dafür,daß später in dem anzufertigenden Amulett die Namen des Klienten und/oderdes Adressaten an dieser Stelle eingefügt werden. Bemerkenswert sind auchAmulette, in denen die Platzhalterformel nicht ersetzt wurde.85
Ein weiteres Indiz für eine tatsächliche Aktualisierung ist die textuelle Kon-gruenz zwischen einem direkten und einem indirekten magischen Textzeugen,z. B. einem Amulett und einem Amulettformular.86 Es stellt sich die Frage, obprofessionelle Amulettschreiber oder auch schreibkundige private KlientenAmulette nach den Vorgaben der Amulettformulare gefertigt haben. Ausdruckeiner merkantilen Professionalisierung ist die Existenz von Schreiberwerkstät-ten für Amulette (und übrigens auch für Zauberschalen), die einerseits durcharchäologische Funde87 und andererseits auch durch Merkmale der Standar-disierung von Texten, die für eine Serienfertigung notwendig sind, evidentscheint. In einigen Textzeugen ist ein spatium für den Namen des Klientenbzw. Adressaten freigehalten worden. Das bedeutet, daß es sich um ein vor-gefertigtes Amulett handelt, in das bei Anwendung nur noch der spezifischeName eingetragen werden mußte.88 Daneben wurden Amulette auch von Kli-enten in Auftrag gegeben und nach ihren Wünschen gefertigt. Aufschlußreichfür den sehr pragmatischen Umgang ist ein Amulett zur Erlangung von Anse-
84 Beispiele für Amulettformulare sind: CUL T.-S. K 1.56, fol. 1a/1–1b/3 (Nr. 2,MTKG I, S. 31f.); CUL T.-S. K 1.37, fol. 2a–b (Nr. 4, MTKG I, S. 58f.); CUL T.-S.K 1.26, fol. 1a (Nr. 45, MTKG II, S. 267); JTSL ENA 2672.20 (Nr. 58, MTKG III,S. 46–54); CUL T.-S. K 1.78 (Nr. 65, MTKG III, S. 114–117); CUL T.-S. NS 175.58
(Nr. 71, MTKG III, S. 160–166). Zu den Bann- und Fluchformularen gehören z. B.CUL T.-S. NS 160.18 (Nr. 47, MTKG II, S. 278–284) und JTSL ENA 3657.2–3
(Nr. 48, MTKG II, S. 285–297).85 Vgl. z. B. CUL T.-S. K 1.26, fol. 1a/2.5 (Nr. 45, MTKG II, S. 267); CUL T.-S. K 1.106,
fol. 1a/13f. (Nr. 46, MTKG II, S. 275).86 Vgl. Bohak, in: Ginzei Qedem 1 (2005), S. 9*–29*. Ein eindrückliches Beispiel für
eine solche Kongruenz ist das Amulett aus H˙
orvat Rimmon (= »Amulet 10«, Naveh;Shaked, Amulets, S. 84–89) und das Amulettformular in dem Geniza-FragmentCUL T.-S. Misc. 27.4.11, fol. 1a/8–16 (= »Geniza 22«, Naveh; Shaked, Magic Spells,S. 216f.); vgl. dazu auch: Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 156f.
87 Vgl. Bohak, Ancient Jewish Magic, S. 184.88 Vgl. ibid., S. 145f. und 152.
51Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
hen und Respekt, das offensichtlich wiederverwendet wurde, indem der Namedes vorherigen Klienten ausradiert und durch den aktuellen Namen ersetztwurde.89 Bei den Werkstätten handelte es sich um eine Art von Dienstleistung,die offenbar nicht nur von Juden in Anspruch genommen wurde. Der litera-rische und zumeist antisemitische Topos des »Zauberjuden« hat hier mögli-cherweise einen realgeschichtlichen Ursprung.90
Die häufigste Textsorte magischer Texte sind Handlungs- bzw. Ritualanwei-sungen.91 Die Funktion bzw. Zweckgebundenheit der zugrundeliegendenkommunikativen Situation dieser Textsorte liegt in der Vorbereitung undDurchführung magischer Praktiken. Zwischen Textproduzent und Textrezi-pient besteht eine Wissensdifferenz, die durch die Textsorte »magische Hand-lungsanweisung« ausgeglichen werden soll. Beide Seiten teilen im Idealfalldieses Interesse wie auch das Niveau der Verschriftlichung des Textes demNiveau der Lesefähigkeit des Anwenders entspricht. Die Vermittlung magi-schen Wissens geschieht demnach nicht mündlich und direkt, sondern schrift-lich und indirekt, ohne daß aber didaktische Intentionen zu erkennen sind.Letztlich entzieht sich die Verbreitung magischen Wissens damit möglichenBestrebungen der Esoterik und der Kontrolle. Die tatsächliche Aktualisierungdieser Anweisungen in der Praxis durch einen Textrezipienten kann in derRegel nur vermutet werden; sie wird nur selten in den handschriftlichen Text-zeugen als Gebrauchsspur sichtbar.92
89 Vgl. das einseitig beschriebene Papieramulett CUL T.-S. K 1.163 (Nr. 42, MTKG II,S. 246–257), das auf den Namen El azar ben Malih
˙a ausgestellt ist. Dieser Name ist
sekundär eingesetzt worden, vgl. ibid. fol. 1a/8.18f. u. ö.90 Vgl. Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews. The Medieval Conception of
the Jew and its Relation to Modern Antisemitism. New Haven 1943 (NachdruckNew York 2002), S. 57–155; Stefan Rohrbacher; Michael Schmidt, Judenbilder.Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und antisemitischer Vorurteile. Reinbek1991, S. 169–177.
91 Diese Textsorte ist generell mit den in der linguistischen Textpragmatik (wie auch inder Alltagspraxis) genannten Textsorten »Instruktion«, »Gebrauchs-« und »Bedie-nungsanleitung«, »Direktive«, »Anweisungstext« oder »Appelltext« vergleichbar;vgl. z. B. die linguistischen Untersuchungen von Markus Nickl, Gebrauchsanlei-tungen. Ein Beitrag zur Textsortengeschichte seit 1950. Tübingen 2001; Nicole
Neckermann, Instruktionstexte. Normativ-theoretische Anforderungen und empi-rische Strukturen am Beispiel des Kommunikationsmittels Telefon im 19. und 20.Jahrhundert. Berlin 2001, und Jong-Moon Yeo, Textpragmatik, Textfunktion,Textanalyse. Frankfurt a. M. 2003.
92 Bei einigen Handschriften läßt sich erkennen, daß sie gefaltet bzw. gerollt wurden,um sie als Amulett zu verwenden; vgl. z. B. CUL T.-S. AS 142.12 (Nr. 15, MTKG I,S. 183–191); CUL T.-S. AS 143.372 (Nr. 18, MTKG I, S. 206–212); CUL T.-S. K 1.147
(Nr. 20, MTKG I, S. 219–234) und CUL T.-S. K 1.26 (Nr. 45, MTKG II, S. 266–273).Das einseitig beschriebene Fragment CUL T.-S. K 1.1 (Nr. 6, MTKG I, S. 79–82)
52 Bill Rebiger
Diätetische und sexuelle, hygienische und spirituelle Reinheitsvorschriftenund -anweisungen dienen der Vorbereitung der eigentlichen magischen Hand-lung.93 Die eigentlichen magischen Handlungsanweisungen stellen im Idealfalleiner Ritualanweisung eine ausführliche, sequentielle Abfolge der einzelnenHandlungsschritte dar und treffen zugleich Aussagen über modale Bedingun-gen wie z. B. Ort, Zeit, Häufigkeit usw. Die sprachliche Form magischerHandlungsanweisungen wird in erster Linie durch einen direktiven Modus desAnweisens, Aufforderns, Befehlens oder Empfehlens bestimmt. Wesentlichseltener sind dagegen deskriptive und argumentative Modi. Die Instruktions-semantik bedient sich vor allem grammatikalischer Formen wie Imperativ undPräformativkonjugation (Jussiv), die explizit eine Aktualisierung intendieren.So heißt es z. B.: »Tue dies!«, »Nimm das!«, »Schreibe!«, »Sprich!«, »Geh!«usw. Die Objekte dieser Handlungen sind materiae magicae, deren Ingredi-enzen quantitativ (Anzahl bzw. Menge) und qualitativ (»frisch«, »neu« usw.)konkretisiert werden können. Zu den damit zu verrichtenden Tätigkeitengehören z. B. Vermischen, Kneten, Essen, Trinken, Vergraben, Ausgießen,Verspritzen oder Umhängen.Zu den pragmatischen Anforderungen an die sprachliche Formulierungdieser Textsorte gehören: Eindeutigkeit (Kohärenz), sprachliche Kürze (Prä-gnanz), Verständlichkeit (Stringenz) und Reproduzierbarkeit. Das Sprach-niveau zeichnet sich durchgängig durch die Verwendung der natürlichenSprache (Gemein- bzw. Alltagssprache), eine niedrige Abstraktionsstufe,wenige Fachtermini und eine ungebundene Syntax aus.94
Eine Sonderform von Handlungsanweisungen stellen Rezepte dar, besondersin magisch-medizinischen Texten. Neben einer Zweckangabe bestehen siezumeist nur aus der Angabe von Ingredienzen und spärlichen Verarbeitungs-hinweisen derselben.95
Eine weitere Sonderform von Handlungsanweisungen sind Anweisungen fürSprechakte, die relativ häufig belegt sind. Besonders interessant für ritualtheo-retische Fragestellungen sind hierbei performative Sprechakte. Diese sind in
weist ebenfalls Faltungen auf. Es handelt sich aber nicht um ein Amulett, sondernum eine Handlungsanweisung für eine Geisterbeschwörung, von der man annehmenkann, daß sie zur Vergewisserung des Ablaufs der Handlung bequem zur Hand seinsollte.
93 Vgl. Michael D. Swartz, Scholastic Magic. Ritual and Revelation in Early JewishMysticism. Princeton 1996, S. 158–165; Lesses, Ritual Practices, S. 119–155.
94 Vgl. das vertikale Fünf-Schichten-Modell von Lothar Hoffmann, Kommunikati-onsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Tübingen 1985, S. 66f.: »Sprache der Kon-sumtion«.
95 Zu Beispielen für Rezeptsammlungen siehe CUL T.-S. NS 322.10 (Nr. 7, MTKG I,S. 83–107); CUL T.-S. K 1.157 (Nr. 8, MTKG I, S. 108–119); CUL T.-S. K 1.146
(Nr. 9, MTKG I, S. 120–132).
53Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
Anweisungen für Beschwörungen, Bannungen oder Verfluchungen bzw. Be-schwörungs-, Bann- oder Verfluchungstexten selbst zu finden.96
Magische Handbücher, die andernorts auch als Grimoire97 oder Manualbezeichnet werden, sind Paradebeispiele für magische Gebrauchsliteratur. Eshandelt sich zumeist um komplexe literarische Strukturen, die z. B. Titel,Inhaltsverzeichnisse, Vorworte, Kapiteleinteilung, Marginalien, Register usw.aufweisen können. Diese makrostrukturellen Textteile haben eine anwender-orientierte Funktion. Ordnungsprinzipien dieser Handbücher können sich z. B.an der menschlichen Anatomie, der alphabetischen Folge der Zweckangaben, anKosmologie oder Astrologie orientieren. Der Charakter magischer Gebrauchs-literatur wird besonders eindrücklich am Beispiel des populärsten magischenHandbuchs im Judentum, dem Sefer Shimmush Tehillim, deutlich:98
1. Das Buch weist eine systematische Struktur auf, die sich an der numerischenAbfolge der Psalmen im Psalter orientiert. Somit wird eine Korrespondenzzwischen magischem Handbuch und biblischem Psalter garantiert.
2. Zumeist werden das Zahlzeichen des betreffenden Psalms und/oder einStichwort für die Zweckangabe am jeweiligen Außenrand einer Seite ange-geben oder im Fließtext durch eine Markierung hervorgehoben. Diese bei-den Gestaltungsmerkmale ermöglichen dem Benutzer, der das Handbuch janicht kursorisch lesen, sondern je nach Bedarf punktuell nutzen möchte,den schnellen, unkomplizierten Zugriff auf die ihn interessierende Stelle.
3. Zahlreiche Handschriften, die vom jeweiligen Schreiber offenbar nicht fürden eigenen Gebrauch gefertigt wurden, verwenden eine Semikursive odersogar eine Halbquadratschrift. Diese Handschriften konnten somit leichtervon verschiedenen Benutzern verwendet werden.
4. Die gedruckten Ausgaben sind vornehmlich im Oktavformat erschienen.Da sie zugleich nur relativ wenige Seiten umfassen, besaßen die Druckeein handliches Taschenbuchformat. Sie wurden in vergleichsweise hohenAuflagen wiederholt gedruckt. Der aus diesen Faktoren resultierende ver-hältnismäßig geringe Verkaufspreis erlaubte die weite Verbreitung desHandbuches.
5. Ein Index der Zweckangaben, der bereits in einigen Handschriften und vorallem in späteren Drucken zu finden ist, erleichtert den gezielten Zugriff aufden entsprechenden Psalm und seinen magischen Gebrauch.
96 Vgl. Roy A. Rappaport, Ritual und performative Sprache, in: Ritualtheorien. Hrsg.von Andrea Belliger; David J. Krieger. Opladen – Wiesbaden 1998, S. 191–211;Rebecca Lesses, The Adjuration of the Prince of the Presence: Performative Utter-ance in a Jewish Ritual, in: Ancient Magic and Ritual Power. Hrsg. von MarvinMeyer; Paul Mirecki. Leiden u. a. 1995, S. 185–206.
97 Vgl. Owen Davies, Grimoires. A History of Magic Books. Oxford 2009.98 Vgl. Rebiger, Sefer Shimmush Tehillim, S. 22f.
54 Bill Rebiger
6. Darüber hinaus weisen zahlreiche Handschriften und Druckausgaben se-kundäre Glossen, Notizen, Hervorhebungen, Empfehlungen sowie weitereGebrauchsspuren auf, wie z. B. Fett und Schmutz von Fingerabdrücken.
Weitere Beispiele für magische Handbücher im Judentum, an denen sich ähn-liche Beobachtungen machen lassen, sind:
− H˙
arba de-Moshe99
− Havdala de-Rabbi Aqiva100
− Losbücher (Sefer Goralot)101
− die sogenannte Haus- oder Dreckapotheke mit magisch-medizinischenRezepten z. B. zur Bekämpfung von Ungeziefer, zur Haarpflege, gegenHämorrhoiden, zur Anregung der Darmtätigkeit, gegen Fieber, Vergiftun-gen, Schwellungen, Pest, Ohrenschmerzen, Ausschlag usw.102
− ein medizinisch-magisches Iatrosophion, das im Babylonischen Talmudtradiert wird103
− ein magisch-dämonologischer Text, der Sefer Qevis˙
at ha-Ruh˙
ot104
Eine besondere Weiterentwicklung magischer Handbücher sind literarischeKompositionen magischer Texte, die sich durch eine elaborierte literarischeStruktur auszeichnen. Die eigentlichen magischen Texte sind dabei häufig ineine übergeordnete narrative Struktur eingebettet. Prominente Beispiele dafürsind der Sefer ha-Razim I und der Sefer ha-Razim II.105 Biblische Personenwie hier Noach oder Adam werden narrativ als Empfänger der Offenbarungmagischen Wissens durch einen Engel, hier Razi el, geschildert. Bereits literar-kritisch lassen sich in diesen komplexen Kompositionen verschiedene Tradi-tionsschichten wie Magie, Kosmologie, Astrologie, Angelologie, Aggada undLiturgie unterscheiden.Dieser erste Versuch einer textpragmatischen Betrachtung und Analyse derUnterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen hat
99 Siehe Harari, xrbadmwh .100 Siehe Gershom Scholem, Havdala De-Rabbi Aqiva. A Source for the Tradition of
Jewish Magic During the Geonic Period (hebr.), in: Tarbiz 50 (1980/81), S. 243–281.101 Vgl. Evelyn Burkhardt, Hebräische Losbuchhandschriften: zur Typologie einer jüdi-
schen Divinationsmethode, in: Jewish Studies Between the Disciplines. FS P. Schäfer.Hrsg. von Klaus Herrmann; Margarete Schlüter; Giuseppe Veltri. Leiden – Boston2003, S. 95–148.
102 So in CUL T.-S. K 1.146 (Nr. 9, MTKG I, S. 120–132).103 bGit 68b–70b; dazu Veltri, Magie und Halakha, S. 238–249.104 Vgl. JTSL ENA 2643, fol. 6a/5 (Nr. 5, MTKG I, S. 69); CUL T.-S. K 1.1 (Nr. 6,
MTKG I, S. 79–82); CUL T.-S. AS 143.45 (Nr. 51, MTKG II, S. 312–321); CUL T.-S.AS 142.83 (Nr. 52, MTKG II, S. 322–326).
105 Siehe Rebiger; Schäfer, Sefer ha-Razim I und II.
55Unterweisung, Überlieferung und Aktualisierung von magischem Wissen
hoffentlich gezeigt, daß dieser Ansatz nicht nur reichlich Untersuchungsma-terial zur Verfügung hat, sondern tatsächlich eine Reihe der eingangs gestelltenFragen zu beantworten vermag. Eine umfassende textpragmatische Untersu-chung der spätantiken und mittelalterlichen, aber auch der späteren Entwick-lung der jüdischen Magie ist bislang ein Desiderat. Für die Neuzeit wäre vorallem die Erfindung des Buchdrucks als eine wesentliche Zäsur für die magi-sche Tradition und ihren Wissenstransfer zu berücksichtigen. Seitdem sindDruckausgaben magischer Texte erschienen, deren teilweise bis heute anhal-tende Popularität und Praxisqualität durch Taschenbuchformat, hohe Aufla-gen, häufige Nachdrucke, preiswerte Ausgaben und entsprechendes Marketingnoch gesteigert werden konnte. Beispiele für gedruckte magische Handbücherim Judentum, die besonders stark rezipiert, das heißt hier auch immer prak-tisch angewendet wurden, sind der Sefer Shimmush Tehillim, der Sefer Gora-lot, der Sefer Segullot, der Sefer Razi el und der Sefer Rafa el.106
106 Vgl. zu einigen neuzeitlichen magischen Handbüchern auch Hagit Matras,Creation and Re-Creation: A Study in Charm Books (hebr.), in: Creation and Re-Creation, S. 147*–164*.






























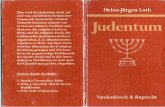













![J. Militký, M. Karwowski; Gold und Silber bei den Boiern und ihren südöstlichen Nachbarn – numismatische und archäologische Überlieferung, [in:] M. Hardt, O. Heinrich-Tamaska](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63147b5d5cba183dbf0796c1/j-militky-m-karwowski-gold-und-silber-bei-den-boiern-und-ihren-suedoestlichen.jpg)

