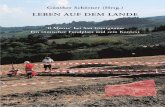Das Über-Leben der Dinge. Ansätze einer materialen Gedächtnistheorie in...
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Das Über-Leben der Dinge. Ansätze einer materialen Gedächtnistheorie in...
59
Das Über-Leben der Dinge. Ansätze einer materialen Gedächtnistheorie in Postkonfliktgesellschaften
Valentin Rauer
O. Dimbath, M. Heinlein (Hrsg.), Die Sozialität des Erinnerns, Soziales Gedächtnis, Erinnern und Vergessen – Memory Studies, DOI 10.1007/978-3-658-03470-2_4, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
V. Rauer ()Frankfurt am Main, DeutschlandE-Mail: [email protected]
4
Nach dem Ende gewaltsamer Konflikte stehen die betroffenen Konfliktparteien vor der Herausforderung, die traumatische Erinnerung der Überlebenden in die neue soziale Ordnung zu integrieren, ohne dass diese Erinnerung den Konflikt wieder aufleben lässt. Über die Formen des Erinnerns und Vergessenes in solchen Post-konfliktgesellschaften ist viel geschrieben worden. Die soziologische Gedächtnis-forschung hat dabei insbesondere die Legitimität der Akteure in den Blick genom-men (Alexander et al. 2006). Diese akteurszentrierten Ansätze sind nicht falsch, greifen jedoch zu kurz. Auch materiale Träger vergangener Konflikte ‚überleben‘ den Konflikt und nehmen anschließend eine besondere erinnerungspragmatische Position ein. Ihre bloße Präsenz lässt sich nicht leugnen. Ihr ‚Material‘ verlangt nach einer Auseinandersetzung. Die überlebenden Materialien und Dinge werden entweder von der kollektiven Erinnerungspraxis ausgeschlossen, oder aber selbst zu einem aktiven bedeutungskonstitutiven Teil. Die theoretischen Strukturmuster solcher In- und Exklusionsweisen von Materialien und Dingen aus der öffentlichen Erinnerung werden in diesem Beitrag analysiert. Ziel ist es, den systematischen Ort des Materiellen innerhalb einer soziologischen Gedächtnistheorie auszuloten und mit Blick auf das Gedächtnisdilemma von Postkonfliktgesellschaften zu plausibi-lisieren.
Zum kollektiven Gedächtnis und zur Erinnerung in Postkonfliktgesellschaf-ten existieren inzwischen zahlreiche Studien und Einzelfallanalysen unterschied-licher disziplinärer Provenienz: Vertreten sind die Literatur- und Kulturwissen-schaften (Assmann 2006; Assmann 1992), die Psychologie (Kühner 2011; Welzer 2001, 2005) die Geschichte und Politologie (Cornelißen et al. 2003; Daase 2010; Frei 1996; Heinrich und Kohlstruck 2008) sowie die Soziologie und Ethnolo-gie (Connerton 1996; Dimbath und Wehling 2011; Halbwachs 1985, 2006). Die
60 V. Rauer
soziologischen Ansätze differenzieren sich inzwischen in wissenssoziologisch 2006 konstruktivistische (Berek 2009; Sebald und Weyand 2011; Wetzel 2011; Zifonun 2011), systemtheoretische (Dimbath 2011; Esposito 2002) und habituelle und pra-xistheoretische Zugangsweisen (Eder und Spohn 2005; Wehling 2011) sowie ein Theorievergleich zwischen System und Akteur-Netzwerk-Theorie (Schmitt 2009). Zudem finden sich performanz- und akteurszentrierte Ansätze, die beispielswei-se ein Täter- und Opfergedächtnis von einem Helden- und Gefallenengedenken unterscheiden (u. a. Assmann 2006; Buser und Rauer 2004; Giesen 2004; Heinlein 2011; Olick 2007; Rauer 2006; Wodak 1990). Ohne mit dieser Auflistung den An-spruch auf Vollständigkeit zu erheben, lässt sich feststellen, dass sich bisher kaum soziologische Ansätze finden lassen, die explizit auch die materielle Beschaffenheit des Postkonfliktgedächtnisses theoretisieren.
Die folgenden theoretischen Überlegungen kombinieren Ansätze der Mediolo-gie (Hartmann 2003) und der Akteur-Netzwerk-Theorie (Callon und Latour 2006; Latour 2006a, b, 2010) sowie Sprech- und Bildakttheorie (Austin 1976; Bredekamp 2010). Die kommunikations- und handlungstheoretische Grundannahme besagt, dass menschliche Akteure in modernen technisierten Gesellschaften stets über materielle Transaktions- und Übersetzungsketten vermittelt handeln. Es gibt nicht den Akteur, sondern nur ein in mediale Transaktionsketten eingebundenes Akteur-Netzwerk. Der Fokus richtet sich also nicht nur auf die inhaltliche Dimension von sozialen Handlungen und Kommunikationsakten, sondern auf die materiellen Grundlagen ihrer medialen Transformation.
Der Beitrag gliedert sich in fünf Abschnitte. Zunächst wird kurz der Forschungs-stand rekapituliert. Zweitens werden die handlungstheoretischen Grundannahmen kurz umrissen, um darauf aufbauend, drittens, die vorhandenen Ansätze einer ma-teriellen Gedächtnistheorie erläutern zu können. Der vierte Abschnitt enthält eine systematische Weiterführung dieses Ansatzes und plausibilisiert die Systematik an-hand von Fallbeispielen. Das abschließende Fazit verallgemeinert die Systematik zu einer materiellen Gedächtnistheorie von Postkonfliktgesellschaften.
4.1 Das Materielle in Ansätzen aktueller Gedächtnisforschung
In den aktuellen Ansätzen zum sozialen und kulturellen Gedächtnis wird stets die grundlegende Bedeutung von materiellen und medialen Gedächtnisformen betont. Beispielsweise besteht der von Jan und Aleida Assmann ausformulierte Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis in einer Medialisierung der Er-innerungen (Assmann 2006; Assmann 1992). Wenn die letzten Zeitzeugen eines Ereignisses gestorben sind, das heißt nach etwa 80 Jahren, endet das kommuni-
614 Das Über-Leben der Dinge
kative Gedächtnis. Fortan berichten nicht mehr die Personen selbst von dem Er-eignis, sondern Speichermedien wie Texte, Bilder, Tonbänder. Aus ‚miteinander‘ über die Vergangenheit ‚kommunizierenden Menschen‘ werden ‚Bücher lesende Menschen‘. Die soziale Transaktionssituation des kommunikativen Gedächtnisses reicht von ‚Mensch zu Mensch‘, die des kulturellen Gedächtnisses von ‚Mensch zu Buch‘, ‚Mensch zu Bild‘ oder ‚Mensch zu Tonband‘.1
Für das Gedächtnisdilemma in Postkonfliktgesellschaften stellt sich die Frage nach dem materialen Gedächtnisträgern jedoch unmittelbar mit dem Ende der Konflikte. Was geschieht mit den Waffen der unterlegenen Partei, was mit dem Gefängnissen, werden sie, wie beispielsweise im Falle des irakischen Gefängnisses von Abu Ghraib auch von der siegreichen Partei als politisches Gefängnis, in die-sem Fall von den Amerikanern genutzt? Die Auseinandersetzung um das materiel-le Gedächtnis eines Konfliktes beginnt also nicht erst nach eine Zeitspanne von 80 Jahren, sondern unmittelbar mit dem Ende der Gewalt.
Eine weiteres die materiellen Grundlagen des Gedächtnisses einbeziehendes Konzept sind die „Erinnerungsorte“, die „Lieux de Mémoire“ (Nora 1998). In der viel zitierten Definition begreift Pierre Nora die Forschung um Erinnerungsorte als: „eine in die Tiefe gehende Analyse der ‚Orte‘ […], in denen sich das Gedächtnis der Nation Frankreich in besonderem Maße kondensiert, verkörpert oder kristalli-siert hat. Das konnten simple Gedenkstätten sein wie die Kriegerdenkmäler in den Dörfern oder […] Rituale, Texte die neues schufen und eine Tradition begründeten wie die der Erklärung der Menschenrechte […]“ (Nora 1998, S. 7).
In der Folgezeit regte dieses raummetaphorische Gedächtniskonzept zahlreiche Folgeprojekte an (Csaky und Stachel 2001; François und Schulze 2005; Henning-sen 2009; Markschies 2010; Robbe 2009; Sabrow 2009; Weber 2011). Beispielswei-se finden sich im Falle der „Deutschen Erinnerungsorte“ Orte wie „Auschwitz“ neben dem „Bürgerlichen Gesetzbuch“, dem „Heil“, der „D-Mark“, dem „Kniefall“, der „Bundesliga“ und der „Nationalhymne“ (François und Schulze 2005, S. 8).2 Der
1 In allgemeinen gedächtnistheoretischen Ansätzen wie dem „Kulturellen Gedächtnis“ von Jan Assmann wird von vier Elementen eines als das „Gedächtnis der Dinge“ (Assmann 1992, S. 20) bezeichnet. Anschließend werden die Dinge eher nur beiläufig in die Systematik mit einbezogen (ebd., S. 21). Zudem werden nur die Dinge für die Gedächtnistheorie mit einbe-zogen, die, so heißt es, „nicht nur auf einen Zweck, sondern auf einen Sinn verweisen: Sym-bole, Ikone, Repräsentation wie etwa Denksteine, Grabmale, Tempel, Idole etc.“ (ebd.). Diese Konzentration auf materielle Sinnträger als konstitutiv für eine Gedächtnistheorie schränkt den Fokus für eine materielle soziologische Handlungstheorie vorab zu sehr ein.2 Ein wenig erinnert die Taxonomie „Deutscher Erinnerungsorte“ an das Vorwort in Mi-chel Foucaults „Ordnung der Dinge“, in der er eine Typologie aus der Chinesischen Enzyk-lopädie zitiert. Typisiert werden „a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese
62 V. Rauer
Ortsbegriff ist offenbar nicht materiell – im Sinne von raumgreifend – gemeint, sondern als Metapher im Sinne kognitiver Verortungen und Positionierungen. Ein solcher dematerialisierter Raumbegriff ist ubiquitär verwendbar. Sein hohes Anregungspotential demonstriert die Anzahl der Nachfolgeprojekte. Soziologisch betrachtet, drängt sich allerdings der Eindruck eines catch all and say nothing Kon-zepts auf. Der hohe Verallgemeinerungsgrad solcher Konzepte ist nicht einem ho-hen Abstraktionsgrad oder universaler Gesetzmäßigkeit geschuldet, sondern ihrer rein metaphorischen Gebrauchsweise. Bei genauerer Hinsicht stellt sich heraus, dass der Ortsbegriff also eher als Akt des menschlichen Bewusstseins – als kogniti-ver Verortungsprozess – definiert ist. Was als Erinnerung bleibt und was vergessen wird, ist vom menschlichen Bewusstsein und diskursiven Konstruktionsprozessen abhängig. Materielle räumliche Zeugnisse der Vergangenheit können dabei eine Rolle spielen, müssen es aber nicht.
Schließlich finden sich Ansätze zur Analyse von Postkonfliktgesellschaften, die im Gegensatz zu den beiden bisher diskutierten Ansätzen dem klassisch soziolo-gischen, subjektiv handelnden Akteur verpflichtet sind. Orientiert an Max Webers Konzept des subjektiven Sinns nehmen diese Studien die maßgeblichen individu-ellen und kollektiven Vergessens- und Erinnerungsakteure in den Blick. Differen-zieren lassen sich Akteure einerseits als Helden und Gefallene und andererseits als Täter und Opfer (Giesen 2004). Beispielsweise weisen ehemalige Täternationen wie Deutschland, Japan oder die Türkei zum Teil homologe Erinnerungs- und Verges-sensmuster entlang der Unterscheidung ‚Täter/Opfer‘ auf (Ischida 2003; Tsutsui 2004). Diese Muster unterscheiden sich von der Erinnerung der triumphalen Sie-gernationen, die ihre Akteure als Helden und Gefallen erinnert (Tab. 4.1). Ehema-lige Siegerländer erinnern sich selektiv an die eigenen heroischen Handlungen und neigen zum Vergessen so genannter ‚Kollateralschäden‘ und eigener Gräueltaten.
Entscheidendes Unterscheidungskriterium ist die jeweils legitime Geltung der ausgeübten Gewalt. Im Falle von traumatischen Konflikten gilt in der Öffentlich-keit die ausgeübte Gewalt als illegitim, daher erinnert man keine Helden und Ge-
Gruppierung gehörige, i) die sich wie Tolle gebärden, k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, l) usw., m) die den Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weiten wie Fliegen aussehen.“ (Foucault 1974, S. 17).
Tab. 4.1 Erinnern in Postkonfliktgesellschaften (modifiziert nach Giesen 2004)Illegitime Gewalt Legitime Gewalt
Subjekte Täter HeldenObjekte Opfer Gefallene
634 Das Über-Leben der Dinge
fallene, sondern Täter und Opfer. Das triumphale Erinnern repräsentiert die Ge-waltereignisse von Revolutionen und Kriegen als Befreiungstat, die traumatische Erinnerung repräsentiert die Ereignisse als kollektives Verbrechen. Triumphalisti-sche Erinnerung neigt dazu, die Opfer und Täter illegitimer Gewalt auf der eigenen Seite zu vergessen, traumatische Erinnerung neigt hingegen dazu, entweder das gesamte Ereignis nachhaltig zu leugnen wie im Falle von Armenien (Bayraktar und Seibel 2004) oder, wie im deutschen, italienischen und japanischen Fall (Corneli-ßen et al. 2003), einerseits selektiv und erst nach Jahrzehnten partielle Ereignisse zu erinnern und andere Aspekte nachhaltig auszublenden. Eine solche an Max We-bers Akteurs- und Handlungstheorie anknüpfende Gedächtnistypologie hat ihren Erklärungswert vor allem mit Blick auf die Frage nach dem Erinnerungswert von legitimer und illegitimer Gewalt. Die Frage nach dem Umgang mit den materiellen Gedächtnisbeständen klammert sie jedoch aus.
Insgesamt zeigen die drei Ansätze, dass materielle Formen des Gedächtnisses in einem soziologischen Sinne nicht systematisch berücksichtigt werden. Unbeachtet bleibt eine theoretisch systematische Bestimmung des Materiellen in Postkonflikt-gesellschaften.
4.2 Das Materielle im Rahmen handlungstheoretischer Grundannahmen
Die Überlebenden von Kriegen und gewaltsamen Konflikten sind umringt von Dingen, die während des Konfliktes das soziale Leben prägten. Waffen, Schutz-mauern, Bunker und Ruinen etc. zeugen von einem vergangenen Funktionszusam-menhang. Die Präsenz von Waffen erinnert daran, dass sich das Gewaltmonopol auf neue soziale Trägergruppen verschoben hat.
Die soziologischen Arbeiten im Umfeld der Akteur-Netzwerk-Theorie und der Science and Technology Studies befassen sich mit der sozialen Logik solcher Un-mittelbarkeiten und medialen Übersetzungsketten. Eine Kernthese besagt, dass im Zuge der Übersetzung sich je nach medialer Gattung und materieller Stabilisie-rung auch das Übertragene, das heißt der kommunikative Sinngehalt, verändert. Vergangenes wird in den jeweiligen Gegenwarten je übersetzt und dabei je nach materiellem Stabilisierungsrad mehr oder weniger modifiziert. In diesem Trans-missionsprozess sind also nicht nur die sinnhaften Rahmungen der beteiligten menschlichen Akteure maßgeblich, sondern auch die medialen Übermittler (Espo-sito 2002; Sebald und Weyand 2011, S. 182 ff.) und die materielle Dauerhaftigkeit des Übermittelten (Goody und Watt 1986). Neben den Intentionen und Werten der menschlichen Akteure ist das Erinnern und Vergessen durch die Stabilitäten medialer Reproduktionstechniken und materialer Artefakte geprägt.
64 V. Rauer
Anstatt den Gegenstand der Soziologie auf das sinnhafte Handeln von mensch-lichen Individuen als kleinste Einheit der Analyse zu reduzieren, erweitert die Ak-teur-Netzwerk-Theorie den Fokus auch auf diejenigen Bestandteile sozialer Inter-aktionssituationen, die durch materielle Objekte, Instrumente und Technologien konstituiert werden. Neben Intersubjektivität gerät auch Interobjektivität in den Blick (Rauer 2012). Der klassische Begriff des sozialen Handelns als subjektiver Sinn (Weber 1980, S. 1 f.), wird um die Dimension des objektivierten Sinns er-weitert. Soziales Handeln beginnt nicht erst dann, wenn Akteure ihren subjekti-ven Sinn am Handeln Anderer orientieren, sondern bereits dann, wenn Akteure „jemanden dazu bringen etwas zu tun“ (Latour 2010, S. 102). Ob dieser Effekt von einem intersubjektiv sinnhaft handelnden menschlichen Akteur oder von einer interobjektiv explodierenden Tretmine verursacht wird, ist für ihre Partizipation an sozialer Ordnungsbildung kein Ausschlusskriterium. Auch Tretminen bringen Akteure dazu, bestimmte Dinge zu tun und andere zu unterlassen. In den Wäldern Kambodschas nutzen einige Dörfer die Tretminen zur Verteidigung ihrer Felder gegen Eigentumsansprüche anderer. Nur die Dorfbewohner wissen, wo exakt die Minen liegen, die Eigentümer der Felder nicht. Soziale Ordnungsbildung baut sich also nicht nur über subjektiven Sinn, sondern auch über materielle Akteure, auch ‚Aktanten‘ genannt, auf. Der soziale Akteursstatus ist mit dieser Definition nicht mehr a priori auf menschliche Akteure beschränkt. Die moderne Gesellschaft hat keine Akteure mehr „denen feste Umrisse zugeschrieben werden könnten“ (Latour 2006b, S. 375). Was den Status eines Akteurs annehmen kann und was nicht, wird vielmehr durch die jeweilige materielle Transaktionskette in der sozialen Interak-tionssituation stets neu bestimmt (Laux 2011).
Mit einem solchen, um die materielle Dimension erweiterten Handlungs-begriff vergrößert sich der Forschungsgegenstand der Soziologie erheblich. Eine Soziologie, die sich nur auf die handelnden menschlichen Individuen beschränke, könne nur in Primatengesellschaften betrieben werden (Callon und Latour 2006, S. 79–84). Für moderne technologisch vermittelte Gesellschaften ist diese alte So-ziologie hinfällig.3 In modernen Zivilisationen interagieren Menschen mit ver-schlossenen Türen, mit Schlüsseln zum Öffnen oder mit Computern und Telefo-
3 Dieser erweiterte Handlungsbegriff wurde vielfach dafür kritisiert, Objekten fälschlicher Weise einen autonomen Handlungsstatus zurechnen. Technische Objekte seien aber stets vom Menschen gemacht und damit lediglich abgeleitete Akteure zweiter Ordnung (Linde-mann 2011). Die kleinste analytische Einheit der Soziologie bleibe daher der menschliche Akteur. Dieser Kritik wird wiederum entgegnet, dass der Akteursstatus nicht a priori auf den Menschen festgelegt wurde; dies bedeutet nicht, dass der Mensch einer der entscheidenden Akteure ist, es finden sich lediglich zunehmend auch andere, die soziale Ordnung konstituie-rende Akteure, deren Umrisse stets empirisch bestimmt werden müssen (Laux 2011).
654 Das Über-Leben der Dinge
nen. Die sozialen Akteure bestehen also nicht nur wie in der Pavian-Gesellschaft aus interagierenden Körpern mit festen Körpergrenzen, sondern aus technisch vermittelten Übertragungsketten, deren Grenzen stets variieren, oder wie es an anderen Stellen auch heißt – deren „Netzwerke“ (Callon und Latour 2006, S. 78) – stets Verbindungen knüpfen oder trennen (Schmitt 2009). Eingebunden in Netz-werke und Transaktionsketten ist der auf seine körperliche Interaktion reduzier-te menschliche Akteur nicht mehr das a priori sozialwissenschaftlicher Analysen. Zu analysieren sind daher nicht nur die Werte und das Wissen der menschlichen Akteure, sondern materielle Transmissionen, in denen die Werte und das Wissen technisch und medial erzeugt, übersetzt und vervielfältigt werden.
Welche Konsequenzen ein solches Akteursverständnis für eine soziologische Gedächtnistheorie von Postkonfliktgesellschaften hat, ist bisher eine offene Frage.
4.3 Das materielle Gedächtnisprogramm
Die bloße Beobachtung, dass mediale Techniken wie Druck-, Film- oder Digital-technologien stets auch Gedächtnisfunktionen wahrnehmen, ist so richtig wie tri-vial. Bereits der Begriff ‚Archiv‘ oder der Begriff ‚Speicher‘ bezieht sich explizit auf eine dieser Erinnerungsfunktionen. Weniger trivial ist die Beobachtung, dass materielle Objekte als Aktanten, das heißt als Quasi-Subjekte eine Gedächtnis-funktion wahrnehmen können. Mit einem solchen handlungstheoretischen Ma-terialitätsbegriff arbeiten in der Regel die kulturanthropologischen Ansätze, wenn sie von Prozessen der „Verstetigung durch Materialisierung“ (Köstlin 2006, S. 14) ausgehen. Schon im 18. Jahrhundert wurde diese Definition einer materiellen Er-innerungspraxis formuliert, so heißt es beispielsweise in einem Zitat aus dem Jahre 1752: „Denckmahl ist ein Ding, welches die Kinder veranlasset, ihre Eltern nach der Ursach und Bedeutung zu fragen“ (zit. nach ebd.).4 Handlungstheoretisch for-muliert, heißt dieser Satz, dass ein Denkmal die Funktion hat, Akteure ‚dazu zu bringen‘, andere Akteure an die Vergangenheit zu erinnern.
Soziologisch weiterführend ist ein solcher materieller Gedächtnisansatz bereits nahezu klassisch in dem Essayband „Der Berliner Schlüssel“ von Bruno Latour angedacht worden (vgl. dazu Dimbath und Wehling 2011, S. 16; Schmitt 2009, S. 196 ff.). Latour beschreibt, wie mithilfe eines materiellen Objektes Hotelgäs-te dazu „gebracht werden“, sich daran zu erinnern, bei ihrer Abreise den Hotel-
4 Der vollständige Verweis auf die Quellenangabe lautet: „Chladenius, Johann Martin: Allge-meine Geschichtswissenschaft (Leipzig 1952, S. 84). Zit nach Alings, Reinhard: Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal Zum Verhältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871–1918 (Berlin 1996, S. 3 f.)“.
66 V. Rauer
schlüssel an der Rezeption zurückzugeben. In dem Text findet sich ein Schema des „Erinnerungsprogramms“ (Latour 1996, S. 57). Die graphische Darstellung ist hier stark modifiziert wiedergeben (Graphik 2). Dargestellt ist ein materielles Ge-dächtnisprogramm, welches zum Ziel hat, die „Erinnerung der Hotelgäste an die Schlüsselabgabe“ zu verwirklichen. Auf der vertikalen Achse des Schemas finden sich die Objekte, Texte und Sprechakte zur Verwirklichung dieses Programms. Auf der horizontalen Achse ist das Kollektiv der Gäste dargestellt, das sich in diejenigen differenziert, die vergessen, und diejenigen, die erinnern. Mit jedem zusätzlichen Objekt, Text oder Sprechakt, der eingesetzt wird, vergrößert sich die Gruppe der sich Erinnernden bzw. verkleinert sich die Gruppe der Vergessenden.
Die effizienteste Weise, die Hotelgäste an die Schlüsselabgabe zu erinnern, ist der materiell raumgreifende Schlüsselanhänger. Die pure Präsenz, das Gewicht und das Volumen verhindert es, den Schlüssel in einer Tasche unachtsam liegen zu lassen. Damit übt das raumgreifende Volumen des Anhängers einen zwanglosen Zwang zur Erinnerung aus. Dieser zwanglose Zwang ist ein funktionales Äquiva-lent zu klassischen Sprechakten bzw. zu Aufforderungen wie beispielsweise: ‚Bitte denken Sie an die Schlüsselrückgabe‘. Der Sprechakt muss kognitiv verstanden wer-den, das raumgreifende Volumen des Schlüsselanhängers wird wahrnehmend rea-lisiert. Dies mag auch seine höhere Effizienz in dieser Transaktionskette erklären.
Mit dieser Unterscheidung in verschiedene kommunikative Gattungen, Sprech-akte oder raumgreifende Objekte ist ein eine graduelle Differenz von Kommunika-tionsakten, wie dem performativen „Sprechakt“ (Austin 1976) und dem „Bildakt“ (Bredekamp 2010) angesprochen. Die Terminologie des ‚Sprech- oder Bildakts‘ so-wie in diesem Fall des Handelns von Objekten verweist auf die jeweilige Medialität (Debray 2003), mit der ein ‚Akt‘, das heißt eine ‚Handlung‘ vermittelt wird. Wenn die Handlung qua Sprache vollzogen wird – wie beispielsweise mit dem Satz: „Hier-mit erkläre ich euch zu Mann und Frau“ – so handelt es sich um einen Sprechakt. Wenn eine Handlung mit einem Bildzeigen vermittelt wird – beispielsweise als Be-weismittel vor Gericht – dann ist es ein Bildakt, und wenn ein dinghaftes Objekt als Kommunikationsmittel eingesetzt wird, dann ist es ein ‚Materialakt‘.
Die Transaktionskette eines materiellen Gedächtnisses besteht also aus zwei Po-len: An einem Pol befindet sich der Sprechakt, am anderen Pol der Materialakt (Abb. 4.1).
Zwischen diesen beiden Extremen sind viele weitere Zwischenformen angesie-delt, die mit jeweils unterschiedlichen materiellen oder semiotischen Vermittlern kommunizieren. So kann ein mündlicher Sprechakt durch einen Aufkleber oder ein Schild an der Rezeption materialisiert und damit verstetigt werden. In der So-ziolinguistik und Robotik wird dies allgemein auch als situated discourse bezeich-net (Roy 2005). Latour nennt diese jeweiligen Ausprägungen auch den „Stabilitäts-grad“ (Latour 2006a, S. 209 f.) der Transaktionskette.
674 Das Über-Leben der Dinge
Auf dem instabilsten Pol ist der mündliche Sprechakt situiert, er muss stets bei jedem Gast wiederholt werden. Der als Aufkleber an eine Tür situierte Text ist be-reits stabiler. Die Transaktion dieses situierten Texts endet immer dann, wenn er in einer Sprache verfasst ist, die ein Gast nicht versteht. Am anderen Pol der materi-ellen Verstetigungen befindet sich der Materialakt des schwergewichtigen Schlüs-selanhängers. Seine bloße Masse ‚zwingt‘ den Träger, sich zu erinnern, ohne einen eigenen kognitiven Verstehensprozess vorauszusetzen. Doch auch der Schlüsselan-hänger ließe sich durch weitere Assoziationen und Innovation weiter stabilisieren.
Die beiden Pole, die hier als ‚Sprechakt‘ und ‚Materialakt‘ spezifiziert werden, nennt Latour „Mittler“ und „Zwischenglieder“. Damit unterscheidet er die Trans-aktionsschritte mit Blick auf ihre jeweiligen materiellen Ausprägungen und dem damit einhergehenden transformativen Potential: „Mittler übersetzen, entstellen, modifizieren und transformieren die Bedeutung oder die Elemente, die sie über-mitteln sollen“ (Latour 2010, S. 70). Zwischenglieder bezeichnen hingegen etwas, „das als Bedeutung oder Kraft ohne Transformation transportiert“ (ebd.). Den Pol, der viele Interpretations- und Transformationspotentiale enthält, in diesem Bei-spiel der ‚Sprechakt‘, wäre nach dieser Terminologie also ein Mittler. Der Pol, der kaum Interpretations- Modifikationsmöglichkeiten zulässt, sondern qua materialer Präsenz zwingend kommuniziert, wie der Schlüsselanhänger, wäre ein Zwischen-
Abb. 4.1 Schema nach Bruno Latour 1996, S. 57; Zahlreiche Ergänzungen und Modifikati-onen: d. Verf
68 V. Rauer
glied. Diese Unterscheidung in die beiden Pole ist als Kontinuum zu denken, nicht als wechselseitiger Ausschluss, das heißt je nach spezifischer Beschaffenheit variiert der jeweilige Mittler- und Zwischengliedanteil. (Latour 1996, S. 59 f.). In dem Fall dieser Transaktionskette gilt, dass je höher der materiale Zwischengliedanteil des Erinnerungsprogramms ausgeprägt ist, desto größer ist die Anzahl der Gäste, die sich an die Abgabe des Schlüssels erinnern. Dementsprechend ist in diesem Fall auch der Interpretationsspielraum des jeweiligen Transaktionsschrittes geringer ausgeprägt.
Situationssoziologisch gewendet, ermöglicht diese Unterscheidung von Mitt-lern und Zwischengliedern den ansonsten theoretisch meist nicht näher definier-ten Kontext systematisch in die Interaktionstheorie einzubeziehen. Die materiellen Zwischenglieder und Mittler sind nicht einfach der Kontext, der aus der Hand-lungstheorie ausgeklammert wird, vielmehr wird der vermeintliche Kontext zum Text, das heißt zum konstitutiven Bestandteil der Kommunikation und Interaktion selbst. Wie der Akteur variieren auch die Umrisse des Kontexts in jeder Transakti-onskette. Nicht nur der subjektive Sinn oder das Bewusstsein der Akteure entschei-den also über das Vergessen und Erinnern, sondern die mediale Beschaffenheit der Mittler und Zwischenglieder.
4.4 Das Gedächtnis als materielle Transaktionskette
Postkonfliktgesellschaften sind keine Hotels. Das Gedächtnisprogramm eines Ho-tels bezieht sich auf eine überschaubare alltägliche Mikrosituation. Die antagonisti-schen Gedächtnisprogramme in Postkonfliktgesellschaften gestalten sich ungleich komplexer. Es bedarf daher einiger theoretischer Zwischenschritte. Entscheidend für die Formen des Erinnerns ist die Art und Weise der Konfliktbeendigung. Ob das Ende gewaltsam herbeigeführt wurde, durch Verhandlungen und Verständi-gung prägt die Ausgestaltung des Gedächtnisses entscheidend mit. Schon sehr früh haben Aleida und Jan Assmann (1990) angemahnt, dass kollektive Gedächtnisse stets heterogen, antagonistisch und konflikthaft sind. Als Ergänzung für diese feh-lende Dimension bietet sich der Bezug auf Georg Simmels „Der Streit“ an (vgl. dazu auch Rauer 2007; Simmel 1992, S. 349 ff.; Wetzel 2011, S. S. 50).
Simmel unterscheidet drei Modi der Konfliktbeendigung: erstens durch Sieg und Niederlage, zweitens durch Kompromissbildung sowie drittens durch Ver-söhnung. Konflikte enden in Folge einer Machtasymmetrie mit einem Sieg der einen Partei und einer Niederlage der gegnerischen Partei. Sie können aber auch im Zuge eines Verhandlungsprozesses als Kompromissbildung enden. Kompromis-se operieren über wechselseitige Nutzenerwägungen. Schließlich enden Konflikte
694 Das Über-Leben der Dinge
auch ohne ersichtlichen Grund – mit einem Mal haben sich die Gründe des Streits scheinbar in Luft aufgelöst. Dieser Modus ist gemeint, wenn von Versöhnung die Rede ist (Simmel 1992, S. 284–382). Zusammenfassend formuliert enden Konflikte also entweder durch Sieg und Niederlage infolge von Machtasymmetrien, durch Kompromissbildung im Zuge wechselseitiger Nutzenkalkulation und durch Ver-söhnung qua kontingenten Verschwindens der Streitgründe. In Postkonfliktgesell-schaften hat das Gedächtnis also nicht die Aufgabe, lediglich an eine Schlüssel-abgabe zu erinnern, sondern an einen Konflikt, der entweder durch Siege, durch Kompromisse oder durch Versöhnung beendet wurde. Siege und Niederlagen hinterlassen andere materielle Spuren im Gedächtnis in Postkonfliktgesellschaften als Kompromissbildungen oder Versöhnungsakte. Im Folgenden sollen nun diese jeweiligen Spuren selektiver Fallbeispiele illustriert und systematisiert werden.
In Ho Chi Minh Stadt, der ehemaligen Hauptstadt von Südvietnam, wurde vor dem ehemaligen Sitz des südvietnamesischen Staatsoberhauptes ein Panzer aufge-stellt, der sein Kanonenrohr auf das Gebäude richtet. Der dort platziert Panzer erin-nert an ein für den Vietnamkrieg ikonisch gewordenes Foto, das den ersten Panzer der nordvietnamesische Armee zeigt, wie er auf das Gelände des Regierungssitzes fährt. Seit dem Ereignis, dem siegreichen Einmarsch der Vietcong in das damalige Saigon, sind über dreißig Jahre vergangen. Der erste Panzer, der damals die Zäune des Geländes durchbrach, steht dort noch immer. Betritt man die Szenerie vor Ort, so wirkt sie für einen kurzen Moment, als ob sie sich in der Gegenwart aktuell voll-ziehe. Zu sehen ist eine eingefrorene Handlung, ein Materialakt. Im Gegensatz zum Sprechakt verstetigt der Materialakt den Modus der Konfliktbeendigung durch seine raumgebundene Präsenz. Die materielle Stabilität des Artefakts artikuliert den Anspruch an ein dauerhaftes Gewaltmonopol. Die materielle Persistenz des Panzers vergegenwärtigt den Übergangsmoment eines gesellschaftlichen Gewalt-monopols und ‚friert‘ diesen Moment ein. Die eine Gruppe, in diesem Beispiel die Nordvietnamesen, erinnert der Materialakt an ihren Sieg, die andere Gruppe, die Südvietnamesen, an ihre Niederlage.
Das transformierte Gewaltmonopol vermittelt sich über einen Aktanten, der damals Menschen dazu gebracht hat, sich der Macht zu beugen und sie heute stets an diese Beugung erinnert. Ob dies Sieg oder Niederlage bedeutet, mag für die einzelnen sich erinnernden Individuen bedeutsam sein, auf der kollektiven Ge-dächtnisebene zählt allein die Aussage, dass sich die sozialen Machtverhältnisse ge-wandelt haben. Macht und Gewaltmonopole in sprachliche Begriffe zu übertragen ist zwar möglich, die Aktanten dieses Gewaltmonopols können jedoch auch für sich selbst ‚sprechen‘. Gewalt und Macht ist vor allem materiell durchsetzbar, daher scheint die Erinnerung an ihre Übergänge auch weniger in Sprechakten, sondern in Materialakten zu erfolgen.
70 V. Rauer
Diese Form eines materiellen Gedächtnisses besetzt einen Transaktionsschritt unter einer Vielzahl weiterer mehr oder weniger materiell verstetigter Transakti-onsschritte. Abbildung 4.2 stellt die Position des Materialakts systematisch dar. Der ohne Schrift und Symbolik präsentierte Materialakt nimmt einen der äußersten Pole ein. Ähnliche Materialisierungen des Sieges und der Niederlage finden sich in zahlreichen weiteren Postkonfliktgesellschaften. Man denke nur an die vielen Mi-litärparaden zu nationalen Unabhängigkeitstagen oder die berühmten Siegesfeiern der Alliierten in der Normandie, zu denen historisches Kriegsgerät und aktuelle Waffengattungen einträglich nebeneinander vorgeführt werden (Rauer 2008).
Die nächste Position in der Transaktionskette wird von Quasi-Akteuren voll-zogen, die hier als ‚Dokumentat‘ bezeichnet werden sollen. Diese Wortschöpfung betont die symmetrische Verteilung eines objektivierenden dokumentierenden An-spruches und dem Vollzug dieses Anspruches in medialer Gestalt eines ‚Aktes‘, das heißt eines Handelns. Das dokumentierte Objekt vollzieht als Dokumentat eine ‚Tat‘. Das, was der Sprecher im Sprechakt in der klassischen Performanztheorie ‚tut‘
Abb. 4.2 Gedächtnisprogramm in Postkonfliktgesellschaften
714 Das Über-Leben der Dinge
(vgl. die Beiträge in Alexander et al. 2006), vollzieht das präsentierte Objekt im Do-kumentationsakt. So wie im Bildakt das Bild an die Stelle des Sprechers tritt (Brede-kamp 2010), so tritt im Materialakt das Dokumentierte an die Stelle des Sprechers.
Die bekanntesten Beispiele solcher Dokumentate sind die öffentlichen Öff-nungen von Massengräbern (Ferrándiz und Baer 2008). Berühmt sind in diesem Zusammenhang auch die Dokumentate der Alliierten gegenüber der Deutschen Bevölkerung unmittelbar nach Befreiung der Konzentrationslager (Brink 1998). Die Alliierten fuhren die Dorfbewohner mit Bussen in die Lager und demonstrier-ten die Leichen und andere Spuren der Vernichtungsaktionen. Aktuell lässt sich eine krasse Variante eines Dokumentats in Choeung Ek, dem wichtigsten, der so genannten „Killing Fields“ in Kambodscha besichtigen. Auf so genannten „Killing Fields“ wurden unter dem Roten Khmer in den 1970er Jahren Hunderttausende von Menschen auf grausamste Art und Weise ermordet (Kiernan 2009). Choeung Ek ist der zentrale Mahn- und Gedenkort in der Nähe der Hauptstadt Phnom Pen. Im Jahre 2010 laufen die Besucher über ein Gelände, dessen Boden nach wie vor von sichtbaren menschlichen Knochen übersät ist.5 Einige Massengräber sind ge-öffnet, andere wurden belassen und sind mit einem Absperrband markiert. Eine Gedenkarchitektur wird von einer Gedächtnis-Stupa dominiert. Die Stupa ist ein Turm aus der buddhistischen Gedenk- und Bestattungskultur. In Choeung Ek ist der Innenraum der Stupa nicht wie sonst häufig geschlossen, sondern von außen durch Glaswände einsehbar. Im Inneren wurde jeweils ein Teil der Überreste des Grauens dem Besucher zur Ansicht präsentiert. Geordnet sind die Objekte nach einer spezifischen Taxonomie. Schädel liegen neben Schädeln, Hüftknochen ne-ben Hüftknochen oder Kleidungsstücke neben Kleidungsstücken. Auf Augenhöhe des Besuchers ist die Glaswand der Stupa wie ein offenes ‚Schaufenster‘ geöffnet. Bei genauerem Hinsehen dokumentieren die Schädel auch die Art und Weise des Mordaktes. Begleitende Texte und Schautafeln erläutern, dass auf dem „Killing Field“ Spitzhacken eingesetzt wurden, um ‚Munition zu sparen‘.
Das Erinnerungsarrangement an dem Ort kann hier nicht in seiner notwendi-gen Komplexität umrissen werden. Wesentlich ist in diesem gedächtnistheoreti-schen Zusammenhang lediglich, dass der materielle Anteil an dem Erinnerungsakt – das Dokumentat – von dem vergangenen Gewaltakt nicht erzählt, sondern die materiellen Folgen des Aktes offen darlegt. Im Falle der Dokumentate betrachten die Besucher nicht nur Objekte aus einer vergangenen Zeit, sondern (über-)zeugen sich und (be-)zeugen das vergangene Geschehen. Dokumentate sind somit nicht nur Indiz, ein Hinweis auf die Ereignisse, sondern sie sind selbst ein dauerhaft materialisierter Handlungsvollzug. Sie sagen etwas über die Ereignisse im Vollzug ihrer Präsentation.
5 Vgl. die Bilder auf der Seite: http://de.wikipedia.org/wiki/Choeung_Ek.
72 V. Rauer
Neben Siegen und Niederlagen werden Konflikte auch über Kompromisse be-endet. Für Simmel stellt der Kompromiss die größte zivilisatorische Errungen-schaft dar. Merkwürdiger Weise hat der Kompromiss bis heute jedoch einen ne-gativen Beiklang, völlig zu Unrecht, wie der politische Philosoph Avishai Margalit (2010) argumentiert, denn Kompromisse sind nicht ‚faul‘, wie es oft heiße, sondern zweckrational. Kompromisse befrieden qua wechselseitiger Vorteilsnahme. Ihre Überzeugungskraft resultiert aus der Schaffung einer Win-Win-Situation. Weder triumphaler Sieg oder die traumatische Niederlage beenden den Konflikt, noch ein kontingentes Erlöschen der antagonistischen Begehrlichkeiten, sondern reiner In-teressenausgleich. Kompromisse wirken nicht über Selbstlosigkeit noch über auf-opferungsvolles Heldentum, sondern über einen vertraglich ausgehandelten Nut-zen. Falls das von beiden Parteien begehrte Gut qua natura unteilbar oder unersetz-bar ist, wie beispielsweise ein Territorium oder die Verluste von Menschleben, so werden äquivalente Tauschgüter ermittelt.
Ein solcher Fall des Kompromisshandelns war beispielsweise das so genannte „Luxemburger Abkommen“ zwischen West-Deutschland und Israel aus dem Jahr 1952 (Diner 2003, S. 261–262). Die Adenauer-Regierung wünschte sich eine wei-tere Westintegration und möglichst vollständige Souveränität. Israel stand vor dem Problem, zahlreiche Flüchtlinge und Vertriebene aus Europa integrieren zu müs-sen. Zudem hatte die nationalsozialistische Vertreibungs- und Vernichtungspolitik dafür gesorgt, dass viele Grundstücke und Immobilien in Europa nach dem Zwei-ten Weltkrieg weder Eigentümer noch Erben hatten (ebd.). Die Menschen waren ermordet oder geflohen. Ihren Immobilienbesitz konnten sie nicht mitnehmen und hatten oftmals keine Möglichkeit mehr zum Verkauf. In Westdeutschland, dem Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, war man mit einem Erbe konfrontiert, des-sen Erben nicht überlebt hatten. Zynischer Weise fällt herrenloses Land damit an den Rechtnachfolger, also an das ehemalige Täterland. Dan Diners Ausführungen verdeutlichen die Bedeutung materieller Formen des Gedächtnisses als Konflikt-gegenstand.
Als Lösung des Problems fand man einen Kompromiss. Westdeutschland zahlte über drei Milliarden D-Mark an Israel beziehungsweise an eigens dafür geschaffene jüdische Institutionen und schaffte sich im Gegenzug die Voraussetzung zur wei-teren Westintegration und zur Erlangung der nationalen Souveränitätsrechte. Der in den Medien und Geschichtsbüchern festgehaltene Bildakt dieses gedächtnispo-litischen Kompromisses ist bemerkenswert. Nicht ehemalige Immobilien werden gezeigt, sondern der Vollzug einer Vertragsunterzeichnung.6 Das in der Regel von
6 Auf den Bildern ist oftmals Konrad Adenauer und Moshe Scharett zu sehen, wie sie im Begriff sind, das Luxemburger Abkommen am 10. September 1952 zu unterzeichnen. Vgl.
734 Das Über-Leben der Dinge
den Medien gewählte illustrierende Bild zeigt einen Tauschakt: die beiden Parteien sitzen sich am Tisch gegenüber und unterzeichnen ein Papier. Das Bild zeigt kei-ne Grundstücke, deren Erben vernichtet wurden, sondern Tische und Menschen, die einen Vertrag wechselseitig ausgehandelt haben. Deutschland und Israel haben sich mit dem Luxemburger Abkommen nicht im emphatischen Sinne des Begriffes ‚versöhnt‘. Dies wäre angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten auch gar nicht möglich (vgl. dazu weiterführend: Rauer 2008). Dennoch war man mit den materiellen Spuren des Krieges, dem Überleben der Dinge konfrontiert und fand einen Ausweg, der beiderlei Interessen bediente.
Der Anteil eines Kompromisses qua Tausch findet sich in zahlreichen weite-ren Fällen. Ein berühmtes Beispiel stellt die so genannte „Wahrheits- und Ver-söhnungskommission“ in Südafrika dar (Kaußen 2003). Obwohl der Prozess den Begriff der ‚Versöhnung‘ bemüht, stellte der Modus der Konfliktbeendigung eher einen Kompromiss dar. Weil nahezu der gesamte Polizeiapparat in die Apartheid verstrickt war, gestalteten sich juristische Strafverfolgungen und Verurteilungen der ehemaligen Täter als äußerst unwahrscheinlich. Die Lösung dieses Dilemmas bestand aus einem Tauschakt: Die Täter würden amnestiert werden, wenn sie als Gegenleistung öffentlich die Wahrheit sagten. In diesem Fall wurden also weni-ger materielle Tauschmittel eingesetzt, sondern ‚Wissen um die Vergangenheit‘ ge-gen ‚Straffreiheit der Täter‘. Auf den bildlichen Illustrationen wird dieser Anteil an symbolischen Handlungen repräsentiert. Anders als im Falle des Luxemburger Abkommens, bei dem zumeist eine nüchterne Szenerie des Moments der Vertrags-unterzeichnung zu sehen ist, sehen wir im diesem Fall zumeist Akteure, die dem Geschehen, dem „healing our past“ eine sprichwörtliche ‚Bühne geben‘.7 Der Tau-schakt wird öffentlich vollzogen, nicht vertraglich unterzeichnet. Die Akteure bli-cken sich nicht gegenseitig an, sondern von der Bühne herab auf das unmittelbar anwesende Publikum, das heißt das Publikum erster Ordnung. Diese Szene wird von dem Publikum zweiter Ordnung, den Medienproduzenten, und dem Publikum dritter Ordnung (vgl. zu dieser Unterscheidung: Rauer 2006), den Medienrezipien-ten nicht als reziproker Vertragsakt, sondern als reziproker Bühnenakt visualisiert. Die Transaktionskette verknüpft ehemalige Opfer mit dem Wissen ehemaliger Täter und verbindet deren Erinnerung mit dem Publikum dritter Ordnung, dem öffentlichen Diskurs einer massenmedial vernetzten Gesellschaft. Die Transforma-tion der Sozialbeziehung wird zwar als Wahrheits- und Versöhnungsakt sprachlich
beispielsweise das Foto: DHM, Berlin auf der Seite: http://www.hdg.de/lemo/html/DasGe-teilteDeutschland/JahreDesAufbausInOstUndWest/GegenwaertigeVergangenheit/luxembur-gerAbkommen.html.7 http://qu301southafrica.wordpress.com/2012/02/22/truth-and-reconciliation-commission/&us.
74 V. Rauer
bezeichnet, der Modus der Transaktionskette operiert jedoch immer noch in der Logik des Tausches und Kompromisses.
Die beiden Fallbeispiele zeigen, dass Erinnerungs- und Gedächtnisakte keines-wegs nur aus symbolisch sinnhaften Bedeutungen bestehen, sondern gleicherma-ßen auch aus wechselseitigen nutzenmaximierenden Zielaspirationen. Dabei vari-iert der Anteil der materiellen und der sprachlich symbolischen Transformatoren in der Transaktionskette graduell. In einem Fall wird Souveränität und internationale Anerkennung gegen Restitutionszahlungen getauscht, im anderen Fall Wahrheit gegen Amnestie. Beide Fälle bilden Beispiele für eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften zur erinnerungspolitischen Beendigung von Konflikten.
Der dritte Modus zur Beendigung von Konflikten ist die Versöhnung. Für Sim-mel ist der Versöhnungsakt prekär, da er voraussetzt, dass mit einem Mal die An-tagonismen nicht mehr gelten, obwohl die Ursachen des Streits eigentlich nicht ausgeräumt sind. Statt eines Kompromisses wird aus nicht rational ableitbaren Be-weggründen von den alten Zielvorstellungen abgelassen. Jacques Derrida (2001) spricht analog vom Paradox eines Vergebungs- und Versöhnungsakts. Von Verge-bung und Versöhnung kann nur sinnvoll gesprochen werden, wenn dieser Prozess weder durch Zwang noch durch Nutzenerwägungen vollzogen wird. Wenn jemand zur Versöhnung gezwungen würde, spricht man von Sieg und Niederlage, wenn es sich um Nutzenerwägungen handelt, spricht man von Kompromissen. Simmel argumentiert, dass Versöhnung stets einen irrationalen Charakter habe und nur religiös überzeugend artikulierbar ist (vgl. dazu weiterführend: Rauer 2007). Ver-söhnungskommunikation vollzieht sich in Ritualen und Symboliken um einen transzendenten gemeinsamen Bezugspunkt zu finden. Die Erinnerung an Versöh-nungsprozesse ist daher stets durch einen hohen symbolischen Anteil und einen geringen materiellen Anteil geprägt.8 Oder anders formuliert, im Falle von Ver-söhnungsrhetoriken überwiegt das Erinnern an den symbolischen Akt während begleitende materielle Tauschvorgänge eher dem Vergessen anheimfallen.
Dieser Mechanismus lässt sich beispielsweise bei den klassischen binationalen Versöhnungsritualen zeigen, in der sich zwei Staatsoberhäupter gemeinsam räum-lich anwesend der Öffentlichkeit präsentieren. Die Geschichte solcher Versöh-nungsrituale reicht mindestens bis in das frühe Mittelalter zurück (Althoff 2011). Die jeweiligen Körpersprachen sind entscheidend für die öffentliche Form der Er-innerung, dass sich die ehemalige verfeindete Beziehung nunmehr gewandelt hat. Beispielsweise haben im Zuge der deutsch-französischen Versöhnung Charles de Gaulle und Konrad Adenauer ihre Versöhnungsinszenierung erst mit einer Mili-
8 Vgl. die Unterscheidung in kleine, mittlere und große Transzendenz bei Thomas Luckmann (1985).
754 Das Über-Leben der Dinge
tärparade in Mourmelon am 8. Juli 1962 begonnen.9 Das gemeinsame Paradieren deutschen und französischen Militärs war auch die Demonstration wechselseiti-ger Nutzen angesichts der Machtgleichgewichte im Kalten Krieg und der Frontlage Westdeutschlands zu den Staaten des Warschauer Pakts. Dieser Anteil der Ver-söhnung sollte jedoch kaum in der Erinnerung an das Ereignis eine Rolle spielen. Bildmächtig wurde indes die feierliche Zeremonie in der ehemaligen französischen Krönungskathedrale Frankreichs in Reims am selben Tag. Die Symbol-, Ritual- und Bildersprache erinnerte an eine klassische Trauungszeremonie: Adenauer und de Gaulle standen nebeneinander während sie an der Messe teilnahmen.10 Sogar die Sitzplätze der beiden Staatsoberhäupter artikulierten eine symbolische Rang-folge. In den französischen Medien wurde bemerkt, dass de Gaulle den ehema-ligen Platz des Königs und Adenauer den Platz der Königin einnahm. Vor dem Hintergrund eines patriarchalen Wahrnehmungshorizontes deuteten die Medien die Sitzordnung als Ausdruck einer binationalen Partnerschaft unter französischer Führung (vgl. weiterführend: Rauer 2008).
In den nachfolgenden deutsch-französischen Versöhnungsritualen verschiebt sich der Anteil des rituell symbolischen Anteils sukzessive zugunsten des materi-ellen Anteils. In den 1980iger Jahren besuchen François Mitterrand und Helmut Kohl das ehemalige Schlachtfeld und heutigen Soldatenfriedhof in Verdun. Dort halten sie sich an den Händen und initiieren einen berühmten Bildakt, der Eingang in das offizielle Gedächtnis der Geschichtsbücher fand.11 So wurde kein Kriegsgerät mehr vorgeführt, wie noch in Mourmelon und Reims im Jahre 1962. Allerdings ist sehr wohl ein materieller Bezug durch den dortigen Soldatenfriedhof gegeben, an dem Hunderttausende Gefallene des Ersten Weltkriegs begraben liegen.
Dieser materielle Bezug zu den Toten der Kriege wurde Helmut Kohl dann im Jahre 1985 zum erinnerungspolitischen Verhängnis, als er ein ähnliches Versöh-nungsritual mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan in Bitburg durchführte. Die Tatsache, dass auf dem Bitburger Soldatenfriedhof auch ehemalige Angehörige der Waffen-SS lagen, sorgte für einen internationalen Me-dienskandal. Es wurde unterstellt, der Versöhnungsakt habe für die deutsche Seite Vorteile, indem sie von den Verbrechen der Waffen-SS ablenke. Es war also die ma-terielle Präsenz der ehemaligen Täter an diesem Ort, die ein gemeinsames versöh-nendes Gedenken unglaubwürdig erscheinen ließ. Ein ikonisches Bild generierte dieser Eklat nicht (vgl. hierzu weiterführend: Rauer 2008).
9 Dies war weniger eine Versöhnungsbotschaft als ein kommunikativer Akt in Richtung der Warschauer Pakt Staaten (Rauer 2008).10 Vgl. für Bilder den Artikel auf www.faz.net am 8. Juli 2012.11 http://iconicphotos.wordpress.com/2010/05/29/mitterrand-and-kohl-at-verdun/.
76 V. Rauer
Die Wirkung materieller Gedächtnisanteile lässt sich auch an einem weiteren Versöhnungsakt beobachten. Als am 7. Dezember 1970 Willy Brandt die Warschau-er Verträge unterzeichnete, verband er diesen Besuch mit einer Kranzniederlegung im ehemaligen Getto von Warschau. Dort fiel er plötzlich auf die Knie.12 Dieser berühmte Kniefall von Warschau hatte international ein enormes Medienecho (Rauer 2006). Die Tatsache, dass mit Willy Brandt jemand kniete, der sich selbst im Widerstand gegen die Nationalsozialisten engagiert hatte, lies den kollektiven Akt glaubwürdig erscheinen. Brandt kniete nicht aus persönlicher Vorteilsnahme, um sich von einer Tätervergangenheit rein zu waschen, sondern er kniete rein im Namen des Kollektivs, das er politisch vertrat. Er war persönlich selbst ein Opfer der Nationalsozialisten, und kniete dennoch im Namen des Nachfolgerstaates der ehemaligen Täternation.
Brandt berührte damit das von Derrida erwähnte Paradox auf spezifische Wei-se: Vergebung und Versöhnung ist per Definition nur dann überzeugend kommu-nizierbar, wenn es den Anschein hat, dass der Akt bar jeder Nutzenerwägungen einer der beiden Parteien erfolgt. Ehemalige Täter suchen oftmals nur nach Ver-söhnung, um sich von ihren Taten rein zu waschen. Der persönlich widerständige Willy Brandt hatte dies nicht nötig. Als Verfolgter des Dritten Reiches musste er sich nicht von vergangener Schuld symbolisch reinwaschen. Er war selbst ein Op-fer der Täter. Dennoch übersetzte er diese Erinnerung in einen rein symbolischen flüchtigen körperlichen Akt als Stellvertreter der Täter. Durch diese Ambivalenz realisierte er das Paradox performativ glaubwürdig. Inzwischen fanden sich Be-mühungen, dem flüchtigen Gedenkakt selbst wieder materielle Dauer zu verlei-hen. So wurde ein Platz in der Nähe des Ehrenmals des Warschauer Aufstandes im ehemaligen Getto als „Willy-Brandt-Platz“ benannt. Dort findet sich ein Relief als Gedenkstein. Das Relief zeigt den knienden Brandt vor einem Gedenkkranz. Im Hintergrund ist ein siebenarmiger Leuchter dargestellt und ein das Getto symbo-lisierender Stacheldraht.13 Das Relief stabilisiert den rein performativ realisierten Kniefall materiell für die Nachwelt.
4.5 Fazit: Das Integrationspotential von materiellen Gedächtnissen
Nach dem Ende von Kriegen und gewaltsamen Konflikten stellt sich in den be-troffenen Gesellschaften die Frage nach einem integrativen Umgang mit der Vergangenheit. Das Gedächtnis darf die vergangen Ereignisse nicht verfälschen,
12 http://iconicphotos.wordpress.com/2009/05/25/warschauer-kniefall/.13 http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackgroundXXL/a18281/l7/l0/F.html.
774 Das Über-Leben der Dinge
gleichzeitig sollte es die Feindschaften aber auch nicht verlängern. Ein Weg wäre das Vergessen – ein häufig eingeschlagener Weg (Connerton 2009; Dimbath und Wehling 2011; Esposito 2002; Kühner 2011). Je materieller das Gedächtnis jedoch ausgestaltet ist, desto schwieriger ist dieser Weg. Wenn ganze Stadtlandschaften zu Ruinenlandschaften gebombt wurden, wenn ganze Bevölkerungen vernichtet wurden, dann ist das Vergessen kein erfolgsversprechender Weg – von den norma-tiven Implikationen eines solchen Verdrängungsaktes einmal ganz abgesehen. Das öffentliche Gedächtnis steht also stets vor einem Dilemma: einerseits soll die Kon-fliktbeziehung möglichst realitätsnah und historisch korrekt vergegenwärtig wer-den, andererseits soll diese Vergegenwärtigung den Konflikt nicht perpetuieren. Wenn aus Feindorientierung Gemeinwohlorientierung werden soll, so muss das Gedächtnis daran erinnern, ‚wie es war‘, und gleichzeitig muss es daran erinnern, dass es ‚nicht mehr so ist‘. Das Gedächtnis von Postkonfliktgesellschaften muss das richtige Maß zwischen einerseits rekonstruktiven und andererseits transformativen Gedächtnisprogrammen entwickeln – eine prekäre Aufgabe.
Um soziologisch zu erklären, wie Gedächtnisprogramme ihre Wirkung entfal-ten, ist es notwendig den Akteurs- und Handlungsbegriff mit Blick auf die verwen-deten Vermittlungsmedien zu spezifizieren. Es ‚handeln‘ nicht einfach ‚Menschen‘, sondern Handlungen werden über kommunikative Akte medial vermittelt. Solche medial vermittelten kommunikativen Akte können aus sprachlichen Äußerungen bestehen, aus Bildern sowie aus materiellen Objekten, oder, anders formuliert: aus Sprechakten, aus Bildakten oder aus Materialakten. Diese medialen Vermittlungs-gattungen gehen mit unterschiedlichen Stabilitäten und Persistenzen einher. Ein Materialakt ist stabiler als ein jeweils im Moment gesprochener und zugleich ver-flogener Sprechakt. Das Gedächtnis sucht sich also Vermittlungsmedien, mit denen flüchtige Sprechakte materiell stabilisiert werden, sei es auf Fotopapier im Bildakt oder als Relief im Materialakt.
Latour charakterisiert in diesen Transaktionen den Mittler als instabiles Me-dium und die Zwischenglieder als stabiles Medium. Sprechakte wären also der Mittlerseite zuzuordnen, Materialakte der Zwischengliedseite. Bildakte und text-liche Diskurse stellen eine semi-stabile Zwischenform dar. In allen drei medialen Kommunikationsgattungen variiert der relative Anteil an Materialität. Der materi-elle Anteil von Sprechakten ist relativ gering. Dies zeigt sich etwa im Kinderspiel der ‚stillen Post‘. Der anfängliche Sprechakt hat sich nach der Flüsterrunde in eine andere Bedeutung verwandelt, und zwar jeweils abhängig davon, wie präzise der jeweilige Flüsterton artikuliert war. Bei Mittlern spielt also der Freiheitsgrad der medialen Transformation eine entscheidende Rolle. Im Zuge der Übertragung verändert sich die Bedeutung des Übermittelten eher als bei materiell stabilisier-ten Medien. Oder mit Latour formalisierter ausdrückt: Bei Transaktionsketten die
78 V. Rauer
einen hohen Mittleranteil haben, ist die Varianz zwischen Ursache und Wirkung besonders ausgeprägt. Es gilt die Formel: Ursache ≠ Wirkung ≠ Ursache.
Am anderen Pol der materiellen Beschaffenheit wird die Transaktion durch mediale Zwischenglieder vollzogen. Hier ist der materielle Anteil des Übertra-gungsmediums höher als bei Mittlern. Zwischenglieder übertragen wie Glieder einer Kette den ursächlichen Impuls nahezu eins-zu-eins. Die typischen Formen des Zwischengliedgedächtnisses sind Materialakte und Dokumentate. Im Akt des Dokumentats ist der sich Erinnernde nicht mit mittelbaren textlichen Repräsenta-tionen des Vergangenen konfrontiert, sondern mit den unmittelbaren Gegenstän-den, die selbst Teil des Geschehens waren. Die Ursache, mit der Menschen dazu gebracht werden, sich zu erinnern, ist im Falle von unmittelbareren Transaktions-ketten der Wirkung sehr viel näher als im Falle von mittelbaren Transaktionsketten. Materialakte wie Waffen und Dokumentate wie das Öffnen von Massengräbern ah-men die Wirkungs-Ursachen-Relation der Geschehnisse unmittelbarer nach (Tar-de 2009). Formalisiert ausgedrückt gilt im Falle von Zwischengliedern: Ursache = Wirkung = Ursache.
Wichtig ist, dass es sich bei diesen terminologischen Unterscheidungen niemals um absolute Differenzen wechselseitigen Ausschlusses handelt, sondern um gra-duelle Relationen. In der Realität der Transaktionsketten finden sich so gut wie nie nur Mittler oder nur Zwischenglieder, sondern stets Mischformen mit mehr oder weniger großen Anteilen beider Vermittlungsformen. Dieses begriffstheoretische Instrumentarium ist besser in der Lage, Antworten auf Gedächtnisdilemmata von Postkonfliktgesellschaften soziologisch aufzuschlüsseln. Folgende drei Transakti-onsketten lassen sich verallgemeinern: Erstens eine Kette mit hohem Zwischenglie-danteil, zweitens eine Kette mit gemischtem Zwischenglied und Mittleranteil und drittens eine Kette mit hohem Mittleranteil.
Im ersten Fall vermittelt eine Transaktionskette das Vergangene über einen ho-hen Anteil an Materialität. Statt über Mittler in Gestalt von Texten und Symbolen artikuliert sich Gedächtnis über Zwischenglieder in Gestalt von technischen Arte-fakten wie beispielsweise Waffen, deren ‚Schweigen‘ zwar an den Waffenstillstand erinnert, aber auch an den Konflikt selbst. Panzer erinnern daran, dass sich das Ge-waltmonopol geändert hat. Sie erinnern nicht daran, dass sich die ‚Feindhaltung‘ der Akteure ebenfalls wesentlich geändert hat. Im Gegenteil, die Gegenwart von Waffen erinnert eher an das Fortbestehen des Antagonismus, als einen Wandel. Da bei Waffen der Zwischengliedanteil besonders hoch ist, entsprechen die Ursachen eher den Wirkungen, das heißt die erinnernden Waffen imitieren die gewalttätige Einstellung und den Modus einer Konfliktbeendigung durch Sieg und Niederlage.
Im zweiten Fall von Gedächtnisprogrammen ist der materielle Zwischenglied-anteil bereits abgeschwächt. Bei Kompromissen wird nicht mehr die unmittelba-re Gewalt imitiert und qua Waffen daran erinnert, dass sich das Gewaltmonopol
794 Das Über-Leben der Dinge
transformiert hat, sondern es werden Kompensationsmittel eingesetzt. Getauscht wird beispielsweise ‚Geld gegen Souveränität‘ wie im Falle Westdeutschlands und Israels oder ‚Wahrheit gegen Straffreiheit‘ wie im Falle Südafrikas. Wie diese Reihe zeigt, wird der jeweilige Anteil an materieller Erinnerung in den Transaktionsket-ten sukzessive geringer. Wenn ‚Land gegen Land‘ getauscht würde, wie in anderen Fällen, die hier nicht erwähnt wurden, dann ist der materielle Anteil noch nahezu identisch ausgeprägt. Wenn Geld als Kompensation eingesetzt wird ist der materi-elle Anteil bereits geringer, im Falle des Tausches von Wahrheit gegen Straffreiheit ist er am geringsten. Kompromisse operieren über die mediale Vermittlungskraft von mehr oder weniger materiell ausgeprägten Äquivalenten. Sie erinnern daran, dass sich antagonistische Interessen wandeln lassen, aber nicht daran, dass aus ehe-maliger Feindorientierung eine Freundorientierung geworden ist.
Ein solcher, noch weiter reichender Schritt ist drittens dem Versöhnungsakt vorbehalten. Das kommunikative Handeln der Versöhnungsakte ist durch einen besonders hohen Mittleranteil gekennzeichnet. Die materiellen Transaktionsfor-men sind geringer als bei den ersten beiden Programmen. Die kommunikativen Mittler referieren auf gemeinsame große Transzendenzen wie beispielsweise eine monotheistische Religion (Luckmann 1985). Die materiellen Orte beziehen sich wie im Falle der Krönungskathedrale von Reims und der Kriegsfriedhöfe in Verdun auf das Christentum. Willy Brandts Kniefall richtete sich an die Helden des War-schauer Gettoaufstandes. Das dortige Denkmal ist ein Ehrenmal, kein Mahnmal. Aus israelischer Sicht wird dies auch so interpretiert. Nur aus deutscher Sicht wird der Ort zumeist als ‚Mahnmahl‘ und nicht als ‚Ehrenmal‘ bezeichnet. Für die einen handelt es sich um eine Erinnerung an Helden, für die anderen an Opfer einer ille-gitimen Vernichtungspolitik.14
Worauf diese Fälle von Versöhnung also vor allem verweisen, ist die Tatsache, dass der performative Akt des Nebeneinanderstehens, des Händehaltens, des Kni-ens auf den Moment beschränkt und damit extrem instabil sind. Eine versöhnen-de Geste lässt sich zunächst nur als Bildakt verstetigen. Erst später versuchte man sich an einer Stabilisierung qua Materialakt in Gestalt des Reliefs. Diese materiel-len Gedächtnisketten reichen also von intersubjektiver Gestik über Bildakte bis zu Materialakten. Diese medialen Vermittlungsketten schöpfen ihr Potential zur Veränderung von Gedächtnisinhalten aus ihrem großen Zwischengliedanteil. Zwi-schenglieder sind Vermittler, die sich selbst im Zuge der Vermittlung verändern. Ihre Instabilitäten ermöglichen interpretative Freiheitsgrade und eröffnen bisher ungekannte Deutungsoptionen. Ursachen-Wirkungsverhältnisse werden im Zuge ihrer Erinnerung nicht imitiert und damit stabilisiert, wie im Falle der Waffen und
14 Weitere Ambiguitäten aus polnischer Perspektive müssen hier ausgeklammert werden (vgl. Schneider 2004).
80 V. Rauer
Dokumentaten, sondern in eine transzendente Unähnlichkeit mit sich selbst über-setzt. Statt die Mittler und Zwischenglieder aus der Konfliktzeit zu wiederholen, wird die Differenz zu jener Zeit materiell initiiert.
Wenn hingegen die Mittleranteile hoch sind, so werden die Grenzen der diffe-renten Erinnerungen der beiden Gruppen variabler ausfallen. Kurz gesagt: Je stär-ker die Kommunikationsgattungen in die Ursachen des Konfliktes materiell wie-derholen, desto mehr tragen sie zur Stabilität des Antagonismus bei. Je unähnlicher die vermittelnde Materialität ist, desto instabiler werden die Antagonismen und desto integrativer wird das kollektive Gedächtnis von Postkonfliktgesellschaften.
Literatur
Alexander, J. C., Giesen, B., & Mast, J. (Hrsg.). (2006). Social performance. Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual. Cambridge: Cambridge University Press.
Althoff, G. (Hrsg.). (2011). Frieden stiften. Vermittlung und Konfliktlösung vom Mittelalter bis heute. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Assmann, J. (1992). Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck.
Assmann, A. (2006). Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichts-politik. München: Beck.
Assmann, A., & Assmann, J. (1990). Kultur und Konflikt. Aspekte einer Theorie des unkom-munikativen Handelns. In J. Assmann & D. Harth (Hrsg.), Kultur und Konflikt (S. 11–48). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Austin, J. L. (1976). How to do things with words. The William James lectures delivered at Har-vard University in 1955. London: Oxford University Press.
Bayraktar, S., & Seibel, W. (2004). Das türkische Tätertrauma. Der Massenmord an den Ar-meniern von 1915 bis 1917 und seine Leugnung. In B. Giesen (Hrsg.), Tätertrauma. Nati-onale Erinnerungen im öffentlichen Diskurs (S. 381–398). Konstanz: UVK.
Berek, M. (2009). Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-keit. Eine Theorie der Erinnerungskulturen. Wiesbaden: Harrassowitz.
Bredekamp, H. (2010). Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007. Berlin: Suhrkamp.
Brink, C. (1998). Ikonen der Vernichtung: öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus den nazi-onalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945. Berlin: Akademie Verlag.
Buser, T., & Rauer, V. (2004). Gianfranco Finis Erinnerungspolitik: Eine Medienanalyse zu den Gedenkbesuchen in den Fossee Ardeantine und in Auschwitz. In B. Giesen & C. Schneider (Hrsg.), Tätertrauma: nationale Erinnerungen im öffentlichen Diskurs (S. 239–268). München: UVK.
Callon, M., & Latour, B. (2006). Die Demontage des großen Leviathans. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: transcript Verlag.
Connerton, P. (1996). How societies remember. Cambridge: Cambridge University Press.Connerton, P. (2009). How modernity forgerts. Cambridge: Cambridge University Press.
814 Das Über-Leben der Dinge
Cornelißen, C., Klinkhammer, L., & Schwentker, W. (2003). Nationale Erinnerungkulturen seit 1945 im Vergleich. In C. Cornelißen, L. Klinkhammer, & W. Schwentker (Hrsg.), Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945 (S. 9–27). Frankfurt a. M.: Fischer.
Csaky, M., & Stachel, P. (Hrsg.). (2001). Die Verortung von Gedächtnis. Wien: Passagen.Daase, C. (2010). Addressing painful memories: Apologies as a new practice in international
relations. In A. Assmann & S. Conrad (Hrsg.), Memory in a global age (S. 19–31). New York: Palgrave Macmillan.
Debray, R. (2003). Einführung in die Mediologie. Bern: Haupt.Derrida, J. (2001). On cosmopolitanism and forgiveness. London: Routledge.Dimbath, O. (2011). Systemvergessen. Zur Vergesslichkeit sozialer Systeme. In O. Dimbath
& P. Wehling (Hrsg.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische For-schungsfelder (S. 139–166). Konstanz: UVK.
Dimbath, O., & Wehling, P. (2011). Soziologie des Vergessens: Konturen, Themen und Per-spektiven. In O. Dimbath & P. Wehling (Hrsg.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder (S. 7–34). Konstanz: UVK.
Diner, J. (2003). Gedächtniszeiten. Über jüdische und andere Geschichten. München: Beck.Eder, K., & Spohn, W. (2005). Collective memory and European Identity. The effects of integra-
tion and enlargement. Aldershot: Ashgate Pub.Esposito, E. (2002). Soziales Vergessen. Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Ferrándiz, F., & Baer, A. (2008). Digital memory: The visual recording of mass grave ex-
humations in contemporary spain [35 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, 9, Art. 35, http://nbn-resolving.de/um:nbn:de:0114-fqs0803351. zugegriffen: 2.Apr. 2014.
Foucault, M. (1974). Ordnung der Dinge. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.François, E., & Schulze, H. (2005). Deutsche Erinnerungsorte. München: Beck.Frei, N. (1996). Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangen-
heit. München: Beck.Giesen, B. (2004). Das Tätertrauma der Deutschen. In B. Giesen (Hrsg.), Tätertrauma. Natio-
nale Erinnerungen im öffentlichen Diskurs (S. 11–53). Konstanz: UVK.Goody, J., & Watt, I. P. (1986). Entstehung und Folgen der Schriftkultur. Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp.Halbwachs, M. (1985). Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.Halbwachs, M. (2006). Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.Hartmann, F. (2003). Mediologie. Ansätze einer Medientheorie der Kulturwissenschaften.
Wien: WUV.Heinlein, M. (2011). Das Trauma der deutschen Kriegskinder zwischen nationaler und euro-
päischer Erinnerung: Kritische Anmerkungen zum gegenwärtigen Wandel der Erinne-rungskultur. In H. Schmitz & A. Seidel-Arpaci (Hrsg.), Narratives of trauma (S. 111–128). Amsterdam: Rodopi.
Heinrich, H.-A., & Kohlstruck, M. (2008). Geschichtspolitik und sozialwissenschaftliche The-orie. Stuttgart: Steiner.
Henningsen, B. (2009). Transnationale Erinnerungsorte. Nord- und südeuropäische Perspekti-ven. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag.
82 V. Rauer
Ischida, Y. (2003). Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit. In C. Cor-nelißen, L. Klinkhammer, & W. Schwentker (Hrsg.), Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945 (S. 233–242). Frankfurt a. M.: Fischer.
Kaußen, S. (2003). Von der Apartheid zur Demokratie. Die politische Transformation Südafri-kas. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Kiernan, B. (2009). Genocide and resistance in Southeast Asia. Documentation, denial ans jus-tice in Cambodia and East Timor. New Brunswick: Transaction.
Köstlin, K. (2006). Die Verortung des Gedenkens. Kulturelle Emotionalisierung der Orte. In E. Fendel (Hrsg.), Das Gedächtnis der Orte. Sinnstiftung und Erinnerung (S. 13–29). Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde.
Kühner, A. (2011). Das Plädoyer für Vergessen als Kritik einer ’obsessiven’ Erinnerungspo-litik? Sozialpsychologische Überlegungen zum Umgang mit beunruhigenden Vergan-genheiten. In O. Dimbath & P. Wehling (Hrsg.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder. Konstanz: UVK.
Latour, B. (1996). Der Berliner Schüssel: Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften. Berlin: Akademischer Verlag.
Latour, B. (2006a). Die Macht der Assoziation. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), AN-Thology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie (S. 196–212). Bielefeld: Transcript.
Latour, B. (2006b). Technik als stabilisierte Gesellschaft. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie (S. 369–397). Bie-lefeld: transcript.
Latour, B. (2010). Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Berlin: Suhrkamp.
Laux, H. (2011). Latours Akteure. Ein Beitrag zur Neuvermessung der Handlungsteorie. In N. Lüdtke & H. Matsuzaki (Hrsg.), Akteur, Individuum, Subjekt. Fragen zu „Personalität“ und „Sozialität“ (S. 275–300). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Lindemann, G. (2011). Die Akteure der funktional differenzierten Gesellschaft. In N. Lüdtke & H. Matsuzaki (Hrsg.), Akteur, Individuum, Subjekt. Fragen zu „Personalität" und „Sozi-alität“ (S. 329–350). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Luckmann, T. (1985). Über die Funktion der Religion. In P. Koslowski (Hrsg.), Die religiöse Dimension der Gesellschaft. Religion und ihre Theorien. Tübingen: Mohr.
Margalit, A. (2010). On compromise and rotten compromises. Princeton: Princeton University Press.
Markschies, C. (2010). Erinnerungsorte des Christentums. München: Beck.Nora, P. (1998). Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Fischer.Olick, J. K. (2007). The politics of regret. On collective memory and historical responsibility.
New York: Routledge.Rauer, V. (2006). Symbols in Action: Willy Brandt’s kneefall at the Warsaw Memorial. In J.
C. Alexander et al. (Hrsg.), Social performance. Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual (S. 257–282). Cambridge: Cambridge University Press.
Rauer, V. (2007). Versöhnung zwischen Erinnerungskulturen. Die mediale Repräsentati-on internationaler Versöhnungsrituale nach dem zweiten Weltkrieg. In E. Ueberschär (Hrsg.), Soldaten und andere Opfer? Die Täter-Opfer-Problematik in der deutschen Erinne-rungskultur (S. 83–108). Loccumer Protokolle.
Rauer, V. (2008). Zwischen Kitsch und Trauma: zur symbolischen Repräsentation transna-tionaler Versöhnungsrituale. In H. H. Hahn et al. (Hrsg.), Erinnerungskultur und Versöh-nungskitsch (S. 55–69). Marburg: Herder-Institut.
834 Das Über-Leben der Dinge
Rauer, V. (2012). Interobjektivität: Sicherheitskultur als Sicht der Akteur-Netzwerk-Theorie. In C. Daase et al. (Hrsg.), Sicherheitskultur. Gesellschaftliche und politische Praktiken der Gefahrenabwehr (S. 69–81). Frankfurt a. M.: Campus.
Robbe, T. (2009). Historische Forschung und Geschichtsvermittlung. Erinnerungsorte in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. Göttingen: V & R unipress.
Roy, D. (2005). Semiotic schemas: A framework for grounding language in action and per-ception. Artificial Intelligence, 167, 170–205.
Sabrow, M. (Hrsg.). (2009). Erinnerungsorte der DDR. München: Beck.Schmitt, M. (2009). Trennen und Verbinden. Soziologische Untersuchungen zur Theorie des
Gedächtnisses. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.Schneider, W. L. (2004). Brandts Kniefall in Warschau. Politische und ikonographische Be-
deutungsaspekte. In B. Giesen & C. Schneider (Hrsg.), Tätertrauma. Nationale Erinnerun-gen im öffentlichen Diskurs (S. 157–194). Konstanz: UVK.
Sebald, G., & Weyand, J. (2011). Zur Formierung sozialer Gedächtnisse. Zeitschrift für Sozio-logie, 40, 174–189.
Simmel, G. (1992). Gesamtausgabe II, Soziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Tarde, G. (2009). Die Gesetze der Nachahmung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Tsutsui, K. (2004). Schuld und nationale Identität. Kollektive Erinnerung nach dem zweiten
Weltkrieg in Japan. In B. Giesen & C. Schneider (Hrsg.), Tätertrauma. Nationale Erinne-rungen im öffentlichen Diskurs (S. 313–345). Konstanz: UVK.
Weber, M. (1980). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).Weber, M. (Hrsg.). (2011). Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangen-
heit und Perspektiven. München: Oldenbourg.Wehling, P. (2011). Inkorporiertes Gedächtnis und vergessene Geschichte. Das Vergessen in
Pierre Bourdieus Theorie der Praxis. In O. Dimbath & P. Wehling (Hrsg.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder. Konstanz: UVK.
Welzer, H. (2001). Das soziale Gedächtnis. In H. Welzer (Hrsg.), Das soziale Gedächtnis. Ge-schichte, Erinnerung, Tradierung (S. 9–21). Hamburg: Hamburger Edition.
Welzer, H. (2005). Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: Beck.
Wetzel, D. J. (2011). Maurice Halbwachs – Vergessen und kollektives Gedächtnis. In O. Dim-bath & P. Wehling (Hrsg.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder (S. 37–55). Konstanz: UVK.
Wodak, R. (1990). „Wir sind alle unschuldige Täter“. Diskurshistorische Studien zum Nach-kriegsantisemitismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Zifonun, D. (2011). „Vergessendes Erinnern“: Eine Wissenssoziologie des Erinnerns und Ver-gessens. In O. Dimbath & P. Wehling (Hrsg.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zu-gänge und empirische Forschungsfelder (S. 189–210). Konstanz: UVK.