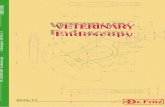Professor in Jena (1931-1936), in: Barbar, Kreter, Arier. Leben und Werk des Althistorikers Fritz...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Professor in Jena (1931-1936), in: Barbar, Kreter, Arier. Leben und Werk des Althistorikers Fritz...
Professor in Jena (1931-1936)
Berufung nach Jena
Anfang 1930 stellte sich die Situation für junge Wissenschaftler, die nach einer
Professur strebten, nicht einfach dar. Ein anderer junger Althistoriker und Mitbewerber
um eine althistorische Professur im deutschen Sprachraum, der schon früher erwähnte
Friedrich Bilabel, beschrieb in einem Brief an seinen Konkurrenten Fritz
Schachermeyr seine persönliche und zugleich auch die allgemeine damalige Lage, wie
sie Schachermeyr seinerseits kaum anders empfinden konnte, folgendermaßen: „Daß
ich in Berufungssachen einige Enttäuschungen erlebte, wissen Sie ja. Am
überraschendsten war mir Graz, da das Gutachten von Prof. Oertel, das ich gelesen
habe, außerordentlich günstig war u[nd] eine Reihe von Fakultätsmitgliedern mich
zugern [sic] deswegen an erste Stelle setzen wollten [sic]. Wenn ich hier die Gründe
meines Nichtberufenwerdens erführe, so wäre ich sehr dankbar. [Es] wird wohl, wie
immer, irgend jemand gegen mich intrigiert haben. Aber ich ahne nicht, wer.
Vielleicht erfahren Sie etwas von Lehmann-Haupt? Der wird ja nun wohl auch bald
pensionsreif werden[,] und dann hoffe ich sehr, daß Sie sein Nachfolger werden.
Tübingen ist auch nicht besetzt. Daß man W. Weber997 zurückberufen hat, haben Sie
wohl gelesen. Da er unglaubliche Gehaltsforderungen gestellt hat, so hat ihn die
Regierung fallen laßen [sic] d. h. er (!) hat abgelehnt? Er war unico loco
vorgeschlagen. Von weiteren Vorschlägen habe ich noch nichts gehört, aber daß man
nur einen, der schon Ordinarius ist, haben will, ist mir von einem Fakultätsmitglied
997 Wilhelm G. Weber (1882-1948); K. Christ 1982, passim, bes. 210-225; K. Christ 1999,
271; K. Christ 2006, 69-74; K. Christ 2008, passim; A. Demandt 1979, 92; A. Demandt 1992,
bes. 199f.; DBE 10, 199, 363; W. U. Eckart – V. Sellin – E. Wolgast 2006, passim; H. Löffler
2001, 240f.; V. Losemann 1977, passim, bes. 48, 75-89, 207 Anm. 14; V. Losemann 2007a,
313-316, 320, 326f. 334; R. Oberheid 2007, bes. 405f.; S. Rebenich 2005, 46; I. Stahlmann
1988, bes. 155-184; J. Vogt 1949, 176-179; W. Weber 1984, 644f.
Professor in Jena (1931-1936) 180
versichert worden. T.998 kann uns Jüngeren also höchstens indirekt nützen. Judeich999,
der längst überfällig ist, hat man gebeten, noch weiterzulesen. Von Wien habe ich
keine zuverlässigen Nachrichten. So sind in Deutschland also die Aussichten nicht
gerade vielversprechend. Besonders interessant ist der Endkampf um Berlin, da
Wilcken1000 im Laufe dieses Jahres ausscheidet u[nd] gerne sehr, wie er mir sagt[,]
‚um endlich arbeiten zu können’.“1001
Für Schachermeyr sollte die Situation des Wartens auf eine Professur allerdings
schon bald ein Ende haben – Anfang 1931 erging an ihn ein Ruf nach Jena auf den
Lehrstuhl des soeben genannten Walther Judeich, und dies, obwohl er im Jenenser
Ternavorschlag nur an dritter Stelle genannt worden war1002. An erste Stelle waren die
998 Gemeint ist zweifellos das eben erwähnte Tübingen, wo dann seit 1932 tatsächlich
vielmehr Woldemar Graf Uxkull-Gyllenband (1898-1939; auch Üxküll geschrieben, so
zuletzt bei K. Christ 2008, passim; vgl. zu diesem George-Jünger weiters S. Breuer 1995,
234; K. Christ 1982, 255; P. Hoffmann 1992, 111; T. Karlauf 2007, passim; V. Losemann
2007a, 318f.; R. E. Norton 2002, bes. 658, 731; W. Schuller 2005, 209-224, bes. 212-215; J.
Vogt 1939, 461-463; W. Weber 1984, 613) lehrte, der zuvor noch nicht Ordinarius gewesen
und selbst einer von „uns Jüngeren“ war; und da es deshalb keinen Wechsel eines schon
andernorts etablierten Lehrstuhlinhabers nach Tübingen gab, konnten Bilabel und
seinesgleichen auch nicht, wie von diesem erhofft, von einer so herbeigeführten Vakanz an
einer anderen Universität profitieren. 999 Walt(h)er Judeich (1859-1942), damals Ordinarius in Jena; Dt. Ztgenlex., 687f.; E. Kluwe
1990, 5-12; R. Urban 2000, 54-56; W. Weber 1984, 275f.; L. Wickert – C. Börker 1979, bes.
180. 1000 Ulrich Wilcken (1862-1944); K. Christ 1982, bes. 70f.; K. Christ 1999, bes. 176-184; K.
Christ 2006 47f.; W. R. Dawson – E. P. Uphill – M. L. Bierbrier 1995, 441; A. Demandt
1979, bes. 87f.; A. Demandt 1992, bes. 190f.; H. Kloft 2006, 294-329; B. Näf 1986, bes. 90-
92; W. Weber 1984, 662; L. Wenger 1945, 199-228; O. Wenig 1968, 337; M. A. Wes 1997,
passim und 213 Anm. 2 mit weiterer Lit. 1001 A I, F. Bilabel an Schachermeyr, Brief vom 22.3.1930. 1002 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 12.
Professor in Jena (1931-1936) 181
beiden Professoren Josef Keil (1878-1963)1003 aus Greifswald und Johannes
Hasebroek (1893-1957)1004 aus Köln, an zweite Stelle der außerordentliche Professor
in Zürich Ernst Meyer (1898-1975)1005 gereiht worden, wobei man von der
Nachbesetzung einer Ordinariatsstelle ausgegangen war1006.
In der Folge wurde Judeichs Lehrstuhl dann aber zu einer außerordentlichen
Professur zurückgestuft1007, was implizierte, daß von allen Gereihten allein oder am
1003 UA Wien, PA Josef Keil; AdR, PA Josef Keil, Präsidentschaftskanzlei Zl. 4176/25, Zl.
12.554/36, Zl. 8502/47, Zl. 41.208/59, Zl. 40987/59; Archiv der ÖAW PA Josef Keil; G.
Baader 1977, 404f.; E. Braun 1964, 521-524; E. Bruckmüller 2004, II, 188; F. Fellner – D. A.
Corradini 2006, 216; F. Jaksch 1929, 127; M. Pesditschek 1996, 108-119; M. Pesditschek
2002, 12-14; M. Pesditschek 2009b, im Druck; F. Schachermeyr 1964g, 5; F. Schachermeyr
1965k, 50f.; R. Teichl 1951, 142f.; W. Weber 1984, 294; G. Wlach 1998, 111f. 1004 K. Christ 1999, bes. 230-232; F. Golczewski 1988, bes. 453; V. Losemann 1977, bes.
201f. Anm. 104; E. Pack 1990, 142-151; W. Weber 1984, 206f. 1005 M. Chambers 1996, 751; K. Christ 1982, 334-337; B. Näf 2002, 1149; F. Volbehr – R.
Weyl 1956, 220. 1006 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 19. Daß die Kandidaten von der Fakultät für ein
Ordinariat gelistet wurden, geht auch aus dem Glückwunschschreiben Judeichs an
Schachermeyr hervor (A I, W. Judeich an Schachermeyr, Brief vom 21.2.1931). 1007 „Nach dem neuen Statut [von 1924] gehörten alle ordentlichen und alle diejenigen
beamteten außerordentlichen Professoren, die alleinige Vertreter eines selbständigen Faches
waren, zur Engeren Fakultät. Diese wurde durch geheime Wahl der Weiteren Fakultät aus
dem Kreis derjenigen Mitglieder ergänzt, die nicht der Engeren Fakultät angehörten. Ihre Zahl
sollte jedoch nicht mehr als ein Viertel der Inhaber ordentlicher Lehrstellen betragen, und
diese Mitglieder des Lehrkörpers durften an Verhandlungen und Beschlußfassungen über ihre
eigene Person nicht teilnehmen […]. Die Weitere Fakultät bestand aus allen ordentlichen
Professoren, den außerordentlichen Professoren und den Privatdozenten. […] ‚Der Große
Senat setzt sich aus sämtlichen Mitgliedern der engeren [sic] Fakultäten zusammen’, denen
[…] jetzt auch Nichtordinarien angehörten, teils in ihrer Eigenschaft als alleinige Vertreter
eines selbständigen Faches, teils als gewählte Vertreter der sonst außerhalb der Fakultät
Professor in Jena (1931-1936) 182
ehesten Schachermeyr den Ruf annehmen würde, denn jeder Ruf an eine Universität
war für die von ihm ohne Zweifel angestrebte wissenschaftliche Karriere besser als
weiterer Gymnasialunterricht. So machte denn also Schachermeyr das Rennen, wofür
folgende Begründung gegeben wurde: „Allgemeine Aufmerksamkeit hat
Schachermeyr mit seinem im Jahr 1929 veröffentlichten großen Buch ‘Etruskische
Frühgeschichte’1008 erregt. Zwar der Nachweis, der das Ziel des Buches bildet, wird
bestritten, der Nachweis nämlich, daß die Herkunft der Etrusker im nordwestlichen
Kleinasien zu suchen sei. Aber die umfassende Kenntnis, die Vorlegung des Materials,
die großen Gesichtspunkte und die mit historischem Takt getroffenen Fragestellungen,
endlich die Vorzüge der Darstellung, die besonders in der Beschreibung der
archäologischen Denkmäler hervortreten, haben volle Anerkennung, teilweise
geradezu Bewunderung gefunden. Schachermeyr hat sich mit diesem Buch, das einen
viel umfassenderen Inhalt hat[,] als der Titel verrät[,] und auf Grund genauer Kenntnis
und großzügiger Betrachtung der Frühgeschichte der ganzen östlichen Mittelmeerwelt
geschrieben ist, als Historiker von Rang ausgewiesen.“1009 Bereits im Sommer 1930
hatte der Archäologe Camillo Praschniker (1884-1949)1010, der nur das
Sommersemester 1930 in Jena lehrte und danach nach Wien wechselte, Schachermeyr
mitgeteilt, daß sein Name „unter einer großen Zahl sozusagen zur engeren Wahl
stehenden Lehrkräfte. Hinsichtlich der Mitgliedschaft zum Kleinen Senat wurde präzisiert,
daß von den sieben Wahlsenatoren fünf aus dem Kreis der ordentlichen Professoren, und zwar
je einer aus jeder Fakultät stammen mußten“ (R. Ludloff 1958, 561); vgl. dazu M. Schmeiser
1994, 62, der allerdings nur über die preußischen Verhältnisse berichtet. 1008 F. Schachermeyr 1929a. 1009 AdR PA Friedrich Schachermeyr, fol. 19f. Zur Beurteilung von Schachermeyrs
Habilitationsschrift vgl. S. 124-126, 137. 1010 F. Fellner – D. A. Corradini 2006, 326f.; F. Jaksch 1929, 221; J. Keil 1950, 292-306; H.
Kenner 1988b, 224f.; H. Vetters 1983, 241f.; G. Wlach 1998, 106f.; G. Wlach 2007; G.
Wlach 2009, im Druck.
Professor in Jena (1931-1936) 183
gestellt wurde“1011. Am 19. Dezember 1930 holte das Thüringische
Volksbildungsministerium, im besonderen Oberregierungsrat Friedrich Stier (1886-
1966)1012, der zusätzlich an der Jenenser Universität las, im Österreichischen
Bundesministerium für Unterricht Auskünfte über Schachermeyr ein, wobei man sich
auch über dessen Persönlichkeit sowie politische Aktivitäten informierte1013. Das
Ministerium in Wien gab diese Fragen nach Tirol weiter, und dort hieß es,
Schachermeyr sei, „soweit dem Landesschulrate bekannt, politisch nie
hervorgetreten“1014. Bezüglich seiner Besoldung wird angegeben, daß Schachermeyr
samt diversen Zulagen und Überstundenvergütung auf ein monatliches
Nettoeinkommen von ATS 517,60 komme1015. Auch der Dekan der Philosophischen
Fakultät der Universität Innsbruck, Ernst Philippi (1888-1969)1016, der 1945 entlassen
wurde, weiß von keiner politischen Betätigung Schachermeyrs, er sei ihm „persönlich
als sehr sympathischer jüngerer Kollege bekannt, der meines Wissens auch bei den
anderen Kollegen beliebt ist“1017. Schachermeyr selbst bezeichnete sich später als bis
zu diesem Zeitpunkt „vollkommen unpolitisch“. Weiters führte er erklärend und völlig
glaubhaft aus: „An eine studentische Korporation habe ich mich während meiner
Universitätsjahre nicht angeschlossen. In den nachfolgenden zehn Jahren, welche ich
1011 A II, C. Praschniker an Schachermeyr, Karte vom 25.7.1930. 1012 B. v. Brocke 2002, 210; M. Grüttner 2004, 169; J. Hendel u. a. 2007, passim; W. Löhlein
1931, 35; E. Naake 1998, 280-282, 290f.; R. Stutz 1995, 360, 363, 365; S. Wallentin 2007,
268-270. Zu seiner Funktion im Nietzsche-Archiv vgl. D. M. Hoffmann 1991, 81, 107. 1013 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 12. 1014 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 16. 1015 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 16. Die Wirtschaftskrise hatte Österreich zu diesem
Zeitpunkt in vollem Umfang erfaßt. Zum Vergleich sei hier die Höhe der monatlichen
Arbeitslosenunterstützung angeführt, die samt der 1922 installierten Notstandshilfen im Jahr
1931 ATS 74,- ausmachte. „Der durchschnittliche Monatslohn eines Metallarbeiters betrug im
selben Jahr 245,- Schilling“ (V. Pawlowsky 2000, 25). 1016 P. Goller – G. Oberkofler 2003, 19; G. Machek 1971, bes. 195-197. 1017 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 18.
Professor in Jena (1931-1936) 184
1921 bis 1931 am Innsbrucker Mädchenrealgymnasium wirkte, war ich dem
Katholischen Mittelschullehrerverband nahegestanden, ohne mich aber zu politischer
Betätigung zu entschließen, denn meine damals schon sehr intensive wissenschaftliche
Forschungsarbeit und eine Mittelschullehrverpflichtung von oft bis zu 28
Wochenstunden füllte mich vollkommen aus.“1018
Mit 17. Februar 1931 war schließlich das alles entscheidende an Schachermeyr
gerichtete Schreiben datiert, mit dem der Ruf an ihn erging: „Die philosophische
Fakultät der Thüringischen Landesuniversität Jena hat für den freigewordenen
Lehrstuhl der alten [sic] Geschichte neben anderen Gelehrten Sie vorgeschlagen. Die
Stelle wird durch die Entpflichtung des Geheimen Hofrats Professor Dr. Judeich am 1.
April 1931 frei. Es handelt sich jetzt um eine planmäßige außerordentliche Lehrstelle.
Wir haben den Wunsch, daß sie zu diesem Zeitpunkt auch besetzt werden kann. Im
Auftrage meines Herrn Ministers habe ich Ihnen heute den Ruf auf diese Lehrstelle zu
übermitteln“1019. Die Nachricht von dem an Schachermeyr ergangenen Ruf verbreitete
sich offenbar wie ein Lauffeuer, das Glückwunschschreiben des jüngeren Dozenten
Fritz Moritz Heichelheim (1901-1968)1020, der dann nach England emigrieren mußte,
1018 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 98. Die Vermutung liegt nahe, daß freilich auch schon
der „unpolitische“ Schachermeyr, ganz ähnlich wie der prominenteste „Unpolitische“, der
Thomas Mann der Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin 1918 (H. Bürgin u. a., Das
Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie, Frankfurt am Main 1959, ND 1984, 1, 12), jede
Menge von rechtsgerichteten Einstellungen hatte; vgl. die Andeutung bei S. Deger-Jalkotzy
1988a, 126 und auch schon gewisse Formulierungen in F. Schachermeyr 1929a, s. o. S. 127-
130. (Zum jungen Thomas Mann als Autor der „Konservativen Revolution“ vgl. etwa A.
Mohler 1999, passim, bes. 325; auch B. Beßlich 2002, passim, bes. 12f. mit Lit.; M.
Görtemaker 2005, 25-42, 242-244; J. Nordalm 2006, 253-276.) Zu den „politischen Folgen
des Unpolitischen Deutschen“ vgl. F. Stern 1977, 168-186. 1019 A II, Thüringisches Volksbildungsministerium, IV C I 336/31, Oberregierungsrat F. Stier
an Schachermeyr, Brief vom 17.2.1931. 1020 M. Chambers 1994, 272-274; K. Christ 1982, 193-195; K. Christ 1999, bes. 234; W. R.
Dawson – E. P. Uphill – M. L. Bierbrier 1995, 197; K. Ehling 2004, 446-449; KGL 1931,
Professor in Jena (1931-1936) 185
ist am 26. Februar geschrieben1021, das von Josef Schatz (1871-1950)1022 am 28.
Februar1023, die Gratulationsschreiben von Friedrich Bilabel und der Witwe Adolf
Bauers sowie von Rudolf Egger und Camillo Praschniker sind alle bereits mit 25.
Februar 19311024, die von Wilhelm Ensslin und Emil Forrer gar schon mit 24. Februar
1931 datiert1025. Schachermeyrs Schwester Maria beglückwünschte ihn noch einen Tag
früher mit „Heil Fritz!“1026, und ebenfalls mit dem 23. Februar sind Alfons Nehrings
und Friedrich Oertels Gratulationsschreiben sowie eines von der Dieterich’schen
Verlagsbuchhandlung datiert1027. Am 22. Februar1028 gratulierte der Münchener
Landschaftsmaler Richard Kaiser (1968-1941)1029, und Albert Debrunner, Hans Lamer
(1873-1939)1030 und Friedrich Münzer entboten ihre Glückwünsche gar schon am 21.
1076; KGL 1950, 741; KGL 1976, 3655; H. A. Strauss – W. Röder 1983, 474; C. Wegeler
1996, 385. 1021 A II, F. Heichelheim an Schachermeyr, Brief vom 26.2.1931. 1022 H. Giebisch – G. Gugitz 1964, 352. 1023 A II, J. Schatz an Schachermeyr, Brief vom 28.2.1931. 1024 „Soeben sehe ich in der Zeitung Ihre Berufung nach Jena und freue mich aufrichtig“ (A II,
F. Bilabel an Schachermeyr, Karte vom 25.2.1931); „Eben erfahre ich, von der, für Sie so
ehrenvollen Berufung“ (A II, M. Bauer an Schachermeyr, Karte vom 25.2.1931); „Zum
Ordinarius wünscht Ihnen […] herzlich Glück“ (A II, R. Egger an Schachermeyr, Karte vom
25.2.1931); A II, C. Praschniker an Schachermeyr, Brief vom 25.2.1931. 1025 A II, W. Ensslin an Schachermeyr, Karte vom 24.2.1931; A II, E. Forrer an
Schachermeyr, Brief vom 24.2.1931. 1026 A II, M. Fichtenau an Schachermeyrs, Brief vom 23.2.1931. 1027 A II, A. Nehring an Schachermeyr, Brief vom 23.2.1931; A II, F. Oertel an
Schachermeyr, Brief vom 23.2.1931; A II, Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung an
Schachermeyr, Brief vom 23.1.1931. 1028 A II, R. Kaiser an Schachermeyr, Brief vom 22.2.1931. 1029 DBE 5, 1997, 408; H. A. L. Degener 1935, 776; Reichshandbuch, 874; H. Vollmer 1956,
6; H. Vollmer 1999a, 450. 1030 ABES; KGL 1925, 563.
Professor in Jena (1931-1936) 186
Februar1031. Anfang März1032 folgten dann noch die Wünsche Franz Leifers (1883-
1957)1033 und Friedrich Pfisters und aus dem familiären Bereich die von seinem
Bruder Hans und dessen Frau Gertrude. Ende Februar war Schachermeyr gerade nach
Weimar gereist, um persönliche Gespräche über die Modalitäten seiner Berufung zu
führen1034. Erst am 26. März 1931 teilte man Schachermeyr mit, daß er gesundheitliche
Atteste für seine Anstellung beizubringen habe1035. Wenn man die Zeit für die
Briefwege miteinrechnet, hatte Schachermeyr höchstens einen Monat Spielraum, um
Verhandlungen mit der Regierung zu führen und gleichzeitig zu überlegen, ob er die
Bedingungen akzeptieren solle. Ganz erstaunlich ist, daß Judeich von der Berufung
Schachermeyrs bloß aus „unserem Lokalblatt“ erfahren haben will. Weiters führte
Judeich in seinem Brief an Schachermeyr aus: „Ich zweifle nicht, daß die Nachricht
richtig ist, wenn die Regierung auch bisher der Fakultät kein Wort darüber mitgeteilt
hat, und möchte d[es]halb als einer der Nächstbeteiligten Ihnen gleich einen herzlichen
Glückwunsch senden.“1036
Fritz Schachermeyr übersiedelte also in das „ersehnte{n} Deutschland“1037, und
trat am 1. April 1931 seine Stelle als außerordentlicher Professor in Jena an1038 –
1031 D II, A. Debrunner an Schachermeyr, Karte vom 21.2.1931; A II, H. Lamer an
Schachermeyr, Brief vom 21.2.1931; A II, F. Münzer an Schachermeyr, Karte vom
21.2.1931. 1032 A II, F. Leifer an Schachermeyr, Brief vom 2.3.1931; A II, F. Pfister an Schachermeyr,
Karte vom 9.3.1931; A II, H. Schachermeyr an F. Schachermeyr, Brief vom 7.3.1931; A II,
G. Schachermeyr an F. Schachermeyr, Brief vom 7.3.1931. 1033 KGL 1926, 1105; KGL 1961, 2380; R. Teichl 1951, 175. 1034 A II, M. Fichtenau an Schachermeyrs, Brief vom 23.2.1931. 1035 A II, Thüringisches Volksbildungsministerium, IV C I: 841/31, Brief vom 26.3.1931. 1036 A I, W. Judeich an Schachermeyr, Brief vom 21.2.1931. 1037 F. Schachermeyr 1984, 81. In seinem politischen Bekenntnis bezeichnet Schachermeyr
Deutschland als „eine Art von Paradies“ (Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt.
1, 1. Ein politisches Bekenntnis, fol. 1), und bereits im Vorwort seiner Etruskischen
Frühgeschichte (F. Schachermeyr 1929a) gibt er an, sich als Deutscher zu fühlen, wenn er
Professor in Jena (1931-1936) 187
physisch war er erst seit 12. April in Jena anwesend1039 –, wo der berühmte Johann
Gustav Droysen (1808-1884)1040 das „Historische Seminar“ begründet und schon
Friedrich von Schiller als Professor für Geschichte gelehrt hatte1041.
Mit seinen Lehrveranstaltungen begann er noch im Sommersemester1042. In
Thüringen weilte Schachermeyr zunächst ohne seine Gemahlin Gisela, die anfangs1043
schreibt: „August Göllerich […] hat mich in jene Sphäre höchster Kunst eingeführt, welche,
wie kaum etwas anderes, für uns Deutsche die Erfüllung alles Strebens und Sehnens bedeutet“
(F. Schachermeyr 1929a, X); s. o. S. 129 Anm. 595. 1038 UA Heidelberg, PA 5599, Standesliste; UA Graz, PA Fritz Schachermeyr, Dienstzeiten.
Schachermeyrs Berufung wurde auch in den Personalien der Klio (C. F. Lehmann-Haupt
1931, 529), des Gnomon (7, 1931, 176) bzw. des AfO (7, 1931-1932, 73) sowie in der
Chronik der Universität für das Jahr 1930/31 (W. Löhlein 1931, 33) angezeigt. In dieser
Periode hatte auch „Erich Brandenburg (Weimar), der bekannte Forscher auf dem Gebiete der
Felsarchitektur, […] einen Lehrauftrag für altorientalische Kulturgeschichte an der
Universität Jena erhalten“ (C. F. Lehmann-Haupt 1931, 529); s. zu diesem u. S. 201-203, 216,
222, 227, 230, 424. 1039 Vgl. A II, Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung an Schachermeyr, Brief vom 24.3.1931. 1040 H. W. Blanke 2008; M. Chambers 1996, 374f.; K. Christ 1989, 50-67; K. Christ 1999, 19-
21; C. Hackel 2008; O. Hintze 1904, 82-114; C. Maltzahn 2002, 76f.; W. Nippel 2008; S.
Paetrow 2008; S. Rebenich 2008a, 131-152; J. Rüsen 1971, 7-23; T. Schieder 1959, 135-137;
P. Schumann 1995, 626f.; F. Volbehr – R. Weyl 1956, 139; W. Weber 1984, 113f.
Hauptsächlich zu Droysens Sohn Gustav: M. Meumann 2002, 123-135. 1041 Vgl. seine Antrittsvorlesung aus dem Jahr 1789 Was heißt und zu welchem Ende studiert
man Universalgeschichte?, hrsg. im Auftrag der Friedrich-Schiller-Universität Jena von
Volker Wahl, Reprint des Erstdrucks der Jenaer akademischen Antrittsrede aus dem Jahre
1789, Jena 1996; R. vom Bruch 2002, 292f. 1042 A II, W. Judeich an Schachermeyr, Karte vom 6.3.1931. Im Vorlesungsverzeichnis finden
sich keine Eintragungen für das Sommersemester 1931 (vgl. S. 740). 1043 Anfang Juni war noch immer keine Wohnung gefunden, und Gisela Schachermeyr war
gerade wieder einmal dabei nach Innsbruck zu reisen (vgl. A I, E. Brandenburg an
Schachermeyr, Brief vom 4.6.1931).
Professor in Jena (1931-1936) 188
nur manchmal zu Besuch kam, weil noch keine entsprechende Wohnung vorhanden
war. Die Wohnungssuche gestaltete sich langwierig, Schachermeyr inserierte
mehrmals. Eine Wohnung mit vier Zimmern, wie gewünscht, war offensichtlich nicht
so einfach aufzutreiben1044. Erst zu Beginn des Wintersemesters scheint sich eine
solche gefunden zu haben1045, als Adresse scheint die Weinbergstraße 15 im
Vorlesungsverzeichnis auf1046. Hier wohnte Schachermeyr bis Ende März 1933, ab
April dieses Jahres führte man ihn in der Wildstraße 141047 und schon ein Semester
später im Haus Nummer 18 einer zentrumsnahen Straße unweit der Saale und der
Universität, die seit 1. Mai 1933 in Fritz-Sauckel-Straße umbenannt war und heute
Westbahnhofstraße heißt1048. Leider erwies sich Jena für das hochmusikalische Paar
als „eine ganz auf Wissenschaft und optische Industrie1049 eingestellte Kleinstadt, in
der jede intensivere Musikpflege mangelte. Wohl bot dafür Weimar reichlich Ersatz,
1044 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, 2 undatierte Briefe, wohl 1931. 1045 Vgl. A II, W. Ensslin an Schachermeyr, Brief vom 16.12.1931. 1046 Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1931/32, 19.
Oktober bis 12. März, 65; Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis
Sommerhalbjahr 1932, 15. April bis 31. Juni, 69; Thüringische Landesuniversität Jena.
Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1932/33, 17. Oktober bis 28. Februar, 69. 1047 375 Jahre Universität Jena 1558-1933. Vorlesungen Sommer 1933. Thüringische
Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Sommerhalbjahr 1933, 24. April bis 31. Juli,
69. 1048 375 Jahre Universität Jena 1558-1933. Vorlesungen Winter 1933/34. Thüringische
Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1933/34, 16. Oktober bis 28.
Februar, 69; http://www.jena.de/chronik/chroni12.html (20.10.2005). 1049 Zur Geschichte der Firma Zeiss s. E. Hellmuth – W. Mühlfriedel 1996; W. Mühlfriedel –
E. Hellmuth 1995, 247-268; über die Verbindungen der Familie Zeiss mit dem Jenaer
Glaswerk s. J. Steiner – U. Hoff 1995, 209-211, 215, 218-223; A. Hermann 1998 behandelt
die Geschichte der Firma Zeiss nach 1945.
Professor in Jena (1931-1936) 189
doch war die Entfernung zu groß1050, um für mein Verlangen nach Hausmusik in
Betracht zu kommen“1051. Dafür wurde Schachermeyr schon mit September 19311052
zum persönlichen Ordinarius für Alte Geschichte befördert, was freilich nicht die
Auszahlung eines Ordinarius-Gehalts nach sich zog. Schachermeyr selbst meinte
später, daß seine Berufung vor allem seinem auf einem Kongreß in Salzburg am 25.
September 1929 gehaltenen Vortrag über „Die historische Rückerinnerung bei den
Griechen“1053 zu verdanken gewesen sei. In Salzburg hatte er jedoch auch die
1050 Offenbar waren damals die 20 km, die Weimar von Jena entfernt ist, nicht so leicht zu
überwinden. 1051 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 10. 1052 UA Heidelberg, PA 5599, Standesliste gibt den 15. September 1931 an; AdR, PA Fritz
Schachermeyr, fol. 45f. hingegen August 1931; dies könnte darauf hindeuten, daß
Schachermeyr zwar im August, jedoch erst mit Wirkung vom 15. September ernannt worden
ist. Im Gnomon findet sich die Erwähnung einer Ernennung „zum beamteten außerord.
Professor für alte Geschichte“ (7, 1931, 288), nachdem zuvor gemeldet worden war, daß
Schachermeyr „als außerord. Professor nach Jena berufen [wurde]“ (7, 1931, 176), das AfO
berichtet: „Fritz Schachermeyr […] wurde zum Ordinarius ernannt“ (7, 1931-1932, 216); vgl.
auch Klio 25, 1932, 286; Fritz Heichelheim gratuliert Schachermeyr im Oktober 1931 zur
Ernennung zum Ordinarius (A II, F. Heichelheim an Schachermeyr, Karte vom 15.10.1931).
[M.] Heinemann drückte seine Freude über Schachermeyrs Beförderung bereits im September
aus (A II, Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung an Schachermeyr, Brief vom 16.9.1931). 1053 Eine Zusammenfassung unter dem Titel Die Grenzen der historischen Rückerinnerung
bei den Griechen erschien in: R. Meister (Hg.), Verhandlungen der 57. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner zu Salzburg vom 25. bis 28. September 1929, Leipzig
1930, 53 = F. Schachermeyr 1930a, 53. Viel später erschien sein Buch Die griechische
Rückerinnerung im Lichte neuer Forschungen, Wien 1983 = F. Schachermeyr 1983a. W.
Weber 1987, 287 vermutet hingegen, daß Schachermeyr „sehr wahrscheinlich über
Verbindungen seines Innsbrucker Lehrers Lehmann-Haupt, des Herausgebers des
einflußreichen Fachorgans ‚Klio’, ins Reich [kam], wenngleich ebenfalls zu vermerken ist,
Professor in Jena (1931-1936) 190
Gelegenheit wahrgenommen, an der Mitgliederversammlung der „Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft“ vom 27. September 1929 teilzunehmen1054, wo sich
ihm sicherlich die Möglichkeit bot, bei bereits etablierten Professoren im Hinblick auf
eine spätere Professur für sich selbst zu werben. Weiters schreibt Schachermeyr um
1957: „Völlig überraschend erhielt ich anfangs 1931 eine Berufung nach Jena auf den
angesehenen Lehrstuhl Judeichs. Für die Schule Wilhelm Webers, welche damals die
deutschen Lehrstühle zu besetzen pflegte und natürlich auch mit Jena ganz anderes
vorgehabt hatte, bedeutete das ein schwerer [sic] Schlag. Der Kreis um Weber hat es
mir d [sic] durch Jahrzehnte nachgetragen, daß ich damals die Berufung erhielt und
annahm.“1055 Diese Behauptungen Schachermeyrs müssen freilich zumindest stark
übertrieben sein, vielleicht sind sie sogar völlig frei erfunden – da Wilhelm Weber eine
notorische Stütze des NS-Regimes gewesen war, konnte einem eine behauptete
Gegnerschaft zur oder Verfolgung durch die Weber-Schule nach 1945 ja durchaus zur
Ehre angerechnet werden, ja mochte eine solche bei weniger informierten
Zeitgenossen sogar eine eigene Oppositionshaltung gegenüber dem
Nationalsozialismus nahelegen. Wie aus einem Brief vom Beginn des Jahres 1936
hervorgeht, hatte Schachermeyr offenbar kurz vor seinem Abgang aus Jena niemand
anderen als seinen angeblichen Feind Wilhelm Weber eingeladen, ihm Vorschläge für
daß er in Jena Nachfolger eines Gelehrten wurde, der lange Jahre ein österreichisches
Ordinariat verwaltet hatte.“ W. Weber 1984, 276 listet jedoch nur das von Schachermeyrs
Vorgänger Judeich 1899-1901 vertretene Extraordinariat in Czernowitz (vgl. auch W. Weber
1987, 544). 1054 Bericht über die Mitgliederversammlung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
im Hörsaal der Theologischen Fakultät in Salzburg am 27. September 1929, 5 Uhr
nachmittags, ZDMG 83 = N. F. 8, 1929, *29*f. 1055 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 10. Zur zweifellos einflußreichen Schule Wilhelm Webers s. K.
Christ 1982, 210-244, K. Christ 2006, 69-87; H. Löffler 2001, 240f.; S. Rebenich 2005, 46-
48.
Professor in Jena (1931-1936) 191
seine Nachfolge zu unterbreiten1056 – dies zweifellos am ehesten Ausdruck einer
freundschaftlichen Verbundenheit –, und auch schon eine Karte Webers vom April
1935 läßt auf gutes Einvernehmen schließen1057. Außerdem publizierte Schachermeyr
danach im von Joseph Vogt herausgegebenen Sammelband Rom und Karthago seinen
Aufsatz Karthago in rassengeschichtlicher Bedeutung1058 – Vogt war Schüler Wilhelm
Webers in Tübingen gewesen1059.
Später legte Schachermeyr Wert auf folgende Feststellung: „Die mich berufende
Regierung war noch eine bürgerliche und keine nazistische gewesen1060. Bald aber
zogen auch in Thüringen die Nazis siegreich in Weimar ein[,] und das wurde für mich
schwierig, da ich von Österreich her zu sehr mit dem aus jüdischer Familie
stammenden Lehmann-Haupt verbunden war“1061, behauptete Schachermeyr nach
1945. Tatsächlich war in Thüringen jedoch schon Anfang 1930 der Nationalsozialist
Wilhelm Frick (1877-1946)1062, der am 1. Oktober 1946 in Nürnberg zum Tode
1056 Vgl. A II, W. Weber an Schachermeyr, Brief vom 22.1.1936. Weber verfaßte bekanntlich
für NS-Wissenschaftsfunktionäre immer wieder Gutachten (M. Willing 2000, 247; vgl. V.
Losemann 1977, 75-89) und konnte daher die Chancen der einzelnen Kandidaten sicherlich
gut einschätzen. 1057 S. u. S. 218. 1058 F. Schachermeyr 1943b, 9-43; vgl. dazu S. 353-356. 1059 Für eine mögliche später gegebene Intimität mit Vogt s. a. S. 226 mit Anm. 1223. 1060 In seinem „Memorandum über die Staatsbürgerschaft und politische Betätigung“ von
1951 spricht Schachermeyr „von der (damals noch demokratischen) thüringischen Regierung
in Weimar“, die ihn mit 1. April 1931 ernannt habe (AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93);
andererseits gab er an, daß seine „Ernennung noch durch die liberale Regierung Kästner“
erfolgt sei (AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 98); vgl. auch F. Schachermeyr 1984, 172:
„[…] ich wurde ja schon 1931, und noch von einer liberalen Regierung, nach Jena berufen“. 1061 Archiv der ÖAW, PA Fritz Schachermeyr, Viermals Ordinarius, zu Jena, Heidelberg,
Graz und Wien. 1062 H.-C. Harten – U. Neirich – M. Schwerendt 2006, passim, bes. 377; J. Hendel u. a. 2007,
passim; U. Hoßfeld 2005, 219f.; E. Klee 2003, 166; K. A. Lankheit 2002, 133f.; G. Neliba
Professor in Jena (1931-1936) 192
verurteilt wurde, Volksbildungsminister geworden. Nach den Wahlen zum Landtag
von Thüringen vom 8. Dezember 1929, an der nur 75 % der Wahlberechtigten
teilgenommen hatten, waren die Nationalsozialisten mit 11,3 % und sechs
Abgeordneten drittstärkste Partei. Koalitionsverhandlungen der „Bürgerlichen“ mit der
NSDAP begannen am 17. Dezember, am 20. Dezember hatte man die Ministerien
aufgeteilt, und mit Adolf Hitlers Nominierung von Wilhelm Frick für das Innen- und
Erziehungsministerium im Jänner 1930 war auch die personelle Auswahl getroffen.
Die NSDAP war damit zweitstärkster Partner in einer bürgerlich-bäuerlichen
Koalitionsregierung, die von 23. Jänner 1930 bis 1. April 1931 im Amt blieb1063. Der
Bürgerliche Willy Kästner (1888-1974)1064 übernahm erst am 22. April 1931, nachdem
Schachermeyr bereits seine Stelle an der Universität angetreten hatte, in einer
bürgerlichen Minderheitsregierung das Volksbildungsministerium von Wilhelm
Frick1065. Schachermeyrs Neffe Heinrich Fichtenau formulierte in einem Zusatz am
Ende eines Briefes seiner Mutter ganz unverblümt: „Dreimal Heil zur Berufung! Jena,
das bedeutet schon allerhand. Der berühmte Rassen-Günther1066 hat es dort nur bis
1993, 80-90; G. Neliba 1995, 75-96; H. Roewer – S. Schäfer – M. Uhl 2003, 151; G. Schulz
1961, 432f.; E. Stockhorst 2000, 144. Zu Fricks Thüringer Zeit bes. G. Neliba 1992, 57-71. 1063 Vgl. J. John 1983, 286; M. Pesditschek 2007, 45 Anm. 31; D. R. Tracey 1995, 69-72; s.
auch T. Borodajkewycz 1966, 17f. 1064 B. v. Brocke 2002, 205; C. Horkenbach 1931, 517;
http://www.geocities.com/CapitolHill/Rotunda/2209/Thuringen.html. 1065 J. John 1983, 286; W. Lesanovsky 1995, 406. 1066 Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968); M. G. Ash 2008, 828f.; S. Breuer 2001, 68-70;
J. Chapoutot 2008a, 60-71, 148-150, 248-251, 261-263; K. Christ 1999, bes. 245f.; DBE 4,
1996, 240; C. Decurtins 1952, 109; E. Faye 2005, passim; H. Graml 2002, 169; H.-C. Harten
– U. Neirich – M. Schwerendt 2006, passim, bes. 138-144, 389; V. Hasenauer 2006, 485-508;
J. Hendel u. a. 2007, passim; U. Hoßfeld 1999, 47-103; U. Hoßfeld 2000, bes. 69-73; U.
Hoßfeld 2005, 220-229; C. M. Hutton 2005, bes. 35-55; E. Klee 2003, 208f.; C. Knobloch
2005, passim; V. Losemann 2007a, 307f.; H.-J. Lutzhöft 1971, bes. 28-47; A. Mohler 1999,
passim, bes. 367f.; R. Oberheid 2007, bes. 372-374; W. Oberkrome 2007, 224f.; H. Pringle
Professor in Jena (1931-1936) 193
[z]um a[ußer]o[rdentlichen] P[rofessor] gebracht (bis jetzt), Du wirst es zum
o[rdentlichen] P[rofessor] bringen! […] Viel Glück zu den Unterhandlungen mit der
Regierung (am Ende gar mit Minister Frick persönlich). Wenn Du dir [sic] ein
Hakenkreuz ansteckst, wird es gut sein.“1067 Das bedeutet, daß Fritz Schachermeyr
ganz genau gewußt haben muß, was ihn politisch gesehen in Jena erwarten würde.
„Der Reichstagsabgeordnete Frick zog als erster nationalsozialistischer Minister
in das thüringische Innen- und Volksbildungsministerium ein und nahm dort sowohl
an Möglichkeiten wie an Maßnahmen Künftiges en miniature vorweg.“1068 Der
Landbund-Politiker Erwin Baum (1868-1950)1069 hatte die Koalition und den Weg für
Frick in die Landesregierung möglich gemacht. Daß Schachermeyrs Berufung in
dessen Amtszeit fiel, beweist auch sein Brief vom 10. November 1933 an den
nunmehrigen Reichsinnenminister Frick, dem er damals zugleich auch einen
Sonderdruck seines Aufsatzes Die nordische Führerpersönlichkeit im Altertum1070
zukommen ließ. Hier heißt es: „seit Sie mich vor nicht ganz drei Jahren nach Jena
berufen haben.“1071 Es war auch Wilhelm Frick, der den nicht habilitierten Philologen
2006, bes. 34-36; K. Pusman 2008, passim; E. Weisenburger 1999, 161-199; E. Wirbelauer –
B. Marthaler 2006, 929. 1067 A II, M. Fichtenau an Schachermeyrs, Brief vom 23.2.1931. 1068 H. Heiber 1988, 223; vgl. dazu auch H. Koch 1966, 350 und historische Daten in J. John
1995a, 225-234. 1069 K Horkenbach 1931, 500; http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/ger_thu.htm;
http://www.geocities.com/CapitolHill/Rotunda/2209/Thuringen.html. 1070 F. Schachermeyr 1933j, 36-43. 1071 V. Losemann 1980, 56. Daß Schachermeyr Exemplare seiner Werke auch später, und
zwar selbst noch nach seiner Emeritierung, gerne an die zuständigen Minister verteilte, geht
z. B. aus dem Widmungsexemplar seiner Griechischen Rückerinnerung im Lichte neuer
Forschungen (F. Schachermeyr 1983a, Besitz M. Pesditschek) an „Frau Bundesminister Herta
[sic] Firnberg“ (1909-1994) hervor. Seine Autobiographie (F. Schachermeyr 1984) schickte er
an deren unmittelbaren Nachfolger, den jetzigen Bundespräsidenten Heinz Fischer (geb.
1938) (A II, H. Fischer an Schachermeyr, Brief vom 20.12.1984). Aber auch der Nachfolger
Professor in Jena (1931-1936) 194
und Publizisten Hans F. K. Günther nach Jena holte. Die Berufung auf einen
ordentlichen Lehrstuhl mit einem Lehrauftrag für Sozialanthropologie – ursprünglich
sollte dieser auf „menschliche Züchtungskunde“ lauten – erfolgte mit 14. Mai für 1.
Oktober 1930 gegen den Widerstand der allermeisten Professoren. Von diesen hatten
nämlich nur zwei der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät die Berufung
Günthers befürwortet1072. (Übrigens war damals auch Schachermeyrs Vorgänger
Heinrich Walt(h)er Judeich in der Kommissionssitzung gewesen.) An dessen
Antrittsvorlesung am 15. November 1930 über „Die Ursachen des Rassenverfalls des
deutschen Volkes seit der Völkerwanderungszeit“ nahmen auch Hitler, Göring und
Frick teil1073. Günthers Programm war es, Rassenlehre und Antisemitismus auf
biorassistischer bzw. rassenbiologischer Grundlage als scheinbar wissenschaftliche
Disziplinen zu betreiben1074, und Fritz Schachermeyr hat ihn in der Folge auch an
mehreren Stellen1075 zitiert, wobei seine Bewertung immer durchaus positiv
ausgefallen ist. Eugen Fischer (1874-1967)1076, den Fritz Schachermeyr später als
Fischers als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung Hans Tuppy (geb. 1924) wurde
– freilich noch in seiner Eigenschaft als Präsident der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften – mit einem Widmungsexemplar Schachermeyrs, und zwar von Mykene und
das Hethiterreich (F. Schachermeyr 1986a), versorgt (A II, H. Tuppy an Schachermeyr, Brief
vom 17.10.1986). 1072 G. Neliba 1995, 90; U. Hoßfeld 2005, 223-225. 1073 J. John 1983, 285; E. Klee 2001, 231; E. Klee 2003, 208; H.-J. Lutzhöft 1971, 40; R.
Stutz 1995, 132; vgl. auch U. Hoßfeld 1999, 67f., 72-76, der als Titel „Über Ursachen des
Rassenwandels der Bevölkerung Deutschlands seit der Völkerwanderungszeit“ angibt (68). 1074 C. M. Hutton 2005, 35-63; V. Losemann 1980, 45. 1075 Vgl. F. Schachermeyr 1933i, 596f.; F. Schachermeyr 1937g, 631-635; F. Schachermeyr
1940a, 23 und 214 („[…] in den Werken von Clauß und Günther in so ausgezeichneter Weise
dargestellt“); F. Schachermeyr 1944a, 605 Anm. 47; vgl. dazu auch H. Gottwald 2003, 931. 1076 Anatom, Anthropologe; I. Fischer 1932, 410; D. Freudig 1996, 144; Führerlexikon, 123;
B. Gessler 2000; M. Grüttner 2004, 48; H.-C. Harten – U. Neirich – M. Schwerendt 2006,
passim, bes. 373; C. M. Hutton 2005, 68-79, 143-149; E. Klee 2003, 151f.; N. C. Lösch 1997;
Professor in Jena (1931-1936) 195
Inspirationsquelle für seine eigenen einschlägigen „Forschungen“ bezeichnete1077,
hatte sich demgegenüber gegen die Berufung seines einstigen Schülers Günther
ausgesprochen1078.
Offenbar nahm Schachermeyr ziemlich bald nach seinem Dienstantritt in Jena
eine politische Tätigkeit für die Nationalsozialisten auf. In seinem Heidelberger
Personalbogen füllte Schachermeyr eigenhändig aus: „Seit Frühjahr 1931 nat. soz.
Werbearbeit unter den Studenten (von der Kreisleitung Jena bestätigt)“1079. Nach 1945
stellte er selbst sein damaliges politisches Engagement wie folgt dar: „Erst in den
Jahren 1932ff., die in Deutschland ja von so ungeheuer starken politischen
Leidenschaften bewegt waren, ergriff auch mich die leider so suggestive Kraft dieser
trügerischen Zeiten.“1080 Daß sich Schachermeyr schon bald nach seiner Ankunft in
Jena für die NSDAP einzusetzen begann, mochte mehrere Ursachen haben: einerseits
hat er vielleicht als ein guter Historiker den zukünftigen Aufstieg dieser Partei korrekt
vorhergesehen, andererseits hat er sich auch nach 1945 immer wieder ablehnend über
Rationalismus und Aufklärung1081 geäußert und ist wohl zeit seines Lebens ein
A. Mohler 1999, 314; Reichshandbuch, 441f.; E. Rimmele 2002a, 122f.; W. Schlicker 1985,
259-265; E. Stockhorst 2000, 135; P.-A. Taguieff 1995, 60-62; W. Weisbach 1956, 339-342;
M. A. Wes 1997, 229, 237, 242; vgl. auch S. 361-364. 1077 Vgl. S. 361-364. 1078 Vgl. U. Hoßfeld 1999, 59: „Fragen Sie endlich nach seiner Eignung etwa als
akademischer Vertreter der Anthropologie, so muß ich das in dieser allgemeinen Form
ablehnen“ (Brief vom 17.2.1930). 1079 UA Heidelberg, PA 5599; s. auch A. Chaniotis – U. Thaler 2006, 403; S. P. Remy 2002,
74; vgl. dazu E. Badian 1988, 4, der den Beginn von Schachermeyrs politischer Tätigkeit erst
mit 1933 ansetzt; auch V. Losemann 1977, 47f., B. Näf 1986, 136. Von seiner Werbetätigkeit
unter den Studenten für die NSDAP berichtet Schachermeyr in seinen autobiographischen
Schriften nichts. 1080 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 98. 1081 Vgl. etwa F. Schachermeyr 1981a, 382.
Professor in Jena (1931-1936) 196
überzeugter Antisemit gewesen1082. Hinzu kam nun aber auch noch, daß er sich bald
auch in Jena wieder als „Fremdkörper“ fühlen mußte: „Die Professoren bildeten einen
eigenen streng sich absondernden Kries [sic], der große Stücke auf die Erhaltung
preußisch-konservativer Umgangsformen hielt. Es waren charakterlich großartige und
auch wissenschaftlich nicht unbedeutende Leute. In ihrer Atmosphäre steifer
Unnahbarkeit fühlte ich mich aber äußerst ungemütlich, und blieb ein Fremdkörper,
zumal ich dauernd teils wissentlich, teils unwissentlich gegen ihren
Gesellschaftskomment verstieß. Nur mit Langlotz1083 und Blumenthal1084 wie nachher
1082 Vgl. die Andeutung bei S. Deger-Jalkotzy 1988a, 126 und für die Zeit nach 1945 bes. S.
404-412. 1083 Ernst Langlotz (1895-1978) wurde ebenfalls im Frühjahr 1931 nach Jena berufen und war
bei Ludwig Curtius in Heidelberg Assistent gewesen; A. H. Borbein 1979, 706-711; A. H.
Borbein 1988, 268f.: „Wichtig wurde […] die Verbindung zum George-Kreis“ (268); A. H.
Borbein 2005, 239f., 243, 252-254 (v. a. seine Beziehungen zum George-Kreis betreffend);
N. Thomson de Grummond 1996, 658f.; H. Dittmers-Herdejürgen 1982, 607f.; H.-P. Höpfner
1999, 430f.; C. F. Lehmann-Haupt 1931, 529; E. S. Sünderhauf 2004, passim, bes. 285-288;
O. Wenig 1968, 171; Skepsis bei B. Näf 1994, 92 Anm. 32: „Gewisse Zweifel [an einer
besonders engen Freundschaft] entstehen allerdings, wenn man im Protokollbuch der Fakultät
sieht, dass Langlotz den Namen Schachermeyrs konstant falsch schreibt.“ Doch finden sich in
den Briefen von Langlotz an Schachermeyr passim Formulierungen wie „Mein lieber Freund“
(A II, E. Langlotz an Schachermeyr, Brief vom 24.1.1934), „Lieber Fritz“, „meine Frau und
ich wären glücklich[,] Dich, vielleicht auch mit Deiner lieben Frau[,] bei uns zu sehen“ (A I,
E. Langlotz an Schachermeyr, Brief vom 8.1.1958), „Lieber verehrter Freund“, „Dein alter
Ernst“ (A I, E. Langlotz an Schachermeyr, Brief vom 9.6.1958) oder „Lieber und verehrter
Freund“, „die mich an unsere Gespräche in Jena vor 35 Jahren erinnert“, „Es wäre so schön
Dich wieder zu sehen“ (A I, E. Langlotz an Schachermeyr, Brief vom 26.2.1967), und in
inhaltlicher Hinsicht geht aus ihnen hervor, daß zwischen den beiden große Eintracht
bestanden haben muß und daß sie sich beruflich gegenseitig unterstützten (vgl. dazu S. 698). 1084 Baron Albrecht von Blumenthal (1889-1945), Altphilologe, Mitglied des Stefan-George-
Kreises und der NSDAP; IJ 28, 1949, 305; KGL 1931, 136; KGL 1940-41,1, 145; B. Näf
Professor in Jena (1931-1936) 197
mit Herbig1085 freundete ich mich wahrhaft an.“1086 Manfred Mayrhofer schildert die
Aufnahme Schachermeyrs durch die Universität Jena an Hand einer ihm von seinem
väterlichen Freund erzählten Anekdote folgendermaßen: „Jena war damals noch eine
volle Ausprägung der preußisch-protestantischen Universität der Mommsen-Zeit, und
zwischen ihr und dem urwüchsigen katholischen Linzer gab es Reibungen, deren
ungewollte Komik Fritz Schachermeyr selbst am deutlichsten empfand. So erzählte er
mir einmal, daß er dort noch bei jedem Professor – also auch bei jedem Mediziner,
jedem Theologen – einen Antrittsbesuch im Cut machen mußte. Bei einem berühmten
alten Geheimrat bemerkte er eine gewisse Reserve, und auf seine eines Anton
Bruckner würdige direkte Frage ‚Ham’s was, Herr Geheimrat?’ erhielt er auch prompt
die Antwort: ‚Ja, es dreht sich um Ihre Kleidung. Der Kött’ – so sagte man damals –
‚ist ja in Ordnung; aaaaber der Zylinder!’. Auf meine Frage, welchen Makel sein
Zylinder denn gehabt habe, antwortete mir Fritz: ‚I hab’ ja gar kan g’habt; i hab’ an
weichen Hut getragen.’“1087. Dies liest sich zwar wie eine Szene aus einem Schwank,
doch müssen die Demütigungen und Zurückweisungen durch die Jenenser
Professorenkollegen auf Schachermeyr tatsächlich außerordentlich traumatisierend
gewirkt haben – ihre Schilderung nimmt in der Autobiographie nicht weniger als fünf
1994, 92; W. Schuller 2005, 210f., 216-219. Zur NS-Mitgliedschaft vgl. S. Breuer 1995, 234;
P. Hoffmann 1992, 111; R. E. Norton 2002, 731. Just Blumenthal hatte, wie nun T. Karlauf
2007, 564f. zu entnehmen ist, Alexander, Berthold und Claus von Stauffenberg im George-
Kreis eingeführt; zu Blumenthal vgl. weiters auch T. Karlauf 2007, 481, 557, 586, 612, 615,
618, 632. 1085 Reinhard Herbig (1898-1961) promovierte bei Ludwig Curtius in Heidelberg und wurde
1933 nach Jena berufen; S. Altekamp 2008, 187 Anm. 63, 194 Anm. 101; W. Fuchs 1988,
274f.; E. Wirbelauer 2006, bes. 134 Anm. 61. Daß sich Schachermeyr mit dem Archäologen
Herbig gut verstand, geht auch aus einem Brief seines Freundes Ernst Langlotz hervor (A II,
E. Langlotz an Schachermeyr, Brief vom 24.1.1934). 1086 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 10f. 1087 M. Mayrhofer 1995/96, 57.
Professor in Jena (1931-1936) 198
ganze Seiten ein1088. Hier liest man unter anderem: „Denn daß ich als richtiger
Habenichts in diesem Kreis debütierte, merkte ich bald, da ich ja allein von meinem
Gehalt lebte, mir also keine Villa mit Park kaufen, ja nicht einmal mieten konnte. Ich
gehörte also nicht zu den echten Vertretern dieses hohen Standes, von denen so
mancher auf den ihm zustehenden Gehalt überhaupt verzichtete und nur für sein
Vermögen die – Steuerfreiheit forderte. Und damit ist auch schon das Wesentlichste
gesagt, die Professoren hatten sich bis zu dieser Zeit nämlich stets aus steinreichen
Familien ergänzt. Wollte ein Habenichts in diese Kreise eindringen, so mußte er eben
eine Professorentochter heiraten.“1089 Am Ende dieser Schilderung der
„Gruppenarroganz“ der „für meinen Geschmack etwas zu plutokratischen Kreise“
heißt es bedauernd und enttäuscht: „Daran hat nicht einmal das nazistische Regime in
Thüringen und dann auch im Reich etwas zu ändern vermocht. Der entscheidende
Wandel erfolgte erst ab 1945. Das kommunistische Jena hat dann alle Reste der alten
Professorenherrlichkeit hinweggefegt“1090. Diese Formulierung läßt vermuten, daß sich
Schachermeyr 1931 gerade auch von den linken Zügen1091 des Nationalsozialismus
1088 F. Schachermeyr 1984, 140-145. 1089 F. Schachermeyr 1984, 141. 1090 F. Schachermeyr 1984, 144; vgl. auch B. Näf 1994, 92. 1091 Vgl. zu den linken, antibürgerlichen Zügen des Nationalsozialismus jetzt etwa G. Aly
2005 und insbesondere H. Beck 2008, passim, letztere Monographie eine Ausnahme von der
Regel, daß sich universitär verankerte Historiker eher gar nicht gerne mit den links-egalitären
Aspekten der nationalsozialistischen (bzw. auch mussolinifaschistischen) Ideologie und
Machtausübung auseinandersetzen und dieses (Minen-)Feld lieber libertär-konservativen
Amateurhistorikern überlassen, die bei ihrer Darstellung der Gemeinsamkeiten zwischen
Nazis/Faschisten und linken Bewegungen dann üblicherweise zur Übertreibung neigen und
andererseits die Gegensätze über Gebühr zu bagatellisieren trachten; zwei – an und für sich
durchaus interessante – Beispiele für dieses Genre aus jüngster Zeit sind J. Goldberg 2007
und J. Schüßlburner 2008 (der Autor galt bislang als weit rechts verortet, während es sich bei
Lichtschlag um einen eindeutig libertären Verlag handelt). Patrick Bahners faßt rezente
Äußerungen des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass zu seiner Mitgliedschaft bei der
Professor in Jena (1931-1936) 199
angesprochen fühlte und dieser das wohlerworbene und durchaus nachvollziehbare
Ressentiment eines „Habenichts“ aus einer 1918 endgültig verarmten „wohlhabenden
Familie“1092 gegenüber dem professoralen Establishment im besonderen und dem reich
gebliebenen Großbürgertum im allgemeinen zu bedienen wußte. Dies hat
Schachermeyr sogar selbst in einer schon von Beat Näf1093 veröffentlichten Passage im
Lebenslauf-Entwurf „etwa um 1957“1094 ziemlich offen angedeutet: „Meine
Sympathien gegenüber Hitler waren damals nicht gering, da ich in ihm den
Österreicher und vor allem den gebürtigen Linzer [sic] sah, von ihm auch die
Beseitigung des mir so verhaßten preußischen Standesdünkels erhoffte.“ Es ist
allerdings unwahrscheinlich, daß Schachermeyr der Aufbau einer eher
meritokratischen Gesellschaft ohne Standesschranken jemals wirklich ein
Herzensanliegen gewesen ist – die logische Konsequenz seiner späteren
Rassereinheitsphantasien1095 wäre ja vielmehr gewesen, den gesellschaftlichen Rang
Waffen-SS so zusammen: „Das Antibürgerliche am Nationalsozialismus sei entscheidend für
die Mobilisierung seiner Generation gewesen“ (FAZ Nr. 186, 12.8.2006, 1; vgl. Günter Grass
selbst ebd. 35: „Ja, es war antibürgerlich!“). Vgl. auch noch G. Radnitzky 2006, 159-163
(„gegen Ende seines Berufslebens als Politiker stellte Hitler resigniert fest, seine ,größte
Unterlassungssünde‘ sei es gewesen, daß er es versäumt habe, ,auch einen Schlag gegen
rechts zu führen‘“); G. Watson 1998, 71-83 (über Hitler als Sozialisten). 1092 F. Schachermeyr 1984, 142. 1093 B. Näf 1994, 92 Anm. 31. 1094 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, fol. 11. 1095 Bes. in F. Schachermeyr 1940a und 1944a. Vgl. in diesem Zusammenhang das zutiefst
erschütternde, die eigene Vernichtung in Kauf nehmende Bekenntnis zum
Nationalsozialismus und zu dessen offenbar schon damals absehbaren mörderischen
Konsequenzen in einem Brief des durch und durch deutschnational empfindenden jüdischen
Historikers Arnold Berney an seinen Freund und Kollegen Hermann Heimpel im November
1923: „Ich bejahe diese Bewegung, weil sie jung ist, rein, im Kerne von tiefen echten Ideen
angefacht und unberührt von der einerseits verderbt-rationalistischen, andererseits kraftlos-
sentimentalistischen Idealität des marxistischen Socialismus. Ich fürchte für sie, weil sie, noch
Professor in Jena (1931-1936) 200
eines Deutschen allein von seiner Haarfarbe und seinen Schädelmaßen abhängig zu
machen, und in seiner Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte. Versuch einer
Einführung in das geschichtsbiologische Denken1096 wird eine „soziale und
wirtschaftliche Auflockerung des deutschen Volkes“1097 offensichtlich abgelehnt1098.
Auch war Schachermeyr später offenkundig zu lebensklug, um für die Verwirklichung
seiner alles andere als harmlosen, vielmehr zutiefst menschenverachtenden
Rassetheorien auch den eigenen Tod (sc. auf dem „Feld der Ehre“) in Kauf nehmen zu
wollen. Man tut Schachermeyr demnach wohl kein Unrecht, wenn man ihn seinem
aufrichtigen Haß auf die Moderne und alles „Semitische“ zum Trotz eher unter die
opportunistischen als unter die idealistischen Parteigänger des Nationalsozialismus
einreiht.
schwach, unreif und mangels geistig-organisatorischer Durchdringung lebensunfähig, bereits
Conzessionen macht an Christentum und Capitalismus. […] Ganz erfüllt von dem Ja lief ich
durch die Nacht. Ich sah eine neue, reinere höhere deutsche Zukunft. Da fiel es mir plötzlich
ein, daß ich Jude sei. Sie werden Dich exilieren, sie werden Dich aus Deinem Beruf stoßen,
wußte ich da. Und hatte nichts dabei als ein Lächeln. Sie können mich töten und ich muß es
bejahen, wenn ich weiß, sie tuen es mit Reinheit und Unschuld. Wenn sie durch dieses
Vernichten Kraft gewinnen, will ich vernichtet sein, weil ich der ihre bin. So bin ich heiter
geblieben und bin es noch“ (zit. nach M. Matthiesen 1998, 23f.). 1096 F. Schachermeyr 1940a; vgl. B. Näf 1994, 95f.; S. Rebenich 2005, 45f.; siehe auch S.
297-319. 1097 F. Schachermeyr 1940a, 226. 1098 In seinen späten Schriften (F. Schachermeyr 1981a und F. Schachermeyr 1984) ist dann
passim eigener Standesdünkel mit Händen zu greifen – schon wer nur „Schallplattenmusik“
hört, ist für Schachermeyr dann total „proletarisiert“ (1981a, 354). Meines Wissens hat sich
Schachermeyr freilich überhaupt niemals anerkennend über die „Arbeiter der Faust“ geäußert
– er ist also wohl zeit seines Lebens (oder jedenfalls spätestens seit seinem Eintreffen in Jena)
einfach ein Kleinbürger mit einem antigroßbürgerlichen Affekt gewesen, der eigentlich lieber
einer NSDKP (mit einem „K“ eher für „Künstler“, der er nach seinem Selbstverständnis
immer gewesen ist) angehört hätte.
Professor in Jena (1931-1936) 201
Von den allermeisten Professorenkollegen offenbar entweder abgelehnt oder
abgestoßen, suchte Schachermeyr verständlicherweise Freunde in anderen Kreisen zu
gewinnen. So begann er bald nach seinem Eintreffen in Jena einen regen Briefwechsel
mit einem gewissen Erich Brandenburg (1877-1936)1099, der seit 1931 als
Lehrbeauftragter für Altorientalische Kulturgeschichte an der Universität Jena wirkte.
Die mir zugänglichen vier Briefe Brandenburgs stammen alle aus dem Jahr 1931, aus
ihnen ist keinerlei Anzeichen für eine Auseinandersetzung oder einen offen
ausgetragenen Konflikt entnehmbar, wohl aber könnte das offenkundige Abreißen des
Briefverkehrs selbst als solches gewertet werden. Schachermeyr scheint nach seiner
Berufung mit dem thematisch auf ähnlichem Gebiet arbeitenden Brandenburg schon
im Mai 1931 Fühlung aufgenommen zu haben1100. Jedenfalls dürften die beiden
Herren einen Nachmittag in der Wohnung Schachermeyrs miteinander verbracht
haben. Eine Gegeneinladung wurde ausgesprochen, einer Freundschaft schien nichts
im Wege zu stehen1101. Brandenburg schrieb: „Aller Wahrscheinlichkeit nach werde
ich sowohl Frau Förster-Nietzsche1102 und auch Hr. ORR. Stier noch vor dem Ersten
sehen und werde, wie wir es verabredet haben, ‚sondieren’, um Ihnen dann zu
berichten. Was ich in dieser Hinsicht tun kann, tue ich nach Ihrem wirklich so
freundlichen Entgegenkommen mir gegenüber aufrichtig gerne! Da ist es nur
selbstverständlich, daß man sich in diesen Dingen gegenseitig hilft; meinerseits
wenigstens soweit ich es kann! Denn ich bin zu jedem stets so, wie er mich behandelt!
1099 AfO 11, 1936-1937, 282; KGL 1950, 2373; C. F. Lehmann-Haupt 1931, 529; W.
Schumann 1958, 640, 644. 1100 A I, E. Brandenburg an Schachermeyr vom 14.5.1931. 1101 A I, E. Brandenburg an Schachermeyr vom 24.5.1931. 1102 Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935); Dr. Phil. h. c. der Universität Jena, Schwester
des Philosophen, verheiratet mit Bernhard Förster (1843-1889), der antisemitische Schriften
verfaßte (DBE 3, 1996, 362; C. Hoffmann 1988, 128; T. Mittmann 2006, 65-71; A. Mohler
1999, bes. 337); vgl. DBE 3, 1996, 365; C. Diethe 2001; Reichshandbuch, 463; L. Salber
2007, 13-98.
Professor in Jena (1931-1936) 202
Da das aber von Ihnen in der wirklich freundlichsten Art geschah, so wäre ich ganz
einfach ein V....kerl [sic; gemeint ist wohl: Viechskerl], wenn ich mich nicht zu
‚revenchieren’ [sic] versuchte!“1103 Im nächsten Brief Brandenburgs klärt sich auf, in
welcher Sache dieser „sondierte“. „Was nun Ihre Sachen hier anbelangt, so war ich
gestern bei Stier’s [sic]. Frau St[ier] wird sich sehr freuen[,] Sie näher kennen zu
lernen [sic], also machen Sie senza zeremonie [sic], dh. OHNE Gehrock etc. Besuch
dort, auch allein; wenn dann später Ihre Gattin defin[itiv] nach J[ena] übersiedelt ist,
gehen Sie mit ihr hin, dh. wenn Sie vorher schon da waren, werden St[ier]’s [sic] Sie
dann wohl gleich zu einem Vortrag oder degl. [sic] auffordern. Fr. St[ier] sagte gestern
ganz von selbst: ‚Ich würde Prof. S[chachermeyr] am liebsten jetzt gleich zum 7.
auffordern, damit er dann bei uns auch noch gleich verschiedene andere Leute kennen
lernt [sic]; aber ich habe bestimmt auf einen gew[issen] %-Satz von Absagen
gerechnet, aber keine bekommen, weiß wirklich nicht, wie ich die Leute alle lassen
[sic] soll, kann also unmöglich noch jemand dazu bitten!’“1104 Gleichzeitig machte er
sich erbötig, Schachermeyr bei Elisabeth Förster-Nietzsche einzuführen, war
Brandenburg doch auch ein „alter Freund des Archivs1105“1106. Es ging also darum,
Bekanntschaften, Freundschaften, Seilschaften, kurzum: nützliche soziale Kontakte
anzubahnen. So nebenbei erfahren wir hier auch, daß Schachermeyr unter
„Heuschnupfen“ litt1107, der ihn offenbar am Ausgehen hinderte. Hier empfahl
1103 A I, E. Brandenburg an Schachermeyr vom 24.5.1931. 1104 A I, E. Brandenburg an Schachermeyr vom 30.5.1931. 1105 Gemeint ist das Nietzsche-Archiv in Weimar, das schon zu Lebzeiten des Philosophen in
dessen Haus, der Villa Silberblick, eingerichtet wurde und zu dessen Besuchern auch sein
Förderer Wilhelm Frick gehörte; vgl. C. Diethe 2001, 135-137; D. M. Hoffmann 1991; L.
Salber 2007, 90-98. 1106 A I, E. Brandenburg an Schachermeyr vom 30.5.1931. 1107 Vgl. auch A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatierter Brief, wohl 1931, und
A II, J. Friedrich an Schachermeyr, Karte vom 18.5.1931: „Von Heufieber habe ich in diesem
Jahre glücklicherweise noch so gut wie nichts gemerkt. Wegen der kritischen Zeit kann ich
Professor in Jena (1931-1936) 203
Brandenburg Schachermeyr eine Therapie, mit der er bereits zwei Bekannte „radikal
geheilt habe“, die eher als Roßkur bezeichnet werden kann – „als sie dies […] sehr
unangenehme Übel nahem [sic] fühlten, nahmen sie fleißig Schnupftabak, der ja die
Nase völlig desinfizierte, wie ich es früher mal durch genaue mikroskop[ische]
Versuche festgestellt habe.“1108 Bei den Stiers verkehrte auch Wilhelm Frick. Hier
hätte Schachermeyr durch persönlichen Kontakt mit den höchsten einschlägigen
Kreisen für den Nationalsozialismus gewonnen worden sein können. Ob dies
tatsächlich der Fall gewesen ist, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Nach den
Angaben Schachermeyrs dürfte sich sein Verhältnis zu Brandenburg in der Folge
ziemlich abgekühlt haben, jedenfalls sobald dieser „nach meinem Lehrstuhl in
Jena“1109 verlangte.
Viel erfreulicher gestaltete sich da sein Verhältnis zu den Studenten. Zwar hatte
Schachermeyr in Jena zunächst nur fünf Leute in seiner Lehrveranstaltung, wobei er
sich zufrieden darüber äußerte, daß er „kein einziges Weib im Kolleg“1110 hatte. Doch
war er als Lehrer offenbar schon bald so beliebt, daß zu Beginn des Sommersemesters
1932 „das Vorhandensein eines größeren Hörsaales[,] als er verfügbar ist, erforderlich
gewesen“1111 wäre. Die Lehrtätigkeit „befriedigte“ ihn seinerseits „durchaus“1112, und
überhaupt hören wir von ihm über seine Jenenser Studenten nur Gutes1113. „Sie waren
leider gar keine Angaben machen, die ist verschieden je nach Individuum, dem Orte und vor
allem [a]uch nach dem Wetter des betreffenden Jahres.“ 1108 A I, E. Brandenburg an Schachermeyr vom 30.5.1931. 1109 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93. Vgl. u. S. 216, 222, 227, 230, 424. 1110 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatierter Brief, wohl Beginn des
Sommersemesters 1931. 1111 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 46. 1112 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 11. 1113 Vgl. A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatierter Brief, wohl Beginn des
Sommersemesters 1931.
Professor in Jena (1931-1936) 204
kenntnisreich und wahrhaft interessiert, ich kam über das Seminar mit Ihnen [sic] in
enge Fühlung und empfand das als besonderes Glück. Auch begann ich, ohne daß sie
es merkten, von ihnen zu lernen. Bald hatte ich nämlich erkannt, daß sie gewähnt [sic]
waren, viel mehr und klarer begrifflich (und weniger emotional beeinflußt) zu denken,
als ich das in Österreich je erlebt hatte. Hierin waren sie mir klar überlegen[,] und ich
verdanke es ihrem Umgang, wenn ich mich nun in eine strenge Schule nahm, und
diese mir so neue Art des Denkens von Grundauf [sic] anzueignen begann.“1114 In
seiner Autobiographie dankt Schachermeyr seinen Jenenser Studenten sogar auf zwei
ganzen Druckseiten dafür, ihm zu einem „zuchtvollere[n] Denken“ bzw. zu einer
„anderen, mehr philosophisch fundierten Denkart“ verholfen zu haben1115. Von seinen
Studenten erwähnt Schachermeyr freilich nur einen namentlich, mit dem er
offensichtlich über eine Lehrer-Schüler-Beziehung hinaus eine intensive, auch
familiäre Freundschaft pflegte. „Für den Universitätsprofessor gibt es, da er ja schon
ganz ‚oben’ sich einstellen muß, nun eine ganz andere Freundschaft, nämlich die eben
von ‚Oben’, und zwar mit ausgewählten Studenten. Verstehen bedeutet da viel mehr,
denn da kommt es nicht nur auf das Wort für Wort Gesagte [an], sondern vor allem auf
das, was zwischen den Worten, gleichsam zwischen den Zeilen steht. Die fand ich
gerade in Jena, aber die allermeisten sind dann im I. [sic] Weltkrieg gefallen. Nur mein
Eberhardt1116 ist mir damals geblieben und er wie seine Familie hat mir immerzu die
1114 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 11. 1115 F. Schachermeyr 1984, 150-152; vgl. auch B. Näf 1994, 92. 1116 Hans Eberhardt († 1975) trat 1949 in „Freyschmidt’s Buchhandlung“ ein und war seit
1959 Alleininhaber dieser Firma (vgl.
http://www.freyschmidts.de/php/index.php?page_id=160). Er ist wohl jener Hans Eberhardt,
der für die Zeit von WS 1934/35 bis WS 1936/37 als NS-Studentenführer (Anführer des
NSD-Studentenbundes) in Jena nachgewiesen ist. M. Bruhn 2001, 77 = M. Bruhn 2003, 253
beurteilt seine Tätigkeit wie folgt: „Beide [sc. Eberhardt und sein Nachfolger Karl Keppel]
festigten ihre Position, indem sie Leute mit den studentischen Ämtern betrauten, deren
Professor in Jena (1931-1936) 205
Treue gehalten, auch als er der Besitzer der großten [sic] Buchhandlung in Kassel
geworden. Und wenn er von uns gegangen, – wenn seine Familie zu mir kommt, dann
ist auch er immer mit uns.“1117 Im Vorwort seiner rassistischen Monographie von 1940
Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte. Versuch einer Einführung in das
geschichtsbiologische Denken1118, einem erstrangigen Probestück seines neuen
„sauberen“ und „schlüssigeren Denkens“1119, das „meinen studentischen Kameraden
an der Universität Jena 1931-1936 gewidmet“ ist, formulierte Schachermeyr dann, daß
er „das Glück hatte, an einer Universität zu wirken, welche für rassenkundliche und
biologische Betrachtungsweise aufgeschlossen ist, wie kaum eine andere. Es ist
entstanden nicht in der Einsamkeit der Studierstube, sondern in lebendigem
Gedankenaustausch mit einer kampfesfrohen neuen Generation. Der Kameradschaft,
welche mich damals mit meinen Schülern wie mit der Jenaer Studentenführung1120
Loyalität sie sicher sein konnten, die aber nicht in der Lage waren, die anstehenden Aufgaben
zu erledigen“ (zu Eberhardt als Führer der Jenenser Studenten vgl. auch M. Rademacher
2000, 278; Thüringische Landesuniversität Jena. Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 1935/36, 1. November bis 22. Februar und Sommersemester 1936, 1. April
bis 30. Juni, 7; J. John – O. Lemuth 2003, 1129; M. Bruhn 2003, 247, 249, 252f.). Zuletzt (in
der Zeit WS 1935/36 bis WS 1936/37) war er zum Gaustudentenführer aufgestiegen. Ein
„Staatsrat Eberhardt“ scheint auch als Mitglied des Vorstandes des Nietzsche-Archivs auf (D.
M. Hoffmann 1991, 81). Zu Schachermeyrs Hörern in Jena zählte im übrigen auch, offenbar
weit weniger geschätzt, der spätere Ordinarius für Klassische Archäologie an der Universität
Innsbruck (ab 1972) Bernhard Neutsch (1913-2002); vgl. H. Vetters 1980, 7 und auch F.
Krause – F. Marwinski 1999, 160 (Neutsch 1936 „Hilfsassistent“ an der Univ. Jena) sowie o.
S. 56f. Anm. 216 und u. S. 521, zu Neutsch im allgemeinen auch noch F. Krinzinger 2003,
13f. 1117 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Die besten Freunde für mich und
meine Wissenschaft, fol. 7. 1118 F. Schachermeyr 1940a. 1119 F. Schachermeyr 1984, 152. 1120 Damit ist wohl sein Schüler Hans Eberhardt gemeint.
Professor in Jena (1931-1936) 206
verband, die uns seither geblieben ist und immer verbinden wird, sei darum auch diese
Arbeit gewidmet“1121, d. h., daß sich Schachermeyr im großen ganzen in Jena unter
einer Studentenschaft, die bereits vor 1933 mehrheitlich die NS-Liste gewählt
hatte1122, doch wohlgefühlt haben muß.
In den Sommerferien des Jahres 1931 hielt sich Schachermeyr in seiner alten
Heimat in Innsbruck auf, wo er in der zweiten Septemberhälfte mit den beiden
Orientalisten Viktor Christian und Ernst Weidner zusammentraf1123. Das Kapitel
Innsbruck war für ihn nämlich keineswegs schon abgeschlossen.
Berufungsverhandlungen mit dem Bundesministerium für Unterricht in
Österreich – Nachfolge Carl Lehmann-Haupt in Innsbruck, Bruch mit
Lehmann-Haupt
Obwohl Schachermeyr „die Arbeitsmöglichkeiten in Jena viel günstiger“1124 als
die in Innsbruck fand, plante er von Anfang an, bald wieder nach Tirol
zurückzukehren, und sondierte in dieser Hinsicht sogleich bei den Innsbrucker
Professoren Ernst Kalinka, August Haffner und Harold Steinacker auf brieflichem
Wege1125. Dabei dachte er natürlich daran, die Nachfolge seines akademischen Lehrers
und Freundes Carl Friedrich Lehmann-Haupt anzutreten, erreichte dieser doch 1931
schon das siebzigste Lebensjahr. Das Antwortschreiben Kalinkas ist erhalten. Dieser
versicherte ihm, „dass ich das Meinige tun werde, um Sie nach Innsbruck
zurückzuführen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet“1126. Jedoch scheint er
1121 F. Schachermeyr 1940a, [7]f. 1122 Vgl. M. Bruhn 2001, 16f.; G. Steiger 1960, 102. 1123 A II, V. Christian an Schachermeyr, Karte vom 15.9.1931. 1124 A II, W. Ensslin an Schachermeyr, Brief vom 16.12.1931. 1125 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatiert, wohl 1931. 1126 A II, E. Kalinka an Schachermeyr, Brief vom 7.5.1931.
Professor in Jena (1931-1936) 207
Zweifel gehabt zu haben, daß Schachermeyr seinen Rückkehrwunsch mittelfristig
weiterhin hegen würde, „denn Jena ist […] ein ganz entzückendes Städtchen[,] und
Ihre nächsten Fachkollegen scheinen Ihnen, wie schon Ihre Berufung zeigt, durchaus
wohlgesinnt zu sein; auch mit dem Institut sind Sie vollauf zufrieden. Da Sie kein
Griesgram und geselligen Vergnügungen nicht abhold sind, werden Sie gewiss
rascher, als Sie glauben, dort festen Fuß fassen[,] und Sie werden vielleicht schon im
Sommer über Ihre jetzige Stimmung hinausgewachsen sein“1127, fügte er aufmunternd
hinzu. Schachermeyr selbst sah seine nunmehrige Stellung, die ein besseres
Einkommen als jene als Gymnasiallehrer mit sich brachte, in einem Brief an seine
Frau „in erster Linie als die [sic] Etappe zur Konsolidierung unseres Hausstandes“1128.
Er schrieb hier im besonderen von „Kleiderschulden“, die er bzw. seine Frau gemacht
hatten und die jetzt beglichen werden konnten, und fuhr fort: „Wenn wir dann nach
Innsbruck zurückgehen, sind wir auf alle Fälle schon viel besser eingearbeitet und
können dann dort ganz anders anfangen. Ohne diesen Umweg wären wir aus der alten
Wohnung und damit aus der alten Wurschtelei [sic] doch nie herausgekommen. – Und
noch ein grosses Glück. Stelle Dir vor, ich wäre erst später und unter Umständen,
welche ein Zurückgehen nicht mehr ermöglichten, hierher gekommen!“1129 Sein Du-
Freund Forrer hatte schon in seinem Gratulationsschreiben vom Februar der Hoffnung
Ausdruck gegeben, daß Jena nur eine Etappe sein werde und daß Schachermeyr recht
bald als Ordinarius nach Innsbruck zurückkehren könne1130. Daß Schachermeyrs
Rückkehrabsichten durchaus auf der Hand lagen, bezeugt auch ein Schreiben seines
Innsbrucker Kollegen Hans Kofler (1896-1947)1131 vom Juni desselben Jahres, in dem
1127 A II, E. Kalinka an Schachermeyr, Brief vom 7.5.1931. 1128 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatiert, wohl 1931. 1129 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatiert, wohl 1931. 1130 A II, E. Forrer an Schachermeyr, Brief vom 24.2.1931. 1131 H. W. Duda 1948/52, 152-155; J. Fück 1955, 259; KGL 1935, 701; KGL 1950, 2428.
Professor in Jena (1931-1936) 208
es heißt: „Du bist ja jetzt ‚fein heraus’ und wirst bald wieder in Innsbruck auftauchen,
um das Erbe Lehmann-Haupts anzutreten“1132.
Im September 1931 stellte der Prähistoriker, Nationalsozialist und spätere
Unterrichtsminister Oswald Menghin (1888-1973)1133 aus Kairo, wo er damals neben
seiner Professur in Wien eine weitere an der ägyptischen Universität innehatte, eine
sehr vertrauliche Anfrage an Schachermeyr. Er wollte wissen, ob Schachermeyr, den
er wenig später als „altbefreundete Seele“1134 bezeichnete und mit dem er dann auch
noch nach 1945 Kontakt hatte1135, „auf die Nachfolgeschaft [sic] Lehmann-Haupts in
Innsbr[uck] reflektiere, ob Lehmann-Haupt [ihn] vorschlagen wird“1136, und gab nach
einer offenbar positiven Antwort seiner Hoffnung Ausdruck, „daß die Sache Ihnen
zufällt“1137, was Schachermeyrs Zuversicht sicher zusätzlichen Auftrieb gab.
Gleichzeitig geht aus der Korrespondenz mit Menghin hervor, daß Schachermeyr
bereits damals eine Professur in Wien als eigentliches Ziel vorschwebte. Ausführlich
referiert Menghin seine Sicht der Dinge: „Was Wien anlangt, so glaube ich, daß Sie
von Innsbruck aus leichter hinkommen werden als von Jena, wenn es auch keineswegs
ausschlaggebend ist, wo Sie sitzen. Die Hauptsache sind bekanntlich immer die
1132 A II, H. Kofler an Schachermeyr, Brief vom 1.6.1931. 1133 E. Bruckmüller 2004, II, 402; F. Fellner – D. A. Corradini 2006, 279f.; R. S. Geehr 1986,
9-24; M. Grüttner 2004, 117; U. Halle 2008, 153; U. Ibler 1987, 111-123; H. Jankuhn 1974,
540-546; S. Karwiese 1976-1977, 55; G. Kossak 1999, 45f., 116; K. Kromer 1994, 75f.; H.
Matis 1997, 16 Anm. 13; K. Pusman 2008, passim; H. Swozilek 2002, 462, 465f.; O. H.
Urban 1996, bes. 3-10; O. H. Urban 2002, bes. 23-25, 43 (zu Menghin als Dichter); O. H.
Urban 2003, 73-78, 80. 1134 A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 4.12.1931. 1135 A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 17.6.1967 nennt ein Treffen in Wien im
Sommer 1966, Menghin unterschreibt mit „Ihr alter O. Menghin“, ähnlich auch auf der Karte
A III, O. Menghin an Schachermeyr vom 8.3.1970 „Ihr alter Menghin“ wie auch im Brief A
II, O. Menghin an Schachermeyr vom 12.6.1970. 1136 A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 16.9.1931. 1137 A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 4.12.1931.
Professor in Jena (1931-1936) 209
persönlichen Beziehungen. Sie müssen diese sorgsam pflegen, bes[onders] zu Egger,
der in der Frage der Nachfolgerschaft für Wilhelm – diese Lehrkanzel kommt für Sie
wohl in Betracht – sicher das erste Wort zu reden hat. Wilhelm ist kränklich, man kann
nicht wissen, wann er nicht mehr mittut. […] Keils Aussichten vermag ich auch nicht
zu beurteilen. Er ist mit Egger von alther befreundet u[nd] wenn er kommen will,
sicher eine schwer überwindliche Konkurrenz. Er scheint aber in Professorenkreisen
nicht sehr beliebt, vielleicht weil er ein etwas gerader Michel ist.“1138
Auch der früher in Innsbruck tätige Geograph Johann Sölch, damals gerade
Professor in Heidelberg, beneidete Schachermeyr bereits in einem Schreiben vom 27.
Oktober 1931 „um die Hoffnung und die Möglichkeit, vielleicht in Bälde wieder
einmal in die Heimat zurückverlangt zu werden“1139. Er hatte nämlich offenbar soeben
erfahren, daß am 21. Oktober vom Bundesministerium für Unterricht um „Weisung in
der Frage der Neubesetzung der Lehrkanzel für Alte Geschichte, die mit der
Zuruhesetzung des ordentlichen Professors Geh.Rat Lehmann-Haupt freiwerden
wird“1140, erbeten worden war.
Und tatsächlich wollte die Universität Innsbruck in der Folge offensichtlich
unbedingt Schachermeyr als Nachfolger seines Lehrers Carl Friedrich Lehmann-Haupt
gewinnen, als dieser nach Absolvierung eines Ehrenjahres mit Ende des Studienjahres
1931/32 emeritiert werden sollte1141. Für die Stelle, die aus Einsparungsgründen nur
mit einem außerordentlichen Professor1142 für „Alte Geschichte einschließlich der
altorientalischen Geschichte“ besetzt werden sollte, wurden in der Sitzung des
Professorenkollegiums der Innsbrucker Universität am 3. Mai 1932 folgende
Wissenschaftler in Vorschlag gebracht: primo loco Dr. Fritz Schachermeyr, secundo et
1138 A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 4.12.1931. 1139 A II, J. Sölch an Schachermeyr, Brief vom 27.10.1931. 1140 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 23. 1141 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 22. 1142 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 24.
Professor in Jena (1931-1936) 210
aequo loco Dr. Friedrich Bilabel, Privatdozent an der Universität Heidelberg, und Dr.
Ernst Meyer, noch immer außerordentlicher Professor in Zürich1143.
Unter anderen wurden auch Johannes Sundwall (1877-1966)1144, Professor für
Alte Geschichte in Åbo in Finnland, und Fritz Moritz Heichelheim, bis 1933
Privatdozent für Alte Geschichte in Gießen, sowie Friedrich Wilhelm König,
Privatdozent für Geschichte des Alten Orients in Wien, Franz Leifer, Privatdozent an
der Juridischen Fakultät in Wien, Althistoriker und Etruskologe, Franz Miltner (1901-
1959)1145, Privatdozent für Griechische Geschichte in Wien, und Franz Schehl,
Privatdozent für Alte Geschichte in Graz, gewürdigt, aber nicht als geeignet für diese
Professur befunden, deren Schwerpunkt auf dem Gebiet der Geschichte des Alten
Orients liegen sollte. Von seiten der Universität Innsbruck wurde betont, daß man
Schachermeyr primo et unico loco vorgeschlagen hätte, wenn nicht vom Ministerium
ausdrücklich ein Ternavorschlag verlangt worden wäre1146, wurde doch explizit
jemand gesucht, der im besonderen mit der Geschichte des Alten Orients und den
entsprechenden Quellensprachen vertraut war1147. Man schlug seitens der Universität
auch gleich vor, für Schachermeyr „mit seiner Berufung zugleich die Verleihung des
1143 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 28; vgl. C. F. Lehmann-Haupt 1933, 160; F.
Schachermeyr 1984, 172 und A II, A. Nehring an Schachermeyr, Brief vom 21.7.1932. Daß
Schachermeyr einen Ruf an die Universität Innsbruck erhalten hatte, berichtete auch die
Jenaische Zeitung vom 9.8.1932, 4 (Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1). 1144 E. Grumach 1967, 1-5; R. Westman 1970, 219f. 1145 E. Bruckmüller 2004, II, 416; K. Christ 2006, 68f.; DBE 7, 1998, 146; F. Fellner – D. A.
Corradini 2006, 284; H.-C. Harten – U. Neirich – M. Schwerendt 2006, 77; J. Keil 1959,
654f.; J. Keil 1960, 361-372; E. Klee 2003, 412; W. Kleindel 1987, 349; K. R. Krierer 1999;
erweiterte Fassung K. R. Krierer 2001, 217-224; V. Losemann 2007a, 317, 321; M.
Pesditschek 2009a, im Druck; R. Teichl 1951, 201f.; C. Ulf 1985, 47-59; W. Weber 1984,
389; I. Weiler 2002, 114f.; G. Wlach 1998, 126-128; Y. Wolf 2003, 234f. 1146 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 28, 46. 1147 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 39.
Professor in Jena (1931-1936) 211
Titels eines ordentlichen Universitätsprofessors zu verbinden“1148, damit er zumindest
die gleiche Stellung wie in Jena erhalte.
Sofort nach diesem Beschluß des Innsbrucker Professorenkollegiums wandte
sich Bilabel erneut brieflich an Schachermeyr, um „für den Fall, daß Sie ablehnen,
diesmal nichts [zu] versäumen“1149. Weiter beschrieb er seine Lage, unter der er litt
und wie sie damals auch andere junge Wissenschaftler ohne Professorenstelle traf: „Da
sich in nächster Zeit kaum etwas erledigt u[nd] ich nun zum 3. mal [sic] an z[we]iter
Stelle stehe, so werden Sie es mir nachfühlen, daß ich, falls Chancen gegeben sind, sie
diesmal benützen will. Ich stehe, offengesagt, zudem mit Wilhelm Weber schlecht,
weil ich ihm einmal in einer Rezension einige Sünden vorgeworfen habe. So i[st] bei
der geringen Zahl von sich in den nächsten Jahren erledigenden Stellen für mich die
Frage Innsbruck sehr wichtig. Eine andere Bitte, die ich ebenfalls schon jetzt
aussprechen möchte, ist die, ob Sie im Falle Ihres Wegganges in Jena mich dort
empfehlen könnten oder wollten?“1150 Ende Juni sah es noch so aus, als ob eine
schnelle Berufung Schachermeyrs erfolgen könnte, denn Ensslin schrieb. „Erfreulich
war bei der Sache auch, daß sich im Falle der althistorischen Lehrkanzel in Innsbruck
das Ministerium rascher zu Beschlüssen bewegen ließ“1151.
Auch die Thüringische Unterrichtsverwaltung sperrte sich nicht, Schachermeyr
mit 1. April 1933 abzuberufen1152, und so begab sich Schachermeyr nach einer
1148 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 46. 1149 A I, F. Bilabel an Schachermeyr, Brief vom 10.5.1932. 1150 A I, F. Bilabel an Schachermeyr, Brief vom 10.5.1932. 1151 A II, W. Ensslin an Schachermeyr, Brief vom 25.6.1932. 1152 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 51; dagegen berichtet die Jenaische Zeitung vom
9.8.1932, 4 (Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1): „Das
Volksbildungsministerium ist indessen eifrigst bemüht, die beiden Dozenten [sc.
Schachermeyr und Langlotz, der einen Ruf nach Frankfurt erhalten hatte] Jena zu erhalten.
Obwohl beide Professoren erst verhältnismäßig kurze Zeit in Jena lehren, hofft man bei den
Professor in Jena (1931-1936) 212
längeren Periode sommerlichen „Stillschweigens“1153 schließlich Anfang Herbst nach
Wien, um dort am 22. September 1932 selbst mündlich über die Berufungsmodalitäten
zu verhandeln1154 – dabei wohnte er möglicherweise bei Franz Leifer, der ihn
ausdrücklich eingeladen hatte und ihm in seiner Wohnung nicht nur ein Zimmer,
sondern auch einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen wollte1155, und er besuchte bei
dieser Gelegenheit auch wieder Amalie Bauer1156. Bei den Gesprächen im Ministerium
bot Schachermeyr dann an, auf einen Teil seiner Bezüge verzichten zu wollen1157,
woferne die Professur nur als Ordinariat deklariert würde. Da bedeutete man ihm zwar,
daß dergleichen „nach dem bestehenden Geh[alts-]Schema gar nicht verwirklicht
werden könnte“1158, sicherte ihm jedoch die Verleihung des Titels eines ordentlichen
Universitätsprofessors zu1159. Obwohl nun diese Verhandlungen dem Anschein nach
nicht gescheitert waren, verharrte das Ministerium fortan nicht nur in Untätigkeit,
zuständigen Stellen, daß sie der Landesuniversität Jena treu bleiben und die ehrenvollen
Berufungen ablehnen werden.“ 1153 „Über das Stillschweigen der Regierung kann ich mich freilich bei der jetzigen
finanziellen Situation wirklich nicht wundern“ (A II, F. Miltner an Schachermeyr, Karte vom
17.9.1932). 1154 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 62; vgl. auch A II, A. Wilhelm an Schachermeyr, Brief
vom 9.10.1932. Schachermeyr war offenbar auch schon einige Zeit davor in Wien gewesen,
wie aus Wilhelm Kubitscheks Schreiben hervorgeht: „Darf ich Ihnen direkt bei dieser
Gelegenheit ausdrücken, wie sehr es mir leid getan hat, Sie zur Zeit Ihrer Anwesenheit in
Wien vor einigen Wochen nicht getroffen zu haben?“ (A II, W. Kubitschek an Schachermeyr,
Karte vom 2.9.1932). 1155 A II, F. Leifer an Schachermeyr, Brief vom 20.7.1932. 1156 A II, A. Wilhelm an Schachermeyr, Brief vom 9.10.1932; für weitere damalige Wiener
Begegnungen Schachermeyrs s. S. 246f. 1157 Vgl. AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 51f.; AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 54; AdR,
PA Fritz Schachermeyr, fol. 66. 1158 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 54. 1159 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 55.
Professor in Jena (1931-1936) 213
sondern sogar Sprachlosigkeit. Schließlich erkundigte sich Schachermeyr sowohl am
27. Oktober 1932 als auch am 27. November 1932 brieflich im Ministerium nach dem
Stand seiner Berufung, „damit ich Fakultät und Regierung diesbezüglich unterrichten
kann“1160, aber offenbar ohne jede Reaktion.
Bereits am 22. Oktober 1932 hatte der Innsbrucker Ordinarius für Geschichte
und spätere „Anschlußrektor“1161 Harold Steinacker Schachermeyr „streng
vertraulich“1162 über die Situation an den österreichischen Universitäten informiert:
„Den Sachaufwand haben sie [sc. die Herren im Finanzministerium] bereits für 1933
so gründlich beschnitten, dass das Unterrichtsministerium die Dotation für 33
überhaupt einstellen musste; unse[re] Institute werden nur die Auditoriengelder zur
Verfügung haben. Natürlich wird das U[nterrichts-]Ministerium, und noch mehr die
Fakultäten, sich energisch wehren[,] und es wird das meiste von den Plänen des
F[inanz-]Ministeriums als undurchführbar zurückgestellt werden. Wohl aber werden
wir selbst zur Abwehr schlimmerer Dinge weitgehende Opfer freiwillig anbieten
müssen. Ich darf auf die verschiedenen Vorschläge nach Wunsch des Dekans nicht
eingehen.“1163
In den folgenden Wochen wurde dann immer deutlicher, daß das
Unterrichtsministerium die Verhandlungen mit Schachermeyr offenbar endgültig
abgebrochen hatte, wohl weil das Bundesministerium für Finanzen seine
grundsätzliche Zustimmung zur Wiederbesetzung dieser Lehrkanzel als
Extraordinariat für das Jahr 1933 aufgrund der Notlage der Bundesfinanzen1164 nicht
1160 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 64; vgl. auch AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 67. 1161 P. Goller – G. Oberkofler 2003, 8. 1162 A II, H. Steinacker an Schachermeyr, Brief vom 22.10.1932. 1163 A II, H. Steinacker an Schachermeyr, Brief vom 22.10.1932. 1164 D. Stiefel 2000, 17-23; A. Teichova 2000, 4-7; vgl. auch D. Stiefel 1988, 95: „Von 1929
bis 1933 sank das Brutto-Nationalprodukt um 25%, der Produktionsindex um 37%, der Index
des allgemeinen Geschäftsgangs um 41%, die öffentlichen Einnahmen aber nur um 13%.
Zwar waren die Steuereinnahmen prinzipiell dem Konjunkturverlauf gefolgt, gleichmäßig,
Professor in Jena (1931-1936) 214
mehr aufrechterhalten konnte und ausdrücklich kein Geld für eine Berufung aus dem
Ausland vorhanden war1165, daher an eine Wiederbesetzung am 1. April dieses Jahres
– so wie zunächst vorgesehen – nicht zu denken war. Schachermeyrs finanziell doch
ins Gewicht fallende Forderung, ein Ordinariat für ihn einzurichten, war dabei
sicherlich nicht hilfreich gewesen1166. Ein namentlich nicht bekannter Beamter im
Ministerium für Cultus und Unterricht notierte damals: „Ich will darüber, dass das
B[undes-]Min[isterium] f[ür] Fin[anzen] dieser Berufung und überhaupt einer
Auslandsberufung im konkreten Falle nicht zustimmen zu können erklärte, weiter kein
Wort verlieren, zumal hieraus bereits die entsprechenden Folgerungen gezogen, d. h.
die Verhandlungen mit Schachermeyr endgiltig abgebrochen wurden“1167. Aus den
Akten ist nicht ersichtlich, daß auch die Ausbürgerung Schachermeyrs im August
19311168 oder auch seine NS-Betätigung beim Abbruch der Verhandlungen eine Rolle
gespielt haben könnten. Anfang 1933 hatte sich Schachermeyr augenscheinlich noch
einmal bei seinem Wiener Kollegen Rudolf Egger über die Indolenz des Ministeriums
beklagt, denn dieser antwortete Schachermeyr am 12. Jänner folgendes: „Was Sie über
das Verhalten des Ministeriums schreiben, wundert mich gar nicht. […] Der
wie bei den Gewinn- und Produktionssteuern, oder ein Jahr nachhinkend wie bei der
Lohnsteuer und den indirekten Steuern, sodaß die Staatseinnahmen an sich ein getreues
Abbild der Wirtschaftsentwicklung hätten sein müssen, doch dem hatte die Fiskalpolitik
entgegen gewirkt.“ 1165 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 56. 1166 Vgl. AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 57. Vgl. dazu auch G. Oberkofler 1969, 167 und
W. Weber 1987, 301f.: „Lehmann-Haupts Innsbrucker Schüler Fritz Schachermeyr, der 1930
[sic] planmäßiger Extraordinarius in Jena geworden war, konnte die Nachfolge seines Lehrers
in Innsbruck 1933 nur deshalb nicht übernehmen, weil er bereits Ordinarius geworden war,
die Stelle aber mit einem Extraordinarius wiederbesetzt werden sollte“. 1167 AdR, PA Friedrich Schachermeyr, fol. 71. 1168 S. u. S. 242-246.
Professor in Jena (1931-1936) 215
Minister1169 reist in Finanzangelegenheiten in der Welt herum. Wer soll da etwas
entscheiden?“1170
Am 13. Jänner 1933 ergriff schließlich Schachermeyr, dem an dieser Stelle
grundsätzlich sicherlich sehr gelegen war, selbst mit einem Schreiben an das
Unterrichtsministerium die Initiative, um in der Situation endlich Klarheit zu schaffen,
und teilte darin mit, daß er sich gezwungen sehe, den Ruf nach Innsbruck
abzulehnen1171 – eine Entwicklung, die der Wiener Indogermanist Paul Kretschmer in
einem Brief von Anfang Februar 1933 übrigens „vorausgesehen“ haben wollte. „Die
Wirtschaftskrise & die katastrophal verringerten Staatseinnahmen veranlassen zu
Sparmaßnahmen, die besonders die Universitäten hart treffen“1172, begründete er diese
seine Vorahnung.
In einem neuen Vorschlag der Philosophischen Fakultät Innsbruck wurde dann
Franz Miltner zwar nur secundo loco nach Bilabel gereiht, gleichwohl wurde er und
nicht Bilabel noch vor Ende des Jahres 1933 als Extraordinarius berufen1173. Bilabel
blieb indes Gymnasiallehrer und las weiterhin als Privatdozent an der Universität
Heidelberg1174.
1933 zerbrach freilich nicht nur Schachermeyrs Traum, Nachfolger Lehmann-
Haupts in Innsbruck zu werden. Bald darauf ging auch die seit 1915 währende
1169 Emanuel Weidenhoffer (1874-1939) war von 16. Oktober 1931 bis 10. Mai 1933
Finanzminister der Regierung unter Karl Buresch (1878-1936) bzw. Engelbert Dollfuß (1892-
1934) und davor seit 1923 Abgeordneter im Nationalrat für die Christlichsoziale Volkspartei
gewesen (E. Bruckmüller 2004, I, 197f., 271, 560; DBE 10, 199, 382). 1170 A II, R. Egger an Schachermeyr, Brief vom 12.1.1933. 1171 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 75; vgl. C. F. Lehmann-Haupt 1933, 394. 1172 A II, P. Kretschmer an Schachermeyr, Brief vom 1.2.1933. 1173 G. Oberkofler 1969, 167; vgl. auch C. Ulf 1985, 50; I. Weiler 2002, 114f. und Miltners
Dank für Schachermeyrs Glückwunschschreiben, „aus dem ehrliche Mitfreude zu spüren war“
(A II, F. Miltner an Schachermeyr, Brief vom 8.12.1933). 1174 C. Jansen 1992, 316 Anm. 15, 333 Anm. 205.
Professor in Jena (1931-1936) 216
Freundschaft mit Lehmann-Haupt selbst zu Bruch. Grund des Zerwürfnisses war laut
Schachermeyrs Autobiographie der „Gebrauch der deutschen Sprache. Lehmann-
Haupt war sehr mit der Gesinnungswelt der norddeutschen Stahlhelmer1175 verbunden,
stand dem Hamburgischen nahe und war in Sprachfragen von seiner gleichsam
preußischen Maßgeblichkeit überzeugt. Ich hingegen zweifelte eine solche
Maßgeblichkeit der ‚Preußen’ durchaus an und vertrat den Standpunkt, daß alle
deutschen Stämme berechtigt wären, das Ihrige bei der Weiterentwicklung der
deutschen Sprache beizutragen. Darüber hatte es schon in Innsbruck allerhand
mündlichen Streit gegeben, der sich aber – ebenfalls mündlich – immer wieder
bereinigen ließ.
Nun hatte mir Lehmann-Haupt, als ich nach Jena ging, angeboten, ich sollte in
die Redaktion der von ihm gegründeten und herausgegebenen Klio als Mitherausgeber
eintreten1176. Ich stimmte dem, allerdings nicht ohne Bedenken, zu, da ja die Gefahr
bestand, daß die NS-Regierung in Weimar mir daraus ‚einen Strick drehen’ könnte.
Gab es doch im Kreis von Frau Förster-Nietzsche einen Kleinasienforscher1177, der
sich für meinen Lehrstuhl zu interessieren schien.
Die andere Gefahr bedachte ich aber nicht, daß nun nämlich unser Sprachenstreit
erneut aufbrechen könnte, ja müßte. Nur geschah das nicht mehr mündlich in der
Erregung des Augenblicks, Lehmann-Haupts Beleidigungen über die oder jene
österreichische Ausdrucksweise, daß sie nicht nur unstatthaft, sondern einfach
scheußlich wäre, erfolgten nun schriftlich. Da mußte ich meinem einstigen Lehrer den
Vorwurf machen, daß er sich in einer so beleidigenden Weise nicht nur über mein
1175 1918 gegründeter Veteranenbund mit allen Wesensmerkmalen „radikaler Verfechter
antirepublikanischer Ideen“, der das Kaiserreich glorifizierte (W. Vogel 1989, 23). 1176 Vgl. dazu auch A II, Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung an Schachermeyr, Briefe vom
3.3.1931 und 24.3.1931; A II, V. Ehrenberg an Schachermeyr, Brief vom 19.5.1931; A II, W.
Ensslin an Schachermeyr, Brief vom 16.12.1931; D I, E. Hesselmeyer an Schachermeyr, Brief
vom 17.11.1931. 1177 Damit ist der schon erwähnte Erich Brandenburg gemeint; vgl. S. 201-203.
Professor in Jena (1931-1936) 217
persönliches, sondern auch über unser österreichisches Deutsch äußerte, daß ich
annahm, er wolle mich aus der Klio als Mitherausgeber wieder herausdrängen. Ich gab
ihm daher meinen Austritt bekannt, und er nahm ihn auch an. Ein weiterer Verkehr
kam zwischen uns nicht mehr in Frage.“1178 Dabei hatte Schachermeyr Lehmann-
Haupt doch noch 1929, als er seine Etruskische Frühgeschichte1179 zum Druck brachte,
für „mannigfache, nur allzu nötige stilistische Verbesserungen“1180 gedankt.
Tatsächlich zeichnete Schachermeyr als Mitherausgeber der Klio von Band 25 =
N. F. 7 bis 26 = N. F. 8, also für die beiden Bände, die 1932 und 1933 erschienen.
Weiters ist bezeugt, daß Schachermeyr bereits bei Band 24, Heft 3 als Mitherausgeber
eingestiegen ist1181. Abgezeichnet hat sich das Ausscheiden Schachermeyrs aus der
Redaktion spätestens seit Ende 1933. Damals teilte Ernst Hohl (1886-1957)1182
Schachermeyr mit, daß er seinen Historia-Augusta-Aufsatz1183 zurückziehen und den
Bezug seines Abonnements kündigen würde, falls die Redaktion der Klio nunmehr
wieder allein in Lehmann-Haupts Händen liegen sollte1184. Miltner, der seine Arbeit
Die Dorische Wanderung1185 bei der Klio noch über Schachermeyr eingereicht hatte,
hatte sich nun auf einmal mit Lehmann-Haupt ins Einvernehmen zu setzen und zeigte
sich darob gegenüber Schachermeyr verwundert: „Wieso kann der reichsdeutsche
1178 F. Schachermeyr 1984, 146. 1179 F. Schachermeyr 1929a. 1180 F. Schachermeyr 1929a, X. 1181 A II, C. F. Lehmann-Haupt an Dr. v. Branca, Brief vom 21.4.1931. 1182 K. Christ 1982, bes. 144-148; KGL 1950, 786; KGL 1961, 2375. 1183 Hohls Aufsatz erschien dann unter dem Titel Zur Historia-Augusta-Forschung doch noch
in einem schon wieder von Lehmann-Haupt allein verantworteten Band der Zeitschrift Klio
(27, 1934, 149-164). In der Anm. 1 hält der Autor fest: „Mit der vorliegenden Abhandlung
entspricht der Verfasser einem ihm im vorigen Jahre von der Redaktion (F. Sch.)
ausgesprochenen Wunsche.“ 1184 A I, E. Hohl an Schachermeyr, Brief vom 10.12.1933. 1185 Klio 27, 1934, 54-68.
Professor in Jena (1931-1936) 218
Verlag Sie ziehen lassen und expediert nicht vielmehr den anderen? Das schiene mir
doch zumal bei den eigenartigen politischen Verhältnissen unseres Dezenniums das
einfachste.“1186 Als Nachfolger auf dem Innsbrucker Lehrstuhl und angeblicher
Freund1187 Lehmann-Haupts sollte Miltner nur ein paar Jahre später, 1936, ab dem
Band 30, 1937 selbst die Herausgeberschaft der Klio von Lehmann-Haupt
übernehmen, womit dann freilich auch den „eigenartigen politischen Verhältnissen“
vollauf Rechnung getragen war. Wilhelm Weber, dessen Schriften „ganz abgesehen
von ihrem Inhalt […] schon durch ihre mit braunen Brocken […] durchsetzte
geröllhafte Sprache für den heutigen Leser kaum mehr genießbar“1188 sind, schrieb
Schachermeyr umgehend an, sobald er festgestellt hatte, daß dessen Name nicht mehr
auf dem Titelblatt abgedruckt war: „Bitte geben Sie mir sofort Nachricht darüber, ob
Sie ausgeschieden, herausgedrängt oder sonst wie lahmgelegt worden sind: Es wird an
der Zeit sein, daß man dann die Klio sprengt. Heil Hitler! Ihr Wilhelm Weber“1189.
In Band 27 = N. F. 9 aus dem Jahr 1934 steht nunmehr wiederum Lehmann-
Haupt allein auf dem Titelblatt der Zeitschrift Klio. Davor waren noch Schachermeyrs
Aufsätze Dekorationsstil, Kulturkreis und Rasse1190 und Zur Chronologie der
kleisthenischen Reformen1191 in der Klio erschienen. Das NS-Opfer Friedrich Münzer,
1186 A II, F. Miltner an Schachermeyr, Brief vom 8.12.1933. 1187 C. F. Lehmann-Haupt bezeichnete Miltner 1936 ausdrücklich als seinen Freund (C. F.
Lehmann-Haupt 1936, V). Nach seinem Tod im Jahr 1938 erschien dann in der von „Freund“
Miltner geleiteten Klio „kein einziges Wort des Gedenkens“ (G. Lorenz 1985a, 44). 1188 A. Demandt 1979, 92. 1189 A II, W. Weber an Schachermeyr, Karte vom 30.4.1935. 1190 F. Schachermeyr 1932b, 245-247; vgl. V. Losemann 1980, 60: „Schachermeyr [war]
schon damals auf das positive Charakterbild der indogermanischen Rasse eingeschworen“, 98
Anm. 132; dies gilt auch schon für F. Schachermeyr 1929a, s. o. S. 127-130. 1191 F. Schachermeyr 1932c, 334-347 = F. Schachermeyr 1974, 59-73; vgl. die Anzeige von F.
Geyer 1933, 210.
Professor in Jena (1931-1936) 219
das „1935 noch ‚in allen Ehren’ in Münster verabschiedet“1192, dann wegen seiner
jüdischen Herkunft mit einem Publikationsverbot belegt werden und schließlich im
Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben kommen sollte, drückte Schachermeyr
sein Bedauern über dessen Ausscheiden als Herausgeber aus1193. Sollte er etwa in
Schachermeyr einen Leidensgenossen vermutet haben? Jedenfalls rechtfertigte er sein
Schreiben so: „Es ist wirklich nichts als die Liebe eines selbst auf dem absteigenden
Ast stehenden Vertreters der alten Geschic[hte] zu seiner Wissenschaft, was mich
bestimmt“1194. Der im März 1933 aus Budapest brieflich vorgetragenen Bitte seines
jüdischen Mitforschers Viktor Ehrenberg, dessen Buch Der griechische und der
hellenistische Staat1195 in der Klio zu rezensieren, kam Schachermeyr, dem Ehrenberg
zutraute, „dass Sie merken, um was es sich handelt“1196, dann nicht mehr nach.
Daß Schachermeyr den Hergang seines Bruchs mit Lehmann-Haupt korrekt
dargestellt hat, scheint zweifelhaft. Daß Lehmann-Haupt geradeso wie etwa auch der
Historiker und „Professor für Religions- und Geistesgeschichte“ Hans-Joachim
Schoeps (1909-1980)1197 von ebenfalls jüdischer Deszendenz eine übergroße
Sympathie für alles Preußische empfand, ist durchaus glaubhaft. Sehr konstruiert
mutet hingegen Schachermeyrs Verdacht an, Lehmann-Haupt habe seinen Schüler und
langjährigen Freund gleich nach dessen Einsetzung als Mitherausgeber seiner bislang
von ihm allein verantworteten „Hauspostille“ schon wieder bewußt zum Rücktritt
1192 V. Losemann 1977, 39. 1193 A II, F. Münzer an Schachermeyr, Karte vom 18.6.1934. 1194 A II, F. Münzer an Schachermeyr, Karte vom 18.6.1934. 1195 (Einleitung in die Altertumswissenschaft 3,3), Leipzig – Berlin 1932. Eine Neuauflage
erschien unter dem Titel Der Staat der Griechen, 2 Bde., Leipzig 1957-1958; ND Darmstadt
1960; erweiterte Auflage Zürich 21965. 1196 A II, V. Ehrenberg an Schachermeyr, Brief vom 18.1.1933. 1197 Schoeps ist wohl der prominenteste Fall eines preußischen Monarchisten jüdischer
Herkunft; vgl. R. Faber 2008; F.-L. Kroll 1996a, 287-306; F.-L. Kroll 2000, 315-340; W.
Schulze 1989, bes. 328; K. Weißmann 1996, 490f.
Professor in Jena (1931-1936) 220
provozieren wollen. Immerhin ist denkbar, daß Lehmann-Haupt nach den vielen
Jahren der Alleinherrschaft über die Klio die Herausgebermacht nicht in fairer Weise
mit einem Jüngeren teilen wollte oder konnte. Tatsache ist jedenfalls, daß die
Freundschaft explizit von Schachermeyr aufgekündigt worden ist, und zwar gerade zu
einem Zeitpunkt, als diese Schachermeyr (im Hinblick auf Innsbruck) schon nicht
mehr nützen, wohl aber (im Hinblick auf das nunmehr nationalsozialistisch regierte
Jena) schon schaden konnte. Die Vermutung liegt auf der Hand, daß die bis 1931 so
ungleiche Freundschaft zwischen einem wohlhabenden Universitäts-Professor im
Besitz einer vorzüglichen Privatbibliothek und einem „Habenichts“ von
Mittelschullehrer von letzterem schon die längste Zeit bloß aus opportunistischen
Gründen aufrechterhalten worden war. Lehmann-Haupt war gewiß ein streitbarer und
nicht uneitler Mann. Der seinerseits stets sehr selbstbewußte Schachermeyr, der sich
Lehmann-Haupt wohl nie intellektuell unterlegen gefühlt haben wird, hatte zumindest
im Unterbewußtsein gewiß wenig Freude daran, seinem Lehrer und Freund gegenüber
andauernd Dankbarkeit (für die Förderung im allgemeinen und die Benützung der
Privatbibliothek im besonderen) empfinden und diesem auch noch allerlei
Knechtsdienste leisten zu müssen. Man kann darüber spekulieren, daß diese so
problematische „Freundschaft“ Schachermeyr in seiner antisemitischen Grundhaltung
vielleicht sogar entscheidend bestärkt hat. Daß die Beziehung zwischen Lehmann-
Haupt und Schachermeyr auch schon früher ihre Tücken gehabt haben muß und
durchaus nicht als ideal anzusehen war, geht auch aus brieflichen Andeutungen von
dritter Seite hervor1198, und ebenso aus der Bemerkung Harold Steinackers in einem
Brief an Schachermeyr von Anfang Dezember 1933, das Zerwürfnis habe eine „weit
zurückreichende Vorgeschichte“1199, die dann freilich nicht näher kommentiert wird.
Gleichzeitig gibt Steinacker übrigens an, eine persönliche Erfahrung mit Lehmann-
Haupt gemacht zu haben, die ihm „zu denken gab. Als dem Ausschuss vom
Ministerium nach Ablauf des Ehrenjahres statt des Ordinariatsvorschlages, an dessen
1198 S. o. S. 141. 1199 A II, H. Steinacker an Schachermeyr, Brief vom 3.12.1933.
Professor in Jena (1931-1936) 221
Spitze Sie standen, ein E[xtra]-O[rdinariats]-Vorschlag abverlangt wurde, mußte ich
nolens-volens das Referat übernehmen. Fast hätte ich aus dem alten Vorschlag, der
einige nicht aufgenommene Privatdozenten genannt hatte, auf dringende Empfehlung
L[ehmann]-H[aupt]s auch Leifer aufgenommen[,] und nur die Erkundigungen, die ich
aus Vorsicht über dessen Persönlichkeit einholte, haben mich darüber informiert, dass
er jüdisches Blut hat und wegen verschiedener Disziplinarfälle von der jurid[ischen]
Fak[ultät] Wien für den angeregten E[xtra]-O[rdinariats]-Titel nicht vorgeschlagen
wurde“1200.
Weiterhin Professor in Jena
Fritz Schachermeyr blieb eine Rückkehr nach Österreich also fürs erste verwehrt,
und er hatte vorerst in Jena auszuharren. Das freute z. B. gewiß den Historiker
Alexander Cartellieri (1867-1955)1201, der sich sehr für einen Weiterverbleib
Schachermeyrs an der Universität Jena eingesetzt hatte1202, oder auch den Vorgänger
Judeich, der Schachermeyr Anfang Oktober 1932 mitgeteilt hatte, „daß Sie uns hier
stets herzlich willkommen sind und wir Sie nur ungern hergeben würden“1203.
1200 A II, H. Steinacker an Schachermeyr, Brief vom 3.12.1933. 1201 H. Gottwald 2003, 913f.; Hb. dt. Wiss., 871; M. Steinbach 2001; H. Tümmler 1995, 117-
125; W. Weber 1984, 85f. 1202 UA Jena, Bestand M, Nr. 632, Cartellieri an den Dekan der Philosophischen Fakultät,
25.7.1932, zit. nach H. Gottwald 2003, 932. 1203 A II, W. Judeich an Schachermeyr, Brief vom 3.10.1932. Vgl. den Brief vom 25.1.1933
von Erich Gustav Ludwig Ziebarth (1968-1944; u. a. Autor eines Bändchens Zypern:
Griechen unter britischer Gewalt (Das Britische Reich in der Weltpolitik 10), Berlin 1940;
KGL 1925, 1176; KGL 1950, 2416; V. Losemann 1977, bes. 210 Anm. 33; W. Weber 1984,
683; L. Wickert – C. Börker 1979, bes. 202) an Schachermeyr, in dem es heißt: „Wie ich jetzt
hoffen darf, bl[eib]en Sie in Jena […]“ (A II, E. Ziebarth an Schachermeyr).
Professor in Jena (1931-1936) 222
Allerdings waren in Thüringen die Nationalsozialisten schon im Sommer 1932 auf
demokratischem Wege an die Macht gelangt1204, und dieser Umstand bewirkte, daß
Schachermeyrs Stellung „in Jena schwierig“ wurde – das behauptete Schachermeyr
dann jedenfalls in seinem „Memorandum über die Staatsbürgerschaft und politische
Betätigung“ aus dem Jahr 1951 und auch sonst zu wiederholten Malen nach 1945: Da
sein früherer Freund Erich Brandenburg „das Ohr der n[ational]s[ozialistischen]
Machthaber (und vor allem auch der in Thüringen zu jener Zeit schier allmächtigen
Frau Förster[-]Nietzsche) hatte, legte er es darauf an, mich ‚abzuschießen’, indem er
verbreitete, ich hätte gegen den Nationalsozialismus und überhaupt gegen Deutschland
feindselige Bemerkungen gemacht.“1205 Daß die briefliche Warnung Fritz
Heichelheims vom 14. Jänner 1932 vor „Prof. Lewy1206, der Sie aus irgendwelchen mir
1204 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93. Die Landtagswahl fand im Juli 1932 statt. Seit
August 1932 leitete Fritz Wächtler in der ausschließlich nationalsozialistischen Regierung
unter dem Thüringischen Gauleiter Fritz Sauckel das Volksbildungsministerium (vgl. J. John
1983, 286; W. Lesanovsky 1995, 406). Im Mai 1933 sollte auch auf dem Marktplatz von Jena
eine Bücherverbrennung veranstaltet werden (J. John 1983, 288; vgl. auch H. Heiber 1992,
89, 593 Anm. 317). Zu den Bücherverbrennungen allgemein zuletzt: W. Benz 2003, 398-406;
J. H. Schoeps – W. Treß 2008; W. Treß 2003; V. Weidermann 2008. 1205 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93; s. auch o. S. 201-203, 216. In einer
„Eidesstättige[n] Erklärung“ Wilhelm Brandensteins heißt es, Schachermeyr sei vorgeworfen
worden, „er hätte gesagt: wenn Hitler ans Ruder käme, dann könne man als anständiger
Mensch nicht in Deutschland bleiben. Schachermeyr hätte deswegen verfolgt werden sollen.
Ich habe das diesbezügliche Schreiben damals selbst gesehen und in der Hand gehabt“ (AdR,
PA Fritz Schachermeyr, fol. 132; vgl. auch S. 424, 429-431). 1206 Gemeint ist wohl der Gießener Assyriologe Julius Lewy (1895-1963), der die
Schriftenreihe der Hilprecht-Sammlung herausgab und 1933 wegen seiner jüdischen Herkunft
entlassen wurde; E. Ellinger 2006, bes. 505; S. Gerstengarbe 1994, 31; L. Hanisch 2003, bes.
196; K. Hecker 1982, 626-633; K. Hecker 1985, 419; J. John 1983, 287; KGL 1926, 1125;
KGL 1931, 1729; KGL 1950, 2109; KGL 1966, 2819; U. Maas 2004, 275f.; R. Oberheid
Professor in Jena (1931-1936) 223
unbekannten Gründen nicht allzusehr mag“, sowie dessen allgemeine Warnung davor,
„dass irgendwie Leute in und ausserhalb Jenas Ihnen nicht wohlgesinnt sind und
eventuell Ihnen zu schaden versuchen“1207, Schachermeyrs Angabe im Memorandum
bestätigt, scheint zweifelhaft – ein jüdischer Gelehrter wäre wohl kaum in die Lage
gekommen, sich an einer NS-Intrige zu beteiligen.
Es ergab sich dann etwa im Juni 1933, daß Schachermeyr den Österreicher Dr.
Gürke1208 kennenlernte, der „einen hohen SA Rang [sic] bekleidete“1209 – deshalb hatte
er aus Österreich flüchten müssen – und später Schwiegersohn des Juristen Professor
Otto Koellreutter (1883-1972)1210, eines erklärten Nationalsozialisten, wurde. Gürke
setzte sich dann für Fritz Schachermeyr angeblich in der Weise ein, daß dieser „ganz
ohne mein Wissen für den Posten eines Gauleiters von Thüringen des damals in
Bildung begriffenen ‚Kampfrings der Deutschösterreicher im Reich’1211 in Aussicht
2007, bes. 381f.; J. Renger 2008, 475f.; H. A. Strauss – W. Röder 1983, 723; E. Weidner
1966c, 262f.; S. Wininger 1936, 251. 1207 A II, F. Heichelheim an Schachermeyr, Brief vom 14.1.1932. 1208 Norbert Gürke (1904-1941), seit 1937 ao. Prof. an der Universität München, seit 1939 o.
Prof. an der Universität Wien; H. Böhm 1995, passim, bes. 608; KGL 1940/41, 1, 594; KGL
1950, 2398; W. Kosch 1963, 1, 436; G. Kress 1959, 102. 1209 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 99. 1210 H. Böhm 1995, passim, bes. 610; Führerlexikon, 244; J. John 1983, 280f., 286; KGL
1926, 982f.; KGL 1976, 3660; E. Klee 2003, 325; A. Mohler 1999, passim, bes. 429f.; E.
Stockhorst 2000, 242; M. Stolleis 1980, 324f. 1211 Zunächst auch „Hilfsbund der Deutschösterreicher“, vgl. dazu auch die in AdR,
Bundeskanzleramt GZ 6217-PrS/51 aufgelisteten „Aufgaben des Hilfsbundes“: „1.)
Organisatorische Zusammenfassung aller im Deutschen Reiche lebenden arischen
Deutschösterreicher, ohne Unterschied des Geschlechtes. 2.) Förderung des gesamtdeutschen
Denkens, des Heimatbewusstseins, Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit über die
völkische, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung Österreichs. 3.) Vertretung der
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Belange der Mitglieder. 4.) Betreuung der im
Deutschen Reiche lebenden österr[eichischen] politischen Flüchtlinge.“
Professor in Jena (1931-1936) 224
genommen [worden sei] (Nov. 1933). Die an mich brieflich ergehende Order lautete
ganz einfach: ‚Sie haben sich … [sic] in Leipzig zur Gründungsversammlung des
Kampfringes einzufinden’.“1212 Dort begegnete Schachermeyr dem späteren Höheren
SS- und Polizeiführer in den Niederlanden und Gründer des Kampfringes, Ing. Johann
Baptist (Hanns) Albin Rauter (1895-1949)1213, der diesem Treffen vorstand. „In
Leipzig wurde mir dann gleich mitgeteilt, daß ich für Thüringen die Geschäfte zu
führen hätte und mich mit dieser Bestellung abzufinden habe. Ich wehrte mich
hiergegen mit allen in meiner damals so schwierigen Lage überhaupt verwendbaren
Argumenten und erreichte in der Tat, daß ich nie richtig ernannt wurde1214, daß die
Gaugeschäftsstelle gar nicht in Jena, sondern in Weimar errichtet ward und daß die
dortigen Geschäfte von einem eigenen Funktionär, einem Gaugeschäftsleiter, geführt
wurden. Die Frage eines Gauleiters blieb de facto offen, doch konnte ich nicht
verhindern, daß man zwischen Dezember 1933 und April 1934 nach Bedarf zu
Propaganda-Zwecken meinen Namen gelegentlich mit der Gauleitung in Verbindung
brachte. Ich konnte das um so weniger hindern oder auch nur kontrollieren, da [sic] ich
mich von Februar bis anfangs Mai 1934 zu Studienzwecken in Griechenland
1212 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 94. 1213 Rauter wurde am 25. März 1949 aufgrund des in Den Haag am 4. Mai 1948 gefällten
Todesurteils hingerichtet (DBE 8, 1998, 116; E. Klee 2003, 482; E. Stockhorst 2000, 337f.; C.
Tepperberg 1983, 444f.). 1214 Vgl. dazu vielmehr S. Rebenich 2005, 62 mit Anm. 104, der nachweist, daß
Schachermeyr „{i}m Herbst 1933 […] die provisorische Leitung des im Gau Thüringen
konstituierten Kampfringes der Deutschösterreicher im Reich [übernahm]“ und „sofort
[begann], eine größere Zahl von Ortsgruppen aufzustellen“, und dann weiter schreibt: „Zu
Beginn des folgenden Jahres wurde er von der Reichsführung in München zum definitiven
Gauführer ernannt; das Amt beabsichtigte er – wie er dem Thüringischen Ministerium für
Volksbildung [am 12. Februar 1934 brieflich] mitteilte – ‚bis zur Gleichschaltung Österreichs
auszuüben.’“
Professor in Jena (1931-1936) 225
befand.“1215 Die Jenenser Quellen bezeugen demgegenüber, daß Schachermeyr sogar
Mitbegründer des nationalsozialistischen Kampfringes der Deutschösterreicher im
Reich gewesen ist1216, die Geschäfte führte damals – so Schachermeyr in dem am 21.
Juni 1951 verfaßten „Memorandum über politische Betütigung zu
n[ational]s[ozialistischen] Zeit“ – ein gewisser Peter Jaritz in Weimar1217, und wenn er
sich in seinen Heidelberger Akten und auf seiner Mitgliedskarte für den
Nationalsozialistischen Lehrerbund selbst als „Gauführer v. Thüringen des N. S.
Kampfringes der Deutschösterreicher im Reich“ für die Jahre 1933-1934 deklariert1218
hat, so war dies tatsächlich, wie Stefan Rebenich erst kürzlich gezeigt hat1219,
keineswegs ein Akt der Hochstapelei. Bereits am 30. September 1933 schrieb
Schachermeyr an seine Frau, die gerade in Saalfelden in Salzburg auf Besuch bei ihrer
Tochter aus erster Ehe weilte: „Nun ist die neue Regelung herausgekommen, dass alle
unter 40 Jahren zu den aktiven Stürmen müssen. Das wird mir eine gewünschte
Gelegenheit geben, mich irgendwie wieder aus der SA loszueisen1220. Hoffentlich in
einer Weise, die mir den gleichzeitigen Eintritt in die Partei ermöglichen wird. Spreche
1215 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 94. H. A. L. Degener 1935, 1361 und W. Kosch 1938,
4182 führen Schachermeyr für die Periode 1933-34 als „Gauführer des nationalsozialistischen
Kampfrings der Deutsch-Österreicher“, und dies in Übereinstimmung mit eigenen Angaben
Schachermeyrs aus der späteren NS-Zeit, siehe sofort im Haupttext. Zu Schachermeyrs
Griechenlandaufenthalt vgl. u. S. 236f. 1216 Vgl. dazu H. Gottwald 2003, 930, 941 Anm. 120; V. Losemann 1980, 96f. Anm. 104. 1217 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 99. 1218 S. u. S. 260 mit Anm. 1423. 1219 Vgl. o. Anm. 1214. 1220 Offenbar drängten ihn SA-Mitglieder wie Dr. Gürke damals zu einem Beitritt in diese
auch schon vor dem sog. „Röhm-Putsch“ (30.6.-2.7.1934) in NS-Kreisen selbst wenig
angesehene Organisation – die Formulierung „aus der SA“ legt eigentlich sogar schon eine
bestehende Mitgliedschaft nahe.
Professor in Jena (1931-1936) 226
nächste Woche darüber mit dem Oberbürgermeister1221. Auch Esau1222 wird mit ihm
darüber sprechen. Mit Vogt1223 werde ich mich ebenfalls darüber unterhalten.“1224
Schachermeyr bemühte sich also bereits im Frühherbst 1933 ganz aktiv um einen
Parteieintritt.
Nach seiner Rückkehr aus Griechenland wurde dann offenbar in Weimar ein
anderer Gauleiter des Kampfringes bestellt, nachdem Schachermeyr bereits auf dem
Weg nach Griechenland persönlich in der Zentralstelle in München vorgesprochen
hatte1225. Schachermeyr blieb jedoch weiterhin Mitglied des Kampfringes, der sich
übrigens auch in der Wohltätigkeit engagierte1226. Schachermeyr hielt dann im
Rahmen dieser Organisation zwei Vorträge, einen in Jena und einen weiteren in
Schmalkalden, die Anweisungen dazu gab offenbar Jaritz, der laut Schachermeyr „ein
schrecklich brutaler Mensch“1227 war und sogar bereits während der NS-Zeit vor
Gericht stand1228. Inhaltlich ging es bei diesen Vorträgen um das Verhältnis von
1221 Armin Schmidt (geb. 1888), 1933 bis 1945 Oberbürgermeister von Jena (H. A. L.
Degener 1935, 1402; Führerlexikon, 421f.; J. Hendel u. a. 2007, passim; E. Stockhorst 2000,
385). 1222 Abraham Esau (1884-1955), seit 1932 Rektor; Esau „wurde 1945 in den Niederlanden als
Kriegsverbrecher verhaftet und interniert, 1949 aber wegen angeblich ‚nicht erwiesener
Schuld‘ wieder freigelassen“ (J. John 1983, 290); DBE 3, 1996, 171; D. Freudig 1996, 132;
M. Grüttner 2004, 45; W. Hartkopf 1992, 91; J. Hendel u. a. 2007, passim; D. Hoffmann – R.
Strutz 2003, 136-179; E. Klee 2003, 139; Poggendorf 6, 1936, 675; Poggendorff 7a, 1956,
527; Reichshandbuch, 402; F. Schröter 1959, 640f.; E. Stockhorst 2000, 125; R. Stutz 2000,
123f., 129, 131-139, 146. 1223 Der Althistoriker Joseph Vogt oder wohl eher der Jenenser Astronom Heinrich Vogt, der
nach Schachermeyr SA-Mitglied war; vgl. u. S. 229 mit Anm. 1242. 1224 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 30.9.1933. 1225 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 100. 1226 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 94, 99. 1227 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 99. 1228 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 100.
Professor in Jena (1931-1936) 227
Österreich und Deutschland. „Ich betonte darin, daß das, was der Nationalsozialismus
als ‚Volksgemeinschaft’ bezeichne, in Österreich immer schon Selbstverständlichkeit
gewesen wäre und daß es die Aufgabe der Österreicher im Reiche sei, für diese
Volksgemeinschaft im Gegensatz zum preußischen Kastengeist zu werben“1229, heißt
es jedenfalls in seinem „Memorandum über politische Betätigung zu ns. Zeit“ von
1951. Schachermeyr gibt 1951 weiter an, daß sich die Situation „gegen Ende 1934
entspannte“1230, da Brandenburg „damals plötzlich verstorben [ist] und seine
Anschuldigungen […] auf Veranlassung meines früheren Jenenser Schülers Dr[.]
Schultz [sic] niedergeschlagen [wurden]. Letzterer ist damals zum persönlichen
Adjutanten des Weimarer Unterrichtsministers Wächtler1231 ernannt worden und setzte
sich mit vollen [sic] Erfolg für meine völlige Entlastung ein.“1232 Seine angeblich
weiter nicht vorhandene politische Involvierung beschreibt Schachermeyr wie folgt:
„Dank meiner Beziehung zu dem oben erwähnten Dr[.] Schulz [sic] konnte ich in Jena
weiterhin bis 1936 wirken, ohne parteiliche Bindungen eingehen zu müssen.“1233
Tatsächlich ist Erich Brandenburg erst am 19. Juli 1936 gestorben1234, ungefähr ein
Jahr nach dem Tod seiner augenscheinlichen Protektorin Frau Förster-Nietzsche im
Herbst 1935. Inwiefern auch die anderen Angaben Schachermeyrs unzuverlässig sind,
1229 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95. 1230 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95. 1231 Fritz Wächtler (1891-1945), zunächst Volksschullehrer und Berater Wilhelm Fricks,
1932-35 stellvertretender Gauleiter, 1932-33 Volksbildungsminister und Nachfolger Fricks,
1933-35 Innen- und Volksbildungsminister, 1936 Gauleiter der bayerischen Ostmark
(Bayreuth) und Führer des NS-Lehrerbundes, Staatsminister für Volksbildung, SS-
Gruppenführer; H. A. L. Degener 1935, 1665; Führerlexikon, 510; M. Grüttner 2004, 179; H.-
C. Harten – U. Neirich – M. Schwerendt 2006, passim, bes. 485; J. Hendel u. a. 2007, passim;
K. Höffkes 1986, 358-361; C. Horkenbach 1932, 558; J. John 1995, 221; E. Kienast 1938,
438; E. Stockhorst 2000, 434; H. Weiß 2002b, 470f. 1232 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95. 1233 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 100. 1234 AfO 11, 1936-1937, 282; KGL 1950, 2373.
Professor in Jena (1931-1936) 228
läßt sich heute kaum mehr mit Sicherheit eruieren. Objektive Fakten sind, daß
Schachermeyr im März 1933 den Wahlaufruf Die deutsche Geisteswelt für Liste 11235.
Erklärung von 300 deutschen Universitäts- und Hochschullehrern1236 unterzeichnet
hat und am 1. November 1934 dem Nationalsozialistischen Lehrerbund beigetreten
ist1237, und daß er nie vorgab, zu beiden Akten der Parteinahme genötigt worden zu
sein. Im Oktober 1934 nahm Schachermeyr in Weimar an der Eröffnung des Instituts
für Schulmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Anwesenheit des
Volksbildungsministers Fritz Wächtler mit einer Ansprache teil, in der er immerhin
ausführte, daß ein Volk, das sich nur der körperlichen Ertüchtigung widmete, verloren
wäre1238. Im selben Monat hielt Schachermeyr bei der zu Propagandazwecken
abgehaltenen Universitätswoche in Meiningen einen Vortrag über „Die nordisch-
indogermanischen Völker“1239.
Sehr auffällig ist, daß sich Schachermeyr zwar in der Zeit zwischen 1932 und
1934 in einer „Zwangslage“ befunden und eine „Bedrohung vonseiten [sic] der
Naziregierung“1240 erfahren haben will, daß er aber andererseits in seiner
Autobiographie die Universität Jena unter dem Regime Fritz Wächtlers geradezu als
Idylle porträtiert: „In Jena hatte sich unter Wächtler und seinen gemäßigten Ratgebern
in den ersten Jahren der NS-Herrschaft kaum etwas geändert. Es gab da keine
1235 Gemeint ist die NSDAP. 1236 Völkischer Beobachter, 46. Jg., 63. Ausgabe, 4.3.1933, 2. Beiblatt; vgl. auch V.
Losemann 1980, 45; K. Schönwälder 1992, 24. N. Hammerstein 1999, 142 behauptet, daß
„sich 1933 nur 1,2 % der Hochschullehrer öffentlich zu Hitler“ bekannten. 1237 Bundesarchiv Berlin, Mitgliedskarte Nr. 309510 Schachermeyer [sic] Fritz. Vgl. auch H.
A. L. Degener 1935, 1361 und B. Näf 1994, 94. 1238 Weimarische Zeitung vom 17. Oktober 1934 (Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz
Schachermeyr, Kt. 1). 1239 W. Schumann 1958, 647. 1240 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95.
Professor in Jena (1931-1936) 229
Parteimitglieder1241[,] und bei der SA war lediglich der Astronom1242 (aber in einem
entsprechend hohen Rang). Zwei Kollegen1243 schieden wohl aus, weil sie gerichtlich
belangt wurden, das lag aber ganz außerhalb der Ingerenz des Unterrichtsministeriums.
Der naturwissenschaftlichen Fakultät hatte man allerdings den Rassen-Günther
oktroyiert, aber das war wohl ein Diktat von höherer Stelle. Die meisten Professoren
waren und blieben in Jena der Hitlerbewegung feindlich gesonnen[,] und manche
gehörten den preußisch-patriotischen Stahlhelmverbänden an.
Als ich nach Heidelberg berufen wurde, kündigte sich gleichzeitig auch für die
Jenaer Universität ein Wandel an, da Wächtler als Gauleiter nach Bayreuth ging und
nun Gauleiter Sauckel [sic] an der thüringischen Universität endlich nach Belieben
1241 „Nominelle NSDAP-Mitglieder waren im Oktober 1935 36 von insgesamt 186
Hochschullehrern“ (J. John 1983, 290), das waren immerhin fast 20 %. E. Maschke 1969, 119
meint: „Der Lehrkörper der Universität blieb bis 1933 fast ganz unberührt vom
Nationalsozialismus.“ 1242 Heinrich Vogt (1890-1968), Professor für Astronomie, Astrophysiker; DBE 10, 1999,
234; D. Drüll 1986, 277f.; W. Hartkopf 1992, 376; Poggendorff 6, 2770; Poggendorff 7a,
781f.; E Stockhorst 2000, 431. 1243 Möglicherweise bezieht sich Schachermeyr hier auf den Juristen Karl Korsch (1886-1961;
M. Buckmiller 1988, 254-267; DBE 6, 1997, 48; C. Horkenbach 1930, 699; U. Maas 2004,
189-192; H. Weber 1980, 599f.), dem kommunistische Betätigung vorgeworfen wurde und
dem in der Folge die Bezüge durch polizeiliche Anordnung gesperrt wurden (vgl. S.
Gerstengarbe 1994, 31, 38 Anm. 28). S. Gerstengarbe 1994, 31 listet noch drei weitere
Professoren, eine Professorin und einen Dozenten, die nach § 3 (1) bzw. § 4 des Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen wurden, also bereits von der ersten
Entlassungswelle betroffen waren. J. John – O. Lemuth 2003, 1108 listen 10 Namen; ebenso
spricht E. Maschke 1969, 121 von 10 entfernten Mitgliedern des Lehrkörpers. J. John 1983,
287f. listet sogar 11 Namen, zusätzlich zu den sonst erwähnten 10 führt er den Juden Julius
Lewy an, der zwar enge Beziehungen zur Jenenser Universität unterhielt, jedoch 1933 seinen
Posten vielmehr an der Universität Gießen verlor.
Professor in Jena (1931-1936) 230
schalten konnte. Natürlich war ich froh, das nicht mehr miterleben zu müssen.“1244
Tatsache ist, daß auch in Jena das „Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“1245 vom 7. April 1933 umgesetzt wurde, es waren weit mehr als
zwei Professoren, die vertrieben wurden, und alle Fakultäten waren von diesem Terror
betroffen1246. Da liegt der Schluß nahe, daß es in den Jahren 1932-1934 für
Schachermeyr trotz der angeblichen Intrige des Dr. Erich Brandenburg weder objektiv
noch subjektiv irgendeine „Bedrohung“ gegeben hat, und daß Schachermeyr seine
angebliche „Zwangslage“ von damals erst nach 1945 konstruiert hat, um die ihm
nunmehr zum Vorwurf gemachten – in Wirklichkeit völlig freiwillig erfolgten – NS-
Aktivitäten aus dieser Periode zu rechtfertigen und zu verharmlosen.
Was Schachermeyrs Forschungstätigkeit namentlich in seinen ersten Jenenser
Jahren anlangt, so begann er schon damals mit den Vorarbeiten für ein Alexander-
Buch1247. Auch schon in seiner Jenaer Antrittsvorlesung „Alexander der Große“1248,
die am 5. Dezember 1931 um 12 Uhr im Hörsaal I der Universität stattfand1249, hat er
nach eigenen Angaben versucht, Alexanders „Persönlichkeit aus ihrer
Eigengesetzlichkeit und aus seinem auf universale Eintracht gerichteten Willen“1250
begreiflich zu machen. Weiters bereitete er sein zweites Buch, Hethiter und Achäer1251
1244 F. Schachermeyr 1984, 156f., vgl. auch 147. 1245 RGBl., Jg. 1933, I, 7.4.1933, bes. 175, § 3 (1), (2) und § 4; vgl. S. Gerstengarbe 1994,
18f.; M. H. Kater 1981, 51-52; M. H. Kater 1985, 468-470; H. Mommsen 1966, 151-165; H.
Seier 1984, 146; U. Wolf 1996, 467. 1246 Vgl. dazu schon S. 229 mit Anm. 1243 und weiters U. Hoßfeld 1999, 49; H. Koch 1966,
347f.; T. Pester 1996, 120-122. 1247 Vgl. dann Alexander der Große. Ingenium und Macht, Graz – Salzburg – Wien 1949 = F.
Schachermeyr 1949a. 1248 Unpubliziert. 1249 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 2; vgl. B. Näf 1994, 97. 1250 F. Schachermeyr 1973a, 631. 1251 Leipzig 1935 = F. Schachermeyr 1935a; ND Osnabrück 1972. Rezensionen dazu
erschienen von K. Bittel 1936, 279-283; E. Cavaignac 1935-36, 179f.; V. Groh 1936a, 211-
Professor in Jena (1931-1936) 231
vor, das schließlich 1935 erschien und sich angeblich als „das bestverkaufte Buch in
der ganzen Serie“1252 der Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft erwies. Mit
diesem Werk setzte er seine mykenischen Forschungen fort und knüpfte gleichzeitig
auch an seine Etruskische Frühgeschichte1253 an, befaßte sich darin speziell mit dem
A__ijava-Problem1254, mit dem er sich bereits in seiner Innsbrucker Zeit
auseinandergesetzt hatte1255, und gab eine Zusammenfassung des damaligen
Forschungsstandes, wobei er letztlich doch deutlich einer „Gleichsetzung der
214; V. Groh 1936b, 298-303; vgl. dazu auch S. Heinhold-Krahmer 1998, 4-6; R. Oberheid
2007, 124 („ein ehrenwerter Vermittlungsversuch von Fritz Schachermeyr“), 131 und
insbesondere S. Heinhold-Krahmer 2007, 315-326; gemäß letzterer Arbeit verfügte
Schachermeyr im Hinblick auf die Interpretation hethitischer Texte z. T. sogar über einen
besseren philologischen Instinkt als der damals führende Hethitologe Ferdinand Sommer (s.
u. S. 233 Anm. 1264). 1252 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 12. 1253 F. Schachermeyr 1929a. 1254 Zur A__ijava-Frage vgl. an rezenter Lit. etwa T. Bryce 2008, 40-42; M. Demir 2007, 541-
558; M. Dietrich – O. Loretz 1998, 339-344; J. Freu 2004, 275-323; J. Freu 2008, 77-106; J.
Freu – M. Mazoyer 2008, darin 102-118 zu A. und bes. 103 (hier unter Verweis auf
Schachermeyr), 111 für Gleichsetzung mit Mykene; I. Hajnal 2003, 35-42; S. Heinhold-
Krahmer 1998, 1-12; S. Heinhold-Krahmer 1999, 567-584; S. Heinhold-Krahmer 2007, 315-
326; S. Heinhold-Krahmer 2007a, 191-207; S. Heinhold-Krahmer 2008, 363-376; A. M.
Jasink – M. Marino 2007, 407-426; P. A. Mountjoy 1998, 33-67; W.-D. Niemeier 1998, 17-
65; W.-D. Niemeier 1999, 141-155; W.-D. Niemeier 2005, bes. 18; R. Oberheid 2007, 101-
152; V. Parker 1999, 61-83; M. Pesditschek 2004, 902; F. Starke 1997, bes. 451; O.
Szemerényi 1988, 257-294; P. Taracha 2006, 143-149; R. Tekoğlu 2000, 980-984 mit Bibl.
984 Anm. 35; U. Thaler 2007, bes. 292f.; C. Watkins 2008, 135-141, darin 135f. eher für A. =
Theben. 1255 A II, F. Sommer an Schachermeyr, Brief vom 2.2.1931.
Professor in Jena (1931-1936) 232
a__iavischen Macht mit dem Königtume von Mykenai“ zuneigte1256, was des weiteren
wiederum auf eine gewisse Parteinahme zugunsten von Emil O. Forrer in dessen (nicht
nur rein) wissenschaftlichem Streit mit Ferdinand Sommer1257 hinauslief. Just dieser
berühmte Indogermanist und Hethitologe Ferdinand Sommer (1875-1962)1258, der
Anfang der dreißiger Jahre gerade selbst an seinen grundlegenden Werken Die
A__ijavā-Urkunden1259 und die A__ijavāfrage und Sprachwissenschaft1260 arbeitete,
zeigte sich damals über Schachermeyrs Pläne, sich diesem seiner Meinung nach
ausschließlich Sprachwissenschaftlern zugänglichen Problem zu widmen, überhaupt
nicht erfreut: „Nun habe ich kürzlich aus Ihrem Bericht in den ‚Forschungen und
Fortschritten’1261 ersehen, daß Sie optima fide in allen wesentlichen Details vom Urteil
der anderen abhängig sind, wie das ja bei einem Nicht-Hethitologen notwendig der
Fall ist. Verzeihen Sie mir daher das freimütige Wort, daß ich es nicht für richtig halte,
wenn ein Historiker sich auf diese Dinge einläßt, ohne die Richtigkeit des Gesagten
wirklich nachprüfen zu können. Das von mir soeben Gesagte kann Sie um so weniger
persönlich treffen, als Sie ja eine ganze Anzahl von Historikern in Übereinstimmung
1256 F. Schachermeyr 1935a, 169. Diese Präferenz hat Schachermeyr später in F.
Schachermeyr 1958a, 365-380, bes. 380 („Am wahrscheinlichsten dünkt mir nach wie vor die
Gleichsetzung mit Mykenai, doch ist daneben auch die Möglichkeit von Rhodos beträchtlich
angestiegen und tritt als dritte Eventualität Kypros in Erscheinung“) und schließlich –
zuversichtlicher denn je – auch noch in seiner allerletzten publizierten Monographie F.
Schachermeyr 1986a (s. zu dieser ausführlich S. 671-676) bekräftigt. 1257 Dazu s. sofort Anm. 1264. 1258 H. Böhm 1995, bes. 617; D. Cherubim 1996, 873; DBE 9, 1998, 368; B. Forssman 1977;
Hb. dt. Wiss., 1348; R. Oberheid 2007, bes. 396-401; O. Wenig 1968, 296. 1259 (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Abteilung, N.
F. 6), München 1932. 1260 (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Abteilung, N.
F. 9), München 1934. 1261 Gemeint ist F. Schachermeyr 1931d, 20f.
Professor in Jena (1931-1936) 233
mit sich wissen, während sich von den Hethitologen, die man in sprachlich-
philologischen Dingen für einigermaßen kompetent erklären kann, keiner an Forrer
angeschlossen hat. Es ist beim Hethitischen nun einmal ein bissl [sic; es fehlt wohl:
anders] als bei Xenophons Anabasis“1262, sprach der extrem „autoritäre und eitle“1263
Sommer seinem Historikerkollegen schlicht die Qualifikation für die Beschäftigung
mit dieser Materie ab1264, was diesen aber nicht daran hinderte, seine Arbeit
fortzusetzen, um dann auch Sommers „bahnbrechende Materialpublikation“1265 in sein
Buch einzuarbeiten. Eine „nachfolgende zweite“1266 Abhandlung war geplant, die sich
mit der mykenischen Kultur auseinandersetzen sollte, wozu es aber dann in absehbarer
Zeit nicht kam1267.
Weiterhin schrieb Schachermeyr an Artikeln für die RE. Zu erwähnen sind hier
besonders Theagenes (2)1268, Theomestor1269, Theron (1)1270 und Thrasybulos (1-2)1271,
1262 A II, F. Sommer an Schachermeyr, Brief vom 2.2.1931. Die Anabasis des Xenophon wird
im Griechischunterricht als Anfängerlektüre verwendet. Vgl. dazu auch R. Oberheid 2007,
124-132. 1263 B. Schlerath 2000, 176f. 1264 Dieses Verhalten Sommers steht in Zusammenhang mit seinem notorischen, höchst
unprofessionellen (wenngleich nicht unprofessoralen) blindwütigen Haß auf Emil O. Forrer
im allgemeinen und dessen A__ijava-Thesen im besonderen, von dem offenkundig auch
Mitforscher in Mitleidenschaft gezogen wurden, wenn sie, wie Schachermeyr dies schon um
1930 tat, auch nur eine gewisse Sympathie für die Position Forrers erkennen ließen. Dank R.
Oberheid 2007, 71-76 kennen wir nun die höchst persönlichen Gründe für diesen Haß
Sommers, und dank S. Heinhold-Krahmer 2007, 315-326 wissen wir nun auch, daß
Schachermeyrs philologische Interpretation der einschlägigen Texte jener Sommers
schlußendlich überlegen war – für Sommers Herablassung und Häme bestand also objektiv
nicht der geringste Anlaß. 1265 F. Schachermeyr 1935a, [V]. 1266 F. Schachermeyr 1935a, [V]. 1267 Vgl. G. Dobesch 1974, 448-453. 1268 5 A, 2, 1934, 1341-1345.
Professor in Jena (1931-1936) 234
die zusammengenommen eine Art Vorstudie für eine Geschichte der griechischen
Tyrannis darstellen. Noch während seiner Jenenser Zeit verfaßte Schachermeyr auch
einen Beitrag für eine Festschrift zu Ehren des Indogermanisten Herman(n) Hirt
(1865-1936)1272 mit dem Titel Wanderungen und Ausbreitung der Indogermanen im
Mittelmeergebiet1273, und Hirt bedankte sich schon im Jänner 1936 für die „Belehrung,
die ich aus ihm schöpfen konnte“1274.
Zusätzlich hat Fritz Schachermeyr offenbar im Jahr 1933 „Herrn Kollegen
Zucker1275 in der Stellung als Vertrauensmann der Fakultät für die Hilprecht-
Sammlung1276 abgelöst“1277. Der Herausgeber der Texte und Materialien der Frau
Professor Hilprecht Collection of Babylonian Antiquities im Eigentum der Friedrich-
1269 5 A, 2, 1924, 2034. 1270 5 A, 2, 1934, 2447-2451. 1271 6 A, 1, 1936, 567f. 1272 DBE 5, 1997, 69; G. R. Garg 1, 1987, 179; R. Hiersche 1982, 423-433; KGL 1925, 407;
KGL 1950, 2375; C. Knobloch 2005, passim; G. Neumann 1972, 235f.; B. Schlerath 2000,
51, 148; R. Schmitt 1996, 419f. 1273 F. Schachermeyr 1936a, 229-253; vgl. die Rezension von R. Pittioni – A. Pfalz 1937,
172f. (zu Schachermeyrs Beitrag 172: „Es wäre vielleicht wünschenswert gewesen, wenn
Schachermeyr noch mehr Uraltertumskunde herangezogen hätte, besonders bei Besprechung
der ersten indogermanischen Einwirkungen“) und die Anzeige von H. Zeiß 1937, 563-566.
Vgl. auch C. Knobloch 2005, 181-183; R. Schmitt 2004, 325 („die allzu ‚nordisch’ orientierte
Hirt-Festschrift“). 1274 A II, H. Hirt an Schachermeyr, Brief vom 17.1.1936. 1275 Gemeint ist der Gräzist, Papyrologe und NS-Gegner Friedrich Zucker (1881-1973), der
nach dem Krieg Rektor werden sollte; G. Baumgartner – D. Hebig 1997, 1051f.; DBE 10,
1999, 694; W. Hartkopf 1992, 405; Hb. dt. Wiss., 1453; J. John 1983, passim; E. G. Schmidt
1981, 297-304; H. G. Walther 2001; H. G. Walther 2007, 1911-1928; E. Wörfel 1983,
passim. 1276 J. John 1983, 278, 287; F. Krause – F. Marwinski 1999, 160-162 (mit weiterer Lit.). 1277 A II, J. Lewy an Schachermeyr, Brief vom 1.3.1933.
Professor in Jena (1931-1936) 235
Schiller-Universität Jena1278 Julius Lewy1279 bot sich ihm bei diesem Anlaß als
Auskunftsperson für eventuelle Fragen bezüglich dieser Sammlung vorderasiatischer
Altertümer an, die vor allem Keilschrifttexte und babylonische Altertümer umfaßt und
vom Assyriologen Hermann Vollrath Hilprecht (1859-1925)1280 gestiftet worden war.
Vorstand der Hilprecht-Sammlung war Schachermeyr dann ab dem Sommersemester
1934, und als er Jena verließ, wurde sein Nachfolger in dieser Funktion der
Assyriologe Oluf Krückmann (1904-1984)1281, wobei sich dieser die Stelle bis zum
Wintersemester 1938/39 noch mit dem Nachfolger Schachermeyrs auf dem Jenenser
Lehrstuhl für Alte Geschichte Hans Schaefer (1906-1961)1282 teilte1283.
1278 1, 1932-5,1935; N. F. 1/2, 1937. 1279 Vgl. S. 222f. Anm. 1206 und J. John 1983, 287. 1280 DBE 5, 1997, 47; J. John 1983, 278. 1281 E. Ellinger 2006, bes. 502; K. Hecker 1985, 185f.; J. Renger 1979, 181; E. Wirbelauer –
B. Marthaler 2006, 956. 1282 A. Chaniotis – U. Thaler 2006, bes. 405; K. Christ 1999, 224f.; H. Gottwald 2003, 932f.;
Hb. dt. Wiss., 1284; H. U. Instinsky 1961, 844-848; V. Losemann 1977, bes. 209 Anm. 30; B.
Näf 1986, bes. 204-210; S. Rebenich 2005, 50-55; C. Ulf 2001, 427-434; W. Weber 1984,
500f.; E. Wirbelauer – B. Marthaler 2006, 992f.; E. Wolgast 1985, 27; E. Wolgast 1986, 156.
Zur Frage, ob das NSDAP- und SA-Mitglied Hans Schaefer innerlich ein überzeugter
Nationalsozialist gewesen ist, vgl. auch die auf der Leserbriefseite der FAZ geführte
Diskussion zwischen den Professoren Peter Herde (FAZ vom 6.9.2006, 11) und Hans
Buchheim (FAZ vom 4.10.2006, 22). Schaefer scheint nach 1945 eine Heidelberger Professur
Golo Manns verhindert zu haben, vgl. T. Lahme – K. Lüssi 2006, 389. 1283 K. Hecker 1985, 185 bezeichnet Krückmann als „Kurator der Hilprecht-Sammlung
vorderasiatischer Altertümer“; J. John – O. Lemuth 2003, 1115.
Professor in Jena (1931-1936) 236
Reisetätigkeit
Im Frühjahr 1934 hielt sich Fritz Schachermeyr in Griechenland auf1284. Die
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft hatte diese seine „Studienreise nach
Griechenland und Rhodos“1285 finanziert. Damals forschte Schachermeyr offenbar
auch am Deutschen Archäologischen Institut in Athen, wo er mit Walther Wrede und
Georg Karo, der erst „1936 einem Gewaltakt der Hitlerregierung weichen mußte“1286,
zusammentraf1287. Wohl auf dieser Griechenlandreise im Jahr 1934, möglicherweise
jedoch erst 1935 lernte Schachermeyr auch Spyridon Marinatos (1901-1974)1288
kennen, der damals die Position des Ephoros von Kreta innehatte und seit 1929
zugleich Direktor des Museums in Herakl(e)ion / (H)Irakl(e)ion war1289. Ob
Schachermeyr Marinatos auf Kreta oder auf Kephallenia, wo dieser mykenische
1284 A II, G. Karo an Schachermeyr, Brief vom 20.5.1934; F. Schachermeyr 1984, 222; vgl.
dazu auch o. S. 224f. und AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 94, 100, 109. 1285 F. Schachermeyr 1935a, VI. 1286 F. Matz 1964, 638; über Karos „Beziehungen zur höchsten politischen Prominenz“, dank
denen er als Jude mit der persönlichen Zustimmung Hitlers bis 1936 im Amt bleiben konnte,
vgl. K. Junker 1997, 37f.; s. a. W. Weisbach 1956, 371. 1287 A II, G. Karo an Schachermeyr, Brief vom 20.5.1934; vgl. auch F. Schachermeyr 1935a,
VI. 1288 S. Alexiou 1975, 174f.; W. Alzinger 1976-1977, 58f.; EEE 6, 1987, 41f.; È. Gran-
Aymerich 2001, 441f.; R. Hägg 1996b, 726; S. Jakovidis 1975, 635-638; G. S. Korres 1978,
456-462; L. M. Medwid 2000, 197-199; R. Oberheid 2007, bes. 383; F. Schachermeyr 1974g,
493-513; H. Schmuck 2003, 698; M. Schoch 1995, bes. 120-128; A II, S. Marinatos an
Schachermeyr, Brief vom 23.3.1960. 1289 F. Schachermeyr 1974g, 495. Andererseits gibt Schachermeyr an, Marinatos erst während
seiner Exkursion „mit den beiden Geographen“ nach Ostkreta kennengelernt zu haben
(Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Die besten Freunde für mich und
meine Wissenschaft, fol. 9b), d. h. erst 1938; vgl. S. 288.
Professor in Jena (1931-1936) 237
Nekropolen ausgrub1290, getroffen hat, läßt sich nicht feststellen, jedoch ist ein
Zusammentreffen auf Kephallenia wahrscheinlicher, jedenfalls berichtet
Schachermeyr in seiner Autobiographie, daß er 1934 oder 1935 die dortige
mykenische Keramik studierte1291. Seine Heimreise trat er über Linz an, um dort seine
Mutter zu besuchen1292. Das Deutsche Archäologische Institut übertrug ihm dann noch
weitere „Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des mykenischen Altertums in diesem
Jahre“1293, die er aber offensichtlich erst im nächsten Jahr, also 1935, in Angriff nahm.
Auch in diesem Jahr reiste Schachermeyr bereits im Frühjahr1294 nach Griechenland,
diesmal um seine mykenischen Forschungen fortzuführen. Finanziell unterstützt wurde
diese Forschungsreise jetzt vom Deutschen Archäologischen Institut, von Georg Karo
im besonderen1295. Schachermeyr hatte sich ursprünglich bei einer anderen Stelle,
möglicherweise bei der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, um die
Finanzierung seiner Forschungsreise bemüht, sein Ansuchen war aber damals offenbar
von einem Frankfurter Gutachter1296 negativ beurteilt worden. Schachermeyrs Freund
Langlotz bot sich daraufhin an, mit dem Archäologen und damaligen Präsidenten des
Deutschen Archäologischen Instituts Theodor Wiegand (1864-1936)1297 zu sprechen,
1290 M. Steinhart – E. Wirbelauer 2002, 180, 297 Anm. 421, 307 Anm. 515. 1291 F. Schachermeyr 1984, 222. 1292 A II, G. Karo an Schachermeyr, Brief vom 20.5.1934. 1293 F. Schachermeyr 1935a, VI. 1294 Das Vorwort zu F. Schachermeyr 1935a schrieb Schachermeyr bereits in Athen; es ist mit
5. April 1935 datiert. 1295 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 12; vgl. auch F. Schachermeyr 1935a, VI; F. Schachermeyr 1984,
222 und A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatierter Brief. 1296 Einschlägiger Althistoriker in Frankfurt war damals Matthias Gelzer (vgl. V. Losemann
1977, 183; vgl. auch S. 275f. mit Anm. 1484 und S. 695f.). 1297 K. Bittel 1988, 154f.; W. M. Calder III 1996, 1193f.; DBE 10, 1999, 481; EEE 2, 1984,
270; E. Ellinger 2006, bes. 539f.; Führerlexikon, 525; K. Junker 2001, 506f. bes. Anm. 8;
KGL 1925, 1134; KGL 1950, 2378; H. Kullnick 1960, 225; R. Oberheid 2007, bes. 407f.;
Professor in Jena (1931-1936) 238
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß dieser „bei seinem Ansehen und s[eine]r Macht
Dir das Stipendium zum Herbst verschaffen kann“1298. Schachermeyr war diese
Intervention offenbar recht, und tatsächlich reiste er dann, wie geplant bereits im
Frühjahr, mit der Unterstützung des Deutschen Archäologischen Instituts nach
Griechenland. So konnte er in diesen beiden Jahren insbesondere die Keramik der
mykenischen Zeit aus Achaia sowie von den Inseln Kephallenia, Rhodos und Zypern
studieren. Auf letzterer Insel hielt er sich im Jahr 1935 auf1299, wo er einerseits
besonders im Cyprus-Museum1300 von Nikosia, das gerade in diesem Jahr „nun
endgültig einen vollständigen und offiziellen Charakter“1301 erhielt, die Funde,
andererseits aber auch die archäologischen Stätten selbst besichtigen konnte.
Unterstützung erfuhr Schachermeyr hier von Porphyrios Dikaios (1904-1971)1302. Bei
dieser Gelegenheit konnte Schachermeyr auch einen Abstecher in den Nahen Osten,
vor allem nach Syrien machen1303, das damals unter französischem Mandat stand1304.
Dort traf er mit Henri Seyrig (1895-1973)1305 zusammen1306 und besichtigte sowohl
Reichshandbuch, 2028f.; W. Weisbach 1956, 216 (bezeichnete den Antisemitismus als
„ekelhafte Schweinerei“), 348, 352, 389; L. Wickert – C. Börker 1979, bes. 200. 1298 A II, E. Langlotz an Schachermeyr, Brief vom 24.1.1934. 1299 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 12; vgl. auch F. Schachermeyr 1935a, VI und A II, P. Dikaios an
Schachermeyr, Brief vom 15.8.1958. 1300 V. Karageorghis 1989. 1301 V. Karageorghis 1989, 7. 1302 EEE 3, 1985, 281; È. Gran-Aymerich 2001, 225f.; V. Karageorghis 1972, 177-179; V.
Karageorghis 1979, [XIII, III]; L. M. Medwid 2000, 83-85; H. Schmuck 2003, 274. 1303 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Sehr sorgfältiger
Entwurf etwa um 1957, fol. 12. 1304 N. A. Ziadeh 1957, 47-50. 1305 È. Gran-Aymerich 2001, 636-638. 1306 F. Schachermeyr 1935a, VI.
Professor in Jena (1931-1936) 239
Ugarit und Beirut samt seinem Museum als auch Damaskus1307. Auf dieser Reise
lernte Schachermeyr auch Claude Frédéric Armand Schaeffer(-Forrer) (1898-1982)1308
kennen, wobei nicht klar ist, ob bereits auf Zypern, wo dieser eben seine Forschungen
in Enkomi begonnen hatte, oder erst in Syrien. Über diese Reisen nach Zypern und
Syrien geben einige Briefe Schachermeyrs aus Griechenland an seine Frau aus dem
Frühjahr 1935 näheren Aufschluß, von denen zwei exakt datiert sind, einer mit 6. März
19351309, der andere mit 2. April 19351310. Letzteren schrieb er „auf einem
rumänischen Dampfer auf der Fahrt von Beyruth nach Piräus“. Chronologisch hierher
gehört aber auch noch ein anderer, der nur die Aufschrift „12.III. Athen“ trägt. Aus
diesen Briefen geht hervor, daß sich Schachermeyr eigentlich nach Kephallenia
einschiffen wollte, daß aber aufgrund der am 1. März ausgebrochenen sogenannten
„Venizelistischen Revolution“1311 der Schiffsverkehr dorthin gerade eingestellt war. So
fuhr er am 12. März mit der Bahn zurück nach Athen und bestieg bereits am 13. März
gemeinsam mit dem amerikanischen Archäologen Bert Hodge Hill (1874-1958)1312,
der seit 1932 auf Zypern forschte, ein Schiff Richtung Zypern, wo er zehn Tage zu
bleiben gedachte. Den anschließenden achttägigen Aufenthalt in Syrien behielt er dann
in keiner besonders guten Erinnerung: „So ein Gaunerland. Alle Syrer sind Gauner,
1307 F. Schachermeyr 1984, 222; A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom
12.3.[1935]. 1308 C. Burney 2004, 240; È. Gran-Aymerich 2001, 621-623; R. Oberheid 2007, bes. 392f.
(mit falschem Geburtsjahr und falschem Sterbedatum); vgl. A II, Parte Monsieur Claude
Frédéric Armand Schaeffer, seine Frau war Odile, geb. Forrer („de vous faire part du décès
survenu le 25 Août 1982, dans sa quatre-vingt-cinquième année“). 1309 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 6.3.1935. 1310 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 2.4.1935. 1311 G. Hering 1992, 1071-1081; A. Petrowas 1980, 103-127; A. Vakalopulos 1985, 217-219;
N. Wenturis 1984, 80. 1312 C. W. Blegen 1959, 193f.; N. Thomson de Grummond 1996, 590f.; L. M. Medwid 2000,
154f.
Professor in Jena (1931-1936) 240
Lügner, Beutelschneider und Halunken. Alle wollen Bakschis [sic]. Erfreulich waren
nur die Franzosen, welche sich entzückend benahmen[,] und erfreulich war Damaskus.
Alles andere Dreck, Scheiße und Schwindel. Die Brutstätte des einstigen Judentums ist
sich also treu geblieben“1313. Erfreut zeigte sich Schachermeyr darüber, daß er in
Beirut in einer deutschen Pension wohnen konnte. Belastend wirkte auf ihn hingegen,
daß sein Syrienaufenthalt „in die Zeit der schlimmsten Kriegspsychose fiel. Die
ganzen Zeitungen schrieben von nichts wie von Krieg1314[,] und manche Tage schien
es, als ob derselbe unmittelbar darauf auch schon ausbrechen wollte.“1315 Offenbar
noch davor waren Ausflüge nach Ägina zu Gabriel Welter (1890-1954)1316, der
Schachermeyr irgendwann auch ein Stück „polychrome[r] Lederware“1317 für seine
Sammlung schenkte1318, sowie nach Nemea bzw. eine Reise nach Kreta geplant
gewesen, auch Istanbul wäre auf dem Programm gestanden, womit es aber „wohl
1313 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 2.4.1935. 1314 Möglicherweise sind damit Italiens Vorbereitungen auf den Überfall auf Abessinien
(heute Äthiopien) gemeint. Mussolini marschierte dann am 2. Oktober 1935 ein und führte bis
Mai 1936 einen Eroberungskrieg in Ostafrika (vgl. z. B. R. A. C. Parker 1967, bes. 269-272).
Wahrscheinlicher jedoch ist, daß sich diese Äußerung Schachermeyrs auf Deutschland
bezieht, das am 16. März 1935 die Allgemeine Wehrpflicht einführte, nachdem Hermann
Göring (1893-1946) bereits am 10. März 1935 die Existenz einer deutschen Luftwaffe
bekanntgegeben hatte, was jeweils einen Bruch des Vertrags von Versailles bedeutete.
Frankreich, Italien und England reagierten darauf mit einer Erklärung, die bereits im April
1935 auf der Konferenz im norditalienischen Stresa ausgearbeitet wurde, wonach die drei
Staaten gegen jede einseitige Nichtanerkennung von Verträgen vorgehen wollten (vgl. z. B.
R. A. C. Parker 1967, 264-267). 1315 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 2.4.1935. 1316 L. Wickert – C. Börker 1979, bes. 200; R. Wünsche 1988, 246f. 1317 Vgl. dazu F. Schachermeyr 1976d, 218-220; auch F. Schachermeyr 1951b, 749-752. 1318 A II, F. Schachermeyr an S. Hiller, Brief vom 7.5.1975. Daß es sich bei „ein
einschlägiges Fragment in einer Privatsammlung“ (F. Schachermeyr 1976d, 218f.) aus Ägina
um dieses Stück handelt, läßt sich nicht verifizieren, ist jedoch durchaus wahrscheinlich.
Professor in Jena (1931-1936) 241
nichts mehr“1319 wurde. Anfang April 1935 aus Syrien in Athen angekommen,
beabsichtigte Schachermeyr per Schiff, das am 14. April ablegte, nach Venedig und
von dort per Bahn über Villach, Salzburg, Linz, Prag, Dresden und Leipzig nach Jena
heimzukehren1320.
Diese beiden Forschungsreisen kamen zwar zum Teil noch seinem Buch Hethiter
und Achäer1321 zugute, allerdings resultierte vorerst aus keiner eine eigene Publikation.
Erst viel später, zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, erschien dann in ganz
selbständigem Rahmen ein Buch zur griechischen Frühgeschichte, Die ältesten
Kulturen Griechenlands1322, das sich jedoch ausschließlich mit den vormykenischen
Perioden auseinandersetzt, während die „Darstellung der gesamten griechischen
Frühzeit einschließlich der minoischen wie mykenischen Kultur“1323 als ein zweiter
Teil geplant war, der so nie erschienen ist. Kurz vor seinem Tod sah Schachermeyr die
damalige Verlagerung seines Interessenschwerpunktes hin zu Griechenland und weg
vom Alten Vorderen Orient wie folgt: „Meine 1931 erfolgte Berufung nach Jena schob
mir ja gleichsam einen Riegel vor, hatte ich in meinem neuen Wirkungskreis doch vor
allem die griechische und römische Geschichte zu betreuen. Da blieb für das
Hethitische dann nicht mehr allzuviel Zeit übrig.“1324 So schrieb er damals zum Alten
1319 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, undatierter Brief; immerhin gibt
Schachermeyr den Hinweis, daß auf Kreta erst kürzlich ein Erdbeben „ziemlich gewütet“
habe. Eine Datierung mit Hilfe von Erdbeben erweist sich im Fall von Kreta freilich nicht
selten als schwierig, weil dort in manchen Jahren gleich mehrere starke Beben registriert
werden. Allerdings gab es auf Kreta im Jahr 1935 nur ein einziges nennenswertes Beben,
nämlich am 25. Februar. Epizentrum war damals Neapolis-Anoghia (vgl. A. G. Galanopoulos
1960, 58f.). 1320 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 2.4.1935. 1321 Leipzig 1935 = F. Schachermeyr 1935a. 1322 Stuttgart 1955 = F. Schachermeyr 1955a. 1323 F. Schachermeyr 1955a, 7. 1324 F. Schachermeyr 1986a, 7.
Professor in Jena (1931-1936) 242
Vorderen Orient nur mehr einige unfertige Studien über Spezialfragen für die
Schublade.
Die Ausbürgerung – Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft
Im Juli 1934 forderte das Bundeskanzleramt die Bundespolizeidirektion Linz auf,
„die Ausbürgerung des Prof. Dr. Fritz Schachermeyer [sic], der Führer des Gaues
Thüringen des ‘Kampfringes der Deutschösterreicher im Reiche’ ist“1325,
vorzunehmen, weil er sich in den Augen der österreichischen Behörde auf diese Weise
österreichfeindlich betätigte. Gleichzeitig wird Schachermeyrs Familie polizeilich
durchleuchtet. Wir erfahren: „Sein Bruder Ing. Johann Schachermeyer [sic] ist in Linz
eine bekannte Persönlichkeit und genießt einen guten Ruf. Er ist Präsident der
Ingenieurkammer für Oberösterreich und Salzburg und als Zivilingenieur als
Konsulent für das Bauwesen tätig. Der Genannte ist vaterländisch gesinnt, steht der
christlichsozialen Partei nahe und ist Funktionär in der Heimatschutzformation des
Generalmajor Englisch-Popparich1326 in Linz (Stellvertreter des Letzteren [sic]).“1327
1325 AdR, Bundeskanzleramt GZ 192.837. - St.B. / G.D. 34. Vgl. UA Heidelberg, PA 5599,
wo Schachermeyr selbst angibt, „1933-34 Gauführer v. Thüringen des N. S. Kampfringes der
Deutschösterreicher im Reich“ gewesen zu sein, hier führt er dann auch an, „1934 in
Österreich wegen n. s. Betätigung ausgebürgert“ worden zu sein; vgl. dazu A. Chaniotis – U.
Thaler 2006, 403. S. auch Schachermeyrs Mitgliedskarte des Nationalsozialistischen
Lehrerbundes (Mitgliedskarte NSLB Nr. 309510 Schachermeyer [sic] Fritz), in der unter dem
Punkt „Betätigung in der NSDAP – SA. – HJ. – BdM. – Luftschutz usw. als und seit?“
„Gauführer f. Thür. d. Kampfringes d. Dtsch.-Österreicher“ zu lesen ist. H. A. L. Degener
1935, 1361 und W. Kosch 1938, 4182 führen ihn für 1933-34 als „Gauführer des
nationalsozialistischen Kampfrings der Deutsch-Österreicher“. Unspezifiziert stellt S. P.
Remy 2002, 74 fest: „He had been active […] as a Gauführer in Thuringia in 1933 and 1934.“
Vgl. schon o. S. 225. 1326 Oskar Englisch-Popparich; vgl. W. Wiltschegg 1985, 142, 303.
Professor in Jena (1931-1936) 243
Von der Bundespolizei Linz ergeht in der Folge am 13. August 1934 folgender
Bescheid an Schachermeyr: „Im Sinne des § 10, Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 30.
Juli 1925, B.G.Bl. 285 in der Fassung der Verordnung der Bundesregierung vom
16.8.1933, B.G.Bl. 369 wird festgestellt, daß nachstehende Person durch
staatsfeindliche politische Betätigung gegen den Bundesstaat Österreich die
Landesbürgerschaft im Bundesland Oberösterreich verloren hat: Dr. Fritz
Schachermeyer [sic], Professor, 10.1.1895 Linz geb. und zust., Jena, Thüringen,
Sauckelstraße 18 wohnhaft. Begründung: Nach den amtlichen Erhebungen hat sich der
Genannte als Führer des Gaues Thüringen des ‘Kampfringes der Österreicher im
Reich’, einer gegen die Souveränität des österreichischen Staates gerichteten
Organisation, im österreichfeindlichen Sinne betätigt.“1328 Dieser
Ausbürgerungsbescheid wurde mit 30. August 1934 rechtskräftig1329. Schon zuvor
hatte die zunächst einmal bloß augenscheinlich drohende Gefahr einer Ausbürgerung
aus politischen Gründen offenbar auch unter Schachermeyrs Kollegenschaft die Runde
gemacht und Befürchtungen ausgelöst, es könnte Probleme bei seiner
Griechenlandreise von 1934 geben1330, die zwar durch Österreich führte, tatsächlich
jedoch „ohne Zwischenfälle vonstatten gegangen ist“1331.
Im Jänner 1935 berichtete dann aber die Bundespolizeidirektion Linz an das
Bundeskanzleramt, daß Schachermeyr die österreichische Staatsbürgerschaft infolge
des Erwerbs der reichsdeutschen Staatsbürgerschaft schon auf Beschluß der Tiroler
Landesregierung vom 12. August 1931 verloren hatte und so der Bescheid vom 13.
August 1934 aufgehoben werden mußte1332.
1327 AdR, Bundeskanzleramt, GZ 192.837 - St.B. / G.D. 34. 1328 AdR, Bundeskanzleramt, GZ 232.635 - St.B. / G.D. 34. 1329 AdR, Bundeskanzleramt, GZ 192.837 - St.B. / G.D. 34. 1330 Vgl. C. Reinholdt 2001, 12, der generell Griechenlandreisen Schachermeyrs für die Mitte
der dreißiger Jahre annimmt, und hier S. 236-241. 1331 A II, J. Werner an Schachermeyr, Brief vom 15.6.1934. 1332 AdR, Bundeskanzleramt, GZ 192.837 - St.B. / G.D. 34.
Professor in Jena (1931-1936) 244
Und auch in seinem „Memorandum über die Staatsbürgerschaft und politische
Betätigung“1333 von 1951 gab Schachermeyr dann an, seine österreichische
Staatsbürgerschaft schon 1931 durch sein Versäumnis verloren zu haben, vor
Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft eine Doppelstaatsbürgerschaft für sich zu
beantragen1334, was durch einen entsprechenden Brief der Tiroler Landesregierung
vom 12. August 1931 belegt werden kann, in dem es heißt, daß das Bundeskanzleramt
nicht in der Lage sei, „der Beibehaltung der Tiroler Landesbürgerschaft zuzustimmen,
weil Sie die deutsche Staatsangehörigkeit durch den Antritt des Lehramtes an der
Universität Jena erworben haben und damit die Tiroler Landesbürgerschaft bereits
verloren wurde. Es könnte nur eine Wiedereinbürgerung nach vorher einzuholender
Bewilligung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei den zuständigen
reichsdeutschen Behörden in Aussicht genommen werden“1335. Auf ergebnislose, weil
nicht termingerechte, Bemühungen Schachermeyrs um eine Doppelstaatsbürgerschaft
lassen auch zwei an ihn gerichtete Briefe des Anglisten Rudolf Hittmair (1889-
1940)1336 aus dem Jahr 1931 schließen, der nach den eigenen Angaben in diesen
Briefen sehr wohl eine Doppelstaatsbürgerschaft besaß, um diese im Gegensatz zu
Schachermeyr aber bereits vor seinem Dienstantritt in Deutschland angesucht hatte1337.
Andererseits geht aus dem von Schachermeyr eigenhändig ausgefüllten Formular
in seinem Heidelberger Personalakt hervor, daß er damals in der Rubrik „Politische
Betätigung:“ die Angabe „1934 in Österreich wegen n[ational]s[ozialistischer]
Betätigung ausgebürgert“1338 eingetragen hat, was sich wohl am besten so erklärt, daß
1333 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93. 1334 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93. 1335 AdR, Bundeskanzleramt, GZ 192.837 - St.B. / G.D. 34. 1336 ÖBL 2, 1959, 338f.; W. Kosch 1933, 1614; Neffe des gleichnamigen Bischofs von Linz
(1859-1915; ÖBL 2, 1959, 338). 1337 A II, R. Hittmair an Schachermeyr, Briefe vom 21.5.1931 und 29.8.1931; vgl. dazu AdR,
Bundeskanzleramt, GZ 192.837 - St.B. / G.D. 34. 1338 UA Heidelberg PA 5599; s. schon o. S. 242 mit Anm. 1325.
Professor in Jena (1931-1936) 245
sich Schachermeyr durch eine objektiv wie subjektiv unwahre, wenngleich doch
stimmige Auskunft vor den Nationalsozialisten in Szene setzen wollte – ein
entsprechender Bescheid war ja tatsächlich erlassen worden. Weiters erfahren wir aus
einem späteren Personalakt, daß sich Schachermeyr im Jahr seines Wechsels nach
Heidelberg 1936 sehr wohl nach Österreich – nach eigenen Angaben nach Linz und
nicht nach Innsbruck – begab1339, um sich seiner Ausbürgerung, die er als
ungerechtfertigt ansah1340, anzunehmen. Dort in Linz traf er den damaligen
Polizeidirektor Dr. Viktor Bentz (1893-1938)1341, einen „Bekannten meiner
Familie“1342, der sich bereit erklärte, die Löschung von Schachermeyrs Ausbürgerung
zu veranlassen, von der er den Bescheid zuvor im Jahr 1934 eigenhändig
unterschrieben hatte. Schachermeyr dazu: „Wenn ich mich nicht irre, so habe ich
nachher auch noch ein diesbezügliches Schreiben über den Vollzug der Löschung
zugesandt erhalten. Meine ursprüngliche Absicht, mich auch mit der Tiroler
1339 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95. 1340 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 93. 1341 H. Slapnicka 1975, 285, 366; Thomas Karny, Zeit der Wirren. Der Februar 1934 – und
seine Folgen, Wiener Zeitung. Feuilleton Archiv,
http://www.wienerzeitung.at/Desktopdefault.aspx?TabID=3946&Alias=wzo&lexikon=Geschi
chte&letter=G&cob=4211 („In den nächsten Tagen [des März 1938] erhielt
[Polizeioberkommissär Dr. Josef] Hofer Nachricht von der Ermordung mehrerer Kollegen,
auch des Polizeidirektors Viktor Bentz“); vgl. auch Thomas Karny, Der Wandel nach dem
Februar ’34. Abschiede und Wiederbegnungen in einer Zeit der Wirren,
http://www.karny.at/beitraege/zeit_beitrag_02.html; Land Oberösterreich 1938,
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-3DCFCFC3-
90F4CCFB/ooe/hs.xsl/13784_DEU_HTML.htm; D. Ellmauer – M. John – R. Thumser 2004,
259. Schachermeyr nennt ihn den „Polizeipräsidenten Dr. Benz“ (AdR, PA Fritz
Schachermeyr, fol. 95). 1342 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95.
Professor in Jena (1931-1936) 246
Landesregierung wieder in Verbindung zu setzen, habe ich, als nunmehr unnötig,
wiederum fallen lassen.“1343
Offenbar hat Schachermeyr die Löschung seiner Ausbürgerung durch diesen
Freundschaftsdienst des Dr. Bentz auch wirklich erreicht, denn vor seiner Berufung
nach Wien im Jahr 1952 konnte er eine Bescheinigung vom Magistrat Innsbruck
beibringen, daß er am 13. März 1938 das Heimatrecht in Innsbruck besaß1344. In den
staatspolizeilichen Akten ist dagegen keine Löschung seiner Ausbürgerung vermerkt.
In den Listen des Innenministeriums scheint auch keine Wiedereinbürgerung oder eine
Doppelstaatsbürgerschaft auf.
Vorschlag für die Professur für Griechische Geschichte in Wien – Nachfolge
Adolf Wilhelm
Wie schon erwähnt, reiste Schachermeyr im September 1932 nach Wien, um die
Modalitäten seiner Berufung auf den Lehrstuhl von Lehmann-Haupt auszuhandeln.
Diese Gelegenheit nutzte er aber offenbar auch dazu, sich an der Wiener Universität
im Hinblick auf die Nachfolge Adolf Wilhelm in Erinnerung zu rufen, so wie ihm
Menghin geraten hatte1345. Hier hatte er mehrere längere Unterredungen mit Wilhelm
selbst, bei dem Schachermeyr augenscheinlich einen guten Eindruck hinterließ.
Gesprochen wurde auch über Schachermeyrs anstehende Berufung nach Innsbruck1346.
Gleichzeitig sagte Schachermeyr Wilhelm zu, sich für den Archäologen Arnold
Schober (1886-1959)1347 in Jena einzusetzen1348, was freilich ohne Konsequenzen
1343 AdR, PA Fritz Schachermeyr, fol. 95. 1344 Vgl. S. 425f. 1345 Vgl. A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 4.12.1931. 1346 Vgl. S. 212. 1347 E. Diez 1988, 232f.; F. Fellner – D. A. Corradini 2006, 370; E. Wirbelauer 2006, bes.
215-217, 219.
Professor in Jena (1931-1936) 247
blieb. Wilhelm schrieb hinterher nur kryptisch von Schachermeyrs „gegenwärtigen
und künftigen Aussichten“ und weiters: „Ich bin nur neugierig, welche Aufnahme Ihre
Wünsche in unserem Ministerium finden werden, und stelle mich Ihnen, wenn Sie dies
angezeigt glauben, gerne für eine Verwendung zur Verfügung.“1349 Damals dürfte
Schachermeyr außerdem auch noch mit dem zweiten Wiener Ordinarius, Rudolf
Egger, eine Unterredung gehabt haben, und dieser dürfte ihm bereits damals die
Aufnahme seines Namens in den Vorschlag für die Nachfolge Wilhelm in Aussicht
gestellt haben1350. Außerdem war damals allem Anschein nach ein Treffen mit Franz
Miltner in Aussicht genommen1351.
Am 6. Dezember 1934 fand schließlich die entscheidende Kommissionssitzung
statt, in der über die Wiederbesetzung des nach dem Ausscheiden von Adolf Wilhelm
im Herbst 1933 vakanten Lehrstuhls beraten wurde, der das Nominalfach Griechische
Altertumskunde und Griechische Epigraphik sowie die Lehrverpflichtung Griechische
Geschichte umfaßte. Zunächst wurde der bereits im Herbst 1933 emeritierte Professor
Adolf Wilhelm um seine Meinung gebeten. Dieser gab seinen Dreiervorschlag mit
Schachermeyr, Schehl und Miltner ab1352. „Prof. Keil kann von Prof. Wilhelm aus
persönlichen Gründen nicht vorgeschlagen werden.“1353 Die Kommission legte großen
1348 A II, A. Wilhelm an Schachermeyr, Brief vom 9.10.1932; A II, A. Schober an
Schachermeyr, Brief vom 10.11.1932. 1349 A II, A. Wilhelm an Schachermeyr, Brief vom 9.10.1932. 1350 S. u. S. 248. 1351 A II, F. Miltner an Schachermeyr, Karte vom 9.9.1932. 1352 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 42. 1353 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 58. Mit „persönlichen Gründen“ kann gemeint sein (a)
Befangenheit gegenüber einem (Lieblings-)Schüler und/oder engen Freund; (b)
Feindschaft/Eifersucht auf einen Rivalen (Keil war ja als griechischer Epigraphiker selbst eine
Koryphäe). Da Keil nun weder ein Schüler noch ein enger Freund Wilhelms gewesen ist
(gemäß Keils Nachruf auf Wilhelm besaß dieser überhaupt „niemals einen wirklichen intimen
Freund“, J. Keil 1951, 316), kommt nur (b) in Betracht, vgl. auch L. Curtius 1950, 289f.; L.
Curtius 1958, 193f.: „[…] mit seiner hohen Fistelstimme beklagte sich der kleine Mann […]
Professor in Jena (1931-1936) 248
Wert darauf, „eine Persönlichkeit zu gewinnen, welche über Lehrerfahrung verfügt
und, um nach Möglichkeit die 50 Jahre alte bewährte Tradition aufrecht zu erhalten,
ausserdem die schwierige Materie der griechischen Epigraphik beherrscht“1354. In der
darauffolgenden Diskussion wurde darüber beraten, ob Schachermeyr in Anbetracht
seiner eindeutigen politischen Ausrichtung1355 überhaupt in den Vorschlag
aufgenommen werden solle. Weiters wurde bemängelt, daß dieser „der griechischen
Epigraphik ferne steht“, jedoch wurde ihm zugestanden, daß er als Lehrer „von allen
[sic] Anfang an Erfolg gehabt“ habe1356. Wie von Menghin vorhergesagt, erwies sich
Egger als ein treuer Freund von Josef Keil und sprach sich eindeutig für diesen aus:
„Keil ist das Optimum. Die Persönlichkeit Schachermeyrs müßte noch ausführlicher
charakterisiert werden.“1357 In einem am darauffolgenden Tag abgeschickten Brief an
Schachermeyr formulierte Egger demgegenüber: „Indessen schicke ich Ihnen viele
Grüße und freue mich, dass der Vorschlag so geworden ist, wie ich es Ihnen anlässlich
Ihres letzten Besuches gesagt habe“1358. Nach der Abstimmung mit sieben Stimmen
für Schachermeyrs Aufnahme, drei dagegen und einer Enthaltung kamen die
Kommissionsmitglieder, der als Vorsitzender und Dekan fungierende germanistische
Sprach- und Literaturwissenschaftler Dietrich (Ritter von Meyrswalden) Kralik (1884-
unaufhörlich über ihm widerfahrene Unbill und Kränkung, was aber kein Mensch ernst
nahm.“ Dazu stimmt, daß Adolf Wilhelm die Wahl Josef Keils in die Akademie bei keinem
der beiden Wahlgänge unterstützt hat (s. M. Pesditschek 2009b, im Druck) und Josef Keil in
seinem Nachruf auf Wilhelm diesen – bei aller Noblesse in der Form – de facto als
ehrgeizzerfressenen, bindungsunfähigen, zutiefst unglücklichen und friedlosen, also in seinen
Augen ganz unverträglichen Menschen porträtiert hat. 1354 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 42. 1355 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 58: „Kretschmer bedauert, daß Schachermaier [sic] aus
bestimmten Gründen nicht in Betracht komme“; vgl. M. Pesditschek 1996, 136f. 1356 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 44. 1357 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 64. 1358 A II, R. Egger an Schachermeyr, Brief vom 7.12.1934.
Professor in Jena (1931-1936) 249
1959)1359, der Historiker Alfons Dopsch (1868-1953)1360, der Mineraloge Alfred
Himmelbauer (1884-1943)1361, der Historiker Hans Hirsch (1878-1940)1362, der
Indogermanist Paul Kretschmer, der Pädagoge und Philologe Richard Meister (1881-
1964)1363, die Altphilologen Johannes Mewaldt (1880-1964)1364 und Karl Mras (1877-
1962)1365, der Archäologe Camillo Praschniker, der Altphilologe Ludwig (Martin)
1359 E. Bruckmüller 2004, II, 236; F. Czeike 3, 1994, 589; DBE 6, 1997, 67f.; H. Giebisch –
G. Gugitz 1964, 211; W. Kosch 1933, 2317f.; I. Ranzmaier 2005, bes. 77-92; M. Schierling
1980, 666f.; R. Teichl 1951, 159; P. Wiesinger – D. Steinbach 2001, 83-86. 1360 E. Bruckmüller 2004, I, 280; O. Brunner 1959, 77; T. Buchner 2008, 155-190; F. Czeike
2, 1993, 80; DBE 2, 1995, 597; J. Demade 2007, bes. 180 mit Lit.; F. Fellner – D. A.
Corradini 2006, 97; F. Jaksch 1929, 52; R. A. Müller 2002, 76; R. Teichl 1951, 47; H.
Vollrath 1980, 39-54; W. Weber 1984, 109f.; H. Zatschek 1957, 160-170. 1361 E. Bruckmüller 2004, II, 64; F. Czeike 3, 1994, 198f.; DBE 5, 1997, 49; F. K. L.
Machatschki 1972, 171. 1362 E. Bruckmüller 2004, II, 66f.; F. Czeike 3, 1994, 196; DBE 5, 1997, 61; F. Fellner – D. A.
Corradini 2006, 187; W. Hartkopf 1992, 153; KGL 1926, 761f.; KGL 1950, 2394; W. Kosch
1933, 1608; ÖBL 2, 329f.; F. Planer 1929, 253; A. H. Zajic 2008a, 307-417; A. Zajic 2008b,
244-246; H. Zatschek 1972, 214f. 1363 E. Bruckmüller 2004, II, 395; F. Czeike 4, 1995, 237; DBE 7, 1998, 47; J. Derbolav 1981,
2-23; A. Eder 1990, 728f.; F. Fellner – D. A. Corradini 2006, 277f.; F. Jaksch 1929, 174; F.
Kainz 1964, 267-311; KGL 1925, 654f.; KGL 1966, 2820; F. Planer 1929, 412f.; F. Römer –
H. Schwabl 2003, 99; R. Teichl 1951, 197. 1364 I. Auerbach 1979, 568; DBE 7, 1998, 96; W. Hartkopf 1992, 240; H. Hunger 1964, 261-
266; H. Hunger 1964, 524-526; KGL 1925, 663f.; KGL 1970, 3424; F. Römer – H. Schwabl
2003, 98; R. Teichl 1951, 200. 1365 DBE 7, 1998, 237; R. Hanslik 1963, 107-110; W. Hartkopf 1992, 250f.; KGL 1925, 687;
KGL 1966, 2820; R. Meister 1962, 356-367; F. Römer – H. Schwabl 2003, 98f.; R. Teichl
1951, 206; W. Unte 1997, 247f.; C. Wegeler 1996, bes. 380. Mras hatte 1938 seine Professur
verloren und konnte nach dem Krieg wieder an die Universität Wien zurückkehren.
Professor in Jena (1931-1936) 250
Radermacher (1867-1952)1366, der Historiker Heinrich v. Srbik (1878-1951)1367 und
Rudolf Egger, zum Entschluß, Josef Keil und Fritz Schachermeyr, damals „Ordinarius
für alte [sic] Geschichte und Dekan der philos[ophischen, sic] Fakultät in Jena“1368,
gemeinsam primo et aequo loco vorzuschlagen. Gleichzeitig wurde jedoch betont, daß
Keil eindeutig der Vorzug zu geben sei. An zweiter Stelle wurde Franz Schehl, im Juli
desselben Jahres für die Position eines wirklichen Extraordinarius an der Universität
Graz vorgeschlagener Dozent ebenda, und an dritter Franz Miltner, Extraordinarius in
Innsbruck, genannt. Diesem Vorschlag folgte dann das Professorenkollegium der
Philosophischen Fakultät1369.
Die Philosophische Fakultät legte größten Wert darauf, Keil zu gewinnen, doch
schien dessen Berufung zunächst unmöglich, weil das Ordinariat Wilhelm nur ad
personam verliehen worden und die zu besetzende Stelle nunmehr aus finanziellen
Gründen in ein Extraordinariat zurückzuverwandeln war – und diese außerordentliche
Professur meinte man Keil nicht anbieten zu können. Noch im Mai 1935 teilte Oswald
Menghin Schachermeyr mit, „daß die Bemühungen, Keil zu erhalten[,] fortgehen. Da
aber das Ministerium nur ein Extraordinariat hergeben will und Keil nur auf ein
Ord[inariat] gehen kann, so ist die Frage noch offen und die Berufung Keil [sic] kann
1366 DBE 8, 1998, 116; KGL 1925, 801; KGL 1954, 2723; R. Teichl 1951, 242; O. Wenig
1968, 235; K.-G. Wesseling 1994, 1226-1228. 1367 E. Bruckmüller 2004, III, 245; M. Derndarsky 1994, 153-176; B. Faulenbach 2002, 314-
316; F. Fellner – D. A. Corradini 2006, 385f.; G. Franz 1981, bes. 108f.; G. Franz 1995,
2718f.; E. Kienast 1938, 413f.; KGL 1925, 999; KGL 1954, 2730; H. Matis 1997, 14-18 mit
weiterer Lit.; F. Planer 1929, 592; G. von Selle 1953, Nr. 309; E. Stockhorst 2000, 370; R.
Teichl 1951, 290. 1368 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 44. Der Bericht ist einem mit 28. Dezember 1934 datierten
Brief an das Bundesministerium für Unterricht beigelegt (UA Wien, PA Josef Keil, fol. 60).
Zu Schachermeyrs Wirken als Dekan in Jena s. u. S. 251-258. 1369 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 60; auch A II, R. Egger an Schachermeyr, Brief vom
17.12.1934, wo es heißt: „Mag werden, was will, Sie mögen es als Zeichen unseres guten
Willens auffassen.“
Professor in Jena (1931-1936) 251
leicht scheitern. Der betreffende Herr scheint überhaupt der Ansicht zu sein, daß Ihre
Berufung die richtige Lösung wäre, und sich nur mit Rücksicht auf die alten Zusagen
an Keil zurückzuhalten. Wenn diese Sache aber vorüber ist, wird er sich ganz für Sie
verwenden. Auf mich können Sie natürlich auch rechnen.“1370 Die Möglichkeit, für
Wilhelms Fächer in Wien ein Ordinariat zu widmen, ergab sich aber dann doch, als der
Grazer ordentliche Professor Wilhelm Ensslin ins Ausland nach Erlangen gegangen
war, jetzt konnte und sollte Schehl als bloßer Extraordinarius die entstandene Lücke in
Graz ausfüllen, und Keils Ernennung zum ordentlichen Professor der Griechischen
Geschichte, Epigraphik und Altertumskunde in Wien konnte schließlich doch noch am
30. September 1936 erfolgen1371.
Schachermeyr wäre zwar durchaus nicht abgeneigt gewesen, Jena zu verlassen
und als Nachfolger Wilhelms nach Wien zu gehen – so schrieb er auf der Rückreise
aus Syrien1372 am 2. April 1935 tröstend an seine Frau: „Größte Erbitterung über die
Dir erfahrene Ablehnung1373. Nun wenn ich den Ruf nach W[ien] erhalte, ich nehme
an!!!“1374 – doch blieb ihm eine Rückkehr nach Österreich ein weiteres Mal verwehrt,
schließlich war Keil ja doch Schüler des Wiener Archäologisch-Epigraphischen
Seminars gewesen, und Schachermeyr hatte sich damals schon eindeutig als
Nationalsozialist profiliert1375.
1370 A II, O. Menghin an Schachermeyr, Brief vom 5.5.1935. 1371 UA Wien, PA Josef Keil, fol. 51, 57; M. Pesditschek 1996, 113. 1372 Siehe S. 238-240. 1373 Vermutlich Anspielung auf eine Kränkung seiner Frau durch das „hochnäsige“ Jenenser
professorale Establishment. 1374 A II, F. Schachermeyr an G. Schachermeyr, Brief vom 2.4.1935. 1375 Schachermeyr hatte zu dieser Zeit schon einige Schriften in nationalsozialistischem Sinn
veröffentlicht. Vgl. u. S. 260-263.
Professor in Jena (1931-1936) 252
Dekan im Nationalsozialismus
Wie schon aus dem soeben erwähnten Bericht der Wiener Berufungskommission
vom Dezember 1934 hervorgeht1376, fungierte Schachermeyr also bereits im
Wintersemester 1934/35 als Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Jena.
Er ist dann insgesamt zwei Perioden lang, vom 1. Oktober 1934 bis 31. März 19361377,
in dieser Funktion tätig gewesen, und zwar zu einem Gutteil der Zeit unter dem
nationalsozialistischen Rektor Wolf Meyer-Erlach (1891-1982)1378.
1376 Vgl. UA PA Josef Keil, fol. 42; s. auch o. S. 250. 1377 UA Heidelberg, PA 5599; Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis
Winterhalbjahr 1934/35, 22. Oktober bis 28. Februar, 4; Thüringische Landesuniversität Jena.
Vorlesungsverzeichnis Sommerhalbjahr 1935, 1. April bis 29. Juni, 7; Thüringische
Landesuniversität Jena. Personal- und Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 1935/36, 1.
November bis 22. Februar und Sommersemester 1936, 1. April bis 30. Juni, 6; vgl. dazu auch
Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsführer, Vorlesungsverzeichnis und Wegweiser
der Deutschen Studentenschaft für das Sommersemester 1941, 11; für das Winter-Semester
1941/42, 11 oder Karl-Franzens-Universität Graz, Vorlesungsverzeichnis und
Universitätsführer für das Sommersemester 1942, 77; für das Winter-Semester 1943/44, 81.
Am 24. Juli 1935 bekam Schachermeyr offenbar seine zweite Ernennung zum Dekan der
Philosophischen Fakultät überreicht (vgl. W. Schumann 1958, 621); vgl. auch A. Chaniotis –
U. Thaler 2006, 403; B. Näf 1994, 93. Übrigens saß Schachermeyr schon vor seiner
Ernennung zum Dekan im Pädagogischen Ausschuß der Universität und als Wahlsenator im
Akademischen Senat (375 Jahre Universität Jena 1558-1933. Vorlesungen Winter 1933/34.
Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1933/34, 16.
Oktober bis 28. Februar, 2f.; Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis
Sommerhalbjahr 1934, 30. April bis 31. Juli, 4; UA Heidelberg, PA 5599; vgl. auch A.
Chaniotis – U. Thaler 2006, 403). 1378 M. Grüttner 2004, 120; J. Hendel u. a. 2007, passim; S. Heschel 2007, passim; H.
Junginger 2008c, 80; E. Klee 2003, 409; E. Stockhorst 2000, 294.
Professor in Jena (1931-1936) 253
Meyer-Erlach wurde 1935, ohne jemals eine wissenschaftliche Arbeit vorgelegt
und ohne einen akademischen Grad erworben zu haben, an die Universität Jena
berufen, und seine Ernennung zum Rektor erfolgte, obwohl er selbst nur acht Stimmen
und zugleich der Physiker Abraham Esau 108 Stimmen von Mitgliedern des
Lehrkörpers erhalten hatte. Dieser war bereits seit 1932 Rektor gewesen und hatte
seinerseits „maßgeblichen Anteil an dieser Integration der Jenaer Universität in das
faschistische Herrschaftssystem“1379 gehabt. Schon 1933 hatte ein preußischer
Ministerialerlaß den Hochschulen das Recht entzogen, ihre Rektoren selbst zu wählen,
das „Führer“-Prinzip1380 wurde in Jena am 6. November 1933 eingeführt. Die Senate
waren ab diesem Zeitpunkt nur mehr Beratungsgremien. Dem Rektor waren die Leiter
der Dozentenschaft und der Studentenschaft unterstellt. „Die Person Meyer-Erlachs
sicherte der Universität in der nun beginnenden entscheidenden Periode der restlosen
Faschisierung der Universität einen Rektor, der alles einzusetzen gewillt war, um die
Universität in kürzester Frist so zu gestalten, wie es die Führer der Nazipartei in
Thüringen, mit Sauckel1381 an der Spitze, verlangten.“1382 Die Wahl der Rektoren,
Dekane und Senatoren fiel in der Regel auf Professoren, die seit langem der Partei
angehörten oder sich doch wenigstens schon früh mit deren Zielen identifiziert
1379 J. John 1983, 289. 1380 J. John 1983, 289; vgl. M. H. Kater 1985, 470. 1381 Gemeint ist Gauleiter und Reichsstatthalter Fritz Ernst Christoph Sauckel (1894-1946),
der als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde und bereits im August 1932 noch als
Ministerpräsident an die Spitze Thüringens trat (vgl. dazu auch G. Mai – D. Heiden 1995, 9).
Bereits 1934 erschien Sauckels Kampf und Sieg in Thüringen. Im Geiste des Führers und in
treuer Kameradschaft gewidmet den thüringischen Vorkämpfern des nationalsozialistischen
3. Reiches. Zum Gauparteitag 1934, Weimar 1934. Vgl. P. W. Becker 1999, 236-245; DBE 8,
1998, 525; J. Hendel u. a. 2007, passim; K. Höffkes 1986, 281-283; E. Klee 2003, 520; M.
Rademacher 2000, 278; E. Rimmele 2002b, 395; E. Stockhorst 2000, 357. 1382 W. Schumann 1958, 621.
Professor in Jena (1931-1936) 254
hatten1383. Der Dekan wurde Führer der Fakultät, er bestimmte die Kommissionen und
Berichterstatter der Fakultät und war dabei nur verpflichtet, „Vertreter der
Dozentenschaft mitheranzuziehen. Der Rektor besaß eine Schlüsselstellung bei der
Ernennung der Dekane.“1384 Es versteht sich von selbst, daß von diesen Dekanen im
Nationalsozialismus höchste Parteilichkeit erwartet wurde. Schon die Betrauung mit
dem Amt des Dekans allein läßt also vermuten, daß sich Schachermeyr nicht nur mit
den Machthabern arrangiert hat. Gemäß der von Ernst Nolte1385 erstellten Typologie
des Verhaltens der Hochschullehrer unter dem Nationalsozialismus haben sich
etablierte Professoren im Normalfall (d. h. mit Ausnahme „der wenigen Überzeugten“)
mit dem System aber eben lediglich arrangiert und es nur jüngere aufstrebende
Wissenschaftler für nötig befunden, sich aktiv zu engagieren. Zumindest nominell
auch schon Ordinarius, hat sich Schachermeyr also aus welchen Gründen auch immer
nicht wie die überwiegende Mehrheit der schon in sicherer Position befindlichen
Professorenkollegen verhalten und an der Universität Jena vor allem in den Jahren
1934-1936 als Dekan, akademischer Lehrer und Forscher gleichermaßen höchste
Parteilichkeit an den Tag gelegt: Als Dekan mit dem Gehaben eines „aktive{n}
Nazi“1386 behauptete er in seinem Gutachten vom Jänner 1936 über Friedrich (Richard)
Schneider (1887-1962)1387, „daß ihm ‚noch so manche Anschauung und Auffassung
des alten Deutschnationalen’ anhafteten. Der alte Deutschnationale“, so mutmaßt
Matthias Steinbach, „– das war in den Augen eines Mannes wie Schachermeyr nicht
nur der um Monarchie und Bismarckreich, um Hindenburg zudem Trauernde, sondern
auch der Anhänger der Naumannschen Idee vom sozialen Kaisertum, der im Jenaer
1383 H. Seier 1964, 108. 1384 H. Seier 1964, 145; vgl. dazu auch M. H. Kater 1981, 50. 1385 E. Nolte 1977, bes. 144-150; vgl. dazu M. Grüttner 2002, 339-353; M. H. Kater 1981, 55;
V. Losemann 1980, 77f.; V. Losemann 1995, 69; B. Näf 1994, 93; S. P. Remy 2007, 42; M.
Steinbach 2001, 222f.; auch E. Maschke 1969, 104f. 1386 W. Behringer 1999, 237. 1387 Hb. dt. Wiss., 1311; Reichshandbuch, 1677f.; M. Steinbach 2003, 943-966.
Professor in Jena (1931-1936) 255
West- und Landgrafenviertel wohnende Bildungsbürger, der den Arm zum Hitlerguß
nur unwillig heben und das Horst-Wessel-Lied nicht singen mochte.“1388 Der
wichtigste Zug am „alten Deutschnationalen“ war freilich wohl der, daß er
Schachermeyr in Gestalt von Lehmann-Haupt sowie der allermeisten
Professorenkollegen in Jena zutiefst gedemütigt hatte. Im übrigen kannte
Schachermeyr nicht nur gegenüber der „Reaktion“, sondern auch gegenüber der
„Rotfront“ keinen Pardon. Schon am 13. Dezember 1934 faßte Schachermeyr als
Dekan der Philosophischen Fakultät den Beschluß, dem bereits 1933 entlassenen1389
Entwicklungsbiologen Julius (Christoph) Schaxel (1887-1943)1390, der zunächst in die
Schweiz ausgewandert und dann 1934 in die Sowjetunion gegangen war, wo ihm an
der Akademie der Wissenschaften ein Posten angeboten worden war, seine am 1. Juli
1909 erworbene Doktor-Würde abzuerkennen, da sich dieser als Marxist „gegen die
biologisch gegründete [sic] nationalsozialistische Weltanschauung“ wandte1391.
1388 M. Steinbach 2003, 948; M. Steinbach 2004, 73. 1389 W. Gerstengarbe 1994, 31. 1390 DBE 8, 1998, 578; D. Fricke 1988, 45-54; J. Hendel u. a. 2007, 37f., 41, 151-157, 193-
195; U. Hoßfeld – O. Breidbach 2007, bes. 1186, 1190; H. Penzlin 1984, 812-814; H. Penzlin
1988, 19-44; R. Stolz 1988, 9-18; H. A. Strauss – W. Röder 1983, 1026. 1391 U. Hoßfeld 2003, 553; vgl. auch J. John 1983, 285, 287f.; H. Penzlin 1988, 39. Nach dem
Krieg wurde Schaxel postum rehabilitiert und der Beschluß am 20.8.1945 aufgehoben (U.
Hoßfeld 2003, 574 Anm. 287; vgl. auch U. Hoßfeld 2007, 1077-1079). Als Linksaktivist hatte
er Vorträge vor sozialistischen Studenten gehalten. „Dort führte er aus: ‚Jedes Wort der
rassistischen Forderung ist faktischer, historischer, soziologischer, biologischer Unsinn. Den
nordischen Menschen gibt es nicht, weder in der Vergangenheit noch als Rezept, wie er
künftig zu machen wäre. Aus keinem geschichtlichen Zusammenhang erhellt, daß eine
‚rassisch’ umschriebene Gruppe für die Größe irgendwelcher Völker irgendwie
verantwortlich wäre. Ebensowenig kann von der Führung einer solchen eingebildeten oder
fälschlich herausgeschälten Gruppe die Rede sein. Schließlich ist die Rasse überhaupt kein
Begriff, mit dem für den Menschen theoretisch und praktisch etwas anzufangen ist’.“
Vielmehr setzte sich Schaxel für die Bildung „der proletarischen Massen“ ein, damit „ihre
Professor in Jena (1931-1936) 256
Angesichts der Tatsache, daß die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, die
für Schaxel fachzuständig gewesen wäre, inzwischen aus der gemeinsamen
Philosophischen herausgelöst worden war1392, wäre es für Schachermeyr sicher ein
leichtes gewesen, sich für nicht zuständig zu erklären, doch mußte ein marxistischer
Antirassist auf ihn damals wohl in jeder Hinsicht wie ein rotes Tuch gewirkt haben1393.
Ebenfalls im Dezember 1934 hatte der Kirchenrat aus dem Preußischen Ministerium
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Eugen Mattiat (1901-1976)1394
Schachermeyr gebeten, ein Gutachten über den Berliner Dozenten Lothar Wickert
(1900-1989)1395 zu verfassen1396, wobei dieses nun wiederum augenscheinlich derart
positiv ausfiel, daß Wickert im Jahr darauf auf den Althistorischen Lehrstuhl im
preußischen Königsberg berufen werden konnte.
unerschöpflichen Möglichkeiten zur Entfaltung kommen können“ (zit. nach H. Penzlin 1988,
38f.). 1392 Vgl. U. Hoßfeld 2003, 574 Anm. 285. 1393 Daß Schachermeyr die internationalistische Linke grundsätzlich und auch noch viel später
verabscheute, scheint seine Äußerung zu zeigen, daß er nach den griechischen
Parlamentswahlen von 1981 nicht mehr nach Griechenland reisen wolle, weil damals die von
der PASOK (= Panhellenische Sozialistische Bewegung / Panellinio Sosialistiko Kinima)
angeführte Linke die Stimmenmehrheit erringen konnte (vgl. Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz
Schachermeyr, Kt. 1, Lebenslauf. Zweiter Nachtrag 1982, fol. 3f.); doch vgl. vielmehr u. S.
623f., 626f. 1394 M. Grüttner 2004, 115; H. Junginger 2008c, 61f.; E. Klee 2003, 395; KGL 1940/41, 2,
140. 1395 K. Christ 2006, 25, 112f.; A. Demandt 1979, 91; A. Demandt 1992, bes. 199; Hb. dt.
Wiss., 1428; H. Kloft 1990, 475-478; V. Losemann 1977, bes. 209 Anm. 30; R. Steimel 1958,
436; W. Weber 1984, 658; E. Wirbelauer 2006, bes. 167 Anm. 161. 1396 A II, E. Mattiat an Schachermeyr, Brief vom 20.12.1934.
Professor in Jena (1931-1936) 257
Als Dekan rekrutierte Schachermeyr Teilnehmer für NS-Dozenten-Lager, so
versuchte er den Archäologen Emil Kunze (1901-1994)1397 zu gewinnen, dessen
Habilitation jedoch zu diesem Zeitpunkt noch im Laufen war und der ihn deshalb auf
den Sommer vertröstete1398. Als Dekan unterzeichnete Schachermeyr die
Habilitationsurkunde1399 des Historikers Ulrich Crämer (1907-1992)1400 und
befürwortete die Erteilung eines Lehrauftrages an diesen ab Sommersemester 1935
gegen den Wunsch der Fakultät1401. Crämer mußte dann 1945 die Universität München
verlassen und fristete seit November 1950 auf Basis von Werkverträgen als
Fachredakteur für Mittlere und Neuere Geschichte bei F. A. Brockhaus in Wiesbaden
sein Leben. Als dieser später in Pension gehen wollte, bat er Schachermeyr um
Bestätigung seiner Dienstzeiten an der Jenenser Universität, damit ihm diese Zeiten für
seine Rente angerechnet werden könnten1402. Ob Schachermeyr dieser Bitte nachkam,
läßt sich nicht entscheiden, es ist weder ein Dankschreiben noch eine
Empfangsbestätigung erhalten. Daß sich Schachermeyr an Crämer erinnern konnte, ist
wohl anzunehmen, denn als „nationalsozialistische[r] Dekan der Philosophischen
Fakultät“ hatte er am 26. Februar 1936 auch noch ein Gutachten des Inhalts gefertigt,
„daß Crämer ‚alter Kämpfer und mit Erfolg für den Neuaufbau eines
nationalsozialistischen Geschichtsbildes tätig’ ist“1403. Auch in einem Bericht zur
Nachbesetzung der Jenenser Professur für Neuere Geschichte war Crämer neben Willy
1397 I. Auerbach 1979, 555; DBE 6, 1997, 173; EEE 5, 1986, 69; Hb. dt. Wiss., 1108; KGL
1940/41, I, 1035; KGL 1996, 1663. 1398 A II, E. Kunze an Schachermeyr, Brief vom 2.12.1935. 1399 Die Urkunde trägt das Datum vom 17. November 1934 (A I, U. Crämer an Schachermeyr,
Brief vom 15.8.1971); vgl. K. Jedlitschka 2006b, 69f. 1400 H. Gottwald 2003, bes. 915f.; K. Jedlitschka 2006a, 299-344; K. Jedlitschka 2006b; W.
Schulze 1989, bes. 316; W. Weber 1984, 95. 1401 K. Jedlitschka 2006b, 70. 1402 A I, U. Crämer an Schachermeyr, Brief vom 15.8.1971. 1403 H. Gottwald 2003, 916, 937 Anm. 17.
Professor in Jena (1931-1936) 258
(Ludwig) Andreas (1884-1967)1404 und Erich Botzenhardt (1901-1956)1405 von
Schachermeyr vorgeschlagen worden1406.
Als Dekan stellte Schachermeyr schließlich in einer Rede anläßlich einer
Preisverleihung im Juni 1935 seine nationalsozialistische Gesinnung außer Zweifel:
„‚An die Stelle der alten Wertungen des Allgemein [sic] Menschlichen und seiner
Untergliederung, des Staates, habe der Nationalsozialismus die neuen Wertmaßstäbe
Rasse und (als deren Untergliederung) Volk gesetzt.’ Als neue Aufgabe der
Philosophischen Fakultät bezeichnete es Schachermeyr, ‚von der Gemeinde des
Nordischen aus die einzelnen Kulturentwicklungen und Kulturbereiche neu zu
beleuchten.’“1407
Dementsprechend sah auch sein Vorlesungsprogramm aus: „Fritz Schachermeyr
erläuterte in zahlreichen Vorlesungen seine Vorstellungen von nordischem Führertum
und der Rassentheorie“1408 bereits in Jena, wo er seit dem Sommersemester 1934 den
folgenden fünfteiligen Vorlesungszyklus1409 abhielt: „Geschichte der nordisch-
indogermanischen Völker im Altertum I: Der alte [sic] Orient mit besonderer
Rücksichtnahme auf Hethiter und Perser“1410, „Geschichte der nordisch-
indogermanischen Völker im Altertum II: Die Zeit der kretisch-mykenischen Kultur
1404 I. Auerbach 1979, 461f.; DBE 1, 1995, 132; D. Drüll 1986, 3f.; G. Franz 1995, 106f.; W.
Hartkopf 1992, 8; Hb. dt. Wiss., 801; J. Lerchenmueller 2001, 42; Reichshandbuch, 26; W.
Schulze 1989, bes. 313; W. Weber 1984, 8f.; E. Wirbelauer – B. Marthaler 2006, 888f. 1405 R. P. Ericksen 1998, bes. 440-449; E. Klee 2003, 67. 1406 H. Gottwald 2003, 916. 1407 Jenaische Zeitung 19.6.1935 zit. nach H. Gottwald 2003, 931; vgl. auch W. Schumann
1958, 641, der zusätzlich „UAJ, Best. BB, Nr. 46 [o. P]“ zitiert (616 Anm. 145). 1408 M. Willing 2000, 248. 1409 Vgl. auch V. Losemann 2001, 738; B. Näf 1994, 94; S. Rebenich 2005, 56. 1410 Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Sommerhalbjahr 1934, 30.
April bis 31. Juli, 49f.
Professor in Jena (1931-1936) 259
und das archaische Griechentum“1411, „Geschichte der nordisch-indogermanischen
Völker im Altertum III: Griechische Geschichte während der Tyrannis und der
Perserkriege“1412, „Geschichte der nordisch-indogermanischen Völker im Altertum IV:
Griechische Geschichte von Perikles bis Alexander“1413, „Geschichte der nordisch-
indogermanischen Völker im Altertum V: Griechische Geschichte seit Alexander“1414.
Schon vorher hatte er ein dem Zeitgeist entsprechendes „Seminar für alte [sic]
Geschichte: Die Schlacht im Teutoburgerwalde“1415 veranstaltet. Im Sommersemester
1936 kündigte er dann noch das „Seminar für Alte Geschichte: Römer und
Karthager“1416 an. Dieses Thema fand später im Aufsatz Karthago in
rassengeschichtlicher Betrachtung1417 seinen Niederschlag. Schachermeyr setzte
dieses Programm dann auch in Heidelberg1418 und Graz1419 fort. Sein Seminar zur
1411 Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1934/35, 22.
Oktober bis 28. Februar, 49. 1412 Thüringische Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Sommerhalbjahr 1935, 1.
April bis 29. Juni, 46. 1413 Thüringische Landesuniversität Jena. Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 1935/36, 1. November bis 22. Februar und Sommersemester 1936, 1. April
bis 30. Juni, 46. 1414 Thüringische Landesuniversität Jena. Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 1935/36, 1. November bis 22. Februar und Sommersemester 1936, 1. April
bis 30. Juni, 74. 1415 375 Jahre Universität Jena 1558-1933. Vorlesungen Winter 1933/34. Thüringische
Landesuniversität Jena. Vorlesungsverzeichnis Winterhalbjahr 1933/34, 16. Oktober bis 28.
Februar, 34. 1416 Thüringische Landesuniversität Jena. Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 1935/36, 1. November bis 22. Februar und Sommersemester 1936, 1. April
bis 30. Juni, 74. 1417 F. Schachermeyr 1943b, 9-43. 1418 Vgl. S. 281f. 1419 Vgl. S. 325f.
Professor in Jena (1931-1936) 260
„Dorischen Wanderung“1420, das „mit einem großartigen Seminarkostümfest
abschloß“1421, besuchte damals auch Gotthold Rhode (1916-1990)1422, der spätere
Mainzer Professor für Osteuropäische Geschichte und Mittlere und Neuere
Geschichte.
Was nun Schachermeyrs damalige Forschungstätigkeit anlangt, so bezeichnete er
„in der wohl anfangs 1935 ausgefüllten Personalakte […] als sein besonderes
Forschungsgebiet die ‘Gesch[ichte] d[es] Altertums mit besonderer Berücksichtigung
der Beziehungen zur Vorgeschichte, zu Rassenkunde u[nd] Kulturpolitik’ […]“. Das
paßte gut zu seiner Angabe „unter der Sparte ‘Politische Betätigung’ […]:
‘Mitbegründer des nat[ional]soz[ialistischen] Kampfringes der Deutschösterreicher im
Reich (zeitweise Gauführer im Gaue Thüringen). Kulturpolitisch im Sinne der
nat[ional]soz[ialistischen] Bewegung durch Vorträge und Veröffentlichungen
tätig.’“1423
1420 Thüringische Landesuniversität Jena. Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 1935/36, 1. November bis 22. Februar und Sommersemester 1936, 1. April
bis 30. Juni, 46. 1421 Archiv der ÖAW, Nachlaß Fritz Schachermeyr, Kt. 3, G. Rhode an Schachermeyr, Brief
vom 8.1.1985. 1422 I. Auerbach 1979, 591; K. Fuchs 1999, 1358-1369; W. Weber 1984, 474f. 1423 B. Näf 1994, 94; vgl. auch UA Heidelberg, PA 5599; UA Jena, Bestand D, Nr. 2474
(unpag.) zit. nach H. Gottwald 2003, 930; V. Losemann 1980, 63. H. A. L. Degener 1935,
1361 nennt als Schachermeyrs Spezialgebiet „Gesch[ichte] d[es] Altert[ums], bes[onders]
dess[en] Frühz[eit]; Kult[ur]- u[nd] Rassentheor[ie]“; auch KGL 1940/41, 2, 549 führt als
Schachermeyrs Forschungsschwerpunkt während seiner nunmehrigen Professur in Graz
„Geschichte der Mittelmeerländer (einschließlich Vorderasien) im Altertum unter
Berücksichtigung von Geschichtsbiologie und geschichtlicher Rassenkunde“ an. In KGL
1931, 2502 und KGL 1935, 1171 fehlt der Zusatz „unter Berücksichtigung von
Geschichtsbiologie und geschichtlicher Rassenkunde“ noch. Vgl. dazu auch V. Losemann
1977, 206 Anm. 4. S. Rebenich 2005, 62 hält fest, daß Schachermeyr „auf dem Fragebogen,
den auszufüllen das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933
Professor in Jena (1931-1936) 261
„Als einer der ersten Althistoriker war er mit besonderem Elan darum bemüht,
Verbindungen zwischen der Alten Geschichte und der nationalsozialistischen
Rasenlehre herzustellen“1424: Schon 1933 erfolgte die Publikation der ersten von
Schachermeyr in eindeutig nationalsozialistischem Geist verfaßten Schriften: Die
nordische Führerpersönlichkeit1425 erschien bereits wenige Wochen nach der
nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Jänner 1933 im Völkischen
Beobachter vom 13. April 1933. Hier schreibt er von den Deutschen „als den
gegenwärtig wohl reinsten Vertretern nordischer Gesinnung und Art unter den
abendländischen Nationen“, die einer „arische[n] Führerpersönlichkeit“ bedürfen. Zu
lesen ist weiters, daß es „der Persönlichkeit Adolf Hitler zu danken ist und der
deutschen Jugend“, daß „dieser Anschlag auf das deutsche Leben“ – gemeint ist die
„autarke Individualisierung und [die] damit verbundene Lösung der Bindung an das
eigene Volkstum“ – „vereitelt wurde“1426. Als eine Art erweiterte und speziell im
Hinblick auf die Alte Geschichte ausgearbeitete Fassung erschien gleich darauf der
Aufsatz Die nordische Führerpersönlichkeit im Altertum. Ein Baustein zur
Weltanschauung des Nationalsozialismus1427, in dem er seine direkte Bezugnahme auf
den Führer Adolf Hitler wiederholt1428. Die Aufgaben der Alten Geschichte im Rahmen
verlangte, […] freiwillig [ergänzte]: ‚Der Name Schachermeyr hat mit ‚schachern’ nichts zu
tun, vielmehr ist ‚Schacher’ das oberösterreichische Dialektwort für ‚kleiner Wald’,
‚Gehölz’’“. Ein feindseliger Laie (J. Haury 1932, 22f.) hatte seinen Namen mit Aplomb aus
dem Hebräischen hergeleitet. 1424 A. Chaniotis – U. Thaler 2006, 403; vgl. J. Wiesehöfer 2008, 213. 1425 F. Schachermeyr 1933k, 2. Beiblatt; s. auch F. Schachermeyr 1933j, 36-43; vgl. dazu F.
Bucherer 1934, 2; K. Christ 1999, 252; V. Losemann 1980, 54f.; B. Näf 1994, 94f. 1426 F. Schachermeyr 1933k, 2. Beiblatt. 1427 F. Schachermeyr 1933j, 36-43. Dazu ausführlich J. Chapoutot 2008a, 323f., 368f., 430,
433; V. Losemann 1980, 55-59; vgl. auch V. Losemann 2001, 730. 1428 F. Schachermeyr 1933j, 41 Anm. 2.
Professor in Jena (1931-1936) 262
der nordischen Weltgeschichte1429 wird noch im selben Jahr in der parteiamtlichen
Zeitschrift des NS-Lehrerbundes, in Vergangenheit und Gegenwart1430, publiziert,
wobei Schachermeyr einen Sonderdruck dieses Aufsatzes dem Hamburger
Althistoriker Erich Gustav Ludwig Ziebarth zukommen ließ, der dann dazu meinte:
„Zuerst bin ich mit Ihnen darin einig, dass [d]ie alte [sic] Geschichte alles tun muss,
um zu zeigen, dass sie die Zeichen der Zeit versteht und dass ihr wichtigstes
Wirkungsfeld, das Gymnasium, von Männern betreut wird, die mit ihrer Zeit zu gehen
entschlossen sind. In den Einzelausführungen bin ich allerdings vielfach durchaus
anderer Ansicht als Sie. So in der Beurteilung eines welthistorischen Führers[,] wie
Alexander d. Gr. doch sicher [einer] gewesen ist[,] und in der Beurteilung des
Hellenismus und überhaupt des späteren Griechentums. Dagegen haben Sie völlig
Recht [sic], dass wir Althistoriker oft die germanische Frühzeit zu flüchtig abgetan
haben.“1431
Auf diese Weise in seinem Tun grundsätzlich ermuntert, schrieb Schachermeyr
dann für die Zeitschrift Der Thüringer Erzieher1432 den schon 1934 erschienenen
Aufsatz Die neue Sinngebung der Weltgeschichte1433. Es geht dabei um die Frage,
1429 F. Schachermeyr 1933i, 589-600; vgl. dazu A. Chaniotis – U. Thaler 2006, 417; J.
Chapoutot 2008, 157, 161; J. Chapoutot 2008a, 146-148, 257, 264, 358, 418f.; K. Christ
1982, 204; K. Christ 1999, 252; H. Kloft 2001, 384 (spricht hier von Schachermeyrs
„Anbiederung bei den neuen Machthabern“); V. Losemann 1980, 56f., 59, 78f.; V. Losemann
2001, 730; B. Näf 1994, 94f.; S. Rebenich 2005, 45f.; M. Sommer 2000, 23. 1430 Vgl. dazu H. Löffler 2001, 236f. 1431 A II, E. Ziebarth an Schachermeyr, Brief vom 13.12.1933. 1432 Diese „Päd[agogische] Halbmonatsschrift des N.S.L.B. Gau Thüringen, Herausgeber:
Regierungsrat [später Staatsrat, Paul] Papenbroock [geb. 1884], Weimar“ erschien bereits seit
Jänner 1933 (Sperlings Zeitschriften- u. Zeitungs-Adreßbuch. Handbuch der deutschen
Presse. 59. Ausg., Leipzig 1935, 11); zu Oberregierungsrat Paul Papenbroock, Gauwalter des
NSLB für Thüringen, s. P. Josting 1997, 149. 1433 F. Schachermeyr 1934h, 97-99; vgl. H.-C. Harten – U. Neirich – M. Schwerendt 2006, 77,
459.
Professor in Jena (1931-1936) 263
welche „sinnerfüllte Auswahl historischer Stoffe“ (dies ist hier offenbar im
wesentlichen unter „Weltgeschichte“ zu verstehen) den „Gegenstand
geschichtsphilosophischer Erwägungen und kompendiöser Geschichtswerke“, aber
auch des „Schulunterrichtes“ bilden soll1434, wobei es nach Schachermeyr „unmöglich
[ist], Weltgeschichte als die Summe der uns bekannten historischen Tatbestände aller
Geschichtskreise aufzufassen; mangeln doch einer so weit ausgreifenden Fassung des
Begriffes die notwendigen Gemeinsamkeiten an Form und Inhalt“; in Sonderheit lehnt
er eine Beschäftigung mit der chinesischen Geschichte ab, vielmehr sei „Europa und
Vorderasien“ der Weltgeschichte „alleiniger Schauplatz, der sich erst seit der Zeit der
Entdeckungen erweitert, soferne die europäischen Völker und Mächte ihre
geschichtliche Wirksamkeit auf fernere Räume ausdehnen“1435. „Die
unglückbringende Berührung mit artfremden Elementen hat uns endlich zur Besinnung
gebracht auf das Wesen unserer eigenen Art, wie es sich allein durch die Erkenntnis
seiner blutmäßigen Bedingtheit erschließt“, und „{n}ur die nordische Rasse kann für
uns den übergeordneten Höchstwert bedeuten, und aus ihr wollen wir den Sinn
gewinnen für die neue Weltgeschichte“; damit „wird klar, was die neue Art der
Weltgeschichte eigentlich will: Sie hat zum Inhalt die Selbstverwirklichung der
nordischen Substanz in der geschichtlichen Erscheinung“1436. Dabei könne man „auch
den neuen Typus ruhig als ,Weltgeschichte‘ bezeichnen“, denn „Sumerier und
Semiten, hamitische Elemente und sich eindrängende Mongolenschwärme bleiben
weiterhin miteingeschlossen. Es ist ja das Schicksal des Nordischen, sich immer
wieder mit dem Fremdrassischen auseinandersetzen zu müssen. […] Wir wollen und
müssen unsere weltgeschichtlichen Gegenspieler so genau wie nur möglich kennen,
denn unsere künftige Selbsterhaltung hängt vielleicht davon ab“1437. Geschichte, so
1434 F. Schachermeyr 1934h, 99. 1435 F. Schachermeyr 1934h, 97. 1436 F. Schachermeyr 1934h, 98; vgl. H.-C. Harten – U. Neirich – M. Schwerendt 2006, 77
(wo übrigens nicht wortgetreu zitiert wird). 1437 F. Schachermeyr 1934h, 98.
Professor in Jena (1931-1936) 264
heißt es zusammenfassend gegen Ende des Aufsatzes, „lehrt uns die Bedeutung des
Blutes für alles menschliche Geschehen und die Pflicht, Blut gegen Blut zu erhalten;
sie lehrt uns die Liebe zum Artverwandten und den Kampf gegen das gefahrbringende
Fremde; sie verkörpert zugleich eine Antithese von unerhörter geschichtlicher
Wucht“1438.
Schachermeyr scheute auch nicht die Mühe, Minister Wilhelm Frick, der schon
am 5. April 1930 den Erlaß Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum1439
gezeichnet hatte und nach dem Weltkrieg als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde,
seine aktuellen Projekte anzukündigen. „Trat Schachermeyr gegenüber dem Minister
mit dem Anspruch auf, eine Grundlegung seines Faches auf der Basis der
nationalsozialistischen Weltanschauung einzuleiten, so nahm er gegenüber den
Kollegen diesen Reformanspruch weitgehend zurück: in einem Schreiben an den
Marburger Althistoriker Fritz Taeger1440 v. 1.12.1933 wies er darauf hin, dass die
beiden angesprochenen Abhandlungen1441 ‘auf Wunsch des Verlages geschrieben
wurden und sich nicht so sehr an die Mitforscher wie auch an die Regierungsstellen
wenden. Es wird Ihnen ja bekannt sein, dass augenblicklich massgebende Strömungen
geneigt sind, die Lehraufgabe der Alten Geschichte im dritten Reich gering zu
schätzen und u. U. daraus auch schwerwiegende Konsequenzen zu ziehen. Hier gilt es,
aufzuklären und entgegenzukommen. Letzteres fällt mir als altem Kämpfer für die
1438 F. Schachermeyr 1934h, 99. 1439 Amtsblatt des Thüringischen Ministeriums für Volksbildung, Weimar 9, 1930, Nr.
6/1930, 22. April 1930, 40f.; Mitteilungen des Kampfbundes für deutsche Kultur, München 2,
1930, Nr. 4/5, April/Mai 1930, 36-38 (mit Kommentar); s. auch M. Lücke 2004, 246f. 1440 (1894-1960); I. Auerbach 1979, 618f.; K. Christ 1977, 544-552; K. Christ 1982, bes. 225-
231; K. Christ 1999, bes. 254-268; K. Christ 2006, bes. 77-82; A. Demandt 1984, 388f.; Hb.
dt. Wiss., 1377; C. Hoffmann 1988, 274; V. Losemann 1977, bes. 209 Anm. 27; B. Näf 1986,
bes. 210-221; W. Weber 1984, 597; E. Wirbelauer – B. Marthaler 2006, 1011f.; U. Wolf
1996, bes. 204-230; Y. Wolf 2003, 219. 1441 Gemeint sind wieder F. Schachermeyr 1933i, 589-600 und F. Schachermeyr 1933j, 36-43.
Professor in Jena (1931-1936) 265
Bewegung ja nicht schwer und deshalb habe ich diese Aufgabe schließlich
übernommen’.“1442 Aus der Formulierung „mir als altem Kämpfer“ geht hervor, daß
Schachermeyr sich damals schon seit langem mit der nationalsozialistischen
Bewegung identifizierte oder dies zumindest hier vorgab, obwohl er zu diesem
Zeitpunkt noch kein Mitglied der NSDAP war. „Parteiintern galt nur das erste Drittel
als Gemeinschaft der privilegierten ‚alten Kämpfer’, während die opportunistische
Mehrheit auf manches Ressentiment traf.“1443 Jedoch dürfte Schachermeyr trotzdem
eine privilegierte Stellung genossen haben1444. Aus einem Antwortschreiben des
Prähistorikers Gero von Merhart geht hervor, daß sich Schachermeyr diesem
gegenüber offenbar in ähnlicher Weise geäußert hatte, da ihm dieser folgendes
mitteilte: „Den letzten Erguss Ihres Briefes habe ich mit großem Interesse gelesen und
mir soll es nur recht sein, wenn die N.S.D.A.P. möglichst viele solche Leute gewinnt,
die vitale Fragen der Wissenschaft mit Verstand beurteilen und auch zu Gehör bringen
können.“1445
Als Schachermeyr anscheinend auch dem späteren Innsbrucker „Anschlußrektor“
Harold Steinacker seine beiden programmatischen Schriften aus dem Jahr 1933
zugesandt hatte, bezeichnete sich dieser in dem schon erwähnten Brief vom 3.
Dezember 1933 (in dem er sich auch als Antisemit zu erkennen gab1446) als „streng
1442 Zit. nach V. Losemann 1977, 47f. bzw. V. Losemann 1980, 56f. Der Brief befindet sich
im Nachlaß von Fritz Taeger im Besitz von Familie Taeger in Marburg/Lahn (V. Losemann
1977, 206 Anm. 10); vgl. auch V. Losemann 1995, 69 und B. Näf 1994, 93. 1443 H.-U. Wehler 2003, 606. 1444 Vgl. dazu auch seinen schnellen Parteibeitritt nach Aufheben der Aufnahmesperre, S.
278-280. 1445 A II, G. v. Merhart an Schachermeyr, Brief vom 20.2.1933. Der überzeugte Katholik
Merhart ging dann übrigens einige Jahre später seiner Marburger Professur verlustig, vgl. u. a.
G. Kossack 1999, 56-76. 1446 S. o. S. 220f.
Professor in Jena (1931-1936) 266
national“, „ohne aber P[artei]G[enosse] [sc. in der NSDAP] zu sein“1447, und
präzisierte seine politischen Ansichten dann sehr offen: „Sie werden ja wohl auch
sonst Nachrichten aus Innsbruck erhalten und im Bilde sein, wie dieses System […]
auf die rechtlich denkende und deutschgesinnte Mehrheit der Bevölkerung wirkt. Sie
läßt sich nicht in dem Glauben erschüttern, dass der Anschluss früher oder später
kommen wird, weil jede andere Lösung Österreich in die wirtschaftliche Verelendung
und in die französische oder italienische Fremdherrschaft führen würde. An dem
Nationalsozialismus in Deutschland sehen wir gewisse Härten des Überganges. Aber
wann gab es eine so unblutige und geordnete Revolution? – Wir sind auch nicht ohne
Kritik gegen gewisse Mängel in der Theorie und in der Praxis des Nat[ional-
]Soz[ialismus]. Aber unser Zutrauen, dass alle diese Mängel überwunden werden,
beruht auf dem Gefühl für die weltanschauliche Grösse des führenden Mannes[.] Wir
freuen uns gerade des Österreichischen in ihm: dass er Politik mit dem Herzen macht
und nicht eine kalte Macht- und Verstandesnatur ist, wie der Romane Mussolini, – und
dass er vom volksdeutschen Gedanken ausgeht, der uns in Ö[sterreich] durch das
Auseinanderfallen von Staat und Volk erlebnismässig längst klar geworden ist,
während die grosse Masse der Reichsdeutschen ihn erst noch begreifen muss.“1448
Damals mag Schachermeyr übrigens auch noch andere Österreicher zu
missionieren versucht haben. Erhalten ist etwa ein Brief seines Du-Freundes Wilhelm
Brandenstein, der evidentermaßen aus der „Systemzeit“ stammt und in dem eine
nationalsozialistische Regierung für Österreich doch als etwas Erstrebenswerteres als
die gegenwärtige austrofaschistische Diktatur angesehen wird, offenbar hatte ihm
Schachermeyr zuvor von den Zuständen in Thüringen ein positives Bild gezeichnet.
Hier heißt es speziell: „Hier ist es trostlos. Die Nationalbibliothek kauft überhaupt
nichts mehr; ja sie bindet nicht einmal mehr die Zeitschriften! Die Regierung verbietet
den Beamten jede Kritik an ihr (bei schwerer Disziplinierung) und hat erklärt, dasz
kein Beamter sich in der NSDAP betätigen darf; es sei dies ‚Treubruch der Regierung
1447 A II, H. Steinacker an Schachermeyr, Brief vom 3.12.1933. 1448 A II, H. Steinacker an Schachermeyr, Brief vom 3.12.1933.
Professor in Jena (1931-1936) 267
gegenüber’[,] und droht mit der Entlassung usw. usw. Die werden es auch noch
billiger geben.“1449 Zu Brandensteins politischer Einstellung schreibt Manfred
Mayrhofer etwas kryptisch: „Der junge adelige Offizier, in der ersten Zeit nach der
Heimkehr noch den Traditionen seines Standes verhaftet, schloß sich bald den bisher
von der Herrschaft Ausgeschlossenen an und glaubte mit ihnen einer gerechteren,
freieren Welt entgegenzugehen“1450, was wohl darauf hinweist, daß Brandenstein ein
„Roter“ war. Möglicherweise wollte ihn Schachermeyr also für die sozialistischen
Aspekte des Nationalsozialismus begeistern, auf die er ja offenbar selbst angesprochen
hatte1451. Nach 1945 war Brandenstein eine Autorität bei der Entnazifizierung und
verhalf seinem Freund Schachermeyr zweifellos wider besseres Wissen, aber der Form
nach vielleicht ganz korrekt, zu einem „Persilschein“1452.
Im übrigen ging Schachermeyr sofort daran, „den programmatischen Ansatz des
Jahres 1933 konsequent“1453 umzusetzen. So ist schon in der ersten Fußnote von Die
nordische Führerpersönlichkeit im Altertum ein „im Entstehen begriffene[s]“1454 Werk
„Grundlegung der nationalsozialistischen Weltanschauung aus dem Geiste der
Historie“ angekündigt, das sich unter diesem oder einem ähnlichen Titel
bibliographisch allerdings nicht nachweisen läßt1455. Zusätzlich bereitete
1449 A II, W. Brandenstein an Schachermeyr, Brief, undatiert. 1450 M. Mayrhofer 1969, 342. 1451 S. o. S. 198f. 1452 S. S. 429-431. 1453 V. Losemann 1980, 80. 1454 F. Schachermeyr 1933j, 36 Anm. 1. 1455 V. Losemann 1980, 80 nimmt an, daß mit diesem nach Schachermeyrs Angaben bereits in
Arbeit befindlichen Werk dessen 1940 erschienene Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte (F.
Schachermeyr 1940a; vgl. dazu sofort im Text und dann S. 297-319) gemeint sei; vgl. dazu
auch F. Bucherer 1934, 2: „Vom Führergedanken handelt Fritz Schachermeyr, der aus
seinem im Entstehen begriffenen Buche ‚Grundlegung der nationalsozialistischen
Weltanschauung aus dem Geist der Historie’ ein Kapitel ‚Die nordische
Führerpersönlichkeit im Altertum’ beigesteuert hat.“ Schachermeyrs
Professor in Jena (1931-1936) 268
Schachermeyr damals eine Schrift über „D[ie] gesch[ichtliche] Send[un]g d[er]
nord[ischen] Rasse“1456 vor, die dann offenbar (gleichfalls) nicht (mehr) gedruckt
wurde.
Demgegenüber ist die von Schachermeyr noch in Jena konzipierte Monographie
Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte sehr wohl – im Jahr 1940 – veröffentlicht
worden. Dieses Werk und die einschlägigen Vorstellungen Schachermeyrs im
allgemeinen werden in den Abschnitten über die Heidelberger und Grazer Zeit noch
ausführlich vorgestellt werden, doch sei hier schon erwähnt, daß Schachermeyr wohl
der konsequenteste Rassist unter den Althistorikern gewesen ist1457. Das meinte etwa
auch sein Gesinnungsgenosse (und Konkurrent) Helmut Berve, der Schachermeyr
bescheinigte, daß er „fast als einziger unter den Althistorikern sich der antiken
Rassengeschichte mit Eifer angenommen hat“1458. Ursula Wolf charakterisiert
Schachermeyr als „dezidiertesten Vertreter rassentheoretischer Ansätze“1459 und
begründet ihre Ansicht so: Seine während des Dritten Reichs publizierten Arbeiten
habe er „rassentheoretisch angelegt, und er hat als einziger auch versucht, seine
Interpretation quellenmäßig – z. B. durch Schädelmessungen – mit wissenschaftlichen
Argumenten zu untermauern. Sein Ziel war es, die Einmaligkeit aller Geschehnisse zu
verbinden mit dem Gedanken gesetzlicher Vorgänge aufgrund organisch-biologischer
Lebensgesetzlichkeit enthält immerhin ein tatsächlich einschlägiges Kapitel über „Die
schöpferische Persönlichkeit“ (F. Schachermeyr 1940a, 63-74). 1456 H. A. L. Degener 1935, 1361. 1457 Vgl. dazu E. Meyer 1950, 245; M. Willing 2000, 248. 1458 Brief von Helmut Berve an Walter-Herwig Schuchhardt vom 14.3.1943, zitiert nach E.
Wirbelauer 2000, 116. 1459 U. Wolf 1996, 188; vgl. bereits E. Meyer 1950, 245, der Schachermeyr als „einst
besonders extreme[n] und überzeugte[n] Vertreter der nationalsozialistischen
Weltanschauung“ bezeichnete.
Professor in Jena (1931-1936) 269
Faktoren.“1460 Tatsächlich empfand Fritz Schachermeyr die „Differentialdiagnose
zwischen westisch-mediterranen und nordischen Schädeln“ als „äußerst wichtige
Frage“1461, wie er später (1940) in seinem Forschungsbericht in der Zeitschrift Klio
schrieb.
Ernst Badian (geb. 1925)1462 faßt Schachermeyrs damalige Absichten
folgendermaßen zusammen: „What he had really made his aim was to become the
founder of a philosophy of the Nazi historiography, to provide a basis for a new kind
of history in the anthropological-biological Rassenkunde, thus providing a theoretical
justification for the pillar of Nazi Weltanschauung“1463.
Opportunismus und Karrierismus waren im übrigen wohl nicht die einzigen
Beweggründe und Antriebe für Schachermeyr, das Amt des Dekans zu übernehmen.
Dieses ermöglichte ihm ja nun gewiß auch, dem von ihm gehaßten professoralen
Establishment1464 manchen Tort anzutun. Außerdem dürfte Schachermeyr wohl sein
ganzes Leben lang größten Wert auf offizielle Auszeichnungen und äußere Ehrungen
gelegt haben. So lesen wir in jenem Kapitel seiner Autobiographie, in dem es um seine
Wiener Professur geht, unter anderem: „Um das Folgende recht zu verstehen, muß
man berücksichtigen, daß ich erst im Alter von siebenundfünfzig Jahren nach Wien
berufen wurde und vorher durch mehr als zwanzig Jahre an drei anderen Universitäten
Ordinarius gewesen war (Jena, Heidelberg und Graz). Die meisten meiner
1460 U. Wolf 1996, 236 Anm. 143; vgl. dazu C. R. Hatscher 2003, 84; F. Schachermeyr 1944a,
5. 1461 F. Schachermeyr 1940b, 134. 1462 Almanach der ÖAW 125, 1975, 61, 168: Der gebürtige Wiener wurde am 13. Mai 1975
von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum korrespondierenden Mitglied im
Ausland gewählt; F. Fellner – D. A. Corradini 2006, 46. 1463 E. Badian 1988, 4f. Über das NS-Wissenschaftsprogramm, das durchaus nicht einheitlich
war, vgl. H. Seier 1984, 149-153, der „mindestens vier Richtungen (bei feinerer
Unterscheidung wesentlich mehr)“ ausmacht. 1464 S. o. S. 196-198.
Professor in Jena (1931-1936) 270
nunmehrigen Wiener Kollegen waren viel jünger als ich und meinen engsten Wiener
Kollegen, Professor Artur Betz1465, hatte ich, als ich in Graz Ordinarius war, noch in
seinen Anfangsstufen kennengelernt, jetzt aber mußte ich ihm als dem Rangälteren den
Vortritt lassen.
So erstaunte ich, als ich im Vorlesungsverzeichnis die Vorlesungen, welche Betz
zur Römischen Geschichte hielt, vor den meinen, dem griechischen Altertum
geltenden, gereiht fand. Doch machte man mich darauf aufmerksam, daß für die
Wiener Universität nur die Wiener Anciennität, also die in Wien geleisteten
Dienstjahre, für die hier geltende Rangordnung zählten. Frühere Professuren wie auch
das Lebensalter würden da nicht berücksichtigt. Das gelte auch für die Wahl zum
Dekan oder zum Rektor.
Von alledem hatte man mir bei meinen Berufungsverhandlungen kein Wort
gesagt. Auf ein weiteres Dekanat war ich aber nach dem von Jena gar nicht
neugierig[,] und Rektor zu werden, entsprach meiner Einstellung überhaupt nicht.
Da ich mir ausrechnen konnte, daß ich auf diese Weise weder zum Dekanat,
geschweige denn zum Rektorat gelangen könnte, ja daß selbst Kollege Betz da vor mir
daran käme, zog ich daraus ganz gelassen die Konsequenzen. Ich besuchte zwar die
Fakultätssitzungen, kümmerte mich aber grundsätzlich um nichts, was nicht mein Fach
[…] oder wenigstens die Altertumswissenschaften anging. Für alles andere, was da zur
Verhandlung stand, und überhaupt für alle Angelegenheiten der Universität hatte ich
weder Auge noch Ohr. Die Sitzungen verbrachte ich grundsätzlich mit Lesen von
Korrekturen.“1466 Aus diesen Äußerungen geht trotz Schachermeyrs gegensätzlichen
1465 Artur Betz (1905-1985); AdR, PA Artur Betz, Präsidentschaftskanzlei Zl. 2400/46, Zl.
7494/48, Zl. 2062/65, Zl. 3877/68; Dekanat der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen
Fakultät, PA Artur Betz; Archiv der ÖAW, PA Artur Betz; E. Bruckmüller 2004, I, 135; F.
Fellner – D. A. Corradini 2006, 56; H. A. Hienz 1995, 139-143; M. Pesditschek 1996, 120-
129; M. Pesditschek 2002, 14f.; R. Teichl 1951, 16; W. Weber 1984, 43; I. Weiler 2002, 96;
E. Wirbelauer 2000, 119. 1466 F. Schachermeyr 1984, 185f.
Professor in Jena (1931-1936) 271
Beteuerungen klar hervor, daß ihm das allgemeine Wohl und Wehe von Fakultät und
Universität eben gerade deshalb völlig gleichgültig war, weil er es an diesen
Einrichtungen nicht mehr zu den Ehrenstellungen von Dekan und Rektor bringen
konnte.
Daß Schachermeyr Dekan in Jena gewesen ist, erfahren wir in seiner
Autobiographie im übrigen nur hier und keineswegs im Abschnitt über die Jenenser
Zeit. Das ist zweifellos eine Konsequenz seiner Bestrebungen, sich in diesem Werk
geradezu als NS-Gegner darzustellen (hätte etwa jemand anders als ein Opponent des
Nationalsozialismus wie folgt über Rudolf Egger schreiben können: „Da aber brach
mit dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft über Rudolf Egger die Katastrophe
herein. Er wäre Nazi gewesen (so behauptet man, ich kann es aber nicht
glauben)“1467?). Ganz zu Recht urteilt also Badian: „Schachermeyr’s autobiography
[…] is almost silent, and in what it does say highly misleading, about this phase of his
life.“1468
Anfang 1936 erhielt Fritz Schachermeyr einen Ruf nach Heidelberg. Seine
Nachfolge in Jena hatte er selbst einzuleiten. „Recht bezeichnend ist der Kommentar,
den der Dekan, also SCHACHERMEYR selbst, zu diesen Vorschlägen gab; danach sollte
die Nennung ERNST MEYERs ‘der wissenschaftlichen Eignung dieses Forschers
Rechnung tragen’, man wollte aber auf seine Berufung weniger Gewicht legen, falls er
1467 F. Schachermeyr 1984, 181. 1468 E. Badian 1988, 3; vgl. dazu auch A. Chaniotis – U. Thaler 2006, 403 Anm. 54; M.
Pesditschek 2007, 67; M. Pesditschek 2010, im Druck; M. Sabrow 2002, 133f. Den Aspekt
der gezielten Täuschung verkennt A. Lippold 1986, 27f., wenn er in seiner Rezension zu
Schachermeyrs Autobiographie feststellt: „Mehr Informationen und Auseinandersetzung mit
Gegenwartsfragen bzw. ideologischen Strömungen hätten wohl viele Leser gewiß erwartet für
die Zeit, in der Sch[achermeyr] als Professor für Alte Geschichte in Jena 1931-1936 (dazu S.
139ff.) und Heidelberg 1936-1940 (dazu S. 153ff.), aber auch in Graz 1941-1945 (dazu S.
163ff.) tätig war. Vielleicht wollte Sch[achermeyr] damit der Versuchung ausweichen,
irgendwo zu frisieren oder zu beschönigen.“ S. auch die Lit. S. 667 Anm. 3470.
Professor in Jena (1931-1936) 272
‘auf seinem Züricher Außenposten nicht von deutscher Seite ersetzt werden’ könnte;
auch im Falle von STAUFFENBERGs1469 wollte man nicht irgendwelchen anderen
Vorhaben von außen- oder innenpolitischer Bedeutung vorgreifen.“1470 Nachdem
„Prof. Ernst Meyer und auch der Privatdozent Dr. Alexander Graf Schenk von
Stauffenberg aus unterschiedlichen Motiven heraus nicht bereit waren, nach Jena zu
kommen“1471, wurde schließlich Hans Schaefer Schachermeyrs Nachfolger in Jena,
dem seinerseits im Jahr 1942 gleich wieder Hermann Bengtson (1909-1989)1472 folgen
sollte1473.
1469 Alexander Schenk Graf von Stauffenberg (1905-1964); K. Christ 1999, 339-342; K.
Christ 2006, 91f.; K. Christ 2008; A. Demandt 1979, bes. 92; A. Demandt 1984, 478f.; A.
Demandt 1992, bes. 201; W. Günther 2002, 104-127; P. Hoffmann 1992, passim; T. Karlauf
2007, passim; KGL 1935, 1186; KGL 1966, 2925; S. Lauffer 1964, 845-847; V. Losemann
1977, bes. 210 Anm. 30; V. Losemann 2007a, 318f.; S. Rebenich 2005, 50; W. Schuller 2005,
219-222; W. Schulze 1989, bes. 327; W. Weber 1984, 507f.; M. Willing 2000, 246. 1470 M. Simon 1990, 60f. 1471 H. Gottwald 2003, 932. 1472 K. Christ 2006, 106-108; K. Christ 2008, 69-71; H. Gottwald 2003, 934f.; V. Losemann
1977, bes. 210 Anm. 35; S. Rebenich 2005, 49f., 63f.; S. Rebenich 2005a, 126-131; J. Seibert
2002, 160-173; M. Simon 1990, 61-64; W. Weber 1984, 38f. 1473 D. Lotze 2007, 1749; K. Strobel 1994, 177.