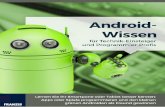Werkzeuge zur Produktion von Metallobjekten und weitere Geräte aus der Trojanischen Sammlung in...
Transcript of Werkzeuge zur Produktion von Metallobjekten und weitere Geräte aus der Trojanischen Sammlung in...
Titelbild: Heinrich und Sophia Schliemann beim Aufbau der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, dem ehema ligen Kunstgewerbemuseum,
im Jahr 1880. Foto: Archiv MYF.
Deutsche Bibliothek - CIP-Einhe itsaufnahme
Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer- Neuvorlage Bd. 2 : Untersuchungen zu den Schatzfunden , den Silber- und Bronzeartefakten, der Gusstechnik, den Gefäßri1arken und den Bleigewichten.
Staatliche Museen zu Berlin - Preußi scher Kulturbesitz Berlin 20 14
Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, N.F. , Bd. 18 ISBN 978-3-88609-757-9
NE: Neuvorlage Schliemanns Trojanischer Altertümer Bd. 2
© Staatliche Museen zu Berlin - Preußi scher Kulturbesitz 2014 Redaktion : Alix Hänselund Heino Neumayer
Satz: stmlmedia GmbH , Köthen Druck: druckhaus köthen GmbH & Co. KG, Köthen
ISBN: 978-3-88609-757-9
MUSEUM FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN- PREUSSISCHER KULTURBESITZ
BERLINER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
NEUEFOLGE BAND 18
herausgegeben von Matthias Wemhoff, Dieter Heliel und Alix Hänsel
STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN- PREUSSISCHER KULTURBESITZ BERLIN 2014
Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer AltertümerNeuvorlage
Bd. 2: Untersuchungen zu den Schatzfunden, den Silber- und Bronzeartefakten, der Gusstechnik, den Gefaßmarken und den Bleigewichten
Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Berlin 2014
Inhalt
Mattbias Wemhoff Votwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Elisabeth Völling Die Silbergefaße aus Schatzfund A in der Berliner Sammlung. Kultgerät im anatolisch-mesopotamischen Kontext . . . . . . . . . . . . II
An De Vos Silbergefaße in altorientalischen Quellen. Ein Einblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hermann Born, Ralf L. Romer und Dieter Rhede Trojanisches Silber in Berlin und St. Petersburg. Archäometrische Untersuchungen zwischen 1996 und 2013 41
Hermann Born, Sylvia Mitschke, Nicole Reifarth und Elisabeth Völling Die organischen Einlagerungen in den Silbergefaßen Sch 5871 , 5872 und 5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Hermann Born, Sandra Schlosser, Roland Schwab, Boaz Paz und Ernst Pernicka Granuliertes Gold aus Troja in der Berliner Schliemann-Sammlung. Teclmologische Untersuchungen eines anatolischen oder mesopotamischen Handwerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Alix Hänsel Die Metallfunde aus den bronzezeitlichen Siedlungsschichten 129
Bianka Nessel Werkzeuge zur Produktion von Metallobjekten und weitere Geräte aus der Trojanischen Sammlung in Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Arsen Bobokhyan Bleigewichte aus den Schichten Troja VIII und IX in der Berliner Schliemann-Sammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
7
Werkzeuge zur Produktion von Metallobjekten und weitere Geräte aus der Trojanischen Sammlung in Berlin
Bianka N es sei
Einführung
Troja ist als Schauplatz des Trojanischen Krieges in die Geschichte eingegangen und gehört zu den wichtigsten und archäologisch am besten erforschten Fundstätten der Türkei. Diese wohl fiir immer mit dem Siedlungshügel in Hisarhk verbundene Interpretation geht auf seinen ersten Ausgräber Heinrich Schliemann zurück. Er fiihrte seine Untersuchungen an der Fundstelle' zwischen 1870 und 1890 durch, und die spektakulärsten Fundstücke der Anlage sind seinen Bemühungen zu verdanken. Dies gilt natürlich besonders ftir die Gold- und Silberartefakte aus dem "Schatz des Priamos", jedoch auch fiir zahlreiche weitere Metallobjekte, die an anderer Stelle dieses Bandes vorgestellt werden 1• Viele der Fundstücke aus Schliemanns und Dörpfelds Grabungen in Troja befinden sich im Museum fiir Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Die Entstehungsgeschichte und das Schicksal der Berliner Trojasammlung wurden bereits mehrfach eingehend dargelegf. Die Bestandteile der Sammlung offenbaren eine ausgeprägte metallurgische Tätigkeit in Troja, welche auf hohem Niveau ab der fhihen Bronzezeit bestand. Kein weiterer Fundort in der Ägäis hat ein vergleichbares Mengenverhältnis an entsprechendem Gerät oder ein ähnliches Formenrepertoire wie die frühbronzezeitlichen Schichten Trojas erbrachrJ. Im Rahmen der Neuvorlage der metallurgisch signifikanten Gerätschaften aus der "Trojanischen Sammlung" Heimich Schliemanns soll in diesem Beitrag daher die Metallurgie Trojas und ihre Bedeutung im Beziehungsgeflecht zwischen der ägäischen, vorderorientalischen und balkanischen Einflusssphäre behandelt werden (Abb . 1). Die Entwicklung metallurgischer Praktiken iimerhalb des Arbeitsgebiets wird im Folgenden einleitend skizziert.
MetaUurgie in Anatolien
Soweit bisher bekatmt, stammen die frühesten Kupferobjekte Anatoliens bereits aus dem ausgehenden 9. Jahrtausend v. Chr. wie zum Beispiel eine Kupferperle aus A~tkh Höyük belegt4
• Sie beweist eine Kupferverarbeitung unter Einsatz gesteuerter Pyrotechnologie schon lange bevor Keramik gebrannt wurde. Objekte ähnlichen Alters sind auch in Siedlungen Nordsyriens, Iraks und Nordirans bekannt. Im Gegensatz dazu konnten bisher jedoch keine Belege ftir neolithische Metallurgie in Südsyrien, der Levante und Jordanien gefunden werden5
•
Im 7. Jahrtausend v. Chr. haben wesentliche Elemente der Pyrotechnologie in Anatolien bereits eine weiträumige Verbreitung. Bezüglich der genutzten Techniken sind zu diesem Zeitpunkt jedoch nur das Glühen und Hämmern von Metall belegt. Beobachtet werden kann dies zum Beispiel an Objekten von <;:ayönü Tepesi in
Vgl. Hänsel in diesem Band. Z. 8. Hennann 2000; zuletzt Saherwala 2008. Kouka 2008, 285. Yalym/Pernicka 1999; Yal9111 2003, 528. 530. Yalym 2003,528.
6 Müller-Karpe 1994, 12. Ebd. Wagner/Pernicka 1982, 53 - 56. Esin 1987.
Südostanatolien. Metallguss im eigentlichen Sitme kommt zwar vereinzelt bereits vor, befindet sich jedoch noch in einem Experimentierstadium und kann nicht als systematisch genutzte Technik ausgewiesen werden6
Die Kupferschlacken des 6. Jahrtausends v. Chr. belegen dagegen die Kenntnis der Verhüttungstechniken von oxydischem und karbonatischem Kupfererz nicht nur als praktizierte, sondern auch gut beherrschte Arbeitsweise . Bleigegenstände aus <;:atal Höyük bezeugen zudem das Metallschmelzen und verwandte Techniken . Gelegentlich werden sie auch bereits mit einer beginnenden Silberverarbeitung in Verbindung gebrachr? . Allerdings können Silbergehalte in Bleilegierungen auch mit einer lagerstättenspezifischen Materialzusammensetzung in Zusammenhang stehen8.
Die mittel und spätchalkolitischen Gussformen, Gusstiegel- und Schlackereste des 5. Jahrtausends v. Chr. in <;:atal Höyük, Malatya-Degirmentepe, Tepes;ik und Tülintepe lassen dann einen völlig neuen Entwicklungsschritt in der Metallurgie erkennen9 Die nun verwendete Arsenbronze kommt sowohl durch natürliche Seimengungen Arsens (bis ca. 1 %) im Kupfer als auch durch bewusst hergestellte Legierungen beider Metalle zu Stande. Erste Artefakte aus Arsenbronze treten in Schicht XVI von Mersin ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. auf. Dort konnten Rollenkopfnadeln, ein Meißel und ein Beil geborgen werden, die zuerst gegossen und danach durch Schmieden endgültig geformt worden waren 10• Sie sind gleichzeitig die momentan ältesten Metallwerkzeuge Anatoliens11
•
Die eigentliche Blüte derartiger Bronzen kann ab dem Ende des 4. bis in die erste Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. konstatiert werden. Arsenbronze bleibt danach vor allem in ländlichen Ansiedlungen noch bis in das 2. Jahrtausend v. Chr. als Legierung in Verwendung 12.
Ab dem Beginn des 4 . Jahrtausends v. Chr. wird auch von einer sicher belegbaren Kupferverhüttung gesprochen. Umfangliehe Surveys haben mehr als 200 Fundstätten mit Hinweisen auf metallurgische Tätigkeiten oder Erzabbau in dieser Periode geliefert 13 • Nun ist eine entwickelte und weit verbreitete Metallurgie in Anatolien zu finden , was durch zahlreiche Erzbrocken, Tiegelreste, Werkzeuge zur Metallbearbeitung und verschiedenartige Gussformen in mehreren Siedlungen belegt ist . Vollständig entwickelte Öfen ftir das Metallschmelzen in Tiegeln sind im ägäischen Bereich auch aus Ansiedlungen auf Kythnos, Naxos, Manika (Euboia) und in der Umgebung von Laurion bekannt 14
•
Gleiches gilt ftir levantinische und ägyptische Fundplätze15•
Metallobjekte finden sich in dieser Zeitspanne besonders häufig in ostanatolischen Siedlungsarealen. Für den westanatolischen Raum sind neben Troja vor allem Fundstücke aus den Ansiedlungen in lltpmar und Beycesultan zu erwähnen 16
• In beiden Fällen handelt es sich um Griffplattendolche mit Nietlöchern17
•
10 Yalym 2003, 531. JJ Yal9111 2008, 101. " Müller-Karpe 1994, 13 ; YalymNalym 2008, I 02. u Begemann u. a. 2003, 146. " Am zallag 2009, 507. Js Craddock 2000, 157 - 162. 16 Yalym 2003, 531. 17 Erkan Fidan 2006, 3- hier auch Zusammenstellung weiterer FB !I-Waffen
mit Abbildung und Literatur.
205
.89
90 •• b 91
Abb. I : Karte aller im Text erwähnten Fundorte: I Qantir- Piramesse; 2 Troja; 3 Ilipinar; 4 Tell Brak; 5 Küllüoba; 6 Beycesultan; 7 Aphrodisias; 8 Kuru9ay; 9 Kish; I 0 Mersin; 11 Göltepe (Kestel); 12 A~ikli Höyük; 13 lkiztepe; 14 Alaca Höyük; 15 Tültepe/ Tepecik; 16 <;:ayönü; 17 <;:atal Höyük; 18 Can Hasan; 19 Manika (Euböa); 20 Laurion; 21 Malatya-Arslantepe: 22 Poliochni; 23 Thermi; 24 A9ana; 25 Cudeyde; 26 Bogazköy; 27 Mahmatlar; 28 Horoztepe; 29 Gedikli; 30 Eskiyapar; 31 Tarsus; 32 Kliltepe/ Karum Kanis; 33 Nor~untepe; 34 Balibagi; 35 Oymaaga9; 36 Li man Tepe; 37 Emporio; 38 Ulucak; 39 Be~iktepe; 40 <;:ukuri9i Höyü k; 41 Alisar; 42 Tell al- Judaidah; 43 Kastri (Syros); 44 Bakla Tepe; 45 Kum Tepe; 46 Demircihöyük; 47 Akrotiri; 48 Aegina; 49 Kum Tepe; 50 Larissa am Hennos; 51 Ajos Antonios; 52 Palmari (Skyros); 53 Asomatos (Rhodos) ; 54 Lemenarea (Thasos); 55 Novoalekseevka; 56 Malaja Ternovka; 57 Ayios Stephanos; 58 Varto- Kayalidere; 59 Nevali <;:ori; 60 Ha9ilar; 61 Raphina; 62 Poros- Katsambas; 63 Kanlige9it; 64 Zincirli; 65 Phaistos; 66 Mallia; 67 Vasiliki ; 68 Chalandriani; 69 Ha9ibekta~; 70 Asketario; 71 Mogilica bei Smoljan; 72 Uzhorod; 73 Pfaffenburg; 74 Koumasa; 75 Phylakopi; 76 Tav$an Ada~i; 77 Bözliylik; 78 Göksuncuk Köyli ; 79 Mykene; 80 Ur; 81 Sippar; 82 Milet; 83 Enkomi; 84 Eleusis ; 85 Ugarit; 86 Tepe Gawra; 87 Tell Chagar Bazar; 88 Geoytepe; 89 Baba Dervi~; 90 Karnut; 91 Jrahovit; 92 KJlirbat Hamra lfdan ; 93 Tiri~ Höyük; 94 Ak9adag; 95 VezirkoprliGölköy; 96 Tilkitepe; 97 Nicosia; 98 Palaikastro; 99 Kap Gelidonya; I 00 Kalinkova; I 0 I Bakir9ay; I 02 Gaziantepe; I 03 Tufalau. Nicht kartiert: Ongartschin; Tell Abraq. Grafik: B. Nessel.
Wie in nahezu allen Siedlungen des Vorderen Orients wurde im 4. Jahrtausend v. Chr. in Anatolien ebenfalls noch innerhalb der Siedlungen verhüttet18
• Bemerkenswert ist eine besonders gegen Ende dieses Zeitraums zu verzeichnende Verhüttung kompliziertester Kupfererze, was große Unterschiede in der Qualität der Fertigprodukte mit sich bringt. Neben Kupfer und Zinn treten nun auch andere Metalle wie Silber, Blei und Gold in nennenswertem Umfang in der Metallverarbeitung auf. Gleichzeitig ist ein großräumiger Handel mit den benötigten Rohmaterialien und Produkten zwischen der Ägäis, Mesopotamien, der Levante und dem Kaukasus feststellbar19 Sowohl im 5. als auch im 4. Jahrtausend v. Chr. bleibt das anatolische Typenspektrum trotz der ersten Blüte extraktiver Metallurgie eher schlicht. Das Artefaktspektrum ist durch einfache Gegenstände wie Ahle, Pfr·ieme, Nadeln oder Beile geprägt. Zimmermann fiihtt diese geringe Va-
18 Ebd. I9 Yal<;:m 2003, 531. 20 Zimmermann 20 11 ,298.
206
rianz vor allem auf eingeschränkte Überlieferungsmöglichkeiten von Siedlungsinventaren zurück20
, was allerdings zu diskutieren bliebe, wenn man bedenkt, dass in der Initialphase der Eisennutzung in Anatolien ein ähnlich begrenztes Typenspektrum festzustellen ist. Lediglich die Prestigeobjekte entziehen sich dem angegebenen Muster. So sind aus Schicht VI A BI von Malatya-Arslantepe (3400-2900 v. Clu-.) mit Silberstreifen verzierte Schwerter21 oder von Tülintepe ein Depot mit verzinnten Lanzenspitzen und einem ebensolchen Schwert belegt22
.
Das 3. Jahrtausend v. Chr. ist durch eine fast industrielle Verhüttung von Erzen geprägt, die in großen Bergwerken gewonnen wurden23 In Anatolien lassen sich nun fast alle metallurgischen Verfalu-en nachweisen. Wie Funde aus Troja I, Poliochni und Thermi I-IV belegen, sind Zinnbronzen ab dem Ende des
21 Palmieri 1981 ; Frangipane et. al. 2002; Hauptmann et. al. 2003. 22 Yal<;:m2008, 113 . 23 Strahm 1994.
4. Jahrtausends v. Chr. bzw. Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr. vorhanden24 Zitmbronze ist von Mesopotamien über Zentralanatolien bis nach Troja verbreitet, auch wenn große Teile des vorderorientalischen Raumes und Anatoliens parallel dazu weiterhin Arsenbronze verwenden25
. Die Troas bildet diesbezüglich eine Ausnahme, da ein Viertel bis etwa die Hälfte aller gefundenen Bronzen bereits aus Kupfer-Zinn-Legierungen bestehen26
•
Als frühe Beispiele für Zinnbronzen können der aus sechs plastischen Figuren bestehende Depotfund von Cudeyde, oder ein Meißel aus Ikiztepe erwähnt werden. Die Fundstücke bilden gleichzeitig auch die ältesten Belege flir den Guss in verlorener Form. Gussformen, die ein solches Verfahren nachweisen und in größerer Anzahl überliefeti sind, stammen in diesem Zeithorizont im Wesentlichen aus der zweiten Schicht Trojas, aus Alaca Höyük, Mahmatlar und Horoztepe. Die Gusstechniken werden nun nahezu in Perfektion beherrscht, Verbindungstech- ' niken wie Nieten, Löten oder Falzen sind vielfach nachweisbar und weit verbreitet. Am Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. können außerdem erstmals Reparaturen durch Überfangguss zum Beispiel an einer Nadel aus Gedikli nachgewiesen werden . Neben den Gusstechniken werden mechanische Verfahren wie die Schneidenhärtung durch Kaltschmieden oder die Toreutik schnell perfektioniert. Zur Dekoration metallener Oberflächen kommen vor allem im Goldscluniedehandwerk zahlreiche Techniken wie Repousse, Filigran, Granulation, Gravur und Ajourarbeiten zur Anwendung27
• Manche Fetiigungsteclmiken sind dabei nur in bestimmten Regionen belegt: Objekte, die Filigran und Granulation aufweisen, werden beispielsweise in Troja sehr geschätzt, fehlen jedoch völlig in Alaca Höyük. Dort wiederum werden verschiedene Metalle wie Kupfer, Gold, Silber und Eisen beim Dekor von Objekten kombiniert, was auf verschiedene Werkstätten bzw. Traditionen zurückgeführt wird, die unterschiedliche Fertigungstechniken vermitteln und/oder lokalen Vorlieben Rechnung trugen28
Bereits in der ersten Schicht Trojas lassen sich Vergoldungen (Plattierungen) und Tauschierungen an figürlichen Metallprodukten nachweisen29 Als ein besonderer Beleg für die hochstehende Metallurgie dieser Periode kann eine Stierfigur aus Horoztepe gewertet werden, auf deren bronzener Oberfläche Arsen durch die Technik des Eindiffimdierens aufgebracht wurde30. Außerdem dokumentieren die Gräber von Alaca Höyük, das Depot von Eskiyapar oder die geplünderten Gräberfelder mit reichen Metallbeigaben von Baltbagt und Oymaaga<;:-Göller den hohen Stand der frühbronzezeitlichen Metallurgie Anatoliens. Vom Oymaaga<;: Höyük stammen drei frühbronzezeitliche Bronzewaffen, darunter ein Dolch und eine Speerspitze. Ersterer ist in Westanatolien, u. a. in Troja Il, letzter in Zentralanatolien gut nachgewiesen. Dazu gesellt sich ein 7 cm langer, bronzener MeißeP 1• Die auffallenden Ähnlichkeiten zwischen Objekten dieser Fundplätze und Troja oder Poliochni belegen einen ausgeprägten Überlandhandel zwischen Zentralanatolien und Troja32 .
Wie auch die weiter östlich gelegenen Einzugsgebiete von Euphrat und Tigris steht Troja zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss der expandierenden mesopotamischen Stadtstaaten,
24 Wilde 2003, 80. 25 Yal9111 2003 , 533 . Zu Zinnhandel in Ägäis und Anatolien zusammenfassend
mit Literatur: Ramstorf2006, 83-85. 26 Eaton/McKerrell 1976, 170. " Müller-Karpe 1994, 13. 28 Zimmermann 2011 , 308. 29 Schliemann 1881 , 285; Müller-Karpe 1994, 13. 30 Smith 1973 . " Czichon et. al. 2006,5. 32 Me l1ink 1992, 173. 33 Zimmermann 2011 , 299.
weshalb es kulturell eher Obermesopotamien zuzurechnen ist33•
Dies geht einher mit einem beispiellosen Reichtum an vollendet ausgeführten Verziemngs- und Legierungsteclmiken sowie der scheinbar mühelosen Beherrschung sehr komplexer Gussverfahren . Am Ende des 3. Jahrtausends herrscht in Kleinasien ein Metallreichtum vor, der eine bis dahin nicht bekannte Bandbreite verschiedener Rohstoffe berücksichtigt34• In dieser zweiten Blüte der Metallverarbeitung sind erste Versuche der Gewinnung und Verarbeitung von geschmiedetem Eisen feststellbar35 . Der älteste Eisenfund Anatoliens datieti bereits ins frühe 3. Jahrtausend v. Chr. und stammt aus einem Grabfimd von Gedikli36
.
Es handelt sich um einen tordierten Armring. Eisen war bis ins frühe 2. Jahrtausend v. Chr. überaus kostbar und relativ streng an HerrschetUtensilien gebunden. Der früheste Eisengegenstand von Troja, ein Keulenkopf, ist jedoch bereits Schicht II zuzuordnen37
•
Weitere Eisenobjekte der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. stammen aus Alaca Höyük und Tarsus38
. Erst ab dem 13. Jahrhundeti v. Chr. vollzieht sich der Wandel in der Verwendung des Eisens vom Luxusmaterial zum Nutzmetall , wobei Waffen und Geräte nun überwiegend aus diesem Material hergestellt werden. Bisher sind in Anatolien keinerlei ältere Verhüttungs- oder Verarbeitungsplätze für Eisen nachgewiesen worden39. Nach der Jahtiausendwende löst das Eisen die Bronze dann endgültig als Werkstoff für Gebrauchsgegenstände ab. Sie wird jedoch weiterhin für die Herstellung von Prestige- und Schmuckgütern genutzt40
•
Metallverarbeitung in Troja
Wie erwähnt ist Troja einer der wichtigsten Fundplätze ft1r die Kenntnis der frühen Metallurgie Anatoliens, da keine andere Fundstelle bislang so viele metallurgische Gerätschaften erbracht hat. Bereits Schliematm nannte etvva 90 aufgefundene Gussformen, soviel wie bei keiner anderen damals bekannten Fundstätte der Region41
. In vielen Fällen fehlt jedoch ein stratigraphischer Bezug der Objekte. Zusätzlich fiel die Meluheit der metallhandwerklichen Utensilien der Trojanischen Sammlung des Museums flir Vor- und Frühgeschichte in Berlin den verehrenden Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zum Opfer, was vielfach auch auf die zugehörige Dokumentation übertragen werden muss. Eine zeitliche oder räumlich exakte Lokalisierung der Fundstücke innerhalb der Ansiedlung ist daher oft nicht möglich. Zwei Drittel der durch Schmidt um 1900 katalogisierten Funde sind den Perioden II-V zugewiesen und datieren demnach ins 3. und frühe 2. Jalutausend v. Clu.<2
.
Die hier zu betrachtenden Gussformen, Gusstiegel, Blasrohrdüsen und Steingeräte streuen also über die gesamte Bronzezeit und kommen ab der ersten Blüte der Metallverarbeitung Trojas vor. Diese fallt in eine Zeit, in der sich in Anatolien bereits ein industriell geprägter und zentral organisierter Abbau von Erzen und eine ausgesprochene Vielfalt an Verarbeitungsteclmiken beobachten lassen. Das Erz wird bei der Lagerstätte verhüttet, jedoch inner-
" Ebd. 305. 35 Muhly 1973, 56. 36 Müller-Karpe 1994, 13; Fundortbezeichnung bei Ya1yll1 1998, 81.83: Ti1men
Höyük. J7 Yal9in 1998, 83. JS Ebd. 39 Ebd. 93 f. 40 Mül1er-Karpe 1994, 13. " Sch 1i emann 188 1, 482. 539. " Müller-Karpe 1994, 43.
207
21 •
13
52
66 .68 • 62 .. 67
39 69 ·.~ 70
Abb. 2: Nachgewiesene Metallwerkstätten in Siedlungen des 3. Jahrtausends v. Chr.: 5 Godin Tepeffakt-e Soleyman (Thornton 2009, 309); 6 Geoytepe (Thornton 2009, 309); 8 Göltepe (Yener!Vandiver 1993; Yener 2000); 9 Nor~untepe ( Mliller-Karpe 1994); I 0 Malatya-Arslantepe (Palmieri et. al. 1993); II Cudeyde ( Goldman 1956); 12 Tlilintepeffepec ik ( Goldman 1956); 13 Gozlli Kuleffarsus (Goldman 1956); 14 Deginnentepe (Esin 1988); 15 Troja (Schliemann 1881); 16 <;ukuris;i Höyük (Horejs u.a. 2010); 17 Liman Tepe (Keskin 20 11, 146); 18 Bakla Tepe (Keskin 2011 , 147); 19 Milet (Keskin 2011 , 147); 20 Baglararas t/<;e~me (Keskin 2011 , 147), 21 Kültepe/Karum Kanis (Schachner 2002, 128); 22 Chalandriani (Muhly 1974); 23 Chrysokamino (Hansen Streily 2000, 76; Chrysokamino 2006); 24 Kastri (Syros) (Shelmerdine 2008, 56; Stampolidis/Sotirakopoulou 2011); 25 Kephala (Keos) (Mcgeehan-Liritzis 1983, 164); 26 Ägina Kolonna (Hansen Streily 2000, 76); 27 Koropi (Maran 1998, 265); 28 Lerna (Mcgeehan-Liritzis 1983, 164); 29 Nichoria (Mcgeehan-Liritzis 1983, 164); 30 Pevkakia (Maran 1992, 389); 31 Poliochni (Doonan u. a. 2007); 32 Paros-Katsambas (Doonan u. a. 2007); 33 Phylakopi (Renfrew 1967, 12); 34 Raphina (Kouka 2008); 35 Thermi (Kouka 2008); 36 Sesklo (Mcgeehan-Liritzis 1983, 164); 37 Saratse (McgeehanLiritzis 1983, 164); 38 Sideri (Kythnos) (Craddock 2000, 160- 161 ); 39 Jrahovit (BobokJ1yan 2010, 183); 40 Khirbet Hamra lfdan (Levy 2002); 41 Meggido (Genz 2000); 42 Tell Malhatta (Genz 2000); 43 Arad (Genz 2000); 44 Numeira (Genz 2000); 45 Camel (Genz 2000); 46 Ashkelon-Afridar (Genz 2000); 47 Tel Erani (Genz 2000); 48 Meser (Genz 2000); 49 Lod (Genz 2000); 50 Yiftahel (Genz 2000); 51 Tell esh-Shuna-North (Genz 2000); 52 Wadi Fidan (Genz 2000); 53 Wadi Feinain (Craddock 2000, !58); 54 Barqa - ei-Hetiye (Genz 2000); 55 Timna (Craddock 2000, !59); 56 Aqaba-Hujarat al Ghuzlan (Genz 2000); 57 Wadi Um Balad (Craddock 2000, !59); 58 Wadi Dara (Craddock 2000, !59); 59 Nahal Besor (Genz 2000); 60 Tell es-Sweyhat (Yener/ Vandiver 1993, 237); 61 Karaköpektepe (Courcier 2007); 63 Baba Dervi~ (Courcier 2007; 65 Amiranis Gora (Küshnareva 1997, 56.197); 66 Gudabertka (Kushnareva 1997, 61); 67 Brdadzori (Courcier 2007); 68 KvatskJ1elebi (Courcier 2007); 69 Garni (Courcier 2007); 70 Shungavit (Courcier 2007); 71 Kul ' tepe ll (Courcier 2007); 72 Galgalati (Kushnareva 1997, 61 ); 73 Kortepe (Courcier 2007). Nicht kartiert: Pülür (Kushnareva 1997, 57); Tepe Hissar (Pigott u. a. 1982); Tepe Sialk (Thornton 2009,309); Tepe Yahya (Thornton 2009, 309); Shar-i SokJlta (Heskel 1982; Thornton 2009, 309); Shadad (Pigott 1989; ders. 1999); Mi~an;ai (Courcier 2007); Cerkertepe (Schachner 2002, 128); Gudabe (Courcier 2007); Maysar (Oman) (Weisgerber 1981 ). Grafik. B. Nessel.
halb der Siedlungen verarbeitet43 (Abb. 244), was eine gut ver
ankerte Spezialisierung und strukturierte Arbeitsteilung innerhalb der frühbronzezeitlichen Gesellschaft Trojas belegt. Eine Kartierung der bisher untersuchten Werkstattbefunde in Siedlungen des 3. Jahrtausends v. Chr. im ostmediterranen Raum, die mindestens eine Kombination von Werkzeugen bzw. Schlacken und Hinweisen auf Ofeninstallationen aufweisen, zeigt jedoch in erster Linie
43 Yalym 2003 , 529. " Die Karte ist als Entwurf zu betrachten, da nur tatsächlich publiziertes Ma
terial berücksichtigt wurde. Bei vielen bisher vorgelegten Siedlungen mit nachgewiesenen metallurgischen Aktivitäten im Chalkolithikum ist jedoch
208
den momentanen Forschungsstand und nicht die tatsächlichen Gegebenheiten. Zukünftig werden sich hier hoffentlich die großen Lücken im inneranatolischen Raum schließen lassen. Vor allem ein Zusammenhang zw ischen Werkstätten in Siedlungen und den verschiedenartigen potentiell bereits in der Prähistorie ausgebeuteten Lagerstätten kann erst zukünftig hergestellt werden, da die Datengrundlage bislang noch nicht ausreichend ist.
prinzipie ll auch von einer Kontinuität des Metallhandwerks in der Frühbronzezeit auszugehen . Entsprechende Vorlagen der Funde und Befunde stehen ftir das 3. Jahrtausend v. Chr. jedoch vielfach noch aus. Mesopotamien und Ägypten wurden nicht berücksichtigt.
Beispiele für Befunde von Metallwerkstätten sind im ägäischen Raum mehrfach bekmmt. In lnsula l und ll von Poliochni azzurro und südöstlich der Befestigungsmauer, in Raum 1119 der Phase Poliochni verde, sowie in den Räumen 424, 502- 504, 609, Gebäude lA der Phase Poliochni giallo und in den Häusern 605 und 832 von Poliochni azzurro bis giallo ist die Verarbeitung von Metall nachgewiesen45
• Für die letztgenannte Phase wird sogar von einer Spezialisierung der Produzierenden auf die Herstellung von Sclunucknadeln und Werkzeug ausgegangen. Überdies ist in Thermi I- IV ein "Metallhandwerkerviertel" mit mehreren eindeutigen Befimden identifiziert worden, und auch Haus VII von Emporio IV weist entsprechende Hinterlassenschaften aufl6
. In Li man Tepe sind sogar in fünf verschiedenen Bereichen der Siedlung Hinweise auf Metallverarbeitung ergraben worden47
. In Nor~untepe, Arslantepe, Cudeyde und Tepes;ik befanden sich die Werkstätten des 3. Jahrtausends v. Clu. in den Randbereichen der Siedlungen (Abb. 3). In Troja lagen die Werkstätten innerhalb der seit dem Frühstadium der Siedlung bestehenden Befestigungen auf dem Hügel48
. Eine Gussform dieser Zeitstellung, welche sich innerhalb der Ringmauern am Rand befimden hat, wird als Indiz für dortige Metallverarbeitung gesehen. Die Existenz separat operierender Köhlereien, welche den hohen Bedarf an Holzkohle als Reduktionsmittel bei der Metallverarbeitung decken konnten, ist wahrscheinlich und kann nicht zuletzt anband etlmographischer Beispiele aus der Troas im Analogieschluss angenommen werden49
Troja I Da die meisten der zu behandelnden Werkzeuge der Trojanischen Sammlung nur einer ungefahren Schichtenzuordnung durch Schmidt unterliegen , empfiehlt es sich zunächst, einige generelle Charakteristika der Stadt und iluer Metallurgie in den einzelnen Schichten der Ansiedlung aufzuzeigen. Dabei sollen jedoch nur die Maritime Troja Kultur (Schichten IIII) , dieAnatolische Troja Kultur (Schichten IV- V) und die Trojanische Troja Kultur (Schicht VI-VIII) nach Korfmmm Berücksichtigung finden , da aus jüngeren Schichten keine metallurgisch signifikanten Geräte in der Sanunlung vorliegen . Die Stadt ist im Norden von steil abfallendem Uferhügelland und Sandbuchten umgeben . In westlicher Richtung schließt sich hügeliges Gelände und im Osten vulkanisches Bergland an. Die im Süden liegenden Kalkbergplateaus erreichen Höhen bis zu 300 m, während sich entlang der Flüsse Karamenderes und Dlilmek alluviale Ebenen ziehen50 Zumindest im mittleren und späten Absclmitt der ersten Schicht (2920-2480 v. Chr.) bestand Troja aus einer befestigten Stadt mit Häusern des Megaron-Typs in der Innenbebauung. Für die frühen Phasen der ersten Schicht ist die Bebauung jedoch noch inm1er nicht ausreichend untersucht51
• Handelsbeziehungen, Jagd und Fi schfang sind belegt und bildeten die wesentlichen Pfeiler der gesellschaftlichen Organisation'' · In der Siedlung wurde vorwiegend arsenisches Kupfer verarbeitet53
. Die Kupfer-ArsenTechnologie ist für Anatolien und angrenzende Gebiete in der ersten Häfte des 3. Jahrtausends v. Chr. typisch und kann an Objekten zahlreicher Siedlungen wie z. B. Malatya-Arslantepe, Be~ik-Tepe, Poliochni , Thermi oder <;ucuris;i Höyük belegt werden54
.
45 Kouka 2002, 62 .,75 ff. 46 Ebd. 288; Horej s u. a. 20 I 0, 24 . 47 Kaptan 2008. 48 Müller-Karpe 1994, 43 . 49 Blum 2005. 50 Weber 2003, II. 51 lvanova 2008, 322. 52 Weber 2003 , 8. 53 Wilde 2003, 8 1. 54 Gale et.al. 1985; Yal9in 2000; Schachner 2002, 124; Hauptmann et.al. 2003,
51; Begemann et. al. 2003 , 178; Horej s 20 I 0, 22. 55 Yakar 1984, 74 .
Objekte aus Legierungen von Kupfer und Ziim werden in einteiligen offenen und mehrteiligen geschlossenen Gussformen gegossen. Neben der Kupfer- und Bronzeverarbeitung wird jedoch auch die Technik, Gold zu raffinieren und zu legieren, sowie das Vergolden von Metallobjekten durch die Metallurgen beherrscht55
.
Neben Schmuckstücken aus Edelmetall werden auch metallene Gebrauchsgegenstände hergestellt56
• Die wenigen sicheren Belege für anatolische Bronzeobjekte des 4. und der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Clu. stammen aus Troja I, Thermi I, Ali~ar I, Cudeyde, Ikiztepe57 , Tell al-Judaidah und Tülintepe58
. Dabei bilden die Funde aus Ali~ar I, Troia I oder Cudeyde im gesamten Vorderen Orient die fhihesten Belege, wobei die Zeitstellung von Ali~ar I und Troia I möglicherweise mit der Stufe Ftiihbronzezeit II Ostanatoliens zu korrelieren ist59
.
In der Trojanischen Sammlung sind keine Gegenstände zur Metallurgie dieser frühen Periode enthalten. Aus den Nachgrabungen Blegens stammt jedoch eine Gussform aus Ton für eine Lanzenspitze vom Rand des Schliemannschen Nord-Süd-Grabens (Abb. 4)60 . Reste von Werkplatzstrukturen oder andere Befimde sind im unmittelbaren Umfeld der Gussform jedoch nicht zum Vorschein gekommen.
Troja II In der zweiten Schicht (255061 - 2480 v. Clu·.) ist die Ansiedlung vor allem durch einen Charakter geprägt, der dem eines Fürsten- oder Königssitzes ähnelt. Technische Innovationen wie die Nutzung der Töpferscheibe und große Kunstfertigkeit bei der Umsetzung metallurgischer Techniken sind nun durch zahlreiche Artefakte belegt. Alle Grundelemente der Metallverarbeitung wie Verwendung und Verhüttung sulfidischen Kupfers, multiple Treibtechniken, Metallguss in einteiligen und mehrteiligen Formen oder das Wachsauschmelzverfahren sowie die Techniken der Tauschierung, Granulation und Repousee sind nicht nur bekannt, sondern werden auch vorzüglich beherrscht62
.
Schicht I! ist bezüglich der Gewinnung von Erkenntnissen zur Metallurgie die bedeutendste Phase, da neben der Serienproduktion einfacher Gegenstände nun auch erstmals die Herstellung von Luxuswaren in größerem Umfang zu erkennen ist. Fast alle bekannten "Schatzfimde" Trojas datieren in diese Zeit. Sie bestehen nahezu vollständig aus Unikaten. Neben Bronze- und Zinnobjekten sind auch solche aus Gold, Silber und Elektrum63
vertreten . Einige der verwendeten Techniken wie Filigran, Granulation, Gravur oder die Vergoldung treten in Troja II und in Mesopotamien relativ zeitgleich und in gleicher Intensität in Erscheinung64. Müller-Karpe geht daher von einem spezialisierten Kunsthandwerk aus, da "Ein Handwerker der damit beschäftigt WC/1; 12271 Ringe und 4066 Plättchen aus Gold zu erstellen, wie sie alleine fiir eines der Diademe des " Priamosschatzes" benötigt wurden, der zu Löten verstand und Filigranarbeiten auszufiihren wusste [ . . . ], sicherlich nicht auch bei der Deckung des Bedcu.ß· an einfach gegossenen Bronzewaffen und -geräten mitgewirkt haben [wird]"65 . Gestützt wird diese Vermutung u. a. durch die Analyse der Fertigungstechniken einzelner Schmuckgattungen, wie zum Beispiel der goldenen Körbchenohrringe. Bisher wurden
56 Ebd. 57 Yal9m 2003, 533 . " Yal9m 2009, 129. 59 Mellink 1956, 39-45; Mellink 1992, 173. 60 Müller-Karpe 1994, 43 Taf. 40,5. ' ' Nach den aktuellen "C-Daten muss Schicht II von Troja etwa um 2500 v. Chr.
begonnen haben (Ramstorf 2006, 149). '' Müller-Karpe 1994,44; Wilde2003 , 13 1; Berger 20 12,29. 63 Wilde 2003, 8 1. " Efe/Fidan 2006 , 26. 65 Müller-Karpe 1994, 44.
209
:------------~--:-~-
: ~ © ''•'"'"'" ., ··.\ I \ ! ,' a . ~q.
\ . \
c;ukuri9i Höyük
Phase 111
Phase IV
Ofcn20f ~ .~ 1 •
( .,, \.J
I '. : ~ I
,, 1'1
r ( . ') '-.)t:....
l tl "I: "
I' 1.•
\ 1:1; I
E§ren1
\_ I~ 1il 1~'1 -
Plan: M. Börner/A. Buhlke/8. Horejs 2009
a
c
l..' ') ' ) ') I .,,
+Ofen 18
Olen10 + --:::.)Ofen 4
'' ''
' ~~ I
1 II'
, .• OfenS
\::) I 11; '-... ·· I
1 I I ,:-. ·,~Qfen 6 1 IC Olen24':-.-:·
(f ' ' Oien 23+ + +
pren 8 ' Oien 22 Ofen 21
' l~~en 9 I' ((\fren 3
\ > -=----
I' 1'1
Ofen 2
J)
_j STEINH AMMER GUSSFORMEN SCHMELZTIEGEL O=KER.~M IK I
I Oien 17
.Jorcn 11 I
Ofen 6
+ Of~n 12
•orenJ3
Oie: 141
Ofen 15 I
b
d
e
Abb. 3: Beispiele fiir Werkstättenbefunde in Anatolien a) Gözlu Kule/Tarsus; b) Malatya-Arslantepe; c) Nor~untepe; d) Troja; e) <;:ucuriyi Höyük; a-d nach Müller-Karpe 1994, Abb. 13, 20, 23 , 25 ; e nach Horejs u. a. 20 l 0, Abb. 2.
210
Abb. 4: Troja I mit Fundort der Gussform. Verändert nach Müller-Karpe 1994, 44 Abb. 24.
als mögliche Verbindungstechniken der Golddrähte Löten, Schmelzen oder Kupfer-Diffi.Jsion vorgeschlagen. Neuere Untersuchungen konnten nun belegen, dass es sich aufgrund erhöhter Kupferwerte an charakteristischen Ste llen der Schmuckstücke tatsächlich um eine Verbindung durch Kupfer-Diffusion handelt66
.
Ohrringe mit entsprechender Herstellungstechnik sind jedoch in erster Linie in der Troas und auf der nahe gelegenen Insel Lemnos zu finden . Im Vergleich zu den deutlich weiter verbreiteten übrigen hoch entwickelten Goldschmiedetechniken handelt es sich also um ein speziell in der Troas genutztes Herstellungsverfalu·en, welches eine dort zu lokalisierende größere Werkstatt oder einen Handwerkskreis nahe legt67
. Vor der Stufe Frühbronzezeit li lassen sich keinerlei Belege fiir die Entwicklung solcher Techniken in Troja finden. Deshalb wird zumindest te ilweise vom Wirken kundiger Spezialisten ausgegangen68
Objekte aus arsenischem und relativ reinem Kupfer, welche weiterhin vorkommen, lassen eine lokale Erznutzung von Kythnos und Laurion vermuten69
; die chemischen Signaturen der Zinnbronzen weisen dagegen in eine andere Richtung. Frühe Zinnbronzen aus Troja zeigen bezüglich ihrer Blei-Isothopie ähnliche Signaturen, wi e sie auch bei zeitgleichen Fundstücken in Kastri
66 Betancourt 2006, 93 f. 67 Ebd. 68 Zimmermann 20 II , 306. 69 Wilde 2003 , 8 1. 70 Ebd. 80.
(Syros) und auf den Kykladen belegt sind, was durchaus auf eine Herkunft des Kupfers aus derselben Lagerstätte hindeuten könnte70. Als viel versprechende Zinnquellen werden derzeit Lagerstätten in Afghanistan gehandelt, da sich die Signaturen von Zinnobjekten aus Troja mit jenen der ungefähr zeitgleichen Königsgräber von Ur und Kish nicht unähnlich sind und der dortige Rohstoff für Gold- und Silbergefäße waluscheinlich aus Afghanistan bezogen worden ist7 1• Weiträumige Handelskontakte bis nach Mesopotamien und Syrien wären damit nicht nur durch Gegenstände72
, sandem auch durch Rohmaterialsignaturen belegt. Ein Bezug des Zinns aus anatolischen Lagerstätten ist dagegen unwahrscheinlich73 •
Solch weiträumige Fernhandelsverbindungen zwischen Mittelasien und der kleinasiatischen Küstenregion können auch anband anderer Rohstoffe wahrscheinlich gemacht werden. Die starke naturräumliche Gliederung der Landschaft verbindet bereits lange vor der frühen Bronzezeit die Kulturräume von Troja über Abu Dhabi bis nach Afghanistan74
.
Überdies scheint Troja fiir die Rohmaterialbeschaffung zur Produktion der in Schicht li nachgewiesenen Vielfalt an Stoffen und Fundgattungen sein reiches Hinterland, welches über Silex,
71 Z. B. Pernicka et. al. 1990, 290f. ; Wilde 2003 , 8 1 f. 72 Efe 2007 , 60.; Kykladen 2011, 147. 73 Stos-Gale/Ga le 1984; Muhly 1993, 24 1. 243; Begemann et. al. 2003 , 196 f. " Cierny u. a. 2005 , 434.
2 11
Kupfer, Edelmetalle und Halbedelsteine verfügte, genutzt zu haben. Zahlreiche festländische Handelswege aus verschiedenen Regionen Kleinasiens, über die nicht nur Rohstoffe, sondern auch neue Techniken, neue Maßsysteme, Anregungen in der materiellen Kultur und Handwerker kamen, führten zur Westküste Kleinasiens und damit auch nach Troja . Nach Kouka hatte dieser "Zustrom von Gütern und Ideen" allerdings keinen fort währenden Einfluss auf bewegliches Gut oder die Architektur der Ansiedlung75. Die unterschiedlichen Baumaßnahmen der frühen zweiten Schicht II , welche nach neueren 14C-Daten zeitgleich mit dem späten Troia I sind76, sprechen fiir e inen soziapolitischen Einschnitt in der Siedlungsgeschichte der Stadt, der eine stärkere Sozialdifferen zierung zur Folge hatte. Innerhalb des Burgareals sollen "wirtschciftlich und politisch" bedeutsame Familien bzw. Eliten residiert haben, wohingegen die übrige Bevölkerung im U'mfeld der Burg lebte. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung erreicht Troja den Höhepunkt seines ökonomischen Wohlstandes77
• Dies zeigt sich in der Einbindung der Stadt in ein weiträumiges Austauschsystem von luxuriösen Waren, welches bis weit in den Vorderen Orient und den mittleren Osten hinein reichte, wie beispielhaft an verschiedenen Perlenformen belegt ist78. Die Ergebnisse der großflächig untersuchten Siedlungen Troia I und II, Bakla Tepe und Li man Tepe/Kiazomenai79 an der Westküste Kleinasiens sowie anderer Siedlungen wie Kum Tepe80, Be~ikYasst-Tepe81 , Larisa am Hermos82, Bayraklt-Smyrna83, Protesilas84, Kastri auf Syros, Ajios Antonios und Limenaria aufThasos, Pa Iamari auf Skyros und Asomatos auf Rhodas zeigen in Arch itektur, technologischem Niveau, Keramik- und Kleinfunden einen ähnlichen Charakter. Dies deutet daraufhin, dass der früheste Abschnitt der Frühen Bronzezeit, besonders aber die Zeit ab dem späten Troia I durch eine "Koine" auf den nord- und ostägäischen Inseln, die von Thasos bis Rhodas und von Skyros bis Liman Tepe-FB I reichte, gekennzeichnet ist. Neben Troja, wo 62% aller gefundenen Bronzeobjekte bereits Zinnbronzen sind85
, zeichnen sich besonders Polioclu1i und Kastri auf Syros in dieser Zeit als Fundorte mit signifikant melu Zitmbronzen als in der übrigen Ägäis vorhanden, aus. In der Nordägäis ist Zinnbronze generell häufi ger vertreten als auf Kreta und dem griechischen Festland86
Die meisten noch erhaltenen Gussformen der Trojanischen Sammlung wurden durch Schmidt selbst der II- V Ansiedlung zugeschrieben. Vermutlich ist die Mehrheit der Fundstücke Schicht II zuzusprechen, was auch Schmidt bereits vermutete87. Einegenaue Einordnung des durch ihn datierten Materials ist nur in wenigen Fällen nachträglich gelungen. So ordnete er beispielsweise die Gussform Sch 6766 (Taf. 12c) der zweiten Schicht Trojas zu88. Die Inventarnummern einiger weiterer Gussformenfragmente dieser Zeitstellung können heute nicht mehr ermittelt werden. Auch die einzige steinerne Blasrohrdüse (Sch 6779; Taf. 3b) datiert in diese Schicht89 Gleiches gilt fiir die Schmelztiegel Sch 6831 , Sch 6832 und Sch 6838 (Taf. Je; 2a.d).
75 Kouka 2008, 289. 76 Korfmann 1993, Abb. 3; Korfmann 1995 , Abb. 18. " Kouka 2008, 290. " Verschiedene Formen goldener Perlen in Troja haben zum Beispiel Ver
gleichsfunde in Tepe Hissar, Marlik oder Mari. Sie datieren ins 3. Jt. und 2. Jt. v. Chr. Siehe dazu: Maxweli-Hyslop 197 1, 34-36; Yule 1982, 2 1 Abb. 1. ; Curti s 1984, 1- 6; Roaf 1990, 183; Tolstikov/Trejster 1996,80- 93, Kat.-Nr. 78- 100; Young 1969, 96f. Fig. 25,4 - 5. Gleiches gilt flir geätzte Karneol perlen, die neben Troja auch in Kolonna auf Ägina, Troja, Tell Brak , Ur, Tell Abraq und Lothai belegt sind ( Rahmstorf 2005, 689).
79 Erkanal 1996, 76-79; Erkanal 1998; Kykladen 20 II , 149. so Sperling 1976; Korfmann 1994, 37- 44. 81 Korfmann 1989; Korfmann 1994. " Boehlau/Schefold 1940. 83 Akurgal 1950, 54. 84 Demangel 1926.
212
Troja III Trojas dritte Schicht (2300/2250-2100 v. Chr.90) bildet im Grunde nur einen Übergangshorizont. Nachdem die Stadt um 2480 v. Chr. durch einen Großbrand nahezu vollständig zerstört wurde, ist die danach neu errichtete Siedlung deutlich kleiner, zeichnet sich jedoch durch eine dicht gedrängte Innenbebauung aus. Neben mehrräumigen Wohnhäusern finden sich auch einräumige, offenbar abgebrannte Megara. Die in Schicht II vorhandenen Befestigungen wurden eventuell noch weitergenutzt91. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein Hausbefund (Haus 300), welcher als Metallwerkstatt interpretiert werden kann. Sie befand sich wohl im südlichen Teil der befestigten Siedlung und war Teil dichter Bebauung mit teilweise großen Gebäuden92
• Offenbar bestand die Werkstatt bereits am Ende der zweiten Schicht und ist direkt auf den alten Mauern wieder errichtet worden. In dieser älteren Phase sind Fertigprodukte aus Bronze und Gold in dem Gebäude belegt. In Schicht III fanden sich innerhalb des Hauses neben Bronze- und Knochengeräten auch eine Gussform mit Stabbarrennegativen, zwei Tondüsen und Keramiknäpfe, die eventuell als Gusstiegel gedeutet werden können, sowie mehrere Feuerstellen. Die innere Gliederung des Hauses unterliegt einer Neustrukturierung im jüngeren Abschnitt von Schicht 111, behält ihren funktion ellen Charakter jedoch bei. Gleichzeitig bezeugen die geborgenen Abfälle die üblichen Aktivitäten innerhalb eines Wohnhauses93 . Weitere zeitgleiche Werkstattareale können nicht sicher belegt werden. Allerdings ist eine Kontinuität in der Metallverarbeitung auf dem Hügel Hisarltk auch in den folgenden Perioden feststellbar94 . Gegen 2300 v. Chr. verfällt die Ansiedlung und ist für ca. I 00 Jahre nur noch geringfiigig und in mehreren Siedlungsarealen überhaupt nicht mehr besiedelt95
In der trojanischen Sammlung des MVF Berlin befanden sich ursprünglich zwei Schmelztiegel, welche nach Schliemann der dritten Schicht zugeordnet werden können, wovon jedoch heute nur noch ein Exemplar erhalten ist96
Troja IV Troja IV (21 00-1900 v. Chr.) ist im Wesentlichen durch den Aufbau neuer, nach außen verlagerter Befestigungsmauern auf den Trümmern der alten Stadt gekennzeichnet97. Eine Änderung der Besiedlungsform selbst ist jedoch nicht nachzuvollziehen. Allerdings ist die Bebauung mit kleinen einräumigen Häusern seJu· weitläufig und verteilt sich über den gesamten Hügel98 . Das Auftreten von Kuppelöfen99 könnte auf metallurgische Tätigkeiten hindeuten, die jedoch insgesamt eher vage bleiben, wenn man bedenkt, dass sich in Schicht IV, wie zeitgleich auch in ganz Vorderasien, das Vorkommen von Zinnbronze archäologisch kaum nachweisen lässt 100. Ab dem Beginn des 2. Jahrtausends v. Clu·. kommt es offenbar zu einem generellen Wechsel der Rohstoffquellen, was durch zahlreiche Metallanalysen suggeriert wird. Abschließende Untersuchungen und damit verbundene Inter-
85 Wilde 2003 , 8 1. 86 Ebd. 82. 87 Schmidt 1912, 25. ss Miiller-Karpe 1994, 200. 89 Ebd. 189. 90 Ramstorf 2006, 149. 91 lvanova 2008, 330-33 1. 92 Miiller-Karpe 1994, 49. 93 Miiller-Karpe 1994, 45 - 47. 94 Ebd ., 49; Biegen et. al. 1951. 95 Weber 2003 , 8. 96 Schliemann 1881, 456 Nr. 469 und 4 70. " Weber 2003 , 8. " Ivanova 2008, 33 1. 99 Weber 2003, 8. too Wilde 2003, 91.
pretationen dieses Szenarios bleiben jedoch abzuwarten 101• In der
Trojanischen Sammlung befindet sich ein Schmelztiegel (Inv. Nr. Sch 6817- 22/4; Taf. 2e), welcher nach Schliemann der vierten Ansiedlung zugeordnet werden kann 102
•
Troja V Troja ist im 2. Jalutausend, verstärkt ab ca. 1800 v. Clu·. den Einflüssen Mykenes und Hattusas ausgesetzt. Das nachhaltige Interesse der Hethiter kann mit den reichen Kupfer-, Arsen-, Silber- und Eisenvorkommen des Pontusgebirges begründet werden, wofür sich zum Beispiel in Bakm;:ay 16 zahlreiche Hinweise finden lassen 103
• Ab dem Beginn der fiinften (1900-1750 v. Chr.) bis zur siebenten Schicht (1250-1180 v. Chr.) können Gegenstände aus Kupfer und Zinnbronze erneut reichlich geborgen werden. Materialanalysen von Objekten deuten die Nutzung eines neuen Bergwerkes an 10•. Befunde zu metallverarbeitenden Werkplätzen oder Werkstätten in Troja sind aus dieser Schicht bisher nicht bekannt. Auch entsprechende Geräte fanden sich bisher nur spärlich. Aus der Schliemann Sammlung kann eine Blasrohrdüse (Sch 6780; Taf. 3e) der fiinften Schicht Trojas zugeordnet werden 105
•
Troja VI In jener fiir die Erforschung der spätbronzezeitlichen Ägäis so bedeutenden Schicht VI Trojas (1700- 1250 v. Chr.) wird die Stadt erneut zu einem Königs- oder Herrschersitz ausgebaut und vervollkommnet. In dieser Phase avanciert sie zur mächtigsten Stadt in der Geschichte der Ansiedlung, welche durch starke Befestigungen mit Toren und Wehrtürmen charakterisiert ist. Die Hausanlagen der Innenbebauung sind geräumiger und vornehmer als zuvor. Zwar sind aus der sechsten Schicht mehrere Funde von Gussformen bekannt, doch gibt es keine Angaben zu ihren Fundkontexten. Einzelne Werkstätten lassen sich daher nicht melu· lokalisieren , obwohl es mit hoher Wahrscheinlichkeit meluere von ihnen innerhalb der Befestigungsmauern gegeben haben wird 106 Nur die Hälfte einer zweischaligen Gussform aus dem so genannten "Pillctr Hause" ist exakt lokalisiert. Sie wurde zusammen mit Hausrat des üblichen Spektrums und einer gewissen Anzahl an Schleuderkugeln geborgen 107
, ohne dass sich weitere Hinweise auf eine Werkstatt oder einen Werkplatz hätten finden lassen. Die ausgeprägten Handelbeziehungen Trojas lassen sich beispielsweise an mykenischer Importkeramik oder Funden von kykladischen Idolen in Troja, jedoch auch anhand eines Austausches mit keramischen Erzeugnissen aus lnneranatolien 108 feststellen. Außerdem kann nun erstmals die Haltung von Pferden belegt werden 109
Die Trojanische Sammlung enthält mehrere Gussformen und Fragmente, welche dieser Phase zugewiesen werden können (Sch 6765- Sch 6767; Sch 6769)1 10
• Ferner stammt mindestens eine Tondüse (Sch 6780; Taf. 3e) aus der sechsten Schicht.
Troja VII Die Stadt der Schicht Vlla (1250- 1180 v. Chr.) wurde durch ein Feuer zerstört und direkt auf den Schuttschichten neu erbaut. In Schicht Vllb (1180 - nach 1000 v. Chr.) unterscheidet sich die Bebauung der Ansiedlung von vorherigen Planungen. Mehrere Häuser werden nun um einen Hof gruppiert. Neue Keramiktypen
IOI Ebd. 82. 101 Schliemann 188 1, 456 f. IOJ Czichon et. al. 2006 ,5. I (}.I \Vilde 2003, 91. 10; Schliemann 188 1, 650. 106 Müller-Karpe 1994, 98 f. 107 Biegen et. al. 195 1, 64 - 66. 108 Efe/ ilasli 1997; Koppenhöfer 2002, 364 - 366. 109 Weber 2003 , 9.
lassen ebenso auf einen tiefgreifenden Wandel schließen. Auch diese Stadt fiel jedoch einem Feuer zum Opfer'"-Aus der siebenten Schicht stammt eine zweiteilige Gussform (Sch 6772) 112 , welche vermutlich innerhalb eines nur halb ergrabenen und nicht ausreichend dokumentierten Werkstattbefundes geborgen wurde. In ihrer unmittelbaren Umgebung befanden sich (nicht dokumentierte) Werkstattreste und melu·ere vollständig erhaltene Keramikgefäße sowie Knochengerät Das entsprechende Gebäude war bereits außerhalb der Befestigungsmauern situiert, wobei von der Existenz weiterer Werkstätten im Inneren der Burgmauern ausgegangen werden muss. Dies wird vor allem durch einen Gussformenfund im westlichen Teil der Burg gestützt. Wie auch bei anderen Gussformen aus Schicht VII ist eine exakte zeitliche Zuordnung und damit auch die relative Gleichzeitigkeit der Befunde, welche Gussformen enthalten, nicht zu ermitteln 113 Einige weitere Fundstücke könnten der siebenten Schicht entstammen, jedoch auch jüngeren Kontexten angehören (Sch 6768a.b. - Sch 6770) .
Geräte zum Metallguss in der trojanischen Sammlung
Unter den Gerätschaften die mit der Metallverarbeitung in Verbindung stehen , sind in erster Linie Gussformen, Gusstiegel, Blasrohrdüsen und verschiedene Arten von Steingeräten zu betrachten. Von den ursprünglich mehr als 262 durch Schliemann 1881 11 • vorgelegten bzw. 180 durch Schmidt 1902 katalogisierten relevanten Objekten, können heute 65 als noch in der Sanunlung vorhanden neu bearbeitet werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um vollständig erhaltene Stücke, allerdings auch einige größere Fragmente von Gussformen und Gusstiegeln. Eine große Anzahl an entsprechenden Utensilien ist jedoch den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges zum Opfer gefallen bzw. verschollen oder konnte aufgrund fehlender Funddokumentation nicht mehr eindeutig der Trojanischen Sammlung zugesetuieben werden.
Schmelztiegel
Schmelztiegel sind bewegliche, transportable Reaktionsbehälter, die zur Transformation von Stoffen unter hoher thermischer Belastung dienen, wobei sie einer permanenten Luftzufuhr ausgesetzt sind. Diese Art der tedmischen Keramik muss thermische Schocks überdauern kötmen, und alle Arbeitsschritte des Schmelzens und Gießens müssen durch sie kontrollierbar sein. Daher ist eine umfassende Kenntnis des Metallurgen von Tonqualität, Hitzeverhalten und spezifischer Materialeignung vorauszusetzen. Grundsätzlich wird der Ton oft mit Stroh und Heu gemagert, wobei jedoch die bevorzugte Verwendung einer bestimmten Tonart für Gusstiegel erst ab der römischen Kaiserzeit belegt werden kann. lm frühbronzezeitlichen Anatolien diente die Meluheit der identifizierten Tiegel zum Schmelzen von Metall , wobei in einigen von ihnen auch Rückstände der Glasherstellung gefunden wurden. Zur Grundkonstruktion der Geräteart ist zu bemerken, dass Tiegel, die von oben erhitzt werden, meist dickwandig und dickbödig sind. Bei jenen, die von der Seite oder vom Boden aus erhitzt werden,
11 0 Bei den Inventarnummern Sch 6771 , Sch 6773- 6776 und Sch 6769 (Taf. 3b) variieren die zeitlichen Ansprachen in der Fachliteratur teilweise erheblich (siehe Katalog). Hier wurde sich nach den Angaben Schmidts bzw. MüllerKarpes gerichtet.
111 Weber 2003 , 9.
" ' Schmidt 1902, 268. '" Müller-Karpe 1994, 99. ' '" Es ist mit deutlich melu· Objekten zu rechnen. Gerade die Anzahl der rele
vanten Steingeräte ist in den Publikationen Schliemanns nicht mit Sicherheit in exakten Zahlen erfassbar.
213
sind oft dünnere Wände und differierende Magerungsbestandteile nachzuweisen 11 5 Müller-Karpe stritt eine bodenseilige Erh itzung der anato lischen Tiegel im 3. Jahrtausend v. Clu. ab, da es bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. nicht gelungen sei, ausre ichend feuerfeste Keramik fiir diesen Vorgang herzustellen 116
• Die Exemplare der Trojanischen Sammlung zeigen ausnahmslos Spuren von Hitzeeinwirkung im Tiegelinneren und auf ihren Randbereichen und Außenwänden. Die postulierte Nutzung des in der Glut eines Feuers stehend genutzten Tiegels mit einer Hitzequelle von oben kann damit bestätigt werden. Insgesamt wurden melu· als 70 Tiegel durch Schliemann in Troja geborgen 117
. Gegenwärtig befinden sich noch sieben Gusstiegel unterschied licher Form in der Trojanischen Sammlung. Einige sind nicht mehr vollständig überliefert und deshalb restaurato-risch in Teilen ergänzt. .. Vier kleine SchmelztiegeP 18 aus rötlich-bräunlichem Ton sind Müller-Karpes Typ A4 zuzuordnen. Ursprünglich waren mindestens 14 gleichart ige Exemp lare aus Troja vorhanden 119• Die länglich ovalen Tonschälchen weisen keine besonders grobe Magerung auf und deuten durch ihre nicht exakt ausgeformten Randbereiche, unterschiedliche Wandstärken und ungleichmäßige Bodengestaltung auf eine sclmelle ad hoc-Fertigung per Hand ohne formgebende Hilfsinstrumente. Angaben zu ihren Fundzusammenhängen stehen nicht zur Verfügung, doch sollen sie vor a llem zum Raffinieren von Gold und Silber mittels Bleizugabe genutzt worden sein 120
• Da jedoch keine Materialanalysen an eventuell anhaftenden Metallrückständen durchgefiilut wurden, kann diese Vermutung nicht bestätigt werden. Jedes der StUcke zeigt vor allem im Bodenbereich und auf der Standfl äche leichte Gebrauchsspuren. Insgesamt sind sie jedoch weit weniger mit Rußoder Verglasungsrückständen behaftet, als die übrigen Schmelztiegel. Metallablagerungen können nicht beobachtet werden. Eine Nutzung in Verbindung mit ei ner Hitzequelle ist jedoch nicht in Zweifel zu ziehen. Die Schälchen sind nur schwach gebrannt und gehören der zweiten und dritten Sch icht Trojas an. Ähnliche Stücke sind bereits seit Längerem aus Thermi bekannt121
•
Die wahrschein lich bekanntesten Vertreter stammen jedoch aus den Metallurgengräbern des Schwarzmeerraumes. In Kurgan 2 von Malaja Ternovka befanden sich gleich sechs solcher Tiegel in einem Grab (Abb. 5). Es datiert ins 17. Jaluhundert v. Chr. 122
•
Auch andere Kurgangräber wie in Novoalekseevka (Kurgan 1, Grab 6) enthalten entsprechende Utensilien in ihrem Beigabenrepertoire l2l. Analogien dürfte es zu diesen schnell und wenig akkurat geformten kleinen Schälchen viele geben, obgleich diese zweifellos mehrheitlich nicht als Schmelztiegel angesprochen bzw. erkannt worden sind. Ihr unspezifischer Charakter legt auch anderweitige Nutzungsmöglichkeiten nahe, weshalb im Einzelfall zu prüfen wäre, ob es sich tatsächlich immer um Schmelztiegel handelt. Da solche Objekte jedoch in den Publikationen der meisten Siedlungsplätze unbearbeitet bzw. nicht abgebi ldet sind, kann eine vollständige Auflistung analoger Fundstücke derzeit nicht erfolgen . Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich solche Tiegel in vielen der metallverarbeitenden Siedlungen mit metallverarbeitenden Werkplätzen finden ließen. Ein schalenart iger Schmelztiegel ohne Handhaben liegt in Stück Sch 6817- 6822/3 (Taf. I b) vor. Der mittelgroße Tiegel von leicht ovaler Form weist einen nur leicht ausgeformten Ausguss auf. Er
115 Bayley/Rehren 2007, 46 f. 11 6 Miiller-Karpe 1994, 119. 117 Schmi dt 1902, 268 f. 118 Bei Bobokhyan 20 I 0, 197 als Guss forme n bezeichnet. 119 Miiller-Karpe 1994, 124. 12o Schliemann 188 1,457. 121 Lamb 1936, 1957, Abb. 30,23. 122 Bobokhyan 20 I 0, 197. 123 Kaiser 2008, 270 f.
2 14
besteht aus einem grau-rötlichen mit Häckselgemagerten Ton und zeigt offenbar Reste eines hellen, beigefarbenen Tonüberzuges am Tiegelboden und dem Randbereich. Sein Boden ist sowoh l im Innenbereich wie auch an der äußeren Standfläche leicht gewölbt. Verglichen mit späteren Formen lassen sich hier enorme Wandstärken beobachten und aufgrund einer sehr flachen Ausprägung nur eine sehr geringe maximale Füllmenge postulieren . Einzelne Randpartien zeigen Verschlackungen und Blasenbildungen. Da nur vergleichsweise wenig von der Originalmasse des Tiegels erhalten ist, kann eine einseitige Ausprägung der Verglasungen, wie bei anderen Stücken zu erkem1en, nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Starke Kupferauflagerungen, Reste von Kupferschlacke sowie ein nicht ganz gesclunolzenes Metallstück haften an der Tiegelinnenseite. XRF-Oberflächenmessungen zufolge handelt es sich bei dem geschmolzenen Material um Kupfer mit einem hohen Eisenantei L Rußspuren und Spannungsrisse durch Hitzeeinwirkung sind an allen erha ltenen Flächen des Tiegels erkennbar. Schmidt vermutete, dass ein großer Teil der nur fragmentarisch überlieferten Stücke aus Troja ebenfalls diesem Typus zuzusprechen sei 124
• Müller-Karpe nahm eine allgemeine Verwendung dieser Tiegelform bei der Verarbeitung von Buntmetallen an125, was zwar eine nur vage Funktionsbestimmung ist, jedoch aufgrund der Analyseergebnisse anhaftender Reste an verschiedenen ähn lichen Tiegeln auch nicht spezifiz iert werden kann (siehe Katalog). Die Fundumstände des Tiegels Sch 6817-6822/3 (Taf. I b) sind heute nicht mehr nachvollziehbar, jedoch kann anband analoger Exemplare von einer zeitlichen Einordnung an den Begim1 der zweiten Hälfte des 3. Jalutausends v. Chr. oder sogar früher ausgegangen werden. Schliematm bi ldete mindestens einen weiteren solchen Tiegel aus seinen Grabungen ab 126, der jedoch nicht nach Berlin gelangte. Ähnlich konzipierte Exemplare, wetm auch meist mit gerader Standfläche, wurden in den Ansiedlungen von Kurut;ay 127
, Tülintepe/Tepet;ik128, Kültepe, Malatya-Arslantepe
und Bogazköy' 29 gefunden. Die meisten von ihnen weisen jedoch eine höhere Wandung auf und konnten entsprechend melu· Schmelzmasse aufnehmen. Das Bruchstück eines wahrschein lich gleichartigen Tiegels aus Demircihöyük wies Meta llreste auf den Tiegelinnenseiten auf. Analysen der Rückstände deuten auf das Schmelzen einer Kupfer- Blei-Legierung hin 130
• Einzig das Exemplar aus Kültepe könnte aufgrund seiner dichten Oberflächenstruktur eventuell auch für die Verarbeitung von Gold geeignet gewesen sein 131 .
Ei ne ähnliche, jedoch weiter entwickelte Form mit knubbenartigen Fortsätzen auf der rechten Bodenseite liegt in Schmelztiegel Sch 6817-22/4 (Taf. 2e) der Trojanischen Sammlung vor, welcher durch Müller-Karpe seinem Typ B l zugeordnet wurde 132
•
Sein Typus besteht jedoch aus Stücken mit einer griffart igen Handhabe, welchen unser Exemplar forma l nicht nahe steht. Derartige Schmelztiegel aus Troja stammen ausnahmslos aus den Grabungen Blegens, woh ingegen die Berliner Sammlung keinen Vertreter dieser Tiegelat1 enthält . Das zu besprechende, spitzova le Stück kann keiner Schicht mehr zugeordnet werden. Es besitzt e inen runden Boden auf der Innenseite und eine flache, ebene Standfläche auf der Außenseite, von welcher sich an der seitlichen Wandung zwei kleine Knubben absetzen. Die Randbereiche ei ner Tiegelseite weisen starke Blasenbildung mit Teilverglasungen auf, die auf eine sehr starke Hitze-
124 Schm idt 1902, 268 f. 125 Miiller-Karpe 1994, 119. 126 Schliemann 188 1, 456- 458 Nr. 4 71. ll7 Duru 1983, 30 Taf. 20, 18. 128 Es in 1976, 22 1 Taf. I b. 129 Mii lle r-Karpe 1994, 119. 130 Bachmann u. a. 1987, 23. 13 1 Mii lle r-Karpe 1994, 119. 132 Ebd. 125.
~2
0 a S em
Abb. 5: Teilinventar des Grabnmdes von Mala Ternovka. Nach Bobokhyan 20 I 0 Abb. 28.
einwirkung hindeuten. Die übrigen Randbereiche sind fi·ei von entsprechenden Spuren. Aufgrund der Nutzungsspuren am oberen Randbereich des Tiegels kann von einer Erh itzung von oben ausgegangen werden . Kle ine grünliche Patinareste deuten auf in der blasigen Struktur des Tons festgesetztes Metall hin. Bereits Sch liemann ließ an einem Teil dieser Metallreste Materialanalysen erstellen, welche neben Goldrückständen auch Partikel von Kupfer und rötlichem Kupferoxid attestieren 133 • Müller-Karpe sprach dem Tiegel daher eher eine Funktion in der Goldraffination zu, obwohl die meisten formal nahe stehenden Formen eher mit der Bronzeverarbeitung in Zusammenhang gebracht worden sind. Aufgrund des FehJens von Bleirückständen ging er von einem Verfahren aus, bei dem unedle Metalle nur durch Erhitzen aus dem Gold herausgelöst wurden 134
. Allerdings konnten bei einer XRF-Oberflächenmessung auf der Tiegelinnen- und Außenseite im Jahre 20 12 auf und direkt unterhalb der Bodenfläche im Inneren des Stückes sowohl Kupfer- als auch Zinnpartikel nachgewiesen werden . Auf dem Boden an der Außenseite sind dagegen nur Zinnrückstände identifiziert worden. Bestandteile anderer Metalle waren in nur unsignifikanter Menge erkennbar. Eine Nutzung bei der Verarbeitung von Kupfer bzw. Kupfer/Zinn-Legierungen ist damit nicht weniger waluscheinlich als die Raffination von Gold. Am formal ähnlichsten dürften diesem Exemplar zwei Schmelz-
IJJ Sch li emann 188 1, 456 f. IH Miiller-Karpe 1994, 126.
tiegel aus Malatya-Arslantepe sein, welche aus einem durch ein Feuer zerstörten Werkstattraum der späten Schicht VI, und damit im späten 3. Jahrtausend v. Chr., stammen. Dort konnten neben vier dieser Tiegel auch Gussformen , Steinhämmer und Keramiken als gemeinsames Ensemble geborgen werden 135
. Die formale Ähnlichkeit und das fi'lihe Entwicklungsstadium der Griffgestaltung berücksichtigend, kann für das Stück aus Troja sicherlich eine Nutzung in der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. angenommen werden. Kahnförmig gestaltet und zwei Griffzapfen aufweisend, ist ein weiterer Schmelztiegel mit der Inventarnummer Sch 6823 (Taf. lg). Er besteht aus dunklem mit Häcksel gemagertem Ton. Einem schmalen, aber deutlich ausgeformten Ausguss liegen zwei seitlich abstehende Knubben gegenüber, welche die Handhaben des Tiegels bi lden. Starke Verschlackungen auf der rechten Seite des Ausgusses und den Randbereichen sowie einseitige Verschlackungen am Ausguss und ein Hitzeriss belegen eine Nutzung unter Einfluss hoher kinetischer Energie. Auch dieser Tiegel ist von oben erhitzt worden. Die Funktion des Stückes ist im Bereich der Bronzeverarbeihmg zu suchen, wie Analysen von Schmelzrückständen im Tiegel belegen 136
. Seine Fundlage innerhalb der Siedlung kann nicht rekonstruiert werden, und eine Datierung muss entsprechend vage bleiben. Allerdings ist auch hier eine
us Ebd. 124. 136 Ebd. 127.
215
b
Abb.6: Schmelztiegel aus A~ana und Nor~untepe . Nach Müller-Karpe 1994, Taf. 12, 1.2.
Nutzung in der zweiten Hälfte bzw. dem Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. anzunehmen. Analoge Exemplare sind aus anderen Siedlungskontexten bisher nicht bekannt. Allerdings sind die Tiegel aus Ac;:ana und Nor~untepe137 unserem Exemplar formal durchaus nahe stehend, auch wenn sie keine seitlichen Knubben aufweisen (Abb. 6). Ein durch Müller-Karpe demselben Typ zugeordneter spitzovaler Tiegel mit einem dem Ausguss gegenüberliegenden Griff wurde zwar in Troja geborgen, verblieb jedoch in der Türkei. Durch Schliemann durchgeführte Analysen von Metallrückständen können jedoch auch ihn mit der Bronzeverarbeitung in Verbindung bringen. Ein in gleicher Art gestaltetes Stück kann aus Kültepe namhaft gemacht werden, lässt sich jedoch bereits in die erste Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. datieren. Vermutlich steht sie in Zusammenhang mit einem Metallwerkstattbefund einer älteren Siedlungsschicht138
• Die genannten anatolischen Vergleichsfunde stammen mehrheitlich aus dem frühen 3. Jahrtausend v. Clu·. und werden teilweise bereits der Frühbronzezeit I zugewiesen (Abb. 7). Allerdings bilden Schmelztiegel durchaus lang lebige Formen, welche auch in selu· viel späteren Kontexten unverändert auftreten. Weitere Tiegel des frühen dritten 3. Jahrtausends v. Cbr. stammen aus den Phasen VI und lll des <;:ucuric;:i Höyük, wo ein Werkstattareal mit 24 Öfen, Düsenfragmenten und Schlackenresten, Gussformen für Barren, Gusstiegelfragmenten, Gusskügelchen, einem Amboss- und einem Klopfstein ausgegraben werden konnten 139
.
Die von Schmidt als Schmelztiegel angesprochene 140 Tasse Sch 6824 soll hier nicht erneut als solcher vorgelegt werden, da meines Eracl1tens aufgrund des verwendeten Materials zur Herstellung des Stückes und auch aufgrund fehlender Nutzungsspuren nicht von einer Umnutzung als Schmelztiegel auszugehen ist. Es handelt sich um ein handgeformtes mittelgroßes, leicht bauchiges Gefaß mit deutlich ausgeformtem Ausguss. Der ihm gegenüberliegende Henkel ist nur noch im Ansatz erhalten. Unterhalb der relativ steil abfallenden Wandung schließt sich ein runder, leicht abgesetzter kleiner Standring mit konkaver Innenfläche an. Das Gefaß besteht aus grob gemagertem, hell rötlichem Ton, der neben teilweise größeren Einschlüssen stark glimmerhaltigen Gesteins auch organische Anteile enthält. Seine Oberfläche ist nur leicht geglättet und überwiegend uneben. Die Wandstärke ist
137 Mliller-Karpe 1994, Taf. 12, 1.2. 13 8 Ebd. 127. 139 Horejs u. a. 20 II , 46 - 48 Abb. I 0. 140 Schmidt 1902, 268. 14 1 Banks/Janko 2008, 428- 430. 1~ 2 Miiller-Karpe I 994 , Taf. 13, 1.4.5.1 0. '" Braidwood/Braidwood 1960, 3 13 f. 1o~" Ebd. 314.
2 16
recht gleichmäßig ausgeprägt, wobei die Wandung im unteren Bereich deutlich massiver ist und sich zu den Rändern hin stark vetjüngt. Das Stück wurde nicht fiir einen Gebrauch in der Metallverarbeitung hergestellt und erfii llt aufgrund seiner Tonqualität die bestehenden thermischen Ansprüche nicht. Angeblich ist ein ähnlich gearbeiteter Schmelztiegel aus Ayios Stephanos bekannt. Auch hier soll es sich um ein tungenutztes Keramikgefaß handeln, was ebenso in Zweifel zu ziehen sein könnte. Die Funde datieren bereits in die späte Frühbronzezeit (FH 111) bzw. an den Beginn der mittleren Bronzezeit (MH 1- 11)' 41
. Napfartige, hohe Schmelztiegel mit und ohne ausgeformte Standböden sind jedoch von einigen Fundorten Anatoliens, wie Tarsus, Varto-Kayahdere oder Nor~untepe 142 bekannt. Letzterer wurde in einem Areal gefunden, in dem sich offenbar über mehrere Siedlungsphasen hinweg ein metallurgischer Werkplatz befunden hatte. Neben Schlacken und Tondüsen kamen dort auch Fragmente weiterer Tiegel sowie Ofeninstallationen und Herdstellen zu Tage143
• Zur Funktion dieser Tiegel liefern die Materialanalysen anhaftender Metallreste des Tiegels aus Cudeyde einen Anhaltspunkt. Die Schmelzrückstände konnten zweifelsfrei als Z innbronze identifiziert werden 144 .
Allerdings weisen ägyptische Beischriften zu Darstellungen dieser Tiegel sie gleichfalls als Reaktionsbehälter bei der Goldverarbeitung aus 145
•
Eine von den übrigen Tiegeln formal abzugrenzende Gattung si nd die runden "Gusslöffel", welche zumindest eine kurze Erwähnung verdienen, auch wenn sie nie Teil der Berliner Sammlung Trojanischer Altertümer waren. Schliemann sprach sie als Schöpfkellen an 146, Schmidt wiederum deklarierte sie als metallurgische Geräte, ohne jedoch eine konkrete Ansprache zu vermitteln 147
. Ihre funktionelle Einordnung als metallurgische Geräte ka1U1 nicht geprüft werden, da die beiden durch Schliemann geborgenen Exemplare nicht mehr erhalten sind. Über eventuelle Ruß- oder andere Nutzungsspuren berichtet er zudem nicht. Auch sie müssten, sofern sie tatsächlich verwendet worden sind, stark verrußte Bereiche oder verglaste Partien aufweisen. Der größere der beiden Tonlöffel aus Troja (Taf. I f) ähnelt jedoch eher Bestandteilen des Geschirrs als den Löffeln mit möglicher Tiegelfunktion, wie sie aus zahlreichen Gebieten Europas in unterschiedlichen Perioden bekannt sind. Eine Zusammenstellung entsprechender Fundstücke des Neolithikums und der Bronzezeit findet sich bei Hood 148
,
die inzwischen sicherlich durch zahlreiche Exemplare ergänzt werden katm. Der kleinere "Gusslöffel" (Taf. le) entspricht formal und funktional eher den übrigen Exemplaren, weshalb seine Funktion nicht in Zweifel zu ziehen ist. Seine besten Parallelen stammen aus Nor~untepe . Ähnliche Exemplare sind auch aus dem frühbron zezeitlichen Emporio auf Chios, Thermi, Hac;: ilar, Tarsus oder Mersin bekannt '-49
, womit sie sich im Wesentlichen in den Siedlungen finden , die auch eine frühe, bereits im Chalkolithikum ausgeprägte Metallurgie aufweisen. Sicherlich kann auch in vielen anderen Ansiedlungen mit Hinweisen auf metallurgi sche Produktion mit entsprechenden Fundstücken gereclmet werden, die bisher noch nicht vorgelegt wurden. Für die beiden trojanischen Exemplare lässt sich kein Fundkontext ermitteln. Schliemann wies sie der "dritten verbrannten Stadt" 150 und damit der zweiten Hälfte des 3. Jalutausends v. Chr. zu 151• Die Vergleichsfunde aus Nor~untepe datieren dagegen bere its in die erste Hälfte des 3. Jahrtausends v. Clu. (Abb. 8a) 152
•
14 ' Drenkhahn 1976, 34 f. ; Mliller-Karpe 1994, 127. 146 Schliemannl 88 1, 471. '" Schmidt I 092 , 268 f. '" Hood et. al. 1982 , 623 - 626. 149 Lamb 1936, PI. 24,30/43 ; Hood et. a l. 1982 , 624. 150 Schliemann 188 1, 457 Nr. 474- 475. 15 1 Mliller-Karpe 1994, 197. 1s2 Ebd. 130.
Abb. 7: Fundstellen von Schmelztiegeln des 3. Jahrtausends v. Chr. I Troja; 2 Demircihüyük; 3 Kuru~ay ; 4 Bogazköy; 5 Kültepe; 6 A~ana ; 7 MalatyaArslantepe; 8 Tülintepe; 9 Tepec ik; I 0 Nor~untepe; II Kayhdere; 12 Cudyede. Erstellt nach lVlüller-Karpe 1994, 142, Abb. 96.
I
I
I
'
Jene übrigen Exemplare werden im Wesentlichen als ungefähr Troja li-zeitlich angesprochen; nur das Stück aus Tarsus ist bereits der frühen Frühbronzezeit (EB 1- Stufe) zugewiesen worden (Abb. 8b.c) 153
•
Die Größe und das Fassungsvermögen der Schmelztiegel unterliegen in der Bronzezeit deutlichen Veränderungen. Tiefe, große Exemplare kommen melu-heitlich erst in der mittleren und späten Bronzezeit sowohl Mitteleuropas als auch des Vorderen Orients v01·1; 4 . Bei der Ermittlung der Volumina mitteleuropäischer Schmelztiegel werden vielfach die Schmelzreste an den Rändern einzelner Tiegel als Indizien fiir eine Füllung "bis unler den Rand' herangezogen. Folglich ergibt sich ein durchschnittliches Fassungsvermögen von 1,1- 1,2 kg Schmelzmasse reinen Kupfers pro Gusstiegel m . Die "maximale" Füllmenge ist auch fiir einige Schmelztiegel der trojanischen Sammlung angegeben, wobei es sich im Fall des Tiegels Sch 6823 um ein Fassungsvermögen von 142 ml handeln solJl 56
. An anderer Stelle gab Müller-Karpe jedoch selbst zu bedenken, dass die Tiegel im Allgemeinen kaum mehr als zwei Drittel gefiillt gewesen sein dürften 1;
7• Das maximale Fassungsvermögen der trojanischen
Tiegel unterscheidet sich sogar ganz wesentlich von den in ihnen
153 Hood et. al. 1982, 624.
" ' Yener/Vandiver 1993,237. Is s Sch1ichterle/Rothländer 1982 , 59; Weissgerber 2004, 16. ebd. 69.
b
r:;.,_-_ ~/
c
Abb. 8: GusslötTel aus Nor~untepe und Tarsus; a nach Müller-Karpe 1994, Taf. 14, 25.26; b und c nach Hood et.al. 1982, Abb. 283 .
tatsächlich geschmolzenen Metallmengen (Abb. 9). Ein Vergleich des maximalen Fassungsvermögens der trojanischen Gusstiegel und den anband der Rußspuren auf der Oberfläche tatsächlich genutzten Tiegelfläche zeigt, dass höchstens mit einer Nutzung ca. der Hälfte des maximalen Tiegelvolumens zu rechnen ist. Die geschmolzenen Metallmengen sind im Normalfall weit unterhalb des Fassungsvermögens der Tiegel geblieben. Ein solches Vorgehen ist durchaus sinnvoll , liegen doch die zur Füllung der Negative der zu gießenden Gegenstände benötigten "Metallmengen" oft ebenfalls weit unterhalb des maximalen Volumens der GusstiegeL Die festzustellende Varianz in der Füllmenge bei den Barrennegativen I iegt zwischen 1 0 und 50 ml. Stabbarrennegative haben dabei regelmäßig ein Volumen von etwa 10 ml , welches mit der Anzahl der Negative auf derselben Gussform multipliz iert werden muss . Da stets mindestens fiinfbis sechs Negative an einer Form angebracht sind, sollte pro GussvOJ·gang ein benötigtes Volumen von 50- 60 ml angenommen werden dürfen, um alle Negative einer Form vollständig zu fiillen. Damit läge die aufzuwendende Metallmenge etwa im selben Bereich wie auch bei einem vollständig ausgefüllten Rundbarrennegativ. Eine Nutzung nur einzelner Barrermegative ist jedoch
Is6 Mliller-Karpe 1994, 127. 1s1 Ebd. 119.
217
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
• max. Tiegelvolumen in ml
• genutztes Tiegelvolumen in ml
Abb. 9: Volumina von Schmelztiegeln der Trojanischen Sammlung. Erstellt durch B. Nessel.
gerade beim Guss von Edelmetall- oder Zilmbarren ebenfalls in Betracht zu ziehen, was entsprechend weniger Materialvolumen innerhalb eines Gießvorganges erfordern würde. Möglicherweise lässt sich in den Nutzungsspuren der Schmelztiegel der Sammlung ein Indiz für eine entsprechende Vorgehensweise erkennen. Gestützt wird diese These durch mindestens einen Tiegel, in dem das Schmelzen von Gold nachgewiesen werden konnte158• Von einer Produktion größeren Ausmaßes innerhalb eines Gussvorganges ist mit den überlieferten Tiegeln aufgrund ihres geringen Volumens nicht auszugehen.
Tondüsen
Die zur techni schen Keramik gehörenden Tondüsen bilden eine Werkzeuggruppe, die seit Langem Gegenstand verschiedener Debatten ist. Schliemann stellte bereits eine Beziehung zwischen den kleinen konischen Geräten und dem Metallguss her, deutete sie jedoch fälschlich als Gusstrichter159
• Wie verschiedentlich bereits ausgeführt wurde, sind sie in jedem Fall von Gebläsedüsen zu unterscheiden. Ihre Funktion liegt einerseits im Schutz organischer und damit entzündlicher Blasrohre, ohne die eine längere Luftzufulu· zur benötigten Hitzequelle nicht realisiert werden könnte. Außerdem steigern sie durch ihre spezifische Form und Ausprägung die Intensität der Sauerstoffzufuhr und steuern somit das austretende Luftvolumen und die Austrittsgeschwindigkeit des Luftstroms auf die anzufachende Glut. Blasrolu·diisen werden daher zum Anfachen des Feuers in Verbindung mit offenen Gusstiegeln, wie jenen aus der Trojanischen Sammlung, verwandt (Abb. I 0). Durch die Luftzufuhr wird die Temperatur des Feuers gesteigert und entsprechend des Schmelzpunktes des jeweiligen Materials so hoch und konstant wie nötig gehalten. Nach experimentellen Versuchen sind für effektive und gleichbleibende manuelle Befeuerung jedoch stets mehrere Personen bei einem Schmelzvorgang nötig 160 . Im Allgemeinen lassen sich deutliche Nutzungsspuren und fl ächig verglaste Austrittsöffnungen an den
158 Schliemann 188 1, 456 f. 159 Ebd. 458 f. 160 Jantzen 2008, 206.
218
Abb. I 0: Schematische Darstellung der Nutzungsweise von Blasrohrdüsen bei einer Befeuerung von oben. Verändert nach Roden 1988, Abb. II.
Blasrohrdüsen feststellen , die auf eine sehr starke Hitzeentwicklung in diesem Bereich hindeuten. Ein konischer Luftkanal erhöht den Druck der die Düse durchströmenden Luft und steigert so ihre Geschwindigkeit. Die in den breiten Tüllenmund der Düse eintretende Luft muss sich in kurzer Zeit durch das schmale Ende an ihrer Austrittsöffinmg zwängen. Aus der sich dabei stetig erhöhenden Geschwindigkeit resultiert e ine stärkere Sauerstoffabgabe, die zwar sehr kle inräumig, dafür jedoch auch sehr intensiv wirkt. Die Länge des schmalen Luftkanals ist daher entscheidend für die Steuerung der Sauerstoffzufuhr auf die Glut. Je länger er ist, desto schneller wird die transportierte Luft, welche folglich beim Austritt mehr Energie abgibt. Im direkten Vergleich müssten sich zwischen den Stücken mit kurzem und langem Luftkanal demnach unterschiedliche Austrittsgeschwindigkeiten und Druckverhältnisse messen lassen. Somit wären die Stücke mit langem Luftkanal und kurzem Absatz zum Anfachen von Glut oder schnellem, starken Erhöhen von Temperaturen besser geeignet, als ihre Pendants mit kürzeren Kanälen . Schmidt konnte bei seiner Inventarisierung des Sammlungsbestandes 19 tönerne und eine steinerne Düse aus Troja benennen 161
•
Die 17 erhaltenen tönernen BlasrolU"düsen haben, wie auch alle bekannten Vergleichsstücke, eine· gut geglättete Oberfläche. Nur Düse Tr. 345 - 1 (Taf. 3o) macht den Eindruck, nicht sorgfältig ausgeformt worden zu sein. Bereits Müller-Karpe wies die anatolischen Düsen insgesamt als mit ,,grob mineralisch gemagerte[n) Tonen hergestellt" aus und gab speziell für die Düsen aus Troja an, sie seien ohne einen Überzug aus Tonschlicker "lediglich geglättet und anschließend poliert" worden. Auch ihr Herstellungsprozess wurde durch ihn bereits anschaulich besclu·ieben, weshalb dies hier nicht nochmal s erfolgen soll 162. An einigen Tondüsen, wie beispielsweise Exemplar Tr. 243 (Taf. 3d) sind im Inneren noch Abdrücke organischen Materials festzustellen, welche wohl von einem zur Herstellung genutzten Formteil stammen. Die tönernen Stücke der Sammlung sind zwar mehrheitlich schwach gebrannt, jedoch trotzdem insgesamt auffallend gut erhalten. Sie können ilu·en Charakteristika nach in jene mit langem
16 1 Schmidt 1902, 268. 162 Miiller-Karpe 1994, I II .
Abb. II : Blasrohrdüsen Sch 6781 und Sch 6790 mit Markierungen. Foto B. Nesse l.
Luftkanal und kurzem Absatz und solche mit kurzem Luftkanal und langem Absatz gegliedert werden. Vier Exemplare sind mit Letzterem ausgestattet, wobei der Luftkanal weniger als die Hälfte des Düseninneren einnimmt. Nur ein einziges Stück zeichnet sich durch einen langem Luftkanal und einen sehr kurzen Absatz aus (Sch 6783 ; Taf. 3a). Bei fiinffragmentierten Exemplaren kann dagegen ein geradlinig verlaufender Luftkanal ohne Absatz beobachtet werden . Ob sich zumindest bei den Düsen Sch 345- 2 und 345- 5 (Taf. 3,m.l) im abgebrochenen Bereich ursprünglich eine Verbreiterung befunden hat, womit beide Exemplare zu den Stücken mit langem Luftkanal zu zählen wären , lässt sich nicht mehr eruieren. Eine verschiedenartige Nutzung der Düsen mit langem oder kurzem Luftkanal kann weder anhand der Befunde, noch anband der Nutzungsspuren belegt werden. Es handelt sich bei den beiden Konstruktionsvarianten in erster Linie um ein spezifisch technisches Detail , ohne direkte Konsequenzen fiir ihre tatsächliche Handhabung. Auffallend bleibt jedoch, dass beide Konstruktionsarten trotzdem nicht nur in Anatolien , sondern im gesamten Vorderen Orient sowie in Mittel- und Südosteuropa zu finden sind. Aufzwei Tondüsen (Sch 6781 ; Sch 6790; Taf. 3,f.c) sind Zeichen in Form einer römischen Drei erkennbar (Abb. 11 ). Dabei dürfte es sich nicht um Verzierungen sondern vielmehr um Markierungen handeln . Sie wurden bisher als "Besitzerzeichen" gedeutet163 , können jedoch auch praktische Merkmale wie Tonbeschaffenheit oder bestimmte Größenvarianten markieren, wie es von anderen Objektgruppen, wie zum Beispiel Gewichten 164 , bekam1t ist. Die einzige steinerne Düse der Sammlung besteht aus anthrazitfarbenem Glimmerschiefer (Sch 6779; Taf. 3b). Ihre äußere Oberfläche ist sehr gut poliert, wohingegen sich in ihrem Inneren Werkzeugspuren von der Herstellung beobachten lassen. Schleifspuren verlaufen zur Kanalöffnung hin und wurden nicht überarbeitet. Am recht scharfen Übergang von Tülle zu Luftkanal befindet sich eine konkave Wölbung, an die sich der in den Stein gebohrte Kanal anschließt. Nutzungsspuren oder Beschädigun-
163 Ebd. 16' Rahmstorf2006, 70 Abb. 10,18.2 1.22. 165 Müller-Karpe 1994, II 0. 166 Lamb 1936, PI. 23; Roden 1988, 70. 167 Müller-Karpe 1994, II 0.
gen lassen sich an diesem Stück nicht beobachten. Gleiches kann auch fiir den größten Teil der tönernen Düsen in der Sammlung geltend gemacht werden . Die zu beobachtenden Nutzungsspuren sind nur in wenigen Fällen tatsächlich ausgeprägt. Oft handelt es sich lediglich um leichtere Rußverflirbungen an den Luftaustrittsöffnungen . Verglasungen oder Deformationen sind nicht feststellbar und auch Spamnmgsrisse nur in einer geringen Anzahl von Fällen zu belegen. Es hat den Anschein , als hätten die erhaltenen Düsen aus Troja keiner intensiven Nutzung unterlegen . Auch von einem Gebrauch über einen längeren Zeitraum hinweg kann kaum ausgegangen werden. Die trojanischen Exemplare stammen aus den Schichten II , Ili und V. Viele können anband der Beifunde zu Werkstattarealen gezählt werden 165 Parallelen besitzen sie im Siedlungsmaterial von Poliochni , Raphina oder Thenni 166 Die dortigen Fundstücke datieren überwiegend in die zweite Stufe der frühen Bronzezeit. Auch in der zweiten Schicht von Karum Kanis befinden sich analoge Stücke innerhalb eines als Metallwerkstatt gedeuteten Areals 167. In Poros Katsambas auf Kreta konnte eine konische Düse wahrscheinlich in einer EM 1/EM HA-zeitlichen Metallwerkstatt168 innerhalb der Siedlung geborgen werden. Neben Schlacken befanden sich auch andere metallurgisch signifikante Gerätschaften in ihrer unmittelbaren Umgebung169. Weitere analoge Exemplare können von dem Frühbronzezeit I-zeitlichen Beycesultan, dem älterkarumzeitlichen Kültepe und Nor~untepe namhaft gemacht werden 170
• Ein Oberflächenfund aus Kanligel(it1 71 lässt sich zwar nicht genau datieren, dürfte jedoch ebenfalls der frühen Bronzezeit zuzuordnen sein, da er dem Exemplar aus Beycesultan formal am nächsten steht. Entsprechende Fundstücke von Alaca Höyük, Eskiyapar, Bogazkoy, ikiztepe oder Zincirli belegen zudem eine Nutzung dieser Geräte und damit auch der Befeuerungstechnik bis in die Eisenzeit hinein 172 . Ton- oder Steindüsen stammen in Anatolien und der östlichen Ägäis stets aus Siedlungen. Exemplare aus Grabfunden, wie sie im Schwarzmeerraum und Mitteleuropa vorliegen, sind im Untersuchungsgebiet unbekannt.
" ' Doonan et. Al. 2007, 104. 169 Dimopoulou 1997; Doonan et.al. 2007, 110. 170 Müller-Karpe 1994, 198. 171 Özdogan/ Parzinger 20 12,224 Tab. 29 Fig. 180,13. m Roden 1988, 67; Müller-Karpe 1994, 109.
219
Geologische Karte der Biga Halbinsel
DQuarliir
• Quar!iire Vulkanite (Basalt)
~ T ertiiire Sedimente
~ Tertiiire Vulkanite(/\ndoxi t, l2llil Rhyosit , Tun)
~~~~1~~~ II ! Tertiiire Plutonite
D jurassisch-kretazische Kalke m:~~~y:,!i.~>f
~ Pennisch- lria~sische ~."~P.i-""'<;1 ~ Sc:dimente + Vulkanite
~~~~ Glimmerschierer ~~'/X.:~ .I
D Pennisch- tria~sische
Ophiolithe
l ?~fjlvletmnOI1Jhite (Gneis, Amphibolit , Mannor)
Q Prii- Jurassische l'lutonite
J77J penno- karbonische '""-""''"'
0
''~ ~ 1\IJctHSCdillll!llle
Abb. 12: Geologische Karte derTroas . Verändert nach Knacke-Loy 1994, 37 Abb. 16.
Gussformen
Gussformen verschiedenster Prägung sind in der Ägäis weit verbreitet, obgleich Troja bisher die meisten Stücke erbracht hat. Sie können aus Stein , Ton und Metall bestehen, wobei die überwältigende Mehrheit der Stücke aus Stein gefertigt wurde. Dies g ilt sowohl für zweischalige als auch einschalige Formen. Da das eire perdure-Verfalu-en jedoch wahrscheinlich schon für die Stufe EH l belegt werden kann, muss wohl insgesamt von einer wesentlich größeren Menge an Tongussformen ausgegangen werden, welche sich nicht erhalten haben 173 .
Heinrich Schliemann konnte während seiner Ausgrabungen in Troja ca. 90 Gussformen bergen , die vielfach nur fragmentiert erhalten sind. Davon gelangten 57 Formen und Fragmente in die Berliner Sammlung174
. Erhalten sind heute noch 22 Exemplare bzw. Bruchstücke. Schliemanns Angaben zufolge sollen fast alle Formen aus Glimmerschiefer bestanden haben, wohingegen nur wenige aus Ton und eine einzige aus Granit gefertigt seim Eine Überprüfung dieser Aussage 176 bestätigte das von ihm gezeichnete Bild fast ausschließlich. Nur zwei Steingussformen (lnv. Nr. Sch 6728; Sch 6730; Taf. I Oa.b) wurden als aus grünlichem Gneis, bzw. weißem Kalkstein bestehend identifiziert und weichen damit geringfügig von der allgemein formulierten Ansprache ab. Einige weitere Formen (Sch 6737; Sch 6738; Sch 6739; Taf. 9b.c; 14d) bestehen aus Tonschiefer bzw. Tonglimmerschiefer, was eine Spezifizierung darstellt, Schliemanns Angaben jedoch nicht widerspricht. Für das Exemplar Sch 6759 (Taf. Sb) wies Sclm1idt außerdem Tuffstein als Fertigungsmaterial aus m Die überwiegende Nutzung des Rohstoffes Schiefer verwundert nicht, ist er doch leicht zu bearbeiten,
173 Muhty 1973, 77. 174 Schmidt 1902, 265-268. 175 Schliemann 188 1, 482.
220
Abb. 13: Charakteristi sche Herstellungsspuren an Gussform Sch 6730. Foto B. Nesse l.
weist ausgezeichnete Spalt- sowie günstige Wärmeleiteigenschaften auf und ist in der unmittelbaren Umgebung Trojas anstehend. Im Hinterland der Siedlung befinden sich leicht zugängliche Vorkommen von phelagischem Schiefer, Glimmerschiefer, Kalkstein, Metasandstein, Serpentinit, Ophiolit, Metaquarzit, Basalt, Gneis, Amphibolit, Tonsteinen und Grauwacken (Abb. 12)178
• Glimmerschiefer wurde nicht nur in der Troas als bevorzugtes Material für die Herstellung von Gussformen gewählt, er scheint vielmehr in der gesamten Ägäis das beliebteste Material zu diesem Zweck gewesen zu sein, gefolgt von Steatit. Dieser ist als Material für
176 Durchgeftihrt durch Grit Jahn, damals Institut ftir Geophysik, TU Berlin , der ich an dieser Stelle sehr herzlich ftir ihr Engagement danken möchte.
177 Schmidt 1902, 266 Nr. 6759. 178 Weber 2003, 13 f. ; Bergmann/ Lippmann 2003 , 36- 37.
Abb. 14: Sägespuren an den Längsseiten der Gussformen Sch 6765 und Sch 6767. Foto B. Nessel.
Abb. 15: Charakteristische Sägemuster kupferner Sägen. Versuch B. Nesse l 20 I 0 unter Verwendung von Speckstein.
Gussformen aufgrund seiner hohen thermischen Belastbarkeit bei nur sehr minimaler Schrumpfung ebenfalls äußerst gut geeignet179•
Auch Sandstein ist als Ausgangsmaterial präsent, was ebenfalls seinen guten Bearbeitungseigenschaften zuzusclu-eiben ist 180
•
Die Anfertigung der Gussformen gehört zu den gut bekannten und leicht zu rekonstruierenden Vorgängen der Werkzeugherstellung. Bei fast allen Formen der Trojanischen Sammlung sind besonders an den Seitenkanten deutliche Herstellungsspuren zu erkennen. Es handelt sich überwiegend um Werkzeugspuren, welche von der abschließenden Formgebung der Stücke stammen. Wahrscheinli ch wurden Meißelmit flacher oder lanzettförmiger Schneide zur groben Formgebung der Steinquader genutzt. Neben metallenen Werkzeugen kommen dafür und zur Einarbeitung der Negative auch Obsidianklingen in Betracht181
• Eine abschließende Politur der äußeren Oberflächen wurde bei keiner der Formen durchgeführt. Lediglich die Innenseiten, auf denen sich die Negative befinden, sind in entsprechender Weise überarbeitet. Bei den zweischaligen Formen ist dies obligatorisch, damit die Hälften passgenau zusammen gefiigt werden konnten, doch auch bei den offenen Herdgussformen ist dies regelhaft.
179 Konstantinidi-Syvridi/Kontaki 2009, 3 14. 180 Muhly 1973 , 78; ßranigan 1974, 78. 181 Muhly 1973 , 78. 182 Nesse l 20 I 0.
Abb. 16: Belassene Stege von abgebrochenem Material an Gussform Sch 6765. Foto B. Nessel.
Die Gussform Sch 6730 (Taf. lOb) zeigt auf einer ihrer Seiten deutlich sichtbar die Herausarbeitung ihrer oberen und unteren Kantenbereiche, und musste dann mit Hilfe von Meißeln aus dem Block nur noch herausgebrochen werden (Abb. I 3). Im Gegensatz zu den übrigen Formen zeigen die Exemplare Sch 6765 (Taf. 12b) und Sch 6767 (Taf. 6d) keine Meißel- , sondern Sägespuren an ihren äußeren Längskanten (Abb . 14). Sie äußern sich in zahlreichen feinen Schnittlinien, die mehrere Richtungswechsel während des Sägeprozesses bezeugen. Die entsprechenden Fertigungsspuren sind nahezu identisch mit experimentell belegten Sägemustern an Speckstein (Abb. 15)182, was die Nutzung von dünnen Sägeblättern mit ungerichteter Zahnung aus Kupfer oder Stein wahrscheinlich macht183 Unter den Bronzegeräten aus Troja befinden sich zwei gezähnte Klingen, die zu Sägemessern gehört haben dürften, von denen eine eindeutig frühbronzezeitlich (aus dem Schatzfund A), die andere hingegen keiner Schicht zuweisbar ist184
. Im Karpatenbecken sind entsprechende Sägeblätter aus Metall zahlreich belegt, datieren jedoch erst in die zweite Hälfte des 2. Jalu·tausends v. Ch.r. Da die Sägeteclmik in Anatolien und Vorderasien weit früher belegt werden kann 185
, steht
183 Nessel 2009. 184 Sch 6157und Sch 6608: vgl. Hänsel in diesem Band Taf. 5, 12-13. 185 Siehe dazu Rieth 1957.
221
,-
einer Nutzung entsprechender Werkzeuge bereits in der frühen Bronzezeit des kleinasiatischen Küstengebietes prinzipiell nichts entgegen. Überdies weisen beide Seiten der Form kleine Stege auf (Abb. 16), welche von den Sägespuren lediglich umgeben sind. Dort war ein weiteres Sägen des Materials nicht erforderlich, da der gewünschte Steinquader vom Ausgangsmaterial mühelos ausgebrochen werden konnte. Schliemann gibt an, die meisten Gussformen aus Troja würden auf all ihren Flächen begonnene oder fertig gestellte Negative aufweisen 186. Gussformen die aus zwei Formschalen bestehen, sollen dabei stets nur eine bearbeitete Seite, niemals jedoch mehrere aufweisen 187. Anband der durch Schliemann und Sclm1idt vorgelegten, aber heute verschollenen Exemplare kann die Richtigkeit dieser Feststellung nicht unbedingt überprüft werden. Es hat sich gezeigt, dass mehrere Gussformen mehr als nur eine mit Negativen versehene Fläche aufweisen, jedoch bei Schliemann nur eine von diesen abgebildet ist. Bei den noch erhaltenen Exemplaren der Sammlung überwiegen jedoch trotzdem nur einseitig mit Negativen versehene Stücke. Dies liegt in erster Linie daran, dass es sich bei den meisten Formen um Stabbarren handelt, welche fast immer eine nur einseitige Flächennutzung aufweisen. Auf Vorder- und Rückseite mit Negativen versehene Gussformen bilden die zweithäufigste Gruppe. Sie tragen vor allem Matrizen zum Guss von Rund- bzw. Stabbarren und Beilen. Allerdings befinden sich auch seltener auftretende Negative zum Guss von T-förmigen Gegenständen bzw. Dolchen unter ihnen. Formen mit drei- oder mehrseitiger Flächennutzung sind dagegen weniger häufig vertreten. Sie weisen Negative für mehrere verschiedene Gegenstände auf. Neben Geräten wie Flachbeilen und -meißeln sind auch Negative für Messer und Barren zu erkennen. Die exakte und eng beieinander liegende Anordnung der Matrizen deutet auf eine bewusst angelegte und optimiert geplante Flächennutzung hin. In diesem Zusammenhang sind die erkemJbaren Umarbeitungen einiger Negativflächen von besonderem Interesse. Auf der Frontfläche von Gussform Sch 6728 (Taf. I Oa) sind zum Beispiel zwei parallel zueinander angebrachte Flachbeilnegative zu erkennen, welche anband der dunklen Verfärbungen zweifelsfrei als benutzt auszuweisen sind . Schräg über ihnen wurde jedoch nachträglich das Negativ eines kleineren Flachbeils angebracht. Entweder waren die ursprünglichen Negative durch eine wiederholte Nutzung in ihrem unteren (nicht melU' erhaltenen) Bereich unbrauchbar geworden, oder das kleinere Beilnegativ wurde nach dem Bruch der Form eingearbeitet, um ihre obere Hälfte weiterhin nutzten zu können. Auffällig ist dabei , dass die älteren beiden Negative besonders an den Kantenbereichen keinen sehr exakt ausgeformten Eindruck vermitteln. Sie sind durch eine gewisse Unschärfe gekennzeichnet, die von sehr kleinflächigen Materialausbtiichen herrührt. Diese sind sicherlich im Laufe ihrer Nutzung entstanden und bezeugen die mehrfache Verwendung der Form. Bei einigen Gussformen der Sammlung sind begonnene, ungenutzte Negative zu bemerken, die so schwach ausgeprägt sind, dass eine Identifikation des zu gießenden Gegenstandes kaum möglich ist. Dies gilt zum Beispiel für Gussform Sch 6727 (Taf. 6c), welche melU'ere nur halbfertige Negative zeigt , die eine Unterscheidung von Flachbeilund Meißel nicht zulassen.
186 Schliemann 1884, 189. 1s1 Ebd. 1ss Schliemann 188 1, 483. 189 Muhly 1973, 80. 190 Roden 1988, 70. 191 !V!uhly 1973, 79. 192 Z.B. Branigan 1974, 78. 193 Canby 1965, 53; Muhly 1973, 78.
222
Von den großen sechsseiti.g bearbeiteten Gussformen waren nur vier vollständige oder fast vollständige Exemplare erhalten 188. Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Stücke legte Schliemann auch die Vorgänge des GussverfalU'ens dar. Die Formen werden erst in der Glut des Feuers erhitzt und zur Stabilisierung in Sand eingebettet. Die in den Gusstiegeln geschmolzenen Rohmetalle können dann in die Eingusskanäle der Negative bzw. die Matrizen selbst gefüllt werden 189. Analogien zu den sechsseitig bearbeiteten Gussformen sind aus Poliochni, Beycesultan 190 oder Chalandriani bekannt, wo auch eine zeitgleich wirkende Werkstatt vermutet wird191. Allseitig bearbeitete Formen werden des Öfteren als Hinweis auf ein ausgeprägtes Spezialistentum im metallverarbeitenden Handwerk gedeutet bzw. als Indiz für ein Wanderhandwerkertum in der frühen Bronzezeit herangezogen192. Als Hauptargument dient die vollständige Ausnutzung aller Flächen, da so viele Negative wie möglich eingearbeitet werden, um nur eine Form transportieren zumüssen 193 Allerdings finden sich auch gegensätzliche Meinungen 19•. Unter den erhaltenen Stücken der trojanischen Sammlung sind nur zwei Gussformen (Sch 6754, Sch 6765; Taf. 7b; 12b) definitiv mit einer zweiten negativ gearbeiteten Formschale ausgestattet gewesen. Erwartungsgemäß befindet sich nur jeweils ein einziges Negativ auf der Formhälfte, welches zum Guss eines Flachbeiles bzw. einer Doppelaxt dient. Während der Ausgrabungen konnten jedoch vier oder sogar fünf zweischalige Gussformen für verschiedene Objekte geborgen werden 195. Insgesamt weisen mehrere Gussformen Passkerben (Sch 6754; Sch 6769; Taf. 7b; 4c) und Passlochbohrungen (Sch 6765; Sch 6777; Sch 6778; Taf. 12b; Taf. 4c.d.j) auf, welche weder in der Ägäis noch im übrigen Europa eine Seltenheit sind196
Regional bevorzugte Gusstechniken können für die frühe Bronzezeit Anatoliens bisher nicht überzeugend herausgearbeitet werden1 97. Lediglich eine gleichzeitige Nutzung einteiliger offener und meluteiliger abgedeckter Gussformen ist feststellbar 198. Die bereits in Troja I und Thermi I auftretenden offenen Gussformen werden in Schicht II- IV beider Fundorte durch geschlossene Formen ergänzt. Besonders Objekte mit elaboriertem Profil werden meist in geschlossenen Formen hergestellt199 . Der Erhaltungszustand der noch vorhandenen Gussformen in der trojanischen Sammlung ist unterschiedlich. Aussagen zur Fragmentierung der Stücke zu treffen, ist in einigen Fällen schwierig, da nicht sicher entschieden werden kann, ob sie auf Altbruch oder Kriegsschäden zurückzuführen ist . Älmlich verhält es sich zum Teil mit starken Rußspuren an den Seitenflächen der Formen, welche unter Umständen sowohl von einer intensiven Nutzung der Geräte, als auch von dem Brand des gelagerten Bestandes im Zweiten Weltkrieg stammen kö1mten.
Negative zum Guss von Flachbeilen und Meißeln Gussformem1egative für Beile und Meißel kommen in der Ägäis und in Anatolien am häufigsten vor200 . Auch unter den Matrizen der trojanischen Sammlung sind sie zahlreich vertreten. Insgesamt 18 Gussformen und Fragmente weisen eingearbeitete Negative für Flachbeile auf (Inv. Nr. 6725; Sch 6723 a.b; Sch 6724-6728; Sch 6731 - 6753/2 (Tr. 267); Sch 6733; Sch 6736-6739, Sch 6754; Sch 6760; Sch 6762; Sch 6766; XIb1264). Dabei ist festzuhalten, dass die Fragmente Sch 6737 und Sch 6739 Teile derselben Gussform sind (Abb. 17).
19' Z. B. Waalke-Meyer 2008, 160. 195 Müller- Karpe 1994, 146. 196 Muhly 1973, 8 1. 197 Ebd. 77 . 198 Gegen die Verwendung abgedeckter Herdgussformen in Anatolien: Klein
1992, 23 1. 199 Muhly 1973, 80.
Abb. 17: Zwei Fragmente derselben Gussform (Sch 6737 und 6739). Foto 8. Nesse l.
Ursprünglich müssen sich etwa 20 Gussformen mit F lachbeil- oder Meißelnegativen in der Trojanischen Sammlung befunden haben. Die drei fehlenden Exemplare (Sch 6760 ; Sch 6761; Sch 6763: Taf. 6a ; 12a; 4e) lagen Schmidt bei der Katalogisierung noch vor, müssen jedoch heute als verscho llen gelten. Ein weiteres Stück wurde von Schliemann publiziert, gelangte jedoch nicht nach Berlin (Taf. 4e)2° 1• Ein großer Teil der Stücke dürfte ursprünglich in Zusammenhang mit der zweiten Schicht Trojas gestanden haben , was jedoch nicht mehr exakt zu rekonstruieren ist. Lediglich drei Gussformen sind durch Schliemann bzw. Schmidt konkreten Schichten zugewiesen worden. Die Form Sch 6723a.b. entstammt Schicht II und ist abgesehen davon auch die einzige Form, für die Angaben zur genauen Fundstelle vorliegen . Die Exemplare Sch 6726 (Taf. II a) und eine weitere Formschale ohne erhaltene Inventarnummer datieren dagegen in die " drit
te verbrannte Stad/" 202 und damit in die zweite Schicht Trojas. Für alle übrigen Gussformen fallt eine zeitliche Einordnung schwer. Sie sind nur sehr summarisch der zwe iten bis fünften Ansiedlung zugesprochen worden und können kaum nachträglich chronologisch näher fixiert werden. Ein Charakteristikum der Gussformen mit Beil- bzw. Meißelnegativen ist ihre sehr effiziente Flächenausnutzung. Es handelt sich fast ausschließlich um all- oder zumindest mehrseitig bearbeitete Gussformen aus Glimmerschiefer. Meist sind die Formen mit einer maximal möglichen Anzahl an Negativen versehen. Beile und Meißel werden, wie auch Beile generell , oft
2oo Ebd. ; Miiller- Karpe 1994, 143. 2o1 Sch1iemann 188 1, 483 Nr. 600.
parallel, aber gegenläufig zueinander ausgerichtet (Abb. 18). Einzeln stehende Beil- oder Meißelnegative sind kaum auf einer Gussform zu finden. Sie treten fast immer zu mindestens zwei Exemplaren auf. Außer zwei Meißelnegativen an Gussform Sch 6727 (Taf. 6b) können alle entsprechenden Matrizen als genutzt ausgewiesen werden. Sie zeigen stets starke Rußrückstände sowie si lbrige Verfarbungen der Negativiimenräume und rissige Oberflächen. Die Nutzungsspuren sind stärker ausgeprägt als bei Negativen fiir andere Artefaktgruppen, weshalb walu-scheinlich von einer mehrfachen Nutzung der Matrizen ausgegangen werden kann. Die übrigen Partien der Formen sind kaum von Spuren einer Hitzeeinwirkung gekennzeichnet. Das monofaziale Stück Sch 6754 ist mit einer Abdeckplatte genutzt worden, da sich auf ihrer Schmalseite eine Passkerbe für ein Gegenstück befindet. Auch Schliemann vermutete bereits die Abdeckung der Formen mit einem "Deckstein"203 .
Zum Guss der Geräte sind wahrscheinlich ausschließlich Kupfer bzw. Kupferlegierungen verwandt worden. Beil- oder Meißelexemplare aus anderen Materialien sind aus dem bronzezeit lichen Anatolien oder der Ägäis nicht bekannt. Eine XRFOberflächenmessung innerhalb des Beilnegatives der Form Sch 6724 (Taf. 9a) ergab sowohl Kupfer als auch Zinnpartikel innerhalb des Negativs. Auf der Längsseite der Form, welche kein eingearbeitetes Negativ aufweist , fanden sich dagegen keine Hinweise auf Kupfer, sondern lediglich Rückstände von Zinnpartikeln.
2o2 Ebd., 482 Nr. 599; 483 Nr. 600. 20J Sch1iemann 1884, 189.
223
Abb. 18: Gegenläufige Ausrichtung zwei er Beilnegative zur optimalen Platzausnutzung. Foto B. Nessel.
Solche Gussformen sind im gesamten 3. Jalu·tausend v. Chr. und
auch danach zahlreich belegt und haben ein weites Verbreitungs
gebiet. Flachbeile bilden die typische Beilform Anatoliens im 3. Jalu·tausend v. Chr., sind bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. be
legt und bleiben auch im 2. Jalu·tausend v. Chr. in Gebrauch. Die
Gussformennegative Westanatoliens sind dabei länger und gra
ziler als jene Südostanatoliens204 . Es könnten zahlreiche analoge
Gussformen mit Flachbeilnegativen verschiedener Ausprägungen
und Längen zum Beispiel aus Kültepe, Arslantepe, Hac;:tbekta~ ,
Tarsus205 in Anatolien, jedoch ebenso von minoischen206, helladischen207 und balkano-karpatenländischen208 Fundplätzen ge
nannt werden . Ein einziges Flachbeilnegativ der Trojanischen Sammlung ist auf
der Hälfte einer Klappform überliefert. Es handelt sich dabei um
die aus Glimmerschiefer gefertigte Gussform Sch 6754 (Taf. 7b),
welche bis auf leichte Ausbrüche an den Kanten vollständig erhal
ten ist. Sie verfügt über eine horizontale Passkerbe an der unter
halb der Beilseimeide verlaufenden Querseite. Das Stück weist
sich durch seine zahlreichen Rußspuren innerhalb des Negativs
zweifellos als genutzt aus. Während Schliemann es seiner "drillen prähislorischen Sladl" zusprach209, wollte sich Schmidt nicht auf
eine Einordnung in eine bestimmte Schicht Trojas festlegen 210 .
Andere Klappformen der Ansiedlung stammen aus dem Kunsthandel211 und kötmen daher ebenfalls keine Hinweise auf eine
zeitliche Einordnung mehr liefern. Klappgussformen tragen ins
gesamt in Anatolien nicht besonders häufig Beilnegative. Analoge
Beispiele sind dennoch aus Beycesultan sowie Ali~ar bekannt, bilden jedoch auch andere Beiltypen ab212 . Ein Exemplar mit gleich
artiger Negativgestaltung ist unter den Klappgussformen bisher
nicht bekannt. Insgesamt ist diese Formenart allerdings weit ver
breitet und findet vor allem als Gießwerkzeug für Schmuck und kleinere Objekte häufig Verwendung.
2().1 Müller-Karpe 1994, 143. 2os Ebd. Taf. 22,6; 26, 1; 26,3; 27, 1; 28, 1; 3 1, 1. 206 Chalandriani und Mallia: Branigan 1974, 201. 2o1 Asketario : Branigan 1974, 20 1; Emporio: Hood et.al. 1982, PI. 137,38. 208 Verschiedene Fundorte nach Novotna 1970; Vulpe 1970; Dergacev 2002 . 209 Schliemann 188 1, 484 Nr. 60 I. 21o Schmidt 1902, 266 Nr. 6754. 211 Müller-Karpe 1994, 146.
224
Neben jenen zum Guss von Flachbeilen war im Fundmaterial
von Troja auch eine Gussform mit einem einzigen Negativ zur
Fertigung von Ärmchenbeilen enthalten (Taf. 4a). Die steineme
Herdgussform lag bereits bei iluer Auftindung nur noch fragmentiert vor213 , gelangte jedoch nicht in die Berliner Sammlung.
Insgesamt sind nur wenige Gussformen bekam1t, die ausschließ
lich zum Guss von Ärmchenbeilen bestimmt gewesen sind.
Meist finden sich entsprechende Matrizen in melu·seitig bearbei
teten Formen mit Negativen für verschiedene Objektgruppen214.
Mangels entsprechender Abbildungen kann zu den Abnutzungs
spuren nichts mehr ausgesagt werden. In Analogie zu den übri
gen Steingussformen Trojas ist jedoch von einer genutzten Form
auszugehen. Ärmchenbeile selbst sind eine sehr weit verbreitete Geräteform. Bronzene Exemplare sind von Zentral- über Süd
osteuropa bis in die Levante zu finden 215. Neben Troja erbrach
ten in Anatolien die Ausgrabungen in Kültepe, Beycesultan und
Ali~ar Gussformen mit derartigen Negativen216• Am älmlichsten
sieht dem trojanischen Negativ jedoch ein ebensolches auf einer
Gussform aus dem Hortfund von Mogilica bei Smoljan, welche
mit diversen weiteren Formen aufgefunden wurde217 (Abb. 19). Der durch Dörpfeld vorgenommenen zeitlichen Einordnung des
trojanischen Stückes in Schicht VII steht nichts entgegen, auch
wenn es sich bei den Ärmchenbeilen um einen sehr langlebigen
Objekttypus handelt. Die Mehrheit der Vergleichsfunde datiert in
mittel- bis spätbronzezeitliche Kontexte, wodurch, wie bei dem
trojanischen Fundstück, der Nutzungszeitraum in der zweiten
Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. liegt. Das älteste Exemplar aus
Beyc;:esultan bezeugt jedoch eine Handhabung und Herstellung der Geräte bereits im letzten Drittel des 3. Jahrtausends v. Clu.,
was durch ein noch etwas älteres Exemplar aus Nordsyrien, das
mit Chirbet-Kerak-Keramik vergesellschaftet war, bekräftigt
wird21 8.
212 Ebd. Taf. 37,2.6. 2u Götze 1902, 405. 214 Müller-Karpe 1994, 144. 215 Für Überblick zur Fundgruppe: Wesse 1990. 216 Buchholz/Drescher 1987, 56. 217 Wesse 1990, 235 Taf. 22,570. 218 Braidwood/Braidwood 1960, 373-375 Abb. 293 , I.
Abb.l9: Gussform fiir Ärmchenbeile aus dem Hortfund von Mogilica. Nach Wesse 1990, Taf. 22,570.
Negative zum Guss von Schaftlochäxten Nur eine einzige Gussform zum Guss von Schaftlochäxten kommt im Bestand der Sammlung vor. In Schliema1ms Veröffentlichungen findet sich auch kein Hinweis auf weitere, ursptünglich vorhandene Exemplare. Gleichzeitig handelt es sich um die einzige eintei lige Tongussform im Sammlungsbestand. Die aus hell rötlichem Ton bestehende Form Sch 6768a.b. (Taf. 8) ist fragmentarisch überliefert und zeigt einen Bruch im Schneidenbereich der Axt, so dass nur die Tonhülle des Schaftes mit dem Klingenansatz erhalten geblieben ist. Sie ist zum Guss in verlorener Form bestimmt, weist eine nur geringe Magerung mit wenigen größeren Einschlüssen auf und zeigt keine Nutzungsspuren. Offenbar wurde sie bereits bei ihrer Herstellung beschädigt2 19
, oder sie ist als Übungsstück zu betrachten, welches letztlich jedoch nicht zum Metallguss genutzt wurde. Leichte Verfärbungen durch Ruß sind
219 Hundt 1986, 144. 22o Götze 1902, 408. 221 Branigan 1974, 79; Maran 200 I, 277. "' Lamb 1936, 157-1 59 Abb. 32,21. 223 Cernych 1992, 54 ff. ; Primas 1996, 152 ff.; Batora 2003.
auf den äußeren Flächen der Form durchaus vorhanden. Auf der Innenfläche finden sie sich jedoch nur im Bereich des Schaftes. Allerdings gibt ihr unscheinbarer Charakter keine ausreichenden Hinweise auf die Ursachen ilu·er Entstehung. Die äußeren Flächen der Form waren mit einer feinen hellen Tonschlemmschicht überzogen, die in Resten noch zu erkennen ist. Heute ist die ursprünglich einteilige Form in zwei Hälften erhalten, da sie 1902 für die Bearbeitung des Fundstückes aufgesägt wurde, um Aussagen bezüglich des Negativs treffen zu können220
Das Negativ selbst ist exakt ausgeformt und wurde mit Hilfe eines Wachsmodelles gefertigt. Nachdem der Ton das Modell vollständig umschlossen hatte, wurde das Wachs ausgeschmolzen. Der Eingusskanal hat sich nicht erhalten. Er kann jedoch nicht über dem Rücken der Axt gelegen haben, was nur den Schluss zulässt, dass er sich am nicht erhaltenen Schneidenbereich der Gussform oder am unteren Ende des Schaftes befunden hat. Eine ähnliche Gussform für eine Schaftlochaxt mit zylindrischer Schaftröhre stanunt aus dem ftiih- bis mittelbronzezeitlichen Polioclmi221 .
Bei dieser wurde um das genutzte Waxmodell an allen Seiten ein deutlich dünnwandigerer Tonmantel gelegt. Der Materialüberhang ist entsprechend geringer, aber die Konstruktionsweise im Wesentlichen gleich. Weitere analoge Exemplare sind aus dem nahe gelegenen Thermi bekannt222
. Schaftlochäxte sind insgesamt eine Waffenform, die seit der ersten Hälfte des 3. Jalutausends v. Chr. im Balkanraum, bzw. in der "Circumpontic i\1etal/urgical Province"223 beheimatet ist (Abb. 20), in die neben dem Karpatenbecken und den Gebieten rund um das Schwarze Meer sowohl das nördliche Griechenland als auch Anatolien eingebunden wm·224
Ilue Anzahl ist in der Ägäis zu dieser ftühen Zeit vergleichsweise gering, was im Besonderen für einen Nachweis durch Gussformen gilt. Die deutliche Verbindung der Form zum balkan-pontischen Gebiet wird nicht zuletzt dadurch unterstrichen, dass sich im 3. und 2. Jahrtausend v. Clu·. südlich von Anatolien keine Belege für Tongussformen finden lassen . Ihre Nutzung entspricht nicht der üblichen Vorgehensweise des Zweistromlandes oder der Levante, wo stattdessen walu·scheinlich überwiegend die Technik des Sandgusses genutzt wurde. Ferner ist der mögliche Metalleinguss über die Beilseimeide eine Eingussvariante, welche im Donauraum bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. belegt ist225
, was ebenfalls auf eine Kontextualisierung unseres Stückes innerhalb der Funde des zircumpontischen Gebietes hindeutet. Allerdings ist auch der Beobachtung Hundts zuzustimmen, dass es sich um vorderorientalische Formelemente handelt, welche die karpatenländischen Axtformen formal beeinflussten, nicht umgekelu·t226 Ist die Form des trojanischen Stückes auch an südlichere Axttypen angelelu1t, so ist sie de1moch unter Anwendung zirkumpontischer Gießtechnik gefertigt worden. Wie aufgezeigt, kommen ähnlich angelegte Gussformen zumindest in geringer Anzahl in der nördlichen Ägäis vor, was allerdings nicht fiir analoge Exemplare der zu gießenden Schaftlochaxt gilt. Dies istjedoch nicht ungewölmlich, ist doch bereits daraufverwiesen worden, dass die Schaftlochäxte als Objektgruppe nur in ilu·en allgemeinen Charakteristika miteinander vergleichbar sind227• Dies kann auf die Formen zu ilu·er Herstellung übertragen werden. Typologisch würde die trojanische Axt den so genannten Nackenkammäxten am nächsten stehe11. Sie sind gekennzeiclmet durch eine starke Verlängerung des Nackenteils. Recht ähnliche Stücke liegen aus Kültepe, dem Bezirk Uzhorod, Ongartschin, Pfaffenberg, der Moldau und der Umgebung von Slatina vor (Abb. 21 )228
• Mit ilmen hat das trojanische Stück die ausgezogenen Nackenspitzen, die senkrechte
m Begemalm u. a. 2003, 145. 225 Primas 2007, 14. 226 Hundt 1986, 148. m Rahmstorf 20 I 0, 268. m Hundt 1986, 156 Nr. 35.37- 4 1. Abb. 10.
225
e25
.26 • e27
~
Abb. 20: Fundstellen von Gussformen aus Ton für Schaftlochäxte des 3. Jahrtausends v. Chr.: I Lebedi; 2. Persin; 3. Simferopol '; 4. Stanica Skacki bei Pjatigorsk; 5. llinskij ; 6. Urocisce Bickin-Buluk; 7. Prisib; 8. Krasnovka; 9. Lugansk; 10. Kramatorsk; II. Pokrovka; 12. Yeselaja Rosca; 13. Kalinovka; 14. Kalinovka; 15. Montesei di Serso; 16. Salzburg- Rainberg; 17. lg, Laibacher Moor; 18. Nagyvarpad; 19. Zok-Yarhegy; 20. Yinkovci; 21. Leliceni; 22. Yerchnjaja Maevka; 23 . Samara; 24. Konstantinovka; 25. Garni ; 26. Picori ; 27. Kjul Tepe; 28. Nor~untepe; 29. Troja; 30. Galgalati. Nicht kartiert: Velikent. Erstellt nach Kaiser 2005 und Primas 2007.
Nackenkontur und teilweise auch das abgewinkelte Schaftloch gemeinsam. Äxte vom Typ $ant-Dragomire~ti , welcher im nördlichen Siebenbürgen und der Karpatoukraine mit vereinzelten Exemplaren in der Slowakei und Ungam verbreitet ist, lassen sich als spätere Ausläufer der Erscheinung ebenfalls als typologisch nahe stehend ansprechen229 • Sie datieren in den Horizont Hajdusamson bzw. die späten Phasen der Otomani-, Wietenberg-, und Suciu-Kultur230 und damit in die erste Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. Aus der Datierung der genannten Vergleichsfunde ergibt sich eine insgesamt etwas frühere Zeitstellung fiir die südosteuropäischen Äxte, soll doch die trojanische Gussform Schicht VII der Ansiedlung entstammen23 1
, womit sie in das letzte Drittel des 2. Jalu-tausends v. Chr. zu stellen wäre. Bei einer relativen Gleichzeitigkeit der Gussform und der Äxte, wäre fiir die Tonform ein Herstellungszeitraum zwischen 1700 und 1200 v. Chr. anzunehmen. Lediglich das Exemplar aus Kültepe kann ebenfalls einem jüngeren Zeitrahmen zugeordnet werden232 • Aufgrund dieses zeitlichen Rahmens nahmen Götze und Deshayes eine Beeinflussung der vorderorientalischen Axttypen durch die chronologisch früher anzusetzenden karpatenländischen Exemplare an233 • Eventuell bildet die trojanische Gussform das bisher jüngste Indiz für eine extreme Langlebigkeit dieses speziellen, nicht häufig belegten Axttypus. Typologisch eindeutig karpatenländische Formen und daher formal etwas weiter entfernt vom trojanischen Stück, jedoch ebenfalls mit dornartigem, schaftabwärts verlängertem Fortsatz ausgestattet, sind die goldenen Äxte von Tufalau (C6falva) im Süden Rumäniens (Abb. 21 f.h.i,k). Sie datieren ebenfalls ins das erste Vierte l des 2. Jahrtausends v. Chr34.
229 Gänzlich gegen eine Herleitung der Form aus dem Karpatenraum: Hundt 1986, 148 und fvlüller-Karpe 1994, 155. Sie sehen ei ne typologische Verwandtschaft zwischen dem trojanischen Exemplar und orientalischen Vorbildern .
230 Vulpe 1970, 60; Novotna 1970, 30.
226
Bezieht man diesen Hortfund in die Überlegungen ein, kann letztlich nicht entschieden werden, ob es sich eher um eine Gussform zum Guss bronzener Äxte oder solcher aus anderen Materialien handelt. Aufgrund der zahlreichen Fertigprodukte im zirkumpontischen Raum kann einerseits davon ausgegangen werden, dass die Nutzung des Negatives zur Herstellung von Bronzeäxten angestrebt war. Die meisten bekannten Schaftlochäxte aus Edelmetall im Balkanraum und Mesopotamien gehören anderen Typengruppen an und liegen zudem in deutlicher Entfernung zum Umfeld Trojas235
. Andererseits zeigen die goldenen Äxte aus Tufälau, welches nicht sehr weit von Troja entfernt liegt, dass möglicher Weise auch mit einer Herstellung solcher Exemplare in Edelmetall gerechnet werden muss. Konkrete Indizien, die sich als Argumente für die Fertigung goldener Äxte in Troja heran ziehen ließen, fehlen bisher jedoch.
Negative zum Guss von Doppeläxten (Labrys) Gänzlich anders ist die einzige Form der Sammlung zum Guss einer Doppelaxt minoischen Typus gestaltet (Sch 6765; Taf.l 2b). Die Hälfte der zweischaligen Gussform liegt in leicht fragmentiertem Zustand vor und besteht aus grünlichem Glimmerschiefer mit recht hohem GlimmeranteiL Weitere Negative befinden sich nicht auf der Form. In der Mitte des Doppelaxtnegativs befindet sich die runde Vertiefung flir den Gusskern, welcher den Hohlraum des späteren Schaftloches ausspart. Die äußere Oberfläche der Formhälfte ist zwar geglättet, zeigt jedoch allseitig deutlich sichtbare Spuren von der Formgebung. Auf ilu-er Rückseite können Meißelspuren, auf der Unterseite (Standftäche) und beiden
231 Schmidt 1902,267; Götze I 902, 405. m Deshayes 1960, 222. 233 Götze 1902, 404; Deshayes 1960, 222. 234 Mozsolics 1965-66; Hansen 2001 ,50-5 1. m Siehe Primas 1996; Hansen 2001 , 11-35; Primas 2007.
a b
c d
=========~ e
f
~~ I ' h
- ----=0 g
J
k
Abb_ 21 : Schaftlochäxte mit dorna1iig verlängertem Schaftteil (o. M.): a Pfaffenberg; b Bez. Uzhorod; c Ongartschin; d Troja; e Umgebung von Slatina; fTufalau ; g Moldau; h Tufalau; i Tufalau; j "Slowakei"; k Tufalau; I Härma11. a nach Hund! 1986, Abb. I 0,3; b nach Hund! 1986, Abb. I 0,6; c nach Hund! 1986, Abb. I 0, 7; d nach Hund! 1986, Abb. II; e nach Hund! 1986, Abb. I 0,5; f nach Hansen 200 I , 50 Abb. 43; g nach Hansen 200 I, 50 Abb. 43 ; i nach Hansen 2001 , 50 Abb. 43;j nach Novotna 1970, Taf. 8,148; k nach Hansen 2001 , 50 Abb. 43 ; I nach Vulpe 1970, Taf. 15,236.
227
b)
Abb. 22 : Hälften von Gussformen zum Guss von Schaftlochtlochäxten (Labtys) aus Mallia (a) und Phaistos (b) . Nach Buchholz 1959, Taf. 13a.e.
Seitenflächen deutliche Sägespuren identifiziert werden. Zwei gebohrte Passlöcher befinden sich in bzw. kurz oberhalb der Unterkante der Form. In ihrem oberen Bereich sind dagegen keine Hinweise auf eine Fixierungshilfe fiir die zweite Formhälfte erkennbar. Nutzungsspuren in Form von weißlichen Rückständen durch Hitzeeinwirkung lassen sich sowohl innerhalb des Negativs als auch entlang der umgebenden Oberfläche feststellen. Ferner sind Rußspuren am linken Rand und dem oberen Abschluss des Formnegativs und auf der Passfläche zwischen beiden Formhälften zu erkennen. Leichte Risse auf der Negativoberfläche und dem Boden der F01m, welche ebenfalls auf starke Hitzeeinwirkung zurückzufuhren sind, konnten ebenfalls beobachtet werden. Die Gussform bezeugt die Beherrschung der Technik des Kastengusses. Sowohl die Form als auch das Negativ weisen insgesamt eine sehr sorgfältig gearbeitete Silhouette auf. Die erhaltene Formhälfte wiegt 933 g, weshalb die vollständige Gussform unter Berücksichtigung des einzusetzenden Gusskerns fiir das Schaftloch und der Verbindungsstifte etwas mehr als zwei Kilogramm gewogen haben dürfte. Das Gerät ist der vierten Schicht zugewiesen. Positive, die formal aus dieser Gussform hätten stammen können, sind in Troja mehrfach belegt. Schliemann erwähnt Exemplare aus der Schicht VF36, von denen eines nach Materialanalysen aus Kupfer mit einem Zinnanteil von weniger als einem Prozent besteht237. Es kann daher auch fiir unsere Form von einer Herstellung kupferner Gegenstände ausgegangen werden. Sowohl der zu gießende Axttypus als auch die Gussform haben kaum Vergleichsfi.mde in Inneren Anatoliens, da sie in der Tradition des ägäischen Formenkreises stehen. Lediglich entlang der kleinasiatischen Küste, in Kreta, dem griechischen Festland und Thrakien liegen entsprechende Funde vor238 .
Mehrere analoge Gussformen aus Steatit wurden in einer Metallwerkstatt innerhalb des Palastareals von Mallia zusammen mit anderen zweiteiligen Gussformen gefunden239
• Die Negative der früh- bis mittelbronzezeitlich datierenden Formen sehen unserem Exemplar sehr ähnlich, laufen jedoch zu den Schnei-
236 Schliematm 1881 , 676 Nr. 1429.1430. 237 Schmidt 1902, 246 Nr. 6135; vgl. hierzu Hänse1 in diesem Band. 238 Buchholz/Drescher 1987, 62 f.; Demakopoulou 1990, 240 f. 239 Buchholz 1959, 53 Taf. 13a.d; Branigan 1976, 79. " o Dayton 1978, 58 Fig. 7.
228
den hin nicht so spitz zu. Die Rückseite einer Form ist durch die Einarbeitung mehrerer Eingusskanäle geprägt, was sie als Gegenstück zu einer weiteren, nicht aufgefi.mdenen, Matrize ausweist (Abb. 22a)240 Eine ähnliche Gussformenhälfte aus Speckstein konnte in Phaistos geborgen werden. Sie lässt sich an den Beginn der mittleren Bronzezeit stellen und weist ebenfalls Eingusskanäle an ihrer Rückseite auf. Außerdem wurde aus Koumasa und Vasiliki auf Kreta jeweils eine entsprechende Gussform bekannt, die sich zeitlich jedoch nicht genau ansprechen lassen241. Sie sind aber ebenso der mittleren Bronzezeit zuzuschreiben. Auf dem griechischen Festland kann ferner eine fast identisch gestaltete zweischalige und vollständig erhaltene Schiefergussform für denselben Typ von Doppeläxten in Sesklo ausgemacht werden. Sie war dort mit graumynischer Ware vergesellschaftet und datiert in die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr.242. Eventuell lässt sich zusätzlich eine walu·scheinlich ähnlich datierende, jedoch formal etwas anders gestaltete Gussform mit Doppelaxtnegativ aus Phylakopi anführen. Das Stück ist deutlich weniger kastenförmig gearbeitet als die übrigen Vergleichsexemplare, und auch das Axtnegativ unterscheidet sich von den übrigen durch ein größeres ovales Schaftloch und eine schmalere Silhouette243 . Ein nur geringfügig jüngeres Fundstück (MM IBIII) als die bisher genannten Exemplare konnte jüngst auf der kleinasiatischen Insel Tav~an Adast geborgen werden . In ilu·em südlichen Teil wurden Überreste von Gebäuden eines Handwerkerviertels freigelegt , welche wahrscheinlich zwischen 2000 und 1700 v. Chr. bestanden haben . Vermutlich gehören sie zu einer minoischen Siedlung, die der Altpalastzeit Kretas angehörte. Neben Kamm·es-Ware, einem Keramikofen und Schnecken zur Purpurgewinnung fand sich auch eine steinerne Form zum Guss einer Doppelaxt minoischen Typs, die unserem Exemplar stark ähnelt244 . Für Gussformen mit verschieden ausgeprägten Doppelaxtnegativen ließen sich weitere Parallelen nennen, doch beschränken wir uns hier auf Stücke mit annähernd kongruenten Negativen.
"' Buchholz 1959, 53 f. 242 Ebd. 54. ; Dayton 1978, 157. 259. 430 Fig. 27/11. 243 Buchholz 1959, 54 Taf. 13b. "' http ://www.minoer.uni-halle.de/htmi/Kampagne20 11.html (Stand 20.0 1.2014);
Bertemes 2011 , 9.
Negative zum Guss von Dolchen Negative zum Guss von Dolchen lassen sich auf vier Gussformen der Sammlung (Inv. Nr. Xlb 1264; Sch 6726; Sch 6727; Sch 6755) beobachten . Gussform Sch 6755 (Taf. 4b) wurde, ebenso wie jene mit der Inventarnummer Sch 6726 (Taf. II a), durch Schliemann der "dritten verbrannten Stadt", also Schicht II Trojas zugewiesen . Zwei der Gussformen bestehen aus Glimmerschiefer, wohingegen ein Exemplar (Xlb 1264; Taf. 12a) aus Phyllit hergestellt wurde. Die Negative weisen unterschiedliche Konstruktionsmerkmale auf. Zum einen sind Stücke mit Griffangel zu beobachten, zum anderen Exemplare mit gerundetem Heft. Letztere gelten fiir Troja als charakteristische Dolchform der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr245 . Negative zum Guss von Dolchen mit gerundetem Heft , wie ein Exemplar, das Schliemann 1881 veröffentlichte246
(Taf. 4e), sind melu-fach in Troja selbst belegt wie auch auf Gussformen aus mittelbronzezeitlichen Fundkontexten in Lidar Höyük und Tarsus247
• Zumindest bei der Kalksteingussform aus Lidar Höyük ist eine Ansprache als Dolchnegativ nicht völlig gesichert, es könnte sich auch um eine Matrize fi.ir Lanzenspitzen handeln. Das Negativ einer anderen charakteristischen Dolchform des 3. Jahrtausends v. Chr. , des ,,zyprischen" Dolches, findet sich auf Gussform Sch 6726 (Taf. II a). Sie ist fast vollständig erhalten, wenn auch in zwei Teile gebrochen, und wurde in Troja "auf dem Turm" gefunden. Kennzeichnend fiir diesen Dolchtyp sind zwei kleine im oberen Drittel befindliche längliche Aussparungen, die sich im gegossenen Positiv als Löcher formieren. Eventuell war auch auf der Form 6725 (Taf. 7a) ein solches Negativ angebracht, was sich heute aufgrund von Materialausbrüchen im Heftbereich des Stückes nicht melu- sicher bestimmen lässt248 Die bronzenen Positive dieser Waffenart sind im gesamten ägäischen Raum in der fi"Lihen Bronzezeit stark vertreten. Auf den kykladischen Inseln und im Vorderen Orient sind Klingen mit geschlitztem Blatt eine verbreitete Waffenform in der frühen Bronzezeit. Die Mehrzahl der zyprischen Stücke datiert in die Stufe Early Cypriot III, was mit der Datierung der trojanischen Gussform hervorragend korrespondiert. Auch die Fundstücke des griechischen Raumes gehören in diesen Zeithorizont249
• Durch verschiedene Bearbeiter wurde auch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich bei vielen Fundstücken durchaus eher um Lanzenspitzen als um Dolche handeln kötme250
•
Gussformen fi.ir diese Art von Dolchen sind dagegen kaum belegt. Eine weitere Dolchform ist deutlich schwerer zu identifizieren, da die Negative auf den Gussformen mit den abschließend ausgeschmiedeten Dolchen in Länge, Proportion und Form meist nicht übereinstimmen. Die aus gräulich-bräunlichem Phyllit bestehende Gussform Xlb- 1264 (Taf. 12a) weist Negative flir drei kleine leicht gewölbte Dolche mit Mittelrippe auf. Die Mittelrippe erscheint hier nicht als wesentliches Element, um die Stücke als Dolclmegative und nicht als solche zum Guss von Messern anzusprechen, denn Mittelrippen sind auch als Merkmale von Lanzenspitzen belegt. Die Körperwölbung ist dagegen ein Merkmal, das von einsclmeidigen Messern bekannt ist . Da es sich hier jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls um zweisclmeidige Objekte handelt, liegt eine Ansprache als Dolchform durchaus im Bereich des Möglichen . Die Negative besitzen in Anatolien weder Gegenstücke auf andern Matrizen, noch sind sie als bronzene Fertigprodukte bekarmt. Am ehesten vergleichbar mit dem linksseitig in der Form befindlichen Stück ist noch die Klinge des Dolches mit Stierkopf aus Troja25 1•
24 ' Müller-Karpe 1994, 198 Taf. 16,6. ' '" Schliemann 1881 , 483 Nr. 600. 247 Müller-Karpe 1994, 145. "' Müller-Karpe (1994, 145) ftihrt beide Gussformenmit derartigen Negativen
an; m. E. kann dies jedoch nicht als sicher gelten. 24• Catling 1964, 57 Abb. 1- 2; Gerlaff 1993, 73. 25• Gerlaff 1993, 73; vgl. hierzu auch Hänsel in diesem Band.
Es ist wohl von einer mechanischen Umarbeitung der Stücke nach dem Gussvorgang auszugehen. Als erwähnenswertes Charakteristikum der Gussform ist ein Passloch an der oberen linken Ecke zu sehen. Seine Platzierung erscheint ungünstig, befindet es sich doch auf der Seite mit den Dolchnegativen innerhalb des Eingusskanals und auf der gegenüber liegenden Seite direkt innerhalb des Beilnegatives. Die ursprüngliche Inventarnummer der Form, welche aus den Trümmern des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Musetuns aufgesammelt wurde, katm heute nicht mehr rekonstruiert werden, weshalb auch ihr stratigraphischer bzw. chronologischer Datierungsansatz nicht mit Sicherheit angegeben werden kann. Anders verhält es sich dagegen mit Form Sch 6727 (Taf. 6b), welches gute Parallelen unter den bronzenen Fertigprodukten Trojas besitzt und dem entsprechend recht eindeutig in die zweite Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. zu stellen ist252
•
' Alle Gussformen weisen neben den Dolchnegativen mehrere andere Negative aufund dienten nicht ausschließlich zur Herstellung der Waffe. Die Matrizen befinden sich auf zwei- bis fiinfseitig bearbeiteten Gussformen, welche jeweils als einteilige Formschalen angelegt sind. Wie auch bei den anderen Exemplaren kann jedoch von einer unprofilierten Abdeckplatte als Gegenstück während des Gussvorganges ausgegangen werden. Negative fiir Dolche wurden meist mit anderen länglichen Objekten in eine Form eingesclmitten, was auf eine bewusst effektiv gestaltete Ausnutzung des bestehenden Platzes hindeutet. Dem entsprechend wurden sie häufig mit Fl achbeilen, Messern oder Stabbarren kombiniert. Zu Beginn der Dolchherstellung wurden die Stücke noch vielfach aus Arsenbronze hergestellt, was sich dann jedoch spätestens in der entwickelten Phase der Schicht Troja II endgültig zugunsten der Zinnbronze veränderte. Gussformen fiir die geläufigste Dolchform der frühbronzezeitlichen Ägäis und des kleinasiatischen Küstengebietes, den "klassischen" Dolch mit Mittelrippe, sind in der Sammlung nicht vorhanden. Allerdings konnten spätere Ausgrabungen in Troja zumindest eine solche Matrize hervorbringen253, die leicht mit exakten Parallelen, zum Beispiel aus Poros-Katsambas, verbunden werden kann254
•
Negative zum Guss von Messern Negative zum Guss von Messern sind selten auf anatolischen Gussformen vertreten. Aus Troja stammen ursprünglich fünf Gussformen mit entsprechenden Matrizen, von denen jedoch nur drei erhalten sind. Soweit bekannt, handelt es sich ausschließlich um Formen aus Schiefer. Da die Beschaffenheit der entsprechenden Stücke (Sch 6725 und Sch 6766; Taf. 7a; 12c) im Objektkatalog ausführlich behandelt wird, konzentrieren wir uns hier ganz auf die Negativformen. Zwei weitere Formen Sch 6756 und Sch 6757 (Taf. 4f) konnten noch durch Schmidt inventarisiert werden, müssen heute jedoch als verschollen gelten. Ihre Negative entsprechen der von Hänsel definierten Messerform mit geschwungenem Rücken und abgesetzter Zunge, die in den früh- bis mittelbronzezeitlichen Schichten Trojas recht häufig vorkommen255 . Es soll es sich bei den Gussformen um zweiteilige Exemplare gehandelt haben, wobei sicherlich eine Kombination von Formschale und Abdeckplatte gemeint ist. Überdies gibt Sclm1idt fi.ir beide Formen an, sie seien durch die Umarbeitung zerbrochener Gussformen mit anderen Negativen entstanden256
•
251 Sch 6151 , vg l. Hänsel in diesem Band Taf. 3,3 . '" Es handelt sich um Dolche mit schmaler Griffzuge. vgl. Hänsel in diesem
Band. m Biegen et. al. 1950, Fig. 221 ,38-110. 25-+ Datierung: ENIII ElvliiA (Doonan et. al. 2007, I 07 f.). 255 Vgl. Hänsel in diesem Band, Taf. 4,6- 12. 256 Schmidt 1902, 266 Nr. 6756 und 6757.
229
Die insgesamt drei gebogenen Negative auf den Formen Sch 6726 und 6725 (Taf. !Ia; 7a) können als Messer identifiziert werden. Die erstgenannte Matrize war zum Guss eines Messers "mit geradem Riicken und abgesetzter Zunge" bestimmt, die in Troja von Schicht li- V auftreten257 • Form Sch 6725 dagegen trägt ein Negativ zum Guss von "siche/fönnigen Messern mit kurzer Griffzunge", welche sich in die zweite Häfte des 2. Jahrtausends v. Chr. stellen lassen258
. Die Negative befinden sich auf fünf- bis sechsseitig bearbeiteten Gussformen, welche auch zum Guss von Flachbeilen, Dolchen oder Lanzenspitzen, Meißeln und Barren dienten. Auffallender Weise sind die Negative nur an sehr leicht zugänglichen Bereichen poliert, während sich an den Randbereichen eine nur grobe Formgebung beobachten lässt. Starke Gebrauchsspuren sind an allen Negativen sichtbar. Schliemann weist die Form 6726 seiner "dritten verbrannten Stadt" zu259
, wohingegen Schmidt sie nur allgemein der II.-V. Ansiedlung zuschlägt. Insgesalnt kann sie jedoch ohne Vorbehalt Schicht II zugeordnet werden. Entsprechungen für die trojanischen Stücke sind zumindest aus dem anatolischen Raum bisher nicht bekannt. Eine analoge Gussform für gebogene Messer stammt jedoch aus Phaistos. Sie besteht aus Schiefer, kann allerdings nicht exakt datiert werden. Branigan sprach diese Matrizen zwar als Sichelnegative an, allerdings entsprechen ihren Silhouetten durchaus den auf unseren Formen zu erkennenden Objekten260
• Eine ähnliche zeitliche Einordnung erfuhr Form Sch 6766 (Taf. 12, c). Schliemann schlug sie seiner "dritten verbrannten Stadt" zu26 1
, wohingegen Schmidt eine Datierung des Stückes in die VI. Ansiedlung vornahm262
• Einer Einordnung in die zweite Hälfte des 3. Jalutausends v. Clu-. steht jedoch nichts entgegen, obwohl auch die übrigen Negative auf den Formen mit Messernegativen oft sehr langlebige Typen bilden, weshalb sie als Anhaltspunkte für eine genauere Datierung ausfallen. Die fragmentierte Form Sch 6766, aus dunkelgrauem Glimmerschiefer ist dreiseitig bearbeitet und zeigt zwei Negative zum Guss von Messern mit geradem Rücken und abgesetzter Griffzunge. Zumindest in einem Fall sind die Nietlöcher bereits in der Matrize angelegt. Die Form ist in der trojanischen Sammlung das einzige Exemplar, welches ein solches Negativ trägt. Verglichen zu al len übrigen ist diese Form sehr grazil. Neben der Messennatrize sind solche zum Guss eines Rundbarrens, eines T-förmigen Gegenstandes und eines Flachbeils erkennbar. Die rückseitigen Negat ive (T-förmiger Gegenstand und Rundbarren) wurden wohl erst nachträglich eingearbeitet. Die Werkzeugspuren der groben Formgebung sind gut erkennbar, da keine der Flächen überarbeitet wurde. Nur das Negativ flir den T-förmigen Gegenstand ist sehr gut poliert, wohingegen in jenem zum Guss des Rundbarrens die groben Arbeitsspuren belassen wurden. Eventuell handelt es sich um eine nicht ganz vollendete Matrize. Die andere Formseite fallt durch eine in jeglicher Hinsicht sehr gut polierte Oberfläche auf. Innerhalb der Negative, besonders an ihren Randbereichen, sind deutliche Nutzungsspuren in Form von Hitzerissen und kleineren Materialausbrüchen feststellbar. Negative für nicht sicher zu identifizierende Objekte mit Griffange l, die sowohl zum Guss von Messern als auch Dolchen verwendet worden sein könnten, lassen sich an drei Gussformen (Sch 6731 - 6753/ 1 und Sch 6731 - 6753/2; Sch 6726) beobachten. Die ersten beiden zeigen Negative in üblicher Größe, wohingegen sie auf der letztgenannten Form deutlich verkleinert sind. Alle drei Exemplare wurden aus Glimmerschiefer gefertigt und gehören zu den melu-seitig bis allseitig mit Negativen versehenen Gussformen Trojas. Da die Form 6726 (Taf. II a) bereits bespro-
257 Vgl. Hänsel in diesem Band, Taf. 3,30.31 ; 4, 1- 5. 258 Vg l. Hänsel in diesem Band, Taf. 14- 15. 259 Schliemann 1881,482 Abb. 599. 260 Branigan 1974, 20 I. 261 Schliemann 1881 , 484 N r. 602; Miiller-Karpe 1994, 200.
230
chen wurde, konzentrieren wir uns hier auf die anderen beiden Stücke. Sie sind wie die meisten Exemplare fragmentiert überliefert und zeigen Spuren ihrer Herstellung an allen erhaltenen Seiten . Gussform Sch 6731 - 675311 (Taf. 5a) ist mindestens fünfseitig bearbeitet und weist Negative verschiedener Kategorien auf. Unter ilmen befinden sich Barren, Werkzeuge und Waffen. Die Innenfläche ist an allen Seiten nur leicht überarbeitet, weshalb alle Spuren der groben Formgebung deutlich erkennbar sind. In allen Negativen lassen sich dunkle Rußspuren beobachten, welche die Form klar als genutzt ausweisen. Die nur dreiseitig mit Negativen versehene Gussform Sch 6731 -6753/2 (Taf. !Oe) weist dagegen eine allseits gut geglättete und sorgfaltig bearbeitete Oberfläche auf, was sich sowoh l auf die Randbereiche der Form als auch auf die Innenräume der Negative bezieht. Spuren der Herstellung lassen sich vor allem an den nicht mit Negativen versehenen Kanten feststellen . Neben dem Stabbarren wurden Flachbei le und weitere Objekte wie Meißel in die Form eingearbeitet. Auch sie ist durch starke Rußspuren in den Negativen eindeutig als benutzt anzusehen. An ihren Bruchkanten kann festgestellt werden , dass die Hitze des einfließenden Metalls den Stein beijedem Negativ mindestens 0,5 cm durchgeglühte. Zahlreiche Hitzerisse und leichte Materialausbrüche sind besonders gut bei dem größeren der beiden Flachbeilnegative erkennbar. In den Randbereichen der Beilklinge können jedoch keine Verfärbungen erkannt werden . Eventuell verhinderte die Bildung von Luftblasen in der Fom1 während des Gießvorganges das Vordringen des flüssigen Metalls in die schmalen Eckbereiche. Eine genaue Datierung lässt sich fiir keine der drei Formen beibringen . Lediglich Form 6726 wurde nachträglich in die zweite Schicht Trojas eingeordnet263 Analogien fiir das auf Form Nr. 6731-6752/2 zu erkennende Negativ eines Gegenstandes mit Griffangel oder-zungesind zum einen aus der Siedlung Kastri auf Syros bekmmt, wo eine zweiseitig bearbeitete Form aus Schiefer gefunden wurde, auf der sich ein ähnliches Negativ befindet. Dass Stück befand sich in einem Hauskontext, der einen Herd mit darin befindlichen Resten von Kupferschlacke aufwies. Zusätzlich lagen bronzene Fertigprodukte und Werkzeuge wie Sägen und Meißel sowie Obsidianklingen (eine mit Metallschlacke darauf), Steingeräte, ein Schmelztiegel sowie Ton- und Steingussformen in unmittelbarer Umgebung264
• Dazu kommt noch ein Gewichtsdepot in einer Mauernische265
• Die zeitliche Einordnung des Befundes in die Stufe Frühkykladisch II (2700- 2300 v. Chr.) legt eine ähnliche Datierung auch für das trojanische Stück nahe. In denselben Zeithorizont lässt sich auch das Fragment einer anderen Gussform mit analogem Negativ stellen. Die Schieferform aus Chalandriani trägt neben dem wahrscheinlichen Messernegativ mit abgerundeter Griffangel auch Matrizen für einen Meißel, ein Flachbeil, eine Pfeilspitze und offenbar einen Banen. Sie wurde mit drei weiteren Gussformen vergesellschaftet aufgefunden266
Bei allen genannten Objekten ist mit einen Guss von bronzenem Werkstoff in die Formen zu rechnen, da Fe1tigprodukte aus diesem Material in der Frühen Bronzezeit im westlichen Anatolien und dem gesamten ägäischen Raum weit verbreitet sind.
Negative zum Guss von Lanzenspitzen Wie envähnt sind Negativformen von geschlitzten Lanzenspitzen von jenen zum Guss von Dolchen nicht eindeutig unterscheidbar. Gerade wenn Gussformen nur fragmentiert überliefert sind, fallt eine sichere Identifikation oft schwer. Grundsätzlich könnte fast
262 Schmidt 1902, 267 Nr. 6766. 263 Miiller-Karpe 1994, Taf. 30. 264 Stampolidis/Sotirakopoulou 20 II , 54. 265 Kykladen 20 II , !5 1. 266 Branigan 1974, 79.20 I.
jedes hier als Dolchform angesprochene Negativ auch zum Guss einer Lanzenspitze gedient haben. Bei einer nicht in die Berliner Sammlung gelangten Gussform aus Troja (Taf. 4k) handelt es sich allerdings recht sicher um das Negativ einer Lanzenspitze267. Gleiches gi lt für eine weitere durch Schliemann entdeckte Form268
(Taf. 4b) sowie Exemplare aus den Ausgrabungen Blegens269. Letztere datieren bereits in die erste Schicht Trojas270 und stellen damit den frühesten Beleg flir das Vorkommen von Klappgussformen am Fundort dar. Die übrigen Stücke datieren jedoch in die zweite Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. Erhalten ist in der Trojanischen Sammlung eine Gussform mit einem Negativ zum Guss von Dolchen- oder Lanzenspitzen (Sch 6726; Taf. I Ia) , welche keiner exakten Schicht bzw. Siedlungsphase melu zugeordnet werden kann, obwohl sie typologisch betrachtet durchaus der zweiten Schicht zugeschrieben werden köm1te. Sie besteht aus Glimmerschiefer und kann als einteilig genutzte oder mit einer Abdeckplatte versehene Herdgussform angesprochen werden, die zwar weitgehend vollständig, jedoch in zwei Teile gebrochen, ist. Die fünfseitig bearbeitete Gussform weist neben der Lanzenspitze auch Negative fiir mehrere Flachbeile, einen Meißel und einen Rundbarren auf. Abgesehen von zahlreichen Herstellungsmarken können zudem starke Nutzungsspuren innerhalb aller Negative, einschließlich Risse auf der Oberfläche, beobachtet werden. Aufgrund der in Troja II, in der Ägäis und dem westanatolischen Küstengebiet bereits allseits verwendeten Zinnbronze kann von einer Nutzung dieses Materials zum Guss der Lanzenspitzen ausgegangen werden . Möglich ist auch eine Herstellung aus Arsenbronze. Aus dem westanatolischen Raum ist eine analoge Gussform aus Bozüyük bekannt, die ebenfalls Troja li-zeitlichen Fundzusammenhängen zuzuordnen ist. Andere Gussformen zum Guss von Lanzenspitzen stammen aus Tepeyik und Göksuncuk Köyü'7 r.
Negative zum Guss von Pfeilspitzen Zum Guss von Pfeilspitzen lag in der Trojanischen Sammlung nur eine einzige Gussform (Sch 6773 ; Taf. 4h) vor, die jedoch verschollen ist. Sie trug mindestes vier nebeneinander liegende Negative zum Guss von lindenblattförmigen Dornpfeilspitzen mit Mittelrippe und datiert entweder ins späte 3. oder frühe 2. Jahrtausend v. Chr. Pfeilspitzen dieser Form sind mir aus Troja selbst nicht bekannt. Zu Material und Herstellungs- oder Nutzungsspuren können mangels detaillierter Beschreibungen keinerlei Angaben gemacht werden. Es ist lediglich erkennbar, dass der Einguss vom Dorn her erfolgt sein muss und es sich wahrscheinlich um kupfernen oder bronzenen Werkstoff gehandelt haben wird. Analoge Gussformexemplare sind im anatolischen und ägäischen Raum bisher unbekannt. Selbst entsprechende Positive können kaum benannt werden. Einzig einige wenige Exemplare aus Grabfunden von Mykene lassen sich als nahe stehend, jedoch typologisch auch nicht exakt übereinstimmend bezeichnen. Sie datieren in die Stufe SH III B272 und sind damit deutlich jünger als es fiir die trojanische Matrize angenommen wird. Auch die bei Catling angefiihrten Pfeilspitzen dieses Types aus Kamilaris sind wenigstens mittelbronzezeitlich, wenn nicht gar jünger273 . Generell handelt es sich bei den bronzezeitlichen Pfeilspitzen Anatoliens um eine nur wenig untersuchte Objektgruppe. Daher muss die Datierung der trojanischen Gussform zukünftig, nach Vorlage neuer Pfeilspitzenfunde, sicherlich erneut geprüft werden.
267 Schliemann 1884, 189 f. Nr. 85. 26s Ebd. 633 Nr. 1267. 269 Biegen et. al. 1950, Taf. 150; 22 1. " " Miiller-Karpe 1994, 150. 271 Ebd.
Negativ zum Guss von Tüllenbeilen Eine weitere Gussformenhälfte der Sammlung war zum Guss eines Tüllenbeiles bestimmt. Sie ist heute verschollen, kann jedoch anband der durch Schmidt vorgelegten Abbildung274 noch beschrieben werden. Die Matrize Sch 6769 (Taf. 4c) ist Teil einer zweiteiligen Gussform und besteht aus grünem Stein, wobei es sich in Analogie zu den übrigen Stücken walu·scheinlich ebenfalls um Glimmerschiefer gehandelt haben. Die Formschale ist fast vollständig überliefert, lediglich eine Ecke im Seimeidenbereich ist ausgebrochen. Es handelt sich um die Hälfte einer Klappform , weshalb das Negativ die gesamte Schale ausfüllt. Die Anlage mindestens eines Passloches auf der linken Formseite und die zu erkennenden Passkerben auf der äußeren Oberfläche der rechten Formseite bilden zusätzliche technische Attribute dieser Gussformenart Das zu gießende Tüllenbeil verfUgt über
- eine runde oder ovale Tüllenform mit einem horizontal gerippten Tüllenrand, an den sich linksseitig eine Öse anschließt. Unterhalb der Rippung verläuft ein dünnes ebenfalls horizontal angelegtes Band, welches aus einer in entgegen gesetzter Richtung verlaufender Musterung aus scluäg gestellten, parallelen Linien gebildet wird . Im Seitenteil des Beilkörpers unterhalb der Öse und wahrscheinlich auch auf der gegenüber liegenden Seite sind schräge vertikal angeordnete Linien zu bemerken, welche jedoch einen wenig exakt angelegten Eindruck vermitteln und unterschiedlich lang sind. Da die Abbildung der Form perspektivisch leicht verzerrt ist und zudem anband einer älteren Fotographie erstellt wurde, kann zur Homogenität der genannten Elemente auf beiden Seiten der Formhälfte nichts ausgesagt werden. Gleiches gilt auch bezüglich etwaiger Herstellungs- bzw. Nutzungsspuren an der Gussform. Das Stück stammt aus Schicht VII und gehört damit bereits in die zwei te Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. Bronzene Tüllenbeile bilden in Anatolien eine Fremdfonn, die in erster Linie im Karpalen-Balkanraum beheimatet ist und dort auch weit früher als in Troja belegt werden kann. Auch das vorliegende Negativ deutet anband seiner typologischen Merkmale eher in dieses Gebiet, wo Tüllenbeile besonders im 2. Jahrtausend v. Chr. flächendeckend auftreten und nur in wenigen Exemplaren in den äußersten Nordwesten Anatoliens vordringen
konnten275•
Wenig überraschend ließ sich keine exakt übereinstimmende Parallele mit dem trojanischem Exemplar finden. Da die Tüllenbeile in Südosteuropa im Allgemeinen nur vergleichsweise selten zu typologisch identischen Stücken an verschiedenen Fundorten vorliegen, sollten die Gestaltung des Randes und die Existenz der Öse als Hauptmerkmale zur Analogiesuche dienen. Matrizen mit horizontal geripptem Rand und einer sich anschließenden vertikalen Rippe, sind besonders aus dem nord- und südwestlichen Bulgarien bekannt, wo diese Gestaltungsform der Tüllenbeile auch ursprünglich beheimatet ist . Dort befinden sich fast alle bronzenen Beile mit entsprechenden Charakteristika und auch der größte Teil der analogen Gussformen ist dort zu finden. Allerdings sind entsprechende Negative auch in diesem Gebiet nicht häufig belegt. Matrizen mit vergleichbarer Randgestaltung und Form stammen aus Lesicevo, Soko! und der Umgebung von Chotnica (Abb. 23b). Ein weiteres Exemplar ist aus der nördlichen Moldau bekannt, und befindet sich damit in deutlicher Entfernung zum Kernverbreitungsgebiet Es handelt sich sowohl bei diesen Gussformennegativen, als auch bei den etwas später datierenden Parallelen aus Bulgarien und Südrumänien um
272 Avila 1983 , 107 Taf. 27,730. m Cat ling 1964, 20. m Schmidt 1902, 267 Nr. 6769; Rekonstruktion des Beiles bei Götze 1902, 405
Abb. 405. m Miiller-Karpe 1994, 150.
231
Abb. 23: Gussformen mit Tüllenbeilnegativen aus Roman (a) und der Umgebung von Chotnica (b). Nach Wanzek 1989, Taf. 46,1b.7.
urnenfelderzeitliche Stücke276 , was mit dem zeitlichen Ansatz für die trojanische Gussform gut vereinbar ist. Auch die räumliche Nähe der bulgarischen Funde zu Troja stellt einen Bezug der Gussform zur südlichen Balkanregion her.
Negative zum Guss von Ohrringen Auf Gussform Sch 6774 (Taf. 4j) sind Negative für verschiedene Schmuckelemente angebracht. Sie besteht aus einem leichten, schwarzen, kristallinen Tuff. Ursprünglich als vollständig erhaltene Hälfte einer zweiteiligen Gussform aufgefunden277
, ist sie heute so stark fragmentiert , dass nur etwas weniger als die Hälfte erhalten ist (Abb. 24). Das Exemplar ist nur einseitig bearbeitet, und abgesehen von den Olm·ingen findet sich nur noch der Rest eines Negativs für einen nicht zu identifizierenden Gegenstand an einer der Bruchkanten. Auf der rückseitigen Oberfläche des frontal sehr gut geglätteten Stückes befu1den sich deutliche Spuren der Herstellung. Hinweise auf ilu·e Nutzung sind dagegen nicht, bzw. nicht melu· feststellbar, da keine Verfärbungen durch Hitzeeinwirkung auf der Oberfläche erkmmt werden können. Schmidt ging bei seiner Neuvorlage des Stückes von Negativen für "zwei dreieckige Anhänger mit nadelartigen Enden" aus278 • Inzwischen lässt sich jedoch begründet argumentieren, dass es sich um Negative zum Guss von Perlen und Ohrringen handelt. Denn obwohl dies anband des erhaltenen Gussformrestes selbst nicht mehr nachvollzogen werden kann, stellt der noch vorhandene Teil des einzelnen Schaftnegatives keinen Anhänger oder eine Nadelform dar279. Miiller-Karpe beftirwortete zumindest bei einigen derartigen Objekten sie tatsächlich als Nadeln und nicht als Ohrringe anzusehen, da sie nach dem Guss sicher nicht alle umgearbeitet worden seien280. Dem ist allerdings unter Berücksichtigung der anatolischen, ägäischen und balkanischen Nadelformen kaum zuzustimmen, da sich nicht einmal annähernd vergleichbare Exemplare finden lassen28 1. Die zumindest formal ähnlicheren Stücke aus dem mesopotamischen Bereich sind zudem ausnahmslos aus dünnem Goldblech geschmiedef82, weshalb sie als direkte Vergleichsobjektenicht zulässig sind.
276 Wanzek 1989, 122. m Schliemann 1881 ,282. m Schmidt 1902, 268. 279 Die Originalzeichnung bei Schliemann zeigt jedoch die ursprünglich intakt
aufgefundene Formschale mit ihren Negativen (Schliemann 1881 , 282 Fig. 103).
280 l'v!üller-Karpe 1994, 152. 281 Keine Übereinstimmung mit den abgebildeten Funden bei Kilian-Dirlmeier
1984; Klein 1992; Vasic 2003 oder Schalk 2008.
232
Ein Negativ dürfte zum Guss von Ohrringen mit triangulärer, fünffach gerippter Kopfplatte angebracht worden sein. Es zeigt einen triangulären Kopf, der durch vier Rippen gekennzeichnet ist und von einem quer zu diesen liegenden Balken abgegrenzt wird. Nach dem Guss vrorden diese Schmuckstücke durch mechanische Bearbeitung so geformt, dass eine eng an die gerippten Ohrringe des westanatolischen Raumes angeleimte Form entstand (Abb. 25). Goldene Exemplare dieses Typus sind aus dem ,,Schatz des Primnos", dem ebenfalls Troja Ir-zeitlichen Schatz von Poliochni und den EB III-Schichten aus Tarsus bekannt283 . Die trojanische Gussform ist durch die verschiedenen Bearbeiter der Sammlung zeitlich unterschiedlich eingeordnet worden. Während Schliemarm sie seiner "ersten prähistorischen Stadt" zuwies, datierte Schmidt die Form in die deutlich späteren Schichten VII-IX284 . Müller-Karpe stellte sie chronologisch nach Troja I oder II und favorisierte damit erneut eine frühe Zeitstellung285 .
Analoge Negative zum Guss von Ohrringen, befinden sich meist auf größeren flachen Gussformen zum Guss zahlreicher kleiner Schmuckobjekte. Da deren gegossene Positive im Fundkontext oft vor allem aus Gold oder Blei bestehen286
, muss unter Berücksichtigung der ausschließlich goldenen Positive auch ftir die Ohrringmatrizen eine Verwendung mit diesem Material und nicht unbedingt aus Kupfer oder Bronze in Erwägung gezogen werden. Schmuckgießformen ähnlicher Art und Anlage können im ägäischen, anatolischen und mesopotamischen Großraum insgesamt häufiger beobachtet werden287. Exemplare mit ähnlichen Negativen, wobei kein einziges davon in vollständig gleicher Art wie das trojanische Stück gestaltet ist, sind jedoch im Gegensatz dazu eher selten. Zwei Gussformen aus dunklem Steatit zeigen gleichartige oder zumindest ähnliche Negative. Allerdings sind die Fundumstände der Stücke nicht gesichert. Zumindest eines von ihnen könnte jedoch aus der Region um lzmir stammen, da es dort käuflich erworben wurde288. Alle diese Exemplare verfügen über eine große Anzahl an Negativen, sind i!U'e übrigen Charakteristika betreffend jedoch ähnlich gestaltet wie das trojanische Fundstück. Clu·onologisch sind die Vergleichsfunde wahrscheinlich an das Ende der Frühbronzezeit zu stellen, wie auch vergleichbare Gussformen in Troja selbst. Ein weiteres Stück mit einem ähnlichen, wenn auch nicht identischen Negativ stammt aus Sippar im südlichen Irak (Abb. 26a). Es wird zwischen 2200 und 1900 v. Chr. angesetzf89
, was wiederum einen zeitlich jüngeren Horizont markiert. Das zweite Negativ der Form 6774 soll in erster Linie in Analogie zu dem bisher Gesagten als OluTing betrachtet werden. Es handelt sich um einen gleichartig strukturierten Gegenstand, welcher jedoch eine insgesamt rechteckige Kopfplatte mit spitzen Zipfeln an allen vier Ecken und einer mittig angebrachten, wahrscheinlich flintfachen Rippung aufweist. Entsprechende Fertigprodukte sind im anatolischen Raum und den angrenzenden Gebieten bisher nicht bekannt geworden. Dies muss jedoch nicht verwundern, bleiben doch einige der elaboriet1en Objekte der zweiten Schicht Trojas bisher ohne exakte Parallelen. Allerdings lässt sich ein durchaus nahe stehendes Negativ auf der bereits erwähnten Gussform aus Sippar namhaft machen. Seine ebenfalls rechteckige Kopfplatte weist zwar insgesamt eher kleeblattartige Züge auf290, istjedoch prinzipiell ähnlich angelegt.
282 Siehe Königsgräber von Ur (Dayton 1978, 91 rechts oben). 283 Canby 1965, 44.; Katalog Moskau 1996, 134 f. ; Treister 2013 , 142- 145. "' V !I- IX Ansiedlung nach Schmidt 1902, 268. 285 Müller-Karpe 1994, 152. 286 Canby 1965, 43. 287 Siehe z. B. Buchholz/Karageorghi s 1971 , 258 Nr. 458-461; 259 Nr. 457.462. 2ss Canby 1965, 43.55. 289 Ebd. 51 - 52 (hier als ohne genauen Fundort ausgewiesen). 290 Ebd. PI. 9d (Mitte).
--
Abb. 24 : Gegenüberstellung des dokumentierten Auffi ndungszustandes und des noch erha ltenen Teil s der Gussform Sch 6774.
c
Abb. 25: Gussform 6774 (a) mit graphischer Darste llung des Ohrringnegatives (b) und entsprechenden goldenen Fertigprodukten aus den Schatzfunden von Troja (c). a Foto B. Nessel; b Zeichnung D. Greinert ; c nach Treister 1996, 60 Nr. 35; 64 Nr. 45.
a b c Abb. 26: Gussformen zur Herstellung von Schmuckstücken und Idolen aus Sippar (a) und lzmir (b) mit graphischer Darste llung zwei er Ohrringnegative (c) . a.c nach Canby 1965, PI. 9d; II ,5.6, b nach Müller-Karpe 1994, Taf. 60, 14.
233
Nach der Abbildung des Stückes in intaktem Zustand (Abb. 24a), ist das Negativ mit einem vergleichsweise ausladenden Eingusskanal ausgestattet. Allerdings scheint es sich dabei nicht um ein funktional besonders relevantes Merkmal zu handeln. Die meisten Eingusskanäle anatolischer Gussformen, einschließlich jene der übrigen Negative dieser Form, sind dagegen recht klein .
Negative zum Guss von Perlen Auf der eben erwälmten Gussform Sch 6774 (Taf. 4j) befindet sich auch ein Negativ zum Guss von Perlen. Soweit nachvollzogen werden kann, handelt es sich um die einzige Form in der Trojanischen Sammlung, die mit einem Perlennegativ versehen ist. Das Negativ ist als eigenständige, allein stehende Matrize neben den beiden Ohrringnegativen angelegt und dient der Herstellung nur einer einzigen unverzierten Perle. Durch ihre kugelige Form und die unspezifische Ausprägung kann sie sicherlich als einfachste unter den zahlreichen Perlenformen des anatolischen bzw. ägäischen Raumes betrachtet werden . Gerade die trojanischen Schätze und typologisch vergleichbare Exemplare anderer Fundorte verweisen auf ein breites Perlenrepertoire von kugeligen über gerippte, rhombische oder auch vielgliedrige Perlen. Wie bei den meisten dieser Stücke, kann auch fiir das Perlennegativ der trojanischen Form von einer Fertigung aus edlem Metall , wahrscheinlich Gold, ausgegangen werden. Zwar wurden bestimmte Schmuckobjekte auch bevorzugt in Blei gegossen, und bleierne Perlen treten in Anatolien seit dem 7. Jahrtausend v. Chr. immer wieder auf, doch dürfte es sich dabei wahrscheinlich überwiegend um mechanisch geformte und nicht um gegossene Perlen handeln. Die Anlage zu nur einer einzigen Perle erscheint eher ungewöhnlich, sind doch alle übrigen bekannten Negative entsprechender Objekte auf den Formen stets zu mehreren, mindestens jedoch zu zweien nebeneinander angelegt und durch einen durchgehenden Kanal miteinander verbunden. Dieser Kanal dient als Raum für den waagerecht einzulegenden Kemhalter, welcher fiir den Erhalt der Durchlochung im Inneren der Perle sorgt, während das einströmende Metall das übrige Formennegativ ausfiillt. Auf diese Art konnten bei einzelnen Gussvorgängen gleich meluere der kleinen Objekte gegossen werden, was zeitlich und ökonomisch betrachtet eine Optimierung des Gussprozesses bedeutet. Ausreichend Raum zur Anlage mehrerer Perlennegative hätte sich auf der Gussformhälfte sicherlich geboten, weshalb die Einarbeitung nur eines einzigen Perlennegatives nur auf individuelle Gründe des Herstellers zurückgefiihrt werden kann . Möglicherweise können zwei weitere mndliche und eine dreieckige Vertiefung auf der Form ebenfalls als etwaige Perlennegative angesprochen werden. In diesem Fall würden sich die zugehörigen Kanäle und Negativhälften auf der zweiten, nicht erhaltenen Hälfte der Gussform befinden. Wie erwälmt, ist die Form wahrscheinlich bereits in der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. hergestellt worden und kann daher als die älteste Gussform mit Perlennegativen gelten291•
Vergleichbare Matrizen finden sich in erster Linie auf den rechteckigen Schmuckgussformen, die bereits genannt wurden. Als Beispiele fiir Formen, die unter anderem zum Guss von verzierten und unverzierten Perlen hergestellt wurden, können weitere Fundstücke aus Troja selbst292 und A9ana293 angefülu·t werden. Sie datieren allerdings deutlich jünger und sind bereits ins 2. Jalu·tausend v. Clu·. zu stellen. Eine weitere Form, die möglicherweise
'" Müller-Karpe 1994, 151. 292 Siehe Sch 6772 und Biegen et. al. 1958, 124 Taf. 220. 293 Müller-Karpe 1994, 213 Taf. 52 ,2- 3.
" ' Götze 1902, 420. 295 Schmidt 1902, 268 No. 6772. 296 Biegen et. al. 1958, 124 Taf. 220.
234
das Negativ zum Guss einer größeren Perle mit senkrecht einzuführendem Kernhalter trägt, stammt aus Milet, ist jedoch bereits dem 7. Jahrhundert v. Chr. zuzuschreiben. Sie kann hier lediglich als Anzeiger der Langlebigkeit entsprechender Sclunuckgussformen dienen. Die Ausrichtung des Kernhalters könnte eventuell ein chronologisch signifikantes Indiz darstellen . Möglicherweise bildet der horizontal einzulegende Kernhalter eine ftiihe Variante, die erst ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. durch den vertikal einzulegenden Kernhalter ergänzt wird. Dies müsste an einer hoffentlich steigenden Anzahl an entsprechenden Gussformen zukünftig noch geprüft werden.
Negative zum Guss von Ringen Ursprünglich befand sich in der Sammlung auch eine zweischalige Gussform Sch 6772 (Taf. 13b) fiir mehrere Ringe, Perlen und einen Anhänger, welche durch Götze vorgelegt294 und durch Schmidt erneut wieder gegeben wurde295
, inzwischen jedoch verschollen ist. Sie weist neben den Negativen fiir mindestens vier schlanke, geschlossene Ringlein und einem Anhänger auch noch solche zum Guss von mindestens vier verzierten Perlen auf. Da es sich jedoch nur um ein Fragment der Form handelt, kann die genaue Anzahl der Negative nicht bestimmt werden. Auffallend viele Gusskanäle durchziehen die Innenfläche der Form. Ihr geschwungener Verlauf ist bei Gussformen ftir Ringe allgemein üblich. Hinweise auf die Bearbeitung melu·erer Seiten der Form lassen sich nicht finden, was auch durch die weitgehende Negativfreiheit auf den Rück- und Seitenbereichen analoger Formen unterstützt wird. Aus welchem Material das Exemplar gefertigt wurde, ist nicht genau bekannt und wurde durch Sclm1idt nur mit "Stein" angegeben. Aussagen über den Grad der Abnutzung sind weder anband der Abbildungen noch anband der Beschreibungen in den genannten Werken möglich. Allerdings lassen sich keine extremen Nutzungsrückstände oder anhaftendes Metall bemerken. Die Negative scheinen vielmehr in tadellosem Zustand zu sein und keine offensichtlichen Gebrauchsspuren aufzuweisen . Sowohl die eingebrachten Negative als auch deren Erhaltungszustand bzw. jener der Form könnten durchaus auf eine Verwendung von Gold- und Silber als Gussmaterial hindeuten, zumal die zu gießenden Ringe und Perlen auch aus diesen Materialien belegt sind. Eine Datierung der Form in die VI. Ansiedlung durch Schmidt ist unumstritten. Vergleichbare Ringnegative kommen häufig auf Klappgussformen vor und sind neben Troja selbst296 zum Beispiel auch in den Ansiedlungen von Zincirli 297 oder <;:atal Höyük298 belegt. Obgleich Ringe aus verschiedenen Metallen zu den ältesten Metallobjekten überhaupt in Anatolien und dem ägäischen Raum zu zählen sind299
, gehören die herangezogenen Vergleichsfunde von Gussformen mit Ringnegativen eher jüngeren Perioden an . Der Fund aus Zincirli wird zwischen die Mitte des 8. und dem beginnenden 7. Jahrhundert v. Clu·. gestellt, jener aus <;:atal Höyük kann nicht genau datiert werden, hat jedoch seinen NutzungszeitTaum zwischen 1500 und 500 v. Clu300
. Die Zeitansätze beider Fundstücke weisen darauf hin, dass eine Datierung der trojanischen Form in die zweite Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. durchaus als waluscheinlich gelten kann. Negative ftir Ringlein auf den Gussformen sind meist mit solchen für zierliche Anhänger und Perlen verschiedenster Art vergesellschaftet. Für etwas größere, massive geschlossene Ringe ließen sich noch zahlreiche weitere Fundorte mit entsprechenden Guss-
"' Wartke 1980, 236 Nr. 19. 298 Mü ller-Karpe 1994, 213 Taf. 51 , 2. 299 Zu frühen Silberringen: Maran 2000; zu frühen Zinnringen: Lamp 1936,
171 - 172 Fig. 50, 30,24; Pernicka et. al. 1990. 300 Müller-Karpe 1994, 213.
formnegativen ausmachen, worauf hier jedoch verzichtet werden solP01
. Die Verschiedenartigkeit der Objekte wird durch die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gefertigten Nachgüsse aus Blei mehr als deutlich302
. Bemerkenswert an unserem trojanischen Exemplar wie auch an den aufgezeigten Analogien ist die durchgehend senkrechte Ausrichtung des Kernhalters. In der Mitte eines jeden Ringnegatives befindet sich eine kleine Vertiefung, in die der Kernhalter senkrecht eingelassen wurde und so beide Hälften der Gussform nicht nur passgenau aufeinander hielt, sondern auch den richtigen Abstand garantierte. Das Fehlen jeglicher Passkerben an allen Schmuckgussformen mit dieser Art der Kernhalterung ist sicherlich dadurch erklärbar. Die recht späte zeitliche Einordnung der Gussform und ihrer Parallelen stützt die erwähnte These einer chronologischen Signifikanz der Kernhalterstellung.
Negative zum Guss von Fingerringen bzw. Fingerringzargen Obwohl das unter diesem Punkt zu besprechende Negativ bei korrekter Funktionsbestimmung eigentlich ein Bestandteil von Ringnegativen ist, soll es hier gesondert behandelt werden, da es bisher nie als Matrize für einen derartigen Gegenstand angesprochen wurde. Alle bisherigen Bearbeiter wiesen es stets als nicht identifizierbar aus303
•
Gussform Sch 6729 (Taf. 4g) trägt neben dem Negativ ftir einen unbekannten rechteckigen Gegenstand mit Ornament auch ein ebensolches für ein deutlich kleineres ovales Objekt. Es weist eine in der durch Schliemann publizierten Zeichnung lediglich angedeutete äußere ovale Begrenzung auf, welche ein offenbar geringfügig abgetieftes inneres Ovalmit nach allen Seiten gleich bleibendem Abstand umgibt. Genauere Angaben zur Ausprägung beider Elemente sind anband der vorhandenen Beschreibungen nicht zu gewinnen. Vorausgesetzt das innere Oval ist gleichmäßig eingetieft und hat eine ebene oder leicht konkave Bodenfläche, könnte es sich dabei durchaus um ein Negativ zum Guss einer Siegelplatte oder Ringzarge zur Fassung von Schmuck- bzw. Siegelsteinen handeln. Einige Matrizen aus Steatit zur Herstellung kretisch-mykensicher Siegelringe zeigen Merkmale, die sich mit dem Negativ auf der trojanischen Gussform durchaus vergleichen lassen. Es handelt sich in der Regel um mindestens dreiteilige Steinformen, wobei in den meisten Fällen nur ein, maximal zwei Bestandteile dieser Formen erhalten sind. Passlöcher und Passkerben deuten stets auf die Komposition mehrerer Formteile hin. Das Herstellungsprinzip der Ringe in den Gussformen ist vergleichsweise komplex und bedingt exakt gearbeitete Gegenstücke. Dabei wird der Ringreif und die Siegel- oder Schmuckplatte des Ringes in der Gussform gegossen, nachdem deren einzelne Negativteile einander angepasst und an- bzw. aufeinander fixiert worden sind (Abb. 27). So entstandene Ringe können auch als Halb-304 und Fertigprodukte305
belegt werden, weshalb iLU'e herstellungstechnischen Aspekte gesichert sind . Nachdem der gegossene Ring nachbearbeitet wurde, kann dann der vorbereitete Schmuckstein auf der Platte eingefasst werden . Siegelringe mit Edelsteineinlagen sind zahlreich, unter anderem aus Mykene (siehe Abb. 29f), jedoch auch aus Troja bekannt. Gussformen ftir den Guss von Schmuck- und Siegelringen in einem Gussvorgang sind selten in der ägäischen Bronzezeit. Nur sieben Exemplare sind bisher bekannt, sie stammen aus Mallia, Poros, Enkomi sowie zwei unbekannten, wahrscheinlich jedoch
J01 Zusammenstellung der Fundstücke aus der älteren Literatur bei MüllerKarpe 1994, 151 f.; neu zusammengestellt unter Berücksichtigung der Ägäis bei Tournavitou 1997.
JO> Wartke 1980. 30J Schliemann 1881 , 633f. ; Schmidt 1902, 265 ; bei Müller-Karpe 1994, 198f.
nicht einmal als Negativ angesprochen. J04 Sakellarakis 1981 , 178 Abb. 28.
ägäischen Fundorten306 Auch aus Eleusis und Mykene (Abb. 28) sind Gussformen zum Guss von Schmuckringen mit ellipsoider Platte bekannt'07
• Die Halbschale aus Mykene trägt eine ellipsenförmige Vertiefung, die im Gegensatz zu den Negativen auf anderen Matrizen nicht ornamentiert ist. Abgesehen von diesen komplexen Formen zum zusammenhängenden Guss von Ringreif und Schmuckzarge bzw. -platte muss es jedoch auch Exemplare gegeben haben, wo beide Ringelemente separat gegossen und erst nach dem Guss miteineinader verbunden worden sind. Dies ergibt sich zumindest aus den herstellungstechnischen Analysen von ca. 30 Ringen aus verschiedenen Fundorten Griechenlands308
• Somit ist auch mit separaten, unverzierten Negativen für Schmuckplatten von Ringen zu rechnen, die jedoch wahrscheinlich größtenteils unerkannt geblieben sind. Neben der Möglichkeit, dass die auf der trojanischen Gussform befindliche ovale Eintiefung einen Teil einer drei- oder mehrteiligen Matrize zum Guss von Schmuckringen bildete, kann sie also ebenso auch als Matrize für eine separat gegossene Schmuckplatte bzw. Zarge eines Fingerringes genutzt worden sein . Die Lage des Negativs auf der Gussform Sch 6729 (Taf. 4g) weist es als sekundär hinzugefügt aus . Die Wahrscheinlichkeit, dass die Identifikation der Matrize tatsächlich das Negativ einer Ringschmuckplatte trägt, wird zusätzlich durch das Vorhandensein eines weiteren Exemplars einer für diesen Zweck hergestellten Matrize in Troja gesteigert. Die Ausgräber sprachen sie zwar als zum Guss von Ohrringen verwendet an309 (Abb. 29), doch die eingeschnittene Silhouette des Ringreifes sind ein klares Indiz dafür, dass es sich um Negative zum Guss von Fingerringen mit Schmuckplatte handelt310
. Damit ist die Herstellung von Schmuck- bzw. Siegelringen mit Gießformen, in denen Schmuckringe vollständig in einem Gussvorgang gefertigt werden konnten, in Troja sicher belegt. Unser Exemplar könnte daher durchaus als ein Produktionsmittel für die separate Herstellung von Schmuckzargen fUr Ringe gesehen werden . Ob wirklich alle Formen auch zur direkten Herstellung der Ringe aus Blei, Gold und Silber genutzt wurden oder eher der Fertigung wächserner Modelle von Ringen fiir das Wachsausschmelzverfalli'en mit tönernen Gussformen gedient haben, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden . Tonmatrizen für Siegel- bzw. Sclmmckringe sindjedoch eine ebenfalls sehr rare Objektgruppe. Eine Nutzung zum Guss von Fayence oder Glasringen ist ebenfalls vorgeschlagen worden3 11
.
Entsprechende Siegelringe lassen sich zwischen 1550 v. Chr. und 1 500 v. Chr. relativ zeitgleich auf ägyptischen und hethitischen Fundplätzen sowie in Ugarit nachweisen. Für den ägäischen Raum kallll ein Gebrauch erst einige Jahrhunderte später aufgezeigt werden, was zu einer clU'onologischen Diskrepanz zwischen der angeblichen Zeitstellung des trojanischen Stückes und seinen Parallelen fiihrt. Angenommen Schmidts Einordnung wäre korrekt, würde es sich selbst bei einer Zuordnung in die späteste Phase der Stufe Troja V immer noch um den frühesten Beleg zur Produktion von Siegelringen im östlichen Mittelmeer handeln. Da seine Zuordnung zur II .~V. Schicht Trojas jedoch eher auf fehlende Indizien zur tatsächlichen zeitlichen Stellung der Gussform hindeutet, ist wohl eine nicht ganz korrekte chronologische Einordnung des Stückes anzunehmen. Eine Zuordnung der Form zu Schicht VI oder VII des Fundplatzes ist unter Berücksichtigung der genmmten Parallelen deutlich walU'scheinlicher.
Jos Müller 2003 . J06 Sakellarakis 1981 , 173 . J07 Konstantinidi-Syvridi/Kontaki 2009, 312 f. Jos Müller 2003 , Nr. 992 und 993 aus Mykene und Nr. 8084 aus Perati . J09 Biegen et. al. 1958, 124 Fig. 220. J10 Sakellarakis 1981 , 173. Jll Ebd. 172.
235
6es 2 c m
Abb. 28: Form zum Guss einer Ringplatte aus Mykene. Nach Sakellarakis 1981 , 170Abb. 5; 6.
236
-: -:_~--- -==-::: :: - ---:.
I I I
Abb. 27: Hypothetische Rekonstruktion der Nutzung des ovalen Negativs als Werkzeug zur Herstellung von Siegelringen unter beispieLhafter Verwendung mehrerer Gussformteile anderer Fundplätze. Graphik erstellt durch D. Greinert mit Vorlagen von Schliemann 1881 , 633 und KonstantinidiSyvridi/Kontaki 2009, 315.
Eine Behenschung und Nutzung dieser Gießtechnik darf walll'scheinlich an allen größeren administrativen Zentren des östlichen Mittelmeerraumes und angrenzender Gebiete in der späten Bronzezeit vermutet werden, da die Siegelnutzung dort ein verbindendes kulturelles Element darstellt. Umso erstaunlicher ist die Seltenheit der zugehörigen Gussformen. Während gegen Ende des 2. und dem Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. solche Stücke auch in Luristan belegt werden können, wurden Siegelringe in Mesopotamien überhaupt nicht verwendet.
Negative zum Guss von Anhängem Anhängerformen sind durch zwei Negative belegt, wovon sich eines auf der eben besprochenen mehrteiligen Form Sch 6772 (Taf.l3b) befindet, während der zweite, ziemlich große Anhänger das einzige Negativ einer Form ist (Sch 6771; Taf. 4d). Das kleinere der beiden Negative auf der erstgenannten Gussform ist ein Ringanhänger, dessen Größe und Ausprägung etwa mit jener der Ringlein übereinstimmt. Auch hier handelt es sich um einen zierlichen geschlossenen Ring. An seiner Seite ist jedoch ein dekorativer Fortsatz zu beobachten, der gedrehten Tex-
0 ·, •, ' . . .
a b
c d
e f
Abb. 29 Formen zum Guss von Ringzargen bzw. Siegelringen: a Eleusis, b Troja, c Mallia, d Enkomi, e Poros, fMykene. a.e.fnach Sakellarakis 1981, 171 ff. Abb. 9; 13; 14; 28; b Biegen et. al. 1950; c Sakellarakis 1981, 174 Abb. I 0-11 ; d Konstantinidi-Syvridi/Kontaki 2009, 313 Fig. 5.
tilien ähnelt und als gerippt beschrieben werden katm. Dieser längliche Fortsatz ist unter den bisher bekannten Negativen auf Gussformen des anatolischen Raumes einzigartig. Allerdings haben all diese Anhänger lediglich ilue strukturelle Anlage gemeinsam und gleichen sich nie exakt. Ihre Verzierung scheint nicht normiert gewesen zu sein und hält zahlreiche Varianten bereit, die fast alle ihres Gleichen noch suchen . Wenn auch keine exakten Parallelen zu finden sind, lassen sich doch nicht wenige ähnlich konzipierte Negativformen mit gleicher Zweckbestim-
312 Miiller-Karpe I 994, 2 I 5 Taf. 53,5.
mung und Herstellungsweise aufzeigen. So sind ringförmige Anhängernegative mit Fortsätzen in Form von zwei, drei bzw. vier aneinander hängenden Kügelchen an zwei Gussfonneo auf Ayana zu beobachten. Beide wurden in einer Palastwerkstatt der IV. Schicht des Fundortes geborgen und bestehen aus dunkelgrauem Steatit312 .
Form Sch 6771 aus Glimmerschiefer zeigt lediglich ein auf ganzer Fläche ornamentiertes Negativ für einen recht großen Ringanhänger. Die Gussform selbst ist nicht mehr in der Sammlung
237
Abb. 30: Gussform zum Guss von Anhängern aus A9ana. Nach Biegen et.al. 1958, Fig. 220,37-389.
enthalten. Ringnegative dieser Größe sind in Anatolien oft unverziert313 und wurden nicht nur als Anhänger oder Armringe, sondern auch als mögliche Pferdegeschirrteile angesprochen3 14
•
Während sich kleine Ringlein meist mit vielen anderen Negativen für Schmuckstücke auf Gussformenschalen finden lassen, kommen größere Ringanhänger des Öfteren als Einzelnegative auf Klappgussformen vor. Das genannte Exemplar zeigt links und rechts des Negativs auf der Innenfläche zwei Passlöcher zur exakten Befestigung der zweiten Formhälfte. Zu möglicherweise vorhandenen Passkerben an den äußeren Flächen der Form können keine Aussagen getroffen werden. Die bei Müller-Karpe als "Strichornamentik" ausgewiesene Verzierung ist in Anatolien ein zwar bekanntes jedoch nicht besonders häufig belegtes Element, und eine exakte Entsprechung zu unserem Fundstück kann bisher nicht aufgezeigt werden. Die Musterung lässt sich jedoch besser als Rippung ansprechen. Die meisten Ringe mit vergleichbaren strukturellen Einzelmerkmalen, wie etwa dem kugelig auslaufenden Schmuckfortsatz an einer Ringseite, sind deutlich kleiner als das trojanische Exemplar. Zu nennen wäre hier beispielsweise eine Gussform aus Zincirli mit einem Anhängernegativ in Ringform und le icht abstehendem abgerundetem Fortsatz.
3 13 Siehe z. B. Stücke aus Zincirli, Kültepe oder Tarsus; Müller-Karpe 1994, Taf. 39,6A; 53,4.5.3.
31-' Ebd. 151. 315 Müller-Karpe 1994, 150; Wanzek 1989, 122. 31 6 Müller-Karpe 1994, 143.
238
Ein formal noch ähnlicheres Negativ, welches jedoch zum Guss eines unverzierten Anhängers bestimmt war, lässt sich auf einer der genannten Formen aus A<;:ana beobachten . Dessen RingfOitsatz gleicht dem trojanischen Exemplar fast genau, wobei seine Oberfläche jedoch glatt ist (Abb. 30). Eine ähnliche Größe wie das trojanische Stück, wenn auch bei einem schlankeren Fottsatz mit Zick-Zack-Muster, weist das Negativ fiir einen Ringanhänger auf einer bereits melu"fach herangezogenen Gussform auf, die ebenfalls aus Troja stammt315
. Auch hier ist der Ring selbst jedoch unverziert. Für di e zu gießenden Objekte beider Gussformen kann eine Herstellung aus Gold oder Blei in Erwägung gezogen werden, da die feingliedrigen Gegenstände im anatolischen, ägäischen und mesopotamischen Raum in erster Linie aus diesen Materialien bestehen. Beide Formen aus Troja sind ins 2. Jahrtausend v. Chr. zu stellen. Form Sch 6771 ist durch Schliemann der IV. Schicht zugewiesen worden, wohingegen die Gussform Sch 6772 (Taf. 13b) in die VII. Ansiedlung gehört. Die zeitliche Stellung der Funde wird durch ihre Parallelen insgesamt bestätigt.
Negative zum Guss von RundbalTen Auf den Gussformen der Trojanischen Sammlung sind vor allem Matrizen für Rund- und Stabbarren feststellbar. Erstere sind auf melu als 30 Gussformen in Anatolien als Negative belegt, wobei viele davon in das 3. Jahrtausend v. Chr. datieren. Die sechs noch in der Sammlung vorhandenen Formen mit Rundbarrennegativen (Sch 6725; Sch 6730; Sch 6731 - 6753/ l ; Sch 6766; Sch 6767) zeichnen sich, verglichen zu analogen Fundstücken, durch die Besonderheit aus, dass keine von ihnen nur das Rundbarrennegativ trägt. Vielmehr handelt es sich stets um ein Negativ unter mehreren. Unter iluen Vergleichsformen, welche vor a llem aus Zentralanatolien stammen (Abb. 31 ), sind dagegen auch einzig für die Herstellung von Rundbarren angefertigte Stücke vorhanden. Die Gussform Sch 6725 (Taf. 7a) weist neben einer Matrize fiir den "klassischen" Rundbarren noch ein deutlich kleineres, rundliches Negativ auf, das offenbar durch einen trapezförmigen bis plankonvexen Querschnitt geprägt ist. Form 6730 (Taf. I Ob) ist durch das Negativ eines durchschnittlich großen Rundbarrens und eines zweiten mit rechteckigem Fortsatz gekennzeichnet. Offenbar dienten speziell diese Barren als vorgefertigtes Rohmaterial zum Treiben von Blechgefäßen3 16
• Das Rundbarrennegat iv der Form Sch 6725 weist zusätzlich bereits in der Form angelegte, sternförmig angeordnete Ritzlinien auf, welche sich leicht erhaben auf dem gegossenen Barren abzeichneten. Solche Ritzlinien können bei sieben weiteren Gussfomen mit Rundbarrennegativen in Anatolien beobachtet werden. Bei dem trojanischen Stück handelt es sich um ein sternförmiges Ornament, während sich im übrigen Anatolien vor allem kreuzförmige Ritzungen in den Gussformen finden lassen31 7 (siehe Abb. 31). Die kreuzförmigen Ritzlinien sind weitgehend an Negative zur Herstellung von Silberbarren gebunden und datieren alle ins späte 3. und frühe 2. Jahrtausend v. Chr. Entsprechende Gussformen lassen sich auch in östlicher und südlicher gelegenen Regionen finden. Analoge Fundstücke stammen zum Beispiel aus Ali~ar Höyük II, Tepe Gawra VI und Chagar Bazar31 8 Weitere Gussformen mit Rundbarrennegativen mit und ohne Markierung fanden sich zum Beispiel in Kültepe, Ha<;:tbecta~, Bogazköy oder Malatya-AJslantepe319.
317 Entsprechende Fundstücke stammen aus Kültepe, Tarsus und Malatya-Arslantepe (ebd. 142) .
318 Buchholz 1987, 16; Müller-Karpe 1994, Taf. 33, 1. 319 Müller-Karpe 1994, 202 Taf. 27, 1; 202f. Taf. 28,1; 204 Taf. 32,2; 202
Taf. 26, 1.
0
8 .7 • •9
10. .2
3
Abb. 31: Fundstellen von Gussformen mit Rundbarrennegati ven (schwarz): I Troja; 2 Kültepe; 3 Tarsus; 4 Malatya- Arslantepe; Rundbarren als Produkt (rot): 5 ikiztepe; 6 Vezirköprii- Gölköy; 7 Ma~at; 8 Bogazköy; 9 Ali~ar; I 0 Hac1bekta~; II Akcadag; 12 Li dar Höyiik. Umgearbeitet nach Miiller-Karpe 1994, 142 Abb. 96.
Sternförmige Markierungen wie an unserem Exemplar werden primär mit der Herstellung von Bronzebarren in Verbindung gebracht320, weshalb in diesem Fall die Verarbeitung von Kupfer oder Bronze angenommen werden darf. Die Kombination der Rundbarrennegative mit solchen für Flachbeile, Meißel und Stabbarren ist öfter zu beobachten, kann jedoch nicht als regelhaft bezeichnet werden. Fast alle Rundbarrennegative zeigen, sofem erkennbar, Verfarbungen und Rissbildungen auf der Oberfläche, die sie als genutzt ausweisen. Einzig bei Exemplar Sch 6727 (Taf. 6c) handelt es sich wahrscheinlich um ein noch unvollendetes Negativ. Es ist auffallend flach in die Oberfläche gearbeitet und weist zudem einen vergleichsweise unebenen lnnemaum auf. Es verwundert daher kaum, dass entsprechende Abnutzungsspuren fehlen . Eine weitere durch Schliemann vorgelegte Gussform fiir mehrere Gegenstände, unter denen sich auch ein Negativ fiir Rundbarren befindee2
', gelangte nicht in die Berliner Sammlung (Taf. 4e) . Die meisten Gussformen mit Rundbarrennegativen aus Troja können nicht eindeutig einer Schicht zugeordnet werden. Nach einer Revision der Angaben Schliemanns322 wird heute mehrheitlich eine Einordnung i11 die II.-V. Schicht angegeben, welche letztlich einen Zeitraum von 700 Jahren umfasst (2600- 1700 v. Chr.) und daher nur bedingt aussagekräftig ist. Gussform 6766 (Taf. 12c) und das verschollene Exemplar wies Schliemann als der "dritten verbrannten Stadt" und damit Schicht li zugehörig aus323 • Form Sch 6767 (Taf. 6c) soll aus der Schicht VI stammen, womit ein Beleg für die Nutzung der Negativformen auch noch am Ende des 2. Jahrtausends v. Clu. gegeben wäre. Auch eine Gussform aus Kültepe, auf der das Negativ eines Rundbarrens mit einem Ärmchenbeil vergesellschaftet ist, zeigt die Nutzung der Barrenform noch zur Kanunzeit324
•
320 Ebd. 141 Tab. I ; 142. ' " Schliemann 188 1, 483 Nr. 600. m Die Schichtenzuordnung Schliemanns ist dem Katalog zu entnehmen. m Schliemann 188 1, 383 Nr, 6766; Müller-Karpe 1994, 200 Taf. 20,7.8.
Negative zum Guss von Stabbarren Ursprünglich befanden sich mindestens elf Gussformen mit Negativen für Stabbarren in der Trojanischen Sammlung. Inzwischen sind nur noch acht Exemplare vorhanden (Tr. 8, Sch 6726, Sch 6739, Sch 6758, Sch 6762, Sch 6767, Sch 6725 , Sch 6731-6753, Sch 6759), von denen jedoch nur noch sieben den Schmidt' schen lnventamummern zugeordnet werden können. Die Formen haben verschiedenartige Konstruktionsmerkmale und bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Aufgrund der Objektfragmentierung kann nicht immer mit Sicherheit entschieden werden, ob es sich um das Negativ eines Stabmeißels oder eines Stabbarren handelt325
.
Drei Gussformen (Sch 6758; Tr. 8; Sch 6762; Taf. 13a.c. d) wurden aus Wandscherben von Pithoi gearbeitet, welche auf diese Art sekundär genutzt werden konnten . Eine weitere Form kann heute unter der Nummer Sch 6761 nicht mehr aufgefunden werden. Das Material der Stücke ist in selu ähnlicher Weise ausgeprägt. Es handelt sich um ein rötliches Ton- Sandgemisch, welches wahrscheinlich unter starkem Hitzeeinfluss grob miteinander verbacken ist. Seine grobe Magerung besteht aus Quarzsand und weist viele mittelgroße und größere Gesteinspartikel auf. Aufgrund der groben Machart, des Wölbungsgrades der "Scherben" und ihres starken Durchmessers kommen dafür nur sehr große Vorratsgefaße, also Pithoi, in Frage. Die Sekundärverwendung großer Pithoischerben ist nicht ungewöhnlich und zum Beispiel aus Schicht JII von Troja in Gruben des Werkstatt-Gebäudes "Haus 300" belegt. Dort wurden die Stücke auch als Wandverkleidung für schüsselförmige Feuergruben genutzt. Sie dienten dort ferner als flache Herdplatten zur längeren Erhaltung der Glut und stehen damit in direktem Zusammenhang mit der Metallverarbeitung vor Ort326
• Generell scheinen Negative für Stabbarren in der Ägäis oder Vorderasien häufiger sekundär aus Keramiken gearbeitet worden zu sein.
m Müller-Karpe 1994, 204 Taf. 33, I . 325 Siehe Angaben im Katalog bei Nummern: Sch 6725, Sch 673 1- 6753,
Sch 6759. 326 Müller-Karpe 1994, 46.
239
Abb. 32: Gussform fiir Barren aus Emporio. Nach Hood et.al.l982, Taf. 130 (oben); 628 Fig. 284 (unten).
Die in Troja fast immer parallel angeordneten Barrennegative sind sich auf den ersten Blick selu- ähnlich. Bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass sie manuell mit unterschiedlicher Sorgfalt und Präzision in die Formen gearbeitet wurden. Gerade die Ausformung der Barrenenden variiert in Form und Tiefe teilweise erheblich, da die Randbereiche mal deutlich und mal weniger deutlich ausgeprägt sind. Dem entsprechend kann auch das Gewicht der fertigen Barren kaum identisch und daher nicht exakt normiert gewesen sein . Die Gewichte können maximal innerhalb einer gewissen Spanne gelegen haben (siehe Sch 6758), was durch Messungen auch bestätigt wurde327
. Diese keramischen Gussformen belegen die Herstellung zumindest eines Teils der Barren im offenen Herdguss. Die Mehrheit der Gussformen mit Stabbarrennegativen in Troja insgesamt besteht dagegen aus Schiefer. Von ilmen sind jedoch nur noch zwei Exemplare in der Sammlung enthalten. Eines von ihnen (Sch 6759; Taf. Sb) ist in ähnlicher Weise konstruiert wie die sekundär verwendeten Pithosscherben. Die Form zeigt vier Barrennegative auf ihrer flachen Seite, während sich auf der gerundeten Rückseite keine eingearbeiteten Negative finden lassen.
m Ebd. 137 f.
240
Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um die Hälfte einer zweiteiligen Gussform handelt, da die Negative hier nicht, wie bei den übrigen Stücken erkennbar, vollständig in die Mitte der Form eingearbeitet sind. Vielmehr schließen sie mit der Oberkante der Gussform ab, was einen zusätzlichen Eingusskanal überflüssig macht. Allerdings laufen die Negative nach unten hin spitz zu, was fiir Stabbarrenmatrizen ein ungewöhnliches Merkmal darstellt. Möglicher Weise handelt es sich hier um Negative fiir die metallene Rohform eines bestimmten Gegenstandes, der nach dem Guss durch mechanische Bearbeitung seine endgültige Form erhielt. Wie viele Negative sich auf einer einseitig bis zweiseitig genutzten Gussform befanden, ist offenbar von der Größe der Gussform abhängig gewesen und war nicht bereits vor ihrer Formgebung festgelegt. Die Anzahl der Negative auf den Gussformen fiir Stabbarren aus Troja variiert zwischen drei und neun pro Seite. Bei den melu·seitig bearbeiteten Formen mit Negativen verschiedener Kategorien sind dagegen oft nur ein oder zwei Negative fiir Stabbarren zu beobachten, deren Länge und Breite den Maßen der Form angepasst sind.
Stabbarren sind sowohl aus Bronze, wie auch aus Zinn und Blei oder in einem Fall sogar aus Elektron überliefert328. Es kommen demnach mehrere zum Guss genutzte Werkstoffe in Frage. Etwa ein Drittel der bekannten Stabbarrengussformen datiert ins 3. Jahrtausend v. Chr. , sie treten jedoch weitgehend unverändert auch im 2. und vereinzelt sogar noch im I. Jalutausend v. Chr. aufl29
• Eine genaue Datierung kann ftir die trojanischen Stücke nicht angegeben werden, und auch die Vergleichsfunde bringen eine zeitliche Eingrenzung des Materials nicht voran. Analoge Fundstücke zu den einfachen flachen Gussformen , welche ausschließlich Stabbarrennegative aufweisen, sind zahlreich belegt und stammen sowohl aus dem zentraleuropäischen wie auch dem vorderorientalischen Raum. Entsprechende Objekte aus Liman Tepe und Bakla Tepe liegen Troja am nächsten . Eine als tönerne Gussform für Stabbarren angesprochene frühbronzezeitliche Form vom <;:ucuriyi Höyük330 soll hier ebenfalls genannt werden, obwohl sie sich sowohl formal als auch herstellungstechnisch von den trojanischen Exemplaren unterscheidet. Ihre beidseitig eingearbeiteten Negative sind kantiger und gedrungener als die bisher bekannten Matrizen. Auch die Ergebnisse der metallkundliehen Untersuchungen331 an dem Objekt zeigen Widersprüche zur Deutung der Ausgräber auf. Trotzdem kann einer Ansprache des Gerätes als Gussform für Stabbarren vorerst nicht begründet widersprochen werden. Als weitere Parallele kann eine zweiseitig bearbeitete Gussform wahrscheinlich für Zinnbarren aus Göltepe, welche ins letzte Drittel des 3. Jalll'tausends v. Chr. datiert332 , genannt werden. Ein weiteres Exemplar aus der Mitte des 3. Jahrtausends v. ClU'. konnte auf Geoytepe geborgen werden. Es besteht aus Lehm und kann durch Fundstücke aus Kültepe, Baba Dervi~ , Karnut und Jrahovit IV ergänzt werden333 Der allseitige Bekanntheitsgrad der stabförmigen Barren und ilu·er Herstellung wird durch Funde in Ägypten und dem östlichen Mittelmeerraum bekräftigt. Stellvertretend sei hier nur auf eine analoge Gussform aus Khirbat Hamra Ifdan in Jordanien eingegangen, welche in Stratum III lokalisiert worden ist und somit der Frühen Bronzezeit III (2700 - 2200 BC) in der Region zugeordnet werden kann334
• Am Fundort wurden zahlreiche weitere Gussformen, Schlacken, Reste des Metallgusses, Steinwerkzeuge und pyrotechnische Installationen gefunden335 . Bemerkenswert ist außerdem ein Fundstück aus Emporio, welches möglicherweise sowohl als Gussform als auch als Schmelztiegel fungiert haben kötmte. An dessen Schmalseite lässt sich ein Stabbarrennegativ feststellen336 Auf der Frontseite ist ein ovales Negativ angebracht, welches entweder als Negativ für einen Barrenm oder eine auszuschmiedende Rohform gedeutet werden katm, jedoch auch zum Schmelzen von Metall genutzt worden sein könnte (Abb. 32). Analoge Exemplare zu den kompakten allseitig bearbeiteten Steingussformen mit melU"eren Kategorien von Negativen in Kombination mit Stabbarren kommen dagegen seltener zu Tage. Eine derartige Form aus Kalkstein stammt aus Stratum VI (spät) von Malatya-Arslantepe und ist damit an das Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. zu stellen338
• In denselben Zeitraum datiert auch ein Exemplar von Titri~ Höyük, welches neben mindestens einem Stabbarrennegativ auch ein solches fiir eine Lanzenspitze, einen unregelmäßig geformten Rundbarren und andere Objekte aufweist339. Eine weitere wahrscheinlich entsprechende Gussform ist aus Schicht IV von Hayibekta~340 bekannt. Die meisten Fundstücke dieser Art wurden jedoch in Troja geborgen.
328 Müller-Karpe 1994, 138. 329 Ebd. 139. JJO Horejs u. a. 20 I 0, Fig. 6. 331 Ebd. 365. 332 Yener/Vandiver 1993 ,22 1 Abb. 4 S. 2 16. JJJ Bobokhyan 20 I 0, 182 f. 334 Levy et. al. 2002, 428 . 335 Ebd. 430 Fig. 3. 336 Hood et. al. 1982, 627 Taf. 130.
Negative zum Guss nicht identifizierter Gegenstände Neben den nicht ganz sicher zu bestimmenden Negativen, sind auch Gussformen in der Sammlung enthalten, welche Matrizen fiir bisher unbekannte oder in ilu·er Funktionsbestimmung unklare Objekte aufweisen. Die wahrscheinlich mindestens zweiteilige Gussform Sch 6729 (Taf. 4g) beispielsweise trägt ein Negativ für einen rechteckigen, ornamentie11en Gegenstand, der weder unter den bekannten Negativen auf Gussformen des ägäischen und anatolischen Raumes, noch unter den Fertigprodukten aus Bunt- oder Edelmetall Parallelen besitzt. Das zu beobachtende Ornament besteht aus einem schmalen umlaufenden Rahmen mit einer gleichartigen mittig angebrachten und vertikal verlaufenden Linie. Im Zentrum des Rechteckes ist ein Oval angebracht, auf welchem ein mit der Spitze zu ihm orientiertes Dreieck steht. Bei ihrer Auftindung war die Form vollständig erhalten und soll aus Glimmerschiefer bestanden haben. Da das Stück heute verschollen ist, müssen weitere Angaben zu Herstellungs- und Nutzungsspuren entfallen. Bei dem länglichen Objekt könnte es sich sowohl um einen Barren als auch um einen blechartigen Gegenstand handeln. Die eigentliche Tiefe des Negativs und damit der Querschnitt des zu gießenden Stückes sind anband der durch Schliemann veröffentlichten Zeichnungen341 nicht genau erfassbar. Auch eine genauere Datierung der Form kann nicht gegeben werden. Zwei andere noch erhaltene Gussformen weisen Negative zum Guss T-fönniger Objekte auf, deren Verwendungszweck bisher nicht überzeugend hergeleitet werden konnte. Gussform Sch 6767 (Taf. 6d) wird bei Müller- Karpe als Fragment bezeichnet342 bzw. bei Schmidt als aus einer zerbrochenen Gussform hergestellt beschrieben343 . Der Grund dafiir erschließt sich jedoch nicht. Die Gussform weist an zwei Seiten eindeutige Bearbeitungsspuren durch Sägen auf, ist also bewusst dort abgeschlossen. Es dürfte sich den Spuren nach bei beiden Seiten um dasselbe Werkzeug gehandelt haben . An den übrigen beiden Kanten befinden sich Abplatzungen und Ausbrüche, ansonsten jedoch natürliche oder bewusst hergestellte Endflächen des Steines (Abb. 33). Müller-Karpe besclu·eibt den T-fönnigen Gegenstand und den Stabbaren als Sekundärnegative. Der Grund dafür ist jedoch ebenso wenig deutlich. Das Barren-Negativ ist eindeutig verwendet worden . Die Rußspuren bezeugen den Einguss heißen flüssigen Metalls, das eine runde Fläche innerhalb des Negativs ausfüllte und nicht bis an dessen Kanten heranreichte. Der in der Frontansicht vorhandene Absatz am linken Negativrand ist bei Betrachtung des Profils ebenfalls bewusst hergestellt und kein zufälliges Merkmal. Seine exakt rechteckige Ausprägung ist eindeutig als Einguss zu sehen. Eine sich eventuell anschließende Passkerbe auf der gegenüber liegenden Seite des Negativs deutet möglicherweise auf eine passende Abdeckschale hin. Allerdings wäre die Kerbe in diesem Fall wenig sorgfältig gearbeitet und hätte eher ad hoc-Charakter. Die beiden Negative auf der anderen Seite der Gussform zeigen dagegen keine Spuren von Hitzeeinwirkung und sind walu·scheinlich nie in Benutzung gewesen. Das vermeintlich als Meißel angesprochene Negativ daneben wäre an einem Ende olme formalen Abschluss und an dem anderen überhaupt nicht richtig ausgearbeitet. Man sollte hier wohl eher von einem unvollendeten Negativ ausgehen.
ll7 Ähnliche Oval-Barren sind auch von Formen aus Li man Tepe bekannt. 338 Müller-Karpe 1994, Taf. 26, 1. 339 Ich konnte das Stück im Archäologischen Museum in Urfa besichtigen. Eine
Publikation scheint bisher noch auszustehen. Literatur zum Fundplatz: z. B. Laneri 2002; Matney/Aigaze 1995; Hartenherger et. al. 2000; Nishimura 2007.
HO Müller-Karpe 1994,202 Taf. 27 ,1. "' Schliemann 188 1, 633 Nr. 1266. "' lvlliller-Karpe 1994, 198. JH Schmidt 1902, 267.
241
Abb. 33: Gussform Sch 6767. Foto B. Nessel.
Die rechteckige Gussform Sch 6775 (Taf. 4i) besteht aus dunklem Glimmerschiefer und trägt das Negativ eines schlanken, spitz zulaufenden Gegenstandes, der sich wohl am besten als Pfriem ansprechen lässt. Es wurde vermutet, es handele sich um einen Gusskanal , der auf einer zweiten fehlenden Formschale vorhandene Negative verbinde344 Die eindeutig bewusste Formgebung der zulaufenden Spitze zur Außenkante der Gussform hin spricht m. E. dagegen, zumal es unter funktionellen Gesichtspunkten deutlich praktischer gewesen wäre, jenes sich vetjüngende Ende zur Innenseite der Form
m Müller-Karpe 1994, 223. Taf. 61 ,3 . m Z. B. ein Exemplar aus Ayana: Müller-Karpe 1994, Taf. 57,6. 346 Klein 1992, Taf. 191 ,7. '" Özgüy 1986, 45 Taf. 92 ,3; Müller-Karpe 1994. 207 Taf. 39, 1.3; 198 Taf. 16,5 . '" Von der Osten 1937, 230; Müller-Karpe 1994, 210 Taf. 44,1C; 208
Taf. 40,7; 203 Taf. 28 ,2A.
242
Abb. 34: Gussform zum Guss eines Pfriemes aus Syrien. Nach Klein 1992, Taf. 191 ,7.
zulaufen zu lassen, wie es auch bei anderen Formdeckschalen zu erketmen ist345 . Links unten und rechts oben neben dem Negativ befindet sich je ein Passloch, welches die Zugehörigkeit zu einer zweischaligen Gussform zweifelsfrei belegt. Die Form datiert in die zweite Schicht Trojas und ist heute nicht mehr erhalten. Gussformen mit gleichartigen Negativen sind aus Anatolien bisher nicht bekannt. Allerdings kann ein analoges Fundstück aus Syrien genannt werden, welches nicht nur über ein sehr ähnliches Negativ, sondern auch über fast kongruente funktionelle Charakteristika verfügt (Abb. 34)346
. Die beiden Passlöcher befinden sich hier jedoch aufnahezu gleicher Höhe zu beiden Seiten des Negativs. Die aus dunkelgrauem Glimmerschiefer bestehende Gussform Sch 6766 (Taf. 12c) ist bereits mehrfach angesprochen worden. Sie weist neben weiteren Negativen ebenfalls auch eines zum Guss eines T-fönnigen Gegenstandes auf. Dieses Negativ ist sehr gut poliert, wohingegen jenes fiir das runde Objekt grobe Arbeitsspuren auf den limenflächen aufweist. In allen Negativen lassen sich deutliche Nutzungsspuren an Randbereichen und Innenflächen feststellen. Während die Form Sch 6767 eindeutig der VI. Schicht Trojas zuzuschreiben ist, wurde die Form Sch 6766 in die Frühbronzezeit datiert. Gussformen für so genannte T-förmige Gegenstände sind abgesehen von den trojanischen Stücken aus Kültepe347
, Bogazköy348, Ali~ar349, Akcadag350 und Vezirköprü-Gölköy bekannt. Sie datieren alle in Kontexte des 2. Jahrtausends v. Chr. oder sind noch jünger. Anhand der Analogien in Anatolien ist daher zu vermuten, dass die spätere Datierung Sclunidts fiir die Gussform Sch 6766 wahrscheinlicher ist. Olme Informationen zu den Fundumständen, kann dies jedoch nicht abschließend geklärt werden. Bei den T-förmigen Objekten muss es sich um massive Gegenstände variabler Größe gehandelt haben . Da entsprechende Positive im Fundgut Anatoliens lange fehlten , wurde davon ausgegangen, dass sie am ehesten als Halbfertigprodukte zu betrachten seien35 1, die in ausgeschmiedeter Form walu·scheinlich ein anderes Erscheinungsbild hatten als direkt nach dem Guss. Inzwischen konnten jedoch einige T-förmige Objekte zum Beispiel in Gaziantepe auch als Bronzen geborgen werden, die allerdings bereits ins 7. Jalu·hundert v. Chr. datieren352 und aufgrund ilu-er ziemlich exakten Verkörperung der Gussformennegative die Problematik der Funktionsbestimmung nicht zu erhellen vermögen. Positivformen aus anderen Metallen liegen bisher nicht
'" Von der Osten 1937, 234 . 236 Abb. 262; Müller-Karpe 1994, 206 Taf. 34, I B.3B; von der Osten 1937a, 94.
Jso Belli 1993, 609 Abb. 4 ,5; Müller-Karpe 1994, Taf. 34,4E. JsJ Müller-Karpe 1994, 145. 352 Bilgi et. al. 2004, 30.
vor, weshalb von der Nutzung bronzenen Werkstoffes zum Guss der Objekte auszugehen ist. Eine bevorzugte Kombination der T-förmigen Objekte mit bestimmten anderen Negativformen ist nicht zu bemerken.
Steingeräte
Art und Anzahl der zu besprechenden Steingeräte entsprechen im Wesentlichen dem typischen Material einer bronzezeitlichen Siedlung im ägäischen Raum. Neben triangulären, rundlichen und trapezoiden Hämmern sind Schaftlochhämmer wie auch Rillenschlegel in der Sammlung vertreten. Zusätzlich werden hier rechteckige Steingeräte mit Rillen und Durchlochungen behandelt, da ihnen bereits des Öfteren ein direkter Bezug zur metallurgischen Sphäre unterstellt wurde. Insgesamt bestehen Steinwerkzeuge meist aus harten Tiefengesteinen, wobei die verwendeten Materialien nur bei einigen der trojanischen Exemplare genauer bestimmt wurden. Die ursprüngliche Anzahl der in der Sammlung vorhandenen Steingeräte zur Metallbearbeitung kann kaum beziffert werden, da weder Schliemann noch Schmidt die Stücke so ausfiihrlich besprochen haben, dass sie von Steinwerkzeugen anderer Tätigkeitsfelder immer begründet separiert werden könnten. Mit Sicherheit waren es jedoch mehr als 21 Exemplare. Gegenwärtig befinden sich noch 20 relevante Objekte in der Trojanischen Sammlung, wobei zumindest zwei identifizierte Geräte sicher verschollen sind.
Trianguläre, rundliche und trapezoide Steinhämmer Steinhämmer mit triangulärer bis trapezoider Körperform sind konzeptuell eine der einfachsten Hammerformen. Sie verfUgen meist über nur eine recht kleine Balm, die einem abgeflachten oder gerundeten Nackenteil gegenüber liegt. Oft weisen sie sehr gut polierte Oberflächen auf. Ihre Bahnformen variieren zwischen schmalen abgerundet rechteckigen Formen wie bei MVF 2596 (Ta f. 16c) oder Sch 7005 (Taf. 16d) und breiteren, eher ovalen Bahnformen wie bei MVF 3134 (Taf. 16e). Bezüglich der Baimausprägung lässt sich mehrheitlich eine eher plane Gestaltung der Arbeitsflächen attestieren, auch wenn leicht gerundete Bahnen ebenso auftreten. Die rundlichen, stößelartigen Hämmer der trojanischen Sammlung dagegen zeigen vielseitige Anlagen. Von den größeren Stücken wie Exemplar Sch 8767-8775b (Taf. 16f) nimmt Müller-Karpe an, dass sie eine ähnliche Funktion wie die so genannten Prelleisen aus Bronze gehabt haben könnten353, wie sie in Anatolien aus hethitischer Zeit bzw. von Kreta3;4 bekannt sind. Ilu·e größeren Salmflächen mit stets leichter Wölbung sindjedoch vielseitig verwendbare Attribute, die in jedem handwerklichen Bereich benötigt werden. Zwar lassen sich die Hämmer zu Schmiedearbeiten nutzen, sind für punktgenaues Arbeiten jedoch zu grob und zu schwer. Zudem lässt sich keine Salmform explizit einer bestimmten Hammerform zuordnen, was die Steinhämmer als individuell hergerichtete Geräte ausweist , die sowohl bei ganz bestimmten Arbeitsgängen als spezialisiertes Werkzeug als auch als ad hocGeräte mit eher unspezifischem Charakter auftreten. Daher empfiehlt es sich nicht von Schmiede-, sondern von Allzweckgeräten zu sprechen. Sie sind nicht nur zum Schlagen, sondern auch zu
353 Miiller-Karpe 1994, 159 Taf. 62,21 - 24. 354 Hundt 1986. 355 Michels-Gebier 1984, 13. Js6 Götze 1902, 380 (hier als Idol angesprochen). 357 Z. B. Comsa 1972; Antonovic 2003; Moucha 2003; Micu et.al. 2005-2006; Freu
denberg 2009 wn nur wenige Beiträge ltir ivl ittel- und Südosteuropa zu netmen. J5s Z. B. Behm-Bianke 1992; Carter 1998; Gatsov 1998; Gatsov/Efe 2005.
mahlenden und quetschenden Vorgängen nützlich, was besonders bei der Arbeit mit Pigmenten oder Pflanzenfasern von Bedeutung ist. Nach bisherigen Erkenntnissen und ethnoarchäologischen Parallelen ist die ungeschäftete Handhabung dieser Steingeräte vielfach am wahrscheinlichsten. Die Effektivität eines solchen Gebrauchs ist inzwischen durch ethnologische Beobachtungen, experimentelle Versuche und nicht zuletzt bildliehe Darstellungen belegt, wobei deutlich wird, dass bestimmte Schlag- und Atemtechniken bei der Schmiedearbeit mit Steingeräten hilfreich sindm . Allerdings können nicht alle Stücke in gleichem Maße oder überhaupt genutzt worden sein. Bei Sch 8777- 8781 (Taf. l6j) fehlen Abnutzungsspuren völlig, wohingegen Sch 75693; 6 (Taf. 16i) anband der feinen Schleifspuren auf der Bahn eher Hinweise auf Tätigkeiten zur Überarbeitung von Oberflächen gibt, die nicht zwangsläufig aus Metall gewesen sein müssen. Steinhämmer mit ähnlichen Anlagen kommen in der gesamten Ägäis und auch den meisten Regionen des übrigen Europa zahlreich vorm. Allerdings wurde gerade für Anatolien bereits öfter auf Defizite in der Bearbeitung und Vorlage lithischer Ensembles der Bronzezeit aufmerksam gemacht. Diese Lücke schließt sich zwar zunehmend, wird jedoch besonders durch Arbeiten zu Silex358- und Obsidianfimden359 gefüllt. Felsgesteinensembles sind bisher nur von selu- wenigen Fundplätzen vorgelegt oder befinden sich noch in der Aufarbeitung. Den triangulären bis trapezoiden Steinhämmern vergleichbare Geräte sind in Anatolien zum Beispiel in der Marmara-Region belegt, wo sie anhand ilu-er Ausprägungen und Nutzungsspuren explizit mit der Metallverarbeitung in Zusammenhang gebracht wurden360. Trianguläre und rundliche Stücke mit ovalen Bahnen sind außerdem aus Demirci Höyük bekannt361 . Bezogen auf die griechischen Inseln und das Festland sollen hier die zumindest teilweise vorgelegten Steinhämmer von Thermi als Beispiel fiir die an allen Fundplätzen zahlreich auftretenden Ensembles dienen. Die Stücke haben hier insgesamt einen eher rundlichen als triangulären Körper, zeigen jedoch ilu-e Bahnen betreffend sämtliche Ausprägungen und Formen. Die Mehrzahl der Hämmer weist auch in Thermi polierte Körperflächen auf. Wie in der Troas kann auch dort Serpentinit, Diorit und Felsgestein als bevorzugtes Material zur Herstellung von Hämmern gelten362.
Schaftlochhämmer Ein grundsätzliches Merkmal der Schaftlochhämmer ist ihre Konzeption als zweibalmiges Werkzeug, was sie von den triangulären, rundlichen und trapezoiden Stücken unterscheidet. Die Bahnen können verschieden ausgeprägt sein, wobei in den meisten Fällen in erster Linie die Bahnausprägung und weniger ihre Formen voneinander abweichen. Mehrheitlich verfUgen steinerne Schaftlochhämmer über zwei gewölbte Salmen, deren Wölbungsgrad variiert. Die Bahnform ist im Grunde auf drei Varianten beschränkt. Sie kann rund, breitoval oder rechteckig sein. In der Berliner Trojasammlung ist nur ein einziges Exemplar aus feinkörnigem , grau- bräunlichem Diorit erhalten (Sch 7179; Taf. 15c), welches höchst walu-scheinlich der zweiten Schicht Trojas zuzuordnen ist363. Eine Bahn ist atmähernd quadratisch und quer zum Schaft ausgerichtet, die andere dagegen rechteckig geformt und längs zum Schaft stehend angelegt. Das Schaftloch ist mittig angebracht und weist deutliche Spuren der Durchbohrung des Steines auf. Zahlreiche Materialausbrüche und Risse bezeugen seine Nutzung
359 Z. B. Bergner et. al. 2008; Özdogan 2008; Balkan-A tlt et. al. 2008. J6o Zimmermann u. a. 2003, 64 Abb. 5,56.58. 36 1 Baycai-Seeher 1996, Taf. 81 , 12.14. '" Lamb 1936, 185- 191 Fig. 56.57, PI. 49,30/ 11.31 /55. J6J Miiller-Karpe 1994, 227; Schliemann 188 1, 488 f.; aufgrundder Politur des
Schaftloches wollte Götze das Stück in die erste Schicht Trojas datieren (Götze 1902, 323), wasjedoch bezwe ife lt werden darf.
243
.,
als Sch laginstrument. Sein recht geringes Gewicht von 171 g weist dabei eher auf eine Nutzung bei feineren Arbeiten hin. An den Bahnen und der Unterseite des Hammerkörpers ist ein flächendeckender grauschwarzer Glanz zu beobachten, der wahrscheinlich als kriegsbedingter Schaden eingestuft werden muss. Sch li emann erwähnte einen wei teren Schaftlochhammer mit gebohrtem Schaftloch, der abgerundet rechteckige oder rundovale Bahnen aufgewiesen haben solP64
. Seine Materialausbrüche an den Arbeitsflächen und einigen Bereichen des Körpers sollen ebenfalls auf ein genutztes Arbeitsgerät gedeutet haben . Mit dem Steinhatru11er Sch 7262 (Taf. 15b) liegt außerdem ein Exemplar vor, dessen Schaftbohrung nicht vo llendet wurde. Der ovale Hammerkörper läuft in zwei sich gegenüber liegenden rechteckigen Bahnen aus. Beide sind längs zum Schaft ausgerichtet und zeigen deutliche Nutzungsspuren, wie sie fiir Schlagwerkzeuge charakteristisch sind . Auf der Unterseite ist etwa ein Viertel des Stückes ausgebrochen. Analoge Fundstücke sind sowoh l im ägäischen Raum und dem Vorderen Orient, wie auch in Zentraleuropa zahlreich bekannt. Da eingehende Studien oder Stoffsammlungen bezüglich der Steingeräte in Anatolien bisher feh len, kann kein Überblick über die Verbreitung einzelner Arten von steinernen Schaftlochhämmern gegeben werden. Ein dem trojanischen Stück vergleichbares Exemplar ist beispielsweise in Grab 169 der frühb ronzezeit lichen Nekropole von Demirci Höyük als Beigabe gefunden worden365
Ähnl iche Stücke sind auch aus Nor~untepe bekannt366. Die troja
nischen bzw. anatolischen Exemplare unterscheiden sich in ihrer grundsätzlichen Gestaltungsweise nicht von jenen des zentraloder südosteuropäischen Raumes.
Rillenschlegel Dies gilt allerdings nicht fiir den großen Rillenschlegel aus Troja. Ein fast 30 cm langes, mehr als 5 kg wiegendes Exemplar (Inv. Nr. 8383; Taf. 15a) wurde von Schliemmm als Hammer bzw. "Stosskeule" bezeichnet und auch von Schmidt als ,,groß er Steinhammer" den geri llten Geräten zugeordnet367
. Es handelt sich um das einzige Exemplar seiner Art in der Trojanischen Sammlung. Das vo llständig erhaltene Stück aus anthraz itfarbenem Diorit weist eine insgesamt trapezoide Form mit einer angedeuteten, nicht geglätteten und nicht ganz umlaufenden Rille im Mittelteil auf. Eine Körperseite ist plan ausgeprägt, wohingegen die andere leicht gewölbt gearbeitet wurde. Oie Oberfläche ist sehr sorgfaltig poliert worden; kleinere Kratzspuren an den intakten Bereichen dürften wohl weniger der Nutzung, sondern mehr seiner Lagerung zuzuschreiben sein. Allerdings ist die gesamte Oberfläche mit kleinen Materialausbrüchen übersät. Auf dem Körper des Stückes befinden sich beidseits der Mittelrille unterschiedliche, ganz bewusst gestaltete Flächen. Auf der planen Seite liegen zwei ovale Bereiche, die leicht konkav gewölbt sind und Bearbeitungsspuren tragen. Oie gegenüberliegende Seite zeigt eine plane und eine leicht gewölbte Fläche. Auch diese unterlagen einer bestimmten Nutzung, wie vie le kleine Einschläge bezeugen. Die große Bahn von abgerundet rechteckiger Form ist plan gestaltet und ebenfalls sehr gut geglättet. Zu ihren Kanten hin ist sie leicht abschüssig angelegt, wobei sich kleinere Materialausbrüche besonders in diesem Bereich beobachten lassen. Der abgerundete Nacken des Stückes weist keinerlei Nutzungsspuren auf und kann daher nicht als Arbeitsfläche angesprochen werden . Vermutlich handelt es sich hier um den zur Fixierung des Stückes genutzten Teil. Nach Schliemann stammt das Objekt aus seiner "dritten prähistorischen Stadt"368
.
364 Sch liemann 1881 , 312 Nr. 152. 365 Seeher 2000, 144 Abb. 28. 366 Schmidt 2002, Taf. III ; 115; 11 8. 367 Schliemann 188 1, 491 ; Schmidt 1902, 299. 368 Schliemann 188 1,491 Nr. 632.
244
Rillenschlegel sind ihre Gestaltung und Funktion betreffend äußerst variantenreich. Neben nur grob zugerichteten Klopfsteinen kommen gut polierte Exemplare vor, die als Hämmer und Äxte fungierten und häufig auch sekundär verändert worden sind. Es liegen immer noch ausnehmend wenige überregionale Arbeiten zu diesen Geräten vm·369
, wo Unterschiede in ihrer Gesta ltung und ihrer Nutzung zudem stets kontrovers diskutiert werden37D.
Sie sind kaum pauschal als Geräte fiir einen bestimmten Zweck anzusprechen, vielmelu- zeigt die Variabi lität iluer Formen und Nutzungsspuren eine Eignung fiir verschiedene Verwendungszwecke. In vielen Fällen handelt es sich tatsächlich um Hämmer, was sich jedoch nicht grundsätz lich von einem Fundstück auf das andere übertragen lässt. A ls Geräte zur Metallbearbeitung wurden sie vor allem durch Horst bestimmt. Er sah sie als " . . . zum Geräteinventar von Spezialisten ... " gehörig37 1
• Als Argumentation dienten ihm besonders die an den meisten zentra leuropäischen Exemplaren zu beobachtenden Schlagnarben sowie eine Vergesellschaftung mit metallurgischem Gerät in einigen Fundverbänden372. Sowohl Horst als auch Kaufmann wiesen jedoch ebenfalls auf die deutlich differierenden Nutzungsspuren der Einzelstücke hin373
•
Große Rillenschlegel werden üblicher Weise als schwere Geräte bei groben Arbeitsgängen eingesetzt und finden sieb häufig in entsprechenden Kontexten auf spezialisierten Bergbau- und Verhüttungsp lätzen. Das trojanische Exemplar istjedoch sicher nicht in diese Kategorie von schweren Arbeitsgeräten einzureihen. Es hebt sich besonders durch die Güte seiner Politur und die völlig unversehrte Oberfläche von anderen großen Rillenschlegeln ab . Eine Nutzung als Hammer oder Amboss in Verbindung mit metallhandwerklichen Arbeitstechniken ist aufgrund fehlender charakteristischer Abnutzungsspuren mit Sicherheit auszuschließen. Die Bestimmung einer potentiellen Funktion in anderen Handwerks- bzw. Tätigkeitsfeldern fa lltj edoch ebenso schwer und ist kaum begründbar, da selbst das Zerstoßen von Pigmenten oder Hülsenfrüchten auf Dauer stärkere Abnutzungsspuren zur Folge gehabt hätte. Eine konkrete Funktionsbestimmung muss daher vorerst offen bleiben . Gleichart ig ausgeprägte Exemplare sind bisher nicht bekannt.
Spezialisierte Steingeräte zur Herstellung beinerner Pfeilspitzen Zu den funktiona l nicht identifizierten Gegenständen der Sammlung gehörten bisher auch vier quaderförmige bzw. annähernd rechteckige Steinobjekte, welche eine oder mehrere Rillen bzw. Durchlochungen aufweisen (Taf. 17). Wie viele Geräte dieser Art sich ursprünglich tatsäch lich in dem durch Schliemann ergrabenen Material aus Troja befunden haben, ist nicht mehr zu ermitteln . Es muss jedoch grundsätzlich mit einer höheren Anzahl gerechnet werden. Die gewählten Materialien zur Herstellung der Sch leifwerkzeuge sind verschieden. Obwohl exakte Geste insanalysen bisher fehlen , kann zumindest bei einigen Geräten Steatit als Grundmaterial angenommen werden. Andere bestehen aus deutlich härterem Gestein. Die Rillen der Objekte sind stets sauber gearbeitet und verfiigen über eine akkurate Kantengestaltung. Es lassen sich sowohl offene, außen liegende Ri llen mit halbmondförmigem Querschnitt, als auch geschlossene, innen liegende Bohrlöcher an den Fundstücken feststellen, die sowohl parallel zueinander als auch über Kreuz liegend angeordnet sein können und verschiedene Querschnittsdicken aufweisen. Aufgrund ihrer Nutzungsspuren können beide Arten von Bohrungen
369 Z. B. lndreko 1956 fiir Nord- und zentraleuropäische Fundstücke. 370 Hundt 1975, 116; Schwarz 2005; Rieser 1998/99 . l7l Kaufmann 1986, 88 . m Horst 1981 , 46 ; Horst 1986, 88 . J73 Kaufmann 1957, 2 11 - 284; ähnliches auch bei Schwarz 2005 , 27.
a
©
d
[J--.. -- o· ---( - - ·. . ~··:· ·· ~
. . . -. ' : . .. . ·.. :
;: . . ·,· ·. ·; :.· .
LJ c:J
-e - -I m n
e
g
~
~ 0 p
c
~IIIJ
h
Grl cJLJ
f
k
q
Abb. 35: Poliersteine fiir Pfeilspitzen (M ca. 1 : 3) : a Kap Gelidonia; b Malatya-Arslantepe; c Hacibekta~ ; d Troja; e Nicosia und Palaiakastro; f.g Troja; h.i Bogazköy; j.k.l.q Qantir-Piramesse; m-o Ali~ar ; p Nor~untepe. a nach Müller-Karpe 1994, Taf. 79, I; b nach Müller-Karpe 1994,Taf. 79,4; c verändert nach Müller-Karpe 1994, Taf. 79,3; d Foto Biegen et . al. 1958, Fig. 220,32 - 337 ; Zeichnung nach Müller-Karpe 1994, Taf. 79, 11 ; e nach Catling 1964, PI. 51 d.e; fnach Biegen et. al. 1951 , Fig. 234; g nach Biegen et. al. 1958; h- i nach Müller-Karpe 1994, Taf. 79, 13.14; j-1 nach Prell 2011 , Taf. I 0, 1.2.3; m-o nach Müller-Karpe 1994, Taf. 79, 17; p nach Schmidt 2002, Taf. 2, 175; q nach Prell 2011 , Taf. I 0,4.
245
Abb. 36: Vorder- und Rücksicht einer Gussform mit Schleifrillen aus Troja, sekundär zur Herstellung von Schmuckstücken genutzt. Nach Demakopoulou 1990, 321 Abb. 280.
als Schleifkanäle angesprochen werden. Die Stücke aus Troja sind sowohl vollständig als auch fragmentiert erhalten. Neben den beute noch in der Sammlung vorhandenen Exemplaren sind in verschiedenen Fundvorlagen Schliemanns weitere Objekte abgebildet374 •
Gute Vergleichsexemplare stammen aus Nor~untepe, wo derartige Fundstücke ebenfalls zahlreich auftreten. Wie die trojanischen Objekte bestehen sie aus glatt und glänzend poliertem Stein mit sorgfaltig eingeschliffenen Rillen an den Außenflächen und einem zylindrischen, das Stück vollständig durchbohrenden Kanal. Dieser läuft bei dem hier abgebildeten Exemplar (Abb. 35p) parallel zu der Rille an der oberen Fläche375 • Die Schleifspuren in der Rille und an den übrigen Oberflächen sind gut zu erkennen. Außerdem sind absolut intakte Kanten an allen Bereichen auffallend376•
K. Schmidt bestreitet aufgrund der Materialbeschaffenheit des Objektes und den zylindrischen Vollbohrungen, welche bei dieser Prozedur keinen effektiven Nutzen haben sollen, eine Funktion als Pfeilschaftglätter 377
• Außerdem konnte in Nor~untepe ein analoges Exemplar aus Ton geborgen werden. Beide Fundstücke stammen aus oberflächennahen Zusammenhängen und sind nicht genau datierbar. Ähnliche Geräte treten in Anatolien auch an anderen Fundstellen auf. Sechs von ihnen können ins 3. Jalutausend v. Clu·. datiert werden. Ein Gerät aus Cudeyde fällt bereits in dessen erste Hälfte, die übrigen in zweite Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. Mittelbronzezeitliche Exemplare sind aus Lidar Höyük378 und Tilkitepe379 bekannt . Letztgenannte habenjedoch keine Durchlochung und sehen den trojanischen Exemplaren nur bedingt ähnlich. Ferner können aus Tarsus und Bogazköy analoge Instrumente des 2. und I. Jahrtausends v. Chr. namhaft gemacht werden (Abb. 35h.i)38° Fünfweitere Geräte sind sicher in einem kammzeitlichen (1974- 1836 BC38 1)
Zusanm1enhang zu sehen, wohingegen acht der Steingegenstände in die hethitische Zeit datieren . Sie bestehen meist aus besonders hartem Glimmerschiefer. Drei ebenfalls in diese Objektkategorie einzureihende Fundstücke stammen aus einer Grubenverfüllung in Nicosia auf Zypern, welche wahrscheinlich in das 12. Jahrhundert v. Chr. datiert, und aus einem unbekannten Fundkontext in Palaikastro auf Kreta (Abb. 35e)382 Auf einem "Formstein" aus Mykene sind zwei solche Rillen zu sehen, die wie bei unserem Stück
m Schliemann 1874, Taf. 93,3. Reihe, 4. von rechts und 4. Reibe, 4. von rechts. 375 Scbmidt 2002, 16. 376 Ebd. Taf. II , 175. 377 Ebd. 16. J7s Ebd. 379 Korfmann 1982, 220 Abb. 20. 380 Schmidt 2002, 16.
246
Tr. 249 (Taf. 17f) parallel zueinander verlaufen und verschieden stark sind. Schliematm ging davon aus, eine Gussform vor sich zu haben383 , was durch die offensichtlichen Eingusskanäle auf der Fornu·ückseite und deutliche Rußspuren in den Negativen bestätigt wird. Es handelt es sich wahrscheinlich um einen sekundär als Gussform verwendeten Polierstein für Pfeilspitzen, was durch Art, Anlage und Querschnittsform der Rillen nahe gelegt wird. Sie sind durch ihre Maßen und ihren halbrunden Quersclmitt ganz ähnlich ausgeprägt wie bei den trojanischen Exemplaren und verlaufen über die gesamte Länge, wobei sie von einem jüngeren Negativ für ein geripptes Blech geschnitten werden (Abb. 36). Die Melu·heit derartiger Objekte wurde, wie in Troja, in Siedlungen gefunden. Drei von ilmen kamen in einem eindeutigen Werkstattkontext in Kanun Kanis zum Vorschein. Müller-Karpe gibt die Längen der anatolischen Vergleichsfunde als zwischen 4 und 10 cm und die Breite der Rillen und Bohrlöcher als zwischen 0,5 und I cm liegend an. Die Rillen mehrerer Stücke sind exakt einen Zentimeter breit, was sicherlich nicht als Zufall gelten kann. Dies wird auch durch ihre gleichartige Anlage bei den Geräten aus Troja bestätigt. Das bei ihm angegebene Maximalgewicht der Stücke von 500 g384 wird durch jene der Trojanischen Sammlung jedoch nicht annähernd erreicht. Fast keines der Objekte (Tr. 246; Tr. 249; Xlb 2847; Taf. 17 g.f.e) wiegt hier mehr als 50 g; lediglich ein formal etwas abweichendes quaderförmiges Exemplar Tr. 78 (Taf. 17b) mit mehrseitiger Bearbeitung wiegt etwas mehr als 300 Gramm. Einige aus Troja stammende Geräte, die sich nicht in der Berliner Sammlung befinden , sollen aus Ton hergestellt gewesen sein38s.
Da die Stücke formal mit den genannten identisch sind und die vorhandenen Instrumente aus einem selu- leichten Stein, walu·scheinlich Steatit, bestehen, kann dies auch auf eine Fehleinschätzung zurückgehen. Steatit bildet eine grau-bräunliche Patina, die leicht mit Keramik verwechselt werden kann. Die Deutungen der Geräte sind wenig variantenreich. Ging Schliemann davon aus, Bratspießstützen vor sich zu haben, worin ihm Bittel später mehr oder minder folgte bzw. eine Nutzung beim Textilhandwerk erwog386 , zog bereits Körte eine Verwendung " .. .für irgendwelche Technik, etwa Meta//verarbeitung ... " in Betrachtl87 • Götze schloss sich dem mit der Begründung an,
3SI Mesopotamian Middle Chronology nach Veenhof 1995 . 382 Catling 1964, 275 PI. 51 d.e. 383 Schliemann 1878 , 12 1. Js4 Ebd. 177. 385 Müller-Karpe 1994, 178 Taf. 79, 13 - 16. 386 Bittel 1937, 24. 387 Körte 1899, 18.
dass das Material mehrerer steinerner Stücke jenem der Gussformen gleiche und die tönernen Exemplare im Brand den Gussformen ähneln würden388
. Besonders diese Interpretation wurde seitdem immer wieder aufgegriffen und die Objekte entweder allgemein als metallurgische Geräte beschrieben389 oder mit spezifischem Verwendungszweck als Teile von Gussformen390 bzw. Werkzeug für die Drahtherstellung angesprochen39 1
. In eine ähnliche Richtung wurde in jüngerer Vergangenheit auch vergleichbares Material des zentraleuropäischen Raumes gedeutet392 .
Aufgrund des Tongerätes aus Nor~untepe schlug K. Schmidt eine Deutung als Gussform für Nadelschäfte vor, da diese im Fundgut bisher völlig fehlen . Rundstabige Rohlinge sollten dann nach dem Guss ausgeschmiedet und per Überfangguss oder ähnliche Techniken mit dem separat gefertigten Nadelkopf verbunden worden sein393 Allerdings bleibt die Frage offen, wie genau ein entsprechender Gussvorgang technisch ausgesehen haben könnte . Denn da die "Negative" in diesem Fall auf beiden Seiten keine Begrenzung aufweisen und sich keinerlei Anzeichen für we itere, entsprechend anzupassende Teile ergeben haben, würde das einströmende, flüssige Metall aus der Form hinauslaufen , ohne einen rundstabigen Rohling zu erzeugen. Zudem sind an keinem der Objekte aus Troja Nutzungsspuren, die auf die Einwirkung von Hitzequellen oder flüssigem Meta ll zurückzuführen wären, erkennbar. Soweit dies anband der Abbildungen zu beurteilen ist, gilt das offenbar auch für die genannten Vergleichsfunde . Ein ähnliches Exemplar aus dem Schiffswrack von Gelidonya394
ist im Gegensatz zu allen übrigen Stücken aus Bronze gefertigt. Es wurde zusammen mit Gussresten, Punzen und einem Hammer aufgefunden, weshalb eine Nutzung im metallverarbeitenden Kontext allgemein nicht angezweifelt wird. Müller-Karpe besclll'eibt es als "A mboss", da in den Rillen Drähte und ähnliches gescluniedet worden sein körmten. Die von Bass postulierte Funktion des Werkzeuges zum Drahtziehen lehnt er jedoch ab, da der Kraftaufwand bei einer Drahtstärke von 4- 6 mm unüberwindlich groß gewesen sei395
. Aufgrund der forma len Ähnlichkeiten zw ischen den steinernen Stücken und dem bronzenen Exemplar nimmt er eine ähnliche Verwendung auch fiir diese an. fn den Rillen der steinernen Exemplare soll folglich ebenso Metall geschmiedet worden sein. Als Vergleich zieht er einen einfachen Rillenstein aus dem Metallurgengrab von Kalinovka heran und konstruiert indirekt anband des Kontextes einen Bezug zur metallurgischen Sphäre. Für einige andere Stücke möchte er allerdings auch eine Verwendung als Pfeilschaftglätter nicht ausschließen396
.
Korfmann warnte vor einer vorschnellen Ansprache derartiger Geräte als Pfeilschaftglätter und wies auf vielseitige Verwendungsmöglichkeiten beim Schleifen und gleichmäßigen Abrunden von Formteilen bei Holzarbeiten und bei der Horn- und Knochen- sowie Geweihverarbeitung oder der Perlenherstellung hin397 Allerdings dürfen die ca. 1 cm breiten Rillen nicht als Spuren von Schleifarbeiten verstanden werden. Keinesfalls sind sie erst durch eine schleifende Tätigkeit entstanden, sondern bewusst konstruiert und waren sicher vor der Erstnutzung bereits im Gerät eingebracht. Dafür sprechen nicht zuletzt die weitgehend übereinstimmenden Maße bei sonst unterschiedlicher Ausprägung.
1ss Götze 1902, 369. 3&9 Schliemann 188 1, 486; Schmidt 1902, 268. 390 Biegen 1951 ,23 1 Taf. 234,32-183. 39 1 Besonders fiir das Objekt aus Gelidonya: Catling 1964, 275; Bass 1967, I 02. 392 Metzinger-Schmitz 2004, 266. J9J Schmidt 2002, 16. "' Bass 1967. m Müller-Karpe 1994, 178.
Abb. 37: Schleifgerät mit in die Rille passender Pfeil spitze aus Qantir
Piramesse. Nach Prell 20 II , Kat. Nr. 280.
Gemeinsam ist allen Deutungen zumindest ein handwerklicher Bezug. Steinobj ekte mit geraden oder gekreuzten Rillen sind auch aus rezenten Kontexten in Ägypten, Algerien oder dem Tschadbecken sowie anderen Regionen bekannt. Dort handelt es sich meist um Felssteingeräte mit künstlich eingerieften Rillen die häufig aus zerbrochenen Geräten hergestellt worden sind. Obwohl die Rillen selbst homogen in Breite, Tiefe und Form sind, legt iiu· verschiedenartiger Verlauf eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten nahe398 . Eine funktionale Zuweisung wird zudem durch fehlende morphologische Unterschiede zwischen Glättern mit Rille fiir Metall , Holz oder Knochen 399 erschwert. Grundsätzlich wird jedoch eine schleifende Funktion vor allem für die Herstellung von Knochengeräten und Perlen angenommen. Gelegentlich ist auch das Randabschleifen von Straußeneiperlen mit ähnlichen Werkzeugen belegt400
• Allerdings sind die Steingeräte zu diesem Zweck rundlich oder amorph geprägt und Durchlochungen, wie sie bei den ägäischen Stücken regelhaft vorkommen, sind kaum festzustellen. Einen entscheidenden Hinweis auf die Nutzung der trojanischen Werkzeuge gaben die Ausgrabungen in Quantir-Piramesse, Ägypten. In Abschnitt Q I , Stratum B/3 des Fund01tes wurde eine Metallwerkstatt ergraben. Innerhalb einer angrenzenden Balkenkonstruktion trat mit den trojanischen Stücken sehr gut vergleichbares Steinwerkzeug auf, welches mit einer großen Anzahl von halbfertigen oder abgenutzten beinernen Pfeilspitzen vergesellschaftet war. Der Bau beherbergte eine Holz- und Knochenwerkstatt , in der die Steingeräte, oft abgenutzt oder zerbrochen, als spezialisiertes Werkzeug zum Schleifen und Polieren von Knochenpfeilspitzen eingesetzt wurden. Wie die trojanischen Exemplare sind auch die ägyptischen melll'heitlich aus Steatit gefertigt und mit gebohrten Löchern oder semizirkularen Rillen versehen401
. Die Maße dieser Schleifkanäle sind mit jenen der knöchernen Pfeilspitzen des Fundplatzes kongruent402 Die Spitzen wurden also durch die vorgebohrten Löcher geschoben und durch die Bewegung in die entgegengesetzte Richtungen poliert. Auf den Knochenpfeilspitzen ließen sich gleichartige Schleifspuren wie an den Steinwerkzeugen feststellen (Abb. 37)403
• Aus dem Werkstattareal in Qantir-Piramesse stammen die meisten der quaderförmigen Steingeräte mit Rillen am Fundort. Die Anlage wird von Prell als auf den Bau von Bögen
396 Ebd. 178. 397 Kerfmann 1982, 161. 398 Rupp 2005, 203 . 399 Zimmermann 1995, 63. 400 Rupp 2005, 203. 401 Pusch 1990, danach Prell 20 11 ; Prell 20 13, 161. -1 o2 Prell 20 11 , 67. 403 Pre ll 20 II , 70.
247
spezialisiert interpretiert404, was die verarbeiteten organischen
Materialien und die Nähe zu der Metallwerkstatt in eine sinnvolle Beziehung zueinander zu setzen vermag, da so die Waffen ferti genden Produktionsstätten nah beieinander positioniert waren . Wahrscheinlich sind die dort arbeitenden Personen befahigt gewesen, in beiden Anlagen tätig zu sein und waren auf die Herstellung von Waffen als Objektgruppe spezialisiert. Die kurze Lebensdauer Quantir-Piramesses ( ca . 1278-ca. 1100 v. Chr.) erlaubt eine recht präzise zeitliche Einordnung der Stücke, welche sich zumindest mit einem Teil der erwähnten Vergleichsfunde deckt. In Analogie zu diesem eindeutigen Befund und unter Berücksichtigung der gesicherten Werkstattzugehörigkeit einiger entsprechender Funde Anatoliens, können die kleinen Steingeräte mit Rillen und Bohrungen aus Troja am wahrscheinlichsten als spezialis iertes Werkzeug zur Herstellung von Knochenpfeilspilzen angesehen werden. Es werden "pfriemartige" und runde Pfeilspitzen aus den Schliemannschen Grabungen erwähnt, welche teilweise nur roh gearbeitet sind, teilweise jedoch auch bereits Schleifspuren auf\veisen405
. Natürlich sind die kleinen Schleifgeräte auch zur Politur von Knochen- und Beinpfriemen bzw. -ahlen und ähnlichem Werkzeug und Gerät verwendbar. Eine Überprüfung dieser These anhand der metrischen Daten ähnlicher Schleifsteine und organischer Pfeilspitzen bzw. Werkzeuge aus den verschiedenen Troja-Grabungen wäre in diesem Zusammenhang sicher lohnenswert.
Fazit
Die Metallurgie Trojas tritt uns bereits ab der beginnenden Frühbronzezeit in hochentwickelter Form mit ausgereiften Teclmiken entgegen. Dies unterstreicht seine Rolle als Rezipient zahlreicher Einflüsse und Innovationen aus ganz verschiedenen Richtungen. Auch wenn sich in den größeren ergrabenen Siedlungen der umliegenden Regionen wie Poliochni und Thermi ebenfalls Hinweise auf die Anwendung entsprechender Techniken und die Herstellung similiärer Produkte in ähnlichen Zeiträumen beobachten lassen, bleibt Troja doch der Fundplatz mit dem signifikant meisten FundmateriaL Ferner sind die Gussformen durch zahlreiche Negative charakterisiert, fiir die entweder gar keine exakten oder nur selu· wenige Parallelen im ägäischen und anatolischen Raum gefimden werden können . Wie gezeigt werden konnte, sind auch Objekte mit vergleichsweise weit entfernt liegenden Analogien in Troja keine Seltenheit. Sie bezeugen die Einbindung in mehrere Austausch- und Kommunikationsnetze, wie den ägäisch-kykladischen Raum im Westen, das donauländische Gebiet im Norden und Zentralanatolien sowie das Zweistromland im Osten und Südosten. Diese verschiedenen Einftusssphären sind im 3. Jalu·tausend v. Chr. durch die Übernahme von wichtigen Innovationen wie einer fortschrittlichen Metallurgie, metrologischen Standards und einer Zirkulation bestimmter Güter gekennzeichnet. Die günstige geographische Lage Trojas macht es zum äußersten Punkt eines jeden der drei kulturellen Einftussgebiete, was sich nicht als nachteilig, sondern als äußerst vorteilhaft erweist. Troja gehört zu den wenigen Fundplätzen, wo alle technischen und sozialen Neuerungen dieser Zeit innennenswerter Anzahl belegt werden können und scheint als Drehund Angelpunkt "zwischen den Welten" fungiert zu haben. Die anspruchsvolle Metallurgie steht hier in enger Verbindung mit administrativer Verwaltung und Vorratshaltung innerhalb einer prolourban organisiet1en und hierarchisch strukturierten Gesellschaft.
m Prell 20 13, 166.
248
Katalog
Inv. Nr. Sch 6723 a.b. Gussform, Stein, einteilig. Negati ve auf drei Seiten für funf Flachbeile und einen Dolch. L. 22,5 cm; B. II ,5 cm; H. 6,5 cm Schmidt: II. Ansiedlung, G 5-6 Lit.: Schmidt 1902, 265 Nr. 6723a. b. Verschollen
Inv. Nr. Seh 6724 (Taf. 9a) Gussform, einteilig, gut erhalten, teil weise ergänzt, grau-grünlicher Biotit-Schiefer, Negative auf drei Seiten fiir mindestens drei Flachbeile, evt l. einen Meißel oder ein Flachbeil und einen Meißel. Oberfläche auf einer Seite sorgfaltig geglättet, auf anderer Seite nur grob geglättet mit deutlichen Herstellungsspuren, Oberfläche bei Negativen verschieden: auf geglätteter Seite auch die Negativinnenräume gut geglättet, auf anderen Seiten Negativinnenräume nur grob ausgearbei tet und nicht geglättet, in allen Negativen deutliche Rußspuren und silbrige Vert:irbungen an der Oberfläche, an den Beilnegativen auch leichte Versinterungen. Rissbildung und leichte Materialausbrüche aufgrund starker Hitzeeinwi rkung an den meisten Innenflächen, nach XRF-Messung: auf unbearbeiteter Längsse ite ausschließlich Zinnrückstände, in Negati ven Kupfer und Zinnrückstände nachweisbar. L. 23,5 cm; B. 13,5 cm; H. 6,25 cm; Gewicht: 3602 g Schmidt: 11.- V. Ansiedlung Lit .: Schmidt 1902, 265 No. 6724; Kat. Berlin/Sofia 1981, 76 Nr. 6724; Müller-Karpe 1994, 201 f. Taf. 25,3.
Inv. Nr. Seit 6725 (Taf. 7a) Gussform, einteilig, fast vo ll ständig erhalten, grauer Glimmerschiefer, Negati ve auf drei Seiten fiir fiinf Flachbeile, zwei Meißel, ein Messer und einen runden, scheibenförmigen, mit einem achtstrahligen Stern markierten Rundbarren, kleines rundes Negat iv auf der gegenüberli egenden Schmalseite. Gesamte Oberfläche grob geglättet mit deutlichen Herstellungsspuren, eindeutige Schleif- und Polierspuren in Negativinnenräumen, sehr akkurate Kantenfiihnmg bei Negativen, teilweise weißliche Verf<irbung der Oberfläche in einigen Negativinnenräumen mit fl ächigen Materialausbrüchen, Schmalseite deutlich dunkler verfarbt als andere Seiten mit leichter Porosität an einigen Stellen. Alle Negative zeigen Rußspuren, auf der Oberfläche Verfarbungen durch Nutzung, kleinere Materialausbrüche auf allen Flächen. L. 28 cm; B. max. 9,6 cm; 9 cm; H. 8,9 cm; Gewicht: 4067 g Schmiel! : 11.- V. Ansiedlung Lit.: Schmiel! 1902, 265 No. 6725; De Jesus 1980, 420f. Abb. 17,4; Demakopoulou 1990, 217; Müller-Karpe 1994, 203 Taf. 29, I (angegeben als lnv. Nr. 2725 (Nr. 12)
Inv. Nr. Seit 6726 (Taf. lla) Gussform, einteilig, fast vollständig erhalten, in zwei Teile gebrochen (heute wieder dauerhaft zu einer Form verbunden), erste Hälfte ln v. Nr. Sch 6726; zweite Hälfte ohne lnv. Nr., dunkelgrauer Glimmerschiefer. Rechteckige Form vetjüngt sich leicht zu einer Seite hin , grobe Herstellungsspuren sichtbar, Negative auf fiinfSeiten fiir sieben Flachbeile, zwei Dolche oder Lanzenspitzen, einen kleinen Stabbarren und einen Rundbarren. Negativinnenräume nur an leicht zugänglichen Bereichen poliert, an Randbereichen nur grobe Formgebung, eine der kurzen Längsseiten der Form unbearbeitet, starke Gebrauchsspuren in und an den Negat iven L. 26,8 cm; B. 12,5 cm bis max. 13,2 cm; H. 8,2 cm; Gewicht: 4513 g Schliemann: Dritte verbrannte Stadt; Schmidt: II.- V. Ansiedlung; MüllerKarpe: Troja II Lit.: Schliemann 188 1, 482 Nr. 599. 600; Schmidt 1902, 265 Nr. 6726; Götze 1902, Beil. 45,V; Müller-Karpe 1994, Taf. 30.
Inv. Nr. Seit 6727 (Taf. 6b) Gussform, fragmentiert, einteilig, quaderförmiger Querschnitt, grünlicher Glimmerschiefer mit sehr hohem GlimmeranteiL Auf vier Seiten angebrachte Negative flir sechs Flachbeile, einen Dolch und einen Rundbarren. Oberfläche grob geglättet, deutliche Herstellungsspuren, bis auf großes
405 Schmidt 1902, Nr. 6921 - 6929; Bulanda 1913, 39.
Flachbeilnegativ alle übrigen Formen auffallend flach in Oberfläche
eingearbeitet. Negativinnemäume nur leicht geglättet, großes Flachbeilnegativ als einziges innen poliert. Rußverfärbungen in Negativen von drei
Formseiten, leichte Rissbildung in zwei Beilnegativinnenräumen, Rund
barrennegativ und drei Beilnegative zeigen keine Nutzungsspuren , evtl. Negative noch nicht fertig eingearbeitet.
L. 18 cm; B. 9,2 cm; H. 9,3 cm; Gewicht: 2814 g Schmidt: II.- V. Ansiedlung; Easton: Troja II , East-West Trench, Area iii,
EF 6-7(a) Lit.: Schliemann 1974, Taf. 138,2741 ; Schmidt 1902, 265 No. 6727; Easton
2002, 235 Fig. 171,73- 349.
Inv. Nr. Sch 6728 (Taf. lOa) Gussform, einteilig, zweiseitig bearbeitet, sehr massiv, stark mit Glimmer
durchsetzier gräulich-hellgrüner Gneis. Auf ursprünglicher Gussform Negative f'Ur mindestens drei Flachbeile auf oberer Fläche, dann sekundär quer über zwei Beilnegative weiteres Negativ für Flachbeil angelegt , Sekundärverwendung möglicherweise nach Bruch der Form. Oberfläche nur
grob zugerichtet, deutliche Herstellungsspuren an Form, in den Negativen
gute geglättete Oberflächen mit deutlichen Rußspuren durch Hitzeeinwir
kung, gräu lich-silbrige Verfärbung der Negativoberflächen, dort teilweise
leichte Rissbildung mit kleineren Materialausbrüchen. Rußspuren auch zwischen Negativen und auf unbearbeiteter Längsseite . L. 13,8 cm; B . 12,8 cm; H. 10,9 cm; Gewicht: 2813 g Sclunidt: 11.-V. Ansiedlung
Lit.: Schmidt 1902, 265 No. 6728.
lnv. Nr. Sch 6729 (Taf. 4g) Gussform, eintei li g, vollständig erhalten, Glimmerschiefer. Mehrteilig,
einseitig bearbeitet (?) , unregelmäßige Konturen, scheinbar keine abschließende Formgebung an Seitenflächen. Negativ für einen ornamentierten rechteckigen bis rautenfönnigen Gegenstand und wahrscheinlich
eine Ringzarge bzw. Ringplatte (bei Müller-Karpe nicht erwähnt), Ornament auf rechteckigem Gegenstand besteht aus Linien, einem Oval und einem Dreieck, das ovale Negativ fiir die Ringzarge liegt rechtsseitig
davon. Offenbar keine sorgfaltige Glättung der Oberfläche, Herstellungsspuren erkennbar, in Negativinnenräumen dagegen sorgsam behandelte
Oberflächen. Keine Aussagen zu Nutzungsspuren möglich
L. 23 cm; B. 15,5 cm; H. 6,5 cm Schliemann: Vierte prähistorische Stadt, Tiefe 16 Fuß; Schmidt: 11.-V.
Ansiedlung Lit.: Schliemann 1881 , 633 Nr. 1266; Schmidt 1902, 265f. No. 6729; Müller-Karpe 1994, 198f. Taf. 17,7.
Verschollen
lnv. Nr. Sch 6730 (Taf. lOb) Gussform, einteilig, vollständig erhalten, weißer Kalkstein. Rechteckige
Form, selu· massiv, innerhalb beider Negativinnenräume recht viele Luft
einschlüsse/poröses Gefüge, Negative auf je einer Seite fiir Rundbarren und einen Barren mit rechteckigem Absatz, Kombination mit einer Ab
deckplatte aufgrund der Form des Stückes nicht wahrscheinlich , Spuren
von dunklem Ruß auf beiden Formseiten. Negativ ohne Absatz, aber
weitgehend bis vollständig rußfrei , Oberfläche grob geglättet aber nicht
poliert, deutliche Herstellungsspuren sichtbar. L. 15,8 cm; B. 9,8- 10,4 cm; H. 6,8-7,9 cm ; Volumen des Rundbarrens:
ca. 15 ml; Volumen des BatTens mit Absatz: ca. 50 ml; Gewicht: 2406 g
Sch liemann: Fünfte prähistorische Stadt, Tiefe 6 Fuß; Schmidt: ll.- V. Ansiedlung Lit.: Schliematm 1881 , 652 Nr. 1348; Schmidt 1902, 266 No. 6730; Mül
ler-Karpe 1994, 200 Taf. 20,7.
Inv. Nr. Sch 6731-6753/1 (Taf. 5a) Gussform, fragmentiert, nur Endstück erhalten, grünlicher Glimmerschiefer. Mindestens flinfseitig bearbeitet, Reste von zehn Negativen erkenn
bar: ein Rund barren, ein Stabmeißel, ein Dolch- oder Messer, wahrschein
lich Beile und/oder Meißel. Oberfläche auf allen Seiten leicht poliert, aber alle Spuren grober Formgebung erkennbar, Rußspuren in allen Negativen,
nur selu· geringe oder keine Spuren auf übriger Oberfläche. Sclunidt: 11.-V. Ansiedlung; Easton: Troja V-IX, North-South trench ,
Southern sector, area i: CD 8-9(a), deposit 1 L. 11 ,2 cm; B. 9,6 cm; H. 7,2 cm; Gewicht: 1386 g
Lit. : Schliemann 1974, Taf. 83, 1749; Schmidt 1902, 266 No. 6731-6753; Schmidt 1902, 265 f. No. 6731 - 6753 ; Müller-Karpe 1994, 204 Taf. 33,4; Easton 2002, 178 Fig. 154,72-262 (hier ausgewiesen als Sch 6734).
Inv. Nr. Sch 6731 - 6753/2; Tr. 267 (Taf. 14a) Gussform, einteilig, rechteckiger Querschnitt, fragmentiert, grau- grünli
cher Glimmerschiefer. FünfNegative auf drei Seiten fiir mindestens zwei Flachbei Je, evtl. ein weiteres oder einen Meißel, einen stabart igen Gegenstand und ein Messer oder Dolch. Oberfläche allseitig gut geglättet, in Ne
gativen ebenfalls sorgfaltige Oberflächenüberarbeitung, trotzdem überall
sichtbare Herstellungsspuren, starke Rußspuren in Negativen, Die Bruchkanten belegen, dass Stein in jedem Negativ mindestens 0,5 cm durch
geglüht wurde. Rissbildung und leichte Materialausbrüche in großem
Flachbeilnegativ erkennbar, in den Ecken des Beilnegatives keine Ruß
spuren, bei mindestens drei Negativen sichtbare silbrige Verfärbung der Oberfläche, auf zwei Negativoberflächen auch weißliche Ablagerungen. L. II cm; B. 12,3 cm; H. 6,55 cm; Gewicht: I 062 g
Schmidt: ll.- V. Ansiedlung Lit.: Schmidt 1902, 265 f. No. 6731-6753; Albrecht 1992, 320 f. Abb. I.
Inv. Nr. Sch 6732 Gussform, fragmentiert , einteilig, helles Gestein, mindestens einseitig be
arbeitet, Negativ fiir Beil- oder Meißel (nach Schliemann auch fiir Pfeile).
L. 8 cm; B. 4 cm Schmidt: ll.-V. Ansiedlung; Easton: Troja Il-lll , Area iii: CD 4, deposit
II Lit.: Schliemann 1874, Taf. 93, 1974; Schmidt 1902, 266 No. 6731-6753 ;
Easton 2002, 158 Fig. 147,72-779.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6733 (Tal'. 14c) Gussform, fragmentiert , einteilig, Stein, mehrseitig bearbeitet, länglich
rechteckige Form, Negative fiir mindestens zehn Negative, darunter wahrscheinlich Beile und Meißel bzw. Barren, dunkler Verfärbungen in den
Negativinnenräumen erkennbar
B. ca. 8,5 cm, H. ca. 7,5 cm
Schmidt: ll.- V. Ansiedlung Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 6731 - 6753 ; Götze 1902, 368 Beil. 45 ,IV; Müller-Karpe 1994, 201 Taf. 24,4.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6735 Gussform, fragmentiert , einteilig, Stein keine Maße
Schmidt: II.-V. Ansiedlung Lit .: Schmidt 1902, 266 No. 6731-6753 .
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6736 (Tal'. 14b) Gussform, fi·agmentiert, Stein. Einteilig, in zwei Teile gebrochen, kleinere Randbereiche der Form nicht mehr erhalten, mehrseitig bearbeitet, Negative fiir mindestens drei Flachbeile, an allen Seiten stark bestoßen.
Herstellungsspuren deutlich sichtbar, Oberfläche an allen Seiten nur leicht
geglättet, Rußverfiirbungen innerhalb der Negative
L. 21 cm; B. 7,2 cm Schmidt: II.-V. Ansiedlung
Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 6731 - 6753 .
Inv. Nr. Sch 6737 (Taf. 9b) Gussform, fragmentieti (Fragment zugehörig zu Sch 6739), einteilig, grau-grünlicher Tonschiefer. Dreiseilig bearbeitet, Negative wahrscheinlich fiir fiinf Flachbei Je. Oberfläche grob zugerichtet und partiell leicht
geglättet, Unterseite unbearbeitet. Oberflächen von Negativinnenräumen gut geglättet mit Rußspuren in variierender Intensität (an Beilschneiden teilweise intensivere, dunklere Spuren als an Beilkörper), dort auch Riss
bildung und leichte Materialausbrüche sowie silbrige Verfärbung der
Oberfläche. Bruchkante zeigt, dass rund um die Negative ca. 0,5 cm des Steines beim Metalleinguss durchgeglüht wurden. L. 12,2 cm; B.14,5 cm; H. 7 cm; Gewicht: 1942 g
Schmidt: 11.-V. Ansiedlung
Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 6731 - 6753.
249
Inv. Nr. Sch 6738 (Taf. 14d) Gussform, fragmentiert, einteilig, einse it ig bearbeitet, in Mitte gebrochen, grau-grünlicher Phylli t. Form ve1jüngt s ich zur Oberfläche hin . Oberfl äche aufNega ti vseile gut geglättet, aber Herstell ungspuren sichtbar, auf Unterseite an zwei von drei Längskanten nur grobe Formgebung ohne Glättung, dort auch Spuren von Meißeln . Auf Längsse iten sehr gute Politur und
leichte Sägespuren, Negati v fii r Flachbei I, in Negati v Rußverfarbungen. L. l2,9 cm; B. 9 cm; H. 4,4 cm; Gewicht: 940 g Schmidt: II.- V. Ansiedlung Lit. : Schmidt 1902, 266 No. 673 1-6753; Albrecht 1992, Müller-Karpe 1994, Taf. 29, 2A-C
lnv. Nr. Sch 6739 (Taf. 9c)
Gussform, fragmentiert, einteilig, grau-grünlicher Tonschiefer. Dreiseilig bearbeitet, wahrsche inlich flir vier Flachbeile und einen stabart igen Gegenstand. Oberfläche grob geglättet mit deutlichen Spuren der Formgebung, innerhalb all er Negati ve starke Rußspuren, in Negati villnenräumen teilwe ise Rissbildung mit leichten Materi alausbrüchen, in Negati ven deutli ch mehr Glimmerpartikel al s an Rest der Form. L. 10,75 cm; B. 13,4 cm; H. 6,35 cm; Gewicht : l420 g Schmidt: II.- V. Ansiedlung Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 673 1-6753.
lnv. Nr. Sch 6740 Gussform, fragmentiert, einteilig, Ste in keine Maße Schmidt: II.- V. Ansiedlung Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 673 1- 6753.
Verschollen
lnv. Nr. Sch 6741 Gussform, fragmentiert, einteilig, Ste in
ke ine Maße Schmidt: II.- V. Ansied lung Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 673 1- 6753. Verscholl en
Inv. Nr. Sch 6742- 6753 Gussformen, fragmentiert, e inte ilig, Stein keine Maße Schmidt: 11.- Y. Ansiedlung Lit. : Schmidt 1902, 266 No. 673 1- 6753. Verscholl en
lnv. Nr. Sch 6754 (Taf. 7b)
Gussform, fragmentiert, zwe iteilig, fast vo ll ständ ig erhalten, leichte Ausbrüche an Kanten, anthrazit fa rbener Glimmerschiefer. Negati v fiir e in Flachbeil , Oberfläche geglättet, Herste llungsspuren sichtbar, ve1jüngt sich zum Nacken hin (pri smatische Form). Passkerben unterhalb der Beilschne ide auf Schmalse ite, in Negativinneren Rußspuren, fast alle Außenfl ächen ze igen starke Verrußung. L. 18, I cm; B. (an Schneide) 4,5 cm (an Nacken) 2,9 cm; H. max. 2,6 cm; Gewicht : 388 g Schliemann: Dritte prähistori sche Stadt; Schmidt: II.- V. Ansiedlung Li t.: Schliemann 188 1, 484 Nr. 60 1; Schmidt 1902, 266 N r. 6754.
Inv. Nr. Sch 6755 (Taf. 4b) Gussform, fragmentiert, Glimmerschiefer. Zweite ilig, wohl einseitig bearbeitet, Negativ fiir einen Dolch/e ine Lanzenspitze. L. 13 cm; B. 8,5 cm; H. 2,7 cm Schliemann : Zweite Stadt; Schmidt: II.- V. Ansied lung Lit. : Schliemann 1884, 190 Nr. 85; Schmidt 1902, 266 No. 6755; Müller
Karpe 1994, 208 Taf. 40,9. Verscholl en
Inv. Nr. Sch 6756 Gussform, fragmentiert, zwe ite ilig, Stein. Negative fiir kle ine Messer, Sekundärverwendung, hergeste llt aus zerbrochener Gussform. L. I 0,0 cm; B. 6,3 cm; H. 2,3 cm Schmidt: 11.- V. Ansiedlung Lit. : Schmidt 1902, 266 No. 6756. Verscholl en
250
lnv. Nr. Sch 6757 (Taf. 40 Gussform, fragmentiert, zwe iteilig, Stein, mehrse itig gearbeitet, Negati v fiir ein kle ines Messer und e inen we iteren Gegenstand mit Klinge, Sekundärverwendung, hergeste llt aus zerbrochener Gussform L. 19,5 cm; B. 5,5 cm; H. 3,6 cm Schmidt: II.- V. Ansiedlung
Lit.: Götze 1902, 368 Beil. 45,111 ; Schmidt 1902, 266 No. 6757; MüllerKarpe 1994, 204 Taf. 34,2. Verscholl en
lnv. Nr. Sch 6758 (Taf. 13a)
Gussform, einteilig, vo llständig erhalten, grob mit Sand bzw. Steingruss gemagerter Ton ohne Häckse l, he llrotbraun-hellgrau. Negati ve fiir fiinf Stabbarren (Meißel nach Schmidt), aus Wandscherbe eines Pithos sekun
där gearbeitet, ve1jüngt sich zu unterer Seite. Starke Ru ßspuren in und um alle Negati ve, an einer Ecke auf dem Boden ebenfa ll s Rußverfa rbungen
(sekundär?), Negativinnenräume sehr gut geglättet. L.l 8,5 cm; B. (auf breiter Seite) 14,7 cm, (au f schmaler Seite) 12,3 cm; H. 4,3- 4,5; Volumen der Stäbe: ca. I 0 ml (gemessen am zweiten intakten Negati v); Gewicht : 1534 g Schmidt: 11.- Y. Ansiedlung; Easton: Troja II , North-South trench, Nort
hern sector, Area v: D 4- 6, deposit 6 Lit. : Schl iemann 1974, Taf. 70, 1563; Schliemann 188 1, 484 Nr. 605;
Schmidt 1902, 266 No. 6758.6759; Müller-Karpe 1994, 197 Taf. 15, I;
Easton 2002, 172 Fig. 152, 72 - 11 5.
lnv. Nr. Sch 6759 (Taf. Sb) Gussform, eintei lig, Tuffs tein. Negati ve fiir vier stabförmige Gegenstände
oder Meißel, zweiteilig, einseit ig bearbeitet, halbrund im Querschnitt, Oberfläche auf Negativse ite gut geglättet, auf gerundeter Seite kaum be
arbeitet, dunkle Rußverhirbungen im Inneren der Negati ve und auf den Flächen dazwischen. L. 2 1 cm; B. 23 cm; Gewicht : I 024 g
Schmidt : 11.-Y. Ansiedlung Lit. : Schmidt 1902, 266 N r. 6759. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6760 (Taf. 14e)
Gussform, einte ilig, Ton, ungewöhn liche, dre iecki ge Form, Negat ive fiir
dre i Flachbei le
L. 28,5 cm; B. 26,5 cm Schmidt: 11.- V. Ansiedlung; Easton: Troja II , North-South trench, Nort
hern sector, Area v: D 4- 6, depos it 6
Lit. : Schliemann 1974, Taf. 70, 1566; Schmidt 1902, 266 Nr. 6760 Easton 2002, 172 Fig. 152, 72- 11 26. Verschollen
lnv. Nr. Sch 6761 (Taf. 6a) Gussform, einte ilig, vo llständig erha lten, Ton, sekundär als Gussform verwendete Pithosscherbe, Negati v fiir ein Flachbe iL L. 30 cm; B. 19 cm Schmidt : 11.- Y. Ansiedlung; Easton: Troja 11- Ill , North-South trench,
Northern sector area iii : CD 4, deposit II Lit. : Götze 1902, 308 f. Beil. 45,1; Schmidt 1902, 266 No. 6761 ; MüllerKa rpe 1994, 199 Taf. 18,1; Easton 2002, 158 Fig. 147,72-756. Verscholl en
Inv. Nr. Sch 6762 (Taf. 13d) Gussform, fragmentiert, einteilig, rötliches Ton-/Sandgemisch, grob ge
mager! mit Quarzsand und vielen mittelgroßen und größeren Geste inspartike ln , aus der Wandscherbe eines Pithos gearbeitet. Zweiseitig bearbeitet, Negative für mindestens e in Flachbeil und zwei wei tere Flachbeile oder
Meiße l, auf zweiter Seite mindestens sechs Negative fiir Stabbarren. Sehr
starke Gebrauchsspuren, Rußspuren in· den Negati ven und an allen angrenzenden Bereichen, an mindestens einer Stell e grüne Patina zwischen zwei Nega tiven, an zwei Stellen größere Lu ftblasen bzw. Ri sse vom Materialzusammenzug direkt an den Bruchkanten. L. 13,2 cm; B.: 12,9 cm; H. 5,9 cm; Gewicht : 10 12 g Schm idt: II.- V. Ansiedlung Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 6762 .6763 .
Inv. Nr. Sch 6763 Gussform, fragmentiert, einteilig, Ton. Negative auf zwei Seiten fiir
Flachbeile und Meißel.
L.l3cm; B.14cm
Schmidt: I!.-V. Ansiedlung
Lit.: Sclunidt 1902, 266 No. 6762.6763.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6764
Gussform, fragmentiert, zweiteilig, Stein. Negativ flir einen Griffzungen
dolch.
L. 8,5 cm
Schmidt: 11.- V. Ansiedlung
Lit.: Schmidt 1902, 266 No. 6764.
Verschollen
Jnv. Nr. Sch 6765 (Taf. 12b)
Gussform, fragmentiert, zwe iteilig, grünlicher Glimmerschiefer. Negativ
fiir eine Doppelaxt, in Mitte Aussparung fiir Schaftloch als runde Ver
tiefung in der Form angelegt. Oberfläche geglättet, allseitig deutliche
Herstellungsspuren, auf Rückseite Meißelspuren , auf Unterseite (Stand
fläche) und Seitenflächen Sägespuren, zwei gebohrte Passlöcher in bzw.
kurz oberhalb der Standfläche. lm Negativ weißliche Ablagerungen sowie
Rußspuren am linken Rand und dem oberen Abschluss des Formnegativs,
außerdem auf der Passfläche zwischen beiden Fonnhälften . Leichte Hitze
risse aufNegativinnenraum und dem Boden der Form
L. 16,5 cm; B. 4,4 cm; H. 8,2 cm; Gewicht: 933 g
Schmidt: VI. Ansiedlung
Lit.: Götze 1902, 397 Beil. 46, VII; Schmidt 1902, 266 No. 6765; Müller
Karpe 1994, Taf. 48,4;
Inv. Nr. Sch 6766 (Taf. 12c)
Gussform, fragmentiert , dunkelgrauer Glimmerschiefer. Einteilig, dreisei
lig bearbeitet, "bootartige" Form mit sich stark vetjüngenden Endbereichen . Negative fiir einen Rundbarren und einen T-förmigen Gegenstand ,
zwei !v!esser, eine Griffzunge, e ine Axt oder Flachbei I. Gegenstände auf
der Rückseite nachträglich eingearbeitet, Oberfläche auf Seite mit Beil
negativ sehr gut poliert (auch im Negativraum), auf gegenüber liegender
Seite grobe Spuren der Formgebung und kleinflächige Abplatzungen,
hier keine Oberflächenpolitur. Negativ fur T-förmigen Gegenstand sehr
gut poliert, Negativ fur rundes Objekt dagegen mit groben Arbeitsspuren
belassen, deutliche Nutzungsspuren an Randbereichen der Negative, in
nerhalb des Beilnegatives kleinere Materialausbrüche.
L. 15,5 cm; B. 9,9 cm; H. 5,6 cm; Gewicht: 1556 g
Schliemann : Dritte verbrannte Stadt; Schmidt: VI. Ansiedlung; Müller
Karpe: Troja II; Easton : Troja ll-1!1 , North-South trench , Northern sector,
area iii: CD 4, deposit II
Lit.: Schliemann 1881 , 484 Nr. 602; Schmidt 1902, 267 Nr. 6766; Dema
kopoulou 1990, 241 f.; Müller-Karpe 1994, 200 Taf. 20,8; Easton 2002,
158 Fig. 147,72 - 754.
Inv. Nr. Sch 6767 (Taf. 6c)
Gussform, einteilig/mehrteilig (?), grüner Glimmerschiefer mit hohem
GlimmeranteiL Trapeziode form, vetjüngt sich zu längerer Seite hin. Se
kundärnegative fiir Stabbarren und T- fönnigen Gegenstand. Form grob
geglättet, deutliche Herstellungsspuren an allen flächen, an Schmalseiten
Sägespuren und Spuren von mechanischem Abbruch des Grundmaterials ,
längere Außenkanten natürlich belassen. Rußspuren in Negativinneren für
Rundbarren mit mehrfacher Rissbildung und leichten Materialausbrüchen,
Negative fiir T-fönnigen Gegenstand und " Stabbarren" keine Rußspuren.
L. 13 ,8; B. (an schmaler Seite) 9,3 cm, (an breiter Seite) 13 , 7 cm; H.
I ,9-2,9 cm; Volumen des Rundbarrens: ca. I 0 ml ; Gewicht: 798 g
Schmidt: VI. Ansiedlung
Lit.: Götze 1902, 397 Beil. 46,V; Schmidt 1902, 267 No. 6767; Müller
Karpe 1994, 198 Taf. 16,2 (hier !:11schlich als Fragment bezeichnet).
Inv. Nr. Sch 6768a.b. (Taf. 8)
Gussform, fragmentiert, nur Schaft- und Mittelteil erhalten , hell rötlicher
Ton, nur wenig gemagett mit wenigen größeren Einschlüssen , einteilig
aber fiir Bearbeitung durch Götze in zwei Hälften gesägt, Negativ fiir
Schaftlochaxt, sehr exakt ausgeformt, auseinander gesägt, in der form und
auf äußerer Oberfläche Reste von Überzug mit feiner heller Tonschlemm-
schicht, leichte Rußspuren an Außen- und Innenfläche nur im Bereich des
Schaftes, keine Passkerben, keine Schnürspuren, keine Nutzungsspuren
I. Hälfte: L. 14,3 cm B. 9,8 cm; H. 2,8 cm; Gewicht: 230 g
2 . Hälfte: L. 14,3 cm; B. 9,9 cm; H. 2, 7 cm; Gewicht: 232 g
Schmidt: Vli.-IX. Ansiedlung; Götze : Per. VI-V!!
Lit.: Schmidt 1902, 267 No. 6768a.b; Götze 1902,405 Fig. 404; Maxweii
Hyslop 1949, 112; Hundt 1986, 144-148; Müller-Karpe 1994, Taf. 61 ,4.
Inv. Nr. Sch 6769 (Taf. 4c)
Gussform, fast vollständig, lediglich eine Ecke fehlt , grüner Stein (wahr
scheinlich Glimmerschiefer). Zweiteilig, mindestens ein Passloch auf der
linken formseite , Passkerben aufäußer Oberfläche der rechten Formseite.
Negativ für Tüllenbeil mit Öse, hori zontal geripptem Rand und Linien
Musterung.
L. 13 ,5 cm; B . 6 cm
Schmidt: Vll.-IX. Ansiedlung; Götze; Per. VI-VII
VI. Ansiedlung
Lit.: Götze 1902, 405 Fig. 405 und Beil. 46, IX; Schmidt 1902, 267
No. 6769; Müller-Karpe 1994, Taf. 49,5.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6770
Gussform, fragmentiert , zweiteilig, Stein. Negativ für einen Ring.
Dm . 7 cm
Schmidt: VII.-IX. Ansiedlung
Lit.: Schmidt 1902, 267 Nr. 6770
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6771
Gussform, fragmentiert , Glimmerschiefer. Zweiteilig, Negativ fiir einen
gerippten ringförmigen Anhänger mit kugeligem Fortsatz, links oben und
rechts unten neben dem Negativ je ein Passloch, Eingusskanal an Fortsatz.
L. 6,7 cm; B. 5 cm
Schliemann: Vierte prähistorische Stadt; Schmidt: VIJ.- JX. Ansiedlung
Lit.: Schliemann 1881 , 633 Nr. 1268; Schmidt 1902, 267 No. 6771 , Mül
ler-Karpe 1994, 215.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6772 (Taf. 13b)
Gussform, fragmentiert , Stein. Zweiteilig, Negative fiir Ringe, Anhänger
und Perlen , innerhalb der Ring- und Perlennegative sowie außerhalb der
Matrizen insgesamt neun Passlöcher fiir horizontal einzusetzende Stifte,
keine Nutzungsspuren
L. 8 cm; B. 7,5 cm; H. I ,7 cm
Sclunidt: Schicht VII, Sektor B7; Müller-Karpe: VII. Schicht
Lit .: Götze 1902, 420 fig . 454; Schmidt 1902, 267-268 No. 6772; Müller
Karpe 1994, 214.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6773 (Taf. 4h)
Gussform, fragmentiert , Stein. Zweiteilig, Negativ fiir mindestens vier
nebeneinander angebrachte Pfeilspitzen.
L. 7,5 cm; B. 5 cm
Schliemann: Dritte prähistorische Stadt; Schmidt: VII.-IX. Ansiedlung
Lit.: Schliemann 1881 , 484 Nr. 604; Schmidt 1902, 268 No. 6773 .
Versebollen
Inv. Nr. Sch 6774 (Taf. 4j)
Gussform, fragmentiert, schwarzer kristalliner TufT. Wahrscheinlich zwei
teilig, einseitig bearbeitet, Negativ fiir eine Perle und zwei Ohrringe, au
ßerdem für einen nicht mehr zu identifizierenden Gegenstand. Oberfläche
auf beiden Seiten gut geglättet, auf Rückseite deutliche Herstellungs
spuren. Form mehrfach gerissen, Nutzungsspuren nicht mehr feststellbar.
L.), 6,3 cm; B. 5,5 cm; H. I ,95 cm; Gewicht 76 g
Schliemann : Erste prähistorische Stadt; Schmidt: VII.- IX. Ansiedlung;
Schäfer und Müller-Karpe: Troja ll; Easton: Mainly li-V, North Platform,
Area i.5
Lit.: Schliemann 1874, Taf. 22,592; Schliemann 1881, 282, Nr. 103;
Schmidt 1902, 268 No. 6774; Schäfer 1971, Abb. I ; Müller-Karpe 1994,
Taf. 57, I 0; Easton 2002, I 06 fig . 132,72 - 18a.
251
Inv. Nr. Sch 6775 (Taf. 4i) Gussform, fragmentiert, Glimmerschiefer. Zweite ilig, Negativ fiir e inen Pfriem, rechts oben und links unten neben dem Negativ je ein Pass loch, Einguss erfo lgte über die Spitze des Pfriems. Keine Aussagen zu Nutzungsspuren möglich L. 5, I cm; B. 3,8 cm Schliemann: Dritte prähistorische Stadt ; Schmidt : Vll.- IX . Ansiedlung; Easton: Troja IV- V, East-West trench, Area ii .5 Lit.: Schliemann 188 1, 484 Nr. 603 ; Schmidt 1902, 268 No. 6775; Easton
2002, 230 Fig. 169,73-207. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6776 (Taf. 4k) Gussform, fragmentiert, Glimmerschiefer, mehrteilig, rechtecki ger Querschnitt, wahrscheinlich einseitig bearbeitet, Negati v für eine Schwertoder Dolchklinge mit deutli ch ausgeprägter Mittelrippe und abgerundeter Spitze, pro Klingenseite je drei Entgasungskanäle L. 12,5 cm; B. 5,3 cm; H. 3,8 cm Schliemann: Vierte prähistori sche Stadt Schmidt : Vll.- IX. Ansiedlung;
Easton: Troja V?, East- West trench, Area v.4 Lit. : Schliemann 1874, Taf. 142,28 12; Schliemann 188 1, 633 Nr. 1267; Schmidt 1902, 268 No. 6776; Easton 2002, 240 Fig. 173 ,73-502.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6777-6778 Gussform, fragmentiert, Stein, zweite ilig. Negati v fiir pfriemartige Gegenstände, Pass löcher auf Seitenfläche.
Keine Maße Schmidt : Vll.- IX. Ansiedlung Lit.: Schmidt 1902, 268 No. 6777.6778.
Verscholl en
Inv. Nr. Sch 6779 (Taf. 3b) Blasrohrdüse, grauer Glimmerschiefer (oder Gneis). Tülleninnenraum und Luftkanal etwa g leich lang, konisch, Oberfläche gut poliert mit kleineren Materialausbrüchen, Werkzeugspuren von Tüllenherstellung, leichter Absatz an Übergang von Tülle zu Kanal , gle ichmäßige Wandstärke. An Luftkanalöffnung Spuren von Einschürfung einer Mulde, bevor Loch gebohrt wurde, Bohrspuren sichtbar, keine Nutzungsspuren. L. 7,3 cm; B. (M itte): 3,5 cm; Maße Tüllenmund. 4 cm x 4 cm; Maße Tülle: 2,6 cm x 2, 7 cm; Maße Kanalöffnung: 0, 7 cm x 0, 7 cm; Gewicht: 124 g Schliemann : Dritte verbrannte Stadt ; Schmidt: undatierbar; Müller-Karpe: Troja ll Lit. : Schliemann ! 88 1, 457 N r. 476; Schmidt 1902, 268 Nr. 6779; Demakopoulou 1990, 2 17; Müller-Karpe 1994, 189 Taf. 3, 15.
Inv. Nr. Sch 6780; alte Nummer 523 (Taf. 3e) Blasrohrdüse, vo ll ständig erhalten, schwach gebrannter hellgrau- bräunlicher Ton, relativ viele Hohlräume von organi schen Magerungsbestandteilen. Konisch, unregelmäßige Wandstärke und unrege lmäßige Ausformung der Düse, eingeritztes Zeichen in Form einer römischen lli auf Außen
fl äche, Luftaustrittsöffnung einse itig verschoben, Öffnung recht klein fiir Düsengröße und von Feuerseitiger Oberfläche nach innen gebolu·t. Tülleninnenraum mit dünner Tonschicht überzogen (Tonwulst erhalten), ke ine eindeutigen Nutzungsspuren erkennbar, in Tüllenraum zwei Risse. L. 6 cm B. (Mitte) 3,8 cm; Tüllenmund: 3,5 x 3,7 cm; Dm . 3 cm; Wandstärke: 0,8- 0,9 cm; Austrittsöffnung: 0,5 x 0,6 cm; Gewicht: 60 g Schliemann: Fünfte prähistori sche Stadt ; Müller-Ka rpe: Schicht V, in I 0
Fuß Tiefe Lit. : Schliemann 188 1, 650 Nr. 1338; Schmidt 1902, 268 No. 6780.678 1;
Müller-Karpe 1994, 190Taf. 3,25
Inv. Nr. Sch 6781 (Taf. 3f) Blasrohrdüse, vo llständig erhalten, grob gemagerter Ton mit viel organischem Materi al, kle inen Ste ineinschlüssen und wenig Glimmer. Typ mit langem Absatz und sehr kurzem Luftkanal, auf Außenfläche eingeritztes Ze ichen ähnlich einer römischen 111 . Rundliche gedrungene Form, große Tülle mit unterschiedlichen Wandstärken, Luftkanal von feuerseiliger Seite gebohrt (Materialaufwölbung in der Tülle). Oberfläche geglättet, kle inere Ri sse an Tüllenmund, leichte Rußspuren auf unterer Seite der Oberfläche.
252
L.5, 7 cm; B. (Mitte). 4, l cm; Maße Tüllenmund. 3,85 x 3,9 cm; Maße Tülle. 2,8 cm x 2,8 cm; Maße Kanalöffnu ng. 0,9 cm x 0,95 cm; Gewicht : 67 g Schliemann : Fünfte prähistori sche Stadt; Müller-Karpe: Schicht V, in 10 Fuß Tiefe. Lit. : Schliemann 188 1, 650 N r. 1339; Schmidt 1902, 268 Nr. 6780.678 1; Kat. Berlin/Sofi a 198 1 Nr. 3 10 Abb. 45; Müller-Karpe 1994, 190 Taf. 3,26.
lnv. N r. Sch 6782 Blasrolu·düse, Ton, konisch, mit eingerit ztem kreuzförmigem Zeichen
Dm. 5 cm; H. 7 cm N icht datierbar Lit. : Schmidt 1902, 268 No. 6782. Verscho ll en
Inv. Nr. Sch 6783 (Taf. 3a) Blasrohrdüse, Ton gemagert mit Häckse l und Steingruß (teilweise sehr
große Gesteinspartike l}, fl eckig dun kelgrau/he llgrau bis hellbraun-orange. Typ mit langem Kanal und kurzem Absatz, g leichmäßige Wandstärke, kein Überzug, feuerseiliges Ende bestoßen, dort keine stärkeren Brandspuren als auf übriger Oberfläche. AufU nterse ite Rußspuren, an Oberse ite
rötliche Färbung, Oberfläche geglättet, L. 9, I cm ; Dm . max. 4,3 cm, Maße Tüllenmund. 4,35 cm x 4,2 cm; Maße
Tülle: 2,7 cm x 2,75 cm; Dm. Düse 0,8 cm, Gewicht : 116 g, Wandstärke: 0,9- 1,1 cm Nicht dati erbar Lit.: Schmiel! !902, 268 Nr. 6783 - 6798; Müller-Karpe 1994, 190
Taf. 3,28 .
Inv. Nr. Sch 6784 Blasrohrdüse, Ton H. 5- 9 cm Nicht datierbar Lit. : Schmidt 1902, 268 N r. 6783-6798. Verscho llen
Inv. Nr. Sch 6785 (Taf. 3g) Blasrohrdüse, fast voll ständig erha lten, bräunlicher Ton, sehr grob gemagett, viele größere Einschlüsse von Steinen und organischem Material. Konisch, Oberfläche grob geglättet, unrege lmäßig geformt, sehr dünner he ll grau-bräunlicher Überzug auf Oberfläche und Tülleninneren, deutliche Rußspuren vor allem auf der unteren Oberfläche der Düse, Spuren von Hitzee inwirkung an Luftaustrittsöffnung. Wandstärke variiert an Tü llenmund, Luftkanal geradlinig ohne Absatz, Kanal deutlich größer als bei
anderen Düsen, kleinflächige Ausbrüche an Tüllenmund. L.6,8 cm; B. (Mitte) 4 cm; Maße Tüllenmund. 3,8 cm x 3,85 cm; Maße Tüllenöffnung. 2,8 cm x 2,8 cm; Maße Kanalöffnung: I cm x l cm; Ge
wicht : 8 1 g Nicht dati erbar Lit. : Schmidt 1902, 268 No. 6783 - 6798; Kat. Berlin/Sofia 198 1 Nr. 309 Abb. 45 ,Müller-Karpe 1994, 189 Ta f. 3,22.
lnv. Nr. Sch 6786 Blasrohrdüse H. 5- 9 cm N icht dati erbar Lit. : Schmidt 1902, 268 No. 6783-6798. Verschollen
lnv. Nr. Sch 6787 (Taf. 3i) Blasrohrdüse, Ton, vollständig erhalten. Typ: mit langem Absatz und sehr kurzem Luftkanal, koni sch, Magerung scheinbar mittelgrob mit wenigen größeren Steinpartikeln , überzogen mit rötlich-hellbrauner Tonschicht. Verstreichspuren deutlich sichtbar, Oberfl äche geglättet, aber leicht uneben, leichte Rußspuren auf jeder Se ite, untere Wand di cker als obere, Lu ft kanal von fe uerseiliger Fläche gebohrt (Materialaufwölbung in Tülleninnenraum). Tülleninnenraum grob geg lättet und rau, Wandstärke gleichmäßig, an Luftaustrittsöffnung leichte Spuren von Hitzeeinwirkung. L. 6,05 cm; B. (Mitte). 3,25 cm; Maße Tüllenmund. 3,4 cm x 3,65 cm; Maße Tüllenöffnung: 2, I. cm x 2,2 cm ; Maße Kanalöffnung: 0,7 cm x 0,65 cm;
Gewicht: 57 g Wandstärke: 0,95- I, I, cm N icht dati erbar Lit.: Schmidt 1902, 268 No. 6783 - 6798.
Inv. Nr. Sch 6788 und 6789 Blasrohrdüse, Ton H. 5-9 cm
Nicht datierbar Lit.: Schmidt 1902, 268 No. 6783-6798. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6790, alte Nummer: 1476 (Taf. 3c) Blasrohrdüse, vollständig erhalten, konisch, hellgrau-beiger Ton, fein mit Glimmer gemagert, keine gröberen Partikel, Oberfläche grob geglättet und uneben. Austrittsöffnung recht groß, Wandstärke gleichmäßig, leichte Rußspuren auf gesamter Oberfläche. An Innenseite der Tülle durchgehender Riss (dringt nicht bis an Außenoberfläche), leichte
Riffelung innen am Luftkanalansatz, an Außenseite leichter Riss an Düsenrand. Weder innerhalb der Tülle, noch an Luftaustrittsöffnung Spuren von Nutzung L. 6,55 cm; B. (Mitte) 3,5 cm; Wandstärke: 0,8 cm, Tüllenmund: 3,2 cm x 3,4 cm; Tüllenö!Tnung: 2,2 cm x 2,35 cm; Austrittsöffnung: 0,8 cm x 0,75 cm; Gewicht: 70 g
Nicht datierbar Lit.: Schmidt 1902, 268 No. 6783 - 6798.
lnv. Nr. Sch 6791-6798 Blasrohrdüse, Ton H. 5- 9 cm
Nicht datierbar Lit. : Schmidt 1902, 268 No. 6783-6798. verschollen
Inv. Nr. Sch 6799 (Taf. 17d)
Polierstein für Pfeilspitzen, G limmerschiefer. Rechteckige Form, auf oberer Seite horizontal verlaufende Rille, im zentralen Bereich des Körpers eine offenbar nur begonnene Durchlochung, Oberfläche geglättet, keine Aussagen zu Nutzungsspuren möglich.
L. 15,8 cm; B. II cm Schliemann: Dritte, verbrannte Stadt, Tiefe 32 Fuß; Easton: Mainly li-V, North Platform, Area i,5 Lit .: Schliemann 1881 ,486 Nr. 606; Schmidt 1902, 269 No. 6799-6803 (bezeichnet als ,,Bratspießstiitze", oder "Guss/richter"); Müller-Karpe 1994,253 Taf. 80, 13 ; Easton 2002, 106 Fig. 132,72-93 . Verschollen
Inv. Nr. Sch 6803 (Taf. 17c) Polierstein für Pfeilspitzen, Glimmerschiefer. Quadratische Form, auf oberer Seite horizontal verlaufende Rille, in Körpermitte durchlocht . Oberfläche wohl sehr gut geglättet, keine Aussagen zu Nutzungsspuren möglich. L. 3,9 cm; B. 3,5 cm Easton: Troja ll, East-West trench, area iii.4
Lit.: Schliemann 1874, Taf. 130,2577; Schliemann 1881 , 486 Nr. 607; Schmidt 1902, 269 No. 6799-6803 (bezeichnet als ,,Bratspießstiilze" oder Achsen für rotierende Geräte) ; Müller-Karpe 1994, 253 Taf. 80,14; Easton 2002, 235 Fig. 171 ,73 - 337. Verschollen
Tnv. Nr. Sch 6807 (Taf. 17a) Polierstein fiir Pfeilspitzen, vollständig erhalten, weißliches feinkristallines Gestein von dünnen gräulichen Bändern durchzogen. Quaderfönnig, durchgehende Durchlochung in Körpermitte, all seitig gut geglättet, an Längsseite drei parallel verlaufende Rillen mit flachem trapezfdrmigem Querschnitt. Schleifspuren auf Rilleninnenseite, leichte Rissbildung an Bohrloch und Rillenabschluss , leichte Materialausbrüche an Kanten , keine NutzungsspureiL L. 5,61 cm; B. 51 ,60 cm; B. Rillen 0,4- 0,31 cm; Tiefe Rillen 0, 14-0,18 cm, Dm. Bohrloch I ,68-1 ,92 cm; Gewicht. 327 g
N icht datierbar Lit.: Schmidt 1902, 269 No. 6807.
Inv. Nr. Sch 6817-6822/3 (Taf. 1b) Schmelztiegel, grau-röt li cher mit Häcksel gemagerter Ton, offenbar Reste eines hellen , beigefarbenen Tonüberzugesam Tiegelboden und dem Randbereich. Spitzovale Form mit nicht abgesetztem Ausguss, Innenraum sehr
flach, Wände sehr massiv und gleichmäßig, Standfläche leicht gerundet: Starke blasige Verschlackungen des Tiegelrandes an mindestens zwei Sei
ten (aufgrund starker Ergänzungen ist Zustand des übrigen Randes nicht
beurteil bar) , sehr starke Kupferauflagerungen sowohl von erstarrten bzw.
nicht ganz geschmolzenen Metallstücken, als auch von Kupferschlacke
auf gegenüberliegender Seite. XRF-Messung: Kupferpartike l mit hohem EisenanteiL Rußspuren an allen erhaltenen Flächen, melu·ere Spannungsrisse an erhaltenem Material L.l4,8 cm (mit Ergänzungen); B. II ,3 cm (mit Ergänzungen); H. 4,4 cm
(mit Ergänzungen); Wandstärke: nicht exakt bestinunbar; Volumen: nicht
messbar, zu stark fragmentiert und ergänzt; Gewicht: nicht messbar, zu
stark ergänzt
Keine Sch ichtenangabe
Lit.: Schmidt 1902, 268 No. 6817-6822 ; Müller-Karpe 1994, 191
Taf. 8, 1.
Inv. Nr. Sch 6817-6822/4, alte Nr. Sch 6818 (Taf. 2, e)
Schmelztiegel, ovale Form mit spitzem Ausguss, dunkelgrauer angeblich
mit Kuhdung gemagerter Ton, keine groben Magerungsbestandteile fest
stellbar. Wandstärke relativ gleichmäßig und massiv, Wände vetjüngen
sich leicht zum Rand hin, zwei einseitig angebrachte Standfiiße, aufgrund starker Ergänzungen keine Aussagen zu Herstellungsspuren und Ton
beschaffenheit mehr möglich. Oberfläche sorgfaltig geformt und grob geglättet, leicht gewölbter Boden, viele Spannungsrisse durch Hitzeein
wirkung im gesamten Tiegelinnenraum und den Außenwänden, großflä
chige Verschlackungen im gesamten rechtsseitigen Randbereich bis kurz
vor den Ausguss. Auf gleicher Seite zwei Knubben unterhalb der Wand
fläche an Boden, Rußspuren auf Tiegelboden und im Lnnemaum. XRF
Messung: in Tiegel innerem: Kupfer- und Zinnpartikel , auf Tiegelboden an
Außenseite: Zinnpartikel ; ehem. in Tiegelinnerem anhaftende Kupferreste
(nach Metallanalysen : Goldtei lchen, kohlesaures mit Kristallen und rotem
Kupferoxid vermischtes Kupfer).
L.l4 cm; B.ll,2; H. 4,8 cm; Wand stärke: I ,6 cm- 0,8 cm; max. Volumen:
85 ml; wahrscheinlich genutztes Volumen: 28 ml; Gewicht: (rekonstruiert) ca. 498 g
Easton : Troja Il, East-West Trench, area v.9 Lit.: Schliemann 1874, Taf. 140,2769; Schmidt 1902, Schmidt 1902, 268
No. 6817 - 6822; Müller-Karpe 1994, 194 Taf. 12,5; Easton 2002, 244
Fig. 174,73-408.
Inv. Nr. Sch 6819 (Taf. la)
Schmelztiegel, Ton, leicht gebrannt, mit Kuhdung gemagert , spitzovale Form mit Ausguss, keine Handhaben, Nutzungsspuren vorhanden aber
nicht beurteilbar Keine Maße
Schliemann: Vierte prähistorische Stadt, Tiefe 19 Fuß
Lit .: Schliemann 1881,622 Nr. 1197; Schmidt 1902,268 No. 6817 - 6822;
Müller-Karpe 1994, Taf. 9,4.
Verschollen
Inv. Nr. Sch 6823 (Taf. lg)
Schmelztiegel, fragmentiert , sehr stark ergänzt, kahnfdrmig mit zwei
Griffzapfen, dunkelgrauer- schwarzer mit Häcksel gemagerter Ton.
Zahlreiche Rußflecken an Oberfläche, Griffzapfen flächig rußig und mit
Metallpartikeln bedeckt, an Innen- und Außenflächen anhaftende Metall
reste . Sekundärer Brand in zweitem Weltkrieg, starke Verschlackungen aufrechter Ausgussseite und noch vorhandenen Randbereichen, dort auch
ein Hitzeriss. L. 15,8 cm, B. mit Henkel11 ,85 cm, ohne Henkelmax. 8,6 cm; H. 4,7 cm;
Wandstärke rechts: 1,4 cm; Wandstärke links: 1,65 cm; Bodenstärke: 1,3 cm; Gewicht (mit Ergänzungen): 273 g; Volumen: 142 ml
Nicht datierbar
Lit .: Schmidt 1902, 268 No. 6823; Müller-Karpe 1994, 194 Taf. 12,6.
Inv. Nr. Sch 6825-6830
Schmelztiegel, Ton, napfartig
Dm. Öffnung 3-7 cm; H. 1,8-5,5 cm
Nicht datierbar
Lit.: Schmidt 1902, 268 No. 6825 - 6830 Verschollen
253
Inv. Nr. Sch 6831 (Taf. lc) Schmelztiegel, Ton, schwach gebrannt , mit Ausguss und breitem Griffansatz. L. 12 cm; Dm. Öffnung 7 cm; Br. 5,3 cm; H. 4,5 cm Schliemann : Dritte verbrannte Stadt ; Müller-Karpe: Troja II ; Easton: Troja II , Western Area iv.9 Lit.: Schliemann 1874, Taf. 150,2998; Schliemann 188 1, 47 1 Abb. 5 12; Sclunidt 1902, 268 No. 683 1; Müller- Karpe 1994, 194 Taf. 12, 3; Easton
2002, 279 Fig. 182,73 - 63 1. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6832 (Taf. 2a) Schmelzti ege l, vo llständig erhalten, sehr hell rötlicher Ton, schwach gebrannt, Magerung sehr grob mit mehrheitlich organischen Einschlüssen und größeren Steinpartikeln . Länglich ova l, insgesamt eher grob geformt, Innenbereich geg lättet, Wandstärken varii eren nur unwesentlich. An
Unterseite meluere tiefe Spannungsri sse von starker Hitzee inwirkung (besonders direkt am max imalen Wölbungspunkt des Bodens), an Boden leichte einseitige Rußspuren, auf gegenüberli egender Seite rötliche Brandspuren. In Tiegel innenbereich auf Mittelteil und linker Seite leicht graue Rußspuren mit Spuren leichter Versinterung. L. I 0 cm; B. 5,5 cm; H. 2,8 cm; Tiegeltiefe: 2,2 cm; Wandstärke: 0,6- 1 cm; max. Vo lumen: 25 ml ; max. genutztes Volumen: 8 ml ; Gewicht : 11 6 g Schliemann : Dritte prähi stori sche Stadt ; Müller-Karpe: Schicht II Lit. : Schliemann 188 1, 456 f. Nr. 473; Schmidt 1902, 269 No. 6832 - 6845; Demakopoulou 1990, 2 17; Müller-Karpe 1994, 194 Ta f. 12,8.
Inv. Nt·. Sch 6833 Schmelztiegel, nussschalenfö rmig bis längli ch L. 3-9,5 cm; H. I ,5 cm N icht datierbar Lit. : Schmidt 1902, 269 No. 6832-6845. Verschollen
Inv. Nt·. Sch 6834 (Taf. 2c) Schmelztiegel, fast vollständig erhalten, he ll rötlicher Ton, Magerung recht grob mit mitte lgroßen Einschlüssen und wenig Glimmer. Läng lich ova l, Innense ite geglättet, Außenseite grob geformt und nicht übera rbeitet, starke Rußspuren an gesamter Unterse ite. In Tiegelinnerem einseitig dunkelgraue Rußverfarbungen, an melueren Randbere ichen kle inere oberflächliche Spannungsri sse. In Tiegelinneren rötli ch schimmernde Metallpartikel, keine verschlackten Bereiche, Wandstärke variiert leicht. XRF-Messung: in Tiegelinneren Kup fe r- und Zinnparti ke l, auf Tiegelboden an Außense ite ZinnpartikeL L. 9,9 cm; B. 4 cm; H. 2,7 cm ; Tiegeltiefe: 1,9 cm; Wandstärke . 0,4- 0,6 cm; max. Volumen: 20 ml ; wahrscheinlich genutztes Volumen: 2 ml ; Gewicht : 69 g Schliemann: Dritte prähistorische Stadt Lit .: Schliemann 188 1, 456 f. Nr. 472; Schmidt 1902, 269 No. 6832- 6845.
Inv. Nr. Sch 6835 (Taf. 2b)
Schmelztiegel, fast vo ll ständig erhalten , beigefarbener Ton, recht feine Magerung enthä lt starken Anteil an organischem Materia l und deutlich sichtbare GlimmerpartikeL Oberfläche außen und innen sorg!:ci ltig geglättet, Randbere iche deutlich ausgeformt und leicht nach innen gewölbt, wenige Abplatzungen an Se itenflächen. In Tiege linnerem leichte Rußver!:cirbungen, fl ach ebener Boden deutlich dunkler rußverfa rbt , Wandstärke g le ichmäßig. L. 9,55 cm; B. 4 ,9 cm; H. 2 cm; Tiegeltiefe: 1,5 cm; Wandstärke. 0,5-0,6 cm; max. Volumen: 22 ml ; genutztes Vo lumen: 5 ml ; Gewicht: 70 g Schliemann : Vierte prähistori sche Stadt Lit. : Schliemann 188 1, 622 Nr. 1199; Schmidt 1902, 269 No. 6832- 6845; Müller-Karpe 1994, 195 Taf. 12, 11 .
lnv. Nr. Sch 6836 und Sch 6837 Schmelzti ege l, Ton, nußschalenförmig bis länglich. L. 3-9,5 cm; H. I ,5 cm N icht datierbar Lit. : Schmidt 1902, 269 No. 6832-6845. Verschollen
254
Inv. Nr. Sch 6838 (Taf. 2d)
Schmelztiege l, voll ständig erhalten, grob gemagerter Ton mi t mittelgroßen und großen Gesteinspartikeln und organischem Material. Oval kle in und gedrungen, grob von Hand geformt, Oberfl äche ni cht geglätte; und unregelmäß ig, Bodeninnenfläche geglättet. Ein die Wand vo ll ständig durchziehender Spannungsri ss auf Oberfl äche, deshalb leichter Verzug der Wand, auf Bodenaußense ite rechtecki ger Abdruck (evtl. Zeichen) und wenige kle inflächige Rußspuren, an Tiegelinnense ite (besonders am Rand) fl ächendeckende Rußf:ci rbung, dort Oberfläche rauer als auf anderer Seite Wandstärke va riiert kaum . '
L. 7,55 cm; B. 5, 1 cm; H. 2,2 cm; Tiegeltiefe: 1,6 cm; Wa ndstärke. 0,5- 0,75 cm ; max. Volumen: 14 ml ; wahrscheinlich genutztes Volumen: 5 ml ; Gewicht: 50 g N icht datierbar
Lit .: Schmidt 1902, 269 No. 6832 - 6845; Kat. Berlin/Sofia 198 1, 82 Nr. 307 Abb. 45; tvlüller-Karpe 1994, 194 Taf. 12,7 .
Inv. Nr. Sch 6839-6845 Schmelzti egel, Ton, nußschalenfö nnig bis länglich. L. 3- 9,5 cm; H. 1,5 cm N icht datierbar Lit.: Schmidt 1902, 269 No. 6832- 6845. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6846
Schmelzti egel, Ton, längliche Form, viereckige Öffnung, mit Standfläche. L. 6 cm; Br. 3 cm; H. 3 cm Nicht datierbar Lit .: Schmidt 1902, 269 No. 6846 Verschollen
Jnv. Nt~ Sch 6847 (Taf. 2g) Schmelztiegel, Ton, längliche Form, mit Gri ffza pfen.
L. 9 cm; H. 3,7 cm Schliemann : Dritte verbrannte Stadt ; Müller-Karpe: Troja II ; Easton: Troja II Mitte, Westem area vi:BC5 - 6, deposit 8 Lit.: Schliemann 188 1,456 Nr. 47 1; Schmidt 1902, 269No. 6847.6848; Müller-Karpe 1994, 195 Taf. 12, I 0; Easton 2002, 303 Fig. 193 ,At.l 88- 3447x. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6848 Schmelzti egel, Ton, längliche Form, mit Gri ffzapfen. L. 6,5 cm; H. 2,9 cm Nicht datierbar Lit.: Schmidt 1902, 269 No. 6847 .6848. Verschollen
Jnv. Nr. Sch 6849 Schmelztiegel, Ton, nussschalenförmig bis länglich, quer verlaufende
Durchlochung des Bodens. L. 5 cm, H. 2,7 cm N icht datierbar Li t.: Schmidt 1902, 269 No. 6849. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6850 Schmelztiegel, Ton, mit Gussrinne und seitl ichem "Stützzapfen" . L. 7cm, B.5 cm, H.3 cm N icht datierbar Lit. : Schmidt 1902, 269 No. 6850. Verschollen
Inv. Nr. Sch 6851 52 Schmelztiege l, Ton, napfartig und nusschalenförmig länglich.
Keine Maße Nicht datierbar Li t. : Schmidt 1902, 269 No. 685 1. Verschollen
Inv. Nr. Sch 7005 (Taf. 16d) Steinhammer, vollständig erhalten, grünliches, hartes, feinkristallines Gestein mit Glimmerantei L Oberfläche gut geglättet aber nicht poliert, Bahn-
form I: schmal rechteckig, beidseitig gewölbt , Bahnform 2: oval geformt, längs plan , quer gewölbt. Aufbeiden Bahnen Nutzungsspuren mit leichten
Materialausbrüchen ( aufrechteckiger Bahn stärker ausgeprägt).
L. 6,7 cm; B, 4 cm, H. 3 cm, Maße rechteckige Bahn: 3,8 x 1,7 cm; ovale Bahn: 3,2 cm x 2,5 cm; Gewicht: 172 g
Nicht datierbar
Lit.: Schmidt 1902, 271 No. 6987-7036.
Inv. Nr. Sch 7179 (Taf. I Sc)
Schaftlochhammer, braun-gräulicher Diorit, feinkörnig . Bahnform I : annähernd quadratisch; Bal1nform 2: rechteckig. Schaftloch in Mitte, deutliche Bohrspuren, auf Oberflächen mehrere Einritzungen: Unterseite:
phallusartiges Gebilde mit Querlinien; auf anderer Seite des Schaft loches :
zwei übereinander angeordnete Pfeile bzw. Dreiecke, an Hammerkörper
zahlreiche weitere Linien, auf Oberseite und rechtsseitig neben Schaft
loch feine Risse, auf gegenüberliegender Seite zwei recht großflächige Abp latzungen. WalU'scheinlich lange und ausdauernd genutzt, auf Unter
seiten sowie beiden Bahnen ein stark ausgeprägter grauschwarzer Glanz,
auf Unterseite direkt um das Schaftloch ein schmaler glanzfreier Bereich,
Vertei lung an Rändern nicht linear. L. 7,6 cm; B. 3,95 cm; H. 3,6 cm; tvlaße Schaftloch: I ,9 cm x 2 cm; Maße
Bahn I: 3,4 cm x 3,4 cm ; Maße Bahn 2: 3,2 cm x 3,4 cm; Gewicht: 171 g
Schliemann 188 1: Dritte verbrannte Stadt; Götze : Troja I; Müller-Karpe:
Troja II Lit.: Schliemann 1881 , 488 f. Nr. 622; Schmidt 1902, 273 No. 7179; Götze 1902, 323 Fig. 258; Müller-Karpe 1994, 227 Taf. 64,3.
Inv. Nr. Sch 7262 (Taf. 15b)
Hammer oder Stößel , fragmentiert , hellgrau-grünliches grobkristallines
Gestein, eine Seite des Stückes fas t vo llständig ausgebrochen (Ausbruch ist nicht auf Nutzung zurückzufiihren) . Oberfläche geglättet, jedoch un
ebene Struktur mit vielen kleineren Vertiefungen, auf beiden Längsseiten
jeweil s mittig eine ova le Vertiefi.mg, zwe i Bahnen. Bahnform I: abge
rundet rechteckig, längs plan, quer gewölbt, Bahn 2: ursprünglich schmal länglich rechteckig und beidachsial gewölbt, an beiden Bahnen deutliche
N utzungsspuren in Form von kleinen einzelnen Materialausbrüchen sicht
bar, diese unterscheiden sich in der Ausprägung von den übrigen Dellen.
L. 8,8 cm; B. 4, 7 cm; H. 4,35 cm ; Maße I. Bahn. 4,5 cm x 3,95 cm; Maße 2. Bahn: ursprünglich ca . 3,8 cm x I ,9 cm; Gewicht: 348 g
Nicht datierbar
Schmidt 1902, 275 No. 7240- 7262 .
lnv. Nr. Sch 8383 (Taf. 15a)
Steingerät mit Rille, vo ll ständig erhalten, antlu·azitfarbener Diorit. Tra
pezoide Form mit angedeuteter, nicht ganz umlaufender Rille in Mitte,
ganze Oberfläche zeigt kleine Materialausbrüche, an wenigen Bereichen noch Politurspuren s ichtbar. Große Bahn hat abgerundet rechteckige
Form und ist plan und sehr gut geglättet, zu den Kanten hin leicht ab
schüssig gearbeitet. Auf Körper unterschiedl iche bewusst gesta ltete
Flächen beidseits der Mittelrille: auf planer Seite zwei ovale Bereiche mit leicht konkaver Wölbung und Bearbeitungsspuren ; auf gegenüber
liegender Seite eine plane Fläche und eine solche mit vielen kleinen Ein
schlägen, an Nacken keine Nutzungsspuren, auf großer Bahn kleine Aus
brüche an den Kanten. L. 29,2 cm ; B. ca. 12,8 cm ; H. ca. II ,6 cm: Breite der Rille ca. 3,3 cm:
Maße Bahn. 11,8cm x l3 ,5cm; Maße "Nacke11" . Ca. 7,1 cm x 7,5cm;
Gewicht: mehr als 5 kg Schliemann: Dritte prähistorische Stadt
Lit. : Schliemann 1881 , 491 Nr. 632; Schmidt 1902, 299 No. 8383.
Inv. Nr. Sch 8767-8775b (Taf. 161)
Hammer oder Stößel, glatter heller feinkristalliner Stein: Starke Rußspu
ren auf gesamter Oberfläche, we lche von Brand stammen (ob in Zweitem Weltkrieg oder in Troja ist nicht zu bestimmen), Nacken oval geformt,
Stück verjüngt sich nach oben hin . Ursprüngliche Form der Bahn: rund
oval , Bahnausprägung: längs und quer gewölbt, größere Materialausbrüche an drei Kantenbereichen. Auf Bahn keine Schleif- oder Reibspuren ,
keine besonders glatte Ausprägung der Arbeitsfläche. L. 17,2 cm; B. (an Mitte) 6 cm; H. (an Mitte) 5 cm ; Maße Bahn:
ca. 6,5 cm x ca. 5, I cm; Gewicht: 923 g
N icht datierbar
Lit.: Schmidt 1902, 302 No. 8767 - 8775 (hier als Reibstein bzw. Mörser
keule bezeichnet); Mü ller-Karpe 1994, 225 Taf. 62,22 (hier als Hammer
oder Amboss ausgewiesen)
Inv. Nr. Sch 8777-8784 (Taf. 16j)
Hammer, sehr glatter, feiner, anthrazitfarbener Stein mit dünnen Band
strukturen. Dreieckige Form mit leicht gebogenen Seiten, Bahn selu·
schmal und länglich ova l, sowohl längs als auch quer gerundet. Ober
fläche voll ständig poliert, keine Herstellungs- oder Abnutzungsspuren.
L. 6,5 cm; B. (Mitte) 3,3 cm; H. (Mitte) I ,8 cm; Maße Bahn : 3,8 cm x 0,8 cm;
Gewicht: I 00 g
Nicht datierbar
Lit.: Schmidt 1902, 302 No. 8777- 8784 (hier als Glätt- oder Reibstein
bezeichnet)
Inv. Nr. Sch 8777 (Taf. 16g)
Hammer, vollständig erha lten , sehr g latter, feiner, schwarzer Stein (derse l
be wie 8779) mit kleinen flächigen hellen Einsprenkelungen. Trapezoide
Form, Oberfläche sehr gut poliert, abgerundeter Nacken, der ein wenig
schmal zuläuft. Seiten etwa gleich lang, länglich rechteckige Bahn, an bei
den Ecken zu den Schmalseiten hin kleine Materialausbrüche. Bahn: längs
plan, quer leicht gewölbt , Bahnkanten klar definiert, auf Bahn deutliche
waagerecht verlaufende Schleifspuren, keine sonst igen NutzungsspureiL
L. 6,5 cm; B. (Mitte)3 ,3 cm; H. (Mitte) 1,8 cm; Maße Bahn: 3,8 cm x 0,8 cm;
Gewicht: 86 g
Nicht datierbar
L it.: Schmidt 1902, 302 No. 8777- 8784 (hier als Glätt- oder Reibstein
bezeichnet).
Inv. Nr. Sch 8778 (Taf. 161)
Hammer, vollständig erhalten, sehr glatter, feiner, gräu licher Ste in , leichte
Bänderung und Einsprenkelung. Nacken gerundet und leicht spitzoval,
keine Anzeichen fiir Schäftung, sehr plane Bahn. Bahnfonn: langoval , gut
polierte Ober- und Arbeitsfläche, Polierspuren sichtbar, minimale Abplat
zungen an einigen Randbereichen, auf einer Bahnkante eine geschliffene
Facette, keine Nutzungs- oder Herstellungsspuren .
L. 5,4 cm, B. max. 3,6 cm ; H. I , 75 cm, Maße Bahn : 3,3 cm x I ,4 cm;
Gewicht : 51 g
Nicht datierbar
Lit.: Schmidt 1902, 302 No. 8777-8784 (hier als Glätt- oder Reibstein
bezeiclmet).
Inv. Nr. Sch 8779 (Taf. 16h)
Hanuner, vollständig erhalten, trapezoide Form, selU' glatter, feiner,
schwarzer Stein, ganz schwache Bänderung. Oberfläche selU' gut poliert,
abgerundeter Nacken der sich ve1jüngt, linke Seite etwas länger als rechte,
schmale, rechteckige Bahn, Bahnkanten klar definiert. Bahnausprägung:
längs plan, quer leicht gewölbt, auf linker Bahnseite deutliche Facetten
auf beiden Seiten, die bis zum Nacken reichen (nur auf Frontseite) , auf
Rückseite keine Facetten. An beiden Schmalseiten, Nacken und anderen
Bereichen kleinere Materialausbrüche (besonders im schneidennahen Be
reich), Pickspuren an Nacken und entlang der Facetten, auf Bahn keine
Abnutzungsspuren.
L. 7, 1 cm ; B.(Mitte)3 ,5 cm; H.(Mitte) 1,7 cm ; MaßeBahn:4 cm x 0,7 cm;
Gewicht: 90 g
Nicht datierbar
Schmidt 1902, 302 No. 8777-8784 (hier als Glätt- oder Reibstein be
zeichnet)
Inv. Nr. Sch 8781 (Taf. 16b)
Hammer, vollständig erhalten, grünli cher Hämatit. Gut polierte Ober
fläche mit mehreren Haarrissen, trapeziode Form, Nacken abgerundet
mit fast planem Abschluss , länglich ovale Bahn. Bahn mit sehr klar
definierten , nicht gerundeten Kanten , Bahnausprägung: längs und quer
leicht gewölbt, dort von unten links nach oben rechts gerichtete Sch lei f
spuren.
L. 7,2 cm; B. (Mitte) 4,25 cm; H. (Mitte) 2,55 cm; Maße Bahn :
5,2 cm x I ,8 cm; Gewicht: 163 g
Datierung: unbekannt
Lit.: Schmidt 1902, 302 No. 8767- 8775 ; Demakopoulou 1990, 218.
255
Inv. r. Sch 8785 (Taf. 16k) Hammer, vollständig erhalten , grauer, le icht fl eckiger feinkristalliner
Stein . Trapeziode Form mit abgerundetem Nacken, gut po lierte Ober
fläche. Bahnfonn: schmallänglich oval, e in kleiner und ein fl ächiger Ma
terialausbruch an Bahnkanten, auf gegen überliegender Seite eine Facette,
we lche über gesa mte Bahnlänge verläuft. Bahnausprägung: längs plan,
quer le icht gewölbt, Schleifspuren auf gesamter Länge.
L.6,4 cm; B. (an Mitte) 3,5 cm; H . I ,4 cm; Maße Bahn: 4,35 cm x I, I cm;
Gewicht : 57 g Datierung: unbekannt
Lit.: Schmidt 1902, 302 No. 8785.
Inv. Nr. Tr. 8 (Taf. 13c) G ussform, fragmentiert, einteilig, e inse itig bearbeitet, sekundär aus
Wandscherbe e ines Pithos geferti gt, rötlich- bräunlicher sehr körniger,
glimmerha ltiger, poröser Ton mit Sand gemagert, grob verbacken, ge
brannt. Negative für mindestens acht Stabbarren, starke Rußspuren , einige
Bereiche stark durchgeglüht und porös, le ichte dunkle Verfarbungen auf
der unbea rbeite ten Rückseite der Form. L. 22, I cm; 8. 24,7 cm; H. 4,7 cm; Gewicht: 2689 g
Datierung: unbekannt
Lit.: A lbrecht 1992, 320ff. Abb. 3; Müller-Karpe 1994, 197 Taf. 15,7.
Inv. Nr. Tr. 78 (Taf. 17b)
Ste inobjekt, quaderförmig, anthrazitfarbener, stark g limmerhaltiger Stein.
Auf zwei Seiten mehrere Rillen mit trapezfönnigem Querschnitt in die
Oberfläche eingearbeite t, Flächen gut geglättet, Kanten an Rillen nur
wenig geglättet, auf Fläche ohne Ri llen stark bestoßen, auf gegenüber
liegender Längsseite unvo llendete Durchlochung.
L. 7,6 cm; 8. 4,45 cm; H. 4,35 cm; Maße der Rillen: B. zw ischen 0,5 cm
und 0,8 cm; T. zwischen I cm und 0,3 cm; Gewicht: 338 g
Nicht datierbar
Inv. Nr. Tr. 171 (Taf. 3h)
Tondüse, Typ mit 1-.·urzem Luftkanal und langem Absatz, konische F01m, voll
ständig erhalten . Grau-brauner Ton mit feinem Glimmer gemagett, außen gut
poliert, Wandstärke variiert leicht, in Düseninnenraum Glättspuren erkennbar.
Luftaustrittsöffnung von außen nach innen gebohrt und leicht einseitig verscho
ben, Spuren von Hitzeeinwirkung erkennbar durch gräuliche Verfarbungen.
L. 6,55 cm; 8. (an M itte) : 4 cm; Wandstärke: 0,7 cm- 0,9 cm; Tüllen
mund : 3,9 cm x 4 cm; TüllenöffiHmg: 2,55 cm x 2,65 cm; Maße Austritts
öffnung : 0,65 cm x 0,6 cm; Gewicht: 73 g
N icht datierbar
Inv. Nr. Tr. 243 (Taf. 3d)
Ton düse, Typ mit kurzem Luftkanal und langem Absatz, vollständig erhal
ten, rötlich- hellbrauner Ton, grob gemageit mit vielen größeren Gesteins
partikeln. G rob geglättet, le ichte Rissbildung auf Oberfläche, recht breite
Tülle, relativ dünnwandig, Spuren von Hitzeeinwirkung an Luftaustritts
öffnung, leichte Abdrücke organischen Materials an Tülleninnenseite.
Maße: L. 6,95 cm; 8 . (Mitte): 3,95 cm; Munddm. 4,2 cm; max. Tüllendm.
2,8 cm; Kanaldm. 0,6 cm, Gewicht: 96 g, Wandstärke: 0 ,7-0,85 cm.
N icht datierbar
Inv. Nr. Tr. 244 (Taf. 3j)
Tondüse, Typ mit kurzem Luftkanalund langem Absatz, fragmentiert, Teil ei
nes Randbereiches abgebrochen, hell- dunkelgrauer, stark glimmergemagerter
Ton, feine, gut geglättete Oberfläche, te ilweise mit Polierspuren, Magerung
mit sehr feinem Steinmaterial ( evtl. Quarzsand) nur selu wenige größere Ein
schlüsse. Luftkanal geringfiigig einseitig verschoben, in Tülle Abdrücke von
organischem Material, dunkle Verfarbungen an Luftaustrittsöftlmng.
Maße: L. 6,9 cm; 8. (Mitte): 4,3 cm; Munddm. 3,75 cm; max. Tüllendm.
2,2 cm; Kanaldm. 0,5 cm, Gewicht: 62 g, Wandstärke: 0,8- 1, I cm
N icht datierbar
Inv. N r. Tt·. 246 (Taf. 17g)
Polierstein fiir Pfeilspitzen, e inteilig, anthrazitfarbeuer Stein, voll ständig
erhalten . Gut geglättete Oberfläche, zwei Durchlochungen, insgesamt drei
Rillen aufzwe i Seiten, zwei davon durchgehend, Rillen verschieden breit
und über Kreuz verlaufend. Querschnitt vetjüngt sich stark zur durchloch
ten Se ite, in Rillen Schleifspuren erkennbar, Rillenquerschnitt ha lbrund
und v-för mig, Objekt ze igt ausgebrochene Kantenpartien.
256
L. 4,7 cm; B. 4,35 cm; H. I ,45 cm; Maße Rillen: zwischen I, I cm und 0,3 cm; T. 0,5-0, I cm; Gewicht: 48 g
N icht datierbar
lnv. Nr. Tr. 249 (Taf. 171)
Polierstein fiir Pfeilspitzen, hellgraues Gestein mit beigefarbeuer Außen
se ite, flach rechteckige Form und Querschnitt, gut geg lättete Oberfläche.
Auf Oberseite zwe i verschieden breite, durchgehende Rillen mit halbrun
dem Querschnitt, dazwischen Durch Iochung, Materialausbruch an oberer
Ecke, in Rillen keine N utzungsspuren, Innenfläche der schmalen Rille
deutlich unebener als bei der breiten Rille.
L. 8,05 cm; B. 5,6 cm; H. 1,9 cm; Maße Rillen: 8. große Rille: I cm; T. 0 ,7 cm; B. kleine Rille: 0,5 cm; T. 0,5 cm; Gewicht: 184 g
N ich! datierbar
Inv. Nr. Tr. 345- 1 (Taf. 30)
Blasrohrdüse, Typ mit geradem Luftkanal , fragmentiert, untere Hälfte und
Düsenöffnung abgebrochen , feiner rötlicher Ton mit e iner grauen dünnen
Tonschicht überzogen. Gebogene Form, Oberfläche gut geglättet, Ver
streichspuren der grauen Tonschicht erkennbar, Unterseite der Oberfläche
einseitig vo llständig mit Rußverfarbunegn bedeckt. Wandstärke variiert,
in Tülleninneren ist graue Tonschicht dicker aufgetragen als außen, da
durch innen unregelmäßig rund, verg leichsweise dünnwandige Tülle,
T üllenmund verbreitert, grob geformt und kaum geglättet, durchgehend.
Maße: L. 4,5 cm; 8 . (M itte): 2,75 cm; Maße Tüllenmund: 4,2 cm x
4,25 cm; max. TüllenDm. I ,9 cm; Maße Kanal: I ,95 cm x I ,3 cm, Ge
wicht : 34 g, Wandstärke: 0,6- 1 cm
N icht datierbar
lnv. Nr. Tr. 345-2 (Taf. 3m) 8lasrohrdüse, gerader Luftkanal , grauer Ton, sehr grobe Magerung mit
vergleichsweise großen, weißen Gesteinspartikeln und organi schem
Material , Oberfläche geg lättet aber nich t po liert. Tülleninnenraum zuerst
ausgeformt, dann dicke Tonschicht außen herum ge legt, insgesamt asym
metrische, sekundär veränderte (!) Form, mit e igentlich rot-bräunlicher
Tonschich t überzogen, die jedoch durch Hitzeeinwirkung vo ll ständig grau
bis olivgrün geHirbt ist . Starke Gebrauchsspuren, äußere Tonschicht groß
flächig abgeplatzt, an Luftaustrittsöffnung weinrote Spuren von starker
Hitzeeinwirkung, Spannungsri sse in Tülle, in Tüllenmund bräunlicher
Ton, erst ab Höhe des Luftkanals weiße "Versinterungen", rötliche Brand
spuren auch an abgebrochenem Ende der Tüllenöffnung.
Maße: L. 5,65 cm; B . (Mitte): 3,5 cm ; max. Tüllendm: I ,45 cm x I ,5 cm;
Maße Kanalöffnung: I ,3 cm x I ,3 cm, Gewicht: 65 g, Wandstärke:
1,2- 1,7 cm
N icht datierbar
lnv. Nr. Tr. 345-3 (Taf. 31<) 8lasrohrdüse, gerader Luftkanal, fa st vo ll ständig erhalten, Teile des
Tüllenmundes fehlen , rötlicher, sehr grob mit viel Sand gemagerter Ton.
Form sehr kurz und gedrungen, Tüllenmund besteht aus zwei Schichten,
die deutlich voneinander getrennt sind, obere Schicht ist wesentlich fe iner
gemagert und ebenfa ll s leicht rötlich mit wenig G limmer ohne größere
GesteinspartikeL Untere Schicht an Tüllenmund, kleinen Seitenflächen
und in der Tülle sichtbar, in Tülle jedoch ni cht bis an die Austrittsöff
nung des Luftkanals heranreichend, schwache Rußspuren an Tüllenmund,
Wandstärke variiert, Luftaustrittsöffnung größer als durchschnittliche
Größe des Luftkanals, dort le ichte Spuren von Hitzeeinwirkung, Maße: L. 3,8 cm; B. (Mitte): 3,5 cm; Maße Tüllenmund : 4, 15 cm x 4,2 cm;
max. Tü llendm: I ,3 cm; Maße Kanalöffnung: I ,65 cm x I ,6 cm, Gewicht:
56 g, Wandstärke: I ,4- 1 ,6 cm
N icht datierbar
lnv. Nt·. Tr. 345-4 (Taf. 3n)
8lasroludüse, gerader Luftkana l, fa st voll ständig erhalten , le ichte Ab
platzungen am Tüllenmund, re lativ feiner, beige- gräulicher Ton, sehr
feinkörnige Magerung mit Glimmeranteil, kaum größere GesteinspartikeL
Oberfläche geglättet und mit leicht rötli cher Tonsch icht überzogen, darauf
Verstreichspuren, leichte Rußspuren an Oberfläche, Wandstärke variiert.
l'vlaße: L. 5,05 cm; B. (Mitte): 2,8 cm; Maße Tüll enmund. 3,7 cm x 3,7 cm;
max. Tüllendm.: 1,4 cm; Maße Kanal: I , I cm x I ,25 cm, Gewicht: 52 g,
Wandstärke: I , 1- 1,3 cm
N icht datierbar
Inv. Nr. Tr. 345-5 (Taf. 31) Blasrohrdüse, gerader Luftkanal , fragmentiert , nur unterer Teil mit Kanalöffnung erhalten , grauer Ton, sehr stark mit Gesteinspartikeln und Sand (wahrsche inlich Quarzsand) gemagert. Oberfläche gut geglättet, te ilwe ise Polierspuren, Bruchkante ze igt Herste llung mit me!u·eren Schichten: dünnes Kernröhrchen, dickere Ummantelung (aus demselben Ton), le icht gebogene Form. Wandstärke variiert , Düsenunterse ite durch Ruß dunke lgrau verf:irbt, Düsenoberseite he llgrau, innen sehr dünne Schicht von he llerem Ton, leicht rötliche Brandspuren an der Luftaustrittsöffnung . Maße: L. 4,3 cm; B. (f\,litte): 2,95 cm; max. Tüllenbruchkante : außen: 3,6 cm, innen: 1,6 cm x I ,6 cm; Maße KanalötTnung: I, I cm x I cm, Gewicht : 46 g; Wandstärke: 0,9-1 , I cm
N icht datierbar
lnv. Nr. Xlb 1264 (Taf. 12a) Gussform, fragmentiert, gräuli ch-bräunlicher Phyllit mit sehr hohem Glimmeranteil, e inte ili g. Zweise itig bearbeitet, ve rg leichsweise gra z il e Form, Oberfläche so rg faltig poliert , Negative auf zwei Se iten für dre i kleine Dolche mit Mittelrippe und e inen läng lichen ni cht melu bestimmbaren Gegenstand (an Bruchkante). Auf Rückse ite Nega ti v fiir e inen Dolch mit rundem Heft, Rußspuren in a llen Negat iven und te ilwe ise auch in den Zwischenräumen, innerhalb des Bei lnegativs e in Passloch. L. I 0, I cm; B. 6,4 cm; H. 2,3 cm ; Gewicht : 228 g N icht dati erbar Lit.: Müller-Karpe 1994, 207 Taf. 39,2.
Tnv. N1·. Xlb 2847 (Taf. 17e) Polierste in für Pfe il spit zen, frag mentiert, he ll-gräuli ches Gestein , stark g limmerhalti g. Flach rechtecki ge Form und Querschnitt, Stück ve1jüngt s ich zu Ende hin , auf den Breitseiten j e eine e ingea rbeitete Rille, erste Rill e tra pez förmi g, zweite Rill e flach halbrund im Querschnitt , links daneben e ine kl e ine Durch Iochung. Oberfläche einseitig g ut geg lätte t, Oberfläche auf Seite mit flacher Rille de utli ch unebener a ls di e andere, Rill en sehr sauber gearbe ite t. Ke ine Hinweise aufNutzungsspuren, an e inigen Kantenste llen le ichte Materialausbrüche, Oberfl äche teilwe ise mit kreideartiger Patina bedeckt , L. 4 ,65 cm; B. 3, 75 cm; H. I ,8 cm; Maße Rill e : I cm bi s I , I cm ; T. 0,6 - 0,3 cm; Gewicht: 46 g Nicht datierbar
lnv. Nr. MVF 3134 (Taf. 16e) Steinhammer, vollständig erhalten, aus festem feinen Gestein, hellgrau mit feinen weißen Einsprenke lungen, Stück ve1jüngt sich zum Kopf hin , Kopf se lbst flach eben, gut polierte Oberfl äche, eine durchgehender Riss auf der gesamten Längsse ite des Körpers, Bahnform länglich oval, Bahnausprägung: längs und quer gewölbt, keine Nutzungsspuren, leichte Ausbrüche an kl e ineren Kantenpartien L.5,9 cm; B. (an Mitte) 4 , I cm; H. 3 cm; Maße Bahn: 4,5 cm x 2,3 cm; Gewicht: 134 g
Nicht dat ierbar Unveröffentlicht
lnv. Nr. MVF 3IIl (Taf. 16a) Steinhammer, fast vo ll ständig erha lten, schwarzes feinkristallines Gestein . Trapeziode Form, gut po lierte Oberfläche, starke Materialausbrüche an Körper und Kanten, auch deutliche Schlagmarken auf der Bahn. Bahnform : länglich ova l, Bahnausprägung: längs und quer gewölbt. L.7 cm; B. (an Mitte)4,6 cm; H. ca. 3,4 cm; Maße Bahn : 5,5 cm x ca. 3,4 cm; Gewicht : 195 g Schliemann: Dritte verbrannte Stadt. Lit. : Schliemann 188 1, 496 Nr. 668.
Inv. Nr. MVF2596 (Taf.16c) Steinhammer, fast vollständig erha lten , schwarzes fe inkristallines Gestein mit he lleren Einschlüssen. Trapeziode Form, gut poli erte Oberfläche, starke Materialausbrüche an Bahnkanten und Kopfbereich. Bahnform: längli ch rechteckig, Bahnausprägung: längs und quer plan, leichte Schleifspuren an Bahn. L. 5,65 cm; B. (an Mitte) 3,2 cm; H. ca. 1,7 cm; Maße Bahn: 4,2 cm x ca. I, 7 cm; Gewicht: 64 g N icht datierbar
Dr. Bianka Nessel ERC Project BronzeAgeTin Institut flir Geowissenschaften Ruprecht-Karls-Uni versität Heidelberg Im Neuenheimer Feld 234-236 69120 Heidelberg Bianka.Nessel@geow. uni-heidelberg.de
257
--Abkürzungen:
ARM CAD
Archi ves Royales de Mari The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the Uni versity ofChicago (Chicago 1958-2 111 )
Literatur
Akurgal 1950 E. Akurgal , Bayrak li : Ein vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Alt-Smyrna. Dil Tarih Cografya Fakültesi Dergisi 8, 1950, 2- 97.
Albrecht 1992 M. Albrecht, Hinweise auf Metallverarbeitung in den trojanischen Funden Schliemanns. In : J. Herrmann (Hrsg.), Heinrich Schliemann: Grundlagen und Ergebnisse moderner Archäologie I 00 Jahre nach Schliemanns Tod (Berlin 1992) 319- 328.
Alberti 2003 M. E. Alberti , Weighing and Dying between East and West: Weighing Materials from LBA Aegean Funerary Contexts. In : Metron - Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9'h International Aegean Conference. Aegaeum 24 (New Haven, Yale University, 18.-2 1. April 2002) (2003 ) 277 - 284.
Ambronn 20 12 M. Ambronn, Die fi"ühbronzezeitliche Keramik aus den Grabungen I 994-98. ln: M. Özdogani H. Parzinger, Die frühbronzezeitliche Siedlung von Kanhgeyit bei Ktrklareli , Archäologie in Eurasien 27, Studien im Thrakien-Marmara-Raum 3, 20 12, 53 - 147.
Amzallag 2009 N. Amzallag, From Metallurgy to Bronze Age Civi lisation : The Synthetic Theory. American Journal Arch. I 13, 2009, 497-519.
Anderssan Strand et al. 20 10 E. Anderssan Strand I K. M. Frei I M. Gleba I U. Mannering I M.-L. Nosch/1. Ska is, Old Textiles- New Possibil ities, European Journal of Archaeology 13 (2), 20 I 0, 149- 173.
Andn!-Salvin iiDescamps-Lequime 2005 B. Andre-SalviniiS. Descamps-Lequime, Remarques sur l ' astragale en bronze de Suse. Studi Micenei et Egeo-Anatolici 47,2005, 15 - 25 .
Antonovic 2003 D. Antonovic, Neolitska industria g lacanog kamena u Srbiji (Beograd 2003).
Archi 1987 A. Archi , Reflections on the System ofWeights from Ebla. Eblaitica I, 1987, 47-89.
Archi 1993 A. Archi , Trade and Administrative Praxis. Altorientalische Forschungen 20, 199311, 43-58.
Armbruster 2000 B. Armbruster, Goldschmiedekunst und Bronzetechnik. Studien zum Metallhandwerk der Atlantischen Bronzezeit auf der Iberischen Halbinel. Monographies instrumentum 15 (Montangnac 2000).
KBo KUB TCL
Keilschriftttexte aus Boghazköy. Keilschrifturkunden aus Bohazköy. Textes cuneiformes du Louvre.
Arnaud 1967 D. Arnaud, Contribution a l' etude de Ia metro logie syrienne au IJ< millenaire. Revue d' Assyriologie 61, 1967, 164- 169.
Arnaud et al. 1979 D. Arnaud/Y. Ca lvetiJ.-L. Huot, Ilsu-ibni su, orfevre de I'«E.BABBAR de Larsa». Syria 56, 1979, 1-64.
Aruz/Wallenfels 2003 J. Aruz/R. Wallenfels (eds.), Art ofthe First Citi es: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the lndus (New York, New Haven, London 2003).
Ascalone 2006 E. Ascalone, Tell es-Su ltan/Jericho Weight Systems: New Ev idences ofWeights from Inner Palestine during the Early and Middle Bronze Age. In : M. E. AlbertiiE. Ascalonei L. Peyronel (eds.), Weights in Context - Bronze Age Weighting Systems of Eastern Mediterranean: Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. International Co ll oquium in Rome, 22'h-24'h November 2004 (Rome 2006) 16 1- 183.
AscaloneiPeyronel 1999 E. AscaloneiL. Peyrone l, Typologica l and Quantitative Approach to the Ancient Weight Systems: Susa, Persian Gulf and lndus Valley, from the End of the 111 Millennium to the Beginning of the II Millennium BC. Altorientalische Forschungen 26, 2, 1999, 352-376.
AscaloneiPeyronel 2006 E. AscaloneiL. Peyronel, Early Bronze IVA Weights at Tell Mardikh-Ebla: Archaeological Associations and Contexts. In : M. E. AlbertiiE. AscaloneiL. Peyronel (eds.) , Weights in ContextBronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean: Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. Internat ional Colloquium in Rome, 22-24 November 2004 (Rome 2006) 49 - 70.
Asderaki-Tzoumerkiotii Rehren 2011 E. Asderaki-Tzoumerkioti/Th . Reluen, Going in Circles: The Use of Lead Meta! through Time in Magnesia. In: A. HauptmanniD. Modarressi-Tehrani , M. Prange (eds), Archaeometallurgy in Europe III, International Conference of Deutsches Bergbau-Museum Bochum June 29'h- July 1" 20 II. Metalla Sonderheft 4 (Bochum 20 I I) 85.
Aslan u. a. 2002 R. AslaniS. W. E. BlumiG. Kastl/F. Schweizeri D. Thumm (Hrsg.), MauerschalL Festschrift fiir Manfred Korfmann (RemshaldenGrunbach 2002).
AslaniSönmez 20 12 R. AslaniA. Sönmez, The discovery and smuggling of Priam's treasure. In : Troy. C ity, Homer, Turkey. Ausstellungskata log, Allard Piersan Musetun Amsterdam (Amsterdam 20 12) 137- 14 1.
293
Assmann 1999 J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Sclu·ift, Erinnerung und politische Identität in den fi'lihen Hochkulturen (München 1999).
Avetisyan 1992 G.G. Avetisyan, Biainskaya keramika iz pamyatnikov Araratskoy doliny (The Biaynili Potte1y from tbe Sites of Ararat Valley) (Erevan 1992).
Avi la 1983 R. Av ila, Bronzene Lanzen- und Pfeilspitzen der griechischen Spätbronzezeit. PBF V, I (München 1983 ).
Baadsgaard 2008 A. Baadsgaard, Trends, traditions, and transformations: Fashions in dress in Early Dynastie Mesopotamia (unveröffentlichte Dissertation; University ofPennsylvania 2008).
Bachhuber 2009 G. Bachuber, The treasure deposits ofTroy: rethinking crisis and agency on the Early Bronze citadel. Anatol. Stud. 59, 2009, 1-18.
Bachmann u. a. 1987 H. G. Bachmann/H. Otto/F. Prunnbauer, Analyse von Metallfunden. In: M. Korfmann (Hrsg.), Demircihüyi.ik. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975- 78. Bd. 2: Naturwissenschaftliche Untersuchungen (Mainz 1987) 21 - 24.
Balfanz 1995 K. Balfanz, Bronzezeitliche Spinnwirtel aus Troia. Studia Troica 5, 1995,117-144.
Balkan-Atli et al. 2008 N. Balkan-Ath/D. Binder/B. Gratuze, Göllli Dag (Central Anatolia). Obsidian Sources, Workshops, Trade. In: Anatolian Meta! IV. Der Anschnitt, Beiheft 21 (Bochum 2008) 203 - 210.
Banks/Janko 2008 E. C. Banks/ R. Janko, The Middle Helladic small finds , including the Linear A inscription. In: W. D. Taylour et al. , Ayios Stephanos: Excavations at a Bronze Age and Medival settlement in southern Laconia. The British School at Athens. Supplementary Volumes 44 (Athens 2008) 445-470.
Barber 1991 E. J. W. Barber, Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Age with Special Reference to the Aegean (Princeton 1991 ).
Bartelheim u. a. 20 II M. Bartelheim/S. Behrendt/B. Kizilduman/U. Mliller/E. Pernicka, Der Schatz auf dem Königshügel , Kaleburnu/Galinoporni , Zypern. In: Ü. Yalc,;in (Hrsg.), Anatolian Meta! V. Der Anschnitt, Beiheft 24 (Bochum 2011) 91 - 11 0.
Basedow 2000 M. A. Basedow, Be~ik Tepe. Das spätbronzezeitliche Gräberfeld. Studia Troica Monographien 1 (Mainz 2000) .
Bass 1966 F. Bass, Troy and Ur. Gold links between two capitals . The Bulletin ofthe University Musetun ofthe University ofPennsylvania, Expedition 8,4, 1966, 26-39.
Bass 1967 G. F. Bass, Cape Gelidonya- a bronze age shipwreck (Philadelphia 1967).
294
Bass 1970 F. Bass, A hom·d ofTrojan and Sumerian jewelery. American Journal Arch. 74, 1970, 335-342 .
Batara 2002 J. Batora, Contribution to the Problem of "Craftsmen" Graves at the End of Aeneolithic and in the Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe. Slovenska Arch. 50, 2002, 179- 228.
Batara 2003 J. Batora, Kupferne Schaftlochäxte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (zu Kulturkontakten und Datierung - Äneolithikum/Frlihbronzezeit) . Slovenska Archeologia 5 1,1, 2003, 1-38.
Bayburtoglu/Yiidmm 2008 B. Bayburtoglu/S. Yiidmm, Gold and Silver in Anatolia. In: Ü. Yalc,;in (Hrsg.), Anatolian Meta! IV. Der Anschnitt, Beiheft 21 (Bochum 2008) 43-53 .
Baykal-Seeher/Obladen-Kauder 1996 A. Baykal-Seeher/J. Obladen-Kauder, Die lithischen K1einfunde. in: M. Korfmmm (Hrsg.), Demircihüyi.ik. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975- 1978. Bd. 4: Die Kleinfunde (Mainz 1996).
Bemdieu 2003 P.-A. Beaulieu, The Pantheon ofUruk during the Neo-Babylonian Period. Cuneiform Monograph 23 (Leiden, Boston 2003).
Bauer u. a. 1993 I. Bauer/W. Endres/B. Kerkhoff-Hader/R. Koch/H.-G . Stephan, Leitfaden zur Keramikbestimmung (Mittelalter-Neuzeit) (Kallmlinz/Opf 1993).
Bayley/Rehren 2007 J. Bayley/T. Rehren, Towards a functional and typological classification ofcrucibles. in: S. La Niece/D. Hook/0. Craddock (ed.), Metals and Mines. Studies in Archaeometallurgy (London 2007) 46-55 .
Beckman 2003-05 G. Beckman, Opfer. A.II. Nach schriftlichen Quellen. Anatolien. 1n: M. P. Streck (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 10 (Berlin, New York 2003-2005) I 06-111 .
Becks/Guzowska 2004 R. Becks/M. Guzowska, On the Aegean-type Weaving at Troia . Studia Troica 14, 2004, 101 - 115.
Begemann/Schmitt-Strecker/Pernicka 1992 F. Begemann, S. Schmitt-Strecker, E. Pernicka, The Meta! Finds from Thermi Ill-V: A Chemical and Lead-Isotope Study. Studia Troica 2, 1992, 219-239.
Begemann/Schmitt-Strecker/Pernicka 2002 F. Begemann/S. Schmitt-Strecker/E. Pernicka, On the composition and provenance of meta! finds from Be~iktepe (Troia). In : G. A. Wagner/E. Pernicka/H.-P. Uerpmann (eds.), Troia and the Troad (Berlin 2002) 173-20 I.
Behm-Blancke 1992 M. R. Behm-Blancke, Hassek Höyük, Naturwissenschaftliche Untersuchungen und lithische Industrie (Tübingen 1992).
Beinhauer 1995 W. Beinhauer (Hrsg.), Die Sache mit Hand und Fuß: 8000 Jahre Messen und Wiegen. Sonderausstellung Reiß-Museum der Stadt Mannheim. Studio Archäologie D 5 (Mannbeim 1995).
-
Belli 1993 0. Belli , Neue Funde steinerner Gussformen aus Akc;adag bei Ma latya. In: M. Frangipanei H. Hauptmann/M. LiveraniiP. MatthiaeiM. Mellink (eds.), Between the rivers and over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri dedicata (Rom 1993) 605-613.
Bendall 1996 S. Bendall, Byzantine Weights: An Introduction (London 1996).
Berger 2012 D. Berger, Bronzezeitliche Färbeteclmiken an Metallobjekten nördlich der Alpen. Eine archäometallurgische Studie zur prähistorischen Anwendung von Tauschierung und Patinierung anband von Artefakten und Experimenten. Forschungsberichte des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 2 (Halle a.d. Saa le 20 12).
Bergemanni Lippmann 2003 K. Bergmanni P. Lippmann, Geologische Kartierung des TrojaRückens im Maßstab 1: 10000. Diplomarbeit der Technischen Universität Bergakademie Freiberg (Freiberg 2003).
Bergner et al. 2009 M. BergneriB. Horejsl E. Pernicka, Zur Herkunft der Obsidianartefakte vom (:ukuric;i Höyiik. Studia Troica 18, 2009, 249-27 1.
Bernabo-Brea 1964 L. Bernabo-Brea, Poliochni. Citta preistorica nell ' isola di Lemnos I (Rom 1964).
Bernabo-Brea 1976 L. Bernabo-Brea, Poliochni li. Citta preistorica nell ' isola di Lemnos. Monographie della Scuola Archaeologica di Atene e delle Missioni Italiene in Oriente li (Rom 1976).
Berriman 1955 A. Berriman, H istorical Metrology (New York 1955).
Bertemes 200 I F. Bertemes, Tav~an Adas1 - eine minoische Hafensiedl ung nördlich von Didyma. In: J. Seeher (Red.) , Broschüre DA! Istanbul 9, 201 1, 9.
Betancourt 2006 P. P. Betancourt, Joining techniques of Early Bronze Age Trojan jewellery. Sh1dia Tro ica 16, 2006, 89-95 .
Biga 2006 M.G. Biga, Some Thoughts on Fairs, Temples and Weights. in : M. E. AlbertiiE. AscaloneiL. Peyronel (eds), Weights in Context -Bronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean: Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. International Colloquium in Rome, 22-24 November 2004 (Rome 2006) 34 1-345.
Bilgi 1984 Ö. Bilgi, Meta! objects from ikiztepe-Turkey. Beitr. z . allgem . u. vergl. Archäologie 6, 1984, 31 - 96.
Bilgi 2004 Ö. Bilgi , Anatolia, cradle of castings. Anadolu, dökümün besigi (Istanbul 2004).
Bilgi et al. 2004 Ö. BilgiiH. Özba liÜ. Yalc;m, Cast ings of copper-bronze I BakirTunc; Döküm Sanati. In: Ö. Bil gi (ed.), Anatol ia, Cradle of Castings - Anadolu , Dökümün Be~igi (Istanbu l 2004).
Bittell937 K. Bitte!, Bogazköy. Die Kleinfunde der Grabungen 1906- 1912. Bd. 1: Funde hethitischer Zeit. Wiss. Veröff. Dt. Orientges. 60 (Leipzig 1937).
Bittel1959 K. Bitte! , Beitrag zur Kenntnis anatolischer Metallgefäße der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. Jahrb. DA! 74, 1959, 1- 33.
Bitte llOtto 1939 K. Bittel/H. Otto, Demirci-Hüyük, eine vorgeschichtliche Siedlung an der phrygisch-bithynischen Grenze. Bericht über die Ereignisse der Grabung von 193 7 (Berlin 1939).
Blavatskaya 1955 V. D. Blavatskaya, 0 pantikapeiskoy vesovoy sisteme (On Weight System of Pantikapei) . Sovetskaya Arkheologiya 23 , 1955 , 201-205.
Biegen et al. 1950 C. W. Biegenil L. CaskeyiM. RawsoniJ. Sperling, Troy l. General Introduction. The Fist and Second Settlements, Part 1- 2 (Pr inceton 1950).
Biegen et al. 1951 C. W. Biegeni l L. CaskeyiM. Rawson, Troy II. The Third, Fourth, and Fi fth Settlements. Part I - 2 (Princeton 195 1 ).
Biegen et al. 1953 C. W. BlegeniJ. L. CaskeyiM. Rawson, Troy lll. The Sixth Settlement. Part 1- 2 (Princeton 1953) .
Biegen et al. 1958 C. W. BlegeniC. G. BoulteriJ. L. CaskeyiM. Rawson, Troy IV. Settlements V!Ia, VIIband VIII. Part 1- 2 (Princeton 1958).
Biegen 1963 C. W. Biegen, Troy and the Troyans (London, New York 1963) .
Biegen 1964 C. W. B iegen, Troy, Sections from Chapters XVIII , XXIV. Sectians from Chapters XV, XXI (Cambridge 1964).
Bloedow 1999 E. F. Bloedow, "Priam's Treasure" revisited: old Theoriesand new Evidence. Acta Praehist. et Arch. 3 1; 1999, 48 - 75.
Blum 2005 S. W. E. Blum, Holzkohlegewinnung und Köhlere ibetreib in der Troas, Nordwesttürkei. Studia Troica 15, 2005, 209 - 2 19.
Blum u.a. 201 1 S. W. E. BlumiD. Thumm-DograyaniM. Thater, Die Besiedlung der Troas vom Neolith ikum bis zur beginnenden Mittleren Bronzezeit: Clu-onologische Sequenz und Sied lungsstrukh1r. in: Gesamtpublikation zu Troja (in Vorbereitung).
Bobokhyan 2006 A. Bobokhyan, IdentifYing Balance Weights and Weight Systems in Bronze Age Troia : Preliminary Reflections. in : M. E . A lbertiiE. Ascalonei L. Peyronel (eds.) , Weights in Context - Bronze Age Weigh ing Systems ofEastern Mediterranean: Chronology, Typology, Materia l and Archaeological Context. International Co lloquium in Rome, 22'h- 24'h November 2004 (Rome 2006) 71- 125.
295
Bobokhyan 2008 A. Bobokhyan, Kommunikation und Austausch im Hochland zwischen Kaukasus und Taurus, ca. 2500-1500 v. Clu·. British Archaeological Reports 1853, 1- 2 (Oxford 2008).
Bobokhyan 2008a A. Bobokhyan, Bronze Age Balance Weights in the Berlin Schliemann Collection: Their Identification and Reconstruction of the Archaeological Context. In : M. Wemhoff/D. Hertel/A. Hänsel (Hrsg.), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer- Neuvorlage,. Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte N.F. 14 (Berlin 2008) 271 - 294.
Bobokhyan 2009 A. Bobokhyan, Trading Implements 111 Early Troy. Anatolian Studies 59, 2009, 19-50.
Bobokhyan 2010 A. Bobokhyan, "Siele caucasien": Zur Frage der bronzezeitlichem Gewichtssysteme im Kulturgebiet zwischen Kaukasus und Taurus. In : S. Hansen/A. HauptmanniL Motzenbäcker/E. Pernicka (Hrsg.) , Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung und Verarbei tung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jt. v. Clu-. (Berlin 20 10) 179- 203.
Bokhari/Kramers F. Y. Bokhari/J. D. Kramers, Lead isotope data from massive sulfide deposits in the Saudi Arabian Shield. Economic Geology 77 , 1982, 1766-1769.
Bode u.a . 2011 M. Bode/N. Hanel/A. Hauptmann /P. Rothenhöfer, Lead Ingots, Lead Isotopes and the History of Roman Lead Trade - The Corpus Massarum Plumbearum Romanarum (CMPR) - Running Results. In: A. Hauptman. , D. Modarressi-Tehrani , M. Prange (eds .), Archaeometallurgy in Europe III , International Conference of Deutsches Bergbau-Museum Bochum June 29'11 - July 1" 2011 . Metalla Sonderheft 4 (Bochum 20 II) 86- 87.
Boehlau/Schefold 1940 E. Boehlau/K. Schefold, Larisa am Hermos 1 (Berlin 1940).
Boehmer 1972 R. Boehmer, Die Kleinfimde von Bogazköy aus den Grabungskampagnen 193 1-1939 und 1952-1969, Bogazköy - Hattusa VII. Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen OrientGesellschaft 87 (Berlin 1972).
Boehmer 1986 R.M. Boehmer, Einflüsse der Golfglyptik auf die anatolische Stempelglyptik zur Zeit der assyrischen Handelsniederlassungen. Baghdader Mitteilungen 17, 1986, 293-298.
Bölke 1996 W. Bölke, Der ' Schatz des Priamos'- seine Entdeckung und das weitere Schicksal. Das Altertum 41, 1996, 305 - 338.
Borelli 1993 L. V. Borrelli , Fälschungen, "Pasticci", Imitat ionen . In : Die Etrusker und Europa . Ausstellungskatalog (Berlin 1993) 432-439.
Born 1997 H. Born, Troianische Silbergefaße. Forschungsprojekt zu Material und Herstellung und Möglichkeiten der Restaurierung. Acta Praehist. et Arch. 29, 1997, 110-121.
296
Born 2009 H. Born, Troja- Ur- Gon ur Tepe. Restaurierung und Forschung an Silberfimden des 3. Jahrtausends v. Chr. In: U. Peltz/0 . Zorn (Hrsg.) , Standards in der Restaurierungswissenschaft und Denkmalpflege (Berlin 2009) I 05-114.
Born i.Vorber. H. Born, Ketten, Perlen und ldolanhänger. Neue herstellungstechnische Beobachtungen an Goldschmuck aus Troja und Ur (in Vorbereitung) .
Born!Völling 2006 H. Born/E. Völling, Beutekunst in Mesopotamien. Ein Silbergefäß aus dem "Schatz des Priamos" aus Troja bietet noch heute Überraschungen. Antike Welt 37,1, 2006 , 61 - 67.
Born/Hausdörfer/Thieme 2004/05 H. Born/U. Hausdörfer!F. Thieme, Die Restaurierungswerkstätten . In : W. Menghin (Hrsg.), Das Berliner Musemn für Vor- und Frühgeschichte. Festsclu-ift zum 175-jährigen Bestehen. Acta Praehist. et Arch . 36/37, 2004/05 , 487-498.
Born u. a. 2009 H. Born!S. Schlosser!R. Schwab/B. Paz/E. Pernicka, Granuliertes Gold aus Troia in Berlin. Erste teclmologische Untersuchungen eines anatolischen oder mesopotamischen Handwerks. Restaurierung und Archäologie 2, 2009, 19-30.
Boroftka/Sava 1998 N. Boroffka/E. Sava, Zu den steinernen "Zeptern/Stössel-Zeptern", "Miniatursäulen" und "Phalli" der Bronzezeit Eurasiens. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 30, 1998, 17-115 .
Bossert 1942 H. Th. Bossert, Altanatolien. Kunst und Handwerk in Kleinasien von den Anfangen bis zum völligen Aufgehen in der griechischen Kultur (Berlin 1942).
Braidwood/Braidwood 1960 R. J. Braidwood/L. S. Braidwood, Excavations in the plain of Antiach I. The Earlier Assemblages, Phases A- J. Oriental lnst. Pub!. 51 (Chicago 1960).
Branigan 1968 K. Branigan, Copper and Bronze Warking in Early Bronze Age Crete. Stud. Mediter. Arch . 29 (Lund 1968).
Branigan 1974 K. Branigan, Aegean Metalwork of the Early and Middle Bronze Age. Oxford Monographs of Classical Archaeology (Oxford 1974).
Brasinskij /Marcenko 1984 I. B. Brasinskij/K. K. Marcenko, Elisavetovskoje: Skythische Stadt im Don-Delta. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 27 (München 1984).
Braun-Feldweg 1950 W. Braun-Feldweg, Metall. Werkformen und Arbeitsweisen (Ravensburg 1950).
Braun-Holzinger 1991 E.-A. Braun-Holzinger, Mesopotamische Weihgaben der frühdynastischen bis altbabylonischen Zeit (Heidelberg 1991).
Bregl ia 1958 L. Breglia, Question i ponderali. In: H. lngbolt (ed.), Centential Publication of the American Numismatic Society (New York 1958) 147-166.
Brepohl 1996 E. Brepohl , Theorie und Praxis des Goldschmieds (Leipzig 199612
) .
Bruns 1970 G. Bruns, Archaeologia Homerica. Küchenwesen und Mahlzeiten (Göttingen 1970).
Bry 2005 P. Bry, Des regles administratives et techniques a Mari. Contribution a Ia mise au jour multidisciplinaire de modes operatoires. Aula Orientalis 20 (Barcelona 2005).
Buchholz 1953 H. Buchholz, Keftiubarren und Erzhandel im zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Prähist. ZeitsclU'. 37 , 1953, 1- 40.
Buchholz 1959 H. Buchholz, Zur Herkunft der kretischen Doppelaxt. Geschichte und Beziehungen eines mil10ischen Kultsymbols (München 1959).
Buchholz 1962 H.-G. Buchholz, Der Pfeilglätteraus dem VI. Schachtgrab von Mykene und die helladischen Pfeilspitzen. Jahrb. DAI 77, 1962, 1- 58.
Buchholz 1967 H.-G. Bucholz, Analysen prähistorischer Metallfunde aus Zypern und den Nachbarländern. Berliner Jahrb. Vor- u. Frühgesch. 7, 1967, 198- 256.
Buchholz 1987 H .-G . Buchholz, Ägäische Bronzezeit (Darmstadt 1987).
Buchholz/Drescher 1987 H. Buchholz/ H. Drescher, Einige frühe Metallgeräte aus Anatolien. Acta Praehist. et Arch. 19, 1987, 37- 70.
Buchholz/Karageorghis 1971 H.-G. Buchholz!V. Karageorghis , Altägäis und Altkypros (Tübingen 1971).
Buchholz u. a. 1973 H.-G. Buchholz/G. JölU'ens/1. Maul!, Jagd und Fischfang. Archaeologia Homerica II , Kap. J (Göttingen 1973).
Bulanda 1913 E. Bulanda, Bogen und Pfeil bei den Völkern des Altertums (Wien, Leipzig 1913).
Burns 1927 A. R. Burns, Money and Monetary Policy in Early Times (New York 1927).
Butter !in 2012 P. Butterlin, Die Expansion der Uruk-Kultur. In: N. Crüseman/ M. van Ess/M . Hilgert/8. Salje (Hrsg.), " Uruk- 5000 Jahre Megacity" . Begleitband zur Ausstellung (Petersberg 20 13) 205 - 211.
<;:ah~-Sazci 1999 D. <;:ah~-Sazci , Verbreitung, Datierung und Bedeutung des Gefaßtyps " Depas Amphikypellon" : Eine Neubetrachtung. Magisterarbeit Universität Tübingen (Tübingen 1999).
<;:ai1~-SaZCI 2003 D. <;:ah~-Sazci, Troy: Journey to a City between Legend and Reality. Exibition at Yap1 K.redi Vedat Nedim Tör Museum 2002 (lstanbul 2003) .
<;:ah~- SaZCI 2006 D. <;:ah~-Sazc i , Die Troianer und das Meer: Keramik und Handelsbeziehungen der sog. "Maritimen Troia-Kultur" . In: M. 0. Korfmann (Hrsg.) , Troia: Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz am Rhein 2006) 201 - 208.
Calmeyer 1977 S. Calmeyer, Das Grab eines altassyrischen Kaufmanns. lraq 39, 1977, 87- 97.
Canby 1965 J. Canby, Early bronze trinke! moulds. lraq 27, 1965, 42 - 59.
Caneva 2000 I. Caneva, Early Metallurgy in Cilicia: a review from Mersin. In: Ü. Yalyin (Hrsg.), Anatolian Meta! I. Der Anschnitt: Beiheft 13 (Bochum 2000) 69 - 74.
Caneva/ Palumbi/ Pasquino 2012 I. Caneva/G. Palumbi/ A. Pasquino, The Ubaid impact on the periphery: Mersin-Yumuktepe during the fi fth millennium B.C. In: C. Marro (ed.), After the Ubaid: lnterpreting Change from the Caucasus to Mesopotamia at the Dawn of Urban Civi lization (4500- 3500 BC) . Centre national de Ia reellerehe scientifique Unites de service et de reellerehe 3131 , 2012, 353-392.
Carroll 1983 D. L. Caroll , On granu lation in ancient meta lwork. American Journal of Archaeology 87, 1983, 551 - 554.
Carter 1998 T. Carter, Through a glass darkly - Obsidian and society in the Southern Aegean Early Bronze Age. E-Thesis University College London, London University 1998. (http://discovery.ucl. ac.uk/1317919/ I /300293 _ Vol_ l.pdf) (Stand 11.01.20 14)
Catling 1964 H. Catling, Cypriot bronzework in the Mycenaean world (Oxford 1964).
Caubet/Pouyssegur 1997 A. Caubet/P. Pouyssegur, L'Orient ancient (Paris 1997).
Cavigneaux 1999 A. Chavigneaux, A Scholar 's Library in Meturan? With an edition oftablet H72. In: T. Abusch/K. van der Toorn , Mesopotami an Magie. Ancient Magie and Divination I, 1999, 251 - 262.
Cavigneaux/Al-Rawi 2000 A. Cavigneaux/ F. N. H. Al-Rawi , Gilgames et Ia mort: Textes de Tell Haddad VI, avec un appendice sur les textes funeraires sumeriens. Cuneifonn Monographs 19 (Leiden 2000).
Ceyhan 2003 N. Ceyhan, Lead isotope geochemistry of Pb-Zn deposits from eastern Taurides, Turkey. MS Thesis, Middle East Technical University (Ankara 2003) l - 90.
Cernych 1992 E. N. Cernych, Ancient Metallurgy in the USSR. The early Meta! Age. New studies in archaeology (Cambridge 1992).
297
Cierny u. a. 2005 J. Cierny/T. Stöllner/G. Weisgerber, Zinn in und aus Mittelasien. ln: Ü. Yal~in/C. Pulak/R. Slotta (Hrsg.), Das Schiffvon Uluburun. Welthandel vor 3000 Jalu·en (Bochum 2005) 431-448.
Chrysokamino 2006 Ph . Betancourt (ed.), The Cluysokamino Metallurgy Workshop an Its Territory. Hesperia Suppl. 36 (Athens 2006).
Comsa 1972 E. Comsa, Date despre uneltele de piatra slefuita din epoca neolitica si din epoca bronzului , de pe terituriul Romaniei. Studii si Cercetari de lstorie Veche 23 , 1972, 245- 262.
Contenson 2000 H. de Contenson, Ramad, site neolithique en Damascene (Syrie) aux Vllle et Vlle millenaires avant I ' ere chretienne (Beyrouth 2000).
Coureier 2007 A. Courcier, La metallurgie dans !es pays du Caucase au Chalcolithique et au debutde l' äge du Bronze: bilan des etudes et nouvelles perspect ives. In: B. Lyonnet (sous Ia direction) , Les cultures du Caucase (VJ•-III' millenaires avant notre ere). Leurs relations avec le Proche-Orient (Paris 2007) 199- 23 1.
Coureier 20 I 0 A. Courcier, Metalliferous potential , metallogenous particularities and extractive metallurgy: interdisciplinary research on understanding the ancient metallurgy in the Caucasus during the Early Bronze Age. In : S. Hansen/A. Hauptmann/!. Motzenbäcker/ E. Pernicka (Hrsg.) , Von Majkop bis Trialeti-Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jt. v. Chr. Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 1.- 3. Juni 2006 (Bann 20 I 0) 75- 95.
Chvojka/Hn1by 2007 0. Chvojka/P. Hruby, Höhenfundstellen der Bronze- und Hallstattzeit in Südböhmen und ihre Anknüpfung zum interregionalen Handelsaustausch . In: J . Baron/ !. Lasak (ed.) , Lang Distm1ee Trade in the Bronze Age and Early Iran Age. Studia Archeologiczne 40 (Wroclaw 2007) 71 - 88.
Clark 1953 G. Clark, Doistoritscheskaja Evropa (Prehistoric Europe) (Moscow 1953).
Coblenz 1985 W. Cobl enz, Straubing und Aunjetitz. Bemerkungen zu einem Depotfund aus Kyhna, Kr. Delitsch. Bayer. Vorgeschbl. 50, 1985, 113- 126.
Cochavi-Rainey 1999 Z. Cochavi-Rainey, Royal gifts in the Late Bronze Age, fourteenth to thirteenth centuries B.C.E. Selected texts recording gifts to royal personages (Beer-Sheva 1999).
Colbow 1987 G. Colbow, Zur Rundplastik des Gudea von Lagas (München 1987).
Craddock 2000 P. T. Craddock, From Hearth to Furnace: Evidences for the Earliest Meta! Smelting Technologies in the Eastern Mediterranean. In: La pyrotechnologie a ses debuts. Evolution des premieres industries faisant usage du feu/ Early pyrotechnology. The evolution of the first fire-using industries . Paleorient 26/2, 2000, 151 - 165.
298
Craddock/Cowell/Guerra 2005 P. T. Craddock/M. R. Coweii/M.-F. Guerra, Controlling the Composition of Gold and the Invention of Gold Refining in Lydian Anatolia. Anatolian Meta! Ill. Der Anschnitt, Beiheft 18 (Bochum 2005) 67- 77.
Cronyn 1924 J. M. Cronyn, The Elements of Archaeological Conservation. (London 1995)
Culican 1964 W. Culican , Spiral-End Beads in Western Asia . Iraq 26, 1964, 36-43.
Curtis 1984 J. Curtis , Nush-i Jan Ill. The Small Finds (London 1984).
Czichon et al. 2006 R. M. Czichon/M. Flender/J. Klinger/H. KürschnerN. von Seckendorff, Interdisziplinäre Geländebegehung im Gebiet von Oymaagac-Vezirköprü I Provinz Samsun. Mitteilungen der Deutschen Orient Gesellschaft 138, 2006, 127 - 160.
Dayton 1974 J. Dayton, Money in the Near East before Coinage. Berytus 23, 1974, 41-52.
Dayton 1978 J. Dayton , Minerals, Metal s, Glazing & Man or Who was Sesostris I? (London 1978).
De Jesus 1980 P. S. de Jesus, The Development of Prehistoric Mining and Metallurgy in Anatolia. BAR Internat. Ser. 74 (Oxford 1980).
Demakopoulou 1990 K. Demakopoulou (ed.), Troy, Mycene, Tiryns, Orchomenos. Heinrich Schliemann: The I 00'11 Anniversary of hi s Death (Athen 1990).
Demange 2003 F. Demange, 135 - Cylinder seal of lbni-sharrum, a scribe of Shar-kali-sharri. In J. Aruz/R. Wallenfels (eds.), Art of the First Cities (New York 2003) 208- 209 .
Demangel 1926 R. Demangel, Le Tumulus dit de Protesilas (Paris 1926).
Demortier 1984 G. Demortier, Analysis of gold jewellery artifacts. Gold Bulletin 17,1, 1984, 27-38.
Demortier/Houbion 1987 G. Demortier/Y. Houbion, ls the scanning electron microprobe suitable for complete eiemental analysis of solders on gold alloys? Ox ford Journal of Archaeology 6, I, 1987, I 09-114.
Dergacev 2002 V. Dergacev, Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde Moldaviens. PBF XX,9 (Stuttgart 2002).
Deshayes 1960 J. Deshayes, Les outils de bronze, de l' lndus au Danube. Institut fran~aise d ' archeologie de Beyrouth, Bibi. arch. et bist. 71 (Paris 1960).
Oe Vos 2006 A. Oe Vos, Von leuchtenden Goldgefaßen. Ein Einblick nach keilschriftliehen Quellen . In: H. Born/ E. Völling, Gold im alten Orient. Technik - Naturwissenschaft - Altorientalistik (Würzburg 2006) 119- 124.
Dimopoulou 1997 N. Dimopoulou , Workshopsand craftsmen in the habour-town of Knossos at Poros Katsambas. In: R. Laffineur/Ph. P. Betancourt (eds.) , TEXNH - Craftsmen, Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age. Aegaeum 16 (Liege 1997) 433-438.
Diringer 1949 D. Diringer, The Alphabet (London 1949).
Dörpfeld 1902 W. Dörpfeld, Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen Schichten von llion 1870- 1894 (Athen 1902).
Doonan et al. 2007 R. C. P. Doonan/P. M . Day/N. Dimopoulou-Rethemiotaki , Lame excuses for emerging complexity in Early Bronze Age Crete: the Metallurgical Finds from Poros Katsambas ancl their Context . ln : P. M. Day/R. C. P. Doonan (eds.), Metallurgy in the Early Bronze Age Aegean . Sheffi.elcl Studies in Archaeology 7 (Oxforcl 2007) 98-122 .
Doumas 2000 C. G. Doumas, Early Cycladic culture. The N. P. Goulandris Collection (Athen 2000).
Drenkhahn 1976 R. Drenkhahn, Die Handwerker und ihre Tätigkeiten im Alten Ägypten. Ägyptol. Abhancll. 31 (Wiesbaden 1976).
Drescher 1986 H. Drescher, Draht. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 6 (Berlin, New York 1986) 141 - 152.
Dunning/Mykura/Siater 1982 F. W. Dunning/W. Mykura/D. Slater, Mineral cleposits of Europe 2: Southeast Europe. The Inst itution of Mining and Metallurgy ancl the Mineralog ical Society (Lonclon 1982).
Dunning et al. 1989 F. W. Dunning/P. Gerarci!H. W. Has lam/R. A. lxer, Mineral deposits of Europe 4/5: Southwest and Eastern Europe, with Iceland. The Institution of Mining ancl Metallurgy and the Mineralogical Society (London 1989).
Durand 1985 J .-M . Durand, Les dames du palais de Mari a l' epoque du royaume de Haute-Mesopotamie. In: Mari : Annales cle Recherehes Interdisciplinaires 4 (Paris 1985) 385 - 436.
Duru 1983 R. Duru, Kuruyay Höyügu Kazllan , 1981. Anadolu Ara~t1rmalan 9, 1983, 13 - 40.
Duru 2007 R. Duru, Hactlar. In: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.), Die ältesten Monumente der Menschheit (Stuttgart 2007) 144- 146.
Duval!Eluere 1986 A. R. Duvai/C. Eluere, Solder characterization on ancient gold artifacts with electron microprobe. Scam1ing Electron Microscopy 13 , 1986, 1331 - 1335 .
Duval et al. 1989 A. R. Duvai/C. Eluere/L. P. Hurte! , Joining techniques in ancient golcl jewe llery. Jewellery Studies 3, 1989, 5-13.
Earl!Özbal 1996 N. B. Eari/H. Özbal , Early Bronze Age Tin Processing at Kestel / Göltepe, Anatolia. Archaeometry 38/2, 1996, 289 - 303 .
Easton 198 1 D. F. Easton, Schliemann's cliscovery of "Priam 's Treasure" : Two enigmas. Antiquity 55, 198 1, 179- 183.
Easton 1984 D. Easton, Priam 's Treasure. Anatolian Studies 34, 1984, 141 - 169.
Easton 1984a D. Easton, Schliemann 's menclacity- a false trail? Antiquity 85, 1984, 197- 204.
Easton 1990 D. F. Easton, Reconstructing Schliemann's Troy. ln : W. M. Ca lder IIII J. Cobet (Hrsg.), Heinrich Schliemann nach hundert Jahren (Frankfurt/Main 1990) 43 1- 448 .
Easton 1991 D. F. Easton, Troy before Schliemann. Stuclia Troica I, 1991 , 111 - 129.
Easton 1994 D . F. Easton, Schliemann clicl admit the Mycenaean clate of Troy VI. A Review. Stuclia Troica 4, 1994, 173 - 175.
Easton 1997 D. F. Easton , The Excavation of the Trojan Treasures and their History up to the Death of Schliemann in 1890. In: E. Simpson (ed.), The Spoils of War: The Loss, Reappearance ancl Recovery of Cultural Property (New York 1997) 194- 206 .
Easton 2002 D . F. Easton, Schliemann 's Excavations at Troia 1870- 1873. Stuclia Troica Monographien Bel. 2 (Mainz 2002) .
Easton 2000a D . F. Easton, A pair of pendent earrings of Troj an type. Stuclia Troica I 0, 2000, 239-250.
Easton 2000b D. F. Easton, Schliemann 's "Burnt City". Stuclia Troica I 0, 2000, 73-83.
Easton 2006 D. F. Easton, Mit der !Iias im Gepäck - Die Erforschung Troias bis 1890. ln : M. Kerfmann (Hrsg.), Troia. Archäologie eines Siedlungshüge ls und seiner Landschaft (Mainz 2006) 107- 116.
Eaton/McKerrell 1976 E. R. Eaton/ H. McKerrell , Near Eastern Alloying and Some Textual Eviclence for the Early Use of Arsenical Copper. Worlcl Archaeology 8/2, 1976, 169- 191.
Echt/Thiel e 1987 R. Echt,/W.-R. Thiele, Etruskischer Goldschmuck mit gelöteter und gesinterter Granulation. Arch. Korrbl. 17, 1987, 213 - 222.
299
Echt/Thiele 1995 R. Echt/W.-R. Thiele, Sintering, welding, brazing and soldering as bonding techniques in Etruscan and Celtic goldsmithing. In: G. Morteani/J. P. Northover (eds.), Prehistoric gold in Europe. Mines, metallurgy and manufacture (Dordrecht 1995) 435-451.
Echt/Thiele 1995a R. Echt/W.-R. Thiele, Zur Herstellungs- und Fügetechnik der Goldringe. ln: H.-J. Joachim, Waldalgesheim: Das Grab der keltischen Fürstin . Kataloge Rhein. Landesmus. Bann 3 (Bann 1995) 111 - 140.
Eckmann/ Eimer 1994 C. Eckmanni l Th. Eimer, Die Restaurierung und Konservierung archäologischer Bodenfunde aus Metall in einem WasserstoffNiederdruckplasma. ln: P. Heinrich (Hrsg.) , Metallrestaurierung. Beiträge zur Analyse, Konzeption und Technologie (München 1994) 138- 147.
Edzard 1960 D.-0. Edzard, Die Beziehungen Babyloniens in der Mittelbabylonischen Zeit und das Gold. Journal of the Economic and Social History of the Orient 3, 1960, 38- 55 .
Edzard 1997 D.-0. Edzard, Gudea and His Dynasty. The Royal Inscriptions of Mesopotamia Early Periods 3/ 1 (Toronto 1997).
Edzard 2004 D.-0 . Edzard, Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen (München 2004).
Efe 1988 T. Efe, Demircihüyük. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978. III.2 Die Keramik 2. C Die frühbronzezeitliche Keramik der jüngeren Phasen, ab Phase H (Mainz 1988).
Efe 2001 T. Efe, Seyitgazi /Küllüoba Excavations. In: 0 . Bell i (ed.), Istanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey, 1932- 2000 (Istanbul 2001) 97 - I 01.
Efe 2002 T. Efe, The Interaction between Cultural/ Political Entities and Metalworking in Western Anatolia during the Chalcolithic and Early Bronze Ages. In: Ü. Yal9in (ed.), Anatolian Meta] II. Der Anschnitt : Beiheft 15 (Bochum 2002) 49 - 65.
Efe 2003 T. Efe, Pottery Distribution within the Early Bronze Age ofWestern Anatolia and its Implications upon Cultural, Political and (Etlmic?) Entities. In: M. Özba~aran/0. Tanmd1/A. Boratav (eds.), Archaeological Essays in Honour of Homo amatus : Güven Arsebück (lstanbul 2003) 87 - 103.
Efe 2006 T. Efe, Anatolische Wurzeln - Troia und die frühe Bronzezeit im Westen Kleinasiens. In: M. Korfmann (Hrsg.), Troia. Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 15 - 28.
Efe 2007 T. Efe, The Theories of the ' Great Caravan Route' between Cilicia and Troy: The Early Bronze Age IIl Period in Inland Western Anatolia . In: A. Fletcher/A. M. Greaves (eds.) , Transanatolia : Proceedings of the Conference Held at the British Museum, 31 March to I April 2006 (London 2007) 47 - 64.
300
Efe/Fidan 2006 T. Efe/E. Fidan, Pre-middle Bronze Age meta] objects from in land western Anatolia : A typological and chronological evaluation. AnatoliaAntiqua 14, 2006, 15 - 43.
Efe/ ilaslj 1997 T. Efe/A. ilaslj , Pottery links between the Troad and Inland Northwestern Anatolia during the Trojan Second Settlement. In: Ch. Dumas (ed.) , Poliochni et l'antica eta del Bronzo neii 'Egeo Settentrionale (Athen 1997) 596- 609.
Efe/Türkteki 20 II T. Efe/M. Türkteki , Meta] Warking in Inland Western Anatolia (3rd Millennium BC). In: V. Sahoglou/P. Sotirakopoulou (eds.), Across the Cyclades and Western Anatolia during the 3'd Millennium BC (Istanbul2011) 224 - 226 .
Ehelolf 1939 H. Ehelolf, Texte verschiedenen Inhalts (vorwiegend aus den Grabungen seit 1931). Keilschrifturkunden aus Boghazköi 30 (Berlin 1939).
Eiwanger 1989 J. Eiwanger, Talanton : Ein bronzezeitlicher Goldstandard zwischen Ägäis und Mitteleuropa. Germania 67 , 1989, 443 - 462.
Elayi/Elayi 1997 J. Elayi /A.G. Elayi , Recherehes sur les poids Pheniciens (Paris 1997).
Eluere 1989 C. Eluere, Secrets of ancient gold (Giun-Düdingen 1989).
Emre 1971 K. Emre, Anatolian Iead figurines and their stone moulds. Türk tarih kurumu yayinlaindan - VI. ser. Sa. 14 (Ankara 1971 ).
Englund/Nissen 1993 R. K. Englund/H. J. Nissen , Die lexikalischen Listen der archaischen Texte aus Uruk. Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 13 (Berlin 1993).
Eriksson 1991 K. Eriksson , Red Lustraus Wheelmade Ware: A Product of Late Bronze Age Cyprus. ln: J. A. Barlow (ed.) , Cypriot Ceramics : Reading the Prehistoric Record (Philadelphia 1991) 81 - 96 .
Erkan Fidan 2006 M. Erkan Fidan, Waffen aus Metall von ihren Anfängen bis zum Ende der Frühen Bronzezeit aus dem inneren Westanatolien. Colloquium Anatolicum 5, 2006, 91-106.
Erkanal 1977 H. Erkanal, Die Äxte und Beile des 2. Jalutausends in Zentralanatolien. PBF IX,2 (München 1977).
Erkanal 1996 H. Erkanal , Early Bronze Age Urbanizat ion in the Coastal Region of Western Anatolia. In: Y. Sey (ed.) , Housing and Settlement in Anatolia. A Historical Perspective (Istanbul 1996) 70- 82.
Erkanal 1998 H. Erkanal , 1996 Liman Tepe Kaz!lan. 19. KST, Bd. I, 1998, 379- 398.
Erkanal 2008 H. Erkanal , Die neuen Forschungen in Bakla Tepe bei lzmir. In: H. Erkanai/H. Hauptmann/ V. ~ahoglu/ R. Tun9el (eds.), The Aegean in the Neolithic, Calcolithic and the Early Bronze Age. Proceedings ofthe International Symposium in Urla, October 13'11
- 19'11 1997 (Ankara 2008) 165- 177.
Erkanal 2008a H. Erkanal, Liman Tepe: New Lights on Prehistoric Aegean Cultures. In: H. Erkanai/H. Hauptmann/ V. ~ahoglu/ R. Tun9el (eds.), The Aegean in the Neolithic, Calcolithic and the Early Bronze Age. Proceedings of the International Symposium in Urla, October 13'11 - 19'11 1997 (Ankara 2008) 179- 190.
Erzen 1940 A. Erzen, Kilikien bis zum Ende der Perserherrschaft (unveröff. Inaugural-Dissertation , Universität Leipzig 1940).
Esin 1976 U. Esin, Die Anfange der Metallverwendung und Bearbeitung in Anatolien (7500- 2000 v. Chr.). ln: H. Müller-Karpe (Hrsg.), Le Debut de Ia Metallurgie. Union Internat. Seien. Prehist. et Protohist. IX• Congres Nice 13.- 18. Septembre 1976 (Gap 1976) 209- 240.
Esin 1987 U. Esin, Tepecik ve Tülintepe ' ye (Altmova-Eiaz1g) Ait Bazi Metal ve Cüruf Analiz leri. TI . Arkeometri Sonu9lan Toplantisi , Ankara 26.- 30.05 .1986 (Ankara 1987) 69 - 80.
Eslick 2009 C. Eslick, Elmali-Karata~ V. The Early Bronze Age Pottery of Karata~: Habitation Deposits (Oxford 2009).
Evans 1894 A. J. Evans, Primitive Pictographs and a Prae-Phoenician Script from Crete and the Peloponnese. Journal of Hellenie Sturlies 14, 1894, 270- 372.
Evans 1906 A. Evans, Minoan Weights and Medium of Currency, from Crete, Mycenae and Cyprus. In: Corolla Numismatica. Numismatic Essays in Honour of Barclay V. Head (Oxford 1906) 336- 367.
Fales/Postgate 1992 F. M . Fales/J. N. Postgate, Imperial Administrative Records. Part 1: Palace and Temple Administration . State Archives of Assyria 7 (Helsinki 1992).
Fielden 1981 K . J. Fielden, The Clu·onology of Settlement in Northeast Syria during the Later Fourth and Third Millennia B.C. in the Light of Ceramic Evidence from Teii-Brak (unveröff. PHD Dissertation, Corpus Christi College 1981 ).
Figulla/Weidner 1916 H. H. Figulla/E. F. Weidner, Keilschrifttexte aus Boghazköi (Leipzig 1916).
Finet 1974- 1977 A. Finet, Le vin a Mari. Archiv fiir Orientforschung 25 , 1974- 1977, 122- 131.
Fleischmann 2011 K . Flei schmann, Beiträge im Katalogteil von: Kykladen. Lebenswelten einer frühgriechischen Kultur. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung in Karlsruhe ( Darmstadt 2011 ).
Floreano 200 I E. Floreano, The Role of Silver in the Domestic Economic System ofthe Hittite Empire. Altorientalische Forschungen 28, 200 I, 209- 235.
Formigli 1993 E. Formigli, Fälschungen etruskischen Goldschmucks. In: Die Etrusker und Europa. Ausstellungskatalog (Berlin 1993) 440-441.
Formigli/Heilmeyer 1993 E. Formigli/W.-D. Heilmeyer, Einige Fälschungen antiken Goldschmucks im 19. Jahrhundert. Arch. Anzeiger 1993 , 299 - 332.
Forty 1981 A. J. Forty, Micromorphological sturlies of the corrosion of gold alloys. Gold Bulletin 14,1, 1981 , 25-35 .
Frangipane 1993 M. Frangipane, Local Components in the Development of centralized Societies in Syro-Anatolian Regions. In: M. Frangipane (ed.) , Between the Rivers and the Mountains. Festschr. fiir A . Palmieri (Roma 1993) 133- 161.
Frangipane 2007 M. Frangipane (ed.), Arslantepe Cretulae: An Early Centralised Administrative System before Writing. Arslantepe 5 (Roma 2007).
Frangipane et al. 2002 M. Frangipane/G. M. Di Nocera/A. Hauptmann/ P. Morbidelli/ A. Palmieri/L. Sadori/M. Schultz/T. Schmidt- Schultz, New symbols of a new power in a " royal" tomb from 3000 BC Arslantepe, Malatya (Turkey) . Paleori ent 27/2, 2002, I 05 - 139.
Frayne 2008 D. R. Frayne (ed.), Presargonic Period . Royal lnscriptions of Mesopotamia Early Periods 1 (Toronto 2008).
French 1969 D.H. French , Anatolia and the Aegean in the Third Millennium B.C. (unveröff. PHD Dissertation, London University 1969).
Freytag/Mannsperger 1991 B. Freytag v. gen. Löringhoff/D . Mannsperger, Troja: Realität und Mythos im Spiegel der Denkmäler (Tübingen 1991 ).
Freudenberg 2009 M. Freudenberg, Steingeräte zur Metallbearbeitung - Einige neue Aspekte zum spätneolithischen und frühbronzezeitlichen Metallhandwerk vor dem Hintergrund des Schleswig-Holsteinischen Fundmaterials. Arch. Korrbl. 39, 2009, 341 - 359.
Friedrich I 966 J. Friedrich, Geschichte der Schrift (Heidelberg 1966).
Frirdich 1997 C. Frirdich, Die Keramik der maritimen Troia-Kultur (Troia IIIl). Studia Troica 7, 1997, 111 - 258.
Fügert/Sanati-Müller 2013 A. Fügert/Sh. Sanati-Müller, Der altbabylonische Palast von Uruk und seine Texte. In: N . Crüsemann/ M. van Ess/M. Hilgert/B. Salje (Hrsg.), "Uruk - 5000 Jahre Megacity", Begleitband zur Ausstellung (Petersberg 20 13) 243 - 251.
301
Gaedtke-Eckardt 2008 D.-B. Gaedtke-Eckardt, Die Funde aus den Schl iemann-Grabungen in der Sammlung des archäologischen Instituts der Universität Göttingen. In: M. Wemhoff/D. Hertel/A. Hänsel (Hrsg.), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage Bd. I. Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, N.F. 14 (Berlin 2008) 307-35 1.
Gale/Stos-Ga le 198 1 N. H. Gale/Z. A. Stos-Gale, Lead and silver in the ancient Aegean. Scienti fic American 244 (6), 198 1, 142- 152.
Gale/Stos-Ga le/G i lmore 1984 N. H. Gale/Z. A. Stos-Gale/G. R. Gilmore, Early Bronze Age Troj an meta! sources and Anatolians in the Cyclades. Oxford Journa l Arch. 3, 1984, 23-43 .
Gale/Stos-Ga le/Gilmore 1985 N . H. Gale/Z. A. Stos-Gale/G. R. Gilmore, A lloy Typesand Copper Sources of Anatolian Copper Arti fac ts. Anatolian Studi es 35, 1985, 143 - 174.
Gale et al. 1985 N. H. Gale/A. Papastamataki/Z. A. Stos-Gale/K. Leoni s, Copper sources and copper metallurgy in tbe Aegean Bronze Age. In: P. T. Craddock/M . J . Hughes (ed.), Furnaces and Smelting Technology in Antiquity (London 1985) 81- 1 0 I .
Gale et a l. 1997 N. H. Gale/Z. A. Stos-Ga le/G. Mali ot is/N. Annetts, Lead isotope data from the Isotrace Laboratory, Oxford . Archaeometry data base 4, ores from Cyprus. Archaeometry 39, 1997, 237-246.
Gambaschidze u. a. 200 I I. Gambaschidze/A. Hauptmann/R. Slotta/Ü. Yal r;: in (Hrsg.), Georgien. Kata log der Ausstellung des Deutschen Bergbau-M useums Bochum in Verbindung mit dem Zentrum fü r Archäologische Forschungen der Georgischen Akademie der Wissenschaften Tibli ss i vom 28 . Oktober 200 I bi s Mai 2002 (Bach um 200 I).
Gardiner 1950 A. Gm·diner, Egyptian Grammar (London 1950).
Garslang 1953 J. Garstang, Prehi storic Mersin . Yümük Tepe in Southern Turkey (Oxford 1953).
Gatsov 1998 I. Gatsov, Techn ical and Typological Analys is of the Chipped Stone Assemblages from Troia. Studi a Troica 8, 1998, 11 6- 140.
Gatsov/ Efe 2005 I. Gatsov/T. Efe, Some observa tions on the EB I! chipped stone arti facts from Kulluoba (near Eski ~ehir) in inland Northwestern Anatolia. Anatolia Antiqua 2005 , 111 - 118.
Gedl 2009 M. Gedl , Die Lanzenspitzen in Polen. PBF V,3 (München 2009) .
Geluke 2003 H.-J . Gehrke, Was ist Vergangenhei t? Oder: Die "Entstehung" von Vergangenhe it . ln : Ch. Ulf(Hrsg.), Der Neue Streit um Troja. Eine Bilanz (München 2003) 62 - 8 1.
Genouillac 19 11 H. de Genouillac, Tablettes de Drehem. Textes Cuneiformes du Louvre 2 (Paris 19 11 ).
302
Genter/Gropengiesser/ Wagner 1979-80 W. Genter/ H. Gropengiesser/G. A. Wagner, Blei und Si lber im ägäischen Raum. Eine archäometrische Untersuchung und ihr archäologisch-histori scher Rahmen. Mannileimer Forum (Mannheim 1979/ 1980).
Genz 2000 H. Genz, The Organi sation of Early Bronze Age Metalworking in the Southern Levant. Paleorient 26/1 , 2000, 55-65.
Genz 2002 H. Genz, Überlegungen zu frühbronzezei tlichen Kulturkontakten zwischen der Levante und der Ägä is. In: R. Aslan/S. Blum/ G. Kastl/F. Schweizer/ D. Thumm (Hrsg.) , Mauerschau: Festsclui ft für Manfred Korfmatm (Remshalden-Grunbach 2002) 595 - 605 .
Genz 2002a H. Genz, Die fhihbronzezeitliche Kerami k von Hirbet ez-Zeraqön. Abhand lungen des Deutschen Paläst ina-Vereins 27,2 (Wiesbaden 2002).
Genz/Schwarz 2004 H. Genz/R. Schwarz, Von Häuptlingen und anderen Oberhäuptern - Re ich ausgestattete Gräber in der Frühbronzezeit. In: H. Meiler (Hrsg.), Der geschmiedete Himmel. Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren. Begle itband zur Sonderausstellung (Halle 2004) .
Gerlaff 1993 S. Gerloff, Zu Fragen mi ttelmeerländi scher Kontakte und absoluter Chronologie der Frühbronzezeit in Mitte l- und Westeuropa. Prähi st. Zei tschr. 68 , 1993 , 58- 102.
Gerloff20 10 S. Gerloff, Von Troj a an di e Saa le, von Wessex nach Mykene Chronologie, Fernverbindungen und Zinnrouten der Frühbronzezeit M itte l- und Westeuropas. In : H. Mell er/F. Bertemes (Hrsg.), Der Gri ff nach den Sternen Internat. Symposi um Halle 2005 (Halle 20 10) 603 -639.
Gilg et al. 2003 H. A. Gilg/C. Allen/G. Balassone/M. Boni/F. Moore, The 3-stage evoluti on of tbe Angouran Zn "oxide"-sul fi de deposit, Iran. In : Eli opoul os et al. (eds.), Minera l exploration and sustainable development (Rotterdam 2003) 77-80.
Gerstenblith 1983 P. Gerstenbli th, The Levant at the Beginning of the Middle Bronze Age (Winona Lake 1983).
Götze 1902 A. Götze, Die Kleingeräte aus Metall , Stein, Knochen, Thon und ähnlichen Stoffen. ln : W. Dörpfeld, Troj a und llion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen Schichten von Ilion 1870- 1894 (Athen 1902) 320- 423 .
Goldman 1956 H. Goldman, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus Il: From the Neolithic through the Bronze Age (Princeton 1956).
Goldmann 199 1 K. Goldmann, Der Schatz des Priamos. Anti ke Welt 1991 ,3, 195 - 205 .
Goldmann/Menghin 1993 K. Goldmann/W. Menghin, Schliemanns Gold und die Schätze Alteuropas aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte. Eine Dokumentation. Staatliche Museen zu Berlin- Preußischer Kulturbesitz (Mainz 1993).
Goldmann/Schneider 1995 K. Goldmann/ W. Schneider, Das Gold des Priamos. Geschichte einer Odyssee (Berlin 1995)
Griesa 1992 I. Griesa, Bemerkungen zum heutigen Stand der SchliemannSammlung. In: J. Herrmann (Hrsg.), Heinrich Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archäologie I 00 Jahre nach Schliemanns Tod (Berlin 1992) 391-396.
Grumach 1962 E. Grumach, Ein Gewichtsstein der Sammlung Metaxas, Herakleion. Kadmos I, 1962, 162- 164.
Gülr,:ur 2002 S. Gülr,:ur, Handelsbeziehungen im Vorderen Orient. In: Ü. Yalr,:in (Hrsg.), Anatolian Meta! II. Der Anschnitt, Beiheft 15 (Bochum 2002) 27- 37.
Guerra 2008 M. F Guerra, Etruscan gold jewellery: genuine, restored or pastiche? in: S. Rovira Llorens/M. L. Garcia-Heras/M. Gener Moret/1. Montero Ruiz (eds.), Actas VII Congreso Iberico de Arqueometria (Madrid 2008) 479- 489.
Guerra/Calligaro 2003 M. F. Guerra/T. Calligaro, Gold cultural heritage objects: a review of studies of provenance and manufacturing technologies. Measurement Science and Technology 14 (9), 2003, 1527- 153 7.
Guichard 2005 M. Guichard, La vaisselle de Juxe des rois de Mari. Archives Royales de Mari 31 (Paris 2005) .
Haas 2003 V. Haas, Materia magica et medica hethitica. Ein Beitrag zur Heilkunde im Alten Orient (Berlin, New York 2003).
Haas/Wegner 20 J 0 V. Haas/1. Wegner, Beiträge zum hurritischen Lexikon: Die hurritischen Verben uss- ,geben' und ass- ,abwaschen , abwischen ' . ln: J. Klinger/E. Rieken/Ch. Rüster (eds.), Investigationes Anatolicae. Gedenkschrift für Erich Neu, Studien zu den BogazköyTexten 52 (Wiesbaden 2010) 97- 109.
Hadj isavvas 1999 S. Hadjisavvas, Zypern, Kupfer und das Meer. In: R. Busch (Hrsg.), Kupfer für Europa. Bergbau und Handel auf Zypern (Neumünster 1999).
Hänsel 1992 A. Hänsel, Der Hortfund von Crevic, ein urnenfelderzeitliches Handwerkerdepot aus Lothringen. Acta Praehistorica et Archaeologica 22, 1992, 57- 81.
Hänsel 1997 A. Hänsel , Die Funde der Bronzezeit aus Bayern. Bestandskatlaog Museum für Vor- und Frühgeschichte 5 (Berlin 1997).
Hänsel2004 A. Hänsel, Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer (Berlin 2004).
Hänsel2008 A. Hänsel, Die handgemachte Keramik der VII. Ansiedlung in der Berliner Sammlung. ln: M. Wemhoff/D. Hertel/A. Hänsel (Hrsg.), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage Bd. I (Berlin 2008)57- 92.
Hänsel1968 B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken I u. II. Beitr. z. ur- u. frühgesch . Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 8 (Bonn 1968).
Hänsel u. a. 20 12 B. Hänsel!B. Ter:Zan/K. Mihovilic, Beile und ihre Teile. Beobachtungen an Funden aus Monkodonja/ lstrien. In: P. Anreiter/ E. Banffy/L. Bartosiecicz/W. Meid/C. Metzner-Nebelsick (Hrsg.), Archaeological , cultural and linguistic heritage. Festschrift für Erzsebet Jerem in Honour of her 70'11 birthday. Archaeolingua 25 (Budapest 20 12) 225- 248.
Hänsel/Weihermann 2000 B. Hänsel!P. Weihermann, Ein neu erworbener Goldhort aus dem Karpatenbecken im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Acta Praehist. et Arch. 32, 2000, 7- 29.
Haff01·d 200 I W.B. Hafforcl, Merchants in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean (unveröff. PHD Dissertation , Pennsylvania University 2001).
Hansen 2003 D. P. Hansen, 145 - Cylinder Seal with kneeling nude heroes. in J. Aruz/R. Wallenfels, Art of the First Cities (New York 2003) 217.
Hansen 2000/0 I S. Hansen, Fruchtbarkeit? Zur Interpretation neolithischer und chalkolithischer Figuralplastik. Mitteil. Anthropol. Ges. Wien 130/ 131 , 2000/2001 , 93 - 106.
Hansen 2001 S. Hansen, Helme und Waffen der Bronzezeit in der Sammlung Axel Guttmann. in: H. Born/S. Hansen, Helme und Waffen Alteuropas. Sammlung Axel Gutmann , Bd. 9 (Mainz 200 I) 11-166.
Hansen 2007 S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa. Archäologie in Eurasien 20 (Mainz 2007).
Hansen 2011 S. Hansen, Technische und soziale Innovationen in der zweiten Hälfte des 4. Jts. v. Chr. In: S. Hansen/J. Müller (Hrsg.), Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel zwischen 5000- 1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus. Internationale Tagung 15.- 18. Oktober 2007 in Kiel. Archäologie in Eurasien 24 (Mainz 2011) 153-210.
Hansen Streily 2000 A. Hansen Streily, Bronzezeitliche Töpferwerkstätten in der Ägäis und in Westanatolien (Mannheim 2000). https://ub-madoc.bib. uni-mannheim.de/1133 (Stand: 20.11 .20 13)
303
Hartenherger et al. 2000 B. Hartenberger/S. Rosen/T. Matney, The Early Bronze Age Blade Workshop at Tigri~ Höyük: Lithic Specialisation in an Urban Context. Near Eastern Archaeology 63/ 1, 2000, 51 - 58.
Hatz 2003 M.-J. Hatz, 128 - Disk of Enheduanna, daughter of sargon. In 1. Aruz/ R. Wallenfels, Art of the First Cities (New York 2003) 200-20 I.
Hauptmann 2008 A. Hauptmann, Erzlagerstätten im östlichen Mittelmeerraum. In: Ü. Yalyin (Hrsg.), Anatolian Meta! IV. Der Anschnitt, Beiheft 21 (Bochum 2008) 55- 66.
Hauptmann 2012 A. Hauptmann, Forschungsprojekt: Die Königsgräber von Ur. Jahresbericht des Instituts fiir archäologische Wissenschaften fUr das akademische Jahr 2010-2011 der Ruhr-Universität Bochum (Bochum2012) 115.
Hauptmann et al. 2003 A. Hauptmann/S. Schmitt-Stecker/F. Begemann/A. Palmieri , Chemical Composition and Lead Isotopy of Meta! Objects from the "Royal" Tomband Other Related Finds at Arslantepe, Eastern Anatolia . Paleorient 28, 2003 , 43 - 70.
Hawkes 1936/37 Ch. Hawkes, TheDouble Axe in Prehi storic Europe. Annual British School Athens 37, 1936/37, 141 - 159.
Hazzidakis 1963 J. Hazzidakis, Fouilles executees a Mallia li (Paris 1963).
Heinhold-Kramer 2003 S. Heinhold-K.ramer, Zur Gleichsetzung der Namen 1lios-Wilusa und Troia-Taruisa . 1n: Ch. Ulf(Hrsg.), Der Neue Streit um Troja. Eine Bilanz (München 2003) 146- 168.
Heinhold-Kramer 2003 S. Heinhold-Kramer, A!J.l]iyawa - Land der homerischen Achäer im Krieg mit Wilusa? In: Ch. Ulf (Hrsg.), Der Neue Streit um Troja. Eine Bilanz (München 2003) 193-2 14.
Hend in 2007 D. Hendin, Ancient Scale Weights and Pre-Coinage Currency of the Near East (New York 2007).
Hermann 2000 J. Herrmann, Schliemann, Virchow und die Berliner Akademie der Wissenschaften. ln: Kolloquium: Akademie der Wissenschaften (Akademische Wissenschaft) im säkularen Wandel: 300 Jahre Wissenschaft in Berlin. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 38, 2000, 81-92.
Hertel2008 D. Hertel , Die Geschichte der Erforschung Trojas. ln : M. Wemhoff/ D. Hertei/A. Hänsel (Hrsg.), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage 1. Berliner Be iträge zur Vor- und Frühgeschichte N.F. 14 (Berlin 2008) 19-28.
Herzog 1955 A. Herzog, Mikrophotographischer Atlas der technisch wichtigen Pflanzenfasern (Berlin 1955).
304
Heuck Allen 1999 S. Heuck Allen, Finding the walls ofTroy (Berkeley/ Los Angeles 1999).
Heurtley 1939 W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia (Cambridge 1939).
Hirschfeld 2008 N. Hirschfeld, The Potmarks from Troy VI-VII in the Berlin Schliemann Collection. ln: M. Wemhoff/D. Hertei/A. Hänsel (Hrsg.), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage 1. Berliner Beiträge zur Vor- und FrühgeschichteN. F. 14 (Berlin 2008) 301 - 306.
Hitz! 1996 K. Hitz!, Die Gewichte griechischer Zeit aus Olympia (Berlin, New York 1996).
Hochsteller 1987 A. Hochstetter, Kastanas. Ausgrabungen in einem Siedlungshügel der Bronze- und Eisenzeit Makedoniens 1979- 1979. Die Kleinfunde. Prähistorische Funde in Südosteuropa 6 (Berlin 1987).
Höckmann 2003 0. Höckmann, Zu früher Seefahrt in den Meerengen. Studia Troica 13, 2003 , 133 - 160.
Holdermann/Trommer 20 11 C.-S . Holdermann/F. Trommer, Organisation, Verfahrenstechniken und Arbeitsaufwand im spätbronzezeitlichen Metallhandwerk. In: U. L. Dietz/ A. Jockenhövel , Bronzen im Spannungsfeld zwischen praktischer Nutzung und symbolischer Bedeutung. Beitr. Beiträge zum internationa len Kolloquium am 9. und 10. Oktober 2008 in Münster. PBF XX, 13 (Stuttgart 2011 ).
Holloway 1981 R. R. Holloway, ltaly and the Aegean 3000- 700 B.C. Archaeologia Transatlantica I (Louvain-La-Neuve 1981).
Holmgren 2004 R. Holmgren, "Money on the Hoof': The Astragalus Bone - Religion, Gaming and Primitive Money. ln: B. S. Frizell (ed.) , Pecus: Man and Anima! in Antiquity: Proceedings of the Conference at the Swedish Institute in Rome, September 9'h- 12'h, 2002 (Rome 2004) 212- 220.
Hood 1961 M. S. F. Hood, The Tartaria Tablets. In: C. C. Lamberg-Karlowsky (ed.), Old World Archaeology: Foundation of Civilization (San Francisco 1961) 210- 217.
Hood et al. 1982 S. Hood/J. Clutton- Brock/P. G . Bialor, Excavations in Chios 1938- 1955: Prehistoric Emporio and Ayio Gala ll. British School at Athens. Supplementary Volumes 16 (Oxford 1982).
Horejs 2009 8. Horejs, Metalworkers at the <;: ucurivi Höyük? An Early Bronze Age Mould and a "Near Eastern Weight" fi·om Western Anatolia. In: T. L. Kienlin/B. Roberts , Metals and Societies - Studies in honour of Barbara S. Ottaway. Universitätsforsch. z. Prähist. Arch. 169 (Bochum 2009) 358-368.
H01jes/Mehofer/ Pernicka 2010 B. HOtj es/M. Mehofer/E. Pernicka, Metallhandwerker im frühen 3. Jt. v. Chr. - Neue Ergebnisse vom <;:ukuri9i Höyük. lstanbuler Mitteilungen 60, 2010, 7- 37.
H B lll
Ft z
H F. R (I
H F
Horejs u. a. 20 II B. Horejs/A. Gailik/U. Thanheiser/S. Wiesinger, Aktivitäten und Subsistenz in den Siedlungen des <;::ukuriryi Höyük. Der Forschungsstand nach den Ausgrabungen 2006- 2009. Prähist. Zeitschr. 86, 200 I, 31-66.
Horst 1981 F. Horst, Bronzezeitliche Steingegenstände aus dem Eibe-OderRaum . Jahrb. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 29, 1981 (1982), 33 - 83.
Horst 1986 F. Horst, Die jungbronzezeitlichen Kannelurensteine des mitteleuropäischen Raumes - Werkzeuge fiir die Bronzebearbeitung? Helvetia Arch. 67, 1986, 82- 91.
Hrouda 1991 B. Hrouda, Der Alte Orient (München 1991 ).
Hronzy 1921 F. Hrozny, Keilschrifttexte aus Boghazköi 5 (Leipzig 1921 ).
Hultsch 1882 F. Hultsch, Griechische und römische Metrologie (Berlin 1882).
Hundt 1975 H.-J. Hundt, Steinerne und kupferne Hämmer der frühen Bronzezeit. Arch. Korrbl. 5, 1975, 115-120.
Hundt 1986 H.-J. Hundt, Zu einigen vorderasiatischen Schaftlochäxten und illl'em Einfluss auf den donauländischen Guß von Bronzeäxten. Jahrb. RGZM 33/ 1, 1986, 131 - 157.
Hunger 1983 H. Hunger, Spätbabylonische Texte aus Uruk 2. Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka (Berlin 1983).
lndreko 1956 R. Indreko, Steingeräte mit Rille (Stockholm 1956).
Inseln der Winde 20 I 0 Th. Guttandin/ D. Panagiotopoulos/H. Pflug/G. Plath (Hrsg.), Inseln der Winde. Die maritime Kultur der bronzezeitlichen Ägäis. Ausstellungskatalog (Heidelberg 20 I 0).
IRERP Team 2 1997 IRERP Team, Archaeological Researches at Li man Tepe (An Archaeological Guide) (lzmir 1995, updated 1997).
Isler 1973 H.-P. Isler, An Early Bronze Age Settlement on Samos. Archaeology 26, 1973, 170- 175.
lvanova 2008 M. Ivanova, Befestigte Siedlungen auf dem Balkan, der Ägäis und in Westanatolien, ca . 5000-2000 v. Chr. Tübinger Schriften zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie 8 (Münster 2008).
Jablonka 2006 P. Jablonka, Vorbericht zu den Arbeiten in Troia 2005. Studia Troica 16, 2006, 3- 26.
Jablonka 2006a P. Jablonka, Leben außerhalb der Burg - Die Unterstadt von Troia. In: M. 0. Korfmann (Hrsg.), Troia: Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 167- 180.
Jantzen 2008 D. Jantzen, Quellen zur Metallverarbeitung im Nordischen Kreis der Bronzezeit. PBF XIX, 2 (Stuttgart 2008).
Japp 2009 S. Japp, The Local Pottery Production of Kibyra. Anatolian Studies 59, 2009, 95 - 128.
Joannes 2009- 11 F. Joannes, Silber. A. In Mesopotamien. I: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie 12, 2009-11 , 486-491.
Johns 1898- 1923 C. H. W. Johns, Assyrian Deeds and Documents 1-4 (Cambridge 1898- 1923).
Joukowsky 1986 M. S. Joukowsky, Prehistoric Aphrodisias. An Accotnlt ofthe Excavations and Artifact Studies (Providence, Rhode lsland, Louvain-La-Neuve 1986).
Junker/Wieder 2004/05 H. Junker/H. Wieder, Zur personellen Ausstattung des Museums flir Vor- und Frühgeschichte seit 1829. Personalverzeichnis -Kurzbiographien - Stellenübersicht In: Das Berliner Museum fiir Vor- und Frühgeschichte. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen. Acta Praehist. et Arch 36/37, 2004/2005 , 513 - 591.
Kaiser 2008 E. Kaiser, Frühbronzezeitliche Gräber von Metallhandwerkern mit Gußformen für Schaftlochäxte im osteuropäischen Steppenraum. In: B. Horejs/R. Jung/E. Kaiser/B. Tel'Zan (Hrsg.), Interpretationsraum Bronzezeit. Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet. Universitätsforsch . z. Prähit Arch. 121 (Bonn 2005) 265 - 291.
Kämil 1982 T. Kämil , Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia. BAR International Series 145 (Oxford 1982).
Kaptan 2008 E. Kaplan, Metallurgical Residues from Late Chalcolithic and Early Bronze Age Liman Tepe. In: Erkanal et al. (eds.), Prodeedings of the International Symposium "The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age"- October 1311'-19'h 1997, Urla-izmir (Turkey) (Ank.ara 2008) 243 - 250.
Karo 1930/33 G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai (München I930/33).
Kassianidou/Knapp 2005 V. Kassianidou/A. B. Knapp, Archaeometallurgy in the Mediterranean: The Social Context ofMining, Technology, and Trade. In: E. Blake/A. B. Knapp (eds.), The Archaeology of Mediterranean Prehistory (Oxford 2005) 215-251.
Katalog Athen 1990 Katalog zur Ausstellung Troja, Mykene, Tiryns, Orchomenos, Heinrich Schliemann zum 100. Todestag (Athen 1990).
305
Katalog Berlin/Sofia 1981 Troja und Thrakien. Katalog zur Ausstellung in Berlin und Sofia (Berlin 1981 ).
Katalog Bronzezeit 2013 Staatliche Eremitage/Staatliches Histori sches Museum/Staatl iches Puschkin Museum der Bildenden Künste/Staatliche Museen zu Berlin Preußi scher Kulturbesitz (Hrsg.), Bronzezeit- Europa ohne Grenzen. 4. bis 1. Jahrtausend v. Chr. Katalog zur Ausstellung in St. Petersburg und Moskau (St. Petersburg 20 13).
Katalog Moskau 1996/97 W. P. Tolstikow/M. J. Treister, Der Schatz aus Troja. Schliemann und der Mythos des Priamos Goldes. Katalog zur Ausstellung in Moskau (Stuttgart, Zürich 1996/67).
Katalog St. Petersburg 1998 Sliman, Peterburg, Troja. Katalog zur Ausstellung in der Eremitage St. Petersburg vom 19.06.- 18. 10.1998 (St. Petersburg 1998).
Kaufman n 1957 H. Kaufmann, Steingeräte mit Schäftungsrille aus Sachsen . Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 6, 1957,2 11 - 284.
Keskin 20 11 L. Keskin, Metalworking in the Western Anatolian Coastal Region in the 3rd Millenium. In: Across. The Cyclades and Western Anatolia during the 3'dMillenium BC (lstanbul2011) 144- 153.
Kilian- Dirlmeier 1984 I. Kilian-Dirlmeier, Nadeln der frühhelladischen bis archaischen Zeit von der Peloponnes. PBF Xlll ,8 (München 1984).
Kili an-Dirlmeier 1993 I. Kilian-Dirlmeier, Die Schwerter in Griechenland ( außerhalb der Peloponnes), Bulgarien und Albanien. PBF IV, 12 (Stuttgart 1993).
Kilian-Dirlmeier 2005 I. Kilian-Dirlmeier, Die bronzeze itlichen Gräber bei Nidri auf Leukas . Monographien RGZM 62 (Ma inz 2005) .
Kisch 1965 B. Ki sch, Scales and Weights: A H istorica l Outline (London 1965).
Klein 1992 H. Kl ein, Untersuchung zur Typologie bronzezeitlicher Nadeln in Mesopotamien und Syrien. Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie 4 (Saarbrücken 1991 ).
Kl ein et al. 2012 S. Klein/A. Hauptmann/ M. Jansen/D. Kirchner/R. Lehmann/R. Zettler, Platimun group element inclusions in early Bronze Age go ld artefacts from the Royal Tombs of Ur, 2600/2500 BCE. European Mineralogical Conference Vol I, 2012, 575.
Knacke-Loy 1994 0 . Knacke-Loy, lsothopenchemische, chemische und petrographi sche Untersuchungen zur Herkunftsbestimmung der bronzezeitlichen Keramik von Troi a. Heidelberger Geowissenschaftliehe Abhandlungen 77 (Heidelberg 1994).
Knacke-Loy et al. 1995 0. Knacke-Loy/M. Sat1r/E. Pernicka, Zur Herkunftsbestimmung der bronzezeitlichen Keramik von Troja. Studia Troica 5, 1995, 144- 175.
306
Knudtzon 1915 J. A. Knudtzon, Die EI-Amarna-Tafeln. Vorderasiati sche Bibliothek 2 (Leipzig 1915).
Koch 1999 S. Koch , Troianisches Silber. Technologische Untersuchung und Rekonstruktion eines Gefäßes aus dem "Schatz des Priamos". Di plomarbeit, eingereicht 1999 an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Studiengang Restaurierung/Grabungstechnik Berlin , unpubliziert. (Berlin 1999).
Koch 200 1 S. Koch mit Beitrag von H. Born, Troianische Silbergefaße. Herstellungstechnische Untersuchung und Restaurierung eines Schnurösengefaßes (Sch 5861 ). Acta Praehi st. et Arch. 33, 200 I, 252-266.
Koerte 1899 A. Koerte, Kleinasiatische Studien IV: Ein altplu·ygischer Tumulus bei Bos-öjlik (Lamunia). Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Inst ituts 24, 1899, 1-45.
Kohlmeyer 1994 K. Kohlmeyer, Zur frühen Geschichte von Blei und Silber. Handwerk und Technologie im alten Orient (Mainz 1994).
Konsola 1990 D. Konsola, Die trojanische Sammlung des Nationalmuseums. In: Troja, Mykene, Tiryns, Orchomenos. Heinrich Schliemann zum I 00. Todestag. Gemeinsame Ausstellung des Nationalmuseums Athen und des Musetuns flir Ur- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin (Athen 1990) 79- 87.
Konstantinidi-Syvridi/Kontaki 2009 E. Konstantinidi-Syvridi/M. Kontaki , Castingfinger rings in mycenean times: two unpublished moulds at the National Archaeological Museum in Athens. The Annual of the British School at Athens 104, 2009, 311-319.
Koppenhöfer 2002 D. Koppenhöfer, Die bronzezeitliche Troia VI-Kultur und ihre Beziehung zu den Nachbark:ulturen. Studia Troica 12, 2002, 282 - 395.
Korfmann 1972 M. Korfmann , Schleuder und Bogen in Südwestasien. Antiquitas Reihe 3 (Bonn 1972).
Korfmann 1982 M. Korfmann, Tilkitepe. Die ersten Ansätze prähistori scher Forschung in der östlichen Türkei. Instanbuler Mitteilungen, Beiheft 26 (Tübingen 1982).
Korfmann 1983 M. Korfmann, Demircihüyük I. Die Ergebni sse der Ausgrabungen von 1975- 1978. Architektur, Stratigraphie und Befunde (Mainz 1983).
Korfmann 1986 M. Korfmann , Troy: Topography and Navigation: The Geopolitical Significance of the Hisarllk ("Troy") and the Harbor Problem. In . M. J. Mellink (ed.), Troy and the Trojan War: A Symposium held at Bryn Mawr Co llege 1984 (Bryn Mawr 1986) 1- 16.
Korfmann 1987 M. Korfmann, Die westanatolische Frühbronzezeit und deren Datierung nach den neuesten Grabungsergebnissen in Demircihüyük und Be~ik-Yass1tepe. In: K. Pizehelami (Hrsg.), Kaukasien im System der Paläometallischen Kulturen Eurasiens (Tbilisi 1987) 80-90.
Korfmann 1989 M . Korfmann, Ausgrabungen am Be~ik-Tepe 1982- 1987. In: K. Emre/E. Ozgen (Hrsg.), Anatolia and the Ancient Near East. Studies in Honour ofTahsin Özgü9 (Ankara 1989) 271-278.
Korfmann 1994 M . Korfmann, Troia-Ausgrabungen 1993. Studia Troica 4, 1994, 1-50.
Korfmann 1995 M . Korfmann, Troia - AResidenrial and Trading City at the Dardanelles, In: R. Laffineur/W.-D. Niemeier (eds.), Politeia . Society and State in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 5'11
International Aegean Conference, Heidelberg 1994. Aegeaum 12 (Liege, Austin 1995) 173-183.
Korfmann 200 I M. Korfmann, Troia/Wilusa- Ausgrabungen 2000. Studia Troica 11 , 2001 , 1- 50.
Korfmann 200 l a M. Korfmann, "Schatz A" und seine Fundsituation. In: J. W Meyer/ M. Novak/A. Pruß (Hrsg.), Beiträge zur Vorderasiatischen Archäologie, Winfried Orthmann gewidmet (Frankfurt am Main 2001) 212- 235 .
Korfmann 200 I b M. Korfmann, Troia- Traum und Wirklichkeit. Eine Einführung in das Thema. In: M. Korfmann/J. Latacz (Hrsg.), Troia. Traum und Wirklichkeit. Begteilband zur gleichnamigen Ausstellung in Stuttgart (Stuttgart 2001) 4-23.
Korfmann 200 l c M. Korfmann, Wilusa/(W)llios ca. 1200 v. Chr. - llion ca. 700 v. Chr. Befundberichte aus der Archäologie. ln: M. Korfmann/ J. Latacz (Hrsg.), Troia. Traum und Wirklichkeit. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung in Stuttgart (Stuttgart 200 l) 64-76.
Korfmann 200 1 d M. Korfmann, Der prähistorische Siedlungshügel Hisarlik. Die "zehn Städte Troias" - von unten nach oben. ln: M. KorfmamliJ. Latacz (Hrsg.), Troia. Traum und Wirklichkeit. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung in Stuttgart (Stuttgart 2001) 34 7-354.
Korfmann 2001 e M. Korfmann, Troia als Drehscheibe des Handels im 2. und 3. vorchristlichen Jahrtausend. In: M. Korfmann/J. Latacz (Hrsg.), Troia. Traum und Wirklichkeit. Begteilband zur gleichnamigen Ausstellung in Stuttgart (Stuttgart 200 I) 355- 368.
Korfmann 200 l f M. Korfmann, Neue Aspekte zum " Schatz des Priamos" . Der Schatz A von Troia, sein Auffindungsort und seine Datierung. In: M. Korfmann/J. Latacz (Hrsg.), Troia. Traum und Wirklichkeit. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung in Stuttgart (Stuttgart 2001) 373 - 383.
Korfmann 2004 M. 0. Korfmann , Troia/Wilusa: Überblick und offizieller Rundgang (lstanbul 2004).
Korfmann 2006 M. 0. Korfmann, Troia - Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft In: M. 0. Korfmann (Hrsg.), Troia. Archäologie e ines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 1- 12.
Korfmann/Kromer 1993 M. Korfmann/B . Kromer, Demircihüyük, Be~ik-Tepe, Troia -Eine Zwischenbilanz zur Chronologie dreier Orte in Westanatolien . Studia Troica 3, 1993 , 135- 171.
Kouka 2002 0. Kouka, Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit (3 . Jt . v. Chr.). Internationale Archäologie 58 (Rahden/Westf. 2002).
Kouka 2008 0. Kouka, Zur Struktur der frühbronzezeitlichen insularen Gesellschaften der Nord- und Ostägäis. Ein neues Bild der sogenannten "Trojanischen Kultur" . In: H . Erkanai/H. Hauptmann/Y. ~ahoglu/R. Tuncel (eds .), The Aegean in the Neolithic, Chalcolitbic and the Early Bronze Age (Ankara 2008) 285 - 300.
Ko~ay/ Akok 1950 H.Z. Ko~ay/M. Akok, Amasya Mahmatlar köyü definesi. Türk Tarih Kurumu Bel lelen 14, 1950, 481-485.
Kossack I 999 Religiöses Denken in dinglicher und bildlieber Überlieferung Alleuropas aus derSpätbronze-und frühen Eisenzeit (9.- 6. Jahrhundert v. Clu·.). Bayerische Akademie der Wissenschaften, Abhdl. 116 (München 1999).
Kramer 1989 S. N. Kramer/J. R. Maier, Myths ofEnki the Crafty God (Oxford 1989).
Krebernik 2013 M. Krebernik, Die frühe Keilschrift und ihr Verhältnis zur Sprache. In: N. Crüsemann/M. van Ess/M. Hilgert/ B. Salje, "Uruk-5000 Jahre Megacity", Begteilband zur Ausstel lung (Petersberg 2013) 187- 193.
Kryszat 1995 G. Kryszat, Ilu-suma und der Gott aus dem Brunnen. In: W. von Sode11IO. Loretz/M. Dietrich (Hrsg.), Vom Alten Orient zum Alten Testament (Kevelaer 1995) 201 - 213.
Kruse/Stumpf 1998 F.-W. Kruse/G. Stumpf, Auf die Goldwaage gelegt ... Waage, Gewicht und Geld im Wandel der Zeiten. Staatliche Münzsammlung (München 1998).
Kuckenburg 1992 W. Kuckenburg, Dokumentation zur Rekonstruktion des großen Diadems aus dem Schatz A von Troia. Studia Troica 2, 1992, 201-218.
Kühne 1976 H. Kühne, Die Keramik vom Tell Chuera und ilu·e Beziehungen zu Funden aus Syrien , Palästina, der Türkei und dem Iraq (Berlin 1976).
Kürkman 2003 A. Kürkman, Anatolian Weights and Measures (lstanbul 2003).
307
Kunu;:aytrh/ Özbal 2005 E. Kunu;:aytrh/H . Özbal, New Meta! Analysis from Tarsus Gözlükule. ln: Ü. Yalc;:in (Hrsg.), Anatolian MetalliJ. Der Anschnitt, Beiheft 18 (Bochum 2005) 49- 61.
Kushnareva I 997 K. Kh. Kushnareva, The Southern Caucasus in Prehistory: Stages of Cultural and Socioeconomic Development from the Eighth to the Second Millennium B.C. University Museum Monograph 99 (Philadelphia 1997).
Kykladen 2011 Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.), Kykladen- Lebenswelten einer Frühgriechischen Kultur. Katalog zur Austeilung (Darmstadt 20 II ).
Laffineur 2002 R. Laffineur, Reflections on the Troy Treasure. ln: R. Aslan/ S. BlumiG . Kasti/ F. Schweizer/D. Thumm (Hrsg.), Mauer Schau: Festschrift fiir Manfred Korfmann (Remshalden-Grunbach 2002) 237- 244.
Lamb 1936 W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos (Cambridge 1936).
Lamberg-Karlowsky 1990 C. C. Lamberg-Karlowsky, Modeli vzaimodeystviya v III tysyacheletii do n.e. ot Mesopotamii do doliny lnda (Models of Interconnections in the 3'd millem1ium BC from Mesopotamia to the lndus Valley), Vestnik Drevney lstorii (Moscow) I, 1990, 3- 20.
Lambert 1972- 75 W. G. Lambert, T)egal. ln: D .-0. Edzard (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 4 (Berlin, New York 1972- 1975) 247.
Lambert 1980-83 W. G. Lambert, Labama-Abzu. In: D.-0. Edzard, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 6 (Berlin, New York 1980- 1983) 431.
Laneri 2002 N. Laneri , The Discovery of a Funerary Ritual: Inanna/ lshtar and Her Descent to the Nether World in Titri~ Höyük, Turkey. East and West 52/1 , 2002 , 9-51.
Lang 2002 A. Lang, Speise- und Trankopfer. In: L. Zemmer-Plank (Hrsg.) , Kult der Vorzeit in den Alpen (Bozen 2002) 917 - 944.
Lang/Grosby 1964 M. Lang/M. Grosby, Weights, Measures and Tokens: The Athenian Agora v. X. (Princeton, New Jersey 1964).
La Niece 1995 S. La Niece, Depletion gilding from third Millennium BC Ur. Iraq 57, 1995, 41 - 47 .
de Laperouse 2003 1.-F. de Laperouse, 152 - Lobed crescent earrings. ln: J. Aruz/ R. Wallenfels, Art of the First Cities (New York 2003) 221-222.
Laroche 1971 E. Laroche, Catalogue des textes hittites (Paris 1971) - mit Ergänzungen in Revue Hittite et Asianique 32, 1972, 94- 133 und Revue H ittite et Asianique 33, 1973, 68- 71.
308
Lassen 1994 H. Lassen, Zu den beiden Bronzebeinringen aus dem Gräberfeld an der Be~ik-Bucht in der Troas. Studia Troica 4, 1994, 127-142.
Lassen 2000 H. Lassen, Introduction to Weight Systems in the Bronze Age East Mediterranean: The Case ofKalavasos-Ayios Dhimitrios. In: C. F. E. Pare (ed .), Metals Make the World Go Round: The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe. Proceedings of a Conference held at the University of Binningham in June 1997 (Exeter 2000) 233 - 246.
Laughlin/Todd 2000 G. J. Laughlin/ J. A . Todd, Evidence for Early Bronze Age Tin Ore Processing. In: Materials Characterization 45 ,4-5, 2000, 269- 273.
Lechevaher 1791 J.-B Lechevalier, Description of the Plain of Troy. Translated by Andrew Dalziel (Edinburgh 1791 ).
Leskov 1981 A. M. Leskov, Jung- und spätbronzezeitliche Depotfunde im nördlichen Schwarzmeergebiet I. PBF XXX,5 (München 1981 ).
Levy et al. 2002 Th. E. Levy/R. B. Adams/A. Hauptmann/M. Prange/S. SchmittStecker/M. Najjar, Early Bronze Age metallurgy: a newly discovered copper manufactory in Southern Jordan. Antiquity 76, 425- 437.
Lilyquist 1993 C. Lilyquist, Granulation and glass: chronological and stylistic investigations at selected sites, ca. 2500- 1400 B.C.E. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 290/291 , 1993, 29- 94 .
Limet 1986 H. Limet, Textes administratifs relatifs aux metaux. Archives Royales de Mari 25 (Paris 1986).
Lindsten 1943 E. Lindsten, Vorgeschichtliche Gewichte aus Troja. Acta Archaeologica 14, 1943, 91-105.
Lloyd/Mellaart 1962 S. Lloyd/J. Mellaart, Beycesultan I.: The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels. Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 6 (London 1962).
Lloyd/Mellaart 1965 S. Lloyd/J . Mellaart, Beycesultan I!.: Middle Bronze Age Architecture and Pottery. Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 8 (London 1965).
Lo Schiavo 2006 F. Lo Schiavo, Western Weights in Context. In: M. E. Alberti/ E. Ascalone/L. Peyronel (eds.), Weights in Context - Bronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean: Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. International Colloquium in Rome, 22'"-24'" November 2004 (Rome 2006) 359- 379.
Luschey 1939 H. Luschey, Die Phiale (Bleicherode a. Harz 1939).
Makkay 1992 J. Makkay, Priam's Treasure: Chronological Considerations. ln : J. Hennann (Hrsg.), Heimich Schliemann - Grundlagen und Ergebnisse moderner Archäologie: 100 Jahre nach Schliemanns Tod (Berlin 1992) 199-204.
Malmer 1992 M. Mahner, Weight Systems in the Scandinavian Bronze Age. Antiquity 66, 1992, 377-388.
Manning 1995 S. W. Manning, The Absolute Clu·onology of the Aegean Early Bronze Age: Archaeology, Radiocarbon and History. Sheffield Monographs in Mediterraneall Archaeology (Sheffield 1995).
Mannsperger 1992 D. Mannsperger, Das Gold Troias und die griechische Goldprägung im Bereich der Meerengen. In: I. Gamer-Waller! (Hrsg.), Troia: Brücke zwischen Orient und Okzident (Tübingen 1992) 124-151.
Mannsperger 200 I D. Mannsperger, Mythen , Machtpolitik und Münzpropoganda. 1n: M. Korfmann/W. Latacz (Hrsg.), Troia: Traum und Wirklichkeit, Ausstellungskatalog (Stuttgart 2001) I 03 - I 07 .
Mannsperger 2006 D. Mannsperger, Vom Zahlungsmittel zum Leilattefakt - Münzen und Münzfunde in llion. In: M. 0 . Korfmann (Hrsg.), Troia: Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz am Rhein 2006) 265-274.
Mannsperger/Mannsperger 2002 B. Mannsperger/D. Matmsperger, Die Ilias ist ein Heldenepos: llosgrab und Athena llias. ln: R. Aslan/S. BlumiG. Kastl/ F. Schweizer/D. Thumm (Hrsg.), Mauer Schau. Festschrift für M. Korfmann (Remshalden-Grunbach 2002) I 075-1101.
Mansfeld 200 I G. Mansfeld, Die Kontroll-Ausgrabungen des Pinnacle E4/5 im Zentrum der Burg von Troia. Studia Troica 11 (Mainz 200 I) 51 -308 .
Maran 1992 J. Maran, Die Deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien lll. Die mittlere Bronzezeit. Beitr. z. Archäologie des Mittelmeerraumes 30-31 (Bonn 1992).
Maran 1998 J. Maran, Kulturwandel auf dem griechischen Festland und den Kykladen im späten 3. Jahrtausend v. Clu. Studien zu den kulturellen Verhältnissen in Südosteuropa und dem zentralen sowie östlichen Mittelmeerraum in der späten Kupfer- und frühen Bronzezeit. Universitätsforsch. z. prähistorischen Archäologie 53 (Bonn 1998).
Maran 2000 J. Maran , Das ägäische Chalkolithikum und das erste Silber in Europa. ln: C. 1~ik (Hrsg.), Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des ägäischen Bereiches. Festschrift für Baki Ögün zum 75. Geburtstag. Asia Minor Studien 39 (Bonn 2000) 179- 193.
Maran 2001 J. Maran, Der Depotfund von Petralona (Nordgriechenland) und der Symbolgehalt von Waffen der ersten Hälfte des 3. Jts. v. Chr.
zwischen Karpatenbecken und Ägäis.ln: R. M. Boehmer/J. Maran (Hrsg.), Lux orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa . Festschrift fiir Harald Hauptmann zum 65. Geburtstag (Rahden/ Westf. 2001) 275-284.
Marcoux/Moelo 1991 E. Marcoux/Y. Moelo, Lead isotope geochemistry and paragenetic study of inheritance phenomena in metallogenesis: examples from base meta! sulfide deposits in France. Economic Geology, 86, 1991 , 106- 120.
Marangou 2001 Ch. Marangou, Evidence for Counting and Recording in the Neolithic? Artefacts as Signs and Signs on Artefacts . In: A. Michailidou (ed.), Manufacture and Measurement: Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies, MEAETHMATA33 (Athens 2001) 11 - 43.
Margueron 2004 J.-C. Margueron, Mari , Metropole de I' Euphrate (Paris 2004).
Marro 1997 C. Marro, La culture du Hout-Euphrate au Bronze Ancien (Paris 1997).
Marzahn 2013 J. Mahrzahn, Vom Beginn der Schrift. In: N. Crüsemann/ M. van Ess/M. Hilgert/B. Salje (Hrsg.), "Uruk - 5000 Jahre Megacity", Begleitband zur Ausstellung (Petersberg 20 13) I 84- 186.
Mathews et al. 1994 R.J. Mathews/W. Matthews/H. McDonald, Excavations at Tell Brak, 1994. Iraq 56, 1994, 177- 194.
Matney/ Algaze 1995 T. Matney/G. Algaze, Urban Development at Mid-Late Early Bronze Age Titri~ Höyük in Southeastern Anatolia. Bulletin of the American School ofOriental Resaerch 299/300, 1995, 33 - 52.
Mathota/Demortier 2004 S. Mathota/G. Demortier, Diffusion bonding from antiquity to present times. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam lnteractions with Materials and Atoms 226, I -2, 2004, 222- 230.
Matthiae 2009 P. Matthiae, Regionale Verbundenheit? - Das Königreich Ebla. Tn : Landesamt Württemberg, Stuttgart u.a. (Hrsg.), Schätze des Alten Syrien 20 I 0 (Stuttgart 2009) 47- 50.
Matz 1928 F. Matz, Die frühkretischen Siegel : Eine Untersuchung über das Werden des minoischen Stiles (Berlin, Leipzig 1928).
Maul 1994 S. Maul , Zukunftsbewältigung. Eine Untersuchung altorientalischen Denkensanhand der babylonisch-assyrischen Löserituale (Namburbi) . BaghdaderForschungen 18 (Mainz 1994).
Mauss 1990 M. Mauss, Die Gabe. Form und Funktion des Austausches in archaischen Gesellschaften (Frankfurt a. M. 1990).
Maxwell-Hyslop 1949 K. R. Maxwell-Hyslop, Western Asiatic Shaft-Hole Axes. Iraq II / I, 1949, 90- 129.
309
Maxweii-Hyslop 1971 K. R. Maxweli-Hyslop, Western Asiatic Jewellery, c. 3000-612 B. C. (London 1971 ).
Maxweii-Hyslop 1977 K. R. Maxweli-Hyslop, Sources of Sumerian gold, the Ur goldwork from the Brotherton Library. University ofLeeds; a preliminary report. Iraq 39, 1977, 83 - 86.
Maxweii-Hyslop 1989 K. R. Maxweli-Hyslop, An Early Group ofQuadruple Spirals. In: Anatolia and the Ancient Near East. Studies in Honor of Tashin Özgü<;: (Ankara 1989) 215-223 .
Mayer 1983 W. Mayer, Sargons Feldzug gegen Urartu - 714 v. Chr. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin 115, 65 - 132.
Mazzoni 1980 S. Mazzoni , Un peso in forma di leone da l Palazzo Q. Studi Eblaiti lll/9-1 0, 1980, 157-160.
Mcgeehan- Liritzis 1983 V. Mcgeehan- Liritzis , The relationship between metalwork, copper sources and the evidence for settlement in the Greek Late Neolithic and Early Bronze Age. Oxford Journal of Archaeology 2, 1983, 147- 180.
Mc Ginnis 1987 J. Mc Ginnis, A Neo-Assyrian Text Describing a Royal Funeral. State Archives of Assyria Bulletin I/I , 1- 13.
Meeks/Craddock I 991 N. D. Meeks/P. T. Craddock, The detection of cadmium in gold/ silver alloys and its alleged occurrence in ancient gold solders. Archaeometry 33, 1, 1991 , 95 - 107.
Mellaart 1966 J. Mellaart, The Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East and Anatolia (Beirut 1966).
Mellink 1956 M. Mellink, The Royal Tombs at Alaca Höyük and the Aegean World (New York 1956).
Mellink 1963 M. J. Mellink, An Akkadian Illustration ofa Campaign in Cilicia? Anatolica 7,1963, 110- 115.
Mellink 1973 M. Mellink, Archaeology in Asia Minor. American Journal of Archaeology 77, 1973, 169- 193 .
Mellink 1986 M. J. Melli nk, The Early Bronze Age in West Anatolia. In: G. Cadogan (ed .), The End of the Early Bronze Age in the Aegean : Aegean and Asiati c Correlations. Classical Studies 6, 1986, 139-152.
Mellink 1989 M. J. Mellink, Anatolian and Foreign Relations of Tarsus in the Early Bronze Age. In: K. Emre/M. Mellink/8. Hrouda/N. Özgü<;: (eds.), Anatolia ancl the Ancient Near East. Studies in Honor of Tahsin Özgü<;: (Ankara 1989) 319- 331.
310
Metlink 1992 M. J. Mellink, Anatolian Chronology. in: R. W. Ehrich (Hrsg.), Chronologies in Old World Archaeology I I (Chicago I 992) 207 - 220.
Mellink I 993 M. J. Mellink, The Anatolian South Coast in the Early Bronze Age: The Cilician Perspective. In: M. Frangipane (ed.), Between the Rivers and Over the Mountains. Alba Palmieri cledicata (Rome 1993) 495 - 508.
Mello et al. 1983 E. Mello/P. Parrini/E. Formigli, Etruscan filigree: welding techniques of two gold bracelets from Vetulonia. American Journal Arch. 87, 1983, 548-551.
Menghin 1996 W. Menghin , Außenstelle Moskau? Die Trophäen aus dem Berliner Museum tlir Vor- und Frühgeschichte in Russland. Arch. Nachrbl. I ,2, 1996, II 0-120.
Metzinger-Schmitz 2004 Metzinger-Schmitz, Die Glockenbecherkultur in Mähren und Nieclerösterreich : Typologische und chronologische Studien auf dem Hintergrund der kulturhistorischen Abläufe während der späten Kupferzeit im Untersuchungsgebiet; mit einem paläometallurgischen Exkurs (Saarbrücken 2004). http://scidok.sulb. uni-saarland.de/volltexte/2004/320/ (Stand 24.05.20 13).
Micu et al. 2005 - 2006 C. Micu/C. Ha ita/F. M ihail , Quelques Observations sur !es pieces en pierre polie decouvertes dans I" etablissement Eneolitique de Carcaliu (dep. de Tulcea). Peuce S. N. III,3-4, 2005-2006, 9- 40.
Michailidou 2001 A. Michai lidou, Recording Quantiti es ofMetal in BronzeAge Societies in the Aegean and the Near East. In: A. Michailidou (ed.), Manufacture and Measurement: Counting, Measurement andRecorcling Craft ltems in Early Aegean Societies. MEAETHMATA 33 (Athens 200 I) 85-119.
Michailidou 200la A. Michailidou, Script and Metrology: Practical Processes ancl Cognitive Inventions. In: A. Micha ilidou (ed.), Manufacture and Measurement: Counting, Measuring and Recording Craft ltems in Early Aegean Societies. MEAETHMATA 33 (Athens 2001) 53-82.
Michel!Veenhof 20 I 0 C. MicheVK. R. Veenhof, The Textiles Traded by the Assyriens in Anatolia (19'h- 18'h BC). In: Textiles Terminologies. Ancient Textile Ser. 8 (Oxford 2010) 210-271.
Michels-Gebier 1984 R. Michels- Gebier, Schmied und Musik. Über die traditionelle Verknüpfung von Schmiedehandwerk und Musik in Afrika, Asien und Europa. Orpheus-Schriftemeihe 37 (Sonn I 984).
Milano 2004 L. Milano, Weight Stones from Tell Beydar/Nabada. Kaskal I, 2004, 1- 7.
Milojcic 1961 V. Mi lojcic, Samos I. Die Prähistorische Siedlung unter dem Heraion . Grabung 1953 und 1955 (Sonn 1961).
Mitschke 2001 S. Mitschke, Zur Erfassung und Auswertung archäologischer Textilien an korrodiertem Metall. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 51 (Marburg 200 I).
Mkrtchian 1990 K. H. Mkrtchian, Armenian Monetary Units (Yerevan 1990) (in Armenian and English).
Montet 1928 P. Montet, Byblos et l'Egypte. Bibliotheque Archeologique et Historique II (Paris 1928).
Moorey 1985 P. R. S. Moorey, Materials and manufacture in ancient Mesopotamia, the evidence of archaeology and art; metals and metalwork, glazed materials and glass. British Archaeological Reports Internat. Ser. 237 (Oxford 1985).
Motzenbäcker 1996 I. Motzenbäcker, Sammlung Kossnierska. Der digorische Formenkreis der kaukasischen Bronzezeit. Bestandskataloge des Musetuns fiir Vor- und Frühgeschichte 3 (Berlin 1996).
Moucha 2003 V. Moucha, Pokus interpretac i nalezu z obdobi kultury se zvoncovitymi pohary ve Svobodnych Ovarech (okr. Hradec Kralove). Arch. Rozhledy 55/4, 2003 , 772 - 783.
Mountjoy 2008 P. A . Mountjoy, The Mycenean Pottery from Troy in the Berlin Schliemann Collection. ln : M. Wemhoff/0 . Hertei/A. Hänsel (Hrsg.) , Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage I (Berlin 2008) 29-55.
Mozsolics 1965- 66 A. Mozsolics, Goldfunde des Depotfundhorizontes Hajdllsamson. Ber. RGK 46-4 7, 1965- 66, 1-76.
Mudrinic/Serafimovski 1992 C. Mudrinic/T. Serafimovski, Lead, sulphur, oxygen and carbon isotopes in the Zletovo ore field (Eastern Macedonia). Geologia Balcania, 24 (3), 1992, 39-48.
Müller 1965 G. Müller, Hieratische Paläographie! (Osnabrück 1965).
Müller 1982 M. Müller, Gold, Silber und Blei als Wertmesser in Mesopotamien während der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. u. Z.ln: M. A. Dandamaev (ed.), Societies and Languages of the Ancient Near East. Studies in Honor ofl. M. Diakonoff (Warminster 1982) 270- 278.
Müller 2003 W. Müller, Precision Measurements ofMinoan and Mycenaean Gold Rings with Ultrasound. In: K. P. Foster/R. Laffineur (Hrsg.), Metron: Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9th International Aegean Conference. Aegaeum 24 (Liege 2003) 475 - 481.
Müller-Karpe 1990 M. Müller-Karpe, Metallgefaße des Dritten Jalu·tausends in Mesopotamien. Arch. Korrbl. 20, 2, 1990, 161 - 176.
Müller-Karpe 1993 A. Müller-Karpe, Metallgefaße im Iraq. Pähistorische Bronzefunde II , 14 (Stuttgart 1993).
Müller-Karpe 1994 A. Müller-Karpe, Altanatolisches Metallhandwerk. Offa-Blieber 75 (Neumünster 1994).
Muhly 1973 J. D. Muhly, Copper and Tin: The Distribution of Mineral Resources and the Nature of the Metals Trade in the Bronze Age. Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Seiences 43 (Hamden 1973).
Muhly 1993 J. Muhly, Early Bronze Age Tin and the Taurus. American Journal of Archaeology 97/2, 1993 , 239 - 253.
Muller 2005 B. Muller, Oe Mari a l'Egee: La Peinlure Proche-Orientale au 2' Millenaire av. J.-C . In : A. Villing (ed.), The Greeks in the East. The British Museum Research Publication 157 (London 2005) 37- 52.
Munir 2010 J. Munir, Experimentelle Forschungen zur Herstellungstechnik eisenzeitlicher Hohlblechringe. Restaurierung und Archäologie 3, 2010,27-42.
Muscarella 1974 0. Muscarella (ed.), Ancient Art . The Norbert Schimmel Collection (Mainz 1974).
Musehe 1992 B. Musche, Vorderasiatischer Schmuck von den Anfangen bis zur Zeit der Achaemeniden (ca . 10 000 - 330 v. Chr.). in: Handbuch der Orientalistik, Abt. 7. Kunst und Archäologie Bd. I. Der alte vordere Orient. Abschnitt 2, Die Denkmäler (Leiden, New York, Kobenhavn, Köln 1992).
Muthmann 1987 H.-0. Muthmann, Mehrfachgefaße in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (Rheinfelden 1987).
Nagel 1992 W. Nagel/H. Becker, Der Schatz des Priamos - Übersetzungen und Kommentar zu der Geletutendiskussion um Schliemanns Funde. Acta Praehist. et Arch. 24, 1992, 191 - 204.
Naster 1975 P. Naster, La metbade en metrologie numismatique. In: P. Naster (ed.) , Numismatic Antique: Problemeset Methades (Nancy, Louvain 1975) 65-74.
Nessel2009 B. Nessel , Funktionelle Aspekte der bronzenen Sägeblätter in der späten Bronze- und Urnenfelderzeit im Karpatenbecken. In: 0. Dietrich/ L. Dietrich/ B. Heeb/A. Szentmiklosi , Aes Aeterna - Festschrift fiir Tudor Soroceanu. Analeie Banatului 17, 2009, 239-259.
Nessel 2010 B. Nessel , Bronzene Sägeblätter - Handhabung und Konzeption im Lichte experimentalarchäologischer Versuche. Apulum 4 7, 2010, 41 - 56.
Nestler/Formig li 1993 G. Nestler/ E. Fonnigli, Etruskische Granulation. Eine antike Goldschmiedetechnik (Siena 1993).
311
Nishimura 2007 Y. Nishimura, The North Mesopotamien Neighborhood: Domestic Activities and Hausehold Space at Tigri~ Höyük. Near Eastern Archaeology 70/1 , 2007,53-56.
Nougayrol 1956 J. Nougayrol , Textes accadiens des Archives Suds. Le Palais royal d ' Ugarit 4 (Paris 1956).
Nriagu 1993 J. 0 . Nriagu, Lead and Iead poisening in Antiquity (New York 1993).
Novotna 1970 M. Novotna, Die Äxte und Beile in der Slowakei. PBF IX,3 (München 1970).
Ohnefalsch-Richter 1893 M. Ohnefalsch-Richter, Kypros, die B ibel und Homer: Beiträge zur Culh1r-, Kunst und Religionsgeschichte des Orients im Alterthume; mit besonderer Berücksichtigung eigener zwölfjähriger Forschungen und Ausgrabungen auf der Insel Cypern (Berlin 1893).
Olshausen 1887 0. Olshausen, Drei angebl iche Eisenobjecte aus der zweituntersten Ruinenschicht von Hissarlik. Zeitschr. f. Ethnologie, Verhand I. Berliner Ges. Antlu. , Ethn. u. Urgesch . 22 , 1887, (500)- (506).
Orthman 1 963 W. Orthmann, Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus lnneranatolien. lstanbuler Forschungen 24 (Berlin 1963).
Orthmann 1966 W. Orthmann, Keramik der Yortan-Kultur in den Berliner Museen. Istanbuler Mitte ilungen 16, 1966, 1- 26.
Orthmann 1975 W. Orthmann, Der Alte Orient. Propyläen Kunstgeschichte 14 (Berlin 1975).
Otten 1963 H. Otten, Hethitische Rihmle. Keilschrifturkunden aus Boghazköi 39 (Berlin 1963).
Otten 1958 H. Otten, Hethitische Totenrituale. Institut für Orientforschung Veröffentlichung 37 (Berlin 1958).
Otten 1970 H. Otten, Aus dem Bezirk des grossen Tempels . Keilscluifttexte aus Boghazköi 19 (Berlin 1970).
Otten/Rüster 199 5 H. Otten/Ch. Rüster, Hethitische Texte vorwiegend von Büyükkale , Gebäude A. Keilschrifttexte aus Boghazköi 39 (Berlin 1995).
Otto 1992 B. Otto, Vergleichende Betrachtungen zur Ornamentik goldener Zierate aus Troja und Mykene. In: J. Herrmann (Hrsg.), Heinrich Schliemann: Grundlagen und Ergebnisse moderner Archäologie 100 Jahre nach Schliemanns Tod (Berlin 1992) 243-252 .
Ouyang 2013 X. Ouyang, Monetary RoJe of Silver and its Administration m Mesopotamia during the Ur IIl Period (c. 2112 - 2004 BCE): A
312
Case Study of the Umma Province. Biblioteca de1 Pr6ximo oriente Antiguo 11 (Madrid 20 13).
Özdogan 2008 M. Özdogan, Obsidian in the Context ofNear Eastern Prehistory. A Conspectus on the Status ofResearch. Problemsand Prospects. Anatolian Meta! IV. Der Anschnitt, Beiheft 21 (Bochum 2008) 191 - 201.
Özdogan/Parzinger 2000 M. Özdogan/H. Parzinger, The StahlS of Metallurgy between the Balkansand Anatolia: The evidence of A~ag1 Pmar and Kanhgec;it Excavations at Eastern Trace. In: Ü. Yalc;in (Hrsg.), Anatolian Meta! I. Der Anschnitt, Beiheft 13 (Bochum 2000) 83 - 91.
Özdogan/Parzinger 2012 M. Özdogan/H. Parzinger, Die frühbronzezeitliche Siedlung von Kanligec;it bei Kirklareli, Ostthrakien während des 3. Jahrtausends v. Chr. im Spannungsfeld von anatolischer und balkanischer Kulturentwicklung. Studien im Thrakien-Marmara-Raum 3. Archäologie in Eurasien 27 (Darmstadt 2012).
Özgüc; 1995 N. Özgüc; , Silver and Copper Ingots from Acemhöyük. In: U. Finkbeiner!R. Dittmann!H. Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur Kulturgeschichte Vorderasiens. Festscl1rit für R. !VI. Boehmer (Mainz 1995) 513 - 519.
Özgür,: 1986 T. Özgüc;, New Observations on the Relationship of Kültepe with South-East Anatolia and North Syria during the III mill. B.C. In: J. V. Canby/E . Porada/B . S. Ridgway/T. Stech (eds.), Ancient Anatolia: Aspects of Change and Cultural Development. In Honour ofM. J. Metlink (Wisconsin 1986) 31-47 .
Ozgüc; 1986a T. Özgür,:, Kültepe-Kanis ll. Eski Yakmdogu 'nun Ticaret Merkezinde yeni Ara~tumalar. Türk Tarih Kurumu Yaymlari V, 41 (Ankara 1986).
Özgüc; 2003 T. Özguc;, Kültepe Kanis/Nesa. The Middle Eastern Culh1re in Japan (lstanbul 2003).
Özgüc;/Tem izer 1993 T. Özgür,:/R. Temizer, The Eskiyapar Treasure. In: !VI. J. Mellink/ E. Porada/T. Özgüc; (eds.), Aspects ofArt and Iconography: Anatolia and its Neighbours. Studies in Honor ofN. Özgüc; (Ankara 1993) 613 - 628.
Özyar 2000 A. Özyar, Einige neue Gedanken zu den sogenannten Fürstengräbern aus Alacahöyük. In: Ü. Yalc;in (Hrsg.), Anatolian Meta! I. Der Ansclmitt, Beiheft 13 (Bochum 2000) 101 - 112.
Palmieri 1981 A. Palmieri , Excavations at Arslantepe (Malatya) . Anatolian Studies31 , XIII-XVI, 1981 , 101-119.
Palmieri et al. 1999 A. M. Palmieri/A. Frangipane/A. Hauptmann/K. Hess, Early metallurgy at Arslantepe during the Late Chalcolithic and Early Bronze Age lA-IB periods . In: A. Hauptmann/E. Pernicka/Th . Rehren/ Ü. Yalcin (Hrsg.), Proceedings of the International Conference "The Beginnings of Metallurgy" . Der Anschnitt, Beiheft 9 (Bochum 1999) 141-148.
I·
Parrini et al. 1982 P. Parrini/E. Formigli/E. Mello, Etruscan Granulation: analysis of orientalizingjewelry from Marsiliana d 'Albegna . American JournalArch. 8~ 1982, 118- 121.
Parrot 1983 A. Pan·ot, Sumer und Akkad (München 1983).
Parzinger 1993 H. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus. Römisch-Germanische Forschungen 52 (Mainz 1993).
Papazoglou-Manioudaki 2003 L. Papazoglou-Manioudaki, Poliochni and the Civilization of the Northeastern Aegean. In: J. Aruz/R. Wallenfels, Art of the First Cities (New York 2003) 270-276.
Patay 1984 P. Patay, Kupferzeitliche Meißel, Beile und Äxte in Ungarn. PBF IX,S (München 1984).
Paoletti 2012 P. Paoletti , Der König und sein Kreis. Das staatliche Schatzarchiv der III. Dynastie von Ur. Biblioteca del Pr6ximo Orienteantiguo 10 (Madrid 2012).
Pe-Piper/Piper 200 I G. Pe-Piper/D. J. W. Piper, Late Cenozoic, post-collisional Aegean igneous rocks; Nd, Pb and Sr isotopic constraints on petrogenetic and tectonic models. Geological Magazine 138, 200 I, 653 - 668.
Pernice 1894 E. Pernice, Griechische Gewichte (Berlin 1894 ).
Pernicka et al. 1984 E. Pernicka/T. C. Seeliger/G. A. Wagner/F. Begemann/S. SchmittStrecker/C. Eibner/0 . Öztunali/I. Baranyi , Archäometallurgische Untersuchungen in Nordwestanatolien . Jahrb. RGZM 31 , 1984, 533 - 599.
Pernicka et al. 1990 E. Pernicka/F. Begemann/S. Schmitt-Strecker/A. P. Grimanis, On the Composition and Provenance of Meta! Artefacts from Poliochni on Lemnos. Oxford Journal of Archaeology 9/3, 1990, 263 - 297.
Pernicka et al. 1998 E. Pernicka/T. Rehren/S. Schmitt-Strecker, Late Uruk silver production by cupellation at Habuba Kabira, Syria. In: T. Rehren/ A. Hauptmaml!J. D. Muhly (Hrsg.), Metallurgica Antiqua. In Honour of Hans-Gert Bachmann and Robert Maddin. Festschrift Bachmatm/Maddin. Der Ansclmitt, Beiheft 8 (Bochum 1998) 123 - 134.
Pernicka et al. 2003 E. Pernicka/C. Eibner/Ö. Öztunalt /G. A. Wagner, Early Bronze Age Metallurgy in the N01th-East Aegean. In: G.A. Wagner/ E. Pemicka/H.-P. Uerpmann (eds .), Troia and the Troad: Scientific Approaches (Berlin, Tokyo 2003) 143 - 172.
Petrescu-Dimbovila 1978 M. Petrescu-Dimbovi\a, Die Sicheln in Rumänien mit Corpus der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. Prähistorische Bronzefunde XVIII, 1 (München 1978).
Petrie 1926 W. M. F. Petrie, Ancient Weights and Measures. Publications of the British School of Archaeo1ogy in Egypt 39 (London 1926).
Petruso 1977 K. M. Petruso, Trojan Systems of Weight and their Affinities. Paper read at the IV'h International Colloquium on Aegean Prehistory, University of Sheffield ( 1977) (unpublished).
Petruso 1978 K.M. Petruso, System of Weight in the Bronze Age Aegean (unpublished PHD Dissertation, 1ndiana University 1978).
Petruso 1984 K.M. Petruso, Prologomena to Late Cypriot Weight Metrology. American Journal of Archaeology 88, 1984, 293-304.
Petruso 1992 K. M. Petruso, Ayia lrini : The Balance Weights. Keos VIII (Mainz 1992).
Piller 2008 Ch. K. Piller, Untersuchungen zur relativen Chronologie der Nekropole von Marlik. Elektr. Diss. München (Straubing 2008).
Pinnock 2006 F. Pinnock, The Raw Lapis Lazuli in the Royal Palace G of Ebla: New Evidence from the Annexes of the Throne Room. In: M. E. Alberti/E. Ascalone/L. Peyronel (eds.) , Weights in Context -Bronze Age Weighing Systems ofEastern Mediterranean: Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. International Colloquium in Rome, 221h- 241h November 2004 (Rome 2006) 347-357.
Platz-Horster/Tietz 1993 G. Platz-Horster/H.-U . Tietz, Etruskische Skarabäen-Kolliers -mit einem Exkurs über die Granulation bei den Etruskern . Jahrb . Berliner Museen N. F. 35, 1993, 7-45.
Podzuweit 1979 C. Podzuweit, Trojanische Gefaßformen der Frühbronzezeit in Anatolien, der Ägäis und angrenzenden Gebieten . Ein Beitrag zur vergleichenden Stratigraphie. Heidelberger Akad. Wiss. Internat. Interakd. Komm. Erforsch. Vorgesch. des Balkans. Monographien I (Mainz 1979).
Pollock 2013 S. Pollock, Differenzierung und Klassifizierung in Gesellschaften des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr. In: N. Crüsemann/ M. van Ess/M. Hilgert/B. Salje (Hrsg.), "Uruk - 5000 Jahre Megacity", Begleitband zur Ausstellung (Petersberg 20 13) 149-154.
Poppelt·euter 1895 J. Poppelreuter, Troische Schriftzeichen. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 10, 1895, 211-212.
Porter/McLeellan 2003 A. Porter/T. McLeellan, Tell Banat. In: J. Aruz/R. Wallenfels, Art of the First Cities (New York 2003) 184- 186.
Postgate et al. 2003-05 N. Postgate/W. Sallaberger/A. Archi/D.-0 . Edzard, Palast. In: M. P. Strecket al. (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie I 0 (Berlin, New York 2003 - 2005) 195 - 208.
313
Potts 1990 D. T. Potts, The Arabian Gulf in Antiquity (Oxford 1990).
Potts 1997 D. T. Potts, Mesopotamian Civilization: The Material Faundatians (London 1997).
Powelll987- 1990 M. A. Powell , Maße und Gewichte in Mesopotamien. Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 7 (Berlin, New York 1987- 1990) 457 - 517.
Prell 2011 S. Prell , Einblicke in die Werkstätten der Residenz. Die Stein- und Metallwerkzeuge des Grabungsplatzes Q I. Forschungen in der Ramsesstadt 8 (Hi ldesheim 20 II ).
Prell 2013 S. Prell , A glimpse into the workshops of tbe chariotry of Quantir-Piramesse - Stone and meta! tools of site Q I. In: A. 1. Veldmeijer/S. Ikram, Chasing Chariots: Proceedings of the first international chariot conference (Cairo 2012) (Leiden 2013) 157- 174.
Primas 1996 M. Primas, Velika Gruda I. Hügelgräber des frühen 3. Jalu·tausends v. Clu·. im Adriagebiet. Velika Gruda, Mala Gruda und ilu Kontext. Universitätsforsch. Präbist Arch. 32 (Zürich 1996).
Primas 2007 M. Primas, Innovationstransfer vor 5000 Jaluen: Knotenpunkte an Land- und Wasserwegen zwischen Vorderasien und Mitteleuropa. Eurasia Antiqua 13 , 2007, 1-19.
Pulak 2000 C. Pulak, The Balance Weights from the Late Bronze Age Shipwreck at Uluburun. In: C . F. E . Pare (ed.) , Metals Make the World Go Round: The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe. Proceedings of a Conference held at the University of Birmingham in June 1997 (Exeter 2000) 247-266.
Pullen 1994 D. 1. Pullen, A Lead Seal from Tsoungiza, Ancient Nemea, and Early Bronze Age Sealing Systems. American Journal of Archaeology 93 , 1994, 35 - 52.
Pusch 1990 E. B. Pusch, Metallverarbeitende Werkstätten der üühen Ramessidenzeit in Quantir-Piramesse Nord. Ein Zwiscbenbereicht. Egypt & Levant 1, 1990, 75 - 113.
Przeworski 1939 St. Przeworski, Die Metallindustrie Anatoliens in der Zeit von 1500 bis 700 v. Chr. Rohstoffe, Technik und Produktion. Internat. Archiv Ethnogr. 36, Suppl. (Leiden 1939).
Raczky 1990 P. Raczky (Hrsg.), Alltag und Religion: Jungsteinzeit in Ost-Ungarn . Ausstellungskatalog (Frankfurt am Main 1990).
Rambach 2000 Kykladen I. Die frühe Bronzezeit. Grab- und Siedlungsbefunde. Beitr. z. ur- u. frühgesch. Arch. des Mittelmeerraumes 33 (Bonn 2000).
314
Rahmstorf 2003 L. Rahmstorf, The Identification of Early Hel ladic Weights and their Wider Implications. In : Metron - Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9'h International Aegean Conference, New Haven, Yale University, 18.-21. April 2002 = Aegaeum 24, 2003 , 293 - 299.
Rahmstorf 2006 L. Rahmstorf, Zur Ausbreitung vorderasiatischer Innovationen in die frühbronzezeitliche Ägäis. Prähist. Zeitsclu·. 81,1 , 2006, 49 - 96.
Rahmstorf 2006a L. Ralunstorf, In Search of the Earliest Balance Weights, Scales and Weigbing Systems from the East Mediterranean, the Near and Middle East. ln: M. E. Alberti/E. Ascalone/L. Peyronel (eds.), Weights in Context - Bronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean: Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. International Colloquium in Rome, 22'h-24'h November 2004 (Rome 2006) 9-45.
Rahmstorf 2010 L. Rahmstorf, Die Nutzung von Booten und Schiffen in der bronzezeitlichen Ägäis und die Fernkontakte der Frühbronzezeit In: H. Meller/F. Bertemes, Der Griff nach den Sternen. Internationales Symposium in Halle (Saale) 16.-21. Februar 2005 (Halle 2010) 675 - 697 .
Rahmstorf 20 I Oa L. Ramstorf, Indicationes of Aegaen-Caucasien relationes during the third millenium BC. In: S. Hansen/A. Hauptmann/ I. Motzenbäcker/E. Pernicka (Hrsg.) , Von Majkop bis Trialeti . Gewinnung und Verarbeitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2 . Jt. v. Chr. (Berlin 20 I 0) 263-295.
Rathgen I 924 F. Rathgen, Die Konservierung von Altertumsfunden. II . und III . Teil: Metalle und Metallegierungen organische Stoffe. 2. umgearbeitete Auflage (Berlin 1924).
Reiter 1997 K. Reiter, Die Metalle im Alten Orient. Alter Orient und Altes Testament 249 (Kevelaer, Neukirchen-Vlyn 1997).
Reifarth 2011 N . Reifarth, Die Textilien vom Bestattungstisch in Kammer 4. Vorbericht zu den mikrostratigraphischen und textiltechnologischen Untersuchungen. In: P. Pfalzner (Hrsg.), Interdisziplinäre Studien zur Königsgruft von Qatna . Qatna Studien I (Wiesbaden 2011) 499 - 523.
Reifarth 2013 N. Reifarth, Zur Ausstattung spätantiker Elitegräber aus St. Maximin in Trier: Purpur, Seide, Gold und Harze. Internat. Archäologie 124 (Rahden/Westf. 2013) .
Rei farth/Drewello 2011 N. Reifarth/R. Drewello, Textile Spuren in der Königsgruft Vorberiebt zu ersten Ergebnissen und dem Potenzial zukünftiger Forschungen. in : P. Pfalzner (Hrsg.), Interdisziplinäre Studien zur Königsgruft von Qatna. Qatna Studien I (Wiesbaden 2011) 469-482 .
Reifarth/Pümpin in Vorb. N. Reifarth/Ch. Pümpin, Sedimentäre Textilstrukturen in der Königsgruft. Mikrostratigrafische und mikromorphologische Unter-
suchungen. ln: P. Pfalzner (Hrsg.) , Die Befunde in der Königsgruft von Qatna. Qatna Studien 6 (in Vorbereitung).
Reinholdt 2003 C. Reinholdt, The Early Bronze Age Jewelry Hoard. In: J. Aruz/ R. Wallenfels, Art ofthe First Cities (New York 2003) 260-261.
Reinl10ldt 2008 C. Reinholdt, Der frühbronzezeitliche Schmuckhortfund von Kap Kolonna: Ägina und die Ägäis im Goldzeitalter des 3. Jahrtausends v. Chr. Denkschriften der Gesamtakademie 46. Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean 15 (Wien 2008).
Reiter 1997 K Reiter, Die Metalle im Alten Orient. Alter Orient und Altes Testament 249 (Neukirchen-Vluyn 1997).
Reiter 1999 K. Reiter, Metals and Metallurgy in the Old Babylonian Period. In: A. Hauptmann/E. Pernicka/T. Rehren/Ü. Yal<;m (eds), The Beginnings of Metallurgy: Proceedings of the International Conference in Bochum 1995. Der Anschnitt, Beiheft 9 (Bochum 1999) 167 - 171.
Renda 1993 G. Renda, Woman in Anatolia. Exhibition 29.11.1993 - 28.2. 1994 (lstanbul 1993).
Renfrew 1972 C. Renfrew, The Emergence ofCivilisation: The Cyclades and the Aegean in the Third Mi llennium BC (London 1972).
Renfrew 1967 C. Renfrew, Cycladic Metallurgy and the Aegean Early Bronze Age. American Journal of Archaeology 7111 , 1967, 1- 20.
Riederer 2002 J. Riederer, Die Berliner Datenbank von Metallanalysen ku lturgeschichtlicher Objekte. IV. Objekte der mitteleuropäischen Bronzezeit sowie etruskische, sardische, griechische, ägyptische und vorderasisatische Objekte. Berliner Beitr. Archäometrie 19, 2002, 72 - 226.
Rieken et al. 2009 E. Rieken et al. (eds.) , 2009sqq : hethiter.net/ : CTH 364.1 , hethiter. net/ : CTH 364.2, hethiter.net/ : CTH 364.3 , hethiter.net/ : CTH 364.4, hethiter.net/ : CTH 364.5.
Rieser 1998/99 B. Rieser, Urgeschichtlicher Kupferbergbau im Raum SchwazBrixlegg, Tirol. Arch. Austriaca 82- 83 , 1998/99, 135 - 179.
Rieth 1957 A. Rieth, Werkzeuge zur Holzbearbeitung: Sägen aus vier Jahrtausenden. Saalburg Jalub. 16, 1957, 47 - 60 .
Roaf 1982 M. Roaf, Weights on the Dilmun Standard.lraq 44, 1982, 137-141 .
Roaf 1990 M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East (Oxford 1990).
Robert 1966 L. Robert, Monnaies antiques en Troade (Paris 1966).
Roden 1988 Ch. Roden. Blasrohrdüsen. Ein archäologischer Exkurs zur Pyrotechnologie des Chalkolithikums und der Bronzezeit. Der Anschnitt 40, 1988, 62-82 .
Röllig 1980- 83 W. Röllig, Kupfer A. Reallexikon fiir Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 6 (Berlin , New York 1980- 1983) 345- 348 .
Rohm 2009 S. Rohm, Operation Schatz des Priamos. Konservierung, Restaurierung, Untersuchung und Rekonstruktion eines trojanischen Si lbergefäßes. In: U. Peltz/0. Zorn (Hrsg.) , KulturGUTerhalten. Restaurierung archäologischer Schätze an den Staatlichen Museen zu Berlin (Mainz 2009).
Romer et al. R . L. Romer/W. Heinrich/B. Schröder-Smeibidi/A. Meixner/ C.-0. Fischer/C. Schulz, Eiemental dispersion and stable isotope fractionation during reactive fluid-flow and fluid immiscibility in the Bufa del Diente aureole, NE-Mexico: Evidence from radiographies and Li , B, Sr, Nd, and Pb isotope systematics. Contributions to Mineralogy and Petrology 149, 2005 , 400- 429.
Romer/Born 2009 R. L. Romer/H. Born, The origin of the Trojan si lver: Lead isotope constraints. Acta Praehist. et Arch. 4 1, 2009, 23-27.
Rose 2006 Cb. B. Rose, Am Schnittpunkt von Ost und West- Das westliche Kle inasien in griechischer und römischer Zeit. In: M. 0. Kerfmann (Hrsg.), Troia: Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 81-104.
Rose 2006a Ch. B. Rose, Auf mythengetränktem Boden-Ilion in griechischer, römischer und byzantinischer Zeit . ln: M. 0 . Korfmann (Hrsg.), Troia: Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 188- 198.
Rupp 2005 N. Rupp, Land ohne Steine. Oie Rohmaterialversorgung in Nordost-Nigeria von der Endsteinzeit bis zur Eisenzeit (2005).
Safar/Mustafa/Lioyd 1981 F. Safar/M. A. Mustafa/S. Lloyd, Eridu (Baghdad 1981).
Sagona/Zimansky 2009 A. Sagona/P. Zimansky, Ancient Turkey (Oxford 2009) .
Saherwala 2004/05 G. Saherwa la, Zur Geschichte der "Sammlung trojanischer Alterthümer" . ln: Das Berliner Museum fiir Vor- und Frühgeschichte. Festschrift zum 175-jährigen Bestehen. Acta Praehist. et Arch 36/37, 2004/2005, 288- 295.
Saherwala 2008 G. Saherwala, Zur Gesch ichte der Heinrich-Sch liemannSammlung im Berliner Musetun fiir Vor- und Frühgeschichte. In: M . Wemhoff/D. Hertei/A. Hänsel (Hrsg.) , Heinrich Schliemanns Samm lung Trojanischer Altertümer- Neuvorlage. Berliner Beiträge zur Vor-und Frühgesch ichte N.F. 14 (Berlin 2008) 11-17.
315
Saherwala u. a. 1993 G. Sahenvala/K. Goldmann/G. Mahr, Heinrich Schliemanns
"Sammlung trojanischer Altertümer" . Berliner Beiträge zur Vor
und Frühgeschichte N. F. 7 (Berlin 1993).
Sahoglu 2005 A. Sahoglu, The Anatolian Trade Network and the lzmir Region
during the Early Bronze Age. Oxford Journal Arch . 24, 2005 ,
339- 361.
Sahoglu 2009 A. Sahoglu, Izm ir Region Excavations and Research Project
(IRERP). Bulletin Institute Classical Studies 52, 2009, 263-264.
Sakellarakis 1981 J. A. Sakellarakis, Matrizen zur Herste llung kretisch-mykenischer
Siegelringe. In: I. Pini (Hrsg.), Studien zur minoischen und hella
dischen Glyptik. Beiträge zum 2. Marburger Siegel-Symposium,
26.-30. September 1978. CMS Beiheft I (Berlin 1981) 167- 179.
Sallaberger 2003 W. Sallaberger, Nachrichten an den Palast von Ebla . Eine Deu
tung von nig-mul-(an). In : P. Marrassini (ed.), Semitic and As
syriological Studies Presented to Pelio Fronzaroli by Pupil s and
Colleagues (Wiesbaden 2003) 600-625.
Sallaberger 2003-05
W. Sallaberger, Opfer. A.I. Nach schriftlichen Quellen. Mesopo
tamien (gemeinsam mit W. R. Mayer). Reallexikon der Assyrio
logie und Vorderasiatischen Archäologie I 0 (Berlin, New York
2003 - 2005)93 - 102.
Sallaberger 2005 W. Sallaberger, Priester. A.I. Mesopotamien (gemeinsam mit
F. Huber Vulliet) . Reallexikon fiir Assyriologie und Vorderasiati
sche Archäologie 19 (Berlin, New York 2005) 617 - 640.
Sallaberger 2008
W. Sallaberger, Das Gilgamesch-Epos. Mythos, Werk und Tradi
tion (München 2008).
Sallaberger 2009 W. Sallaberger, Von der Wollration zum Ehrenkle id. Textilien als
Prestigegüter am Hofvon Ebla. In: B. Hildebrandt/C. Veit (Hrsg.),
Der Wert der Dinge- Güter im Prestigediskurs. Münchner Studi
en zur Alten Welt 6, 2009, 241 -278.
Sallaberger 20 13 W. Sallaberger, Gilgamesch, sagenhafter König von Uruk. In :
N . Crüseman/M. van Ess/M. Hilgert/B. Salje (Hrsg.) , "Uruk -
5000 Jahre Megacity", Begleitband zur Ausstellung (Petersberg
2013) 51 - 57 .
Salonen 1966 A. Salonen, Die Hausgeräte der alten Mesopotamier nach sume
risch-akkadischen Quellen. II: Gefäße. Eine lex ikalische und kul
turgeschichtliche Untersuchung. Annales Academiae Scientiarum
Fennicae B 144 (Helsinki 1966).
Sargnon 1987 0 . Sargnon, Les bijoux prehelleniques. lnst . Franc;:. d 'arch. Proehe Orient. Beyrouth-Damas-Amman. Bibi. Arch . et bist. CVlll (Pa
ris 1987).
Sarianidi 2005 V. Sarianidi , Gol'\ur-Depe, city ofkings and gods (A~gabad 2005).
316
Sayce 188 1 A. H. Sayce, Die Insclu-iften von Hissarlik. In: H. Schliemann,
llios (Leipzig 1881) 766-781.
Sazct2007 G. Sazct, The Treasures ofTroia (lstanbul 2007).
Sazct /<;alt~-Sazct 2002 G. Sazct/D. <;alt~-Sazct , Die Vasenkopfnadeln aus Troia und ihre Entsprechungen im Formenspektrum der frühbronzezeitlichen
Keramik. In: R. Aslan/ S. Blumi G. Kastl /F. Schweizer/D. Thumm
(Hrsg.), Mauerschau: Festschrift für Manfred Korfmann (Rems
halden- Grunbach 2002) 457 - 467 .
Sazct/Korfmann 2000
G. Sazct/M. Korfmann, Metallfunde des 3. Jahrtausends v.u.Z. aus Troia: E ine Studie in Verbindung mit den Ergebnissen der
neuen Ausgrabungen. In: Ü. Yalc;:m (Hrsg.), Anatolian Meta! I.
Der Anschnitt, Beiheft 13 (Bochum 2000) 93 - 100.
Sazct/Treister 2006 G. Sazc t/M. Treister, Troias Gold - Die Schätze des dritten Jahr
tausends vor Chri stus . ln: M. Korfmann (Hrsg.) , Troia. Archäo
logie e ines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006)
209- 218.
Schachner 2000 A. Schachner, Zur Entwicklung der Metallurgie im östlichen
Transkaukasien (Azerbaycan und Nahc;:evan) wälu-end des 4. und
3. Jahrtausends vor Chr. Anatolian Metall!. Der Ansclmitt Beiheft
13 (Bochum 2002) 115-130.
Schachner 2003-05 A. Schachner, Opfer. B.Il. In der Bildkunst Anatolien. In:
M. P. Streck (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorder
asiatischen Archäologie I 0 (Berlin , New York 2003 - 2005)
111 - 113.
Schachner/Schachner 1995 S. Schachner/A. Schachner, Some New "depas amphikypellon" and Tankards in the Museum of Ürgüp and Nev~ehir and their
lmplications. In: A. Erkanal (ed.), Eski Yakm Dogu Kültürler
Üzerine Incelemeler. In Memoriam I. M. Akyurt (lstanbul 1995)
307- 316.
Schachner/Schachner 1995a
S. Schachner/ A. Schaclmer, E ine "syrische" Flasche aus Fara. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 127, 1995,
83 - 93.
Schäfer 1971 H. P. Schäfer, Zur Datierung einer Gussform aus Troja. Archäolo
g ischer Anzeiger 2, 1971 , 4I9 - 422.
Schaeffer 1952 C. F. A. Schaeffer, Enkomi- Alasia (Paris 1952).
Schalk 2008 E. Schalk, Die Bronzenadeln in der Berliner Sammlung. In :
M. Wemhoff/0. Het1el/A. Hänsel (Hrsg.) , Heinrich Schlie
manns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage Bd. 1.
Berliner Beitr. z. Vor- u. FrühgeselL N.F. I4 (Berlin 2008)
183 - 226.
Schauensee 2002 M. de Schauensee, Two lyres fi·om Ur (Philadelphia 2002).
Schauer 1980 P. Schauer, Ein bronzezeitliches Schmuckdepot aus dem persischtürkischen Grenzgebiet. Arch . Korrbl. I 0, 1980, 123 - 13 7.
Scheel 1989 B. Scheel, Egyptian metalworking and tools (Aylesbury 1989).
Schettler/Romer 2006 G. Schettler/R. L. Romer, Atmospheric Pb-pollution by pre-medieval mining detected in the sediments of the brackish karst Iake An Loch M6r, weslern Ire land. Appl ied Geochemistry, 21 , 2006, 58- 82.
Schlichterle/ Rottländer 1982 H. Schlichterle/R. Rottländer, Gusstiegel der Pfyerner Kulh1r in Südwestdeutschland. Fundber. Baden Württemberg 7, 1982, 59-71.
Schli emann 1869 H. Sch li emann, lthaka, der Peloponnes und Troja (Leipzig 1869).
Schliemann 1874 H. Schliemann, Atlas Trojanischer Alterthümer (Leipzig 1874).
Schliemann 1874a H. Sch liemann, Trojanische Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen in Troja (Leipzig 1874).
Schliemann 1878 H. Schliemann, Ausgrabungen in Troja. Zeitsclu. f. Ethnologie I 0, 1878, Verhandl. Berliner Ges. Anthr., Ethn. u. Urgesch. (425)(426) Taf. 23.
Schliemann 1878a H. Schliemann, Bericht über die Forschungen und Entdeckungen in Mykene und Tiryns (Leipzig 1878).
Schli emann 1880 H. Schliemann, Ilios (London 1880).
Schliemann 1881 H. Sch liemann, Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und auf der Baustelle von Troja (Leipzig 1881 ).
Schliemann 1884 H. Schli emann , Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen auf der Baustelle von Troja, in den Heldengräbern, Bunarbaschi und anderen Orten der Troas im Jahre 1882 (Leipzig 1884 ).
Schmidt 1901 H. Schmidt, Die Neuordnung der Schliemann-Sammlung. Zei tschr. Ethnologie, Verhandl. Berliner Ges. Anthr. , Ethn. u. Urgesch. 33, 190 I, (255)-(259); (33 1 )- (335).
Schmidt 1902 H. Schmidt, Heinrich Schliemann 's Sammlung trojanischer Altertümer (Berlin 1902).
Schmidt 1902a H. Schmidt, Die Keramik der verschiedenen Schichten. ln : W. Dörpfeld, Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen Sch ichten von Ilion 1870- 1894 (Athen 1902) 234- 319.
Schmidt 1904 H. Schmidt, Troja- Mykene- Ungarn . Zeitschr. Ethnologie 36, 1904, 608 - 656 .
Schmidt 1912 H. Schmidt, Trojanische Nachlese I. Prähist. Zeitschr. 4, 1912, 19-24.
Schmidt 2002 K. Schmidt, Nor~untepe . Kleinfunde Il - Artefakte aus Felsgestein, Knochen und Geweih, Ton, Metall und Glas. Archaeologica Euphratica 2 (Mainz 2002).
Schuchhardt 189 1 C. Schuchhardt, Schliemann 's Ausgrabungen in Troja, Mykene, Orchomenos, lthaka im Licht der heutigen Wissenschaft (Leipzig 1891).
Schwarz 2005 W. Schwarz, 1000 B.C.: Steinwerkzeug der Metallhandwerker. Archäologie in Niedersachsen 8, 2005, 27-30.
Seeher 1987 J. Seeher, Demircihüyük. Die Ergebn isse der Ausgrabungen 1975- 1978 III, I . Die Keramik I . A Die neolithische und chalkolith ische Keramik. B Die frühbronzezeitliche Keramik der älteren Phasen (Mainz 1987).
Seeher 2000 J. Seeher, Die bronzezeitliche Nekropole von DemircihüyükSariket (Tübingen 2000) .
Seid! 2003-05 U. Seid! , Opfer. B.I. In der Bildkunst. Mesopotamien. in: M.P. Streck (Hrsg.), Reallex ikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 10 (Berlin, New York 2003-2005) I 02 - 106.
Seitmann 1955 Ch. Seltmann, Greek Coins: A Hi story of Metallic Currency and Coinage down to the Fa ll of the Helleni stic Kingdoms (London 1955).
Selz 1993 G. Selz, Beobachtungen zur "Silvervase" des Entemena. Aula Orientalis II , 1993, I 07 - II I.
Selz 2004 G. J. Selz, Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Zu "Leben" und "Tod" nach Q uellen der mesopotamischen Frü hzeit - Interaktionen zwischen Diesse its und Jenseits. In : F. Schipper (Hrsg.), Zwischen Euphrat und Tigris. Österreichische Forschungen zum Alten Orient.Wiener Offene Orientalistik 3 (Wien 2004) 39-59.
Shelmerdine 2008 C. W. Shelmerdine, The Cambridge companion to the Aegean Bronze Age (New York 2008).
Sheperd 1993 R. Shepherd, Ancient Mining. The Institution ofMining and Metallurgy (Amsterdam 1993).
Siebier 1994 M. Siebler, Troja, Geschichte, Grabungen, Kontroversen. Antike Welt, Sondernr. (Mainz 1994).
Siegelova/Tsumoto 20 II J. Siegelova/H . Tsumoto, Metals and Metallurgy in Hittite Anatolia. in: H. Genz/D. P. Mielke (eds.), lnsights into Hittite History and Archaeology. Colloquia Antiqua 2, 20 II , 275-300.
317
Silberschmied 1995 Der Silberschmied. Lehr- und Handbuch (Stuttgart 19954).
Simon 2009 Zs. Simon, Die ANKARA-Silberschale und das Ende des hethitischen Reiches. Zeitsclll'ift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 99, 247- 269.
Sines/Sakellarakis G. Sines/Y. A. Sakellarakis, Lenses in Antiquity. Ameri can Journ . Antiquity91 , 1987, 191 - 196.
Skinner 1954 F. Skinner, Measures and Weights. In: C. Singer (ed .), A History ofTechnology. I (London 1954) 774- 784.
Smith 1973 C. S. Smith, An exam ination of the arsenic-rich coating on a bronze bull from Horoztepe. In: W. J. Young (ed.) , Application of science in the examination of works of art (Boston 1973) 96- 102.
Smith 1986 P. H. G. H. Smith, A study of 9'11- 7'11 century meta! bowls from Western Asia. lranica Ant iqua 2 1, 1986, l-88.
Sommerfeld 1994 Ch. Sommerfeld, Gerätegeld Sichel: Studien zur monetären Struktur bronzezeitlicher Horte im nördlichen Mitteleuropa. Vorgesell. Forschungen 19 (Berlin, New York 1994).
Spanos 1972 P. Z. Spanos, Untersuchungen über den bei Homer "depas amphikypellon" genannten Gefaßtypus. lstanbuler Mitteilungen, Beiheft 6 (Tlibingen 1972).
Spanos 1977 P. Spanos, Zur absoluten Chronologie der zweiten Siedlung von Troja. Zeitschr. Assyriologie u. vorderas. Arch. 67, 1977, 85 - 107.
Spanos/Strommenger 1993 P. Z. Spanos/E. Strommenger, Zu den Beziehungen zwischen Nordwest Anatolien und Nordsyrien-Nordmesopotamien im III. Jahrtausend vor Christus. In: M. J. Mellink/E. Porada/ T. Özgü9 (eds.) , Aspects of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbours. Studies in Honor of N . Özgü9 (Ankara 1993) 573-578.
Sperling 1976 J. Sperling, KumTepein the Troad. Hesperia 45 , 1976, 305 - 364.
Stacey et al. 1980 J. S. Stacey/B. R. Doe/R. J. Roberts/M. H. Delevaux/J. W. Gramlieh, A Iead isotope study of mineralization in the Saudi Arabian Shield. Contihutions to Mineralogy and Petrology 74, 1980, 175 - 188.
Stampolidis/Sotirakopoulou 20 II N. Chr. Stampolidis/P. Sotirakopoulou, Early Cycladic Metallurgy. ln: Across. The Cyclades and Western Anatolia during the 3'd Mi llenium BC (Istanbul20li) 52-57.
Stech/Pigott 1986 T. Stech/V. C. Pigott , Tbe Metals Trade in South-Western Asia in the Ill Millennium B.C. Iraq 48, 1986, 39- 64.
318
Steinert 2012 U. Steinert, Aspekte des Menschseins im Alten Mesopotamien . Eine Studie zu Person und Identität im 2. und I. Jt. v. Chr. Cuneiform Monographs 44 (Leiden 20 12).
Stos-Gale/Gale 2006 Z. Stos-Gale/N. Gale, The Origin of Meta! Used for the Lead Weights in Minoan Crete. In: M. E. Alberti/E. Ascalone/L. Peyronel (eds.), Weights in Context - Bronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean : Chronology, Typology, Material and Archaeological Context. International Colloquium in Rome, 22 - 24 November 2004 (Rome 2006) 290- 292 .
Stos-Gale/Gale/Gilmore 1984 Z. A. Stos-Gale/N. H. Gale/G. R. Gilmore, Early Bronze Age Trojan meta! sources and Anatolians in the Cyclade. Oxford Journal of Archaeology 3/3, 1984, 23 - 44 .
Stos-Gale/Gale/ Annetts 1996 Z. A. Stos-Gale/N. H. Gale/N. Annetts , Lead isotope data from the lsotrace Laboratory, Oxford: Archaeometry data base 3, ores from the Aegean, part l. Archaeometry 38, 1996, 381 - 390.
Strahm 1994 Ch. Strahm, Die Anfange der Metallurgie in Mitteleuropa. Helvetia Archaeologica 25/97 , 1994, 2-39.
Strauß 2006 R. Strauß, Reinigungsrituale aus Kizzuwatna. Ein Beitrag zur Erforschung hethitischer Ritualtradition und Kulturgeschichte (Berlin, New York 2006).
Strauß 2010 R. Strauß (ed.), hethiter.net/ :CTH 471 (Expl. A, 03.11 .20 I 0)
Swann et al. 1997 C. P. Swann/P. P. Betancourt/S. Fleming/C. R. Floyd, PI XE analysis of Trojan gold jewelry. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 130, 1997, 320- 323.
Tezcan 1960 B. Tezcan , New Finds from Horoztepe. Anatolia 5, 1960, 29 - 46.
The Anatolian Civilizations 1983 The Anatolian Civilizations I: Prehistoric, Hittite, Early lron Age. XVIII European Art Exhibition , St. lrene (lstanbul 1983).
Thomton 2009 Chr. P. Thornton, The Emergence of Camplex Metallurgy on the Iranian Plateau: Escaping the Levantine Paradigm. Journal of World Prehistory 22/3, 2009, 301 - 327.
Thouvenin 1973 A. Thouvenin , La soudure dans la construction des a:uvres d 'orfevrerie antique et ancienne. Revue Arch. de l' est et du centre-est 24, 1973, 11-68.
Tine/Traverso 200 I S. Tine/A. Traverso, Poliochni. Die älteste Stadt Europas (Athen 2001).
Todorovic 1969 J. Todorovic, Written Signs in the Neolithic Cultures of Sautheastern Europe. Archaeologia lugoslaviaca I 0, 1969, 79 - 84.
Tournavitou 1997 I. Tournavitou, 'Jewellers ' moulds and jewellers' workshops in Mycenaen Greece: an archaeological utopia . In: C. Gillis/C. Risberg/C. Sjöberg (eds .), Trade and Production in Premonetary Greece : Production and craftsmen. Proceedings of the 4'h and 5'h International Workshop, Athens 1994 and 1995. Studies in Mediterraneall archaeology and Iiterature 143 (Jonsered 1997) 209-256.
Trebbin 2005 C. Trebbin, Der Ursprung des Geldes 1: Der Anfang der Geldgeschichte in den europäischen und anderen Mittelmeerländern (Saarbrücken 2005) .
Treister 1996/97 M. J. Treister, Die trojanischen Schätze. In: Der Schatz aus Troja. Schliemann und der Mythos des Priamos-Goldes. Katalog zur Ausstellung in Moskau (Stuttgart, Zürich 1996/97) 197-236.
Treister 2002 M. Treister, The Relative and Absolute Chronology of the Trojan Treasures. In A. Aslan/S. BlumiG. Kastl/F. Schweizer/D. Thumm (Hrsg.), Mauerschau: Festschrift fiir Manfred Korfmann I (Remshalden-Grünbach 2002) 245- 258.
Treister 20 13 M. J. Treister, Die trojanischen Schätze. In: Bronzezeit. Europa ohne Grenzen. Katalog zur Ausstellung in St. Petersburg und Moskau (St. Petersburg 2013) 140- 155.
Treister/Sacz1 2006 M. J. Treister/G. SacZI, Trojas Gold. Die Schätze des dritten Jalu·tausends vor Clu·istus. In: M. 0. Korfmann (Hrsg.), Troia . Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 209- 218 .
Todorova 198 1 H. Todorova, Die kupferzeitliehen Äxte und Beile in Bulgarien. PBF IX, 14 (München 1981 ).
Tsochos 200 I C. Tsochos, Poliochni. Der Neue Pauly I 0 (Stuttgart/Weimar 2001) Sp. 12- 16.
Tufnell/Ward 1966 0. Tufnell/W. A. Ward, Relations between Byblos, Egypt and Mesopotamia at the End of the Third Millennium B.C. Syria 43, 1966, 165 - 241.
Thureau-Dangin 1912 F. Thureau-Dangin, Une relation de Ia huitieme Campagne de Sargon (714 av. J.-C.). Textes Cuneiformes du Louvre 3 (Paris 1912).
Tolstikov/Treister 1996 V. Tolsti kov/M. Treister, The Gold of Troy: Searching for Homer 's Fabled City (London 1996).
Ünlüsoy2010 S. Ünlüsoy, Die Stratigraphie der Burg von Troja II (Ti.ibingen 20 10).
Uerpmann/ Uerpma1m 2003 H.-P. Uerpmann/M. Uerpmann , Zambujal : Die Stein- und Beinartefakte aus den Grabungen 1964 bis 1973 (Mainz 2003).
Ulf2003 Ch. Ulf, Was ist und was will " Heldenepik": Bewahrung der Vergangenheit oder Orientierung fiir Gegenwart und Zukunft? In: Ch. Ulf (Hrsg.), Der Neue Streit um Troja. Eine Bilanz (München 2003) 262- 284 .
Unger 1926 E. Unger, Kunstgewerbe. Rea lexikon der Vorgeschichte 7 (Berlin 1926) 178- 183.
Vaiman 1976 A. A. Vaiman, Issledovanie po shumero-vavilonskoy metrologii (Investigations on Sumerian and Babylonian Metrology). Drevniy Vostok 2, 1976, 37-66.
Van den Huot 1987 - 1990 Th. P. J. van den Huot, Maße und Gewichte bei den Hethitern. Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 7, 1987- 199~517-527.
Vanstiphout 1998 H. L. J. Vanstiphout, Camparalive Notes on sar tamhari. 36. Rencontre Assyriologique Internationale (Ankara 1998) 573-589.
Vasic 2003 R. Vasic, Die Nadel n im Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo und Makedonien). PBF XIII,! I (Stuttgart 2003).
Veenhofl995 K. R. Veenhof, Kanesh : an Old Assyrian colony in Anatolia, In: J. M. Sasson (ed.), Civilizat ions ofthe Ancient Near East Il (New York 1995) 859-87 1.
Veenhof/Eidem 2008 K. Veenhof/J. Eidem, Mesopotamia. The Old Assyrian Period. Orbis Biblicus et Orientalis 160/5 (Fribourg 2008).
Viedebannt 1923 0. Viedebannt, Antike Gewichtsnormen und Münzfüße (Berlin 1923).
Völling 2008 E. Völling, Die durchlochten Tonobjekte in der Berliner Sammlung. ln: M. Wemhoff/D. Hertel/A. Hänsel (Hrsg.) , Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer - Neuvorlage. Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte N. F. 14 (Berlin 2008) 227- 270.
Völling/Reifarth/Vogl 2012 E. Völling!N. Reifarth/J. Yogi , The Intercultural Context ofTreasureAinTroy - JewellryandTextiles.ln: M.-L.Nosch/R. Laffineur (eds.), Jewellry, Adornment, and Textiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13'h International Aegean Conference 20 10 (Liege 20 12) 531-538.
Vogel 2013 H. Vogel , Der ,Große Mann von Uruk' - Das Bild der Herrschaft im späten 4. Jahrtausend. In : N. Crüseman/M. van Ess/ M. Hilgert/8 . Salje (H.rsg.) , "Uruk- 5000 Jahre Megacity", Begleitband zur Ausstellung (Petersberg 20 13) 139-145.
Vogl/Pritzkow/Koenig 2008 J. Vogl/W. Pritzkow/M . Koenig, Prüfbericht vom 09.12.2008 der Bundesanstalt fiir Materia lforschung und -prüfung (SAM), Fachgruppe I .5, Arbeitsgruppe lsotopenanalytik.
319
Vogl et. al. 2012 J. Vogl/B. Paz/M. KoenigiW. Pritzkow, A modified Iead-matrix separation procedure shown for Iead isotope analysis in Trojan silver artefacts as an example. In: Anal Bioanal Chem, Published online: August 2012.
Von der Osten 1937 H. H. von der Osten, The Alishar Hüyük. Seasons of 1930~32 ,
Part 2. Orient. Inst. Pub!. 29. Researches in Anatolia 8 (Chicago 1937).
Von der Osten 1937a H. H. von der Osten, The Alishar Hüyük. Seasons of 1 930~32 ,
Part 3. Orient. lnst. Pub!. 30. Researches in Anatolia 9 (Chicago 1937).
Vulpe 1970 A. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien I. PBF IX,2 (München 1970).
Vulpe 1975 A . Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien II. PBF IX,5 (München 1975).
Vygodskiy 1967 M. Y. Vygodskiy, Arifmetika i algebrav drevnem mire (Arithmetics and Algebra in the Ancient World) (Moskau 1967).
Waalke-Meyer 2008 J. Waalke-Meyer, Die eisenzeitli chen Stempelsiegel aus dem Amuq-Gebiet: ein Beitrag zur Ikonographie altorientalischer Siegelbitder (Saint-Paul 2008).
Waetzoldt 2001 H. Waetzoldt, Wirtschafts- und Verwaltungstexte aus Ebla Archiv L. 2769. Materiali Epigrafica di Ebla 7 (Roma 2001).
WaetzoldtiBachmanniPernicka I 984 H. WaetzoldtiG. BachmanniE. Pernicka, Zinn- und Arsenbronzen in den Texten aus Ebla und aus dem Mesopotamien des 3. Jahrtausends. Oriens Antiquus 23 , 1984, l ~ 18.
WagneriÖztunal! 2000 G. A. Wagner!Ö . Öztunal! , Prehistoric Copper Sources in Turkey. In: Ü. Yalvin (Hrsg.), Anatolian Meta! I, Der Anschnitt, Beiheft 13 (Bochum 2000) 31 ~67.
WagneriPernicka 1982 G. Wagner!E. Pernicka, Blei und Silber im Altertum: Ein Beitrag der Archäometrie . Chemie in unserer Zeit 16, 1982, 46~55.
Wagner!PernickaiUerpmann 2002 G. WagneriE. PernickaiH.-P. Uerpmann (eds.) , Troia and the Troad ~ Scientific Approaches (Heidelberg 2002) .
Wagner et al. 1983 G. A. WagneriE. PernickalT C. SeeligeriÖ. Öztunal!II. Baranyil F. Begemann/ S. Schmitt-Strecker, Geologische Untersuchungen zur frühen Metallurgie in NW-Anatolien, 1983, http:llwww.mta. gov.trlv2.01engldergi_pdfl 1 0 l ~ 1 0215.pdf: 49~ 81.
Wagner et al. 1986~87 G. A. WagneriE. PernickalT C. SeeligeriTh. Lorenz/F. Begemannl S. Schmitt-StreckeriC. Eibner, Ö. Öztunal!, Geochemische und isotopische Charakteristika fi·üher Rohstoffquellen fiir Kupfer, Blei, Silber und Gold in der Türkei . Jahrb. RGZM 33, 1986-1987, 723-752.
320
Waldbaum 1980 J. Waldbaum, The first archaeological appearance of iron and the transition of the Iran Age. In : TA. WertimeiJ. D. Muhly (Hrsg.), The coming of the Age of Iran (New Haven 1980) 69 - 98.
Wanhill2013 R. Wanhill , Stress corrosion cracking in ancient silver. Studies in Conservation 58, 1, 2013 , 41-49.
Wanzek 1989 B. Wanzek, Die Gussmodel für Tüllenbeile im südöstlichen Europa. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 2 (Bann 1989).
Warner 1994 J. L. Warner, Elmal!-Karata~. The Early Bronze Age Viilage of Karata~ (Bryn Mawr 1994 ).
Wartke 1980 R. B. Wartke, Vorderasiatische Gussformen aus den Staatlichen Museen zu Berlin . Forsch. u. Ber. 20121 , 1980, 223 - 258.
Weber 2003 C. Weber, Hydrogeologische Verhältnisse der östlichen Troas. Diplomarbeit der Technischen Universität Bergakademie Freiberg (Freiberg 2003).
Weber o.J. 0. Weber, Die Kunst der Hethtiter (Berlin, ca 1921 ).
Weeks 1999 L. Weeks, Lead Isotope Analyses fi·om Tell Abraq, United Arab Emirates : New Data Regarding the " tin problem" in Western Asia. Antiquity 73 , 1999, 49~ 64.
Wegner 2002 Wegner, Hurritische Opferlisten aus hethitischen Festbeschreibungen. Teil II: Texte flir Tessub, ljebat und weitere Gottheiten. Corpus der hurritischen Sprachdenkmäler I ,2 ~ 3 (Rom 2002).
Weissgerber 2004 G. Weissgerber, Schmucksteine im Alten Orient (Lapislazuli , Türkis, Achat, Karneol). In: Th. Stöllner!R. SlottaiA. Vatandoust (Hrsg.) , Persiens antike Pracht. Bergbau - Handwerk~ Archäologie. Ausstellungskatalog Deutsches Bergbau-Museum Bach um. Veröffentlichung aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bocbum 128 (Bochum 2004) 64 - 74.
Weisgerber!Cierny 2002 G. Weisgerber/J. Ciemy, Tin for Ancient Anatolia?. 1n: Ü. Yalvin (Hrsg.), Anatolian Metall II , Der Anschnitt, Beiheft 15 (Bochum 2002) 179~ 186.
WemhoffiHertel!Hänsel 2008 M. WemhoffiD. Hertel/A. Hänsel (Hrsg.), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer ~ Neuvorlage. Berliner Beiträge zur Vor~ und Frühgeschichte N. F. 14 (Berlin 2008) 271~294.
Wesse 1990 A. Wesse, Die Ärmchenbeile der Alten Welt. Ein Beitrag zum Begim1 der Eisenzeit im östlichen Mitteleuropa. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 3 (Bann 1990).
Whiting 1987 R. M. Whiting, Old Babylonian Letters from Tell Asmar. Assyriological Studies 22 (Chicago 1987).
Wilde 2003 H. Wilde, Technologische Innovationen im zweiten Jahrtausend vor Christus: zur Verwendung und Verbreitung neuer Werkstoffe im ostmediterranen Raum. Göttinger Orientforschungen IV. Reihe Ägypten 44 (Wiesbaden 2003).
Wilhelm 2008 G. Wilhelm (ed.), hethiter.net/ : CTH 52.1 (TX 14.05 .2008, TRde 12.05.2008).
Wolkersdorfer 2006 C. Wolkersdorfer, Wasser, Quell des Lebens - Hydrogeologische Untersuchungen in Troia. In: M. 0. Korfmann (Hrsg.), Troia -Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006) 329-336.
Wolters 2002 A. Wolters, Metrological PRS- terms from Ebla to Mishna. Eblaitica 4, 2002, 233-241.
Wolters 1983 1. Wolters, Die Granulation. Geschichte und Technik einer alten Goldschmiedekunst (München 1983).
Wolters 1996 J. Wolters, Löten im Mittelalter. In: U. Lindgren (Hrsg.), Europäische Technik im Mittelalter (Berlin 1996) 187- 203.
Woolley 1934 L. C. Woolley (ed.) , The Royal Cementery. Ur Excavation 2 (Philadelphia 1934).
Yadin 1963 Y. Yadin, The Art ofWarfare in Biblical Lands (London 1963).
Yakar 1984 Y. Yakar, Reg ional and local schools of metalwork in Early Bronze Age Anatolia. Anatolian Studies 34, 1984, 59-86.
Yakar 1985 J. Yakar, The Later Prehi story of Anatolia. The Late Chalcolithic and Early Bronze Age. BAR Internat. Ser. 268.1 (Oxford 1985).
Yakar 2002 1. Yakar, Revising the Early Bronze Age Chronology of Anatolia. In: A. Aslan/S. BlumiG. Kastl/F. Schweizer/D. Thumm (Hrsg.), Mauerschau. Festschrift ftir Manfred Korfmann (RemshaldenGrunbach 2002) 445-456.
Yal<;:m 1998 Ü. Yal<;:m, Frühe Eisengewinnung in Anatolien. Istanbuler Mitteilungen 48, 1998, 79 - 95.
Yal<;:m 2000 Ü. Yal<;:m, Anfänge der Metallverwendung in Anatolien. In: Ü. Yal<;:m (Hrsg.), Anatolian Meta! I. Der Anschnitt 13 (Bochum 2000) 17- 30.
Yal<;:m 2003 Ü. Yal<;:m, Die Anfänge der Metallurgie in Anatolien . In: Tb. Stöllner/G. Körlin/G. Steffens/J. Cierny (eds.), Man and Mining -Mensch und Bergbau. Studies in honor of Gerd Weissgerber on occasion of bis 65 'h birthday. Der Anschnitt, Beiheft 13 (Bochum 2003) 17- 30.
Yal<;:m 2009 Ü. Yal<;:m, Evidence for early use of tin at Tülintepe in Eastern Anatolia. Türkiye Bilimler Akademisi-AR 12, 2009, 123 - 142.
Yal<;:m/Yal<;:m 2008 Ü. Yal<;:m/H. Gönül Yal<;:m , Der Hortfund von Tülintepe, Ostanatolien. Anatolian Meta! IV. Der Anschnitt, Beiheft 21 (Bochum 2008) I 01 - 123.
Yal<;:m/ Pernicka 1999 Ü. Yal<;:m/ E. Pernicka, Frülmeolithische Metallurgie in A~ikli Höyük. Der Anschnitt, Beiheft 9 (Bochum 1999) 45-54.
Yal<;:m u. a. 2005 Ü. Yal<;:m/C. Pulak/R. Slotta (Hrsg.), Das Schiff von Uluburun: Welthandel vor 3000 Jahren . Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (Bochum 2005).
Yener/Vandiver 1993 K. A. Yener/P. B. Vandiver, Tin processing at Göltepe, an Early Bronze Age Site in Anatolia. American Journal of Archaeology 97/2, 1993, 207 - 238.
Young 1969 T. C. Young, Excavations at Godin Tepe. First Progress Report (Toronto 1969).
Yule 1982 P. Yule, Tepe Hissar. Neolithische und kupferzeitliche Siedlung in Nordostiran (München 1982).
Zaccagnini 1986 C. Zaccagnini , Aspects of Copper Trade in the Eastern Mediterranean. In: M. Marazzi (ed.), Traffici Micenei nel Mediterraneo, Atti del Convegno di Palermo 1984 (Taranto 1986) 413 - 424.
Zaccagnini 1986a C. Zaccagnini , The Dilmun Standard and its Relationship with the Indus and Near Eastern Weight Systems. Iraq 48, 1986, 19- 23.
Zartman/Doe 1981 R. E. Zartman/B. R. Doe, Plumbotectonics - the model. Tectonophysics 75 , 1981 , 135 - 162.
Zettler/Horne 1998 R. L. Zettler/ L. Horne (ed.), Treasures from the Royal Tombs of Ur. Ausstellungskatalog, University of Pennsylvania Museum (Philadelphia 1998).
Zidarov 2005 P. N. Zidarov, Problemy ustanovleniya mestorozhdeniy nefrita , zhadeita i lazurita , ispol 'zovannykh dlya izgotov1enija toporovskipetrov naidennykh v Troe. V: Archeomineralogija i Rannjaja Istorija Mineralogii (Problems of Identification of Deposits of Nephrite, Jadeite and Lapis Lazuli for Preparing of AxesSceptres found at Troy. In: N. P. Jushkin (ed.) , Archaeomineralogy and the Early Hi story ofMineralogy (Syktyvkar 2005) 124 - 126.
Zimmermann 1995 A. Zimmermann, Austauschsysteme von Silexartefakten in der Bandkeramik Mitteleuropas. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 26 (Bonn 1995).
321
Zimmermann 2006 T. Zimmermann, Die bronze- und früheisenzeitlichen Troiafunde der Sammlung Heinrich Schliemann im Römisch-Germanischen Zentralmuseum (Mainz 2006).
Zimmermann 2009 T. Zimmermann, Frühmetallzeitliche Eliten zwischen Ostägäis und Taurusgebirge im 3. Jahrtausend v. Chr. In: M. Egg/0 . Quast (Hrsg.), Aufstieg und Untergang. Monographien RGZM 82 (Mainz 2009) 1-29.
Zimmermann 20 II T. Zimmermann, Frühe Metallobjekte zwischen westlichem Schwarzmeer und Taurusgebirge in kultischem und profanem Kontext -
322
Neue Studien zu Rohstoffen, Technologie und sozialem Zeigerwert In: U. L. Dietz/A. Jockenhövel (Hrsg.), Bronzen im Spannungsfeld zwischen praktischer Nutzung und symbolischer Bedeutung. Beiträge zum internationalen Kolloquium am 9. und 10. Oktober 2008 in Münster. PB F XX, 13 (Stuttgart 20 II) 297- 313.
Zimmermatll1 u. a. 2003 T. Zimmermann/A. Bane1jee/J. Huth, Frühe Steinwerkzeuge aus Anatolien. Archäologische und Mineralogische Untersuchungen. Arch. Korrbl. 33, 2003, 57-74.
Zurbach 2003 1. Zurbach, Schriftähnliche Zeichen und Töpferzeichen in Troia. Studia Troica 13,2003, 113-130.