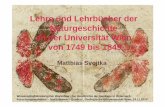Lernen und seine Körper. Habitusformungen und -umformungen in Bildungspraktiken
Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Spannungsfeld...
Transcript of Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Spannungsfeld...
ARCHÄOLOGIEForschung und Wissenschaft
Band 4
Diese Publikation erscheint zugleich als Band 3 der ReiheSPECTANDA – Schriften des Archäologischen Museums Innsbruck
LIT
Florian M. Müller (Hg.)
ArchäologischeUniversitätsmuseen und -sammlungen
im Spannungsfeldvon Forschung, Lehre und Öffentlichkeit
LIT
Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine der größten ihrer Art an einer deutschen Hochschule, ihre Ge-schichte reicht weit in das 19. Jahrhundert zurück.1 Schon Johann Wolfgang von Goethe, der zeitlebens der Ur- und Frühgeschichte aufgeschlossen war, hat zum Bestand der Sammlung beigetragen, als er 1811 an der Bergung eines jung-bronzezeitlichen Hortfundes bei Dornburg an der Saale oder einige Jahre spä-ter an der Untersuchung eines jungsteinzeitlichen Grabhügels bei Kleinromstedt zusammen mit seinem Schwager Christian August Vulpius beteiligt war und persönlich über diese „Alterthümer“ auch Berichte verfasst hat. Diese und wei-tere Funde bildeten den Grundstock einer Sammlung, mit der es dem damali-gen Privatdozenten, später Professor der Kunstgeschichte, Dr. Friedrich Klopf-leisch, gelang, am 24.10.1863 ein „Germanisches Museum“ im runden Turm des Schlosses in Jena einzurichten. Die Sammlung wurde in die Kategorie der für die Universität bestehenden großherzoglichen Anstalten für Wissenschaft und Kunst eingegliedert und gehört somit zu den ältesten ihrer Art in Deutschland. Klop�eisch vermehrte den Bestand allein durch 150 Grabungen, dazu wurden Sammlungen aus Schlesien und Oberfranken erworben. Seine Grabungen doku-mentierte Klop�eisch vorbildhaft in Ortsakten, die auch heute noch eine Quelle von unschätzbarem Wert für die wissenschaftliche Bearbeitung darstellen.
Nach dem Tode von Klop�eisch nahm sich der Arzt Dr. Gustav Eichhorn 1901 der Sammlung an, stellte sie im runden Turm neu auf und tauschte die historischen Inventarstücke gegen die prähistorischen Funde aus dem Stadtmu-seum. 1905 wurde die Sammlung, als das Schloss abgerissen und die Universität neu gebaut wurde, in das Alte Collegiengebäude überführt. Eichhorn richtete das „Archiv für vor- und frühgeschichtliche Fundnachrichten“ ein und inven-
1 Ettel (2002); Grabolle (2009); Neumann (1963); Peschel (1974).
Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
im Spannungsfeld von Forschung, Lehre und Ö�entlichkeit
Peter Ettel – Ivonne Przemuss, Jena
342 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
tarisierte die Sammlung. Darüber hinaus kümmerte er sich um die Vermehrung und Publikation der Bestände, die entscheidend zum Ruf der Sammlung weit über ³üringen hinaus beitrugen. Dazu gehört insbesondere der von ihm aus-gegrabene germanische Urnenfriedhof von Großromstedt mit ca. 600 Gräbern. Die Gräber vermitteln mit ihrer überdurchschnittlichen Ausstattung einen Ein-blick in die Bewa´nung germanischer Krieger. Sie stellen nach wie vor einen Schlüsselfund dar für die Erforschung der kulturellen Verhältnisse weit über den Saaleraum hinaus am Übergang von der Latènezeit zur römischen Kaiserzeit, ein Zeitraum, der geprägt ist vom Vordringen der Elbgermanen an Rhein und Donau sowie der römischen Okkupation im Freien Germanien.
Nach dem Tod Eichhorns wurde Gotthard Neumann am 1. November 1930 zum neuen Vorstand des Museums, 1934 schließlich zum Professor für Vor- und Frühgeschichte ernannt. Neumann wurde zudem staatlicher Vertrauensmann für die vor- und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer ³üringens und das Mu-seum Landeszentrale für Ur- und Frühgeschichte, d. h. mit der neu gescha´enen Bodendenkmalp�ege betraut. In seiner Zeit wuchs die Sammlung schnell weiter an, wurde systematisch ausgebaut und insbesondere um Fundkomplexe aus dem Mittelalter ergänzt und erweitert. In Folge des Zuwachses der Sammlung zog das Germanische Museum 1936 in das Paulinerheim, heute Forstweg, um. Die Bestände wurden getrennt in Schausammlung, Studiensammlung und Magazin. In 10 Räumen konnten die mitteldeutschen Funde der Ö´entlichkeit zugäng-lich gemacht werden, geordnet nach der Abfolge der Kulturen in ³üringen/Mitteldeutschland mit Grab-, Hort- und Siedlungsfunden. Die Ausbildung der Studenten umfasste so idealerweise neben der ³eorie auch die Praxis. Die wis-senschaftlichen Ergebnisse konnten in eigenständigen Publikationen „Der Spa-tenforscher“ und „Irmin“ vorgelegt werden.
Während des 2. Weltkrieges wurden die männlichen Mitarbeiter eingezo-gen, die Sammlung musste teilweise ausgelagert werden. 1945 wurde das Mu-seum in „Vorgeschichtliches Museum der Friedrich-Schiller-Universität Jena, In-stitut für Prähistorische Archäologie“ umbenannt. Gerhard Mildenberger und Günther Behm-Blancke, Letzterer übernahm 1947 den Wiederaufbau der Bo-dendenkmalp�ege in ³üringen in Verbindung mit dem Museum in Weimar, lei-teten zwischenzeitlich das Museum, bis Gotthard Neumann 1953 wieder Direk-tor wurde und die ausgelagerten Sammlungsbestände wieder zusammenführte.
Nach dem Krieg lagen die Aufgaben des Vorgeschichtlichen Museums in Jena vor allem in der Forschung und in der Lehre, was bis heute andauert. Nach Emeritierung Gotthard Neumanns 1967 übernahm Günther Behm-Blancke die Leitung des Museums. 1968 musste infolge der 3. Hochschulreform der Stand-ort im Forstweg aufgegeben werden, die Funde der ehemaligen Schausammlung wurden in die Kemenate der Wasserburg Kapellendorf verbracht, die Magazin-bestände nach Weimar ausgelagert. Die Ur- und Frühgeschichte wurde der neu gegründeten Sektion Geschichte als Bereich angegliedert. 1977 übernahm Karl Peschel, der seit 1959 als Oberassistent, seit 1969 als Kustos für die Sammlung
| 343Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
tätig war und sich für die Eigenständigkeit und den Fortbestand der Sammlung einsetzte, die Leitung des Bereichs und führte Forschung und Lehrtätigkeit wei-ter. 1990 wurde Karl Peschel nach der politischen Wende zum Professor ernannt und die Lehre im Hauptfach Ur- und Frühgeschichte wieder aufgenommen, die nach der Pensionierung Peschels seit 2000 durch den Verfasser fortgeführt wird.
Die Sammlung fand nach den Auslagerungen, dann 1973 und bis heute an-dauernd im Löbdergraben 24a eine neue Unterkunft – allerdings ohne Möglich-keiten, sie für die Ö´entlichkeit nutzbar zu machen. Die Sammlung ist großteils im Keller magaziniert, 1995 auf einen neuen Stand gebracht, ein Teil als Lehr-sammlung in alten Schauschränken im Seminarraum und auf den Fluren unter-gebracht.
Die Bestände der Sammlung umfassen z. Z. ca. 45.000 archäologische Ob-jekte oder Objektgruppen, die von ca. 1.500 Fundorten aus dem In- und Aus-land stammen (Abb. 1).
Der Schwerpunkt liegt mit über 1.000 Fundorten in ³üringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Funde decken einen Zeitraum von der Altsteinzeit bis zum Mittelalter ab und vermitteln eine nahezu lückenlose Abfolge aller in Mit-teldeutschland ehemals vorhandener Kulturen in der Vor- und Frühgeschichte. Dies reicht von den frühesten Jäger- und Sammlerkulturen, wie sie in Bilzingsle-ben vorliegen, über die Sesshaftwerdung des Menschen in der Jungsteinzeit, die nachfolgende Bronze- und Eisenzeit bis hin zur historischen Zeit des Mittelal-ters mit Slawen, Deutschen und der Entstehung mittelalterlicher Städte, die den Anschluss zur Neuzeit und Gegenwart bieten. Die Bedeutung der Sammlung zeigen einige Fundkomplexe, die z. T. namengebend wurden für ganze Kultur-gruppen und Zeithorizonte der Vor- und Frühgeschichte – z. B. die Bandkera-mik, die älteste sesshafte Kultur in Mitteleuropa mit Häusern, Ackerbau und
Abb. 1. Verbreitung der Fundorte von Objekten aus der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung.
344 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
Viehhaltung, die erstmals anhand von Jenaer Gefäßen beschrieben wurde, die Dreitzscher Gruppe für die ältere Eisenzeit oder den bereits angesprochenen Großromstedter Horizont. Ferner gibt es aus ³üringen und den anschließenden Regionen auch einige Fundkomplexe von überregionaler Bedeutung, wie z. B. die Funde von Oelknitz aus dem Paläolithikum, als Unikate die Zeugnisse kel-tischen Kunsthandwerks des 5. Jh. v. Chr. wie die Fibel aus Ostheim v. d. Rhön (Abb. 2 rechts unten) mit Tier- und Menschenmasken auf Bügel und Fußende oder die Schnabelkanne von der Borscher Aue mit ½guralverziertem Henkel (Abb. 2 links) – Nachbildungen dieser Figuren wurden früher von der Universi-tät als Erinnerungsgeschenke für ausländische Gäste angefertigt. Aus dem ger-manischen Kulturkreis gehört dazu das Ebergefäß von Greußen des 3. Jh. oder der Silberschmuck, darunter zwei vergoldete Scheiben½beln aus einem germani-schen Adelsgrab von Dienstedt des 4. Jh. Umfangreiche Funde aus den Ausgra-bungen in Jena vermitteln ein Bild vom mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Leben in der Stadt.
Neben dem einheimischen Fundmaterial beherbergt die Sammlung schließ-lich auch eine Reihe von Vergleichsfunden aus verschiedenen Ländern Europas. Hier ist zu nennen z. B. ein altsteinzeitlicher Fundkomplex aus dem Vézère-Tal in Frankreich, ein bronzezeitliches Schwert aus Österreich oder ein bedeuten-der ältereisenzeitlicher Fundkomplex von über 80 Grabinventaren mit Helmen (Abb. 2 rechts oben), Fibeln etc. aus dem Picenum in Mittelitalien, den der Grün-der des Glaswerkes Schott & Gen., Dr. Otto Schott, der Universität schenkte.
Abb. 2. Keltische Schnabelkanne aus der Borscher Aue (links), eisenzeitlicher Helm aus Montegiorgio, Stiftung Schott (rechts oben) und keltische Fibel aus Ostheim vor der Rhön (rechts unten).
| 345Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Die Erschließung der Sammlung erfolgte z. T. bereits in der Frühzeit mit handgeschriebenen Inventarbüchern, nach dem 2. Weltkrieg auch durch eine Kustodenstelle, die jedoch nach der Wende von der Universitätsleitung gestri-chen und eine Restauratorenstelle die von 100 % auf 75 % reduziert wurde. Ein wenig erfolgreicher Umsetzungsversuch der Inventarbücher in EDV erfolgte in den 90er Jahren. Einige Fundkomplexe, so aus dem Spätmittelalter und der Neuzeit, sind bis heute noch nicht erfasst und inventarisiert. Im Jahre 2000 sollte verstärkt das neue Medium Internet genutzt werden, um die Sammlung wenigs-tens auf diesem Wege für die Ö´entlichkeit zu ö´nen. In den Jahren 2001 und 2002 wurde so auch begonnen, die Sammlung in einem vom Arbeitsamt Jena ge-förderten Projekt unter der Leitung von PD Dr. Sven Ostritz systematisch über EDV in einem Computer-Katalog zu dokumentieren. Hierzu gehört die Erfas-sung aller Daten aus den Inventarbüchern, Grabungsdokumentationen, Schrift-wechseln und älteren Bearbeitungen, dazu die zeichnerische und fotogra½sche Dokumentation der Funde. Das Ziel ist die Erschließung und Aufbereitung der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung für die wissenschaftliche und auch wie-derum – zumindest in beschränktem Maße – über den Bildschirm für eine öf-fentliche Nutzung. Dieses Projekt wurde jedoch nach einem Jahr vom Arbeits-amt nicht weiter gefördert, so dass die EDV-gestützte Aufarbeitung bislang ein Torso geblieben ist. In letzter Zeit hat sich erneut die Möglichkeit ergeben, im Rahmen einer Landesinitiative eine Bilddatenbank aufzubauen, die von unserer Seite die Erschließung und Inventarisierung aller Objekte der ur- und frühge-schichtlichen Sammlung Jena zum Ziel hat. Die Zukunft wird die Möglichkei-ten und Grenzen aufzeigen.
Alle Funde der Sammlung bilden zusammen gesehen eine hervorragende Grundlage für die Lehre und Ausbildung der Studierenden im Studiengang Ur- und Frühgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Studieren-den haben so die Möglichkeit, den Fundsto´ aus den verschiedenen Perioden der Ur- und Vorgeschichte mit Stein-, Bronze- und Eisenzeit, genauso der Frühge-schichte mit Kaiser-, Völkerwanderungszeit bis hin zum Hoch- und Spätmit-telalter nicht nur von Zeichnungen und Abbildungen in Büchern, sondern in Autopsie kennenzulernen und teilweise auch in die Hand nehmen zu können. „Geschichte zum Anfassen“ wird so auch persönlich erfahrbar, was umso mehr für populärwissenschaftliche Führungen in der Sammlung gilt wie im Rahmen z. B. der periodisch statt½ndenden „Langen Nacht der Wissenschaft“.
Die jetzige Nutzung der Sammlung ist denn auch auf die Lehre und Aus-bildung der Studierenden konzentriert. Im Bachelorstudium Ur- und Frühge-schichte sind eigene Module eingerichtet, die sich mit dem formenkundlichen Studium beschäftigen, sei es der Ur-, Vor- oder Frühgeschichte. Im Bachelor- und Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte haben Module die zeichneri-sche Dokumentation, Beschreibung und Auswertung von Funden zum Inhalt. Dazu kommen museumspädagogische Lehrveranstaltungen zur Vorbereitung von Ausstellungen, ebenso periodisch statt½ndende Übungen der Restaurato-
346 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
rin, die den Studierenden Aufgaben, Möglichkeiten und Probleme der Konser-vierung und Restaurierung nahebringen sollen. Alle diese Lehrveranstaltungen können bestens auf die Sammlung zurückgreifen, so z. B. im Seminarraum di-rekt auf den Fundsto´ in den aufgestellten Vitrinen (Abb. 3). ³eoretische und praktische Ausbildung greifen so zwanglos ineinander und ergänzen einander.
Die Sammlung in Jena dient zudem über die reine Lehre hinaus der Bera-tung von Museen und Heimatp�egern, sowie der Unterstützung von heimat-kundlicher Arbeit im Raum Jena und der Region. Dies mündet oftmals in der gemeinsamen Gestaltung und Bestückung von lokalen und regionalen Ausstel-lungen. In den letzten fünf Jahren fanden so allein ca. 15 Ausstellungen unter Beteiligung oder alleiniger Regie der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung Jena statt.
Neben der Lehre dient die Sammlung in Jena als Grundlage für vielfältige Forschungen. Hierbei ist der Übergang Lehre/Forschung ganz bewusst �ie-ßend. Aus der Beschäftigung mit dem Fundmaterial aus der Sammlung in den Lehrveranstaltungen entstehen studentische Abschlussarbeiten mit regionalen und überregionalen ³emen aus allen Perioden der Ur- und Frühgeschichte. Die hauseigene, 2005 gegründete Monographienserie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Abschlussarbeiten mit Ka-talog der Funde auch zu publizieren. So haben die ersten drei Bände der „Jenaer Schriften zur Vor- und Frühgeschichte“ denn auch Sammlungsbestände zum Inhalt (Abb. 4). Dazu gehörten bronze- und eisenzeitliche Funde aus Polen – Band 1, eisenzeitliche Funde aus Italien – Band 2, sowie ein frühmittelalterlicher Fundkomplex bei Jena – Band 3. Die Sammlung in Jena ist so in die „scienti½c community“ mit in- und ausländischen Fachkolleginnen und Fachkollegen ein-gebunden.
Abb. 3. Schausammlung im Seminarraum im Institut für Ur- und Frühgeschichte.
| 347Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Die Sammlung ist darüber hinaus Gegenstand einiger Forschungsprojekte. Hier ist einmal der Alte Gleisberg zu nennen, eine bronze- und eisenzeitliche Hö-hensiedlung etwa 10 km östlich von Jena. Die Altbestände aus dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Teil der Sammlung, die in den 60er Jah-ren in einer Diplomarbeit in Jena bearbeitet wurden. Zum Fundsto´ gehört auch eine Bucchero-Scherbe, die die überregionale Bedeutung der Höhensied-lung zeigt. Vor ca. fünf Jahren ist aus der Beschäftigung mit dem Fundsto´ in der Lehrveranstaltung ein lokales regionales Projekt mit einem Sponsor aus der Wirtschaft entstanden. In diesem Projekt werden seit 2005 jedes Jahr archäolo-gische Ausgrabungen und geoarchäologische Untersuchungen auf der Höhen-siedlung in Zusammenarbeit mit Geologen und Geographen der Universität Jena durchgeführt2.
Schließlich ist ein Fundkomplex der Sammlung 2006/2007 auch Gegen-stand des EU-Projektes „Piceni & Europe. ³e role of a prehistoric community in shaping of European Cultural Heritage“ geworden. Hierbei handelt es sich um das eisenzeitliche Gräberfeld Montegiorgio aus dem Picenum in Mittelita-lien, das im Rahmen des Projektes zusammen mit italienischen und sloweni-schen Studierenden und Kollegen aufgearbeitet und publiziert wurde. Auf einer internationalen Tagung in Piran konnten die Ergebnisse der Fachö´entlichkeit, zudem in Ausstellungen in Koper, Slowenien, sowie Udine und Ascoli Piceno, Italien, der allgemeinen Ö´entlichkeit vorgestellt werden. Mit dem Projekt wird auch deutlich, dass die Sammlung, die von der Nutzung in Lehre und Forschung eher den Charakter einer Studiensammlung besitzt, auch durchaus ausstelleri-sches Potential besitzt.
2 Zudem ein Archäologiecamp für interessierte Schüler aus Jena und Umgebung unter Lei-tung des 2005 gegründeten Vereins „Alter Gleisberg“ in Kooperation mit der Universitäts-grabung.
Abb. 4. Publikationen in der Reihe „Jenaer Schriften zur Vor- und Frühgeschichte“.
348 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
Das EU-Projekt stellte so ein interessantes Arbeitsfeld dar, das sowohl Lehre und Forschung, als auch Ö´entlichkeitsarbeit miteinander verband und auch zueinander brachte. Ansonsten ist aufgrund der räumlichen Verhältnisse die ur- und frühgeschichtliche Sammlung Jena jedoch kaum bzw. nur sehr einge-schränkt für die Ö´entlichkeit nutzbar zu machen. Abgesehen von der Präsen-tation der bedeutendsten Zeugnisse der Sammlung auf nationalen und internati-onalen Ausstellungen im In- und Ausland wie z. B. der Borscher Kanne 1991 in Venedig, 2002 in Hessen, 2007 in Lyon oder der Ostheimer Masken½bel 2007 in Lyon, wird dies regional wohl auch in allernächster Zukunft nur in kleineren Ausstellungen an unterschiedlichen Orten möglich sein, wie derzeit in Aschaf-fenburg.
Eine Änderung dieses Zustandes ist z. Z. noch nicht greifbar, wenngleich Pläne zur Errichtung einer Universitätssammlung bzw. eines Universitätsmuse-ums bestehen, da eine beständig erforderliche technische Betreuung durch eine Restaurierungswerkstatt zwar bislang gesichert, aber eine ebenso dringend er-forderliche wissenschaftliche Betreuung durch einen Kustos nicht gewährleistet und dies mit dem vorhandenen Personal zeitlich nicht zu scha´en ist.
Peter Ettel
Sowohl der Umfang dieser bedeutenden Sammlung, als auch deren Materialviel-falt machen eine konservatorische und restauratorische Betreuung des archäolo-gischen Fundmaterials innerhalb der Depoträume und der Studiensammlung bis heute und auch in Zukunft unentbehrlich. Demnach ist der Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte mit einer Restauratorenstelle bzw. einer -werkstatt ausge-stattet, um eine optimale P�ege des Fundgutes zu gewährleisten.
Mit dem Einzug des Bereichs für Ur- und Frühgeschichte in das Gebäude am Löbdergraben 24a im Jahre 1974 hat auch die eigens eingerichtete Restau-rierungswerkstatt hier ihren Standort bekommen. In dieser werden, damals wie heute, neben der P�ege und Aufarbeitung von Altfunden auch Restaurierun-gen an fundfrischen archäologischen Objekten durchgeführt, die auf Lehr- und Forschungsgrabungen geborgen wurden (Abb. 5). Zunächst nur spärlich einge-richtet, diente die Werkstatt in ihren Anfangsjahren vornehmlich der Wieder-herstellung archäologischer Keramikobjekte, konnte aber in den Folgejahren di-verse Ausbauphasen verzeichnen. So wurde die Werkstatt Anfang der 90er Jahre schließlich mit einer umfassenden Laboreinrichtung (inkl. Luftabzugsanlage), Durchlichtmikroskop und Mikroschleifgerät ausgestattet, was die Grundlage des Arbeitens und der Ausstattung einer Restaurierungswerkstatt darstellt.
In den letzten Jahren konnten, trotz des begrenzten Budgets des Lehrstuhls, zusätzlich diverse Gerätschaften angescha´t werden, die eine Bearbeitung und wissenschaftliche Untersuchung des archäologischen Materials verbessern und erleichtern sollten. Zur Ausstattung gehören mittlerweile außerdem ein Durch-
| 349Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
lichtmikroskop, eine Sandstrahlanlage (nebst Kompressor und Kältetrockner) sowie diverse Kleingeräte. Mit der Beantragung ½nanzieller Mittel bei der Uni-versität Jena, unterstützt durch den Arbeits- und Gesundheitsschutz, wurden in den vergangenen drei Jahren zusätzlich ein mobiles Staubabsauggerät und ein Lösemittelschrank angescha´t, die auch die vom Arbeitsschutzgesetz geforder-ten Richtlinien erfüllen. Zwar ist die Werkstatt mit einer Größe von ca. 25 m² als verhältnismäßig klein anzusprechen, jedoch ist das Platzverhältnis so opti-miert, dass zeitweise auch ein Arbeitsplatz mit einer Hilfskraft besetzt werden kann. Hier werden die restauratorischen Arbeiten temporär durch befristet über Projekte ½nanzierte Mitarbeiter unterstützt.
Dank der Mikroskopiertechnik ist es uns möglich, Ober�ächenuntersuchun-gen am Fundmaterial durchzuführen, eventuell vorliegende organische Au�age-rungen am Objekt zu lokalisieren und zu bestimmen und mittels Fototechnik für Dokumentationen und daraus resultierende Publikationen digital abzubilden. Trotz vorhandener Technik sind natürlich in heutiger technisch schnell voran-schreitender Zeit noch Möglichkeiten o´en, die diese Arbeitsschritte erleichtern bzw. vereinfachen könnten. Den Großteil des in der Restaurierungswerkstatt des Lehrstuhls zu bearbeitenden Materials machen die Metalle aus, die mittels me-chanischer, seltener chemischer Freilegungsmethoden restauriert werden. Ak-tuell wird am Fundmaterial des Gräberfeldes Mühlen Eichsen (Kr. Nordwest-mecklenburg), sowie an Objekten aus diversen Drittmittelprojekten gearbeitet, bei welchem, dank vorhandener Technik, Verzierungen, Herstellungs- und Zer-störungsspuren am Objekt nicht unentdeckt bleiben. Sollten Röntgenuntersu-chungen notwendig sein, arbeitet der Lehrstuhl eng mit dem Landesamt ³ü-ringen, sowie den Restaurierungswerkstätten des Römisch-Germanischen
Abb. 5. Blick in die Restaurierungswerkstatt des Lehrstuhls für Ur- und Frühgeschichte (im Hintergrund die Gipsabgussformen-Sammlung).
350 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
Zentralmuseums Mainz zusammen, die dankenswerterweise bereits des Öfteren ihre Technologie und Beratung zur Verfügung gestellt haben, so zuletzt wäh-rend den Vorbereitungen zur Picener-Ausstellung 2004. Anhand im Vorfeld an-gefertigter Röntgenaufnahmen konnten Tauschierungen auf vielen Eisen½beln erkannt und so eine fachgerechte Freilegung der Objekte durchgeführt werden. Aufgrund der Erhaltungszustände bzw. fortschreitender Korrosion der meist re-stauratorisch bislang unbehandelten Objekte ist die Möglichkeit der röntgen-technischen Untersuchung natürlich unentbehrlich.
Nennenswert sei noch die umfassende Sammlung von über 200 Gipsabguss-formen3 zur Fertigung von Kopien der bedeutendsten Fundobjekte der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung. Nach Anfrage von Interessenten werden gele-gentlich in der Restaurierungswerkstatt Repliken dieser einzigartigen Stücke angefertigt.
Um der Bearbeitung des oft umfangreichen Keramik-Materials gerecht zu werden, sind die Studierenden des Fachbereichs Ur- und Frühgeschichte intensiv in die Bearbeitung des aus Grabungen geborgenen Fundguts involviert. So wird unter Anleitung der Restauratorin das Waschen, Beschriften und Kleben von Keramik überwiegend von den Studierenden durchgeführt. Nebst der wissen-schaftlichen Ausbildung ist der Fachbereich sehr daran interessiert, die Studie-renden an das archäologische Objekt heranzuführen und im Umgang damit zu sensibilisieren. Demnach wird periodisch einmal im Jahr, parallel zum Lehrbe-trieb, ein fakultativer Kurs angeboten, der Materialien und Techniken für einen fachgerechten Umgang mit fragilen archäologischen Objekten unterschiedlichs-ter Materialklassen von der Bergung und ersten Sicherung bis zur Nachbearbei-tung (Reinigung, Klebung, etc.) aus restauratorischer Sicht vermittelt.
Durch den Erwerb dreier Standvitrinen aus einer Ausstellungsau�ösung können in den Fluren des Lehrstuhlgebäudes seit kurzer Zeit kleine Wechsel-ausstellungen durchgeführt werden. Auch hier werden die Studierenden in die Planung und Gestaltung der Vitrinen involviert und bekommen so die Möglich-keit, in Zusammenarbeit mit der Restauratorin ihre wissenschaftlich erarbeite-ten Objekte einer breiten Interessenschaft vorzustellen. Einen Schwerpunkt in der Betreuung der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung der Friedrich-Schil-ler-Universität stellt die Frage nach einer angemessenen Aufbewahrung und Prä-sentation der Sammlungsfunde dar. Eine Aufstellung, wie ehemals im Germani-schen Museum zu Jena (1863–1939) wäre wohl mit der Erschließung zukünftiger Ausstellungsmöglichkeiten wünschenswert, jedoch momentan nicht realisierbar. Der Großteil der Sammlungsobjekte ist demzufolge heute in den im Kellerge-schoss des Lehrstuhls untergebrachten Depoträumen magaziniert. In Stülpde-ckelkartonagen lagernd, sind die Fundobjekte hier nach Fundorten übersichtlich in moderne Metallregalsysteme einsortiert. Die meisten Keramikobjekte müssen
3 Gefertigt von der zwischen 1957 und 2002 am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte täti-gen Restauratorin Hildegund Storch.
| 351Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
jedoch aufgrund ihrer Größe freistehend in den Regalen aufgestellt und daher re-gelmäßig von Staubablagerungen gereinigt werden. Geschieht dies nicht, kann Schmutz und Staub den Nährboden für Schimmelsporen ausmachen.
Mit Geldern aus der Volkswagen-Stiftung konnte Mitte der 90er Jahre ein Depotraum mit einer Hebelschubanlage ausgestattet werden, was die Aufbe-wahrungszustände im Hinblick auf die Platzprobleme durchaus verbesserte (Abb. 6 links). Ein Teil der zur Sammlung gehörenden Fundobjekte wird je-doch unsachgemäß und den Witterungsbedingungen ausgesetzt im Dachge-schoss des Lehrstuhlgebäudes untergebracht, ein weiterer Teil der Sammlung ist seit den 60er Jahren in Holzkisten verstaut noch immer außerhalb Jenas aus-gelagert. Hinzu kommt, dass diese Funde und ein Teil der im Depot gelagerten Altfunde neben unsachgemäßer Lagerung noch heute uninventarisiert und zu-meist restauratorisch wie wissenschaftlich unbearbeitet sind. Eine große Menge an Steinartefakten muss ungeschützt vor Diebstahl in Schränken auf den Fluren des Gebäudes deponiert werden. Hinzu kommt eine erhebliche Menge an Fund-material aus drittmittel½nanzierten Grabungskampagnen, welches nach der Be-arbeitung ebenfalls Lager�äche in Anspruch nimmt und der Bereich damit oft an die Grenzen seiner Platzkapazitäten stößt.
Außerdem bestehen die Schwierigkeiten nicht nur in der Lagerung der Ob-jekte. Ein weiteres Problem innerhalb der ur- und frühgeschichtlichen Samm-lung stellt die Optimierung der klimatischen Aufbewahrungsbedingungen des archäologischen Fundmaterials dar, die sich aus logistischen und bauli-chen Gründen überaus schwierig gestaltet. Obwohl es sich bei der beschriebe-nen Sammlung um eine recht umfangreiche und bedeutende, nicht zuletzt sogar um eine der ältesten archäologischen Sammlungen Deutschlands handelt, wird dieser Umstand leider selten in den Ausgabenetats berücksichtigt. Dementspre-chend �ießen Gelder aus ö´entlichen Mitteln bzw. aus Mitteln der Kultusmi-
Abb. 6. Hebelschubanlage im Magazin des Lehrstuhlgebäudes (links). Während Feuchtperioden eindringende Nässe in die Kellerwände des Gebäudes. Daraus resultierende Salzausblühungen auf den Wandoberflächen (Mitte). Regelmäßige Zu-standskontrollen der Sammlungsobjekte, sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen innerhalb der Depoträume sind unabdingbar (rechts).
352 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
nisterien nur gering in nichtö´entliche Sammlungen, obwohl deren Erhaltung und P�ege ebenso eine gewichtige Rolle spielt. Über mehrere Jahre wurde da-her von der Verfasserin versucht, den Zustand bzw. die Lagerungsbedingungen innerhalb der im Kellergeschoss untergebrachten Depoträume zu verbessern. Aufgrund vorhandener Mängel am Gebäude stiegen die relative Luftfeuchtig-keit und die Temperatur innerhalb der Räumlichkeiten auf unakzeptable Werte (periodisch < 78 % rF); ferner schwankten Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf-fallend mit den Jahreszeiten und den Klimabedingungen außerhalb des Gebäu-des. Grundwassereinbrüche in das Mauerwerk erbrachten feuchte Kellerwände und Fußböden, was wiederum durch Salzausblühungen am Mauerwerk sicht-bar wurde (Abb. 6 Mitte). Aus restauratorischer Sicht wirken sich solche La-gerungsbedingungen auf jegliche Art von archäologischen Objekten zerstörend aus. Da es sich um eine „gemischte“ Sammlung handelt, ½nden sich dement-sprechend auch die verschiedensten Materialklassen wieder, die wiederum je-weils unterschiedlichen Aufbewahrungsbedingungen unterliegen sollten.4 Kann eine räumliche Trennung zur Separierung unterschiedlicher Materialklassen un-ter entsprechenden Klimabedingungen nicht eingerichtet werden, so sollte hier von Anfang an ein Kompromiss-Richtwert5 erreicht werden, um die Objekte optimal aufzubewahren. Folge der jahrelang unzureichenden Bedingungen war Schimmelbefall auf Kartonagen (Abb. 7) und einigen freistehenden Keramikob-jekten sowie neu gebildete Korrosionsausblühung an Metallobjekten. Ein�üsse, die an Objekten zum Teil irreversible Schäden verursachen können. Ein Zustand also, der dringlichst aufzuhalten war. Darüber hinaus waren die gesundheitli-chen Risiken für das Personal durch die dauernde Schimmelsporen-Belastung unvertretbar.
Trotz begrenzten Etats musste eine kostengünstige Lösung für das Prob-lem gefunden werden. Die fortwährende Dokumentation und Unterrichtung zum Sachverhalt, Antragstellungen auf Gelder, die Anforderungen durch den Arbeitsschutz6 und dank einer neueingerichteten, zwar befristeten Stelle einer Sammlungsbeauftragten für die Friedrich-Schiller-Universität Jena konnten letztlich Gelder für neue Kartonagen, für die Reinigung und Desin½zierung der Regalsysteme und Depoträume, sowie für die Anscha´ung zweier mobiler Kli-mageräte erbracht werden, die eine Verschlechterung der Zustände vermeiden. Allerdings wird es noch einige Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, um die be-reits sichtbaren Schäden an den Objekten zu beseitigen.
4 Vorwiegend Keramik, Eisen, Kupferlegierungen und Edelmetalle, seltener aber auch Kno-chen, Elfenbein, Bernstein, Glas und Holz.
5 Der empfohlene Wert für „Mischsammlungen“ liegt bei einer Luftfeuchtigkeit von ≤ 30% rF und einer Temperatur zwischen 18 bis 25°C. Vgl. Hilbert (1996).
6 U. a. wurde diese unterstützt durch mykologische Untersuchungen der Abteilung Medizi-naluntersuchung des ³üringer Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucher-schutz.
| 353Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Neben der P�ege und Betreuung von Sammlungsgut durch einen Restaurator, die u. a. die ständige Zustandskontrolle der Sammlungsobjekte beinhaltet (Abb. 6 rechts) bzw. durch Kuratoren in anderen Einrichtungen wird als weiterer Schwer-punkt die Frage nach ausreichend präventiven Maßnahmen zum Schutze der Ob-jekte gestellt. Hier sollten Maßnahmen und Notfallpläne im Sinne des Diebstahl- und Katastrophenschutzes von Seiten der Verantwortlichen geprüft und ausgebaut werden. Katastrophen ereignen sich unkalkulierbar und plötzlich und können zu verheerenden Konsequenzen führen. Spielte die ³ematik des Hochwasserschut-zes in der Jenaer Sammlung bisher keine Rolle, sollte sie dennoch bedacht werden. Im Falle einer Hochwasserkatastrophe, wie sie sich unlängst in Dresden ereignete, wären Schäden an den im Depot untergebrachten Sammlungsobjekten aufgrund der ca. 200 m Entfernung bis zum Saale-Ufer nicht undenkbar. Die Vergangenheit hat leider aufgezeigt, dass archäologische Funde sehr emp½ndlich gegenüber jeg-licher Art von Katastrophen und Fremdein�üssen sind, dabei oftmals unwieder-bringlich zerstört wurden oder irreversible Schäden erlitten.
Momentan ist die Restauratorenstelle ausgelastet, gehören zu den Aufgaben nicht nur konservatorische und restauratorische Maßnahmen an dem archäolo-gischen Fundmaterial, sondern auch die Vorbereitung, Fotogra½e und Verpa-ckung von Objekten zu Ausstellungszwecken. In Zukunft wird sich zeigen, in-wieweit das Interesse und die ½nanziellen Zuwendungen für eine sachgerechte Aufbewahrung und Präsentation dieser einzigartigen archäologischen Samm-lungsobjekte ausreichen.
Ivonne Przemuß
Abb. 7. Erhöhte Luftfeuchtigkeit und Staubauflagerungen boten optimalen Nährboden für Schimmel-sporen auf Kartonagen und Objekten.
354 | Peter Ettel – Ivonne Przemuss
Abbildungsnachweis
Abb. 1, 2, 4: Foto: Bereich für Ur- und Frühgeschichte der FSU Jena.Abb. 3, 5, 7: Foto: Ivonne Przemuß.Abb. 6: Foto links und Mitte: Ivonne Przemuß; Foto rechts: Grit Hezel.
Literaturverzeichnis
Ettel (2002)Ettel P., Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität Jena, ³üringer Museumshefte, 2002, 16–21.
Grabolle (2009)Grabolle R., Bereich für Ur- und Frühgeschichte, in: Lorke A., Walther H. G. (Hrsg.), Schätze der Universität. Die wissenschaftlichen Sammlungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena 4 (Jena 2009) 67–75.
Hilbert (1996)Hilbert G., Sammlungsgut in Sicherheit (Berlin 1996) 180–188.
Neumann (1963)Neumann G., Hundert Jahre Vorgeschichtliches Museum der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Prähistorische Archäologie, Ausgra-bungen und Funde 8, 1963, 223–231.
Peschel (1974)Peschel K., Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung, in: Steiger G., u. a. (Hrsg.), Reichtümer und Raritäten. Denkmale, Sammlungen, Akten und Handschriften, Jenaer Reden und Schriften, 1974, 137–143.
Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Peter EttelLehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte Friedrich-Schiller-Universität JenaLöbdergraben 24aD-07743 JenaDeutschlandE-Mail: [email protected]
Dipl.-Rest. (FH) Ivonne PrzemußLehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte Friedrich-Schiller-Universität JenaLöbdergraben 24aD-07743 JenaDeutschlandE-Mail: [email protected]