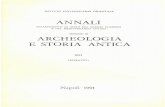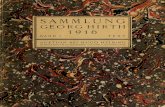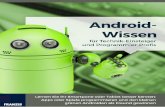Simon Matzerath / Ulla Münch (in Zusammenarbeit mit Hans-Christoph Strien), Die altneolithische...
-
Upload
historisches-museum -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Simon Matzerath / Ulla Münch (in Zusammenarbeit mit Hans-Christoph Strien), Die altneolithische...
Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V.
JÜLICHER GESCHICHTSBLÄTTERBand 76/77/78
herausgegeben
von
Guido v. Büren
Jahrbuch des Jülicher Geschichtsvereins
2008/2009/2010
5
Inhaltsverzeichnis
Marcell PerseBEITRÄGE ZUR JÜLICHER ARCHÄOLOGIE (IX) . . . . . . . . . . . . . . . 9
Simon Matzerath / Elaine Turner / Peter Fischer / Joseph BoscheinenBeiträge zur spätpleistozänen Megafauna im Rheinland. Ergebnisse der geo-
logischen und paläontologischen Untersuchungen in der Ziegeleigrube Coenen (Kreis Düren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Simon MatzerathEine kurze Würdigung zum Jubiläum. 50 Jahre archäologische Forschung im
Vorfeld des Braunkohletagebaus auf der Aldenhovener Platte . . . . . 175
Simon MatzerathQualitative und quantitative Merkmale der archäologischen Sammlung Gerhard-
Walter Dittmann. Eine Evaluierung ihrer wissenschaftlichen Bedeutung für die Siedlungsgeschichte des Neolithikums auf der Aldenhovener Platte 179
Simon Matzerath und Ulla Münch in Zusammenarbeit mit Hans-Christoph Strien
Die altneolithische Keramik der Sammlung Dittmann (Aldenhovener Platte). Ein Anwendungsbeispiel für den Merkmalskatalog »Bandkeramik Online« 207
Tobias MühlenbruchDie Grabung 2004 im Michelsberger Erdwerk Inden 9. Neue Erkenntnisse
durch die Keramikanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Jennifer KompRömisches Fensterglas und die zu seiner Herstellung verwendeten Rohgläser 225
Gerhard ReißDiskussion zu den Steinmaterialien zweier Meilensteine der Via Belgica . 241
Marcell PerseSpurensicherung römischer Matronenheiligtümer bei Jülich . . . . . . . 249
Helmut Holtz DIE HISTORISCHEN WINDMÜHLEN DES JÜLICHER LANDES (V) . . . . 259
Windmühlen in der Gemeinde Titz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
11. Die Rödinger Bockwindmühle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
12. Ein Nachtrag zur Spieler Bockwindmühle . . . . . . . . . . . . . . . 267
6
13. Ein Nachtrag zur Höller Windmühle . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE VON HAUS OVERBACH . . . . . . . . . 281
Helmut HoltzSalesianum Haus Overbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Bernhard DautzenbergArchäologische Baubegleitung am Herrenhaus von Haus Overbach in Jülich-
Barmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Robert ClaßenDie Geschichte der Ansichtskarte – dokumentiert am Beispiel von Haus
Overbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
***
Simon MatzerathTonabbau und -verarbeitung im mittleren Rurtal. Die Entwicklung der Zie-
geleigrube Coenen vor dem Hintergrund der Keramik- und Ziegelproduktion in Körrenzig und Glimbach (Stadt Linnich) . . . . . . . . . . . . . . 321
Wolfgang Vomm»Dorf im Jülicher Land« – ein Gemälde von Caspar Scheuren und seine Me-
tamorphosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Peter NievelerDer neu gestaltete Chorraum der Propsteikirche St. Mariae Himmelfahrt in
Jülich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
DOKUMENTATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Heinz SpelthahnIn Memoriam Dr. jur. Alfred Mendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Manfred SpeidelGottfried Böhm – Architekt der Rochuskirche in Jülich . . . . . . . . . . 387
Guido v. Büren und Marcell Perse (Bearb.)Museum Zitadelle Jülich / Stadtgeschichtliches Museum Jülich – Biblio-
graphie 2006–2010 (mit Nachträgen und Korrekturen für den Zeitraum 1987–2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Udo MainzerVorstellung des Buches »Das ›italienische‹ Jülich« am 8. November 2009 in
der Schlosskapelle der Zitadelle Jülich . . . . . . . . . . . . . . . . 429
7
REZENSIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Günter Breuer, Die Ortsnamen des Kreises Düren. Ein Beitrag zur Namen- und Siedlungsgeschichte, Aachen 2009 (Eberhard Graffmann) . . . . . . 439
Marcell Perse, Römerstraße Via Belgica. Teilstrecke Köln–Jülich. Geradewegs vom Rhein zur Rur (= Reisen in die Heimat), Köln 2011 (Günter Hürtgen) 442
Bernd Löhberg, Das »Itinerarium provinciarum Antonini Augusti«. Ein kaiser-zeitliches Straßenverzeichnis des Römischen Reiches, 2 Bde., Berlin 2006 (Marcell Perse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland. Abteilung VI: Nordrhein-Westfalen. Bd. 2/1: Reg.-Bezirk Aachen (Landkreise Düren, Erkelenz, Jülich), bearb. von Holger Komnick, Johannes Heinrichs und Bernd Päffgen, Mainz 2008 (Peter Franz Mittag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Frank Biller, Kultische Zentren und Matronenverehrung in der südlichen Germania inferior (= Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, Bd. 13), Rahden/Westf. 2010 (Bernd Päffgen) . . . . . . . 454
Michael Kuhn, Marcus. Soldat Roms I. Historischer Roman, Aachen 2008 (Evelyn Wirtz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Joseph Milz, Neue Erkenntnisse zur Geschichte Duisburgs (= Duisburger Forschungen, Bd. 55), Duisburg 2008 (Eberhard Graffmann) . . . . . 459
Geschichtlicher Atlas der Rheinlande. Im Auftrag der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde in Verbindung mit dem Landschaftsverband Rheinland hrsg. v. Franz Irsigler. Bd. IV: Siedlungsgeschichte, Lieferung 10.
Teil 11: Mittelalterliche Burganlagen in Kölner Bucht und Nordeifel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Bearb. von Reinhard Friedrich und Bernd Päffgen, Bonn: Habelt 2007.
Frank Bartsch (Red.), Der Geschichtliche Atlas der Rheinlande. Vorträge gehalten auf der Veranstaltung zum Abschluss des Atlasprojektes der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde am 5. Dezember 2008 im Rheinischen Landesmuseum Bonn, veranstaltet von der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde in Verbindung mit dem Landschaftsverband Rheinland (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichts-kunde. Vorträge, Bd. 35), Düsseldorf 2010 (Guido v. Büren) . . . . . 461
Monika Doll, Forschungen zu Haus Horst in Gelsenkirchen. Tierknochen aus acht Jahrhunderten (= Denkmalpflege und Forschung in Westfalen, Bd. 49.4), Mainz 2010 (Nadine Nolde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
F. M. J. Müllender, Die Wappen des Reuländer Urbars. Eine heraldisch-genealogische Betrachtung, Norderstedt 2011 (Maximilian Baur) . . . 471
8
Theodor Wieczorek/Marianne Gädtke, Die Ahnentafeln der Turnierteilnehmer bei der Jülicher Hochzeit 1585, Limburg an der Lahn 2010
Thomas Rahn, Festbeschreibung. Funktion und Topik einer Textsorte am Beispiel der Beschreibung höfischer Hochzeiten (1568–1794) (= Frühe Neuzeit, Bd. 108), Tübingen 2006 (Guido v. Büren) . . . . . . . . . 473
Ingeborg Unger, Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Be-stände des Kölnischen Stadtmuseums (= Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums, hrsg. von Werner Schäfke, Bd. 8), Köln: Selbstverlag des Kölnischen Stadtmuseums o.J. (2007) (Marcell Perse) . . . . . . . . . 476
Gabriele Häussermann, Wer stahl Schirmers Bilder? Ein Kunstkrimi an drei Orten: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Museum Kunstpalast Düsseldorf, Museum Zitadelle Jülich (= Führer des Museums Zitadelle Jülich, Bd. 25), Petersberg 2013 (Edeltraud Wickum-Höver) . . . . . . . . . . . . . 481
Günter Bers, Zwischen Tradition und Innovation: Prof. Dr. Joseph Kuhl (1830–1906). Wegbereiter der Jülicher Regionalgeschichte (= Forum Jüli-cher Geschichte, Bd. 45), Jülich 2006 (Guido v. Büren/Heinz Spelthahn). 482
Ingrid Bachér, Die Grube. Roman, Berlin 2011 (Wolfgang Schneiders) . . 485
Gegendarstellung zur Rezension von Horst Dinstühler, »Itzo redt sie mitt dem teuffell«. Hexenglaube und Lynchjustiz in Jülich (= Forum Jülicher Geschichte, Bd. 43), Jülich 2006 durch Klaus Graf, in: Jülicher Geschichts-blätter, Bd. 74/75, 2006/2007 (2008), S. 376–378 (Horst Dinstühler) . 488
Ergänzungen und Korrekturen zur Monographie »Die alte Pfarrkirche St. Pe-ter zu Körrenzig. Geschichte eines ländlichen Sakralbaus im Rheinland« (Jülich 2012) (Simon Matzerath) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Bei der Redaktion eingegangene Veröffentlichungen . . . . . . . . . . . 506
VEREINSMITTEILUNGEN
Guido v. Büren (Zusammenstellung)Chronik des Jülicher Geschichtsvereins 1923 e. V. vom 1. Juli 2006 bis zum
31. Dezember 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
NachrufeEin vorbildlicher Mensch und Heimatpfleger. Nachruf auf Wilhelm Schol
(11.6.1913–5.12.2008) (Simon Matzerath) . . . . . . . . . . . . . . 551
Norbert Thiel (1940–2008) – ein schlesischer Rheinländer, langjähriges Mit-glied des Jülicher Geschichtsvereins 1923 e.V. (Uwe Cormann) . . . . 561
Verzeichnis der Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
207
Simon Matzerath und Ulla Münch in Zusammenarbeit mit Hans-Christoph Strien
Die altneolithische Keramik der Sammlung Dittmann (Aldenhovener Platte)
Ein Anwendungsbeispiel für den Merkmalskatalog »Bandkeramik Online«
Im Rahmen der Aufarbeitung der Samm-lung Gerhard-Walter Dittmann im Mu-seum Zitadelle Jülich ließ sich eine große Komponente verzierter alt- und mittelneolithischer Scherben feststellen (Abb. 1; hier: 53.–50. und 47.–45. Jh. v. Chr.).1 Die Scherben sollen ausschließ-lich bei Oberflächenbegehungen ge-borgen worden sein, was hinsichtlich der guten Erhaltung überraschen mag. Ihre Fundorte liegen im Umfeld von Aldenhoven, größtenteils im Bereich von Fundstellen, die auch durch das international berühmte Forschungspro-jekt »Siedlungsarchäologie des Neoli-thikums auf der Aldenhovener Platte« (SAP) archäologisch untersucht wurden.2 G.-W. Dittmann hat seine Scherben im Wesentlichen in den 1970er Jahren entdeckt, als auch die Ausgrabungen des Forschungsprojektes stattgefunden haben. Im vorliegenden Beitrag stehen die altneolithischen (linearbandkerami-
1 Vgl. Simon Matzerath, Qualitative und quantitative Merkmale der archäologischen Sammlung Gerhard-Walter Dittmann – Eine Evaluierung ihrer wissenschaftlichen Bedeutung für die Siedlungs-geschichte des Neolithikums auf der Aldenhovener Platte, im vorliegenden Band.
2 Vgl. Simon Matzerath, Eine kurze Würdigung zum Jubiläum. 50 Jahre archäologische Forschung im Vorfeld des Braunkohletagebaus auf der Aldenhovener Platte, im vorliegenden Band.
Abb. 1: Sammlung Dittmann. Die prähistorischen Scherben im Museum Zitadelle Jülich. Ausbreitung der Scherben nach Fundstellen sortiert (Arbeitsfoto).
208
schen) Scherben der Sammlung im Mittelpunkt.3 Sie blieben in den Publikationen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte weitgehend unberücksichtigt. Lediglich sechs Scherben aus Dittmanns Fundstelle Niedermerz 3 (identisch mit der SAP-Fundstelle Niedermerz 6) wurden mit einer Zeichnung abgebildet.4 Diese Funde müssen als verschollen gelten, nachdem sie bei der Aufarbeitung des Sammlungs-bestandes nicht identifiziert werden konnten.
Seit Juni 2010 ist die neueste Version des Merkmalskatalogs zu bandkerami-schen Verzierungsmustern »Bandkeramik ONLINE« im Internet veröffentlicht. Dieses komplexe Aufnahmesystem wird hier vorgestellt und auf die Funde in der Sammlung Dittmann exemplarisch angewendet. Die Grundlagen dafür hatte Petar Stehli im Rahmen des oben genannten Forschungsprojektes SAP in den 1970er Jahren entwickelt.5 Nach Antrag durch das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln hat die Stiftung zur Förderung der Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier eine Überarbeitung und Vervollständigung des Merkmalskatalogs unterstützt und dessen Bereitstellung auf ihrer Internetseite ermöglicht.6 Der Katalog wurde durch die Forschungsergebnisse verschiedener Bearbeiter aus dem Rheinland, aus Südwestdeutschland, Hessen, Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern ergänzt, sodass ehemals verstreut publizierte Typendefinitionen nun an einer Stelle zusammengeführt und vereinheitlicht sind. Durch die Vorlage des Katalogs mit einer zugehörigen Anleitung auf der Internetseite ist der Abruf der jeweils aktuellen Fassung für jeden Bearbeiter sichergestellt. Außerdem besteht dort die Möglichkeit per E-Mail Kontakt zur »Arbeitsgruppe Merkmalskatalog« aufzunehmen, die eine zeitnahe Ergänzung neuer Muster gewährleistet und Nummernkontingente für eine Materialaufnahme vergibt. Die Nutzung des Merkmalskataloges ermöglicht die ver-gleichende Betrachtung altneolithischer Keramik durch Bearbeiter aus verschiedenen Regionen Mitteleuropas und damit überregionale Analysen.
3 Zur mittelneolithischen Keramik der Slg. Dittmann vgl. Simon Matzerath/Markus Pavlovic, Frühes Rössen auf der Aldenhovener Platte – Datierung mittelneolithischer Keramik aus den Siedlungen »Aldenhoven 1« und »Schleiden 3«, in: Archäologische Informationen, Bd. 35 (2012), S. 253–258.
4 Vgl. Rudolph Kuper/Hartwig Löhr/Jens Lüning/Petar Stehli, Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte IV, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 174 (1974), S. 424–508, hier: S. 453, Abb. 17,1–6.
5 Vgl. Petar Stehli, Keramik, in: Jean-Paul Farruggia/Rudolph Kuper/Jens Lüning/Petar Stehli, Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 2 (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 13), Bonn 1973, S. 139–152. Zuletzt: Ders., Chronologie der Bandkeramik im Merzbachtal, in: Jens Lüning/Petar Stehli (Hrsg.), Die Bandkeramik im Merzbachtal auf der Aldenhovener Platte (= Beiträge zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte, Bd. V = Rheinische Ausgrabungen, Bd. 36), Köln/Bonn 1994, S. 84–191.
6 http://www.archaeologie-stiftung.de/wissenschaft/bandkeramik+online/index.htm; vgl. dort: Hans-Christoph Strien, Bandkeramik Online: Merkmalskatalog zur Aufnahme verzierter Keramik (Stand 8.3.2010).
209
Die Verzierungsmerkmale dienten schon beim Forschungsprojekt »SAP«in erster Linie für die zeitliche Gliederung des Keramikma-terials – und darüber hinaus für die Datierung von Befunden und Siedlungen.
Die Bandkeramik lässt sich auf dieser Grundlage feinchronologisch in die Hausge-nerationen (HG) I (älteste HG) bis XV (jüngste HG) gliedern. Über die datierenden Möglich-keiten hinaus gewinnen in den letzten Jahren zunehmend Fragen nach der Sozialstruktur an Bedeutung, welche eine detaillierte Un-terscheidung von Verzierungsmerkmalen erfordert.7 Zusätzlich zu den Bandmustern, die der Linearbandkeramik ihren Namen gaben, werden dafür auch Randverzierun-gen, Sekundärmotive, Bandabschlüsse und Bandunterbrechungen aufgenommen. Ak-tuell enthält der gesamte Merkmalskatalog ca. 270 Bandtypen, 100 Bandabschlüsse, 80 Bandunterbrechungen, 190 Ränder mit 19 Metopierungen (Unterbrechungen im Randmuster) und knapp 900 Sekundärmotive.
Der typische bandkeramische Verzie-rungsstil besteht aus geritzten und gesto-chenen Mustern auf der Oberfläche von Keramikgegenständen, wie insbesondere den sog. Kümpfen (Abb. 2). Die Bandmuster bedecken fast jedes verzierte Gefäß, wobei man nach nur geritzten, nur gestochenen, der Kombination aus geritzt und gestochenen, einzelnen Einstichen oder Stichen mit einem Kamm und Furchen- und Tremolierstichverzierungen unterscheidet. Beim Furchenstich wird eine Linie einge-ritzt, indem man das Werkzeug abwechselnd in Längsrichtung zieht, also einritzt und wieder auf der Linie nach vorne einsticht. Der Tremolierstich besteht aus abwechselnd
7 Vgl. Hans-Christoph Strien, Familientraditionen in der bandkeramischen Siedlung bei Vaihingen/Enz, in: Jens Lüning/Christiane Friedrich/Andreas Zimmermann (Hrsg.), Die Bandkeramik im 21. Jahrhundert. Tagung Brauweiler 2002, Rahden/Westf. 2005, S. 189–197. Die methodischen Prämissen für die Abgrenzung von 15 Hausgenerationen bzw. die Zuordnung von Grubeninventa-ren zu Hausgrundrissen werden inzwischen intensiv diskutiert. Vgl. etwa Regina Smolnik (Hrsg.), Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Beiträge der internationalen Tagung »Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?« (Dresden 2012).
Abb. 2: Linearbandkeramik. Sogenannte Kümpfe (rundbo-dige und henkellose, handgefertigte Gefäße) mit typischer Verzierung. Idealzeichnungen nach Grabungsfunden. Oben: Älteste Bandkeramik im Rheinland (Flomborn; 53. Jh. v. Chr.). Mitte: Spätere Phase der Bandkeramik mit engen, parallel gezogenen Ritzlinien in den Bändern (ca. 52. Jh. v. Chr.). Unten: Jüngere Bandkeramik (rechts: Kammstichverzierung; ca. 51. Jh. v. Chr.).
210
– »wackelnd« – gesetzten Einstichen, die mit einem Kamm ausgeführt wurden und eine geschwungene Zick-Zack-Linie erzeugen. Seltener sind Verzierungen durch plastische Auflagen, welche auch in Kombination mit Einstichen oder Ritzlinien vorkommen können. Grobkeramische, größere Gefäße können auch durch Finger-tupfeneindrücke und Fingerkniffe verziert sein. Als Motive sind zahlreiche Varianten von Spiralen und Winkelbändern besonders häufig. Dazu sind oft die Ränder verziert und Sekundärmotive aufgebracht. Bei den Sekundärmotiven – auch Zwickelmotive genannt – handelt es sich um kleine Muster die zwischen den Bandornamenten auf der Gefäßoberfläche liegen.
Für eine Datierung des keramischen Fundmaterials, also einer Chronologie auf der Basis von bandkeramischen Verzierungsmustern, muss eine Methode angewendet werden, die auf die Merkmalsveränderungen des Fundstoffes durch die Zeit reagiert und Kontinuität und Diskontinuität aufdecken kann. Diese Voraussetzung erfüllt das multivariate statistische Verfahren der Korrespondenzanalyse. Es berücksichtigt die absoluten Quantitäten der Merkmale in den Inventaren (die Häufigkeit der einzel-nen Muster in einer Siedlungsgrube) und geht von der Annahme aus, dass sie sich bezüglich der Zeit unimodal verhalten. Das heißt jedes Merkmal nimmt im Laufe der Zeit zunächst allmählich zu – »es kommt in Mode« – erreicht einen Höhepunkt und nimmt schließlich wieder ab. Die Korrespondenzanalyse ordnet die Tabellen, die die Merkmalskombination verschiedener Muster (Typen) in geschlossenen Funden erfassen, nach ihren Ähnlichkeiten. Nach einer solchen Ordnung, die man auch Seriation nennt, wird jeder Verzierungstyp in optimaler Weise zu den anderen Verzierungstypen in Beziehung gesetzt. Damit erhält man Zahlenreihen, welche die Datierung der Typen und der Gruben wiedergeben. Die relativen Abstände zwischen den Zahlen – die sogenannten Schwerpunkte – der archäologischen In-ventare entsprechen ihrer relativen Position entlang der Zeitachse. Für jede Grube wird dadurch ein relatives Alter bestimmt. Bei der Interpretation des Ergebnisses muss berücksichtigt werden, dass seine Aussagefähigkeit in erster Linie von der Anzahl der in den Gruben enthaltenen Gefäße und von der Breite des Merkmalsspektrums abhängig ist. Man geht dabei von der Grundannahme aus, dass das Inventar einer Grube einen Zeitraum repräsentiert, der sicher kürzer ist als die Belegungsdauer der untersuchten Siedlung und oft kürzer als die Nutzungsdauer desjenigen Hauses, zu dem der Befund gehört. In diesem Sinne könnte man das Inventar einer Siedlungs-grube als »relativ geschlossenen Fund« ansprechen. Enthält eine Grube nur wenige Gefäße, würde sich schon bei Wegfall oder Hinzufügung von einem einzigen Gefäß die Datierung erheblich verändern. Allerdings verbessert ein sehr breites Merkmals-spektrum die Datierung einer Grube nicht zwingend, es kann auch ein Hinweis auf eine sehr lange Nutzung der Grube sein. Am genauesten lassen sich also vermutlich Inventare mit einer mittleren Anzahl von Gefäßen datieren. Die Schwerpunkte der
211
Gruben werden als Zeitpunkte interpretiert, obwohl die Grubeninhalte Ergebnisse stochastischer Prozesse von unbekannter Dauer sind. Deshalb ist die Datierung eine Wahrscheinlichkeitsaussage und man muss bei der chronologischen Interpretation mit einem gewissen Schwankungsbereich rechnen.
Grundlage dieser datierenden Ergebnisse ist somit die Analyse von Grubeninven-taren mit einer mittleren Anzahl von verzierten Gefäßen. Deshalb eignet sich diese Methode gut zur Datierung von gegrabenen Fundstellen. Im Rheinland, besonders in der Tagebauregion, wurden zahlreiche bandkeramische Siedlungen ausgegraben. Das dort geborgene, umfangreiche keramische Material wurde seit dem SAP-Projekt nach der oben beschriebenen Methode datiert. Damit sind Aussagen zu Beginn und Ende einer Besiedlung, beispielsweise einer einzelnen Fundstelle, möglich. Gleichzeitig können aber auch Besiedlungslücken aufgezeigt werden. Während der langen Tradition dieser Auswertung hat sich die Anzahl der erfassten Muster deutlich vergrößert. Außerdem wurden Differenzierungen oder Zusammenfassungen vorgenommen. Deshalb wäre es wünschenswert das keramische Material der alten Grabungen noch einmal nach dem neuen Standard aufzunehmen.
Bei Begehungsfunden, wie sie aus der Sammlung Dittmann vorliegen, ist der chronologische Aussagewert eher gering, da die aufgesammelten Scherben einen zufälligen und mengenmäßig kleinen Ausschnitt aus der gesamten Siedlung wider-spiegeln. Weil jedes Verzierungsmerkmal innerhalb der Laufzeit der Bandkeramik längere Zeit »in Mode« war, ist es kaum möglich anhand eines einzelnen Musters
Tab. 1: Fundstellen mit verzierter altneolithischer Keramik. Korrelation der Fundstellenkürzel in der Sammlung Dittmann mit den entsprechenden Fundstellen des SAP-Projektes. AL=Aldenhoven; LN=Lohn; LW=Langweiler; NM=Niedermerz.
212
Abb. 3: Verzierte Scherben der Bandkeramik. Sammlung Dittmann (Auswahl). Fundstellenkürzel nach Dittmann und SAP-Projekt (in Klammern). Nr. 1, 2 (Rand): 248 (LW 2); Nr. 3, 11: NM 3 (NM 6); Nr. 4: L 2 (?); Nr. 5, 14, 15: A 2 (AL 2); Nr. 6, 10 (Rand), 18, 19: L 5 (LN 14); Nr. 7, 9, 17, 20 (2 Scherben): NM 3/1 (NM 6); Nr. 8, 12 (Rand), 13: 269 (LW 8); Nr. 16: L 1 (nahe LN 1); Nr. 21 (Rand): L 1 und NM 3 (!) (entsprechend SAP: nahe LN 1 bzw. NM 6). Nr. 1–20 mit bestimmbarem Bandmuster.
213
eine genaue Datierung festzumachen. Grundsätzlich gilt, dass die Bandmuster aus ausschließlich breiten Bändern mit zwei oder drei Ritzlinien (ggf. mit großen Ein-stichen) typisch für den Beginn der Bandkeramik im Rheinland, der Flombornzeit, sind (Abb. 2 oben).8 Mit kleinen, dicht gesetzten Stichen gefüllte Bänder, eng parallel gezogene Ritzlinien und Furchenstichverzierungen setzen später ein (Abb. 2 Mitte) und Verzierungen aus Kamm- und Tremolierstich liegen am Ende der Bandkeramik (Abb. 2 unten). Insgesamt steigert sich der Anteil der Verzierungen, die in Stichtechnik ausgeführt wurden, gegenüber den primär in Ritztechnik ausgeführten frühen Mustern.
In ihrem Bandmuster bestimmbare altneolithische Keramik liegt in der Samm-lung Dittmann mit 17 verschiedenen Fundstellenkürzeln vor (Tab. 1; Abb. 3), wovon fünf Kürzel aber lediglich Untergliederungen oder Erweiterungen einer Hauptfundstelle sind (L 1/1 und L 1/2 von L 1; L 2/1 von L 2; NM 3/1 und NM 3/2 von NM 3). Entsprechend der Nummerierung des aktuellen Merkmalskata-logs konnten 22 verschiedene Verzierungsmuster (Bandmuster) bestimmt werden (Tab. 2–3; Abb. 4).9 Berücksichtigt wurden dabei nur die repräsentativ erhaltenen Scherben, während kleinere Fragmente einer Verzierung nicht in die Untersuchung eingegangen sind.
Die Sammlung Dittmann ist, wie an anderer Stelle gezeigt wird, in ihrer Doku-mentation und der Fundstellenzuweisung nicht unproblematisch, weshalb in Ta-belle 1 nicht alle Fundstellenkürzel Dittmanns genau lokalisiert werden konnten.10 Im Gegensatz zu den Steinartefakten sind die Keramikscherben weitgehend mit einem Fundstellenkürzel beschriftet. Dennoch konnten auch hier einzelne Fehler beobachtet werden, wie z. B. zwei zusammenpassende Randscherben, die angeblich aus zwei völlig unterschiedlichen Fundstellen stammen (»L 1« und »NM 3« nach Dittmann; Abb. 3,21).
8 Vgl. Ulla Münch, Zur Siedlungsstruktur der Flombornzeit auf der Aldenhovener Platte, in: Andreas Zimmermann (Hrsg.), Studien zum Alt- und Mittelneolithikum im Rheinischen Braunkohlenrevier (= Beiträge zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte, Bd. 7), Rahden/Westf. 2009, S. 1–102.
9 Die hier vorgestellten Verzierungsmuster wurden von folgenden Autoren erstmals beschrieben (siehe Literaturkürzel in Tab. 2): Cladders 1997: Maria Cladders, Befunde und Keramik des band-keramischen Siedlungsplatzes Hambach 21, Gem. Jülich, Kr. Düren, in: Studien zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte, Bonn 1997, S. 131–227. Stehli 1973: Stehli 1973 (wie Anm. 5). Stehli 1977: Petar Stehli, Keramik, in: Rudolph Kuper/Hartwig Löhr/Jens Lüning/Petar Stehli/Andreas Zimmermann, Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 9 (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 18), Bonn 1977, S. 107–126. Stehli 1988: Petar Stehli, Zeitliche Gliederung der verzierten Keramik, in: Ulrich Boelicke/Detlef von Brandt/Jens Lüning/Petar Stehli/Andreas Zimmermann, Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 28), Köln/Bonn 1988, S. 441–547. Strien 2000: Hans-Christoph Strien, Untersuchungen zur Bandkeramik in Württemberg (= Universitätsforschungen Prähistorische Archäologie, Bd. 69), Bonn 2000. Strien in Vorb.: Hans-Christoph Strien, Fund-vorlage Vaihingen/Enz. In Vorbereitung.
10 Vgl. dazu Matzerath (wie Anm. 1), mit Kartierung und Koordinaten.
214
Für die einzelnen Bandmuster gibt es bislang noch keine überregionale chro-nologische Zuordnung. Die Bandmuster in der Sammlung Dittmann können aber mit Bandmustern aus drei Siedlungen im Schlangengrabental (östliche Aldenhove-ner Platte) verglichen werden, die von Christiane Krahn anhand einer Seriation mit verschiedenen Hausgenerationen korreliert wurden.11 Als langläufige Band-muster zeichnen sich hier vor allem Nr. 83 und 548 ab, die im Schlangengra-ben zwischen Hausgeneration I und XII vorkommen. Zu den spätesten Mustern im Schlangengraben, die auch in der Sammlung Dittmann beobachtet wurden, gehören Nr. 5, 9, 19, 22 und 24 (Haus-generationen X–XIV). Sie fanden sich in Dittmanns Fundplatz Niedermerz 3 (SAP NM 6) auf fünf Gefäßeinheiten.
Einen Hinweis auf eine sehr späte Stel-lung innerhalb der Bandkeramik gibt die Kammstichverzierung (Bandmuster 14) von der Fundstelle »Z 269« (SAP LW 8). Die Fundstellen Lohn 1 und Lohn 5 (SAP LN 14) mit 15 bzw. 17 Gefäßeinheiten weisen einen hohen Anteil an Mustern mit Stichtechnik auf.12 Zwei Gefäßeinheiten aus Lohn 1 besitzen einen Furchenstich (Bandmuster 22), so wie auch eine Ge-fäßeinheit aus Lohn 5 (Bandmuster 26). Diese beiden Fundstellen waren gemäß den vorliegenden Bandmustern auch in der jüngeren Phase der Bandkeramik
11 Vgl. Christiane Krahn, Die bandkeramischen Siedlungen im oberen Schlangengrabental. Studien zur bandkeramischen Besiedlung der Aldenhovener Platte (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 57), Mainz 2006.
12 Die Zusammensetzung der Bandmuster in den Fundstellen »L 1«, »L 1/1« und »L 1/2« ist insgesamt auffallend homogen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Scherben aus einem intakten Grubenkontext stammen.
Abb. 4: Die an den altneolithischen Scherben der Sammlung Dittmann bestimmten Bandmuster (vgl. Tab. 2). Schemazeichnungen.
215
besiedelt. Der größte Anteil verzierter altneolithischer Keramik in der Samm-lung Dittmann gehört zu den Fundstellen NM 3 (24 bestimmte Gefäßeinheiten) und NM 3/1 (31 Gefäßeinheiten), die eine zusammenhängende Fundstreu-ung beschreiben. Neben der üblichen Ritzverzierung ist hier die Stichtechnik wieder stark vertreten.
Für eine einigermaßen sichere Da-tierung von Oberflächenfundplätzen ist ein breites Spektrum an Bandmus-tern und eine Anzahl von mindestens 50 Gefäßeinheiten grundlegend. Diese Anforderungen erfüllt in der Sammlung Dittmann allein die Fundstelle NM 3 bzw. NM 3/1 (SAP NM 6) mit zusam-men 55 bestimmten Gefäßeinheiten und 13 verschiedenen Bandmustern. Die bestimmten Bandmuster der anderen Fundstellen in der Sammlung Dittmann sind in diesem Kontext eher als Ergänzung des Forschungsstandes von Interesse.
Die oben aufgelisteten Fundstellen sind mit einer Ausnahme (Aldenhoven 1 = Dittmann A3) primär durch Funde der Linearbandkeramik bekannt.13 Die Fund-stelle Aldenhoven 1 gehört dagegen ins Mittelneolithikum (»Rössener Kultur«) und braucht in diesem Zusammenhang mit der einen bandkeramischen Gefäß-einheit nicht weiter berücksichtigt zu werden. Es gibt somit keine Unstimmig-
13 Vgl. zur Datierung Ulrich Boelicke/Rainer Drew/Jörg Eckert/Jürgen Gaffrey/Jens Lüning/Winrich Schwellnus/Petar Stehli/Andreas Zimmermann, Untersuchungen zur neoli-thischen Besiedlung der Aldenhovener Platte XII, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 182 (1982), S. 315–320.
Tab. 2: Beschreibung der in der Sammlung Dittmann bestimmten Bandmuster (Abb. 4). Vgl. Anm. 9.
216
keiten zwischen den altneolithischen Keramik-Inventaren des SAP-Projektes und den entsprechenden Inventaren in der Sammlung Dittmann.
Im Rahmen des SAP-Projektes wurden einige der von Dittmann begangenen Fund-stellen mit verzierter Keramik durch Ausgrabungen näher untersucht (in Klammern die Größe der Grabungsfläche, Fundstellenkürzel nach SAP): AL 2 (1.220 m²),14 NM 6 (Notbergung),15 LW 2 (35.500 m²),16 LW 8 (98.350 m²).17 Die Fundstellen LN 118 und LN 1419 sind dagegen nur aufgrund von Begehungen bekannt. Hausgrundrisse wurden weder bei der Notbergung in Niedermerz 6, noch bei der vergleichsweise kleinen Ausgrabung in Aldenhoven 2 dokumentiert, während sie aus Langweiler 2 und Langweiler 8 in großer Zahl vorliegen. Für Langweiler 2 ließen sich dabei die Hausgenerationen V, VII und IX–XIV bestimmen. Langweiler 8 war von Hausgene-ration I–XIV durchgängig besiedelt.20
Interessant ist noch die Datierung der Keramik aus Dittmanns Fundstelle L 1, die vermutlich zu einem Grubenbefund gehört. Über die häufige Stichtechnik und die an zwei Gefäßen bestimmte Furchenstichverzierung kann der Befund vor allem in die jüngere Bandkeramik (Hausgenerationen VIII bis XIII) datiert werden. Obwohl der SAP-Fundplatz Lohn 1 laut den Kartierungen nur in der Nähe der gleichnamigen Fundstelle Dittmanns liegt, wurde auch dieser in die jüngere Bandkeramik datiert. Vielleicht handelt es sich hierbei um einen zusammengehörigen Fundplatz.
14 Vgl. Jörg Eckert/Margarete Ihmig/Antonius Jürgens/Rudolph Kuper/Hartwig Löhr/Jens Lüning/Irene Schröter, Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte, in: Bonner Jahr-bücher, Bd. 171 (1971), S. 558–664, hier: S. 572ff.; Kuper/Löhr/Lüning/Stehli 1974 (wie Anm. 4), S. 442.
15 Vgl. Kuper/Löhr/Lüning/Stehli 1974 (wie Anm. 4), S. 452ff.; Rudolph Kuper/Hartwig Löhr/Jens Lüning/Winrich Schwellnus/Petar Stehli/Andreas Zimmermann, Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte V, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 175 (1975), S. 191–229, hier: S. 209ff.
16 Vgl. Eckert/Ihmig/Jürgens/Kuper/Löhr/Lüning/Schröter 1971 (wie Anm. 14), S. 620; Jörg Eckert/Margarete Ihmig/Rudolph Kuper/Hartwig Löhr/Jens Lüning, Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte II, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 172 (1972), S. 344–403, hier: S. 350; Jean-Paul Farrugia/Rudolph Kuper/Jens Lüning/Petar Stehli, Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte III, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 173 (1973), S. 226–256, hier: S. 242; Farrugia/Kuper/Lüning/Stehli 1973 (wie Anm. 5).
17 Vgl. Eckert/Ihmig/Jürgens/Kuper/Löhr/Lüning/Schröter 1971 (wie Anm. 14), S. 623; Eckert/Ihmig/Kuper/Löhr/Lüning 1972 (wie Anm. 16), S. 376ff.; Kuper/Löhr/Lüning/Stehli 1974 (wie Anm. 4), S. 429f., 450; Petar Stehli, Großgartacher Scherben vom bandkeramischen Siedlungsplatz Langweiler 8, Kr. Düren. Archäologisches Korrespondenzblatt, Jg. 4 (1974), H. 2, S. 117–120; Ulrich Boelicke/Detlef von Brandt/Jens Lüning/Petar Stehli/Andreas Zimmermann, Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 28), Köln/Bonn 1988.
18 Vgl. Eckert/Ihmig/Jürgens/Kuper/Löhr/Lüning/Schröter 1971 (wie Anm. 14), S. 630; Ulrich Boelicke/Ebba Koller/Rudolph Kuper/Hartwig Löhr/Jens Lüning/Winrich Schwellnus/Petar Stehli/Max Wolters/Andreas Zimmermann, Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte VII, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 177 (1977), S. 481–559, hier: S. 512; 514.
19 Vgl. Kuper/Löhr/Lüning/Schwellnus/Stehli/Zimmermann 1975 (wie Anm. 15), S. 212; Boelicke/Koller/Kuper/Löhr/Lüning/Schwellnus/Stehli/Wolters/Zimmermann 1977 (wie Anm. 18), S. 512, 514.
20 Freundliche Mitteilung Sara Schiesberg, Köln.
217
Insgesamt beinhaltet die Sammlung Dittmann 1.109 Scher-ben (ohne die römische und früh-mittelalterliche Sammlung) aus 36 Fundstellen (gemäß den Kürzeln Dittmanns) auf der Aldenhove-ner Platte. Hierbei liegt aus dem Umfeld der Fundstellen Lohn 1 (SAP s. Tab. 3; n=227) und Nie-dermerz 3 (SAP NM 6; n=267) die größte Anzahl an Scherben vor. 138 Scherben sind aus Dittmanns Fundstelle Lohn 5 (SAP LN 14) überliefert.21
Auf Grundlage der verzierten Scherben mit einem identifizier-baren Muster konnten 127 band-keramische Gefäßeinheiten von 14 Fundstellen der Sammlung Dittmann bestimmt werden. Für zukünftige Untersuchungen kann insbesondere die verzierte Keramik vom Fundplatz Niedermerz 3 (SAP NM 6) weitere Hinweise zur Ein-ordnung der Fundstelle liefern. Da-bei sei jedoch abschließend noch einmal darauf hingewiesen, dass in der Dokumentation der Sammlung Dittmann stellenweise Unregelmä-ßigkeiten aufgetreten sind.
21 Zur Übersicht vgl. Matzerath (wie Anm. 1), Tab. 7.
Tab. 3: Verzierungsmuster der altneolithischen Keramik, Sammlung Dittmann. Aufnahme nach dem aktuellen Merkmalskatalog »Bandke-ramik ONLINE«. Fundplatzkürzel entsprechend der Benennung durch Dittmann (vgl. Tab. 1). BT=Bandtyp. GE=Gefäßeinheiten. Summe GE: Summe bestimmbarer Gefäßeinheiten.
Abbildungsnachweis: Simon Matzerath: 1, 3 (zus. mit Bernhard Dautzenberg); Ulla Münch: 2; Simon Matzerath/Ulla Münch: 4 (Skizzen nach http://www.archaeologie-stiftung.de/wissenschaft/bandkeramik+online/index.htm; ergänzt durch Nr. 179, 180, 548).Tabellennachweis: Simon Matzerath/Ulla Münch: 1–3.