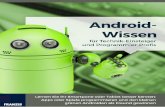Hans Schrader und die Abguß-Sammlung der Klassischen Archäologie an der Johann...
-
Upload
ku-eichstaett -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Hans Schrader und die Abguß-Sammlung der Klassischen Archäologie an der Johann...
VOM OBJEKT ZUR KULTURGESCHICHTE. WIE ARCHÄOLOGEN
ARBEITEN
herausgegeben vom Institut für Archäologische
Wissenschaften
Beiheft zur gleichnamigen Ausstellung vom 21. Oktober 2014 bis 31. März 2015
im I.G. Farben-Haus der Goethe-Universität Frankfurt am Main
INHALTVorwort .............................................................................................................................7
Einführung .......................................................................................................................9
ARCHÄOLOGISCHE WISSENSCHAFTEN AN DER GOETHE-UNIVERSITÄT
Das Institut für Archäologische Wissenschaften .....................................................12
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients .....................................16
Klassische Archäologie .................................................................................................24
Archäologie und Geschichte der Römischen Provinzen/Archäologie von Münze, Geld und von Wirtschaft in der Antike ..........................36
Vor- und Frühgeschichte und Archäobotanik ..........................................................50
Der Studiengang Archäometrie und die Forschungsstelle Keramik ...................56
VOM SAMMLUNGSOBJEKT ZUR KULTURGESCHICHTE
Zwei unterschiedliche Töpfertraditionen .................................................................62
Lekythen – Salböl und Bilder für die Toten ...............................................................74
Realität und Fiktion in den Münzmotiven Kleinasiens ...........................................90
Das Schwert in der Bronzezeit – Statussymbol oder Waffe? ...............................102
Getreide – Basis des sesshaften Lebens ..................................................................118
ANHANG
Ausstellungsvorbereitung als Teil des Studiums der Klassischen Archäologie .............................................................................................132 Museumspraxis im Studium von Archäologie und Geschichte der Römischen Provinzen ..........................................................................................135
Experimenteller Bronzeguss im Studiengang Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie ..............................................................137
Frankfurter Archäologische Schriften .....................................................................139
Dank ...............................................................................................................................141
Impressum ....................................................................................................................142
Seite 26
HANS SCHRADER UND DIE ABGUSS-SAMMLUNG
Die Entstehung der Abguss-Sammlung ist unmittel-bar mit der Fachgründung an der Goethe-Univer-sität und dem ersten Lehrstuhlinhaber Hans Schrader verbunden. Bereits bei seiner Berufung 1914 war „die Aufstellung, Verwaltung und Mehrung einer Ab-guss-Sammlung“ in der Ausschreibung festgehalten worden. Schrader besaß zu diesem Zeitpunkt als Direktor der Wiener Antikensammlung nicht nur die entsprechende Erfahrung, sondern er maß der antiken Bildhauerkunst auch einen hohen Stellen-wert zu.
Hans Schrader im Jahre 1914 kurz vor seiner Berufung nach Frankfurt, Kunsthistorisches Museum Wien. Foto Emil Gustav Voigt, Atelier Elsa, Wien.
Seite 27
BERLIN – ATHEN – WIEN – FRANKFURTWer war dieser Kunstliebhaber, der den ersten Frankfurter Lehrstuhl für Klassische Archäologie so prägen sollte? Hans Schrader (1869–1948) begann 1888 sein Studium der Klassischen Philologie, der Archäologie, der Ge-schichte und der Kirchengeschichte in Marburg, um dann nach dem ersten Semester zu Reinhard Kekulé nach Berlin zu wechseln, wo er 1893 seine Disserta-tion einreichte. Er erhielt 1895 das Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das er gemeinsam mit seinem Freund Theodor Wiegand (1864–1936) antrat. Wilhelm Dörpfeld (1853–1940) zog ihn gleich zu der Aufnahme der archaischen Skulp-turen auf der Athener Akropolis hinzu. Außerdem arbeitete er von 1895–1899 mit Wiegand in Priene – eine Grabung, die bis heute das Leben des Faches an der Goethe-Universität prägt. Wiegand und Schrader legten schon 1904 eine vorbildliche Gesamtpublika-tion der Grabungsergebnisse vor. Schrader wurde 1899 Direktorial-Assistent an den Berliner Museen. Von 1901 bis 1905 hatte er die Position des zweiten Direktors bzw. Sekretärs des Deutschen Archäolo-gischen Instituts in Athen inne. Zurück in der Universitätslandschaft übernahm er Professuren in Innbruck (ab 1905), Graz (ab 1908) und Wien (ab 1910), bevor er 1914 an die neugegründete Goethe-Universität nach Frankfurt a. M. berufen wurde. Schon 1930 musste er sich aus gesund-heitlichen Gründen aus dem Universitätsbetrieb zurückziehen. Er brachte jedoch noch gemeinsam mit Ernst Langlotz (1895–1978) und Walter-Herwig Schuchhardt (1900–1976) das Werk zu den archai-schen Marmorbildwerken der Akropolis (1939) zum Druck. Zu den besonders nachhaltigen Ergebnis-
Seite 28
sen seiner Forschung gehören seine detaillierten sorgfältigen Beobachtungen und Beschreibungen antiker Kunstwerke, sein Beitrag zur Rekonstruk-tion des Pergamonaltars und die Ergänzung des sog. Kritios-Knaben von der Athener Akropolis in einem kontrapostischen Aufbau. Außerdem gelang ihm die Rückgewinnung der Schildreliefs der Athena Parthenos aus neuattischen Kopien.
ABKEHR VOM KLASSIZISMUS: GIPSABGÜSSE ALS MEDIENGRIECHISCHER ORIGINALE
Den Grundstock für den Aufbau der Abguss-Samm-lung in Frankfurt bildeten die der neugegründeten Universität überlassenen Abgüsse des Städelschen Kunstinstituts. Schon bei seinen Berufungsverhand-lungen bemühte sich Schrader um die Einrichtung eines großen Oberlichtsaals nahe dem archäologi-
Oberlichtsaal der Gipsabguss-Sammlung des neugegründeten Archäologischen Instituts im Jügel-haus. Universitäts-archiv Frankfurt.Fotograf unbekannt
Seite 29
schen Seminar und den übrigen altertumswissen-schaftlichen Instituten im Jügelhaus, wobei die Stadt ihn unterstützte. Mithilfe des von Stadt und Universität festgeschriebenen Etats baute er die Städelsammlung zu einer Sammlung von Abgüssen griechischer Originale aus, die auch die monumen-talen Giebelskulpturen des Zeustempels von Olympia und der Tempel von der Athener Akropolis enthielt. Bis 1929 war die Sammlung von den 77 verzeichne-ten Städel-Abgüssen auf 497 inventarisierte Abgüsse angewachsen. Die Sammlung hatte ganz unmittelbaren Einfluss auf das Werk Schraders. So schreibt er in seiner Einlei-tung zu „Phidias“ (1924), dass seine Beschäftigung mit den Meistern der griechischen Skulptur aus dieser Aufgabe erwuchs. Auch bei seinen späteren Unternehmungen wie der Rekonstruktion der ar-chaischen Marmorgiebel auf der Athener Akropolis arbeitet er teilweise mit den Frankfurter Gipsabgüs-sen, unter denen auch Figuren der Mittelgruppe waren. Es war ihm ein Anliegen, der Sammlung
Zustand des Oberlicht-saales im Jahre 1993 mit Parthenonfries am ursprünglichen Ort.Foto Achim Ribbeck
Seite 30
seines Lehrstuhls möglichst viele griechische Kunst-werke hinzuzufügen, die im Original erhalten sind. Anders als die Archäologen des 19. Jhs. suchte er die großen klassischen Bildhauer nicht in römischen Kopien ihrer verlorenen Originale aus Bronze zu fassen, sondern in formverwandten Arbeiten von „Schülern“ unter den erhaltenen originalen Marmor-werken. Mehrere der im „Phidias“ besprochenen Werke hat-ten als Abgüsse Eingang in die Sammlung gefunden und wurden in gut ausgeleuchteten Neuaufnah-men in der Publikation abgebildet. Die Vorteile des direkten Vergleichs, den Abgüsse ermöglichen, fasst Schrader dort selbst in Worte: „Sehr lehrreich aber war es, den wohlerhaltenen nackten linken
Inventarbuch, Titelblatt, mit Vermerk der Kriegszerstörung
Seite 31
Unterschenkel und Fuß der Göttin neben dem am Fuß krauenden Knaben aus dem Ostgiebel zu be-trachten. Hier wie dort die gleiche Hand!“ Schrader verband seine Forschung unmittelbar mit der Lehre, so dass er die Sammlungen in seine Übun-gen einbeziehen konnte. Er betont in „Die archaisch-en Marmorbildwerke der Akropolis“ (1939) auch in Fragen der Beleuchtung und der Rekonstruktion der einstigen Aufstellung der Giebelfiguren die Vorteile der Abgussräume gegenüber beengten Museums-verhältnissen: “… um so mehr, als sich am Abguß die notwendige seitliche Verschiebung des Giganten nach r. ohne Schwierigkeiten durchführen ließ.“ Über seine Vorstellungen, in welcher Weise Plastik, Bauskulptur bzw. deren Abgüsse ideal aufgestellt
Titelblatt der in Frankfurt ver-fassten Untersuchung zur attisch-klassischen Skulptur.
Seite 32
werden müssten, sagte er wenig. Sein Einsatz für ei-nen großen Oberlichtsaal für die Frankfurter Samm-lung, die Befestigung des Parthenonfrieses in er-höhter Position, sein Interesse am damaligen Mu-seumsstreit um die Neuaufstellung des Pergamon-altars, seine würdigenden Worte in Reinhard Kekulés Nachruf zu dessen Aufstellung der Bonner Samm-lung und sein Lob anlässlich des Neubaus des Per-gamonmuseums im Nachruf auf Carl Humann lassen erahnen, was ihm wichtig war: eine dem zerstreuten Freilicht möglichst entsprechende Beleuchtung, eine Betonung originaler Künstlerarbeit auch in der Aufstellung, eine zweckmäßige Gliederung unter Heraushebung der Hauptstücke und eine Harmonie zwischen Baukörper, Raumwirkung und Aufstellung.
FARBIGE ZEUGNISSESchon während seiner Arbeiten in Priene und auf der Athener Akropolis beschäftigte er sich mit anti-ker Polychromie. Die Farbspuren auf den archaisch-en Skulpturenfragmenten der Athener Akropolis wurden für die Publikationen durch die Malerin Maria Henriques und durch Gilliéron père in Aquarell festgehalten. Schrader selbst fertigte Skizzen or-namentierter Gewandfragmente an, die er fotogra-fischen Aufnahmen zur Seite stellte. Vielleicht war es auch sein Interesse an der farbi-gen Antike, die 1924 zur Erwerbung zweier attischer weißgrundiger Lekythen mit polychromer Bemalung führte. Diese beiden Salbgefäße waren der Auftakt zum Aufbau einer Originalsammlung an seinem In-stitut.
Seite 33
ZERSTÖRUNG UND WIEDERAUFBAUSchraders häufige Abwesenheit am Lehrstuhl infolge seiner Krankheit bewirkte, dass konkurrierende Interessen die Sammlung aus ihren gefragten Räu-men drängte. Sie wurde in angemietete Räume der ehemaligen Union-Druckerei an der Bockenheimer Landstraße umgesetzt. In diesem Zustand ist eine der ältesten und reichsten Abguss-Sammlungen Deutschlands bei dem schweren Bombardement Frankfurts am 18. März 1944 zugrunde gegangen. Erhalten sind lediglich die am ursprünglichen Stand-ort verbliebenen, in die Wand eingemauerten Teile des Parthenonfrieses. Unmittelbar nach dem Krieg legte Guido Kaschnitz von Weinberg den Grundstock einer neuen Abguss-Sammlung, die 1960 unter Gerhard Kleiner im Insti-
Emile Gilliéron, Aquarell der Farb-spuren der Kore Athen Akropolis 675, Frankfurt Liebieghaus, Skulpturensammlung, nach Schrader 1939 Taf. II.
Seite 34
tut im neuen Philosophicum einen Platz fand und endlich wieder eine Kustodenstelle erhielt. Wulf Raeck und die derzeitige Kustodin Ursula Mandel haben u.a. Pergamenisches hinzuerworben und die bislang unterrepräsentierte Gattung der Porträts zu einem Schwerpunkt gemacht.
2001 erfolgte ein erneuter Umzug des Instituts in das I.G. Farben-Haus auf dem Campus Westend und mit ihm wurde im 7. Obergeschoss benachbart zum Raum der Originalsammlung ein neuer Skulp-turensaal mit Oberlicht für die Abguss-Sammlung eingerichtet. Neun große Abgüsse griechischer Meisterwerke lieh das Archäologische Institut der Universität des Saarlandes als Bereicherung des schönen Skulpturensaales aus.Inzwischen ist die Abguss-Sammlung dank privater Spender und der Unterstützung durch die Freunde und Förderer der Goethe-Universität wieder auf über 200 Stücke angewachsen. Nach wie vor ist sie ein unerlässliches Werkzeug in der Lehre.
Nadin Burkhardt und Ursula Mandel
Die Lehrstuhlinhaber Ernst Langlotz, Guido Kaschnitz von Weinberg, Gerhard Kleiner, Hans von Steuben.
Seite 35
LITERATUR
Th. Wiegand – H. Schrader, Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895–1898 (Berlin 1904).
H. Schrader, Nachruf R. Kekulé von Stradonitz (1939–1911), Bursian-Jahresberichte/Nekro-log BiographJbA 35. Jahrgang, Bd.164, 1913, 1–40.
H. Schrader, Phidias (Frankfurt am Main 1924).
H. Schrader, Der Entdecker von Pergamon: Carl Humann. Ein Lebensbild, Gnomon 8, 1932, 511–512.
H. Schrader (Hrsg.), Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis (Frankfurt am Main 1939).
M. Bieber, Nekrolog Hans Schrader, AJA 53, 1949, 58–59.
W.-H. Schuchhardt, Nachruf Hans Schrader (1869–1948), Gnomon 22, 1950, 418–420.
G. Wiegand (Hrsg.), Halbmond im letzten Viertel. Briefe und Reiseberichte aus der alten Türkei von Theodor und Marie Wiegand 1895 bis 1918 (München 1970, Neuausgabe 1985).
P. Hommel, Hans Schrader, in: R. Lullies – W. Schiering (Hrsg.), Archäologenbildnisse (Mainz 1988) 170–172.
U. Schädler, Hans Schrader und die Anfänge des Archäologischen Instituts, in: M. Herfort-Koch u. a. (Hrsg.), Begegnungen. Frankfurt und die Antike (Frankfurt am Main 1994) 337–346.
U. Mandel, Die Abgußsammlung des Städelschen Kunstinstitutes und ihre Erweiterung als Sammlung des Archäologischen Instituts der Universität, in: M. Herfort-Koch u. a. (Hrsg.), Begegnungen. Frankfurt und die Antike (Frankfurt am Main 1994) 231–252 und ebenda, Die Originalsammlung, 389–390.
W. Raeck, Hans Schrader, Neue Deutsche Biographie 23, 2007, 508–510.
W.-A. Schröder, Teuchos-Biogramm Schrader Hans. Philologische Biographien, Online-Version 15. 04. 2011, letzte Aktualisierung: 26. 10. 2012.
Seite 132
AUSSTELLUNGSVORBEREITUNG ALS TEIL DES STUDIUMS
DER KLASSISCHEN ARCHÄOLOGIESeit 1914 der erste Lehrstuhl für Klassische Archäolo-gie an der Goethe-Universität eingerichtet wurde, stehen Forschung, Sammlung und Lehre in enger Verflechtung. Daher waren auch für diese Ausstel-lung Studierende in die Vorbereitungen einbezogen und diese Teil der Lehre.
In drei aufeinanderfolgenden Semestern fanden Übungen rings um die Themen Objektrecherche, Ausstellungskonzeption, Objektdokumentation und -repräsentation statt. Die dort erbrachten Leistun-gen waren für relevante Module der Bachelor- und Magisterstudienordnung anrechenbar. Die Übungen standen allen interessierten Studierenden offen. Dank dem Förderprogramm der Goethe-Universität „Starker Start ins Studium“ wurden die Studieren-den bei ihren Arbeiten jeweils von Tutorien intensiv begleitet.Um die studentischen Aktivitäten über den Rahmen der Übungen hinaus sichtbar werden zu lassen, sind alle drei Veranstaltungen auf der Onlineplattform USE „Universität studieren. Studieren erforschen“ präsent. In diesem fachübergreifenden Lehrfor-schungsprojekt können Inhalte, Methoden und Ziele vorgestellt und die Ergebnisse der Studierenden veröffentlicht werden.
Die Arbeit begann mit einer Einführung in die Themen “Sammlung” und “Ausstellung”. Gemeinsam wurden Texte zur Sammlungsgeschichte und Samm-lungspraxis besprochen sowie wichtige Aspekte
Seite 133
unterschiedlicher Ausstellungskonzepte, Dokumen-tationsformen archäologischer Funde und Katalog-publikationen behandelt, einschließlich ästhetischer Problematiken. Um uns mit den Ansprüchen, Aufgaben und Beson-derheiten universitärer Sammlungen vertraut zu machen, besuchten wir die archäologischen Samm-lungen, die Modellsammlung des Instituts der Ge-schichte der arabisch-islamischen Wissenschaften an der Goethe-Universität und die universitäre Samm-lung in Gießen. Versuche unmittelbar am Objekt bestanden in Bestimmung und Dokumentation unpublizierter Stücke unserer Original- und Replikensammlungen (einschließlich angeleiteten Fotografierens durch Birgitta Schödel).
Der konkreten Vorbereitung unserer Ausstellung dienten Entwürfe zu Planung, Konzept, Öffentlich-keitsarbeit, Objektbeschriftung und Begleitmedien,
Objektfotografie unter fachfraulicher Anleitung von Birgitta Schödel. Foto Nadin Burkhardt
Seite 134
des weiteren Recherchen zu den für die Ausstel-lungspräsentation vorgesehenen Objekten und archäologischen Methoden sowie zur Instituts- und Sammlungsgeschichte. Für letztere benutzten die Studierenden das Universitätsarchiv der Goethe-Uni-versität und seine Datenbanken.Den Abschluss bildete der gemeinsame Aufbau der vom Designerteam „Zweizehn“ Mainz entworfenen Ausstellungsarchitekturen samt Aufziehen der Texte und Bilder auf die Tafeln. Die Ausstellung wird durch studentische Führungen begleitet.
Nadin Burkhardt
ARBEITSGRUPPEN DER AUSSTELLUNGSVORBEREITUNG
Leitung: Nadin Burkhardt, Michaela Dirschlmayer, Ursula MandelTutorien: Stephanie Armbrecht, Sebastian GampeStudierende: Thomas Böhler, Sophia Böhm, Saman-tha Feick, Jana Freund, Michelle Frost, Sebastian Gampe, Rebecca Hasenfuß, Juliane Heine, Petra Hülsen-Öhring, Patrick Kiefer, Benjamin Leukart, Laura Margielsky, Shagane Nersesyan, Jessica Pulver, Lukas Prawetz, Silke Ribbrock, Melanie Scheidler, Ben Schneider, Anne Sellung, Kathrin Thull, Christine Weid-lich, Hannah Zimmermann
Die Studierendenaktivitäten sind unter folgenden links zu finden:https://use.uni-frankfurt.de/das-archaeologische-objekt-in-universitaeren-sammlungen/ https://use.uni-frankfurt.de/jubiläumsausstellung-archäologie/ https://use.uni-frankfurt.de/objekt-kulturgeschichte/
Seite 142
IMPRESSUMAusstellungskonzeption:Sven Herkt (Zweizehn) und die Kuratorinnen
Ausstellungsgestaltung:Sven Herkt & Minh-Chau Luong für Zweizehn, Design & Kommunikationsberatung für Kultur & Wissenschaft. www.zweizehn.com
Ausstellungsaufbau: Michaela Dirschlmayer mit Michelle Frost, Jens Hajek, Marie Junghans, Patrick Kiefer, Anna Langgartner, Benjamin Leukart, Lukas Prawetz, Jessica Pulver, Axel Reuter, Silke Ribbrock, Anne Sellung, Kathrin Thull.
Ausstellungskuratorinnen: Taos Babour, Nadin Burkhardt, Ursula Mandel, Katharina Neumann, Claudia Pankau, Britta Rabe.
Herausgeber Broschüre: Institut für Archäologische Wissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Gestaltung und Entwurf: Zweizehn Design&Kommunikationsberatung, Mainzwww.zweizehn.com
Redaktion: Ursula Mandel und Britta Rabe
Layout und Satz: Britta Rabe
Druck: KANNE Graphischer Betrieb GmbH, Ginsheim
Auflage: 300
ISBN-Nr. 978-3-00-047350-0