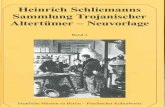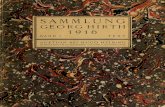D. Modl – J. Kraschitzer, Das „nacheiszeitliche“ Fundmaterial der Repolusthöhle aus der...
-
Upload
museum-joanneum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of D. Modl – J. Kraschitzer, Das „nacheiszeitliche“ Fundmaterial der Repolusthöhle aus der...
2
Schild von Steier26/2013/2014
ISBN978-3-902095-64-0
ISSN2078–0141
HerausgeberUniversalmuseum Joanneum GmbH Archäologie & Münzkabinett
RedaktionMarko Mele, Karl Peitler und Barbara Porod
LektoratMarko Mele, Karl Peitler und Barbara Porod
Grafische KonzeptionLichtwitz – Büro für visuelle Kommunikation
SatzBeatrix Schliber–Knechtl
DruckDravski tisk d.o.o.
Richtlinien zur Vorbereitung undAbgabe von Manuskripten finden sich unter:http://www.museum-joanneum.at/archaeologiemuseum-schloss-eggenberg/ueber-uns/publikatio-nen/schild-von-steier
Für den Inhalt der Beiträge sind die Autorinnen und Autoren verantwortlich.
Graz 2014
Vorwort
Revisionsprojekt „Repolusthöhle“
Daniel ModlDas Ausstellungsprojekt „Zeitenanfang – Die altsteinzeitlichen Funde aus der Repolusthöhle“ – Ein kurzer Rückblick auf 200 Jahre Höhlenforschung am Joanneum
Daniel Modl – Michael Brandl – Martina Pacher – Ruth Drescher-SchneiderAbriss der Erforschungsgeschichte der Repolusthöhle (Steiermark, Österreich) mit einem Bericht zu einer Feststellungsgrabung im Jahr 2010
Viola C. Schmid - Philip R. NigstDie Steinartefakte der Repolusthöhle (Steiermark, Österreich)
Monika DerndarskyUse-wear Analysis of the Chert Arte-facts of the Repolusthöhle/Repolust Cave (Styria, Austria)
Daniel Modl – Martina PacherDie Pseudoartefakte und der Wolfs-zahnanhänger aus der Repolusthöhle (Steiermark, Österreich) – Mit einem Diskussionsbeitrag zum Neandertaler und dem Mittelpaläolithikum im Südostalpenraum
Daniel Modl – Johanna KraschitzerDas „nacheiszeitliche“ Fundmaterial der Repolusthöhle aus der archäologi-schen Sammlung des Universalmuseums Joanneum
Martina PacherDie eiszeitliche Tierwelt der Repolusthöhle (Steiermark, Österreich) – Erste Ergebnisse der paläontologischen Untersuchungen
Michael Brandl – Christoph Hauzenberger – Walter Postl – Daniel ModlDer Hornstein im Becken von Rein (Steiermark, Österreich) –Rohmaterialquelle für die Artefakte der Repolusthöhle
Daniel Modl - Michael Brandl Aktueller Stand der archäologischen Forschungen im Becken von Rein unter besonderer Berücksichtigung einer im Jahr 2010 durchgeführten Probegrabung in der Hornsteinla-gerstätte Rein-Eisbach (Steiermark, Österreich)
Weitere Beiträge
Hubert Preßlinger – Clemens Eibner – Carsten CasselmannDie Grotte „Franz-Josephs-Höhe“ in der Flur Burgstallofen in Unterzei-ring, ein Höhlenfundplatz aus dem Paläolithikum – ein Vorbericht
Hubert Preßlinger – Clemens EibnerMetallographische und mikroanaly-tische Beurteilungsergebnisse von bronzezeitlichen Erz-, Schlacken- und Rohproduktproben
Julia RabitschDie Insula XXIII von Flavia Solva: Kleinfunde und Befunde aus den Grabungen der Karl-Franzens-Universität Graz und des Universalmuseums Joanneum von 2009 und 2010
Hubert Preßlinger – Clemens Eibner – Gerd HajekMetallurgische Bewertung römer-zeitlicher Gewandschließen (Fibeln) aus Oberzeiring
Barbara Kaiser – Sarah Kiszter – Marko Mele – Paul SchusterArchäologische Grabungen bei der Verlegung der Fernwärmeleitung in Schloss Eggenberg
Elfriede HaslauerAegyptiaca im Archäologiemuseum Schloss Eggenberg, Teil II: Die Mumie des Amun-Priesters Anch-pa-chrad in Kartonagehülle
6
8
28
98
166
176
212
238
256
280
310
316
324
344
350
392
5
das Murtal von Frohnleiten im Norden und jenes von Peggau–Deutschfeistritz im Süden trennt. Geologisch gesehen, liegt das Gebiet im rohstoffreichen und stellenweise stark verkarsteten Grazer Paläozoikum, was nicht nur die bis in das Hochmittelalter zurück-reichenden Bergbauspuren erklärt, sondern auch die zahlreichen Höhlenfundplätze. Das Fundmaterial dieser Höhlen reicht zum Teil bis in das Mittelpaläolithikum, wobei die Gründe für ihre Nutzung, wie Menge und Zusammensetzung des Fundmaterials zeigen, recht unterschiedlich gewesen sein dürften. Das Spektrum reicht von kurz– oder längerfristig genutzten Rast– bzw. Zufluchtsstätten über Kultplätze bis hin zu Bestattungshöhlen.4
2.1 Paläolithikum/Neolithikum
Da der Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags auf den der Altsteinzeit nachfolgenden Kulturepochen liegt, sollen die paläolithischen Höhlenfundplätze im Untersuchungsgebiet nur kurz gestreift werden.5 Mit der Repolusthöhle im Badlgraben6, der Tunnelhöhle (2784/2) am Kugelstein7 und der Lurgrotte (2836/1) bei Peggau8 existieren für das Mittelpaläolithikum drei, zum Teil überregional bedeutende Höhlenfundplätze, die vom Neandertaler als Jagdlager und temporäre Wohnstätten genutzt wurden. Bereits dem modernen Menschen sind dagegen die jungpaläolithischen Knochen– bzw. Steinartefakte aus der Großen Badl-höhle (2836/17) im Badlgraben9 oder der Bockhöhle (2836/163) am Tanneben10 zuzuschreiben. Durch Funde nicht sicher fassbar erscheint derzeit der Zeitabschnitt zwischen dem Ende des Jungpaläolithikums und dem beginnenden Mittelneolithikum. Das Mittel– bzw. Spätneolithikum wird im Untersu-chungsgebiet – abgesehen von vereinzelten Streu-funden geschliffener Steingeräte11 (und dazugehöriger
1 Einleitung
Die zeitliche Stellung der Steinartefakte und die einzigartige Höhlenfauna waren zwei der Ursachen, dass dem übrigen „nichteiszeitlichen” Inventar der Repolusthöhle (2837/11) bei Peggau seit Beginn der interdisziplinären Forschungen Maria Mottls vor über 65 Jahren nur wenig Beachtung zuteil wurde. Dieses in seiner Menge überschaubare und vom Neolithikum bis in die Neuzeit reichende Fundmaterial konnte im Zuge der Vorarbeiten zum Ausstellungsprojekt „Zeitenan-fang – Die altsteinzeitlichen Funde der Repolusthöhle“ am Universalmuseum Joanneum nun ebenfalls einer Neubearbeitung zugeführt werden2 und lädt ein, sich erneut mit der archäologischen Fundlandschaft rund um die Repolusthöhle zu beschäftigen. Die günstige verkehrsgeografische Lage und die besonderen geo-morphologischen Gegebenheiten machten die Region um Peggau–Deutschfeistritz (Abb. 1) nicht nur in der Vergangenheit zu einem bevorzugten Siedlungsgebiet mit zahlreichen bekannten archäologischen Fundstel-len und Hinterlassenschaften, sondern seit 175 Jahren auch zu einem leicht erreichbaren Forschungsziel, wodurch das Gebiet heute zu den am besten prospek-tierten der Steiermark gehört.
2 Archäologische Fundstellen und Siedlungs– strukturen im Raum Peggau–Deutschfeistritz
In dem auf dem Kartenausschnitt (Abb. 2) dargestell-ten Untersuchungsgebiet befinden sich mit den inner-alpinen Tal– bzw. Beckenlandschaften von Frohnleiten, Peggau–Deutschfeistritz, Übelbach und Semriach vier, zum Teil über viele Jahrtausende bewohnte Siedlungs-kammern.3 Von besonderer strategischer und verkehrs-geografischer Bedeutung für das Gebiet ist die Murtal-enge zwischen der Badlwand und dem Kugelstein, die
Das „nacheiszeitliche“ Fundmaterial der Repolusthöhle aus der archäologischen Sammlung des Universalmuseums JoanneumDaniel Modl – Johanna Kraschitzer
212
Abb. 1 Blick vom Kirch-berg bei Deutsch-feistritz nach Nordosten in Rich-tung Kugelstein, Badlgraben und Peggauer Wand. Foto: D. Modl.
Abb. 2 Archäologische Fundstellen (u. a. Höhlen, Siedlun-gen, Gräber, Depots, Einzel–funde) und histo-rische Bergwerke, Kirchen und Wehr-anlagen zwischen Frohnleiten, Sem-riach, Kleinstübing und Waldstein. Grafik: D. Modl. Kartengrundlage: GIS–Steiermark.
213
der Anhöhen und Höhlen dürfte es sich jedoch nur um temporäre Ausnahmen handeln, da die Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln schwieriger war als im Tal. Die Niederlassungen in der Ebene kann man sich als einzelne Gehöfte und Gehöftgruppen oder kleine dörfliche Siedlungen mit umgebendem Acker– und Weideland vorstellen. Dass in ihrer unmittelbaren Nähe auch die dazugehörigen Gräber zu suchen sind, zeigt ein möglicher Grabbefund in Kleinstübing, wo bei Bau-maßnahmen zufällig eine Steinpackung mit Resten von fünf Keramikgefäßen angeschnitten wurde43. Abgerun-det wird das Fundspektrum durch die urnenfelderzeitli-chen Bronzedepotfunde von Peggau44 und Waldstein45 sowie durch einige zum Teil nicht genau lokalisierbare Einzelfunde bzw. mögliche Einzeldeponierungen, wie z. B. durch das Fragment einer Messerklinge zwischen Waldstein und Hungerturm und ein Lappenbeil von der Badlwand sowie eine Tüllenlanzenspitze mit geripptem, geflammtem Blatt und ein Riegseeschwert mit dem gemeinsamen Fundort „Peggau“.46
Während für die Hallstattzeit ein auffälliger Mangel an Fundstellen in der Region zu konstatieren ist47, können für die Latènezeit neben zwei Münzfunden48 und kera-mischen Streufunden am Kugelstein49 bzw. bei Greith50 und aus diversen Höhlen51 vor allem Gräber angeführt werden. Hierzu zählen das Flachgräberfeld von Schrauding52 und ein Brandgrab in Kleinstübing53.
2.3 Römerzeit/Spätantike
Von besonderer siedlungsgeografischer Bedeutung für die Römerzeit ist die auf der rechten Murseite verlau-fende Staatsstraße, die sich heute noch am Ostabhang des Kugelsteins als Altweg auf einer Länge von meh-reren Hundert Metern im Gelände verfolgen lässt.54 Zur Infrastruktur dieser Straßentrasse gehören auch zwei römische Meilensteine55 und die sogenannte „Römer-brücke“ bei Adriach56, südlich bzw. westlich des Kugel-steins. Im Zusammenhang mit der Römerstraße ist wohl auch der Münzschatzfund von Adriach zu sehen, der nach 253 n. Chr. im Nahbereich der Trasse südlich der heutigen Murwehr Adriach vergraben wurde.57
Die Murtalstraße wiederum wurde von einer befestigen Höhensiedlung am Plateau des Kugelsteins kontrolliert, wo durch Grabungen stellenweise eine dichte kaiser-zeitliche und spätantike Verbauung nachgewiesen werden konnte.58 Darunter auch ein größerer Rechteck-bau, der als Tempel für Herkules und Viktoria gedeutet wurde, jedoch seit kurzem als frühchristliche Kirche interpretiert wird.59 Weitere spätantike Siedlungsreste sind vom östlichen Hangfuß des Kugelsteins bekannt.60 Aus der Tropfsteinhöhle (2784/3) und der Tunnelhöhle am Kugelstein sind neben diversen Befunden zwei „Schlangengefäße“ und ein Elfenbeinrelief mit der Dar-stellung eines geflügelten Eros bekannt, die zum Teil in einem möglichen Zusammenhang mit Kulthandlungen gesehen werden.61 In einigen Peggauer und Semriacher
Bohrkerne) u. a. aus der Gegend um Frohnleiten12, Peggau13, vom Schartnerkogel14, Deutschfeistritz15, Waldstein16, Semriach17 und Stübing18 – vor allem durch Siedlungsspuren der Lasinja–Kultur (?) im Bereich des Bahnhofs Stübing19 und durch Keramik bzw. Skelett-reste aus den Höhlen im Raum Peggau und Semriach repräsentiert. Besonders erwähnenswert erscheint in Menge und Qualität die Furchenstichkeramik20 aus dem Bereich des Katzensteigs der Lurgrotte–Semriach21 und der Leopoldinengrotte (2832/11) im Kesselfall nahe Semriach22, das reiche kupferzeitliche Fundmaterial der Steinbockhöhle (2836/23)23 sowie die zeitglei-chen Bestattungen einer Frau in der Josefinengrotte (2836/32) bei der Lurgrotte–Peggau24 und eines Kindes in der Grabhöhle (2784/5) am Kugelstein25. An dieser Stelle muss auch der Sinterplattenabbau am Katzen-steig in der Lurgrotte–Semriach erwähnt werden, der durch U/Th–Analysen in den Zeitraum zwischen der Kupfer– und Bronzezeit datiert wurde.26
2.2 Bronzezeit/Eisenzeit
Unklarheit herrscht über die Besiedlung und Nutzung der Region in der frühen und mittleren Bronzezeit.27 Aus der frühen Bronzezeit existiert mit dem Stabdolch aus der Großen Badlhöhle ein exzeptioneller, jedoch isolierter Einzelfund, der als Opfergabe absichtlich in der Höhle deponiert worden sein dürfte.28 Das aus den übrigen Höhlen, wie z. B. der Steinbockhöhle29, der Peggauer–Wandhöhle I (2836/35)30 oder der Großen Peggauer-Wandhöhle (2836/39)31, bekannte kerami-sche Fundmaterial ist dagegen etwas schwerer zeitlich einzuordnen, belegt aber temporäre Höhlenaufenthalte in der Mittelbronzezeit. Mit einer Fundstelle östlich des Ortskerns von Deutschfeistritz (Feldboden) ist bislang lediglich ein potenzieller mittelbronzezeitlicher Sied-lungsplatz im flussnahen Talbodenbereich bekannt.32 Dieses bruchstückhafte Siedlungsbild ändert sich erst in der späten Bronzezeit bzw. Urnenfelderzeit - Epochen, für die sich durch entsprechendes Fundmaterial Tal– und Talrandsiedlungen bei Adriach nahe Frohnleiten33, Muhrhof–Wehr34, Schrauding35 und Kleinstübing36 sowie befestigte/unbefestigte Höhensiedlungen am Kugelstein37, Kugelberg38, bei Badl39 und den westlichen, zur Mur hin gerichteten, spornartigen Ausläufern des Hochtrötsch nachweisen lassen. Bei Letzteren handelt es sich um den Weingartner Kogel östlich von Schrau-ding, den Kästelberg südlich von Ungersdorf und den Geländesporn mit der Ruine Alt–Pfannberg.40 Durch spätbronzezeitliche/urnenfelderzeitliche Kera-mikfragmente ist auch die Anwesenheit des Menschen in den Höhlen des Raums Peggau und Semriach mehr-fach belegt, jedoch lassen die nur vereinzelt auftreten-den Reste – mit Ausnahme der Steinbockhöhle, wo mit Hüttenlehmstücken auch Hinweise zu möglichen Ein-bauten existieren41 – keine weitergehende Aussagen zur genauen Nutzung der Höhlen zu.42 Bei der Besiedlung
214
Zwischen der Mitte des 11. und der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts werden dann die heutigen Ortschaften Peggau (1050), Adriach (1066), Deutschfeistritz und Stübing (1130/1147), Semriach (1212) und Übelbach (2. Hälfte 13. Jh.) erstmals urkundlich erwähnt oder, wie im Fall von Frohnleiten (1276), überhaupt erst zum Schutz der dortigen Murbrücke gegründet.85 Als Keimzelle dieser Ansiedlungen dienten meist romanische oder gotische Kirchenbauten, wie z. B. Hl. Georg/Adriach, Hl. Ägydius/Semriach, Hl. Martin/Deutschfeistritz oder Hl. Margaretha/Peggau.86 Die Epoche der Traungauer und Babenberger war auch die große Zeit des Burgenbaues in der Steiermark, wovon im Untersuchungsgebiet heute noch die Burgruinen Alt–Pfannberg, (Alt–)Rabenstein, Peggau, Alt–Wald-stein/Hungerturm, Henneburg, Forchtenberg und Luegg eindrucksvoll zeugen.87 Der im 12. Jahrhundert errich-tete Wehrbau von Stübing ist heute Kern eines im 19. Jahrhundert errichteten Schlosses im Windsor–Stil.88 Hinzu kommen vom Übergang des Hoch– ins Spätmit-telalter noch Reste kleinerer Wehrbauten, wie z. B. am Mautbichl bei Badl oder in Schönegg.89
Bis ins Spätmittelalter bzw. die frühe Neuzeit reichen auch die ersten urkundlichen Quellen zurück, die vom Bergbau und der Gewinnung von Blei bzw. Silber in die-sem Raum berichten - Aktivitäten, die im 18./19. Jahr-hundert ihren Höhepunkt erreichten.90 Bereits um 1650 betrieben die Fürsten von Eggenberg in Waldstein eine Münzstätte, in der das in der Umgebung gewonnene Silber ausgeprägt wurde.91 Mit Nutzung der Wasserkraft als Energiequelle sind ab dem Ende des 16. Jahrhun-derts auch die ersten Eisenhammerwerke im Raum Deutschfeistritz und Übelbach nachweisbar.92 Trotz der Prosperität im Tal blieben die Höhlen des Raumes Peggau/Semriach das gesamte Mittelalter hindurch bis weit in die Neuzeit wichtige Zufluchtsorte (z. B. Fran-zosenkriege von 1797–180993), wie das archäologische Fundmaterial aus gut 30 Höhlen, darunter auch der Repolusthöhle, zeigt.
Höhlen belegen Keramik– und Münzfunde sowie Gru-ben und Planierungen eine intensive Nutzung in der römischen Kaiserzeit.62
Weitere römische Siedlungsreste konnten in Adriach bei Frohnleiten63, in Zitoll beim Anwesen Deutsch vlg. Gruber64, Peggau(–Hinterberg)65, Neudorf (Haslach-acker)66 und in Kleinstübing67 nachgewiesen werden, wobei es sich bei den über eine größere Fläche verteilten Gebäuderesten in Kleinstübing wohl nicht um eine typische Villa rustica handeln dürfte. Abge-rundet wird das Siedlungsbild durch heute nicht mehr existierende68 römische Hügelgräber unterhalb des Kugelsteins69 und nahe der Badlwand70 sowie durch ein Hügelgrab im Markterviertel bei Semriach71. Hinzu kommen noch ein kaiserzeitliches Grabhäuschen in Peggau72 und ein Brandgrab in Waldstein73 sowie spätantike Körpergräber bei Kleinstübing74 bzw. Greith75. Komplementiert wird das römische Fundbild durch Inschriftsteine aus Kleinstübing, vom Kirchberg bei Deutschfeistritz, aus Prenning, vom Plateau des Kugelsteins und südlich davon (Leich[t]bauer–Wiese), aus Waldstein und aus dem Raum Semriach sowie von der Burgruine Pfannberg und aus Adriach.76 In diesem Zusam-menhang ist anzumerken, dass einige der Steine als Spo-lien in Kirchen und Burgen vermauert sind, weshalb man in diesen Fällen aber nicht auf kaiserzeitliche Gräber in der unmittelbaren Umgebung rückschließen darf.
2.4 Mittelalter/Neuzeit
Abgesehen von den frühmittelalterlichen Siedlungs-resten vom Deutschfeistritzer Kirchberg77, die dort eine frühe Mittelpunktburg vermuten lassen, und einigen Keramikfunden aus den Höhlen des Kugel-steins bzw. der Peggauer Wand (z. B. Tropfsteinhöhle [2784/3]78 und Halbhöhle [2836/22]79) stützt sich die archäologische Forschung für das 8. bis 10. Jahr-hundert ausschließlich auf Grabfunde. Einzelgräber und Gräberfelder liegen vom Fuß des Kirchbergs von Deutschfeistritz80, aus Peggau(–Hinterberg)81, Wald-stein82 und aus dem Bereich des bereits genannten latènezeitlichen Gräberfeldes von Schrauding83 sowie aus Pichelhof84 vor.
Abb. 3 (a) Adaptiertes Profil der Repo-lusthöhle mit den im Text erwähnten Fundschichten im Vorhof und Gang-bereich – (1) neu-zeitliche Aufschüttung, (2) Humus, (3) gelb-brauner Gehänge-lehm, (4) „eiszeitlicher“ Murmeltierabraum und (6) grau-braune, erdige Schicht – sowie (b) Grundrissplan mit Bezeichnung der wichtigsten Höh-lenteile. Grafik: D. Modl. Plangrund-lage: Mottl 1951, Abb. 4 u. 5.
215
ihren Beschriftungszetteln, die den Funden beilagen, kein Hinweis mehr. Nach diesen Aufzeichnungen stam-men mit Ausnahme des Serpentinitbeils und der beiden Knochenartefakte (Kat.–Nr. 1–3), die dem gelbbraunen Gehängelehm zuzuordnen sind, alle im nachfolgenden Katalog beschriebenen Objekte (Kat.–Nr. 4–38) aus der Humusschicht (Abb. 4).
Die Funde wurden damals von ihrem Vorgesetzten am Joanneum, dem Landesarchäologen Walter Schmid, bestimmt und der Hallstatt–, Latène– und Römerzeit sowie der Zeit der Franzosenkriege zugeordnet. Diese Angaben fanden daraufhin eine weite Verbreitung in der Fachliteratur. Bei Kenntnis von Schmids eigenwilligen Ansprachen und Datierungen von archäologischer Gefäßkeramik – man denke in diesem Zusammenhang nur an Noreia oder die Ostnorische Retentionskultur100 – hätten seine Angaben jedoch nicht ohne weitere kri-tische Prüfung von anderen Bearbeitern übernommen werden dürfen. Dies wird deutlich bei der in der Fachli-teratur erwähnten latène– und römerzeitlichen Keramik aus der Repolusthöhle101, die – vorausgesetzt, dass kein Fundmaterial seit den 1990er–Jahren verloren ging – vollständig späteren Zeitperioden zuzurechnen ist, wie die nachfolgende Revision des Fundmaterials zeigt. Besonders bedauerlich ist, dass bislang der Verbleib von drei Steinartefakten, die von Mottl102 als Schaber bzw. Kratzer aus blau-braunem „Chalzedon“ (UMJ, Inv.-Nr. 15.662–15.664; Abb. 5) beschrieben wurden, nicht geklärt werden konnte. Sie stammen aus der im vorderen Höhlenteil über dem grauen Sand liegenden graubraunen, erdigen Schicht (Quadranten 5, 7, 16) und sind von Mottl zunächst ohne Diskussion und in den 1970er–Jahren schließlich doch mit Vorbehalt103 in das Aurignacien datiert worden. Aufgrund der publizierten Fundzeichnungen und der daraus ableitbaren Charak-teristika, wie z. B. die annähernd rechteckige Form, die umlaufende Retouchierung, die geringe Größe und Materialstärke sowie in einem Fall eine typische Abnutzungskerbe, liegt jedoch der Verdacht nahe, dass es sich hierbei in Wirklichkeit um Flintensteine aus dem 19. Jahrhundert handelt.104 Ähnliche Stücke wurden auch in aurignacienzeitlichen Freilandstationen Sloweniens gefunden und dort aus dem jungpaläolithi-schen Fundmaterial ausgesondert.105
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch ein neuzeitlicher Einbau in die Repolusthöhle erwähnt, bei dem es sich um eine Steinmauer mit dahinterliegender Anschüttung im Eingangsbereich handelte, die vom Höhlenforscher Hermann Bock bereits in den 1920er–Jahren großteils abgetragen wurde (Abb. 3).106
3 Fundgeschichte, Stratigraphie und bisherige Datierung
Laut den erhaltenen Fundzetteln und der grundle-genden Grabungspublikation Mottls aus dem Jahr 195194 entstammt das in der Abteilung Archäologie & Münzkabinett am Universalmuseum Joanneum ver-wahrte prähistorische bis rezente Fundmaterial aus der Repolusthöhle ihren archäologischen Untersuchungen der Jahre 1947/48.94 Dieses Fundmaterial wurde von Mottl zwei stratigraphischen Einheiten zugeordnet (Abb. 3), einerseits einer unterschiedlich mächtigen Humusschicht, die als geschlossenes Schichtpaket vom Vorhof der Höhle über die beiden Eingänge bis ungefähr zu Laufmeter 18 im Horizontalgang der Höhle verlief und im hinteren Höhlenteil mit dem „eiszeitlichen Murmeltierabraum“ vermischt war, und einem darun-terliegenden, gelbbraunen Gehängelehm, der ebenfalls im Vorhof– bzw. Eingangsbereich der Höhle seinen Ausgang nahm, aber nur bis zu Laufmeter 3 reichte.
Nach Mottl96 enthielt die Humusschicht im Bereich des kleineren Höhleneingangs – von ihr auch als „Seitennische“ bezeichnet – „viele Hallstatt– und La Tène–Scherben“ sowie römische Kulturreste, während sich „im rückwärtigen Teil der Höhle die Feuerstelle mit Funden aus napoleonischer Zeit“ (Profil 24) befand. Laut einer Faunentabelle in der Grabungspublikation von 195197 wurden im Humus auch Menschenknochen (Homo sapiens) gefunden, die jedoch nicht näher bestimmt wurden und auch in keiner der Sammlungen des Joanneums identifiziert werden konnten. Der gelb-braune Gehängelehm wies nach Mottl98 neben weiteren Keramikfragmenten „einen Knochenpfriem und ein neolithisches Beil aus Amphibolit“ auf.
Dieser stratigraphischen Zuordnung widerspricht jedoch teilweise ein unpublizierter Bericht Mottls99 zu ihren ersten Probeschnitten in der Repolusthöhle im Jahr 1947, wonach Keramikfragmente „in der rotbrau-nen und grauen Ablagerung, sowie in den oberen Lagen der braunen Phosphaterde“ gefunden wurden. Weiters heißt es dort: „Die Anwesenheit rezenter Knochen und Topfscherben auch noch in grösserer Tiefe erweckte vorerst den Gedanken, dass die Ausfüllung durch spätere Wassertätigkeit umgelagert worden wäre. […] Im Laufe der weiteren Grabungen ergab sich dann eine andere Lösung. Die Höhle ist nämlich in ung. 0.5 bis 1.5 m Tiefe mit noch gut erhaltenen, weitverzweigten Murmeltierbauten durchdrungen.“ Es dürften demnach Murmeltiere einzelne Keramikfragmente auch in die später von Mottl als grauen Sand und rostbraune Phosphaterde bezeichneten Hauptfundschichten der Repolusthöhle vertragen haben, doch dazu findet sich in den späteren Publikationen Mottls, wie auch auf
216
4.1 Abkürzungen
AS: AußenseiteBR: BruchBS: Bodenstück Dat.: DatierungH./erh. H.: Höhe/erhaltene HöheIS: InnenseiteKat.–Nr.: KatalognummerL./erh. L.: Länge/erhaltene LängeLit.: LiteraturOberfl.: OberflächeRDm.: RanddurchmesserRS: RandstückT.: TiefeWS: Wandstück
4 Fundmaterial
Das Fundmaterial – alle Objekte werden im Universal-museum Joanneum verwahrt, weitere prähistorische Keramikfunde im Privatbesitz107 oder im Eigentum des Landesvereins für Höhlenkunde in der Steiermark, Graz108, blieben unberücksichtigt – besteht aus knapp 200 Keramikbruchstücken von Gefäßen unterschied-lichster Zeitstellung109, einem hallstattzeitlichen Spinnwirtel, diversen neuzeitlichen Metallfragmenten von Werkzeugen, zwei Schleifsteinen aus Sand– bzw. Speckstein, dem Nackenteil eines (mittel–)neolithi-schen Beils aus Serpentinit110 und einem länglichen Amphibolit–Geschiebe ohne Arbeitsspuren sowie zwei neolithischen Knochenartefakten und drei rezenten, angekohlten Holzresten/Kienspänen (Abb. 6–9). Die Keramik unterscheidet sich entsprechend ihrer zeit-lichen Einordnung in Magerung, Oberflächenbeschaf-fenheit, Brandführung, Scherbenhärte etc. Die Zuord-nung einzelner Scherben zu bestimmten Gefäßtypen und die damit einhergehende Datierung kann in einigen Fällen aufgrund der Kleinteiligkeit und des Fehlens charakteristischer Verzierungen oder Angarnierungen nur mit Vorbehalt erfolgen. Im folgenden Katalog wurde deshalb nur jenes Fundmaterial berücksichtigt (insgesamt 38 Objekte), das sich mit einiger Sicherheit ansprechen und datieren ließ.111
Abb. 5Strittige Funde aus der Repolusthöhle: aurignacienzeit-liche Schaber bzw. Kratzer aus „Chalzedon“ oder neuzeitliche Flin-tensteine? Quelle: Mottl 1950, Taf. VI/57–59.
Abb. 4Beschriftungs-zettel von Maria Mottl aus den 1970er–Jahren, der einigen bronze– und hall-stattzeitlichen sowie frühmittel-alterlichen Fun-den beilag. Quelle: UMJ, AArchMk.
217
Kat.–Nr. 7 (Inv.-Nr. 26.092), Abb. 6/7Objektbezeichnung: BS eines TopfesMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. 6,4 cmMagerung: mittel, Körnchengröße fein bis mittel, vereinzelt weiße PartikelFarbe: dunkelgrau (AS); stark versintert (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: sorgfältig geglättetDatierung: Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit
Kat.–Nr. 8 (Inv.-Nr. 26.093), Abb. 6/8Objektbezeichnung: WS mit Schulter–/Hals–UmbruchMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 3,4 cmMagerung: stark, Körnchengröße fein, reichlich feiner GlimmerFarbe: dunkelbraun bis –grau (AS); dunkelbraun bis –grau (IS); dunkelbraun bis –grau (BR)Oberfläche: rauAngarnierung: HenkelansatzDatierung: Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit
Kat.–Nr. 9 (Inv.-Nr. 26.094), Abb. 6/9Objektbezeichnung: WSMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 3,3 cmMagerung: stark, Körnchengröße fein, reichlich feiner GlimmerFarbe: dunkelbraun bis –grau (AS); dunkelbraun bis –grau (IS); dunkelbraun bis –grau (BR)Oberfläche: rauAngarnierung: zwei horizontal nebeneinander angeordnete, spitze KnubbenDatierung: Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit
Kat.–Nr. 10 (Inv.-Nr. 26.095), Abb. 6/10Objektbezeichnung: WSMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 4 cmMagerung: mittel, Körnchengröße fein, vereinzelt weiße PartikelFarbe: rotbraun (AS); mittelbraun (IS); dunkelgrau, außen und innen dünne rotbraune Zone (BR)Oberfläche: sorgfältig geglättet, außen stellenweise versintertAngarnierung: deutlich vom Gefäßkörper abgesetzte, mittig eingedrückte KnubbeDatierung: Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit
4.2 Katalog
Kat.–Nr. 1 (Inv.-Nr. 25.189), Abb. 6/1Objektbezeichnung: Nackenfragment eines Beils mit ovalem QuerschnittMaterial: SerpentinitMaße: L. 12 cm, Br. 4,6 cm; H. 2,2 cm; Gew. 127,9 gDatierung: Mittelneolithikum (Lengyel) oder Spätneolithikum/Kupferzeit
Kat.–Nr. 2 (Inv.-Nr. 25.187), Abb. 6/2Objektbezeichnung: SpitzeMaterial: KnochenMaße: L. 10,8 cm; Br. 5,1 cm; H. 2,7 cmDatierung: Spätneolithikum/Kupferzeit
Kat.–Nr. 3 (Inv.-Nr. 25.188), Abb. 6/3Objektbezeichnung: MeißelMaterial: Knochen (Ulna/Elle eines Huftiers)Maße: L. 5,2 cm; Br. 1,3 cm; H. 0,6 cmDatierung: Spätneolithikum/Kupferzeit
Kat.–Nr. 4 (Inv.-Nr. 26.089), Abb. 6/4Objekt: WS eines Topfes (?)Material/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 6,9 cmMagerung: mittel, Körnchengröße grobFarbe: rotbraun bis dunkelgrau (AS); rotbraun bis dunkelgrau (IS); rotbraun bis dunkelgrau (BR)Oberfläche: zerklüftet, erodiertAngarnierung: wandständiger BandhenkelDatierung: Spätneolithikum/Kupferzeit oder Bronzezeit (?)
Kat.–Nr. 5 (Inv.-Nr. 26.090), Abb. 6/5Objektbezeichnung: WS eines TopfesMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 6,2 cmMagerung: mittel, Körnchengröße mittelFarbe: dunkelbraun (AS); dunkelbraun (IS); dunkelbraun (BR)Oberfläche: rauAngarnierung: wandständiger BandhenkelDatierung: Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit
Kat.–Nr. 6 (Inv.-Nr. 26.091), Abb. 6/6Objektbezeichnung: BS eines Topfes (?)Material/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. 4,3 cmMagerung: mittel, Körnchengröße feinFarbe: stark versintert (AS); dunkelgrau (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: geglättetDatierung: Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit
218
Kat.–Nr. 15 (Inv.-Nr. 26.100), Abb. 6/15Objektbezeichnung: doppelkonischer Spinnwirtel mit eingezogener OberseiteMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: Dm. 4,2 cm; St. 2,2 cm; LochDm. 0,6 cmMagerung: stark, Körnchengröße mittel bis grobFarbe: rotbraun (AS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: rauVerzierung: schwache, radial angeordnete RitzungenDatierung: Hallstattzeit
Kat.–Nr. 16 (Inv.-Nr. 26.101), Abb. 7/16Objektbezeichnung: WS eines Kegelhalsgefäßes (?)Material/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 7 cmMagerung: mittel, Körnchengröße fein bis mittelFarbe: schwarz bis schwarzbraun, mit roten Farbresten und möglicherweise einem Grafitüberzug (AS); stark versintert (IS); stark versintert (BR)Oberfläche: geglättetVerzierung: Reste einer roten Bemalung (Hämatit)Datierung: Hallstattzeit (?)
Kat.–Nr. 17 (Inv.-Nr. 26.102), Abb. 7/17Objektbezeichnung: WS einer Schale (?)Material/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 3,9 cmMagerung: fein, Körnchengröße feinFarbe: hellgrau, mit roten Farbresten (AS); hellgrau (IS); hellgrau (BR)Oberfläche: poliertVerzierung: Reste einer roten Bemalung (Hämatit) mit senkrechten (?) StreifenDatierung: Hallstattzeit (?)
Kat.–Nr. 18 (Inv.-Nr. 26.103), Abb. 7/18Objektbezeichnung: 1 RS und 2 WS eines TopfesMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: RDm. 14,4 cm (23 %); erh. H. 7,8/4,4/2,9 cmMagerung: stark, Körnchengröße grob, vereinzelt KalzitFarbe: mittelbraun bis dunkelgrau (AS); dunkelgrau (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: geglättetVerzierung: WellenbandDatierung: Frühmittelalter, 8./9. Jahrhundert
Kat.–Nr. 11 (Inv.-Nr. 26.096), Abb. 6/11Objektbezeichnung: WS eines TopfesMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 6,6 cmMagerung: stark, Körnchengröße fein bis mittel, reich-lich Quarz und GlimmerFarbe: dunkelgrau bis –braun (AS); dunkelgrau (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: geglättetAngarnierung/Verzierung: ovale Knubbe, daneben eine Linienverzierung (?) in der Form eines WinkelsDatierung: Mittelbronzezeit/Spätbronzezeit
Kat.–Nr. 12 (Inv.-Nr. 26.097), Abb. 6/12Objektbezeichnung: RS eines Topfes oder einer Schüs-sel mit gerade abgestrichem RandMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 5,9 cmMagerung: stark, Körnchengröße fein bis mittel, ver-mehrt weiße Partikel und KalzitFarbe: mittelbraun, stellenweise dunkelbraun–fleckig (AS); mittelbraun bis dunkelgrau (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: sorgfältig geglättetDatierung: Urnenfelderzeit (?)
Kat.–Nr. 13 (Inv.-Nr. 26.098), Abb. 6/13Objektbezeichnung: RS eines Topfes (?) mit leicht ein-ziehendem, schräg nach ihnen abgestrichenem RandMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. ca. 6,6 cmMagerung: mittel, Körnchengröße fein, vermehrt feine QuarzpartikelFarbe: beige bis dunkelgrau (AS); hellorange–beige, Oberfläche größtenteils abgeplatzt (IS); mittelbraun (BR)Oberfläche: sorgfältig geglättetDatierung: Urnenfelderzeit (?)
Kat.–Nr. 14 (Inv.-Nr. 26.099), Abb. 6/14Objektbezeichnung: WS eines TopfesMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. 6,8 cmMagerung: mittel, Körnchengröße mittelFarbe: dunkelgrau bis –braun (AS); dunkelgrau bis –braun (IS); dunkelgrau, außen dicke dunkelbraune Zone (BR)Oberfläche: sorgfältig geglättet, stellenweise stark versintertVerzierung: applizierte Leiste mit horizontalem Kerb-schnittDatierung: Urnenfelderzeit
219
Kat.–Nr. 24 (Inv.-Nr. 26.109), Abb. 8/24Objektbezeichnung: 2 RS und 1 WS eines Topfes, KragenrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 18 cm (21+20 %); erh. H.: 21,2 cmMagerung: mittel, Körnchengröße fein bis mittelFarbe: orange–mittelbraun (AS); Rand– und Halszone dick dunkelgrün glasiert, darunter stark verwitterte farblose Glasur (IS); orange–mittelbraun, innen dicke dunkelgraue Zone (BR)Oberfläche: außen zurückhaltend körnigDatierung: 16. Jahrhundert
Kat.–Nr. 25 (Inv.-Nr. 26.110), Abb. 8/25Objektbezeichnung: 3 RS eines Henkeltopfes; KragenrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 14,4 cm (26+23+13 %); erh. H. 12,7 cmMagerung: schwach, Körnchengröße fein, vereinzelt dunkle Partikel bis 1,5 mm Dm.Farbe: orange–mittelbraun (AS); dünne grüne bis gelblichgrüne Glasur, stellenweise orangefleckig (IS); orange–mittelbraun (BR)Oberfläche: außen geglättetAngarnierung: randständiger Bandhenkel, Ansatz einer gezogenen AusgussmuldeDatierung: 16./17. Jahrhundert
Kat.–Nr. 26 (Inv.-Nr. 26.111), Abb. 8/26Objektbezeichnung: RS eines Topfes, innen verstärkter LeistenrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 17,2 cm (7 %); erh. H. 1,8 cmMagerung: schwach, Körnchengröße feinFarbe: hellbraun bis orange–mittelbraun (AS); weißlich–hellgrüne Glasur (IS); orange–mittelbraun (BR)Oberfläche: außen zurückhaltend körnigDatierung: 17.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 27 (Inv.-Nr. 26.112), Abb. 8/27Objektbezeichnung: 2 RS, 2 BS und mehrere WS eines Topfes, langgezogener KragenrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 17,2 cm (39+22 %); erh. H.: 6,3/8,2 cm; BDm. 12,3 cmMagerung: schwach, Körnchengröße fein bis mittelFarbe: fleckig dunkelgrau bis –braun (AS); Halszone dick dunkelgrün glasiert, darunter orange–mittelbraune Glasur (IS); mittel– bis dunkelgrau (BR)Oberfläche: sorgfältig geglättet; stellenweise mit Rost-spuren oder ankorrodiertem Eisendraht (Drahtbindung einer Reparatur)Datierung: 17.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 19 (Inv.-Nr. 26.104), Abb. 7/19Objektbezeichnung: 3 WS eines TopfesMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: erh. H. 6,6/5,2/3,8 cmMagerung: stark, Körnchengröße mittel bis grob, vereinzelt KalzitpartikelFarbe: mittel– bis dunkelbraun (AS); dunkelbraun bis –grau (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: geglättetVerzierung: WellenbandDatierung: Frühmittelalter, 8./9. Jahrhundert
Kat.–Nr. 20 (Inv.-Nr. 26.105), Abb. 7/20Objektbezeichnung: RS eines Topfes, Leistenrand, MiniaturgefäßMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 5,6 cm (11 %); erh. H. 3,3 cmMagerung: schwach, Körnchengröße sehr feinFarbe: fleckige bräunlich–mittelgrüne Glasur (AS); hell– bis mittelbraun (IS); hellbraun (BR)Oberfläche: innen zurückhaltend körnigDatierung: Spätmittelalter
Kat.–Nr. 21 (Inv.-Nr. 26.106), Abb. 7/21Objektbezeichnung: RS eines Topfes; verstärkter, eng umgeschlagener KremprandMaterial/Formgebung: Keramik/frei geformtMaße: RDm. 13,6 cm (15 %); erh. H. 4,3 cmMagerung: schwach, Körnchengröße mittel, vereinzelt weiße PartikelFarbe: beige bis dunkelgrau (AS); beige bis dunkelgrau (IS); dunkelgrau, außen und innen dicke mittelbraune Zone (BR)Oberfläche: zurückhaltend körnigDatierung: 13. oder 1. Hälfte 14. Jahrhundert
Kat.–Nr. 22 (Inv.-Nr. 26.107), Abb. 7/22Objektbezeichnung: RS eines Topfes, innen verstärkter LeistenrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 15,6 cm; erh. H. 15,7 cmMagerung: mittel, Körnchengröße fein bis mittelFarbe: dunkelgrau bis dunkelbraun (AS); dunkelgrau bis dunkelbraun (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: zurückhaltend körnigAngarnierung: randständiger BandhenkelDatierung: 15. Jahrhundert (?)
Kat.–Nr. 23 (Inv.-Nr. 26.108), Abb. 7/23Objektbezeichnung: RS eines Topfes, KragenrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 26 cm; erh. H. 7,4 cmMagerung: stark, Körnchengröße feinFarbe: mittelgrau bis –braun (AS); mittelgrau bis –braun (IS); schwärzlichgrau (BR)Oberfläche: feinrauDatierung: 16. Jahrhundert
220
Kat.–Nr. 33 (Inv.-Nr. 26.118), Abb. 9/33Objektbezeichnung: RS eines TellersMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 24 cm; erh. H. 3,7 cmMagerung: schwach, Körnchengröße feinFarbe: orange–mittelbraun (AS); dünne farblose Glasur (IS); orange–mittelbraun (BR)Oberfläche: geglättetVerzierung: innen weißer Malhorndekor unter farbloser GlasurDatierung: 18./19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 34 (Inv.-Nr. 26.119), Abb. 9/34Objektbezeichnung: Fragment einer HandsichelMaterial: EisenMaße: L. 17,5 cm; Br. 1,6 cm; H. 0,5 cmDatierung: 16.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 35 (Inv.-Nr. 26.120), Abb. 9/35Objektbezeichnung: Heftschalen eines Klapp– oder GriffplattenmessersMaterial: Messing, EisenMaße: L. 9,5 cm; Br. 1, 3 cm; H. 0,9 cmVerzierung: ziseliertes BlumenmotivDatierung: 18./19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 36 (Inv.-Nr. 26.121), Abb. 9/36Objektbezeichnung: stift– bzw. meißelartiges Objekt (?)Material: EisenMaße: L. 6,7 cm; Br. 2,5–3,8 cm; H. 1,5 cm Beschreibung: kantiger Schaft mit BartkranzDatierung: Neuzeit
Kat.–Nr. 37 (Inv.-Nr. 26.122), Abb. 9/37Objektbezeichnung: Fragment eines SchleifsteinesMaterial: Speckstein (weißlich–rosa)Maße: L. 4,3 cm; B. 3,1 cm St. 1,7 cm Beschreibung: Wetzspuren und –scharten an fünf SeitenDatierung: Neuzeit
Kat.–Nr. 38 (Inv.-Nr. 26.123), Abb. 9/38Objektbezeichnung: Fragment eines Schleifsteines (Sensenwetzstein)Material: dichter, feinkörniger Sandstein (grau) Maße: L. 8,4 cm; Br. 2,3 cm; H. 1,2 cmBeschreibung: Wetzspuren und –scharten an vier SeitenDatierung: Neuzeit
Kat.–Nr. 28 (Inv.-Nr. 26.113), Abb. 9/28Objektbezeichnung: 5 RS einer Schüssel, RollrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 29 cm (21+13+4+3+2 %); erh. H. 4 cmMagerung: schwach, Körnchengröße fein bis mittel, vereinzelt Quarzpartikel bis 1,5 mm Dm.Farbe: beige bis mittelbraun, stellenweise dunkelgrau–fleckig (AS); grünlich–hellbraune Glasur (IS); mittel-braun bis –grau (BR)Oberfläche: außen geglättetDatierung: 17.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 29 (Inv.-Nr. 26.114), Abb. 9/29Objektbezeichnung: RS einer Schüssel, RollrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 25 cm (8 %); erh. H. 3,2 cmMagerung: schwach, Körnchengröße feinFarbe mittelbraun (AS); dünne orangebraune bis dunkelgrüne Glasur (IS); hellorange–mittelbraun (BR)Oberfläche: geglättetDatierung: 17.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 30 (Inv.-Nr. 26.115), Abb. 9/30Objektbezeichnung: RS einer Schüssel, RollrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 21,2 cm (6 %); erh. H. 2,2 cmMagerung: schwach, Körnchengröße feinFarbe: hellbraun (AS); Reste einer stark verwitterten Glasur (IS); hellorange–mittelbraun (BR)Oberfläche: geglättetDatierung: 17.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 31 (Inv.-Nr. 26.116), Abb. 9/31Objektbezeichnung: RS einer Schüssel (?)Material/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. unbestimmbar; erh. H. 2 cmMagerung: schwach, Körnchengröße fein, vereinzelt SchamottFarbe: hellbraun (AS); orange–mittelbraun bis grünlich–mittelbraun (IS); dunkelbraun (BR)Oberfläche: geglättetAngarnierung: Ansatz einer gezogenen AusgussmuldeDatierung: 17.–19. Jahrhundert
Kat.–Nr. 32 (Inv.-Nr. 26.117), Abb. 9/32Objektbezeichnung: RS einer Schüssel, nach außen verstärkter WulstrandMaterial/Formgebung: Keramik/drehend geformtMaße: RDm. 28 cm (5 %); erh. H. 2,4 cmMagerung: schwach, Körnchengröße feinFarbe: mittelgrau (AS); mittelbraune Glasur (IS); dunkelgrau (BR)Oberfläche: geglättetDatierung: 17.–19. Jahrhundert
221
Abb. 6 Neolithisches, bronze– und hallstattzeitliches Fundmaterial aus der Repolusthöhle (Kat.–Nr. 1–15). Kat.–Nr. 1–5 u. 8–15 = Maßstab 1:2, Kat.–Nr. 6 u. 7 = Maßstab 1:3. Grafik: J. Kraschitzer.
222
Abb. 7 Hallstattzeitliches, früh– und spätmittelalterliches sowie neuzeitliches Fundmaterial aus der Repolusthöhle (Kat.–Nr. 16–23). Kat.–Nr. 16–17 = Maßstab 1:1, Kat.–Nr. 18–20 = Maßstab 1:2, Kat.–Nr. 21–23 = Maßstab 1:3. Grafik: D. Modl/J. Kraschitzer.
223
Abb. 8 Neuzeitliches Fundmaterial aus der Repolusthöhle (Kat.–Nr. 24–27). Kat.–Nr. 24–27 = Maßstab 1:3. Grafik: J. Kraschitzer.
224
Abb. 9 Neuzeitliches Fundmaterial aus der Repolusthöhle (Kat.–Nr. 28–38). Kat.–Nr. 28–33 = Maßstab 1:3, Kat.–Nr. 34–37 = Maßstab 1:2. Grafik: J. Kraschitzer.
225
Abb. 10 Spätneolithischer Meißel aus der Ulna/Elle eines Huftiers (Kat.–Nr. 3). Foto: D. Modl.
Abb. 11 Frühmittelalterliches Randfragment eines Topfes mit Wellen-bandornament (Kat.–Nr. 18). Foto: D. Modl.
Abb. 12 Ausgewählte Randstücke von spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Töpfen bzw. Schüsseln (Kat.–Nr. 22–25, 27, 28). Fotos: D. Modl.
226
vor (Kat.–Nr. 18, 19; Abb. 11), deren nächste Parallelen am nahegelegenen Kirchberg bei Deutschfeistritz zu finden sind.123 Drei Topffragmente sind ins Spätmittel-alter zu datieren (Kat.–Nr. 20–22), wobei für ein Rand-stück mit eng umgeschlagenem Kremprand (Kat.–Nr. 21) ein gutes Vergleichsstück aus dem Keramikmaterial des „Admonterhofs” in Graz bekannt ist, das dort ins 13. Jahrhundert datiert wird.124 Die restlichen Stücke sind grob dem Zeitraum zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert zuzuordnen (Kat.–Nr. 23–33; Abb. 12) und finden ebenfalls zum Teil ihre Entsprechungen im Fundmaterial der Grazer Altstadt-grabungen. Gemeint sind hier beispielsweise zwei glasierte Töpfe, zum einen mit innen verstärktem Leis-tenrand (Kat.–Nr. 26) und zum anderen mit langgezo-genem Kragenrand (Kat.–Nr. 27), wie sie auch aus dem keramischen Fundmaterial aus dem Reinerhof bekannt sind.125 Auch das Handsichelfragment und der Messer-griff (Kat.–Nr. 34–35) können nur grob diesem Zeitraum zugeordnet werden und finden ihre formalen Parallelen z. B. in obersteirischen Funden.126 Gleiches gilt für die beiden Schleifsteine (Kat.–Nr. 37–38), die aufgrund ihres Materials – ein weißlicher Speckstein und ein dichter, feinkörniger Sandstein (typisches und heute noch gebräuchliches Material für Sensenwetzsteine) – mit ziemlicher Sicherheit in die Neuzeit datieren.
Auffällig ist, dass die Keramik insgesamt ein reduzier-tes Formenspektrum zeigt und Töpfe im Fundmaterial bei weitem überwiegen. Sie könnten als Koch– oder Vorratsgefäße interpretiert werden, was gut zu einem Rastplatz oder kurzeitig bewohnten Zufluchtsort, wie einer Höhle, passen würde. Ein Großteil der in der Repolusthöhle gefundenen Keramik lässt sich grob in den Zeitraum zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert datieren. Möglicherweise erklärt sich dieser Überhang durch kriegerische Ereignisse, wie die Franzosenkriege, als die einheimische Bevölkerung in den Höhlen um Peggau Schutz und Zuflucht suchte. Bemerkenswert erscheint der Nachweis des Frühmittelalters, das bislang in den Höhlen rund um Peggau nur vereinzelt belegt war oder – mangels Neubearbeitung der Alt-funde – noch nicht als solches erkannt wurde. Auch die mehrfach vertretene Keramik aus dem Zeitraum zwischen der Mittelbronzezeit und der Urnen-felderzeit fügt sich gut in die damalige Siedlungsland-schaft ein, da zwischen Frohnleiten und Kleinstübing gleich mehrere urnenfelderzeitliche Tal– und Höhen-siedlungen existierten und das Gebiet vermutlich weit-räumig erschlossen war. Auffällig am prähistorischen Keramikbestand ist noch der Umstand, dass – trotz vollständigem Abtrag der entsprechenden Fund-schichten – viele Gefäße nur durch einzelne Scherben repräsentiert werden, was Fragen entweder zur Tapho-nomie in der Höhle, der damaligen Grabungstechnik bzw. der musealen Aufbewahrung oder einer möglichen Pars-pro-toto-Sitte in der Urgeschichte aufwirft.
5 Auswertung und Datierung
Das vorliegende Fundmaterial zeigt, wie für Höhlenfund-plätze typisch, eine weite zeitliche Streuung. Bereits dem Mittelneolithikum könnte die Nackenpartie eines Beils mit ovalem Querschnitt (Kat.–Nr. 1)112 zuzuordnen sein, während die beiden meißel– bzw. spitzenartigen Knochengeräte (Kat.–Nr. 2–3) eher in das Spätneolithi-kum oder in die Kupferzeit datieren dürften. Besonders charakteristisch ist die Ulnaspitze (Abb. 10), die als Arbeitsgerät aus vielen neolithischen Siedlungen Mittel-europas bekannt ist113, so auch aus steirischen Höhlen, wie z. B. der Peggauer–Wandhöhle I (2836/35)114 oder Of[f]enberger Höhle (1733/1) im Mürztal115.
Die chronologische und typologische Einordnung der prähistorischen Keramik erweist sich insgesamt als schwierig, da die vorhandenen Boden–, Rand– und Henkelfragmente nur einfache Profile zeigen und die wenigen verzierten Wandscherben meist nur über chronologisch unempfindliche Dekorelemente verfügen. So sind in manchen Fällen auch die Ton– und Oberflä-chenbeschaffenheit sowie der Erhaltungszustand ein wichtiges Kriterium für die Datierung. Demnach könnte ein Bandhenkel (Kat.–Nr. 4) aufgrund seiner groben Magerung und seines unzureichenden Brandes vielleicht spätneolithisch/kupferzeitlich sein.
Nur allgemein in die Mittel– bzw. Spätbronzezeit/Urnen-felderzeit lassen sich ein weiterer Henkel (Kat.-Nr. 5), ein Henkelansatz (Kat.-Nr. 8), zwei Bodenstücke (Kat.-Nr.6 u. 7) und drei Wandfragmente mit unterschiedlichen Knubben datieren (Kat.–Nr. 9–11).116 Unklar ist, ob es sich bei der alleinstehenden Ritzung auf dem Wandfrag-ment mit ovaler Knuppe (Kat.–Nr. 11) um eine gewollte Verzierung handelt, da solche Rillen als Dekorelement vorallem in Bündeln in Erscheinung treten, wie mittel– bzw. spätbronzezeitliche Keramikfunde aus dem nahen Deutschfeistritz zeigen.117 Die einfache Randbildung könnte auch zwei Gefäßmündungen (Kat.–Nr. 12 u. 13) in die Mittel– bzw. Spätbronzezeit datieren118, doch lässt die sorgfältige Oberflächenglättung auch an eine Datierung in der Urnenfelderzeit denken. Ebenfalls eher urnenfel-derzeitlich dürfte ein Wandstück mit Kerbschnittleiste (Kat.–Nr. 14) sein, bei der es sich um ein beliebtes Dekor-element der steirischen Urnenfelderzeit handelt.119
In die Hallstattzeit sind vielleicht ein doppelkonischer Spinnwirtel mit eingezogener Oberseite (Kat.–Nr. 15)120 sowie zwei Keramikfragmente mit Resten einer roten Hämatit–Bemalung einzuordnen (Kat.–Nr. 16 u. 17), die mit Vorbehalt zu einem Kegelhalsgefäß und einer dünnwandigen Schale gehören könnten.121 Die in der Literatur122 erwähnte latènzeitliche und römische Gefäß-keramik konnte im vorliegenden Material nicht identifi-ziert werden. Dagegen liegen für das Frühmittelalter die Fragmente von zwei Töpfen mit Wellenband–Verzierung
227
7 Summary
The Region around Peggau–Deutschfeistritz with it´s concentration of archaeological sites from Palaeolithic to modern times is one of the archaeological core territories of Styria. One of the most important sites is the Repolust Cave near Peggau with a rich inventory of lithic artefacts from the Middle Palaeolithic period, but also with numerous archaeological remains from the following time periods.To these belong et al. Neolithic bone tools and a fragment of a stone axe, Middle and Late Bronze Age (Urnfield Culture) pottery, a biconical spindle whorl and ceramic fragments with red haematite paintings from the Hallstatt period and an extensive ceramic material from the period between the early Middle Ages and the modern times as well as iron tools from the 18th/19th centuries. The pottery from Latène and Roman Period which is mentioned in literature could not be identified within the present material.
6 Zusammenfassung
Die Region um Peggau–Deutschfeistritz gehört mit einer überaus großen Dichte an Fundstellen vom Paläo-lithikum bis in die Neuzeit zu den archäologischen Kernlandschaften der Steiermark. Als einer der wich-tigsten Fundplätze gilt die Repolusthöhle bei Peggau, die nicht nur ein reichhaltiges Inventar an Steingeräten aus dem Mittelpaläolithikum aufweist, sondern auch zahlreiche archäologische Reste aus nachfolgenden Zeitperioden. Hierzu zählen u. a. neolithische Kno-chengeräte und ein Steinbeilbruchstück, mittelbron-zezeitliche und urnenfelderzeitliche Keramik, ein doppelkonischer Spinnwirtel und Keramikfragmente mit roter Hämatit–Bemalung aus der Hallstattzeit und ein umfangreiches Keramikmaterial aus dem Zeitabschnitt zwischen dem Frühmittelalter und der Neuzeit sowie Reste von Eisenwerkzeugen aus dem 18./19. Jahrhun-dert. Die in der Fachliteratur erwähnte latènzeitliche und römische Gefäßkeramik konnte im vorliegenden Material jedoch nicht identifiziert werden.
Endnoten
1 Nummerierung im österreichischen Höhlenkataster.
2 Für mineralogische und osteologische Bestimmungen sowie fachliche Auskünfte zu archäologischen Funden und Fundstellen haben die Autoren folgenden Personen zu danken: Dr. Michael Brandl (Institut OREA, Abteilung Europäische Archäologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien), Dr. Gerald Fuchs (ARGIS Archäologie Service GmbH, Laaken/Soboth), Dr. Heinrich Kusch (c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Universität Graz), Dr. Martina Pacher (c/o Institut für Paläontologie, Universität Wien), Ing. Dr. Rudolf Pavuza (Karst– und Höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft, Geo-logisch–Paläontologische Abteilung, Naturhistorisches Museum, Wien), Mag. Karl Peitler (Abteilung Archäologie & Münzkabinett, Universalmuseum Joanneum, Graz) und Dr. Walter Postl (c/o Abteilung Geowissenschaften, Mineralogie, Universalmuseum Joanneum, Graz).
3 Allgemeine Überblicksdarstellungen: Mottl 1953, 14–31; Modrijan 1966/67, 5–19; Fuchs 1989b, 13–32, 275–303 (Taf. 43–56); Fuchs 1994, 85–88; Kusch 1996; Pickl 1996, 1–19; Hebert 2000, 18–25; Kramer 2007, 39–82; Obersteiner 2007b, 83–109; Fuchs – Mirsch 2011, 9–72; Brunner 2012, 20–39; Fuchs 2014, 14–41.
4 Zu den unterschiedlichen Motiven, Höhlen aufzusuchen: Kusch 1996, 70–73; Bauer, Ch. 2009, 69–72, 76–80, 87f. u. 152–155. 5 Eine ausführlichere Darstellung ist im Beitrag „Die Pseudo-artefakte und der Wolfszahnanhänger aus der Repolusthöhle
(Steiermark, Österreich) – Mit einem Diskussionsbeitrag zum Neandertaler und dem Mittelpaläolithikum im Südostalpenraum“ von D. Modl und M. Pacher zu finden.
6 Vgl. Fuchs u. a. 1998, 143–172. 7 Vgl. Fuchs – Ringer 1995, 257–271; Fuchs 2000, 136–138.
8 Vgl. Fladerer u. a. 2006, 61–96.
9 Zur Geschossspitze mit massiver Basis vom Typ Mladeč vgl. Peitler u. a. 2011, 20f.
10 Vgl. Kusch 1998a, 21–48; Kusch 1998b, 476.
11 Vgl. Kramer 2007, 57.
12 Vgl. JJb 82, 1893, 44 (siehe auch: UMJ, AArchMk, Jahresakten 1893, Akt–Nr. 116: Frohnleiten, 8. Mai 1893. Gerichtsadjunkt Hans Mixner sichert die Überlassung des Steinbeils aus Frohnlei-ten zu und verspricht Übergabe an das Museum).
13 Vgl. JJb 81, 1892, 35. In diesem Zusammenhang sind auch diverse Höhlenfunde bei Peggau anzuführen (z. B. Kusch 1996, 226, 228), wie z. B. aus der Sinterbeckenhöhle (2836/202) oder der Stein-bockhöhle (2836/23). 14 Vgl. Hilber 1922, 27.
228
15 Vgl. Fuchs 2014, 21.
16 Vgl. Hebert 2000, 20.
17 Vgl. Brunner 2012, 20.
18 Vgl. Hilber 1922, 38; Pittioni 1936, 151f.
19 Vgl. Fuchs 1996a, 428; Fuchs 1999b, 761; Tiefengraber, S. 2011, 400; Fuchs 2014, 20f. u. Abb. 32.
20 Zu den fünf bislang bekannten Höhlen im Raum Peggau und Semriach mit Furchenstichkeramik (vgl. Kusch u. a. 2006, 314) ist nun die Große Badlhöhle als sechste zu zählen, aus der eine kleine Scherbe mit grobem Furchenstich stammt (UMJ, AArchMk, Inv.-Nr. 4345; vgl. JJb 79, 1890, 51).
21 Vgl. Fuchs 1994, 90–101.
22 Vgl. Kusch 2003, 313–315 (Taf. 1–3/1–25).
23 Vgl. Fuchs 1982, 221.
24 Vgl. Hilber 1922, 30–32; Großschmidt – Kirchengast 1994/95, 19–40.
25 Vgl. Mottl 1953, 30; Modrijan 1966/67, 12 (Abb. 3 u. 6).
26 Vgl. Kusch u. a. 2006, 241–255.
27 Bei den „frühbronzezeitlichen Siedlungsfunden aus Adriach“ (vgl. Kramer 2007, 59) handelt es sich um die spätbronzezeitliche Talrandsiedlung in Schrauding (siehe Anm. 35). 28 Vgl. Schmid 1934, 158f.; Peitler u. a. 2011, 30f.
29 Vgl. Bock 1913, 22; Fuchs 1982, 221. 30 Vgl. Hammer 1970, 162 (Abb. 4/8).
31 Vgl. Modrijan 1966/67, 6–8.
32 Vgl. Ehrenreich – Fuchs 2004, 203–205.
33 Vgl. Fuchs 1996b, 443; Fuchs u. a. 1996, 34; Fuchs 1998, 724f.
34 Vgl. Modrijan 1946–1950, 70; Modrijan 1953, 14; Ehrenreich u. a. 2004, 843.
35 Vgl. Fuchs 1999a, 235–256.
36 Vgl. Ehrenreich u. a. 2003b, 741; Ehrenreich – Fuchs 2004, 197–203.
37 Vgl. Fuchs – Kainz 1998, 117 (Taf. 1/1–2).
38 Vgl. Fuchs 1989b, 28 (Kat.–Nr. 18).
39 Vgl. Fuchs 1989b, 30 (Kat.–Nr. 53, Taf. 51); Fuchs 2006, 182 (Abb. 5).
40 Vgl. Fuchs 2006, 182 (Abb. 5); Kramer 2007, 60. Der Weingartner Kogel findet auch bei Werner Murgg Erwähnung, der hier bereits eine kleine prähistorische Wehranlage vermutete (vgl. Murgg 2000, 150).
41 Vgl. Mottl 1953, 23.
42 Vgl. Kramer 1981, 311–314; Fuchs 1989b, 20–24 u. 286f. (Taf. 48).
43 Vgl. Ehrenreich – Fuchs 2004, 198–201.
44 Vgl. Weihs 2004. 45 Vgl. Windholz–Konrad 2002, 395–405.
46 Vgl. allg. mit weiterführender Literatur: Modrijan 1966/67, 8 u. 12 (Abb. 4); Windholz–Konrad 2002, 397 (Abb. 4); Karl u. a. 2009, 81 (Kat.–Nr. 435), 89 (Kat.–Nr. 485).
47 So dürften die aus den Höhlen des Mittleren Murtals bekannten und publizierten Hallstattfunde wahrscheinlich falsch bestimmt und als urnenfelderzeitlich einzustufen sein (vgl. Fuchs 1982, 221; Kramer 2007, 60). Erwähnt sei noch ein vermutlich hallstatt-zeitliches Steinkistengrab, das 1893 bei der Anlage eines Kellers in Deutschfeistritz entdeckt wurde und zwei Gefäße barg (vgl. JJb 82, 1893, 44; siehe auch: UMJ, AArchMk, Jahresakten 1893, Akt-Nr. 156: Graz, 24. Mai 1893. Bericht von Otto Fischbach über einen dienstlichen Ausflug nach Deutschfeistritz bei Peggau und die Auffindung eines Steinkistengrabes mit zwei Urnen durch Kaminfegermeister Fegerl).
48 Vgl. Zeilinger 1953, 80f.; Dembski 1972, 41 u. 61; Kramer, M. 1994, 38f. u. 46f. (Kat.–Nr. 16 u. 19); Schachinger 2014, 74.
49 Vgl. Fuchs – Kainz 1998, 117 (Taf. 1/3–9 u. 2/10–18); Ehrenreich 2000, 622. Diether Kramer (vgl. Kramer 2007, 6) erwähnt – ohne nähere Quellenangabe – für den Nordhang des Kugelsteins noch zwei „keltische Schmelzöfen mit Eisenbarren“.
50 Vgl. Fuchs 1989a, 26.
51 Vgl. Kramer, M. 1994, 46 u. 50 (Kat.–Nr. 17 u. 26–28); Kusch 1996, 95. Siehe auch den spätlatènezeitlichen Noppenring aus der Peggauer–Wandhöhle I (2836/35; vgl. Hammer 1970, 162 [Abb. 2/3]).
52 Vgl. Zeilinger 1953, 64–75; Kramer, M. 1994, 12–16 u. 47–50 (Kat.–Nr. 22, Taf. 8–31).
53 Vgl. Steinklauber – Artner 2010, 168–170.
54 Vgl. Fuchs – Mirsch 2011, 14–25.
229
55 Vgl. JJb 95, 1906, 36f.; Weber 1969, 83–86 (Kat.–Nr. 23 u. 24); Fuchs – Mirsch 2011, 13f.
56 Vgl. Modrijan 1966/67, 16f.; Fuchs – Mirsch 2011, 25–27.
57 Vgl. Wolf 1956, 55–79; Peitler u. a. 2011, 130f.
58 Vgl. Bauer 1997, 126–134; Fuchs – Kainz 1998, 101–136; Porod 2005, 15–19; Fuchs 2014, 29 u. Abb. 31.
59 Vgl. Steinklauber 2008, 415–418; Steinklauber 2012, 156f.
60 Vgl. Fuchs – Mirsch 2011, 24.
61 Vgl. Wedenig 1989, 139–149; Fuchs 1992, 374–379; Groh 1994, 187–195; Adam – Czeika – Fladerer 1995/96, 279–289. 62 Auflistungen bei: Fuchs 1992, 374–379; Kusch 1996, 97–101.
63 Vgl. Fuchs u. a. 1996, 34.
64 Vgl. Maurin 1953, 67. Entsprechende römische Kleinfunde (Fibeln, Münzen, Terra Sigillata etc.) wurden in den 1980er-Jahren aufgelesen (vgl. Fuchs 2014, 33). Südöstlich dieser Fundstelle wurde ebenfalls bei Zitoll in der Abbauwand einer aufgelassenen Lehmgrube weitere römerzeitliche Keramik geborgen (vgl. Fuchs 1989b, 29 [Kat.–Nr. 26]).
65 Vgl. Lohner–Urban – Steigberger 2012, 316f. Bereits im 19. Jahr-hundert wurde in Peggau auch eine Münze des Nerva gefunden (vgl. JJb 61, 1872, 24).
66 Vgl. Brunner 2012, 20.
67 Vgl. Modrijan 1969, 27–29; Ehrenreich u. a. 2003a, 16f.; Ehren-reich u. a. 2003b, 738–741; Steinklauber 2010, 22–29; Steinklau-ber – Artner 2010, 163–167.
68 Nach Gerald Fuchs lagen in Zitoll ebenfalls Hügelgräber (vgl. Fuchs 2014, 34).
69 Vgl. JJb 16, 1827, 11f.; 34, 1845, 23; Byloff 1827; Lebzelter 1927, 40–43; Kramer 2007, 69.
70 Vgl. Pratobevera 1854, 108.
71 Vgl. Modrijan 1969, 30; Hesse 1991, 185–192.
72 Vgl. Gutjahr 2012, 158–163 u. 195–197.
73 Vgl. Modrijan 1954, 116; Hebert 2000, 24.
74 Vgl. JJb N.F. 9, 1979, 112; N.F. 11, 1982, 83; Hebert 2000, 23; Hudeczek 2014, 70-73.
75 Vgl. JJb N.F. 18, 1988, 186f.
76 Vgl. Weber 1969, 82f. u. 86–108 (Kat.–Nr. 22 u. 25–38); Hainzmann 1987, 45–55; Ehrenreich u. a. 2006, 417–426; Fuchs 2014, 34-36.
77 Vgl. Modrijan 1963, 47–53; Gutjahr 2006, 277–344; Gutjahr 2014, 42–51. Im Zusammenhang mit dem Kirchberg sei auch auf frühmittelalterliche Funde in der dortigen Kinghöhle (2784/21) verwiesen (vgl. Mottl 1959b, 145).
78 Vgl. Ehrenreich – Glöckner 1989, 106 u. 118 (Taf. 5/2 u. 20/2).
79 Vgl. Mottl 1959a, 18 u. 146; Modrijan 1963, 79.
80 Vgl. Gutjahr 2006, 309 u. 322f. (Taf. 149–153).
81 Vgl. Kramer 2007, 73–75; Gutjahr 2012, 87–203.
82 Vgl. Kloiber 1959–61, 59–62.
83 Vgl. Modrijan 1963, 79; Kramer, M. 1992, 3–8.
84 Vgl. Modrijan 1963, 79; Kramer, M. 1992, 3 u. 8; FÖ 42, 2003, 49.
85 Vgl. Baravalle 1961, 145, 150 u. 181; Pickl 1996, 13f.; Vaculik 2000, 9f.; Ehrenreich u. a. 2003b, 741; Obersteiner 2007b, 85–87; Brunner 2012, 75–79.
86 Vgl. Bouvier – Neuwirth 1980, 129–134; Woisetschläger – Krenn 1982, 7f., 67f., 354f. u. 523f.; Hebert – Bouvier 1987, 45–52; Hesse 1987, 69–86.
87 Vgl. Baravalle 1961, 150, 160f., 164–170, 174–176 u. 188–191; Murgg 2000, 134, 138 u. 151; Murgg 2009, 46–53 u. 58–63; Murgg 2014, 52-69.
88 Vgl. Baravalle 1961, 181f.
89 Vgl. Baravalle 1961, 147 u. 178; Murgg 2000, 133 u. 151.
90 Vgl. Flügel – Flügel 1953, 211–218; Fuchs 1989a, 302f. (Taf. 56); Weiß 1998, 16–19; Reisinger 2000, 46–55; Hiden 2007, 28–34 (Abb. 2); Schmidt-Högl 2014, 374-419.
91 Vgl. Meyer 1888, 188, 190f. u. 193; Peitler 2014, 440-443. 92Vgl. Weiß 1998, 19–21; Vaculik 2000, 15.
93Vgl. zur Situation im Raum Peggau während der Napoleonischen Kriege: Hutz 2007, 166-169. Durch die zahlreichen Naturstein-höhlen wurde man auch im Zweiten Weltkrieg auf die Ortschaft Peggau aufmerksam, wo am Fuß der Peggauer Wand eine künst-liche Stollenanlage für die unterirdische Rüstungsproduktion der Steyr-Daimler-Puch AG entstand (vgl. Karner 1986, 247; Bauer, Ch. 2009, 73-75).
94 Vgl. Mottl 1951, 15 u. 17.
230
Autor
95 Zur Morphologie und Erforschung der Repolusthöhle siehe den Beitrag „Abriss der Erforschungsgeschichte der Repolusthöhle (Steiermark, Österreich) mit einem Bericht zu einer Feststel-lungsgrabung im Jahr 2010“ von D. Modl, M. Brandl, M. Pacher und R. Drescher-Schneider.
96 Vgl. Mottl 1951, 15; Mottl 1975, 163.
97 Vgl. Mottl 1951, 76.
98 Vgl. Mottl 1951, 17.
99 Naturhistorisches Museum Wien, Geologisch–Paläontologische Abteilung, Karst– und Höhlenkundliche Arbeitsgruppe, Kataster-archiv, Repolusthöhle (2837/1): GZ: 2669/48, „Die paläontologischen, archäologischen und diluvialstratigraphi-schen Ergebnisse der Probegrabungen in der Repolusthöhle. Teil II. des zusammenfassenden Vorberichtes: Die bisherigen Ergeb-nisse der Phosphatsuchaktion im Badlgraben. 1947.“ (Maria Mottl, 10.2.1948), S. 1.
100 Siehe hierzu die Ausführungen des Verfassers im Kapitel „Konti-nuität statt Umbruch (1906–1949)“ der gerade in Druck befindli-chen neuen Landesgeschichte der Steiermark (vgl. Hebert 2015). 101 Z. B. Fuchs 1992, 379; Kramer, M. 1994, 47 [Kat.–Nr. 21]; Kusch 1996, 238.
102 Vgl. Mottl 1950, 17 (Taf. VI/57–59); Mottl 1951, 28.
103 Vgl. Mottl 1975, 163.
104 Zur Herstellung und Verbreitung von Flintensteinen zuletzt: Brandl 2013, 134–162. Siehe hierzu auch den in Endnote 5 genannten Beitrag.
105 Vgl. Brodar 2009, 263.
106 Vgl. Mottl 1951, 4 u. 15.
107 Dabei handelt es sich um einen neolithischen Spinnwirtel aus der Peggauer Privatsammlung von Helge Helm (vgl. Kramer 2007, 56).
108 Zusammen mit mehreren Quarz- und Hornsteinartefakten wer-den am Landesverein für Höhlenkunde in der Steiermark, Graz auch zwei Keramikfragmente verwahrt (vgl. Fuchs u. a. 1998, 172), die aufgrund der sorgfältigen Glättung ihrer Außenseiten in die späte Urnenfelderzeit datieren könnten.
109 Die frühmittelalterlichen Funde aus der Repolusthöhle wurden schon vorab erwähnt bei: Lehner 2009, 200 (Anm. 1310).
110 Mineralogische Bestimmung: W. Postl. Bei Mottl (vgl. Mottl 1951, 17) handelt es sich um Amphibolit.
111 Die Keramik wurde von Mag. Johanna Kraschitzer geklebt und gezeichnet. Zur verwendeten Terminologie für die formale und technische Ansprache siehe: Hofer 2010.
112 Vgl. Weller 2014, 67f.
113 Z. B. Spennemann 1984, 95 u. 299–301 (Taf. 25/171); Fehlmann 2008, 150–153 (Taf. 13–15).
114 Vgl. Hammer 1970, 162 (Abb. 3).
115 Vgl. Hilber 1922, 33, 75 (Taf. II/35–36).
116 Doppelknubbe bei Kramer 1981, 623 (Taf. 44/1), und abgesetzte, mittig eingedrückte (Griff-)Knubbe bei Dular – Šavel – Tecco Hvala 2002, 60 (Taf. 35/3).
117 Z. B. Ehrenreich – Fuchs 2004, 203 (Taf. 5/12, 6/1 u. 2).
118 Z. B. Tiefengraber 2007, 28 (Taf. 3/26); Gutjahr 2011, 157 (Taf. 8/31).
119 Man denke hier nur an die überreich mit Kerbschnittleisten ver-zierte Keramik von der Riegersburg (vgl. Kramer 1981, 476 [z. B. Taf. 8]).
120 Vgl. Grömer 2010, 88 u. 262f. Aus den Peggauer und Semriacher Höhlen sind mehrfach Spinnwirtel bekannt (z. B. Große Badl-höhle [2836/17], Steinbockhöhle [2836/23], Kleine Peggauer–Wandhöhle [2836/38], Delagohöhle [2836/63]), deren Datierung nicht immer eindeutig ist (vgl. Kusch 1996, 177, 182, 208 u. 229).
121 Mineralogische Bestimmung: W. Postl. In der Hallstattzeit wurde in der Regel die gesamte oder ein Teil der Gefäßoberfläche flächendeckend mit einem roten Schlicker überzogen, der aus geschlämmtem, mit Eisenoxid vermengtem Ton bestand. Auf diese rote Engobe wurde dann eine schwarzgraue Graphitbe-malung aufgebracht (vgl. Dobiat 1980, 127f.; Kramer, M. 2013, 364f.). Während bei dem dünnwandigen Schalenfragment (Kat.–Nr. 17) die rote Engobe direkt aufgetragen wurde, besteht bei dem vermeintlichen Kegelhalsbruchstück der Verdacht, dass man die geglättete Gefäßoberfläche vor dem Schlickerauftrag noch leicht graphitierte. Eine derartige Bemalungstechnik erscheint auf den ersten Blick unüblich, ist jedoch auch von einzelnen Keramikfragmenten aus der hallstattzeitlichen Bestattung im sogenannten „Galgenkogel“ bei Wildon bekannt (vgl. Grubinger 1932, 34). Nicht unproblematisch erscheint auch die geringe Wandstärke des möglichen Schalenfragments, das in seiner Dünnwandigkeit keine Entsprechung im heimischen Keramik-material der Hallstattzeit, wie z. B. der Sulmtalnekropole, findet (siehe die dünnwandigsten Gefäße bei: Dobiat 1980, 251 [Taf. 105/6] u. 253 [Taf. 108/6]).
122 Z. B. Mottl 1951, 15; Fuchs 1992, 379; Kramer, M. 1994, 47 [Kat.–Nr. 21]; Kusch 1996, 238.
123 Z. B. Gutjahr 2006, 312 (Taf. 1/12) u. 314 (Taf. 3/37).
124 Vgl. Lehner 2004, 640 (Taf. 2/3) u. 641 (Taf. 3/7).
125 Vgl. Roscher 1997, 77 (Taf. 5/25) u. 92 (Taf. 7/238).
126 Vgl. Mandl 1996, 82; Windholz–Konrad 2003, 52 (Taf. 34/423).
231
Literaturverzeichnis
Adam – Czeika – Fladerer 1995/96A. Adam – S. Czeika – F. A. Fladerer, Römerzeitliche Tierknochenfunde aus zwei Höhlen am Kugelstein bei Deutschfeistritz, Steiermark – Hin-weise auf den Mithraskult?, MAGW 125/126, 1995/96, 279–289.
Baravalle 1961R. Baravalle, Burgen und Schlösser der Steiermark. Eine enzyklopä-dische Sammlung der steirischen Wehrbauten und Liegenschaften, die mit den verschiedensten Pri-vilegien ausgestattet waren (Graz 1961).
Bauer 1997I. Bauer, Römerzeitliche Höhen-siedlungen in der Steiermark mit besonderer Berücksichtigung des archäologischen Fundmaterials, FÖ 36, 1997, 71–192.
Bauer, Ch. 2009Ch. Bauer, Der Karst der Steiermark – Der Karstformenschatz und seine Interaktion mit dem Menschen. Ungedr. Diss. Univ. Graz (Graz 2009).
Bock 1913H. Bock, Eine frühneolithische Höhensiedlung bei Peggau in Steiermark, Mitteilungen für Höhlenkunde 6/4, 1913, 20–24.
Bouvier – Neuwirth 1980F. Bouvier – H. Neuwirth, Die St.–Georgs–Kirche in Adriach – Bauhistorische Untersuchung und Bauanalyse, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmal-pflege XXXIV/3–4, 1980, 129–134.
Brandl 2013M. Brandl, Characterisation of Middle European Chert Sources – A Multi Layered Approach to Analy-sis. Ungedr. Diss. Univ. Wien (Wien 2013).
Brodar 2009M. Brodar, Stara kamena doba v Sloveniji / Altsteinzeit in Slowenien (Ljubljana 2009).
Brunner 2012W. Brunner, Die Geschichte Semriachs – von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert, in: W. Brunner – B. A. Reismann – Redaktionsteam Semriach, 800 Jahre Semriach (Semriach 2012), 17–241.
Byloff 1827F. Byloff, Römische Grabstätte mit inschriftlichem Denkmahle, Der Aufmerksame 145/4, 1827, o. pag.
Dembski 1972G. Dembski, Die keltischen Fundmünzen Österreichs, Numis-matische Zeitschrift 87/88, 1972, 37–73.
Dobiat 1980C. Dobiat, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik, SchvSt Beiheft 1 (Graz 1980).
Dular – Šavel – Tecco Hvala 2002J. Dular – I. Šavel – S. Tecco Hvala, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 5 (Ljubljana 2002).
Ehrenreich 2000S. Ehrenreich, KG Adriach, MG Frohnleiten, VB Graz–Umgebung, FÖ 39, 2000, 622.
Ehrenreich u. a. 2003aS. Ehrenreich – G. Fuchs – H. Kern, Künettenarchäologie im SOS–Kin-derdorf Stübing, AÖ 14/2, 2003, 16f.
Ehrenreich u. a. 2003bS. Ehrenreich – G. Fuchs – H. Kern, KG Kleinstübing, MG Deutsch-feistritz, VB Graz–Umgebung [Fund-chronik], FÖ 42, 2003, 738–741.
Ehrenreich u. a. 2004S. Ehrenreich – G. Fuchs – H. Kern, KG Adriach, SG Frohnleiten, VB Graz–Umgebung [Fundchronik], FÖ 43, 2004, 843.
Ehrenreich u. a. 2006S. Ehrenreich – G. Fuchs – R. Wedenig, Ein municipaler Quaestor von Celeia im mittleren Murtal. Die Grabinschrift vom Kirchberg bei Deutschfeistritz, Steiermark. Mit einem Nachtrag von H. W. Müller, Arheološki vestnik 57, 2006, 417–426.
Ehrenreich – Fuchs 2004S. Ehrenreich – G. Fuchs, Fund-stellen der Urnenfelderzeit und der Bronzezeit in der MG Deutsch-feistritz, mittleres Murtal, Steier-mark, FÖ 43, 2004, 197–211.
Ehrenreich – Glöckner 1989S. Ehrenreich – G. Glöckner, Das archäologische Fundmaterial, in: Fuchs 1989a, 105–138.
Fehlmann 2008D. Fehlmann, Die Knochen–, Zahn– und Geweihartefakte der linear-bandkeramischen Siedlung Asparn/Zaya–Schletz (NÖ). Ungedr. Dipl. Univ. Wien (Wien 2008).
Fladerer u. a. 2006F. A. Fladerer – Th. Einwögerer – Ch. Frank – G. Fuchs – A. Galik – L. Ch. Maul – P. Steier – E. M. Wild, Der neue mittelpaläolithische Fundplatz „Lurgrotte–Vorhöhle“ bei Peggau in der Mittelsteiermark, Quartär 53/54, 2006, 61–96.
Flügel – Flügel 1953H. Flügel – E. Flügel, Geschichte, Ausdehnung und Produktion der Blei–Zinkabbaue des Grazer Paläo-zoikums. IV. Besitzverhältnisse, Zusammenfassung und Schluß, Berg– und hüttenmännische Monatshefte 98/10, 1953, 211–218.
Fuchs 1982G. Fuchs, Funde aus steirischen Höhlen (2. Folge), ZHVSt LXXIII, 1982, 217–221.
232
Fuchs 1989aG. Fuchs (Hrsg.), Höhlenfundplätze im Raum Peggau – Deutschfeistritz, Steiermark, Österreich. Tropfstein-höhle, Kat.Nr. 2784/3, Grabungen 1986–87, BAR International Series 510 (Oxford 1989).
Fuchs 1989bG. Fuchs, Höhlen– und Freiland-fundplätze im Raum Peggau, in: Fuchs 1989a, 13–32.
Fuchs 1992G. Fuchs, Zur Nutzung der steiri-schen Höhlen in der Römerzeit, FÖ 31, 1992, 374–379.
Fuchs 1994G. Fuchs, Archäologie der Lurgrotte, in: R. Benischke – H. Schaffler – V. Weissensteiner (Red.), Lurgrotte 1894–1994 – Festschrift anlässlich des hundertsten Jahrestages der Einschließung von Höhlenforschern durch Hochwasser und ihrer Erret-tung (Graz 1994), 85–101.
Fuchs 1996aG. Fuchs, KG Kleinstübing, MG Deutschfeistritz, VB Graz–Umgebung [Fundchronik], FÖ 35, 1996, 428.
Fuchs 1996bG. Fuchs, KG Adriach, MG Frohnlei-ten, VB Graz–Umgebung [Fundchro-nik], FÖ 35, 1996, 443.
Fuchs 1998G. Fuchs, KG Adriach, MG Frohnleiten, VB Graz–Umgebung [Fundchronik], FÖ 37, 1998, 724f.
Fuchs 1999aG. Fuchs, Prospektion und Not-bergung in der urgeschichtlichen Talrandsiedlung in Schrauding, KG Mauritzen, MG Frohnleiten, Steiermark. Mit Beiträgen von U. Lohner u. H.–P. Stika, FÖ 38, 1999, 235–256.
Fuchs 1999bG. Fuchs, KG Kleinstübing, MG Deutschfeistritz, VB Graz–Umgebung [Fundchronik], FÖ 38, 1999, 761.
Fuchs 2000G. Fuchs, Palaeolithic cave sites in the Mur Valley (Styria, Austria), Praehistoria 1 (Miskolc 2000), 129–148.
Fuchs 2006G. Fuchs, Die Höhensiedlungen der Steiermark im Kontext der regiona-len Siedlungsstrukturen / Hilltop Settlements in Styria (Austria) and their Context to regional Settle-ment Patterns, in: A. Kreen–Leeb (Hrsg.), Wirtschaft, Macht und Strategie – Höhensiedlungen und ihre Funktionen in der Ur– und Frühgeschichte / Economics, Power and Strategy – Hilltop Settlements and their Functions in the Pre– and Early History, AÖ Spezial 1 (Wien 2006), 173–187.
Fuchs 2014G. Fuchs, „Scherben, Dreck und alte Steine“ – Deutschfeistritz von der Altsteinzeit bis zum Ende der Römerzeit, in: Schmidt-Högl – Pöt-scher 2014, 14-41.
Fuchs – Kainz 1998G. Fuchs – I. Kainz, Die Grabung des Jahres 1997 am Kugelstein (KG Adriach, MG Frohnleiten) in der Steiermark mit Berücksichtigung älterer Forschungsergebnisse. Unter Mitarbeit von G. Glöckner, U. Schachinger und E. Schindler–Kau-delka, FÖ 37, 1998, 101–136.
Fuchs – Mirsch 2011G. Fuchs – I. Mirsch, Die Vorläufer der S 35 Brucker Schnellstraße. Ver-kehrswege zwischen Graz und Bruck an der Mur in der Steiermark, FÖMat A, Sonderheft 14 (Wien 2011).
Fuchs – Ringer 1995G. Fuchs – Á. Ringer, Das paläoli-thische Fundmaterial aus der Tun-nelhöhle (Kat.Nr. 2784/2) im Grazer Bergland (Steiermark, Österreich), FÖ 34, 1995, 257–271.
Fuchs u. a. 1996G. Fuchs – J. Fürnholzer – I. Kainz, Rettungsgrabung in Adriach, AÖ 7/2, 1996, 34.
Fuchs u. a. 1998F. Fuchs – J. Fürnholzer – F. A. Fladerer, Untersuchungen zur Fund-schichtbildung in der Repolusthöhle, Steiermark, FÖ 37, 1998, 143–172.
Groh 1994St. Groh, Ein Elfenbeinrelief aus der Tunnelhöhle am Kugelstein in der Steiermark, Arch.Korr. 24/2, 1994, 187–195.
Grömer 2010K. Grömer, Prähistorische Textil-kunst in Mitteleuropa. Geschichte des Handwerks und der Kleidung vor den Römern. Mit Beiträgen von R. Hofmann–de Keijzer zum Thema Färben und H. Rösel–Mautendorfer zum Thema Nähen, Veröffentlichun-gen der Prähistorischen Abteilung (VPA) 4 (Wien 2010).
Großschmidt – Kirchengast 1994/95K. Großschmidt – S. Kirchengast, Neue anthropologische Befunde zum neolithischen „Zwergenskelett“ aus der Josefinengrotte in Peggau, Steiermark, Mitteilungen der Abtei-lung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum 52/53, 1994/95, 19–40.
Grubinger 1932M. Grubinger, Die Hügelgräber bei Wildon, BlHk 10/3–4, 1932, 33–36.
Gutjahr 2006Ch. Gutjahr, Der Kirchberg von Deutschfeistritz, Bezirk Graz–Umgebung, Steiermark – eine frühmittelalterliche Burgstelle? Mit Anhängen von G. Christandl und S. Renhart, Arheološki vestnik 57, 2006, 277–344.
Gutjahr 2011Ch. Gutjahr, Mittel– bis frühspät-bronzezeitliche Gruben aus dem Bereich des Gräberfeldes Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk., in: Ch. Gutjahr – G. Tiefengraber (Hrsg.), Beiträge zur Mittel– und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfel-derzeit am Rande der Südostalpen. Akten des Internationalen Sympo-siums am 25. und 26. Juni 2009
233
in Wildon/Stmk., Internationale Archäologie – Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 15 / Hengist–Studien 2 (Rahden 2011), 141–206.
Gutjahr 2012Ch. Gutjahr, Ausgewählte archäolo-gische Quellen aus der Mittelstei-ermark. Zu einer Neubewertung der südostalpinen Geschichte zwischen 600–1100 n. Chr. Ungedr. Diss. Univ. Graz (Graz 2012).
Gutjahr 2014Ch. Gutjahr, Der Kirchberg – eine frühmittelalterliche Burgstelle? – Ein archäologischer Beitrag zur Erforschung des Kirchberges im frühen Mittelalter, in: Schmidt-Högl – Pötscher 2014, 42-51.
Hainzmann 1987M. Hainzmann, Vier neue Römer-steine aus der Pfarrkirche von Semriach, Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Graz 1 (Wien 1987), 45–55.
Hammer 1970L. Hammer, Über Grabungen und Funde in der Höhle I der Peggauer Wand (Kat.–Nr. 2836/35) bei Peggau (Steiermark), Die Höhle 21, 1970, 159–167.
Hebert 2000B. Hebert, Spuren der Vergangen-heit. Archäologische Funde und die früheste Geschichte von Deutsch-feistritz und Übelbach, in: Kultur-verein Sensenwerk Deutschfeistritz (Hrsg.), Das Übelbachtal. Menschen, Wirtschaft und Kultur - im Wandel der Zeit (Deutschfeistritz 2000), 18–25.
Hebert 2015B. Hebert (Hrsg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark, Geschichte der Steiermark 1 (Graz 2015).
Hebert – Bouvier 1987B. Hebert – F. Bouvier, Archäologi-sche Untersuchungen in der Pfarr-kirche zum Hl. Ägydius zu Semriach,
Österreichische Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege 41/1–2, 1987, 45–52.
Hesse 1987R. Hesse, Zur Frage des Alters der Kirche von Semriach - Ergebnisse einer Grabung, ZHVSt LXXVIII, 1987, 69–86.
Hesse 1991R. Hesse, Ein Römergrab in Sem-riach, MKorrHLK 4, 1991, 185–192.
Hiden 2007H. Hiden, Peggau und das mittlere Murtal. 440 Millionen Jahre Erd-geschichte, in: Obersteiner 2007a, 15–36.
Hilber 1922V. Hilber, Urgeschichte Steiermarks (Graz 1922).
Hofer 2010N. Hofer (Red.), Handbuch zur Ter-minologie der mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik in Österreich, FÖMat A, Sonderheft 12 / Nearchos, Sonderheft 18 / Beiträge zur Mit-telalterarchäologie Österreichs, Beiheft 9 (Horn 2010).
Hudeczek 2014E. Hudeczek, Das Skelett von Kleinstübing – Ein archäologischer Zufallsfund, in: Schmidt-Högl – Pöt-scher 2014, 70-73.
Hutz 2007F. Hutz, Der Markt Peggau vor 1850, in: Obersteiner 2007a, 155–174.
Karl u. a. 2009St. Karl – D. Modl – B. Porod (Hrsg.), Katalog Archäologiemuseum, SchvSt 22 (Graz 2009).
Karner 1986St. Karner, Die Steiermark im Dritten Reich 1938–1945. Aspekte ihrer politischen, wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Entwicklung (Graz 1986).
Kloiber 1959–61Ä. Kloiber, Gräber des 10./11. Jh. n. Chr. in Waldstein bei Deutsch-feistritz, SchvSt 9, 1959–61, 59–62.
Kramer 1981D. Kramer, Vom Neolithikum bis zur Römischen Kaiserzeit. Unter-suchungen zur ältesten Besied-lungsgeschichte der Steiermark, mit besonderer Berücksichtigung der mittelsteirischen Höhensiedlungen. Ungedr. Diss. Univ. Salzburg, 3 Bde. (Salzburg 1981).
Kramer 2007D. Kramer, Ur- und Frühgeschichte von Peggau, in: Obersteiner 2007a, 39–82.
Kramer, M. 1992M. Kramer, Frühmittelalterfunde aus Frohnleiten, AGST-Nachrichtenblatt 2/1992, 1992, 3–8.
Kramer, M. 1994M. Kramer, Latènefunde der Stei-ermark. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 43 (Marburg 1994).
Kramer, M. 2013M. Kramer, Keramische Funde, in: M. Egg – D. Kramer (Hrsg.), Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark: der Kröllkogel, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmu-seums 110 (Mainz 2013), 305–374.
Kusch 1996H. Kusch, Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Höhlenfundplätze entlang des mittleren Murtales (Steiermark), Grazer altertumskund-liche Studien 2 (Frankfurt am Main 1996).
Kusch 1998aH. Kusch, Die Bockhöhle (Kat. Nr. 2836/163) bei Peggau, ein neuer Magdalénienfundplatz im mittelsteirischen Bergland (Austria), in: H. Kusch (Red.), Die Bockhöhle bei Peggau in der Steiermark - Grabung 1997. Eine interdisziplinäre Untersuchung
234
Mottl 1951M. Mottl, Die Repolust–Höhle bei Peggau (Steiermark) und ihre eiszeitlichen Bewohner. Mit einem Beitrag von V. Maurin, ArchA 8, 1951, 1–78.
Mottl 1953M. Mottl, Die Erforschung der Höh-len, in: K. Murban – M. Mottl, Eis-zeitforschungen des Joanneums in Höhlen der Steiermark, Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik am Landesmuseum „Joanneum“ 11 (Graz 1953), 14–58.
Mottl 1959aM. Mottl, Peggau, BH Graz–Umge-bung, FÖ 5, 1959, 18 u. 146.
Mottl 1959bM. Mottl, Deutschfeistritz, BH Graz–Umgebung, FÖ 5, 1959, 145.
Mottl 1975M. Mottl, Die pleistozänen Säuge-tierfaunen und Kulturen des Grazer Berglandes, in: H. W. Flügel, Die Geologie des Grazer Berglandes. Erläuterungen zur Geologischen Wanderkarte des Grazer Berglandes 1:100.000, Mitt. Abt. Geol. Paläont. Bergbau Landesmus. Joanneum, Sonderheft 1 (Graz/Wien 1975), 159–185.
Murgg 2000W. Murgg, Mittelalterliche (und frühneuzeitliche) Wehrbauten in den Bezirken Graz–Umgebung und Weiz, Steiermark. Aufnahme der Bodendenkmale, Beiträge zur Mit-telalterarchäologie in Österreich 16, 2000, 129–190.
Murgg 2009W. Murgg, Burgruinen der Steiermark. Mit Plänen von M. Aigner, G. Reich-halter und H. Reichhalter sowie archäologischen Beiträgen von M. Lehner, FÖMat B 2 (Wien 2009).
Murgg 2014 W. Murgg, Burgruinen, in: Schmidt-Högl – Pötscher 2014, 52-69.
und deren Forschungsergebnisse in Zusammenarbeit mit dem Lan-desmuseum Joanneum in Graz, der Karl-Franzens-Universität in Graz, der Geologischen Bundesanstalt und dem Naturhistorischen Museum in Wien, Mitt. Geol. und Paläont. Landesmuseum Joanneum 56, 1998, 21–48.
Kusch 1998bH. Kusch, Die Grabung 1997 in der Bockhöhle bei Peggau in der Steiermark, FÖ 37, 1998, 469–478.
Kusch 2003H. Kusch, Archäologisches Fundgut aus der Leopoldinengrotte bei Semriach, Steiermark, FÖ 42, 2003, 307–322.
Kusch u. a. 2006H. Kusch – Ch. Spötl – K.–H. Offenbecher – J. Kramers, Der prähis-torische Kalksinterplattenabbau im Höhlenabschnitt „Katzensteig“ der Lurgrotte bei Semriach, Steiermark, SchvSt 19, 2006, 241–255.
Lebzelter 1927V. Lebzelter, Römische Schädel aus der Steiermark, MAGW VIII, 1927, 39–43.
Lehner 2004M. Lehner, Der Admonterhof und die Grazer Stadtmauer. Bericht über die archäologischen Untersuchungen in der Nordwestecke der mittelal-terlichen Stadt Graz, FÖ 43, 2004, 621–660.
Lehner 2009M. Lehner, Binnennoricum - Karantanien zwischen Römerzeit und Hochmittelal-ter. Ein Beitrag zur Frage von Ortskon-tinuität und Ortsdiskontinuität aus archäologischer Sicht. Ungedr. Habil. Univ. Graz (Graz 2009).
Lohner-Urban – Steigberger 2012U. Lohner-Urban - E. Steigberger, KG Peggau, MG Peggau, FÖ 51, 2012, 316f.
Mandl 1996F. Mandl, Das östliche Dachstein-plateau - 4000 Jahre Geschichte der hochalpinen Weide- und Almwirtschaft, in: G. Cerwinka und F. Mandl, Dachstein – Vier Jahr-tausende Almen im Hochgebirge 1, Mitteilungen der ANISA 17/2-3, 1996, 7–165.
Maurin 1953V. Maurin, Die geologischen Verhält-nisse im Raum zwischen Deutsch–feistritz und Semriach. Ungedr. Diss. Univ. Graz (Graz 1953).
Meyer 1888A. Meyer, Die Münzen und Medaillen der Familie Eggenberg, Numismati-sche Zeitschrift 20, 1888, 183-236.
Modrijan 1946–1950W. Modrijan, Rothleiten, BH Graz Umgebung, FÖ 5, 1946–1950, 70.
Modrijan 1953W. Modrijan, Neue Ausgrabungen in Steiermark, ZHVSt 44, 1953, 3–30.
Modrijan 1954W. Modrijan, Römerzeitliches Grab aus Waldstein bei Übelbach, BlHk 28/4, 1954, 116.
Modrijan 1963W. Modrijan, Die Frühmittelalter-funde (8.–11. Jhdt.) der Steiermark, SchvSt 11, 1963, 45–84.
Modrijan 1966/67W. Modrijan, Neue Funde aus Peggau und die Bedeutung des Fundgebie-tes Peggau und Umgebung für die steirische Ur– und Frühgeschichte, SchvSt 13, 1966/67, 5–19.
Modrijan 1969W. Modrijan, Römerzeitliche Villen und Landhäuser in der Steiermark, SchStKlSch 9 (Graz 1969).
Mottl 1950M. Mottl, Das Protoaurignacien der Repolusthöhle bei Peggau, Steiermark, ArchA 5, 1950, 6–17.
235
Steinklauber 2010U. Steinklauber, Die römerzeitliche Villa von Kleinstübing, Sprechende Steine 24, 2010, 22–29.
Steinklauber 2012U. Steinklauber, Die Spätantike in der Steiermark, SchvSt 25 / Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 58, 2012, 156–163.
Steinklauber – Artner 2010U. Steinklauber – W. Artner, Abschlussbericht zu den Grabungs– und Konservierungsarbeiten in der römerzeitlichen „Villa“ von Kleinstübing, Steiermark, FÖ 49, 2010, 163–172.
Tiefengraber 2007G. Tiefengraber, Archäologische Funde vom Fuße des Falkenberges bei Strettweg. Ein Beitrag zur Besied-lungsgeschichte des Aichfeldes, Berichte des Museumsvereines Judenburg 40, 2007, 3–39.
Tiefengraber, S. 2011S. Tiefengraber, KG Kleinstübing, MG Deutschfeistritz [Fundchronik/Steiermark], FÖ 50, 2011, 400.
Vaculik 2000E. Vaculik, Durch die Zeiten, in: Kulturverein Sensenwerk Deutsch-feistritz (Hrsg.), Das Übelbachtal. Menschen, Wirtschaft und Kultur – im Wandel der Zeit (Deutschfeistritz 2000), 8–17.
Weber 1969E. Weber, Die römerzeitlichen Inschriften der Steiermark, Ver-öffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark. Arbeiten zur Quellenkunde 35 (Graz 1969).
Wedenig 1989R. Wedenig, Das Fragment eines Schlangengefäßes und seine Par-allelen in Europa, in: Fuchs 1989a, 139–149.
Obersteiner 2007aG. P. Obersteiner (Red.), Geschichte von Peggau. Erster Teil: Von den Anfängen bis etwa 1850. Mit Beiträ-gen von H. Hiden, F. Hutz †, D. Kramer, N. Müller und G. P. Obersteiner (Peggau 2007).
Obersteiner 2007bG. P. Obersteiner, Burg und Herr-schaft Peggau seit dem Mittelalter, in: Obersteiner 2007a, 83–109.
Peitler 2014K. Peitler, „Taler und Groschen“ – Geld aus Waldstein, in: Schmidt-Högl – Pötscher 2014, 440-443.
Peitler u. a. 2011K. Peitler – M. Mele – B. Porod – D. Modl, Lebensspuren. Die bedeu-tendsten Objekte der Archäologi-schen Sammlungen und des Münz-kabinetts, SchvSt 24 (Graz 2011).
Pickl 1996O. Pickl, 700 Jahre Marktgemeinde Frohnleiten (Frohnleiten 1996).
Pittioni 1936R. Pittioni, Ein Steinbeil aus Stübing, Steiermark, WPZ XXIII, 1936, 151f.
Porod 2005B. Porod, Die archäologischen Aus-grabungen der Familien Heider und Thinnfeld auf dem Kugelstein, in: B. Hebert (Hrsg.), Von der Weite des Blicks. Maler, Forscher, Reisende. Die Familien Thinnfeld und Heider in Deutschfeistritz 1878–1938. Begleitbroschüre zur Ausstellung der Neuen Galerie Sensenwerk und des Landesmuseums Joanneum in Deutschfeistritz, Thinnfeldensia IV (Deutschfeistritz 2005), 15–19.
Pratobevera 1854E. Pratobevera, Archäologische Bei-träge. 1. Die Fundorte keltischer und römischer Antiken in Steiermark. 2. Ein neu aufgefundener Mosaikboden in Cilli, MHVSt 5, 1854, 107–124.
Reisinger 2000N. Reisinger, Bergbau im Übel-bachtal und seiner Umgebung, in: Kulturverein Sensenwerk Deutsch-feistritz (Hrsg.), Das Übelbachtal. Menschen, Wirtschaft und Kultur – im Wandel der Zeit (Deutschfeistritz 2000), 46–55.
Roscher 1997M. Roscher, Der Reinerhof – Ergeb-nisse der archäologischen Unter-suchungen im Grazer Reinerhof mit besonderer Berücksichtigung der keramischen Funde. Ungedr. Dipl. Univ. Graz (Graz 1997).
Schachinger 2014U. Schachinger, Münzfunde aus der Region Deutschfeistritz, in: Schmidt-Högl – Pötscher 2014, 74-78.
Schmid 1934W. Schmid, Ein Dolchstab aus der Steiermark, Prähistorische Zeit-schrift XXV/3–4, 1934, 158–159.
Schmidt-Högl 2014W. Schmidt-Högl, Bergbaue und Schmelzhütten im Raum Deutsch-feistritz, in: Schmidt-Högl – Pöt-scher 2014, 374-419.
Schmidt-Högl – Pötscher 2014W. Schmidt-Högl – J. Pötscher (Red.), Deutschfeistritz – Band 2: Vergangenheit (Deutschfeistritz 2014).
Spennemann 1984D. R. Spennemann, Burgerroth – Eine spätneolithische Höhensiedlung in Unterfranken, BAR International Series 219 (Oxford 1984).
Steinklauber 2008U. Steinklauber, Ein kleines spätan-tikes Kapitell vom Kugelstein bei Frohnleiten. Mit einem Exkurs zum Frauenberg bei Leibnitz, SchvSt 21, 2008, 415–424.
236
Woisetschläger – Krenn 1982K. Woisetschläger – P. Krenn, Steiermark (ohne Graz), Dehio–Handbuch – Die Kunstdenkmäler Österreichs (Wien 1982).
Wolf 1956F. Wolf, Ein Münzfund bei Adriach nächst Frohnleiten, SchvSt 6, 1956, 55–79.
Zeilinger 1953K. Zeilinger, Das La–Tène–Gräberfeld von Frohnleiten und der Fundbe-stand der La–Tène–Kultur in der Steiermark, SchvSt 2, 1953, 63–85.
Weihs 2004A. Weihs, Der urnenfelderzeitliche Depotfund von Peggau (Steiermark). Mit einem archäometallurgischen Beitrag von N. Trampuž–Orel, T. Drglin, R. Urankar und B. Orel, UPA 114 (Bonn 2004).
Weiß 1998A. Weiß, Aus dem Berg– und Hüt-tenwesen in Deutschfeistritz, res montanarum 17, 1998, 16–24.
Weller 2014U. Weller, Äxte und Beile. erkennen – bestimmen – beschreiben, Bestim-mungsbuch Archäologie 2 (München 2014).
Windholz–Konrad 2002M. Windholz–Konrad, Ein mittel– bis jüngerurnenfelderzeitlicher Depot-fund aus Waldstein, Steiermark, FÖ 41, 2002, 395–405.
Windholz–Konrad 2003M. Windholz–Konrad, Funde entlang der Traun zwischen Ödensee und Hallstätter See. Vorlage der prähis-torischen bis neuzeitlichen Metall-funde aus den von Karl Gaisberger und Mitarbeitern vorgenommenen Prospektionen im Salzkammergut, mit besonderer Berücksichtigung der Altfunde, FÖMat A 13 (Wien 2003).
237