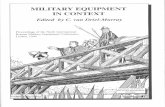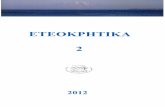Frühmittelalterliche Frauen in Waffen? Divergenzen zwischen der archäologischen und...
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Frühmittelalterliche Frauen in Waffen? Divergenzen zwischen der archäologischen und...
219
Bayerische Vorgeschichtsblätter 79, 2014, S. 219–240
Archäologie
Zur geschlechtsspezifischen Grabausstattung im Frühen Mittelalter
Die merowingerzeitlichen Reihengräberfelder bilden eine hervorragende Grundlage für sozialgeschichtliche Untersuchungen. Dies liegt vor allem daran, dass sich anhand der Grabausstattungen die Geschlechter häu-fig gut voneinander unterscheiden lassen, und darauf aufbauend weiterführende Fragestellungen zur Rolle von Männern und Frauen in der frühmittelalterlichen Gesellschaft verfolgt werden können. Eine Reihe ge-schlechtsspezifischer Beigabengruppen ermöglicht eine eindeutige Zuweisung. Für Frauengräber sind ins-besondere Schmuckgegenstände charakteristisch, wäh-rend ein Teil der Männer vor allem durch eine Waffen-ausstattung gekennzeichnet wird1. Während zeit- und regionalspezifisch auch andere Gegenstände die sozia-le Rolle und die gesellschaftliche Position des Mannes symbolisieren können, verdeutlicht die Bewaffnung den besonderen Rang des Waffenträgers als (ehemals) kämpfendes Mitglied der Gemeinschaft, wobei den ein-zelnen Waffentypen möglicherweise unterschiedliche, heute schwierig zu entschlüsselnde Bedeutungen beige-legt wurden2. Diese an das biologische Geschlecht des Verstorbenen offenbar eng gebundenen Ausstattungs-muster ermöglichen bei aller im Übrigen erkennbaren Variabilität im Bestattungsbrauchtum auf breiter Basis angelegte sozialhistorische Analysen. Dabei wurde im-mer nur ein Teil der Bevölkerung mit geschlechtsspe-zifischen Beigaben ausgestattet, worin sich zum einen soziale Unterschiede, zum anderen aber auch alters-bezogene Ausstattungsmuster widerspiegeln. Männli-chen wie weiblichen Toten können neben Schmuck und Waffen zudem Werkzeuge und Geräte beigegeben wer-den, die oftmals ebenfalls eine geschlechtsspezifische Differenzierung erlauben. Auf den ersten Blick als ge-schlechtsspezifisch erscheinende Werkzeuge und Gerä-te stellen allerdings keine immer und überall verbind-lich eingehaltene Muster dar, sondern allenfalls Ten-denzen3. So zeichnet sich bei weiblichen Bestattungen durch die Beigabe von Spinnwirteln4, Webbrettchen5, als zum Flachsbrechen ansprechbare Geräte6, Spindeln, Färbemitteln und spezielle Gefäße7 oder gar ganze
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen? Divergenzen zwischen der archäologischen und anthropologischen Geschlechtsansprache
Tobias Gärtner, Regensburg, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott, München
Webstühle8 überaus deutlich das textilherstellende und -verarbeitende Handwerk ab, wobei es aber durchaus auch Hinweise auf eine weibliche Tätigkeit in der Kera-mikherstellung gibt9. In den Werkzeugen und Geräten, die aus Männergräbern stammen, spiegeln sich dagegen v. a. das metallverarbeitende10 Handwerk sowie Tätigkei-ten im Holzhandwerk11 und in der Lederbearbeitung12. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass auch Werk-zeuge, die mit der Erstellung von textilen Bändern in Verbindung gebracht werden, in Männergräbern ange-troffen werden können13. In wieweit die beigegebenen Werkzeuge und Geräte tatsächlich die Realität der tägli-chen Arbeitswelt widerspiegeln ist noch nicht abschlie-ßend geklärt. Es scheint durchaus möglich, dass die Ausstattung der Toten bei Aufbahrung und Beisetzung von bestimmten Vorstellungen geprägt war, die nicht unbedingt etwas mit der täglichen realen Arbeitswelt zu tun hat. Schon mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass sich in der Beigabe von verschiedenen Werkzeugen eher ein genormtes Rollenbild oder ein Anspruch auf eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft widerspie-gelt14. Es erscheint nur schwer vorstellbar, dass Frauen nicht in der Lage oder sozialen Position gewesen sein sollen, ein Feuer anzuzünden, auch wenn Feuerstahl und Feuerstein nahezu ausschließlich Männern ins Grab beigegeben werden15. Gefäße aus Holz, Ton, Glas oder Metall werden dagegen beiden Geschlechtern gleichermaßen ins Grab beigegeben. Für Altbayern lässt sich hier jedoch ins-gesamt eine starke Zurückhaltung beobachten. Beige-geben werden hier in erster Linie Schank- bzw. Trink-
1 Brather u. a. 2009; Effros 2000, 635; Härke 2011, 101. 2 Halsall 2010, 360 f.; 364–369. 3 Brather 2004, 505. 4 Gutsmiedl-Schümann 2011, 37–47. 5 Altenerding Grab 607: Sage 1984 Taf. 81,17; Losert 2003, 297. 6 Losert 2003, 299. 7 Bartel/Codreanu-Windauer 1995. 8 Fingerlin 1981. 9 Knaut 1987.10 Losert 2003, 392.11 Straubing Grab 702: Geisler 1998 Taf. 249,8.12 Dannheimer 1987, 68–80; Gärtner 2013, 256.13 Hundt 1974; Losert 2003, 393 f.14 Koch 1996; Gärtner 2013, 262.15 Gärtner 2013, 252.
BVBl_ 79_2014.indd 219 03.11.2014 10:44:16
220
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
gefäße oder sehr kleinformatige Gefäße16, bevorzugt v. a. in Kindergräbern. Normalerweise wird die archäologische Auswer-tung eines frühmittelalterlichen Gräberfeldes von einer anthropologischen Analyse ergänzt, die im Minimal-fall eine Alters- und Geschlechtsdiagnose umfasst. Für weiterführende Aussagen haben sich die auf anthropo-logischem Weg ermittelten Sterbealterbestimmungen von sehr großem Wert erwiesen, konzentrierte sich die archäologische Forschung doch in den letzten Jahren stark auf die lebensalterabhängige Ausstattung der Ver-storbenen17. Die dabei erzielten Ergebnisse sind hochin-teressant. Ohne diese hier jetzt im Detail aufführen zu können, so zeigt sich, dass Mädchen offenbar erst ab der Altersstufe infans II im Haushandwerk mit tätig waren18, dass eine komplette Fibelausstattung von der Heirats- und/oder Gebärfähigkeit mit beeinflusst sein konnte19 oder dass das Alter eines Mannes darauf Einfluss hatte, ob er seinen Gürtel bei der Bestattung angelegt oder le-diglich beigelegt bekam, worin sich vielleicht sein An-spruch auf eine Führungsposition zu Lebzeiten wider-spiegelt20. Wie oben bei den Werkzeugen bereits ange-deutet, ist es auch bei anderen Objekten möglich, dass
Abb. 1. Silberohrringe aus Männergräbern. 1 Petting Grab 586; 2 Petting Grab 85; 3 Waging Grab 56. M. 1:1.
Abb. 2. Scheiden-querbeschlag aus dem „Fürstengrab“ von Wittislingen. Silber, vergoldet, Granate. M. 1:1.
diese die engen Grenzen, die durch das Geschlecht vorbe-stimmt erscheinen, überspringen können. So kommen Schmuckobjekte, die man ja weitgehend der weiblichen Sphäre zuschreibt, auch in Männergräbern vor, wobei hier nicht die Schmuckstücke Gegenstand sein sollen, die als Tascheninhalt angetroffen interpretiert werden können21. Besonders prägnant tritt der Ringschmuck hervor. Nicht nur Goldfingerringe22, die aufgrund ihrer Seltenheit durchaus als Statussymbole zu werten sind, auch einfachere Exemplare aus Bronze wurden von Män-nern an der Hand getragen23. Ebenso kommen Armringe und Ohrringe in frühmittelalterlichen Männergräbern vor24. Während Finger- und Armringe sowohl in ihrer Form wie ihrer Tragweise quasi unisex-Objekte sind, werden Ohrringe von Männern offenbar ausschließlich in der Einzahl – rechts oder links – getragen und auch die verwendeten Formen unterscheiden sich zumeist deutlich von den aus den Frauengräbern bekannten Ohr-ringtypen (Abb. 1)25. Auch Glasperlen kommen ab und zu in Männergräbern vor, besonders bei Knaben oder Jugendlichen26. Exemplarisch dafür mag das Grab 554 von Straubing- Bajuwarenstraße stehen, in dem ein 14 bis 15 Jahre alter juveniler Junge zu Beginn des 7. Jahr-hunderts mit Messer, Sax, einer vielteiligen Gürtelgar-nitur27 und einem kleinen Ensemble aus sechs Perlen am Hals – einer Kette oder einem sonstigen bestickten Gegenstand –beigesetzt worden war. Auch bei erwachse-nen Männern finden sich von Zeit zu Zeit Glasperlen als Beigabe, in Zusammenhang mit der Spatha, als Taschen/Etuibesatz oder als Tascheninhalt28. Ein umfangreicher Perlenschmuck im Hals-/Brustbereich ist bislang jedoch noch nicht beobachtet worden, so dass das Tragen von Perlenketten oder perlenbestickten Tüchern offenbar den Frauen vorbehalten blieb. Möglicherweise ist hier verstärkt auf regionale Unterschiede zu achten, zeichnen sich doch deutliche Differenzen zwischen dem hier in erster Linie beobachteten süddeutschen Raum, und der regio um Metz ab, die Guy Halsall diesbezüglich unter-sucht hat29. Dort kommen Ohrringe, Armringe sowie von Halsall pauschal unter dem Begriff „necklace“ subsu-mierte Perlen ausschließlich in Frauengräbern vor30, ge-
BVBl_ 79_2014.indd 220 03.11.2014 10:44:17
221
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
nau diese drei Fundgruppen sind in Süddeutschland aber auch aus Männergräbern bekannt. Halsall verwendete als Basis für seine Aussagen allerdings lediglich 40 ge-schlossene Grabfunde, was für statistisch belastbare Aus-sagen vielleicht nicht ganz ausreichen mag. Bislang nicht beobachtet wurde eine Kombination von Fibeln und/oder Gehängen in Tragelage mit einer ansonsten männlichen Ausstattung mit Ausnahmen von solchen, die Pfeilspit-zen enthielten. Bis auf die bekannten Ausnahmen des späten 5. Jahrhunderts, in denen spätrömische Militär-gürtel von Frauen getragen wurden31, werden im 6. und 7. Jahrhundert Frauen keine kompletten Männergür-tel mit mehreren Metallbesätzen ins Grab mitgegeben. Dabei können sich in Frauengräbern durchaus Objekte befinden, die eher der männlichen Sphäre zuzurechnen sind. Teile der Spathascheide (Straubing Grab 238) sind hier ebenso zu finden wie Bestandteile vom Spathagurt (Abb. 2) und vom Zaumzeug32 oder Besätze und Riemen-zungen von mehr- und vielteiligen Gürtelgarnituren. Die Besätze und Riemenzungen werden von den Frauen zumeist in das Gehänge integriert. Auffällig ist dabei, dass bei vielen dieser Frauengräber nirgendwo ein Männergrab in der Nähe zu finden ist, dem gera-de diese Objekte am Gürtel, Wehrgurt oder Zaumzeug abgehen würden, möchte man doch – vielleicht etwas sentimental – annehmen, dass die Frauen in den Gür-telbestandteilen Erinnerungsstücke an den ehemaligen Träger sahen33. Zwei Deutungen bieten sich dafür an: Der entsprechende Mann wurde an einem anderen Ort bestattet oder diese Objekte wurden speziell für eine Verwendung am Gehänge hergestellt. Letzteres wurde auch bereits für die zahlreich vorkommenden Ringge-flechte vermutet34, die Frauen am Gehänge oder in den Halsschmuck integriert tragen konnten. Einigen Frau-en wurden diese Ringgeflechte, die früher als Teile von Kettenhemden angesprochen wurden, bei der Bestat-tung lediglich in die Hand gegeben35. Ein apotropäischer Charakter darf diesen Ringgeflechten wohl mit einiger Sicherheit zugeschrieben werden, ebenso wird dies für die äußerst selten vorkommenden Miniaturwaffen in frühmittelalterlichen Frauengräbern gelten36. Auch für die Bestandteile von Männergürteln, die in Gehänge in-tegriert wurden, liegt in einigen Fällen eine apotropä-ische Funktion nahe. Eine solche wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit dem ebergestaltigen Beschlag einer
Abb. 3. Sindelsdorf Grab 29. Bronzebeschlag am Gürtelgehänge. M. 2:3.
16 Haas 1994; Haas-Gebhard 2013, 148–151. 17 Brather 2005; Stauch 2007; Gutsmiedl-Schümann 2011; Gärt-
ner 2012.18 Gutsmiedl-Schümann 2011, 64, Tab. 6.19 Brather 2005; Haas-Gebhard 2013, 36 f.20 Haas-Gebhard 2013, 141.21 Z. B. Lavoye Grab 188: Joffroy 1974, Taf. 20.22 Ziegaus 2010.23 Altenerding Grab 888: Sage 1984 Taf. 113,29.24 Wührer 2000, 110.25 Schleitheim-Hebsack Grab 735: Burzler/Höneisen/Leicht/
Ruckstuhl 2002 Taf. 91; Horb-Altheim Grab 23 und 66: Beil-harz 2011 Taf. 17 A 1 u. 53.1; Chevenez-Lai Coiratte, Dép. Jura : Othenin-Girard/Elyaqtyne/Friedli/Gerber/Gonda/Lége-ret/Saltel/Stadler 2005, 51 Abb. 14; Fischlham-Hafeld Grab 4: Aspöck 2001, 243, 264 Taf. 3,23; Hellmitzheim Grab 20: Dannheimer 1962 Taf. 78,14. Weitere Beispiele: Waging Grab 56, Archäolog. Staatsslg. München Inv. 2010,4055a; Greding-Großhöbing, Mehrfachbestattung Archäolog. Staatsslg. Mün-chen Inv. 2010,4583p; Petting Grab 56 u. 586. Archäolog. Staatsslg. München Inv. 2011,4685 u. 5186.
26 Lohrke 2004, 88.27 Geisler 1998 Taf. 198.28 Schleitheim Grab 608: Burzler/Höneisen/Leicht/Ruckstuhl
2002 Taf. 72; Hellmitzheim Grab 29: Dannheimer 1962, 119. In Zeuzleben gibt es fünf Männergräber mit Perlen: Rettner 1997, 119 f.
29 Halsall 2010.30 Halsall 2010, 295 Abb. 8.2; 296, Abb. 8,3.31 Burzler/Höneisen/Leicht/Ruckstuhl 2002, 90–95.32 Bachran 1991; Burzler/Höneisen/Leicht/Ruckstuhl 2002, 175.33 Dabei ist es durchaus möglich, dass Bestandteile einer einzi-
gen Gürtelgarnitur auf zwei unterschiedliche Träger verteilt werden: Haas-Gebhard 1998, 39. 97, Taf. 81 u. 83.
34 Knaut 1993, 100.35 Haas-Gebhard 2013, 101.36 Koch 1970; Reimann 1995.37 Haas-Gebhard 2013, 99 Abb. 2 unten.38 Menke 2013 Taf. 12,7b.39 Koch 2001, 286 f. Eine ähnliche Garnitur gibt es in Altbayern
lediglich noch aus Gräfelfing, Lkr. München, vergesellschaf-tet mit dem bekannten Runensax. Die Publikation durch B. Haas-Gebhard befindet sich in Vorbereitung.
mehrteiligen Bronzegarnitur zusprechen dürfen, der an einem raffiniert gestalteten Gehänge37 in Sindels-dorf Grab 2938 Platz gefunden hatte (Abb. 3). Gürtelgar-nituren, zu denen solche zoomorphen Besätze gehören, zählen in Altbayern bis heute zu den großen Exoten39, so dass man hier zu Recht auch darüber rätseln kann,
BVBl_ 79_2014.indd 221 03.11.2014 10:44:17
222
wie die Frau in den Besitz dieses Besatzes gekommen sein mag, denn eine eigenständige Produktion als Ge-hängeschmuck wird man hier ausschließen wollen. Mit einiger Sicherheit hatte man den Gesichtern auf den Besätzen einer maskentauschierten vielteiligen Gürtel-garnitur eine unheilabwehrende Bedeutung beigemes-sen, die in Lauterhofen in zwei Frauengräber gelangten. Offenbar handelte es sich dabei um Bestandteile einer einzigen Gürtelgarnitur, von der die Gürtelschnalle in ebendieser Funktion in das Grab 79, die Bestattung ei-ner adulten Frau gelangte40, während fünf Besätze, ein Vertikalbeschlag und eine Riemenzunge derselben Gar-nitur am Gehänge der im juvenilen Alter verstorbenen Frau in Grab 59 Platz gefunden hatten41. Die zu unter-stellenden anderen Bestandteile dieser Gürtelgarnitur gelangten nicht in diesem Lauterhofener Friedhof in ein Grab. In eine andere Sphäre führen dagegen die beiden Grabfunde von Kirchheim/R. Grab 32642 und Wittislin-gen43. In Kirchheim wurden vier Riemenzungen und in Wittislingen ebenfalls vier Riemenzungen sowie drei Besätze von tierstiltauschierten vielteiligen Gürtelgar-nituren in ein Gehänge integriert (Abb. 4). Während ein Besatz oder auch mehrere Besätze aufgrund ihrer üblichen Fixierungsweise mit Ösen oder Stiftösen pro-blemlos auf einem einzigen, vertikal verlaufenden Ge-hängeband angebracht werden können und auch unter-einander, benötigt man zur sinnvollen Anbringung von Riemenzungen jeweils ein ledernes Riemenende. Für die je vier Riemenzungen in Wittislingen und Kirchheim 326 benötigte man demnach auch vier Riemenenden,
die Gürtelgehänge dürften also wie eine umfunktio-nierte, vielteilige Gürtelgarnitur gewirkt haben. Auch in den extravaganten Gehängen manifestiert sich die herausragende soziale Position dieser beiden Frauen, die zudem beide Goldfingerringe44 trugen und Goldblech-scheibenfibeln wohl aus derselben Werkstatt besaßen45. Ob man dabei bewusst den männlichen Charakter einer vielteiligen Gürtelgarnitur zitiert hat, kann nur unter-stellt werden.
Frauen in Waffen?
Hinsichtlich der Geschlechtsansprache kommt es nur in sehr seltenen Fällen zu einer Abweichung zwischen der archäologischen und anthropologischen Einschät-zung. Bis vor kurzem war es in der Forschung noch üblich, von einer anthropologischen Fehlbestimmung auszugehen46. In den Schriftquellen gibt es deutliche Hinweise darauf, dass auch Frauen in der Merowingerzeit, die von gewalttätigen Auseinandersetzungen aller Art ge-prägt war47, zur Waffe greifen konnten48. So trägt zwar die Geschichte vom tragischen Ende des dux Amalo, der nach einer erzwungenen Nacht von einer Frau mit sei-nem eigenen Schwert, das er offenbar am Kopfende sei-nes Bettes aufbewahrt hatte49, erschlagen wird, starke Elemente der alttestamentarischen Judith-Geschichte, so dass ihre Authentizität angezweifelt werden kann. Einen eindeutigen Beleg dafür, dass Frauen zur Waffe griffen, liegt in einer Bestimmung der lex Baiuvario-rum vor, in der einer Frau das nämliche Wergeld wie den Männern zugesprochen wird, wenn sie aber „..so herzhaft ist, dass sie kämpfen will…50“ und nicht das ihr eigentliche zustehende in doppelter Höhe51. Das von König Liutprand († 744) erlassene Kapitel 141 des lan-gobardischen Rechts schildert eine Begebenheit, die auf den ersten Blick nahezu unglaubwürdig erscheinen mag52. Auch im langobardischen Recht gilt der Überfall auf ein Dorf mit einer kleinen Gruppe Bewaffneter als schwerer Friedensbruch, den selbst zuvor von Seiten der Opfer begangenes Unrecht nicht rechtfertigen kann. Der Anführer hat mit der Todesstrafe zu rechnen53, die übrigen Angreifer müssen eine Buße von 80 Schillingen entrichten, dazu weitere Kompensationen für Brand und Totschlag54. Um dieser vorhersehbaren Bestrafung zu entgehen, ergriffen die Männer eines Dorfes eine er-staunliche Maßnahme. Sie forderten die Frauen ihrer Siedlung, sowohl die freien wie auch die unfreien, auf, den Überfall durchzuführen, was auch tatsächlich ge-schah (fecerunt collegere mulieres suas, quascumque habue-runt, liberas et ancillas, et miserunt eas super homines). Da diese wie auch die anderen Regelungen Liutprands die älteren Rechtstexte aus der Zeit König Rotharis, unter dem 643 das langobardische Recht aufgezeichnet wor-den war, ergänzten und hierbei auf aktuelle Ereignisse bezogen waren, und nicht auf nur theoretisch erdachte Strafverstöße zu beziehen sind55, können wir an der Re-alität der hier bezeugten Ereignisse nicht zweifeln.
Abb. 4. Tauschierte Riemenzungen von vielteiligen Gürtel- garnituren aus dem „Fürstengrab“ von Wittislingen. M. 1:1.
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 222 03.11.2014 10:44:17
223
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
Gewaltausübung durch Frauen duldete das lango-bardische Recht nicht56. Die Frau stand vielmehr außer-halb der durch rechtliche Bestimmungen reglementier-ten Konfliktbewältigung im Fehdefall. So konnte eine Frau auch nicht das neben der Wergeldbuße fallweise fällig werdende Fehdegeld empfangen, dieses fiel viel-mehr demjenigen Mann zu, der die Munt über sie be-anspruchen konnte57. Da Frauen nach langobardischem Recht keine Gewalttat begehen konnten, sich hier also gewissermaßen eine Gesetzeslücke auftat, meinten die Männer offenbar, straffrei davonkommen zu können. Dennoch ersann der König eine Möglichkeit, dieses schwere Vergehen zu ahnden. Die Männer mussten für jeden durch ihre Frauen angerichteten Schaden eine Buße leisten. War man somit der Todesstrafe tatsäch-lich entgangen, so wurden die Frauen zusätzlich ge-demütigt, da sie mit ihrer Gewaltausübung gegen die Sitten verstoßen hatten und einem Wiederholungsfall vorgebeugt werden sollte. Sie wurden festgenommen, kahlgeschoren und mit Peitschen durch die Dörfer ge-trieben (conprehendat ipsas mulieres, et faciat eas decalvare et frustare per vicos vicinantes ipsius loci, ut de cetero mulieres tale malitia facere non presumant). Wie ist diese eindrucksvolle Schilderung bezüg-lich der durch Frauen ausgeübten Waffengewalt zu be-werten? Hier ist der Hinweis wichtig, dass das überfalle-ne Dorf von homines, qui minore habebant virtute bewohnt gewesen sei, wobei uns die Gründe hierfür verschwie-gen werden. Diese wenig wehrhaften Einwohner hatten den anrückenden Frauen offenbar nicht viel entgegen-zusetzen. Das bedeutet aber, dass es scheinbar auch mit weniger Aufwand möglich war, in dem Dorf Schaden anzurichten. Eine kampferprobte Truppe war hier nicht erforderlich. Zweifellos dürften die Frauen in ir-gendeiner Form bewaffnet gewesen sein, doch erfahren wir hierüber nichts Konkretes. Immerhin sollen sie är-ger als Männer gewütet haben (plagas fecerunt, et reliqua mala violento ordine plus crudeliter quam viri exercuerunt). Mit schwer gerüsteten und im Kampf bewährten Kämp-ferinnen müssen wir aber offensichtlich nicht rechnen. In den Rechtstexten anderer Gentes werden ge-walttätige Frauen ebenfalls genannt. So kennt auch das burgundische Recht eine den bayerischen Regelun-gen entsprechende Vorschrift, wonach eine an einem Kampf beteiligte Frau ihren erhöhten Wergeldstatus verliert. Bei den Franken finden wir hingegen nichts Vergleichbares58. Hinweise in der erzählenden Litera-tur bleiben meist undeutlich. So erzählt Gregor von Tours, dass Chuppa, ehemals Marschall des fränkischen Königs Chilperich, eine adlige Tochter entführen und ehelichen wollte. Ihre Mutter bemerkte dies jedoch rechtzeitig, ging Chuppa mit ihren Hofleuten entgegen und vertrieb ihn.59 Inwieweit die Mutter hierbei selbst zu den Waffen griff, bleibt offen. Auch wenn diese Stel-le als Hinweis auf weibliche Gewaltausübung gewertet wird, haben wir hier doch letztlich ebenfalls keine Hinweise auf das Waffenhandwerk ausübende Frauen. Das Bild der bewaffneten und kämpfenden Frau war dem Frühmittelalter keineswegs unbekannt. Es wurde
durch die antiken Schriftsteller in Form der Amazonen vermittelt. Die von ihnen geschilderten Frauengestalten wurden von den frühmittelalterlichen Gelehrten als real empfunden. So lässt etwa der so genannte Fredegar in seiner im 7. Jahrhundert verfassten Weltchronik die Frau des byzantinischen Feldherrn Basilius (um 505–565), die vor ihrer Heirat in einem Bordell ihren Lebens-unterhalt verdiente, von den Amazonen abstammen60. Sexuelle Freizügigkeit und Gewaltanwendung sind zwei von den christlichen spätantiken und frühmit-telalterlichen Autoren oft miteinander verknüpfte und angeprangerte Verhaltensweisen der Amazonen. Erst bei einigen Dichtern des 12. Jahrhunderts, welche die Amazonen in einem deutlich positiveren Licht sahen, wurden die sexuellen Verfehlungen entweder entschul-digt oder einfach beiseitegelassen61. Amazonen erschei-nen in mehreren frühmittelalterlichen Stammessagen. So setzt Jordanes in seiner in der Mitte des 6. Jahrhun-derts geschriebenen Getica die gotischen Frauen selbst mit den Amazonen gleich, da er die beim Asowschen Meer siedelnden Goten mit den Skythen, den Männern der Amazonen, identifizierte62. Die Frauen sollen sich mit Herkules gemessen haben, ja sie seien sogar kurz davor gewesen, Troja zu erobern63. Nach Paulus Diaco-nus (725/30–797/99) versuchten Amazonen die auf ihrer
40 Dannheimer 1998 Taf. 19,7.41 Dannheimer 1998 Taf. 17,1–6.23.42 Neuffer-Müller 1983 Taf. 61,2–5.43 Werner 1950 Taf. 16,2.3. Von Werner noch S. 62 als „nicht zur
Bestattung gehörig“ bezeichnet, da seinerzeit das Vorkom-men typisch männlicher Beigaben in Frauengräbern nicht vorstellbar war.
44 Neuffer-Müller 1983 Taf. 60,4; Werner 1950 Taf. 10,4a.b.45 Rettner 2010.46 Effros 2011, 634; Härke 2011, 103; Zintl 2004/2005, 340.47 Zur Omnipräsenz von Waffen in dieser Zeit s. Bodmer 1957,
bes. 62 f.48 Frauen wurden dabei sicherlich Opfer gewalttätiger Ausein-
andersetzungen, wie ein tödlicher Schwerthieb im os frontale der in Dittenheim Grab 149 bestatteten adulten Frau nahe-legt: Haas-Gebhard 1998, 199.
49 Gregor von Tours Hist. IX, 27.50 Beyerle 1926, 80 Tit. IV,29.51 Gärtner 2012, 164; ders. 2013, 266; Gutsmiedl-Schümann
2010, 87; Lynn 1979, 179.52 Bluhme 1869, 142.53 Bluhme 1869, 16.54 Dilcher 2008a, 347 f.55 Dilcher 2008a, 343.56 Balzaretti 1998, 186.57 Dilcher 2008a, 345 f.58 Halsall 2010, 364.59 Buchner 1970, 336: Ipsi quoque Chuppa, iterum commotis quibus-
dam de suis, filiam Badigysili quondam Caenomannensis episcopi diripere sibi in matrimonio voluit. Inruens autem nocte cum coneo sociorum in villam Maroialensi, ut voluntatem suam expleret, prae-sensit eum dolumque eius Magnatrudis matrisfamilias, genetrix sci-licet puellae; egressaque cum famulis contra eum, vi reppulit, caesis plerisque ex illis, unde non sine pudore discessum est.
60 Pohl 2004, 35; Reinle 2000, 11.61 Reinle 2000, 15–19.62 Goetz/Patzold/Welwei 2006, 16–19.63 Bitel 2002, 52; Wolfram 2005, 217.
BVBl_ 79_2014.indd 223 03.11.2014 10:44:17
224
Wanderung befindlichen Langobarden daran zu hin-dern, einen Fluss zu überqueren. Und auch Fredegar erwähnt im Zusammenhang mit der fränkischen Ur-sprungssage die Amazonen64. Die in den Stammessagen geschilderten Vorgänge sollten von den Zeitgenossen als reale Geschehnisse akzeptiert werden, ansonsten hätten sie ihren Sinn als die eigene ruhmreiche Ab-stammung untermauernde und Herrschaft legitimie-rende Schriften verfehlt. Allerdings war man sich kei-neswegs sicher, dass die Amazonen bis in die eigene Zeit überlebt hatten. Isidor von Sevilla (um 560–636) ging davon aus, dass Achilles, Herakles und Alexander der Große die Amazonen vernichtet hätten. Andere Auto-ren siedelten sie am Rande der Welt an, sodass sie zwar noch existierten, aber kein Zeitgenosse sie je zu sehen bekommen hätte. Von den christlichen Autoren wurde das Amazonenbild auch dazu benutzt, die wohlgeordne-ten Verhältnisse in der christlich geprägten Gegenwart von der vielfach chaotisch erscheinenden, paganen und unzivilisierten Vergangenheit der germanischen Gen-tes positiv abzuheben; einer Vergangenheit, in der so-gar Frauen als Kriegerinnen in Erscheinung treten und die Rollenbilder der Geschlechter auf den Kopf stellen konnten65. Man verortete die Amazonen somit entwe-der in der fernen Vergangenheit oder weit außerhalb der eigenen Lebenswelt – und noch im 12. Jahrhun-dert ging Cosmas von Prag (um 1045–1125) davon aus, die Amazonen hätten einst Böhmen bevölkert. Einen „späten“ Beleg für die Existenz von Amazonen schien den frühmittelalterlichen Autoren die Schilderung ei-nes anlässlich des erfolgreichen Gotenkriegs durchge-führten Triumphzugs des Aurelian von 274 zu liefern. Demnach sollen gotische Frauen den Amazonen gleich zusammen mit ihren Männern gegen Rom gekämpft haben66. Aufhorchen lässt schließlich der Bericht des Nikephoros (757/58–828), der im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen den Awaren und Byzanz zum Jahr 626 von gefallenen Frauen auf dem Schlachtfeld berichtet67. Aber in beiden Fällen schrei-ben die Chronisten mehr als 100 Jahre nach den Ereig-nissen, sodass an der Realitätsnähe der Darstellungen Zweifel erlaubt sind. So lassen sich aus der schriftlichen Überlieferung keine eindeutigen Belege für kämpfende, in die Rol-le eines männlichen Kriegers schlüpfende Frauen im Frühmittelalter beibringen. Frauen, die in Notsituatio-nen zu den Waffen greifen konnten, wird es aber zwei-fellos gegeben haben, wie schon die bayerischen und burgundischen Gesetzestexte nahelegen68. Dass man daraus auf „geübte Kämpferinnen“ mit „militärischer Schulung“ schließen kann69, erscheint aber fraglich. Auf die Diskussionen um die mögliche Existenz von kämpfenden Frauen in späteren Jahrhunderten, ins-besondere in Nordeuropa im 10.–13. Jahrhundert, soll hier nicht näher eingegangen werden. Die „Schildmai-den“ des Saxo Grammaticus (um 1140–1220) etwa wer-den von einigen Historikern in das Reich der Phantasie verwiesen und als Parallele zu den antiken Amazonen-legenden gesehen, während andere Wissenschaftler
historische Persönlichkeiten hinter diesen Schilderun-gen aufzuspüren versuchen70. Die Forschung ist hier noch nicht zu einem allgemein akzeptierten Urteil ge-langt. Die Vorstellung, dass eine Frau zur Verteidigung ihrer Interessen zur Waffe greifen konnte, existierte nach den schriftlichen Quellen im Frühen Mittelalter eindeutig71. Die Beisetzung von Frauen mit Waffen, die nach gängigem Interpretationsmuster die Annahme einer Tätigkeit der Verstorbenen im Kriegshandwerk implizierte, wird indes noch immer selten in Erwä-gung gezogen. Zu abwegig erscheint eine Existenz von Kriegerinnen in der mittelalterlichen Gesellschaft vor dem Hintergrund der uns bekannten gesellschaftli-chen Verhältnisse. Ausnahmefälle waren kaum denk-bar, müsste die Rolle der Frau als kämpfendes Mitglied der Gemeinschaft doch von ihrem Umfeld allgemein akzeptiert worden sein, damit sich dies auch im Grab-brauchtum widerspiegeln würde. Inwieweit von dem Gewohnten deutlich abweichendes Rollenverhalten bei der Beisetzung sichtbar zur Schau gestellt werden konnte, wurde in der Forschung noch nicht eingehend diskutiert72. Eine im Jahr 2000 durchgeführte aDNA-Analyse an Individuum C aus der Dreifachbestattung von Niederstotzingen Grab 3 erbrachte vorgeblich ein-deutige Hinweise auf ein weibliches Geschlecht des u. a. mit Spatha, Sax, Schild, Pfeilspitzen ausgestatte-ten 20–30 Jahre alten „Kriegers“73. Diese neue Beob-achtung wurde sehr schnell und bereitwillig in der Fachwelt akzeptiert und in Publikationen aller Art als eine kleine Sensation präsentiert74, bediente sie doch offenbar nur zu gut das Klischee der geheimnisvollen (attraktiven) Kriegerin, das auch heute noch in Martial-Arts- und Sandalenfilmen zu Genüge verbreitet wird75. Die aDNA-Analyse wurde ohne ein Hinterfragen der Analyse-Methoden und deren Probleme auch von sehr kritischen Geistern akzeptiert, ein weiteres Beispiel dafür, welches Vertrauen Archäologen nach wie vor den angeblich mit mathematischer Präzision arbeiten-den naturwissenschaftlichen Methoden entgegenbrin-gen76. Bei einer erst vor kurzem unter der Leitung von J. Wahl durchgeführten erneuten aDNA-Analyse des betroffenen Individuums konnte nun aber tatsächlich das bei der ersten Beprobung offenbar „entgangene“ Y-Chromosom entdeckt werden und der Krieger aus Nie-derstotzingen durfte so sein auf archäologischem Weg ermitteltes männliches Geschlecht behalten77. Die ers-te, im Jahr 2000 publizierte, fehlerhafte aDNA-Analyse führte jedoch dazu, dass man verstärkt bei Widersprü-chen in der Geschlechtsansprache der naturwissen-schaftlichen Methode Glauben schenkte und durch-aus Frauen mit komplett männlicher Ausstattung im Frühen Mittelalter akzeptierte78. Dies war der Anlass, sich erneut mit den altbayerischen Bestattungen ausei-nanderzusetzen, bei denen sich anthropologische und archäologische Geschlechtsansprache widersprachen, ausgehend von den entsprechenden Vorarbeiten T. Gärtners an niederbayerischen Gräberfeldern79. Dabei sollte eine erneute morphologische Skelettbestimmung stattfinden und auf einer abgesicherten methodischen
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 224 03.11.2014 10:44:18
225
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
Basis molekularbiologisch ergänzt werden. Diese Auf-gabe übernahm F. Immler in ihrer Master-Arbeit an der Fakultät für Biologie – Departement Biologie II – An-thropologie und Humangenetik der Ludwig-Maximili-ans-Universität München bei Prof. Dr. G. Grupe80. Ihre weiter unten dargelegten Ergebnisse führten dann zu einer Neubewertung der Grabbeigaben in einigen der ausgewählten Gräber.
Die untersuchten Grabfunde
Unter den Frauengräbern fallen vor allem zwei Bestat-tungen des Gräberfeldes von Straubing-Bajuwarenstra-ße auf. Grab 490 barg ein Individuum adulten Alters, das anthropologisch als sicher weiblich eingeordnet wurde81. Die archäologisch fassbare Grabausstattung besteht aus Spatha, Sax, Lanze, zwei Altfibeln, einem nicht ganz sicher bestimmbaren Bronzeobjekt (Niet oder Nadelkopf) und einem kleinen Bronzeblechfrag-ment. Da die beiden Fibeln als Archaika für eine Ge-schlechtsbestimmung nicht verwertbar sind, liegt hier ein rein männlich anmutendes Grabinventar vor. Über die punzverzierte Lanzenspitze mit durchgehendem Mittelgrat lässt sich das Grab in die Jahrzehnte um 600 einordnen (SD Ph. 7–8). Ein identisches Bild liefert Grab 38882. Hier lag ein aus anthropologischer Sicht vermut-lich weibliches Skelett einer Person, die in frühma-turem Alter verstorben war. Das Beigabenensemble umfasst eine Franziska und einen Kurzsax, ferner eine Eisenpinzette, eine Bronzeschnalle, ein Messer, einen Feuerstein, drei Eisengeräte und ein nicht näher an-sprechbares Bronzeblech. Über die Waffen kann das Grab dem mittleren Drittel oder der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts zugeordnet werden. Als weiteres Waffengrab muss Grab 9 aus Aschheim-Wasserturm Berücksichtigung finden. Hier war das Skelett mit ei-ner Lanzenspitze, drei Pfeilspitzen, einer Eisenschnalle und einer Tasche mit Geräten ausgestattet. Zwei Ringe und eine Schnalle aus Buntmetall im Bereich des linken Knies können nicht sicher in ihrer Funktion angespro-chen werden. Gutsmiedl-Schümann rechnet hier mit einer bewaffneten Frau, obwohl die Knochen von an-thropologischer Seite nur als „eher weiblich“ bestimmt wurden83. Der Befund wird den Jahrzehnten um 600 zugeordnet. Auch aus Weiding liegen zwei Bestattun-gen vor, bei denen als weiblich erkannte Skelette mit einer Waffe vergesellschaftet waren. Grab 121 enthielt einen Sax sowie ein Messer, während Grab 160, das dem letzten Drittel des 7. Jahrhunderts oder der Zeit um 700 zuzurechnen sein dürfte, einen Langsax, ein Klapp-messer, ein weiteres Messer, eine Schere und eine lange silberne Riemenzunge enthielt84. Als stark beraubtes und damit in der Interpretation schwer zu deutendes Grab wurde darüber hinaus Bestattung 62 aus Pliening mit als „wohl weiblich“ bestimmten Skelettresten ein-bezogen. Von einer vielteiligen Gürtelgarnitur hatte sich lediglich ein bichrom tauschierter Beschlag erhal-ten. Dazu fanden sich ein bronzener Saxscheidenniet
und eine Eisenschnalle85. In Peigen Grab 232 befand sich ein Skelett, das anthropologisch als weiblich be-stimmt wurde. Zum Grabinventar gehören zwei Pfeil-spitzen und ein Knochengerät. von Freeden deutete den Befund als Männergrab, wozu das paarige Vorkommen der Pfeilspitzen Anlass gibt, während einzelne Pfeile auch in Frauengräbern auftreten können86. Zu diesen weiblichen Bestattungen mit nur einem Pfeil als Beiga-be zählen auch die Gräber 138 und 172 aus Steinhöring, die ebenfalls in die Untersuchung einbezogen wur-den87. Bei Grab 138 fanden sich zusätzlich zehn Glas-perlen, die darauf hinweisen, dass die anthropologi-sche Bestimmung als weiblich zutreffend sein könnte. Die Pfeilspitze lag hier auf der linken Beckenschaufel, während sie in Grab 172, das keine weiteren Beigaben enthielt und ebenfalls von naturwissenschaftlicher Seite als Frauengrablege angesprochen wird, die Waffe zwischen den Oberschenkeln niedergelegt worden war. Bestattungen, deren Skelette bei einem durchweg weib-lich anmutenden Inventar als anthropologisch männ-lich bestimmt wurden, sind demgegenüber in der Min-derzahl. In Grab 26 von Straubing-Bajuwarenstraße fanden sich neben einer ovalen Gürtelschnalle aus Ei-sen und einem Kamm zwei transluzide Überfangper-len mit Goldgrund, je drei rotbraune bzw. gelbe sowie eine blaue Glasperle, ferner zwei Bernsteinperlen. Die Perlen waren um den Halsbereich angeordnet, sodass sie entweder als Kette getragen wurden oder auf einem
64 Pohl 2004, 26–29. 65 Bitel 2002, 53; Wolfram 2005, 238.66 Wolfram 1990, 385 Anm. 8; 394 f. Anm. 55.67 Wolfram 2005, 238.68 Halsall 2005, 35.69 McLaughlin 1990, 197.70 McLaughlin 1990, 197; Sawyer 1989, 861.71 Halsall 2003, 34.72 Hofmann 2009, 141; 151.73 Zeller 2000, 114; Paulsen 1967 Taf. 88.74 Steuer 2008, 361; Schneider 2008, 9. 13 f.; Brather 2009, 261;
Schneider 2010.75 Das jüngste und sicherlich schönste Beispiel ist im US- ame-
rikanischen Film „300 – Rise of an Empire“ die auf einem historischen Vorbild beruhende Figur der Artemisia, die die persische Flotte in den Kampf gegen Themistokles führt, ver-körpert von dem „Bond-Girl“ Eva Green.
76 Haberstroh 2013, 365.77 Wolf 2013, 55. Frdl. Hinweis Prof. Dr. J. Wahl vom 11.3.2014.
Publikation in Fundber. Baden-Württemberg 34 vorgesehen.78 Gutsmiedel-Schümann 2010, 86; Hakenbeck/Geisler/Gruppe/
O’Connell 2012, 261 Tab. 2.79 Gärtner 2012; Ders. 2013.80 Die aufwändigen DNA-Analysen wurden freundlicherweise
von den „Freunden der bayerischen Vor- und Frühgeschich-te“ und der Archäologischen Staatssammlung München fi-nanziert.
81 Geisler 1998, 178 f.; Taf. 178,490.82 Geisler 1998, 129; Taf. 121,388.83 Gutsmiedl-Schümann 2010, 86. 350 mit Taf. 154,C.84 Schabel 1992, 93. 99 mit Taf. 14,121 u. 19,160.85 Codreanu-Windauer 1997, 160 mit Taf. 6,62.86 von Freeden/Lehmann 2005, 192.87 Arnold 1992, 225 f. 253 mit Taf. 28,138; 40,172.
BVBl_ 79_2014.indd 225 03.11.2014 10:44:18
226
Tabelle 1. Gräberfeld und Grabnummer mit anthropologischer Erstbefundung sowie Ausstattung, die zur archäologischen Geschlechtsbestimmung geführt hat.
textilen Kleidungsstück aufgestickt waren. Das Skelett weist klar männliche Merkmale auf88. Grab 717 aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts war deutlich reicher ausgestattet und enthielt eine Vierfibelkleidung aus zwei Bügel- und zwei S-Fibeln, 31 Perlen im Hals- und Oberkörperbereich, einen Kamm, ein Gehänge und eine römische Münze. Als dritte Kleinfibel wurde eine S-Fibel am linken Knie gefunden, wo sie wohl zusam-men mit verschiedenen Kleinfunden in einer Tasche niedergelegt worden war. Die Bestimmung des Skeletts als männlich war hier offenbar weniger eindeutig als bei Grab 2689. Als weitere potentielle Männerbestattung mit typisch weiblichen Schmuckbeigaben gilt Grab 249 aus Künzing-Bruck. Es war wie die meisten Gräber der Nekropole stark gestört. Von den Beigaben haben sich eine Bronzenadel, 13 Glas- und zwei Bernsteinper-len sowie als Bestandteile eines Gehänges eine Eisen-schnalle, mehrere Eisenteile und zwei bronzene Niet-knöpfe erhalten90. In der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts wurde Sindelsdorf Grab 232 angelegt, in dem ein Mann
mit einigen Glasperlen und einer Nadel am Kopf ausge-stattet worden war91. Schließlich wurde noch Grab 490 aus Aubing in die Untersuchung einbezogen. Hier sollte möglicherweise ein männliches Skelett vorliegen, wäh-rend die Beigaben, insbesondere eine kleine Perlenket-te, auf eine Frau hinzudeuten schienen92. Neben diesen Bestattungen Erwachsener wurden auch zwei Gräber von subadulten Individuen untersucht. Grab 459 aus Straubing-Bajuwarenstraße enthielt die Bestattung ei-nes wohl 13 bis 14 Jahre alten Individuums, das über seine Perlenkette zunächst als weiblich anzusprechen ist. Neben einem Spinnwirtel fanden sich hier auch zwei Schälchen einer Feinwaage, deren Lage im Grab darauf schließen lässt, dass hier ein komplettes Ge-rät mit in das Grab gegeben wurde. Sie liegen im Ab-stand von 17 cm neben dem rechten Unterschenkel, womit sich eine vergleichsweise große Waage anneh-men lässt93. Üblicherweise finden sich Feinwaagen in durchschnittlich bis gut ausgestatten Männergräbern, teilweise wird diese Beigabe neben Bewaffnung und
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
Nr. Gräberfeld, Grab Geschlecht Alter Beigaben DatierungFrauen mit Waffen1 Straubing388 ♀ Frühmatur Schnalle am Becken, Franziska, 2. Hälfte 6. Jh. Tasche2 Straubing490 ♀ Frühadult 2AltfibelnimBauchbereich, Spatha, Um 600 Sax, Lanze3 Aschheim9 ♀ Früh-mitteladult Lanze,Pfeilspitzen,Tasche Ende6.–Beginn7.Jh.4 Pliening62 ♀ Adult VielteiligeGürtelgarnitur,Sax 2.Viertel7.Jh.5 Weiding121 ♀ Adult Sax,Messer 6.–Mitte7.Jh.6 Weiding160 ♀ Adult Sax,Beinbekleidung,Tasche Um700Männer mit Frauenaustattungen7 Straubing26 ♂ Matur PerlenamSchädel, Kamm im 1. Hälfte 6. Jh Beckenbereich, Schnalle am Becken8 Aubing490 ♂ Adult Perlen,Fibel, Bronzearmring, 2. Hälfte 7. Jh. Eisenschnalle in Kniegegend9 Künzing249 ♂ Frühadult Perlen,Bronzenadel,Gehänge Um580–63010 Straubing717 ♂ Frühadult Bügelfibeln,S-Fibeln, Ring, Bronzenadel, 2. Drittel 6. Jh. kleines Messer, Schuhschnallen, Perlen, Kamm, Tongefäß 11 Sindelsdorf 232 Perlen, eine Nadel 2. Hälfte 7. Jh.Mischinventare12 Straubing 295 - Infans I Perlen an Kopf und Hals, Kamm?, 2. Hälfte 6. Jh. dreiteilige Gürtelgarnitur, Sax, Pfeilspitzen13 Straubing 459 - Juvenil Perlen am Hals, Spinnwirtel, Anfang 7. Jh. Waage, Schnalle am BeckenFrauengräber mit Pfeilspitzen14 Peigen232 ♀ Frühadult 2PfeilspitzenamOberkörper Ende5.–7.Jh.15 Steinhöring138 ♀ Adult Perlen;PfeilspitzeamBecken 2.–3.Vierteldes7.Jh.16 Steinhöring172 ♀ PfeilspitzezwischenOberschenkeln Mitte7.Jh.
BVBl_ 79_2014.indd 226 03.11.2014 10:44:18
227
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
Reitzubehör zu den typischen Elementen männlicher Grabausstattungen gezählt, daneben sind jedoch auch in seltenen Fällen Frauen zu finden94. In Straubing wur-den dem Mädchen jedoch keine „Schminkschälchen“, wie gern unterstellt wird95, sondern ein vielleicht sogar noch funktionsfähiges, zumindest aber wohl vollstän-diges Gerät mitgegeben, das lediglich schlecht erhalten ist. Verwendung fanden diese Feinwaagen beim Abwie-gen von Münzen, eine Notwendigkeit, die sich aus dem Umlauf vieler unterschiedlicher Gepräge im Norden und Osten des Merowingerreiches im 6./7. Jahrhundert oder bei der Edelmetallverarbeitung ergab. In Grab 295 aus Straubing-Bajuwarenstraße lag ein etwa dreiein-halb Jahre altes Kind, das typisch männliche Beigaben bei sich hatte: eine dreiteilige Gürtelgarnitur, einen kleinen Sax bzw. ein großes Messer und zwei Pfeilspit-zen. Dazu fanden sich im Kopfbereich sieben Glasper-len und eine weitere Perle an der rechten Schulter. Es sollte geprüft werden, ob hier ein weiteres Beispiel für die Beisetzung eines Jungen mit Perlenkette vorliegt96. Für die Untersuchungsreihe ausgewählt wurden dem-nach neun in der ersten anthropologischen Befundung als erwachsen und weiblich angesprochene Bestattun-gen mit Waffenbeigabe, darunter drei, bei denen die Waffen lediglich Pfeilspitzen umfassten. Diesen ge-genübergestellt werden konnten fünf als „männlich“ befundete Bestattungen Erwachsener, die Beigaben aus der weiblichen „Sphäre“ beinhalteten. Ergänzt wurde die Reihe um zwei Gräber subadulter Individuen, die Beigaben sowohl aus der männlichen wie aus der weib-lichen „Sphäre“ enthielten (Tabelle 1).
Anthropologie
Morphologische Geschlechtsdiagnose
Die Geschlechtsbestimmung ist eine der wichtigsten Diagnosen im Rahmen der morphologischen Untersu-chung, da einige weitere analytische Methoden und Untersuchungen direkt von ihrem Ergebnis abhängen. So werden beispielsweise Körperhöhe und Sterbealter getrennt nach Geschlecht bestimmt. Eine Bestimmung des Geschlechts anhand von Skelettmerkmalen ist möglich, da der Mensch einen Geschlechtsdimorphis-mus aufweist. Generell können schon bei der ersten Sichtung der Skelette Tendenzen hinsichtlich männli-cher und weiblicher Ausprägungen entdeckt werden. Männliche Skelette sind aufgrund eines höheren Mus-kelquerschnittes oft robuster in ihrem Knochenbau und unterscheiden sich auch in ihrer Größe bzw. der Länge der Langknochen von weiblichen Individuen97. Jedoch sollte man sich erst einen Überblick über die Skelettserie verschaffen, da Robustizität wie auch Kör-pergrößenverhältnisse und Merkmalsausprägungen zwischen männlichen und weiblichen Personen und von Population zu Population variieren können. Des
Weiteren hängt eine zuverlässige Geschlechtsbestim-mung an Skelettmaterial vor allem vom Erhaltungs-zustand und Überlieferungsgrad ab, denn je mehr Merkmale für eine Bestimmung herangezogen werden können, umso höher ist die letztendliche Sicherheit. Ebenfalls ein wichtiges Kriterium ist sicherlich die Er-fahrung und Sachkenntnis des Bearbeiters, denn die Ausprägungsformen des menschlichen Skelettes un-terliegen einer sehr hohen Variabilität. Das Geschlecht wird anhand verschiedener Merkmale mit unterschied-licher Gewichtung bestimmt. Vor allem das Becken stellt aufgrund der biologischen Funktion einen Ge-schlechtsindikator mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 95 % dar. Die Merkmale des Schädels sind mit einer Zuverlässigkeit von 85–90 % beschrieben. Robus-tizität, die Bewertung von Muskelmarken und die all-gemeine Größe der Knochen können zu einer Bestim-mung des Geschlechts mit einer Richtigkeit von 80–90 % beitragen98. Eine besondere Schwierigkeit stellt die Geschlechtsbestimmung bei nicht erwachsenen Indivi-duen, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern dar. Bei ihnen sind die späteren geschlechtsdifferenzie-renden Becken- und Schädelmerkmale noch nicht so deutlich ausgeprägt, da sich diese meist erst während der Pubertät ausbilden und entwickeln99. Da in der vorliegenden Arbeit die Frage nach dem Geschlecht eines Individuums im Vordergrund stand, wurde das standardisierte Methodenspektrum um metrische und nicht-metrische Merkmale ergänzt. Am Schädel wurden insgesamt dreizehn nicht-metri-sche und vier metrische, am Becken insgesamt neun nicht-metrische und drei metrische Charakteristika begutachtet. Tabelle 2 zeigt die Merkmale und die da-zugehörigen Literatur, welche für die Geschlechtsdia-gnose zusammengestellt wurde. Bei den verwendeten nicht-metrischen Merkmalen spielt die Ausprägung des Merkmals und die Sachkenntnis des Bearbeiters eine wichtige Rolle, damit die Bewertung mit einer zuver-lässigen Sicherheit durchgeführt werden kann100. Bei den verwendeten metrischen Merkmalen ist die Sicher-heit einer Geschlechtszuweisung umso höher, je mehr Messstrecken erhoben werden können. Bei der Methode der Messung des Abdrucks des Meatus acusticus inter-nus können laut Literatur zwei Drittel aller Individuen dem korrekten Geschlecht zugeordnet werden101. In der
88 Geisler 1998, 6 f. mit Taf. 5,26.89 Geisler 1998, 262 f. mit Taf. 258 f.90 Hannibal-Deraniyagala 2007, 198 mit Taf. 104,A.91 Menke/Menke 2013 Taf. 44.92 Dannheimer 1998, 45. 140 mit Taf. 50,I.93 Werner 1954, 10.94 Halsall 2010, 349; Losert 2003, 390.95 Losert/Pleterski 2003, 390.96 Lohrke 2004, 88.97 Grupe u. a. 2005, 93.98 Brown/Brown 2011, 156.99 Herrmann u. a. 1990, 87.100 Grupe u. a. 2005, 94.101 Graw u. a. 2005.
BVBl_ 79_2014.indd 227 03.11.2014 10:44:18
228
Schädel LiteraturAngulus mandibulae Ferembach u. a. 1978Arcus superciliaris Ferembach u. a. 1978Crista supramastoidea Rösing u. a. 2005Glabella Ferembach u. a. 1978Margo supraorbitalis Rösing u. a. 2005Meatus acusticus internus Graw u. a. 2005Mentum Ferembach u. a. 1978Orbitaform Ferembach u. a. 1978Os zygomaticum: Maße Ferembach u. a. 1978Pars petrosum Wahl u. a. 2001Planum nuchale Ferembach u. a. 1978Protuberantia occipitalis externa Ferembach u. a. 1978Processus mastoideus: Maße Ferembach u. a. 1978Stirnform Rösing u. a. 2005Tubera frontalia Ferembach u. a. 1978Zahnmaße Rösing 1983, Beyer-Olsen 1995Becken Angulus pubis Ferembach u. a. 1978Arc composé Ferembach u. a. 1978DSP Murail u. a. 2005Femurkopfdurchmesser Ferembach u. a. 1978Foramen obturatum Ferembach u. a. 1978Incisura ischiadica major Ferembach u. a. 1978Index: Pubislänge ×100/Ischiumhöhe Novotný 1972Linea arcuata Sodeikat 1982Präauricularfläche: Bruzek 2002 Abgrenzung Tiefe der Grube Tuberkel Ramuskamm am Os ischium: Bruzek 2002 Achsenverlauf Phallus Robustizität Subpubische Konkavität Steckel u. a. 2005Sulcus präauricularis: Maße Ferembach u. a. 1978Ventraler Bogen Steckel u. a. 2005
Tabelle 2. Verwendete Merkmale für die morphologische Geschlechtsdiagose.
ausgesuchten Messstrecken des Beckens. Diese wurden aus unterschiedlichen Serien weltweit zusammenge-tragen und spiegeln die Variabilität der Hüftknochen wider. Ein Computerprogramm wurde entwickelt, wel-ches aus den festgestellten Messwerten die Wahrschein-lichkeit für ein Geschlecht berechnet. Dabei kann eine Genauigkeit von fast 100 % erreicht werden104. Für eine Berechnung reichen vier Messdaten aus. Obwohl damit die Genauigkeit der Analyse nachlässt, können so je-doch auch beschädigte Becken untersucht werden. Da die Becken der untersuchten Individuen in dieser Ar-beit kaum erhalten waren, konnte diese Methode nur zweimal angewandt werden.
Genetische Geschlechtsdiagnose
Zusätzlich zur morphologischen Geschlechtsbestim-mung besteht heutzutage dank moderner genetischer Methoden auch die Möglichkeit, DNA aus archäologi-schem Knochenmaterial zu untersuchen und damit das Geschlecht von Verstorbenen zu bestimmen. Aller-dings liegt, aufgrund der nach dem Tod einsetzenden Autolyse, die konservierte DNA in Skelettfunden in hoch degradierten Zuständen vor. Dies führt zu eini-gen Problemen und Herausforderungen bei der Arbeit mit alter DNA. Degradationsprozesse können verschie-dene Veränderungen im DNA-Strang verursachen105 und diese Produkte können dann beispielsweise zu einer Blockierung der DNA Polymerase während der Replikation und so zu einem Misserfolg der Amplifika-tionsreaktion (PCR) führen. Weiterhin kann beispiels-weise die Desaminierung von DNA-Basen während der Diagenese zur Bildung und zum Einbau von falschen Basen während der PCR und somit zu Fehlern in der erhaltenen DNA-Sequenz führen. Somit können Dia-geneseprodukte und Inhibitoren dazu führen, dass Ergebnisse verfälscht, unvollständig oder überhaupt nicht erhalten werden. Die Arbeit mit alter DNA stellt auch technische Herausforderungen dar. Wie bereits erwähnt, liegt die DNA in Skelettmaterial sehr fragmentiert vor, sodass sich nur kurze Abschnitte von wenigen hundert Basen-paaren extrahieren lassen. Um diese kleine Menge an Ausgangsmaterial detektieren zu können, müssen die Nachweistechniken sehr fein sein. Dabei kann die hohe Sensitivität der Verfahren zu einem anderen Problem führen, der Kontamination durch rezente DNA. Da nur wenige Kopien der alten DNA in einer Probe vorliegen, können schon geringe Mengen an moderner DNA zu Überlagerungen und zur favorisierten Vervielfältigung führen. Um dies bestmöglich zu vermeiden, müssen für die Analyse von alter DNA gewisse Standards ein-gehalten werden. Dazu gehört das Tragen von speziel-ler Schutzkleidung während der Probenentnahme, wie Mundschutz, Haarnetz, Schutzanzug, Handschuhen und der Verwendung von dekontaminierten Werkzeu-gen. Des Weiteren wird eine strenge räumliche Ab-grenzung von prä- und post-PCR-Bereichen eingehalten
Praxis wurde festgestellt, dass nur Personen, die in das eine oder andere Extrem fallen, zuverlässig zugeordnet werden können, da es bei den Messungen einen breiten Graubereich gibt102. Auch die Methode der Pars petrosa-Messung ergibt laut den Autoren in zwei Drittel der Fäl-le eine korrekte Zuordnung103. Hier existiert ebenfalls ein großer Graubereich, sodass eine Geschlechtszuwei-sung in einigen Fällen nicht gelingt. Die Methode der DSP (diagnose sexuelle probabiliste) basiert auf zehn
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 228 03.11.2014 10:44:18
229
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
und die Bearbeitung findet in speziellen Laboren mit Schutzkleidung statt, in denen ausschließlich mit alten Proben hantiert wird. Ferner werden die Ergebnisse durch mehrere Wiederholungen und verschiedene Ana-lysen zum Ausschluss einer Kontamination verifiziert. Der Zerfalls- und Verwesungsprozess von Knochen nach dem Tode ist sehr komplex. Nicht nur Bakterien und Pilze, sondern auch durch Wasser ausgelöste und gesteuerte chemische Reaktionen tragen zur Zerset-zung des Knochenmaterials bei106. Sind Knochen bereits ergraben und nicht mehr durch den Boden und das Liegemilieu geschützt, ergeben sich im Bezug auf DNA-Analysen weitere Schwierigkeiten. Während der Lage-rung verfallen die Biomoleküle innerhalb des Knochens immer mehr, und die Gefahr einer Kontamination mit rezenter DNA durch die Bearbeiter steigt enorm. Zahn-schmelz hingegen degradieren sehr viel langsamer, und weisen eine härtere Struktur auf als Knochen107. Aufgrund dieser Eigenschaften stellen Zähne ein bevor-zugtes Material bei der DNA-Analyse von alten Proben dar. Dabei spielt nicht nur ihr in der Regel besserer Er-haltungszustand eine Rolle. Die Oberfläche kann auch leichter als bei porösem Knochen gereinigt und von kontaminierender moderner DNA befreit werden108. Zur molekulargenetischen Geschlechtsbestimmung wurde in dieser Arbeit eine neue Methode, basierend auf Alon-so & Martín109 für alte DNA-Proben etabliert. Hierfür wurde die Real-Time-PCR-Technik unter Verwendung Fluoreszenz-markierter Sonden angewandt. Die Sonden sind sequenzspezifisch für das Amelogenin-Gen, wel-ches in die Anlagerung von Zahnschmelz während der Zahnentwicklung involviert ist. Das Amelogenin-Gen auf dem X-Chromosom enthält eine Basenpaardeletion und das Produkt ist 106 Basenpaare (bp) lang, während das Produkt des Y-Chromosoms 112 bp aufweist. Durch eine unterschiedliche Fluoreszenzmarkierung der bei-den Sonden können X- und Y-spezifische Amplicons pa-rallel detektiert werden. Die Sonden besitzen einen so-genannten „Quencher“ welcher das Fluoreszenzsignal unterdrückt. Durch den Einbau der komplementären
Basen während der Replikation wird dieser „Quencher“ abgespalten und so sorgt dieses sog. TaqMan®-System dafür, dass die Sonden erst ein Fluoreszenzsignal aus-senden, wenn die Polymerase tatsächlich die korrekte Sequenz amplifiziert hat (Abb. 5). Ein Problem bei der Verwendung von Amelogenin als Geschlechtsindikator ist das Phänomen des alleli-schen „Dropouts“. Dies tritt auf, wenn eines der PCR-Produkte, meist das längere Fragment, in ungenügen-den Mengen synthetisiert wird110. Somit kann nur ein männliches Individuum als sicher eingestuft werden. Sind die Produkte der X- und Y-spezifischen Sequenz vorhanden oder wird nur das Y-Fragment amplifiziert und das X-Fragment unterliegt einem allelischen „Drop-out“, ist das Individuum immer noch als männlich zu erkennen. Anders gestaltet es sich wenn die Y-Sequenz nicht amplifiziert wird. Es kann sich um ein weibliches oder ein männliches Individuum mit einem allelischen „Dropout“ handeln. Um solche Vorfälle weitestgehend auszuschließen, wurden unabhängige PCRs und mehr-malige Wiederholungen durchgeführt. Die in dieser Ar-beit neu etablierte Real-Time PCR bietet weiterhin den Vorteil der gleichzeitigen Quantifizierung der vorhan-denen DNA. So sollen allelische „Dropouts“ gegebenen-falls durch einen nachgewiesenermaßen hohen DNA-Gehalt nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. In we-nigen Fällen kann das Amelogenin-Gen komplett vom Y-Chromosom deletiert sein, trotzdem handelt es sich hierbei um männliche Individuen, da Amelogenin kei-ne Rolle in der physiologischen Geschlechtsausprägung spielt. Auch wird mit einer DNA-Analyse der Genotyp eines Individuums bestimmt, dieser muss nicht in je-dem Falle mit dem Phänotyp übereinstimmen111. Die Bearbeitung der alten DNA-Proben fand im Reinstlabor des Archaeobiocenters der LMU München statt112. Die Vorbereitung der Proben wurde wie bei Seifert u. a.113
beschrieben in einem extra hierfür vorgesehenen Raum dieses DNA-Labors durchgeführt. Die Extraktion wurde nach einem von Wiechmann & Grupe114 modifizierten Protokoll von Yang115 u. a. 1998 durchgeführt. Die PCRs wurden in einem gesonderten Raum des Reinstlabors angesetzt, die Standards für die Bestimmung der Men-ge an Amelogenin-Genkopien in den Knochenproben (9947 A [weibliche DNA]: 10 ng/2 µl, 1 ng/2 µl, 0,25 ng/2µl, 0,0625 ng/2 µl, 0,015625 ng/2 µl; 2800 M [männliche
Abb. 5. Real-Time-PCR-Technik unter Verwendung Fluoreszenz-markierter Sonden. 1 Sequenzspezifische Anlagerung der Sonden und PCR Primer; 2 Primer Extension und Sondenhydrolyse; 3 PCR-Produkt wird vollständig synthetisiert und der Farbstoff getrennt; 4 In Abhängigkeit von der Zahl freigesetzter Reporter-moleküle wächst das Reportersignal (verändert nach: Schild 1996).
102 Graw u. a. 2005.103 Wahl/Graw 2001.104 Murail u. a. 2005.105 Brown/Brown 2011, 118 ff.106 Brown/Brown 2011, 94 ff.107 Grupe u. a. 2005, 73.108 Brown/Brown 2011, 101.109 Alonso/Martín 2005.110 Brown/Brown 2011, 159.111 Brown/Brown 2011, 161.112 Wiechmann u. a. 2012.113 Seifert u. a. 2013.114 Wiechmann/Grupe 2005.115 Yang u. a. 1998.
BVBl_ 79_2014.indd 229 03.11.2014 10:44:18
230
Tabelle 3. Verwendete Primer und TaqMan®-Sonden.
Forward Primer (AMGA) CCC TGG GCT CTG TAA AGA ATA GTGReverse Primer (AMGB) ATC AGA GCT TAA ACT GGG AAG CTGAmelX-Sonde 6FAM-TAT CCC AGA TGT TTCTC-MGBAmelY-Sonde VIC-CAT CCC AAA TAA AGT G-MGB
Schritt Temperatur Zeit Wiederholungen UNG-Inkubation 37°C 10 min UNG-Stop, initiale Denaturierung 95°C 10 min Denaturierung 95°C 15 s Annealing 58°C 40 s 50 Elongation 60°C 20 s
Tabelle 4. Angepasste und etablierte RT-PCR Bedingungen, nach Alonso u. a. 2003.
Reagenz Endkonzentration Mastermix 1×BSA 5 µg/µl BSA 50 ng/µl 0,25 µl10× TaqMan Puffer 1× TaqMan Puffer 2,5 µlMgCl2 25 mM MgCl2 3 mM 3 µl dNTP 10 mM (dUTP 20 mM) dNTP 200 µM (dUTP 400 µM) 0,5 µl AmpliTaq (5 U/µl) AmpliTaq 0,05 U/µl 0,25 µlAMG A 10 µM AMG A 300 nM 0,75 µlAMG B 10 µM AMG B 300 nM 0,75 µlAmelX 10 µM AmelX 300 nM 0,75 µlAmelY 10 µM AmelY 300 nM 0,75 µlUNG 0,8 U 0,2 µlWasser 12,3 µlGesamt 22 µlTemplate 3 µlTotal 25 µl
Tabelle 5. Etabliertes Protokoll, verändert nach Alonso/Martín 2005. Ansatz 25 µl
DNA]: 2,5 ng/2 µl, 0,25 ng/2 µl.) wurden in einem extra Raum des Biozentrums der LMU in die entsprechenden Ansätze pipettiert. Tabelle 3 zeigt die Sequenzen der ver-wendeten Primer und der TaqMan®-Sonden. Die verwen-deten PCR-Bedingungen sind in Tabelle 4 zusammenge-fasst und das etablierte Protokoll ist Tabelle 5 zu entneh-men. Die erhaltenen Graphen und Werte wurden mit dem Programm CFX Manager 3.0 (BioRad) ausgewertet. Zusätzlich wurden STR-Profile ermittelt, um Kontami-nationen auszuschließen bzw. zu entdecken. Short tan-dem repeats (STRs) sind tandemrepetitive Sequenzen die durchgehend im humanen Genom zu finden sind. Sie variieren in ihrer Länge durch Insertionen, Deleti-onen oder Mutationen, besitzen jedoch eine wiederholt auftretende DNA-Kernsequenz. Die Anzahl an Wieder-holungen dieser Basenpaareinheiten variiert sehr stark zwischen Individuen, sodass spezifische Marker für un-terschiedliche STRs zur molekulargenetischen Identifi-kation und der Erstellung von genetischen Profilen ein-gesetzt werden können116. Zeigen zwei der untersuchten Individuen das gleiche genetische Profil, so ist von einer Kontamination durch den Bearbeiter auszugehen. Auch
Mischprofile deuten auf Kontaminationen mit rezenter DNA hin. Für die Amplifikation wurde das AmpFlSTR® MiniFiler™ PCR Amplification Kit von Applied Biosys-tems verwendet. Der Einsatz von fünf unterschiedli-chen Fluoreszenzfarbstoffen erlaubt hier die simultane Amplifikation und Separation von acht STR Loci und des Geschlechtsmarkers Amelogenin. Die Amplifikation und anschließende Aufbereitung zur Messung erfolg-te nach Angaben des Herstellerprotokolls. Die kapillar-elektrophoretische Auftrennung erfolgte durch einen ABI 3730 Kapillarsequenzierer mit 50 cm Kapillarlänge (Applied Biosystems®) und wurde vom Sequenzierungs-service der Genomics Service Unit des Biozentrums der LMU München vorgenommen. Die Analyse der Y-STRs erfolgte mit dem AmpFlSTR® Yfiler™ PCR Amplification Kit von Applied Biosystems und wurde nur mit Proben durchgeführt, die im TaqMan®-Ansatz ein Y-Signal zeig-ten. Mit diesem Kit, unter Verwendung verschiedener Fluoreszenzfarbstoffe, ist es möglich 17 STR-Loci zu am-plifizieren. Durch die Generierung dieses genetischen Profils können Verunreinigungen des Y-Chromosoms ermittelt werden. Auch hier sollten keine zwei Indivi-
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 230 03.11.2014 10:44:18
231
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
duen das gleiche Profil aufweisen, da es sich sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Kontamination han-delt. Des Weiteren können auch hier Mischprofile vor-handen sein. Gegebenenfalls können Kontaminationen einem Bearbeiter zugeordnet werden. Die Amplifikati-on erfolgte nach Angaben des Herstellerprotokolls.
Ergebnisse der morphologischen Geschlechtsdiagnose
Da sich die Skelette teilweise in einem schlechten Er-haltungszustand und Überlieferungsgrad befanden, ge-staltete sich die Geschlechtsbestimmung in einigen Fäl-len schwierig. Bei sieben Befunden (Aubing 490, Asch-heim 9, Künzing 249, Peigen 232, Pliening 62, Straubing 295 und Weiding 121) waren nur wenige Merkmale und Merkmalsausprägungen vorhanden, sodass in diesen Fällen auch die weniger aussagekräftigen Erkennungs-marken wie die allgemeine Größe und Robustizität der Knochen sowie die Ausprägung der Muskelansatzstel-len in die Bewertung mit einbezogen wurden. Im Allge-meinen gilt: Je mehr Merkmale betrachtet werden kön-nen, umso sicherer wird die Geschlechtsbestimmung. Der Methodenkanon wurde für diese Untersuchung um zusätzliche geschlechtsspezifische Merkmale erweitert, welche die Zuverlässigkeit und Tendenz der Bestim-mung verstärkten. Die metrischen Merkmale konnten aufgrund der teilweise schlechten Erhaltungsbedingun-gen nicht oft eingesetzt werden und erbrachten auch nur selten ein Ergebnis. Die Messung des Beckens mit Hilfe der DSP (di-agnose sexuelle probabiliste) konnte aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes nur bei zwei Indivi-duen angewandt werden, erbrachte dann jedoch eine statistische Wahrscheinlichkeit der Geschlechtszu-weisung von >98 %. Die Messung des Innenohrs (Mea-tus acusticus internus und der Pars petrosa) konnte öfter eingesetzt werden, jedoch ergaben sich aufgrund der breiten Graubereiche meist nur Tendenzen oder gar kei-ne Zuweisung des Geschlechts. Auch die tendenziellen Ergebnisse können als zusätzliches Merkmal und zur weiteren Bestätigung hilfreich sein, lassen jedoch als Einzelmarker keine Aussage zu. Nun scheint hier die Verwendbarkeit und Aussagefähigkeit der metrischen Analysen sehr gering, freilich ist hier jedoch mit nur 16 Individuen eine kleine Stichprobenzahl gegeben und lässt keine weitere Aussage über die Zuverlässigkeit me-trischer Daten zu. Schwierig zuzuordnen war Individu-um Straubing 295. Hierbei handelte es sich um ein etwa drei bis vier Jahre altes Kind. Wie bereits erwähnt, sind hier die geschlechtsspezifischen Merkmale noch nicht sehr ausgeprägt, da sich diese erst im Laufe der Puber-tät entwickeln. Das Becken sowie die metrische Analyse des Meatus acusticus internus beidseitig sprechen für ein weibliches Individuum. Das Geschlecht der zu untersu-chenden Individuen wurde aufgrund aller bewertba-ren Merkmale und dem Gesamteindruck des Skelettes
bestimmt. Nach der erneuten morphologischen Begut-achtung ergibt sich nur noch bei den drei Bestattungen Künzing 249, Sindelsdorf 232, Straubing 26 eine Diskre-panz zwischen der archäologischen und anthropologi-schen Geschlechtsbestimmung. Nun stellt sich allerdings auch die Frage, wie zwei anthropologische Befundungen zu solch unterschied-lichen Ergebnissen kommen konnten. Zunächst liegen die Befunde der ersten Begutachtung einige Jahre zu-rück und sind nicht nach dem aktuellen Stand der Li-teratur durchgeführt worden. So wurden beispielweise die metrischen Analysen in den letzten Jahren stark modifiziert117, ebenso wurden weitere Leitfäden und Empfehlungen für die morphologische Untersuchung veröffentlicht118. Weiterhin ist durchaus anzunehmen, dass in den voran gegangenen Arbeiten nicht allzu viele Merkmale und Ausprägungen untersucht wurden wie mit dem erweiterten Befundkatalog. Teilweise handelte es sich auch nur um Kurzbefunde, bei denen nicht alle Merkmale eingehend begutachtet wurden. Darüber hi-naus wurden bei der ersten Befundung ebenfalls Indivi-duen der 16 ausgesuchten Skelette als „eher männlich“ und „eher weiblich“ klassifiziert und keine konkrete Aussage getroffen. Somit handelte es sich dabei mehr um vage Tendenzen als um zweifelsfreie Bestimmun-gen. Es ergab sich jedoch auch das Problem, dass auf die detaillierten Befunde nicht zugegriffen werden konnte und die angewandten Methoden nicht nachvollzogen werden konnten. Gerade ältere anthropologische Studi-en sind kaum zugänglich und verlieren sich meist in un-publizierten archäologischen Katalogen oder Grabungs-berichten.
Ergebnisse der genetischen Geschlechtsdiagnose
Abbildung 6,1–3 zeigen exemplarisch die graphischen Auswertungen der Q-PCRs der Individuen, bei denen die archäologische und anthropologische Geschlechts-bestimmung nicht übereinstimmt. In Grün ist die Y-, in Blau die X-Sonde zu sehen. Sind Kurven beider Sonden vorhanden, so handelt es sich um ein männliches In-dividuum. Sind hingegen nur blaue Kurven zu sehen, so ist ein weibliches vorhanden. Bei den PCR-Läufen wurden Duplikate bzw. Triplikate angefertigt, weswe-gen mehrere Kurven in einem Graphen zu sehen sind. Der relativ späte Anstieg der Kurven ist eine Folge des geringen DNA-Gehalts der Proben. Normalerweise wür-de man bei allen Kurven einen exponentiellen Anstieg der Fluoreszenz erwarten. Ein flacherer Anstieg kann dabei ein Zeichen für die Anwesenheit von Inhibitoren in der Probe bzw. der Reaktion sein. Bei fünf Individu-en (Steinhöring 172, Straubing 388, 490 und 717, sowie
116 Butler/Hill 2012.117 Wahl/Graw 2001; Graw u. a. 2005.118 Steckel u. a. 2005; Rösing u. a. 2005.
BVBl_ 79_2014.indd 231 03.11.2014 10:44:18
232
Weiding 121) wurde kein Signal in der Auswertung der PCR erhalten, was dafür spricht, dass in diesen Proben vermutlich keine nukleäre DNA mehr vorhanden war. Bei einem Individuum aus Straubing (295) konnte kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden, auch die Quantifi-zierung ergab keine konkreten Werte, sodass auch hier von zu wenig konservierter DNA ausgegangen werden muss. Von allen Proben wurden zwei bis vier unabhän-gige PCRs durchgeführt und ausgewertet.
Neun der untersuchten Individuen zeigten eine sichere Quantifizierung der DNA-Menge. Die übrigen Proben zeigten Startquantitäten von teilweise kleiner 1. Dies dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass die Pro-ben durch die Anwesenheit von Inhibitoren in der Reak-tion verzögert sind und damit eine Unterschätzung der eigentlichen Startquantität vorliegt. Hierbei kann man eventuell von Tendenzen hinsichtlich der Geschlechts-zuweisung ausgehen, vor allem wenn ein Ergebnis in
Abb. 6. Real-Time Amplification (RT-PCR).
1 Individuum Künzing 249 (Messung 1.7.2013). Grün: VIC-Y-Sonde; Blau: FAM-X-Sonde; E (X): 93,2 %, R^2:0,949; E(Y): 97,4 %, R^2: 0,262.
2 Invidiuum Sindelsdorf 232 (Messung 1.7.2013). Grün: VIC-Y-Sonde; Blau: FAM-X-Sonde; E (X): 93,2 %, R^2:0,949; E(Y): 97,4 %, R^2: 0,262.
3 Individuum Straubing 26 (Messung 26.6.2013). Grün: VIC-Y-Sonde; Blau: FAM-X-Sonde; E (X): 246,8 %, R^2:0,450; E(Y): 95,9 %, R^2: 1,000
E: Effizienz der Vervielfältigung RFU: relative fluorescence units, relative Fluoreszenzeinheiten.
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 232 03.11.2014 10:44:20
233
unabhängigen PCRs wiederholt erzielt wird. Auch wenn die DNA-Analysen und die Morphologie zu einem über-einstimmenden Resultat kommen, scheint die Richtig-keit der PCR mit sehr geringen Startkopien gegeben. Zur Überprüfung von Kontaminationen wurden pro Probe zwei unabhängige PCR-Durchläufe und Fragmentlän-genanalysen angesetzt. Die Ergebnisse der beiden un-terschiedlichen Ansätze stimmen größtenteils überein. Alle untersuchten Proben zeigen individuelle STR-Pro-file. Auch bei den Y-STRs wurden pro Probe zwei unab-hängige PCR-Durchläufe und Fragmentlängenanalysen angesetzt. Die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Ansätze stimmen überein. Die Proben Pliening 62 sowie Weiding 160 weisen ein unterschiedliches STR-Profil für die autosomalen Marker, jedoch das gleiche Y-STR-Profil auf. Die Ursache für diese Diskrepanzen konnte hier nicht eindeutig geklärt werden. Es könnte sich um zwei männliche Individuen mit demselben Y-STR-Profil han-deln. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Profil durch rezente DNA eines Bearbeiters überlagert wurde, eine Kontamination durch einen Laborbearbeiter konnte je-doch ausgeschlossen werden. Die weiteren Proben zei-gen individuelle Y-STR-Profile. Insgesamt erzielten neun Individuen durch Zahn- und ein Individuum durch eine Knochenprobe ein reproduzierbares Ergebnis bei der Q-PCR. Die Ergebnisse sind auch für die sehr geringen Startquantitäten reproduzierbar und zeigen somit ihre Sicherheit hinsichtlich der Geschlechtsdiagnose. Gerade im Zusammenhang und im Vergleich mit der Morpholo-gie und den STR-Profilen ergab sich auch mit sehr klei-nen DNA-Mengen eine relativ zuverlässige Bestimmung. Jedoch zeigt sich hier, dass die Vorteile einer Q-PCR auch zu Schwierigkeiten in der Bearbeitung und Auswertung führen können. Diese Methode erlaubt Analysen mit sehr kleinen Mengen an Ausgangs-DNA, was freilich für das Arbeiten mit alten Proben aussichts-reich ist. Allerdings ist diese sensitive Technik gerade durch die niedrigen Starkopienzahlen und die meist fragmentierten DNA-Stücke sehr kontaminationsanfäl-lig119. Um diese ausschließen zu können wurden hier spezielle Dekontaminationsmaßnahmen ergriffen. So wurde bei der Q-PCR das Enzym UNG zugegeben. Dies hilft bei der Vermeidung von sog. „carryover“ Kontami-nationen aus vorherigen PCRs durch Aerosolübertra-gung120. Ferner erlaubt die Q-PCR eine Quantifizierung der anfänglichen Kopienanzahl, um eine höhere Glaub-würdigkeit der experimentellen Daten zu erlangen. Zu hohe Ausgangsmengen sprechen beispielsweise für eine Kontamination, zu niedrige erlauben Zweifel an der Au-thentizität der Probe121. Wie allerdings bereits erwähnt, gestaltete sich die Auswertung der Startquantität hier schwierig und eine Abstufung der Zuverlässigkeit der Ausgangsmenge im Bezug auf das Ergebnis wurde ein-geführt. So wurden Startkopienzahlen >1 und eine Berechnung der Quantifizierung aus mindestens zwei Ansätzen als authentisch eingestuft. Ein weiterer Vor-teil der Q-PCR ist das Erkennen von Inhibitoren im Ex-trakt. Aufgrund eines verzögerten Starts der Amplifi-kation und damit auch einem späten Anstieg der Amp-
lifikationskurve kann auf solche Ereignisse geschlossen werden122. Somit kann in den meisten der vorliegenden Fälle tendenziell mit einer Unterschätzung der tatsäch-lichen Kopienzahl gerechnet werden. Die erwähnten Stärken machen die Q-PCR zur Methode der Wahl bei der Arbeit mit alten DNA-Proben. Auch wenn sich eini-ge Schwierigkeiten und Herausforderungen mit dieser Analyse ergeben, so überzeugen die mit einer hohen Si-cherheit an Authentizität gewonnenen Daten. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass, obwohl einige Proben eine sehr niedrige Ausgangsmenge an DNA enthalten, trotzdem mit hoher Wahrscheinlich-keit von der Authentizität der erhaltenen Daten ausge-gangen werden kann, da einige wichtige Faktoren da-für sprechen. So wurden während der Bearbeitung der Proben die Standards der Kontaminationsvermeidung eingehalten. Als weitere Maßnahme wurde die Q-PCR unter Zugabe von UNG durchgeführt, um eine Konta-mination durch vorherige PCR-Produkte zu vermeiden. Die Extrakte der 16 Proben der zu untersuchenden In-dividuen wurden in drei unabhängigen Extraktions-runden erhalten, die zweite Extraktion einer Probe des gleichen Individuums war hier nicht erfolgreich. Die er-haltenen Ergebnisse der durchgeführten Q-PCR wurden in unabhängigen Ansätzen und PCRs überprüft und erzielten wiederholt dieselben Resultate. Des Weiteren wurden die Proben, welche Ergebnisse bei der Q-PCR erbrachten, mit dem MiniFilerTM Kit und dem YfilerTM
Kit (Applied Biosystems) auf Hinweise für mögliche Kon-taminationen überprüft. Da alle Proben ein individuel-les Profil bei der Analyse der STRs zeigten, unterstützt dies die Authentizität und Kontaminationsfreiheit aller Proben. Bei den Y-STRs zeigten zwei Proben das gleiche Profil, alle anderen untersuchten Extrakte lieferten in-dividuelle Profile und bestätigen somit erneut unkonta-minierte und authentische Ergebnisse. Auch die Übereinstimmung der morphologischen und molekulargenetischen Untersuchungen sprechen für glaubhafte Resultate. Nur in einem Fall stimmen die beiden Bestimmungen nicht überein: Das Indivi-duum Künzing 249, welches morphologisch als „eher männlich“ bestimmt wurde, ist laut DNA eine Frau. Auch wenn hier ein allelischer „Dropout“ des Y-Allels diskutiert werden kann, so sprechen die Reproduzier-barkeit der DNA-Analyse sowie die geschlechtsspezifi-sche Grabausstattung mit hoher Wahrscheinlichkeit für ein weibliches Individuum. Nach den molekularge-netischen Untersuchungen sind noch zwei Gräber, Sin-delsdorf 232 und Straubing 26, vorhanden, bei denen die archäologische und anthropologische Geschlechts-bestimmung voneinander abweichen. In den anderen neun Fällen, in denen die DNA-Untersuchung erfolg-reich war, werden die Ergebnisse der Morphologie
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
119 Pruvost/Geigl 2004.120 Pruvost u. a. 2005.121 Pruvost/Geigl 2004.122 Pruvost/Geigl 2004.
BVBl_ 79_2014.indd 233 03.11.2014 10:44:20
234
Abb. 7. Straubing-Bajuwarenstraße Grab 459. Grabplan und Grabausstattung. Befund M. 1:20, Funde M. 1:2.
Abb. 8. Sindelsdorf Grab 232. Grabplan und Grabausstattung. Befunde M. 1:20, Funde M. 1:2.
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 234 03.11.2014 10:44:20
235
bestätigt. So handelt es sich nun auch nach dem DNA-Beweis um zwei männliche Individuen mit einer weib-lichen Grabausstattung.
Ergebnisse
Die DNA-Analysen an bajuwarischem Skelettmaterial haben eindeutige Ergebnisse geliefert. Im Hinblick auf die Frage nach Waffenbeigaben in Frauengräbern, die auf eine Existenz von „Kriegerinnen“ im Frühmittel-alter schließen ließen, muss die Antwort negativ aus-fallen. Sofern die sterblichen Überreste der Toten eine Bestimmung zuließen, erwiesen sich alle „Frauen in Waffen“ als Männer, die den neuen morphologischen Untersuchungen zu Folge auch keinen überaus weib-lichen Körperbau besessen haben dürften. Es konnte keine Frau mit einer Waffenausstattung – außer Pfeil-spitzen in der Ein- oder Zweizahl – nachgewiesen wer-den. Die Bedeutung dieser Mitgabe von einzelnen Pfeil-spitzen in Frauengräbern bleibt spekulativ. Neben einer Kampfwaffe könnte es sich in einigen Fällen auch um eine Waffe für die Jagd gehandelt haben. Nach ethno-logischen Vergleichen beteiligen sich Frauen in Jäger-Sammler-Gesellschaften durchaus an der Jagd, verwen-den allerdings nur sehr selten die von den Männern benutzten Waffen123. Der Erkenntniswert derartiger Analogieschlüsse für die Verhältnisse in den frühmit-
telalterlichen Gesellschaften Europas bleibt aber frag-lich. Das häufige Vorkommen einzelner Pfeilspitzen in Kindergräbern, darunter auch nicht selten Kleinkinder unter zwei Jahren, wie es etwa auch bei Sachsen und Angelsachsen zu beobachten ist124, spricht vielmehr stark für eine symbolische Grabbeigabe, die von der bestatteten Person nicht selbst gebraucht worden sein kann bzw. muss. Auch bei männlichen Kindern und Jugendlichen wird die Beigabe einzelner Pfeile biswei-len mit ihrer nur eingeschränkten Waffenfähigkeit erklärt125. Ließen sich archäologisch bislang keine be-lastbaren Hinweise auf Kriegerinnen im Frühmittelal-ter finden, so bestätigten die DNA-Analysen hingegen den Verdacht, dass in Grab 459 aus Straubing-Bajuwa-renstraße ein juveniles Mädchen mit einer Feinwaage beigesetzt wurde (Abb. 7). Dieser Fund wirft ein interes-santes Schlaglicht auf ihre Rolle innerhalb der Familie bzw. der lokalen Gemeinschaft, die durch die Mitgabe des Geräts während des Bestattungsrituals repräsen-tiert werden sollte126. Zur abschließenden Bewertung des Befundes muss eine eingehende Analyse der Bele-gungsstrukturen des Gräberfeldes abgewartet werden,
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
Abb. 9. Straubing-Bajuwarenstraße Grab 26. Grabplan und Grabausstattung. Befunde M. 1:20, Funde M. 1:2.
123 Kästner 2011, 151 f.124 Hills/Lucy 2013, 311; Weber 2000, 50.125 Groove 2001, 230; Walter 2008, 66.126 Gärtner 2013, 263.
BVBl_ 79_2014.indd 235 03.11.2014 10:44:21
236
die vielleicht weiterführende Hinweise zum familiären Umfeld des Mädchens liefern kann. Überaus beachtenswert erscheint, dass nach dem von F. Immler angewandten umfassenden Kriterienka-talog zur Geschlechtsbestimmung am Skelett127 nach der erneuten, von ihr durchgeführten morphologischen Befundung nur noch drei Individuen aus der Versuchs-reihe übrig blieben, bei denen es in der Geschlechtsbe-stimmung zu einer Abweichung zwischen Archäologie und Anthropologie kam (Künzing Grab 249, Straubing Grab 26, Sindelsdorf Grab 232). In allen anderen Fäl-len hatte sich die auf archäologischem Weg ermittel-te Geschlechtsbestimmung als richtig erwiesen. Es er-scheint uns deshalb sehr wichtig, gegenüber älteren Ge-schlechtsansprachen von anthropologischer Seite aus eine große Vorsicht walten zu lassen v. a. wenn sie dem archäologischen Fundmaterial ganz deutlich wider-sprechen128. Die Ergebnisse der neuen morphologischen Befundung konnten schließlich durch die DNS-Analyse weitgehend bestätigt werden. Das in morphologischer Hinsicht eher männlich wirkende Skelett mit seiner komplett weiblich wirkenden Grabausstattung Künzing Grab 249, ist laut DNS als weiblich anzusprechen. Somit verblieben aus der Versuchsreihe lediglich zwei Gräber, bei denen sich die anthropologische und archäologische Geschlechtsansprache widersprachen, was nichts anderes bedeutet, dass in nahezu 90 % der Fälle die archäologische Geschlechtsansprache korrekt ist. Überraschenderweise handelte es sich dabei nicht um „Amazonen“, sondern um Männer mit Elemen-ten einer weiblich anmutenden Schmuckausstattung (Straubing Grab 26 Sindelsdorf Grab 232). Die Nadel in Sindelsdorf Grab 232, der ungestörten Bestattung eines 25–30 Jahre129 alten Mannes, ist aufgrund ihres Mate-rials und ihrer Form nicht als Gewandnadel, sondern eher als Werkzeug/Gerät anzusprechen (Abb. 8). Die Grablage lässt in beiden Fällen keine sichere Aussage darüber zu, wie die beiden Männer die Perlen trugen. In Sindelsdorf könnten die Perlen gemeinsam mit Kamm und Nadel in einer am Kopf deponierten Tasche gele-gen haben, ähnlich wie in dem oben bereits zitierten Grab von Schleitheim. In Straubing Grab 26 (Abb. 9), der Bestattung eines im maturen Alter verstorbenen Man-nes, der zu Lebzeiten durch eine Verletzung an der ti-bia körperlich beeinträchtigt war, lässt die Störung des Grabes keine sichere Aussage darüber zu, wie die Perlen getragen wurden, wobei man in zeitgleichen Frauen-gräbern zumeist von einem Gehängestrang oder einer Stickerei ausgehen darf130. Durch die Störung kann man auch nicht ausschließen, dass aus diesem Grab eine Waffe oder Bügelfibeln entwendet wurden. Mit Si-cherheit kann man aber ausschließen, dass in diesem Grab ein Gehänge vorhanden war, das in dieser Zeit fast regelhaft mit Bügelfibeln verbunden war und des-sen Bestandteile sich im ungestörten Bereich zwischen den Oberschenkeln und Knien hätten befinden müssen. Ob die im Halsbereich angetroffenen Glasperlen in den beiden Männergräbern von Straubing Grab 26 und Sin-delsdorf Grab 232 als ein Beleg für ein „cross-dressing“
gewertet werden können, muss aber letztendlich offen bleiben. Bedeuten sie, dass ein Mann eine Frauenklei-dung trug, oder lediglich, dass ihm bei der Bestattung vielleicht eine Kette oder ein perlenbestickter Gegen-stand beigegeben wurde?
Literaturabkürzungen (Archäologie)
Arnold 1992S. Arnold, Das bajuwarische Reihengräberfeld von Steinhöring, Landkreis Ebersberg. Charybdis 5 (Münster 1992).
Aspöck 2001E. Aspöck, Merowingerzeitliche Grabfunde aus Fischlham-Hafeld. Reste eines bairischen Reihengräberfeldes. Jahrb. OÖ. Musealver-ein 146, 2001, 235–266.
Bachran 1991W. Bachran, Zaumzeug am Gürtel. Zur sekundären Verwendung frühmittelalterlichen Pferdegeschirrs. In: Spurensuche. Festschr. f. H.-J. Kellner. Kat. Prähist. Staatsslg. Beih. 3 (Kallmünz 1991) 185–190.
Balzaretti 1998R. Balzaretti, „These are Things that Men do, not Women“: the Social Regulation of Female Violence in Langobard Italy. In: G. Halsall (Hrsg.), Violence and Society in the Early Medieval West (Woodbridge 1998) 175–192.
Bartel/Codreanu-Windauer 1995A.Bartel/S. Codreanu-Windauer, Spindel, Wirtel, Topf. Ein beson-derer Beigabenkomplex aus Pfakofen, Lkr. Regensburg. BVbl. 60, 1995, 252–272.
Beilharz 2011D. Beilharz, Das frühmerowingerzeitliche Gräberfeld von Horb-Altheim. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 121 (Stuttgart 2011).
Beyerle 1926K. Beyerle (Hrsg.), Lex Baiuvariorum. Lichtdruckwiedergabe der Ingolstädter Handschrift des bayerischen Volksrechts (München 1926).
Bitel 2002L. M. Bitel, Women in Early Medieval Europe, 400–1100 (Cam-bridge 2002).
Bodmer 1957J. P. Bodmer, Der Krieger der Merowingerzeit und seine Welt (Zü-rich 1957).
Brather 2004S. Brather, Ethnische Interpretation in der frühgeschichtlichen Archäologie (Berlin 2004).
Brather 2005S. Brather, Alter und Geschlecht zur Merowingerzeit. Soziale Strukturen und frühmittelalterliche Reihengräberfelder. In: J.
127 Immler 2013, 18 f.128 So wäre es interessant zu wissen, wie sich das Geschlecht des
angeblichen Mannes mit Fibelausstattung aus Oosterbein-tum (Friesland) Grab 398 nach den von Immler angewandten Kriterien darstellen würde. Knol/Prummel/Uytterschaut/Hoogland/Casparie/de Langen/Kramer/Schelvis 1995/96, 300 f. 398.
129 Bei der Erstbefundung wurde diesem Mann noch ein matu-res Sterbealter zugesprochen: Menke/Menke 2013, 66.
130 Haas-Gebhard 2013, 23 ff.
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 236 03.11.2014 10:44:21
237
Müller (Hrsg.), Alter und Geschlecht in ur- und frühgeschichtli-chen Gesellschaften. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 126 (Bonn 2005), 157–178.
Brather 2009S. Brather, Memoria und Repräsentation. Frühmittelalterliche Be-stattungen zwischen Erinnerung und Erwartung. In: S. Brather/D. Geuenich/Ch. Huth, Historia archaeologica. Festschr. Heiko Steuer zum 70. Geburtstag. Ergbd. RGA² 70 (Berlin 2009) 247–284.
Buchner 1970R. Buchner, Gregor von Tours, Zehn Bücher Geschichten, Bd. 2 (Darmstadt 41970).
Burzler/Höneisen/Leicht/Ruckstuhl 2002A. Burzler/M. Höneisen/J. Leicht/B. Ruckstuhl, Das frühmittelal-terliche Schleitheim – Siedlung, Gräberfeld und Kirche. Schaff-hauser Arch. 5 (Schaffhausen 2002).
Codreanu-Windauer 1997S. Codreanu-Windauer, Pliening im frühen Mittelalter. Materialh. Bayer. Vorgesch. A74 (Kallmünz/Opf. 1997).
Dannheimer 1962H. Dannheimer, Die germanischen Funde der späten Kaiserzeit und des frühen Mittelalters in Mittelfranken. Germ. Denkm. Völ-kerwanderungszeit Ser. A, Bd. VII (Berlin 1962).
Dannheimer 1987H. Dannheimer, Auf den Spuren der Bajuwaren (Pfaffenhofen 1987).
Dannheimer 1998H. Dannheimer, Das bajuwarische Reihengräberfeld von Aubing, Stadt München. Monogr. Archäolog. Staatsslg. München I (Stutt-gart 1998).
Effros 2011B. Effros, Skeletal sex and gender in Merovingian mortuary archa-eology. Antiquity 74, 2000, 632–639.
Fingerlin 1981G. Fingerlin, Eine Runeninschrift der Merowingerzeit aus dem Gräberfeld von Neudingen, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1981, 186–189.
Freeden/Lehmann 2005U. von Freeden/D. Lehmann, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Peigen, Gem. Pilsting. Schriftenr. Niederbayer. Archäologie-mus. Landau 2 (Landau a. d. Isar 2005).
Gärtner 2012T. Gärtner, Alter, Geschlecht und soziale Rolle – Untersuchungen zu den frühmittelalterliuchen Gräberfeldern von Straubing-Baju-warenstraße, Peigen und Künzing-Bruck. BVbl. 77, 2012, 151–172.
Gärtner 2013T. Gärtner, Zur Ausstattung frühmittelalterlicher Frauengräber im niederbayerischen Donauraum. In: K. Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 31. Niederbayerischen Archäologentages (Rahden/Westf. 2013) 243–284.
Geisler 1998H. Geisler, Das frühbairische Gräberfeld Straubing – Bajuwaren-strasse I. Internat. Arch. 30 (Rahden/Westf. 1998).
Goetz/Patzold/Welwei 2006H.-W. Goetz/S. Patzold/K.-W. Welwei, Die Germanen in der Völker-wanderung 1. Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 1b,1 (Darmstadt 2006).
Groove 2001A. M. Groove, Das alamannische Gräberfeld von Munzingen/Stadt Freiburg. Materialh. Arch. Baden-Württemberg 54 (Stuttgart 2001).
Gutsmiedl 2005D. Gutsmiedl, Die justinianische Pest nördlich der Alpen. Zum Doppelgrab 166/167 aus dem frühmittelalterlichen Reihengrä-
berfeld von Aschheim-Bajuwarenring. In: B. Päffgen/E. Pohl/M. Schmauder (Hrsg.), Cum grano salis. Festschr. V. Bierbrauer (Fried-berg 2005) 199–208.
Gutsmiedl-Schümann 2010D. Gutsmiedl-Schümann, Das frühmittelalterliche Gräberfeld Aschheim-Bajuwarenring. Materialh. Bayer. Vorgesch. A94 (Kall-münz/Opf. 2010).
Gutsmiedl-Schümann 2011D. Gutsmiedl-Schümann, Alters- und geschlechtsspezifische Zuwei-sung von Hand- und Hauswerk im frühen Mittelalter nach Aussage von Werkzeug und Gerät aus Gräbern der Münchener Schotter-ebene. In: J. E. Fries/U. Rambuscheck, Von wirtschaftlicher Macht und militärischer Stärke. Beiträge zur archäologischen Geschlech-terforschung. Frauen – Forschung – Archäologie 9 (Münster 2011).
Haas 1994B. Haas, Keramik und Keramikbeigabe. In: T. Springer (Hrsg.), Die ersten Franken in Franken: das Reihengräberfeld von Westheim. Ausstellungskat. German. Nationalmus. Nürnberg (Nürnberg 1994) 57–66.
Haas-Gebhard 1998B. Haas-Gebhard, Ein frühmittelalterliches Gräberfeld bei Ditten-heim (D). Europe médiévale 1 (Montagnac 1998).
Haas-Gebhard 2013B. Haas-Gebhard, Unterhaching. Eine Grabgruppe der Zeit um 500 n. Chr. bei München. Abhandl. u. Bestandskat. Arch. Staatsslg. München 1 (München 2013).
Haberstroh 2013J. Haberstroh, Radiokarbonanalysen in der Bodendenkmalpflege – Ultima ratio oder Rechtfertigungsinstrument. Ber. Bayer. Boden-denkmalpfl. 54, 2013, 365–379.
Härke 2011H. Härke, Gender Representation in Early Medieval Burials: Ri-tual Re-Affirmation of a Blurred Boundary? In: S. Brookes/S. Harrington/A. Reynolds (Hrsg.), Studies in Early Anglo-Saxon Art and Archaeology: Papers in Honour of Martin G. Welch. BAR Bri-tish Ser. 527 (Oxford 2011) 98–105.
Hakenbeck/Geisler/Gruppe/O’Connell 2012S. Hakenbeck/H. Geisler/G. Grupe/T. C. O’Connell, Ernährung und Mobilität im frühmittelalterlichen Bayern anhand einer Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope – Studien zu Mobilität und Exogamie. Arch. Korrbl. 42, 2012, 251–271.
Halsall 2003G. Halsall, Warfare and Society in the Barbarian West, 450–900 (London, New York 2003).
Halsall 2010G. Halsall, Cemetries and Society in Merovingian Gaul. Selected Studies in History and Archaeology, 1992–2009. Brill’s Series on the Early Middle Ages 18 (Leiden 2010).
Hannibal-Deraniyagala 2007A. S. Hannibal-Deraniyagala, Das bajuwarische Gräberfeld von Künzing-Bruck, Lkr. Deggendorf. Bonner Beitr. vor- u. frühgesch. Arch. 8 (Bonn 2007).
Hill/Lucy 2013C. Hill/S. Lucy, Spong Hill, Part IX: chronology and synthesis (Ox-ford 2013).
Hofmann 2009K. P. Hofmann, Grabbefunde zwischen sex und gender. In: U. Rambuscheck (Hrsg.), Zwischen Diskursanalyse und Isotopenfor-schung. Methoden der archäologischen Geschlechterforschung. Frauen – Forschung – Archäologie 8 (Münster 2009) 133–161.
Hundt 1974 H.-J. Hundt, Zu einigen frühgeschichtlichen Webgeräten. Arch. Korrbl. 4, 1974, 177–180.
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
BVBl_ 79_2014.indd 237 03.11.2014 10:44:21
238
Immler 2013F. Immler, Frühmittelalterliche Frauen in Waffen? Morphologi-sche und molekularbiologische Geschlechtsbestimmung in ar-chäologisch/anthropologisch divergierenden Fällen. Masterarbeit zur Erlangung des Grades Master of Science in Biologie. LMU Mün-chen (München 2013).
Joffroy 1974R. Joffroy, Le cimetière de Lavoye (Paris 1974).
Kästner 2011S. Kästner, „Hunting is hard work“. Tierische Beutebeschaffung australischer Aborigines-Frauen im Visier der Forschung. In: J. E. Fries/U. Rambuschek (Hrsg.), Von wirtschaftlicher Macht und militärischer Stärke. Beiträge zur archäologischen Geschlechter-forschung. Frauen – Forschung – Archäologie 9 (Münster 2011) 135–164.
Knaut 1987M. Knaut, Ein merowingerzeitliches Frauengrab mit Töpferstempel aus Bopfingen. Fundber. Baden-Württemberg 12, 1987, 463–478.
Knaut 1993M. Knaut, Die alamannischen Gräberfelder von Neresheim und Kösingen, Ostalbkreis. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 48 (Stuttgart 1993).
Knol u. a. 1995/96E. Knol/W. Prummel/H. T. Uytterschaut/M. L. P. Hoogland/W. A. Casparie/G. J. de Langen/E. Kramer/J. Schelvis, The Early Medie-val Cemetry of Oosterbeintum (Friesland). Palaeohistoria 37/38, 1995/96, 245–416.
Koch 1970R. Koch, Waffenförmige Anhänger aus merowingerzeitlichen Frauengräbern. Jahrb. RGZM 17, 1970, 285–293.
Koch 1996U. Koch, Die Hierarchie der Frauen in merowingischer Zeit. In: H. Brandt/J. Koch (Hrsg.), Königin, Klosterfrau, Bäuerin. Frauen im Frühmittelalter. Bericht zur dritten Tagung des Netzwerks Archäologisch Arbeitender Frauen, 19.–22. Oktober 1995 in Kiel. Frauen – Forschung – Archäologie 2 (Münster 1996) 29–54.
Koch 2001U. Koch, Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. Forsch. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 60 (Stuttgart 2001).
Lohrke 2004B. Lohrke, Kinder in der Merowingerzeit. Gräber von Mädchen und Jungen in der Alemannia. Freiburger Beitr. Archäologie und Gesch. 9 (Rahden/Westf. 2004).
Losert 2003H. Losert, Altenerding in Oberbayern. Struktur des frühmittelal-terlichen Gräberfeldes und „Ethnogenese“ der Bajuwaren (Berlin, Bamberg, Ljubljana 2003).
Lynn 1979H. E. Lynn, The Legal Status of Women in the „Leges Barbarorum“ (Ann Arbor 1979).
McLaughlin 1990M. McLaughlin, The woman warrior: gender, warfare and society in medieval Europe. Women’s Studies 17, 1990, 193–209.
Memminger u. a. 2003M. Memminger/M. Scholz/I. Stork/J. Wahl, Im Tode vereint. Eine außergewöhnliche Doppelbestattung und dir frühmittelalterli-che Topografie von Giengen a. d. Brenz – Hürben, Kr. Heidenheim. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 2003, 158–161.
Menke/Menke 2013H. und M. Menke, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Sindol-vesdorf/Sindelsdorf, Lkr. Weilheim-Schongau. Materialh. Bayer. Vorgesch. 99 (Kallmünz 2013).
Neuffer-Müller 1983Chr. Neuffer-Müller, der alamannische Adelsbestattungsplatz und die Reihengräberfelder von Kirchheim am Ries/Ostalbkreis. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 15 (Stutt-gart 1983).
Othenin-Girard u. a. 2005B. Othenin-Girard/M. Elyaqtyne/V. Friedli/C. Gerber/C. Gonda/V. Légeret/S. Saltel/L. Stadler, Friedhöfe von der Bronzezeit bis zum Frühmittelalter. Arch. Schweiz 28, 2005 (2), 45–55.
Paulsen 1967P. Paulsen, Alamannische Adelsgräber von Niederstotzingen (Kr. Heidenheim). Veröffentl. Staatl. Amt Denkmalpfl. Stuttgart Reihe A, H. 12 (Stuttgart 1967).
Pohl 2004W. Pohl, Gender and Ethnicity in the Early Middle Ages. In: L. Brubaker/J. M. H. Smith (Hrsg.), Gender in the Early Medieval World. East and West, 300–900 (Cambridge 2004) 23–43.
Reimann 1995D. Reimann, Schutz und Trutz en minature – zu einem Miniatur-schild aus Schützing, Gem. Marktl. Lkr. Altötting. Arch. Jahr Bay-ern 1995, 133–134.
Reinle 2000Ch. Reinle, Exempla weiblicher Stärke? Zu den Ausprägungen des mittelalterlichen Amazonenbildes. Hist. Zeitschr. 270, 2000, 1–38.
Rettner 1997A. Rettner, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Zeuzleben (Gde. Werneck, Lkr. Schweinfurt). Phil. Diss. München 1997.
Rettner 2010A. Rettner, Goldscheibenfibeln. In: R. Gebhard (Hrsg.), Archäologi-sche Staatssammlung München. Glanzstücke des Museums (Mün-chen 2010) 40 f.
Sage 1984W. Sage, Das Reihengräberfeld von Altenerding I. Germ. Denkm. Völkerwanderungszeit Ser. A, Bd. XIV (Berlin 1984).
Sawyer 1989B. Sawyer, s. v. Frau. VII. Skandinavien. Lexikon des Mittelalters 4 (München 1989) 860 f.
Schabel 1992A. Schabel, Das bajuwarische Gräberfeld von Weiding (Mühldorf a. Inn 1992).
Schneider 2008T. Schneider, Mehrfachbestattungen von Männern in der Mero-wingerzeit. Zeitschr. Arch. Mittelalter 36, 2008, 1–32.
Schneider 2010T. Schneider, Die Frauenkrieger von Niederstotzingen. In: Amazo-nen. Geheimnisvolle Kriegerinnen. Ausstellungskat. Speyer (Spey-er 2010) 178–181.
Stauch 2007E. Stauch, Alter ist Silber, Jugend ist Gold! Zur altersdifferen-zierten Analyse frühgeschichtlicher Bestattungen. In: S. Brather (Hrsg.), Zwischen Spätantike und Mittelalter. Ergänzungsbd. Reallex. German. Altertumskunde 57 (Berlin, New York 2007) 275–295.
Steuer 2008H. Steuer, Archäologische Belege für das Fehdewesen während der Merowingerzeit. In U. Ludwig (Hrsg.): Nomen et Fraternitas: Festschr. für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag (Berlin 2008) 343–362.
Thörle 2001St. Thörle, Gleicharmige Bügelfibeln des frühen Mittelalters. Uni-versitätsforsch. Prähist. Arch. 81 (Bonn 2001).
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 238 03.11.2014 10:44:21
239
Walter 2008S. Walter, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Mengen. Mate-rialh. Arch. Baden-Württemberg 82 (Stuttgart 2008).
Weber 2000M. Weber, Das sächsische Gräberfeld von Issendorf, Landkreis Sta-de 2. Stud. Sachsenforsch. 9,2 (Oldenburg 2000).
Werner 1950J. Werner, Das alamannische Fürstengrab von Wittislingen. Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 2 (München 1950).
Werner 1954J. Werner, Waage und Geld in der Merowingerzeit (München 1954).
Wolf 2013R. Wolf, Das alamannische Adelsgräberfeld von Niederstotzingen, Kreis Heidenheim. In: D. Planck/D. Krausse/R. Wolf (Hrsg.), Mei-lensteine der Archäologie in Württemberg. Ausgrabungen aus 50 Jahren (Darmstadt 2013) 53–55.
Wolfram 1990H. Wolfram, Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechs-ten Jahrhunderts (München 1990).
Wolfram 2005H. Wolfram, Gotische Studien. Volk und Herrschaft im frühen Mittelalter (München 2005).
Wührer 2000B. Wührer, Merowingerzeitlicher Armschmuck aus Metall. Euro-pe médiévale 2 (Montagnac 2000).
Zeller 2000M. Zeller, Molekularbiologische Geschlechts- und Verwandt- schaftsbestimmung an historischen Skelettresten. Rer. Nat. Diss (Tübingen 2000).
Ziegaus 2010B. Ziegaus, Goldener Münzfingerring. In: R. Gebhard (Hrsg.), Ar-chäologische Staatssammlung München. Glanzstücke des Muse-ums (München 2010) 112 f.
Zintl 2004/2005St. Zintl, Das frühmerowingische Gräberfeld von München-Per-lach. Ber. Bayer. Bodendenkmalpfl. 45/46, 2004/2005, 281–370.
Literaturabkürzungen (Anthropologie)
Alonso/Martín 2005A. Alonso/P. Martín, A real-time PCR protocol to determine the number of amelogenin (X-Y) gene copies from forensic DNA samp-les. Forensic DNA Typing Protocols: Methods in Molecular Biology 297, 2005, 31–44.
Alonso u. a. 2003A. Alonso/P. Martín/C. Albarrán/P. García P/O. García/L. Fernán-dez de Simón L./J. García-Hirschfeld/M. Sancho M./C. de la Rúa/ J. Fernández-Piqueras, Real-time PCR designs to estimate nuclear and mitochondrial DNA copy number in forensic and ancient DNA studies. Forensic Sci. Int. 139, 2003, 141–149.
Beyer-Olsen/Alexandersen 1995E. M. Beyer-Olsen/V. Alexandersen, Sex assessment of medieval Norwegian skeletons bases in permanent tooth crown size. Int. J. Osteoarchaeol. 5, 1995, 274–281.
Brown/Brown 2011T. Brown/K. Brown, Biomolecular Archaeology. An introduction (Wiley-Blackwell 2001).
Bruzek 2002J. Bruzek, A method of visual determination of sex, using the hu-man hip bone. Am. J. Phys. Anthropol.117, 2002, 157–168.
Butler/Hill 2012J. M. Butler/C. Hill, Biology and genetics of new autosomal STR loci useful for forensic DNA analysis. Forensic Science Review 24 Nr. 1 (Central Police University Press 2012).
Ferembach 1978D. Ferembach, Recommendations for age and sex diagnoses of ske-letons. Journal of Human Evolution 1980,9, 1978, 517–549.
Graw u. a. 2005M. Graw/J. Wahl/M. Ahlbrecht, Course of the meatus acusticus in-ternus as criterion for sex differentiation. Forensic Science Inter-national 147, 2005, 113–117.
Grupe u. a. 2005G. Grupe/K. Christiansen/I. Schröder/U. Wittwer-Backofen, Anth-ropologie, ein einführendes Lehrbuch (Berlin, Heidelberg 2005).
Herrmann u. a. 1990B. Herrmann/G. Grupe/S. Hummel/H. Piepenbrink/H. Schutkow-ski, Prähistorische Anthropologie, Leitfaden der Feld- und Labor-methoden (Berlin, Heidelberg 2005).
Murail u. a. 2005P. Murail/J. Bruzek/F. Houet/E. Cunha, DSP: A tool for probabilis-tic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measu-rements. Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris. Numéro 17 (3-4), 2005.
Novotný 1972V. Novotný, Geschlechtsmerkmale und Geschlechtsbestimmung auf dem Hüftbein (Os coxae). Konference europskych antrop, 21 p, (Prag 1972).
Pilli u. a. 2013E. Pilli/A. Modi/C. Serpico/A. Achilli/H. Lancioni/B. Lippi/F. Ber-toldi/S. Gelichi/M. Lari/D. Caramelli, Monitoring DNA contami-nation in handled vs. directly excavated ancient human skeletal remains. Plos one, Vol. 8, Issue 1: e52524.
Pruvost/Geigl 2004M. Pruvost/E. M. Geigl, Real-time quantitative PCR to assess the au-thenticity of ancient DNA amplification. Journal of Archaeological Science 31, 2004, 1191–1197.
Pruvost u. a. 2005M. Pruvost/T. Grange/E. M. Geigl, Minimizing DNA contaminati-on by using UNG-coupled quantitative real-time PCR on degraded DNA samples: application to ancient DNA studies. BioTechniques 38, 2005, 569–575.
Rösing 1983F. W. Rösing, Sexing immature human skeletons. J. Hum. Evolution 12, 1983, 149–155.
Rösing u. a. 2005F. W. Rösing/M. Graw/B. Marré/S. Ritz-Timme/M. A. Rothschild/ K. Rötscher/A. Schmeling/I. Schröder/G. Geserick, Empfehlungen für die forensische Geschlechts- und Altersdiagnose am Skelett. Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik der deut-schen Gesellschaft für Rechtsmedizin (2005).
Schild 1996T. A. Schild, Einführung in die Real-Time TaqMan™ PCR-Technolo-gie. Vers. 2.1. Verlag Applied Biosystems GmbH, Weiterstadt.
https://www.core-facility.uni-freiburg.de/lc480/lc480obj/solsman
Seifert u. a. 2013L. Seifert/M. Harbeck/A. Thomas/N. Hoke/L. Zöller/I. Wiechmann/ G. Grupe/H. C. Scholz/J. M. Riehm, Strategy for Sensitive and Speci-fic Detection of Yersinia pestis in Skeletons of the Black Death Pan-demic. PLoS ONE 8(9): e75742. doi:10.1371/journal.pone.0075742
Steckel u. a. 2005R. H. Steckel/C. S. Larsen/P. W. Sciulli/P. L. Walker, Data Collection Codebook (Ohio State University 2005).
Frühmittelalterliche Frauen in Waffen?
BVBl_ 79_2014.indd 239 03.11.2014 10:44:21
240
Sodeikat 1982F. Sodeikat, Zur morphologischen Alters- und Geschlechtsbestim-mung am Skelett. Anthrop. Anz. 40,4, 1982, 265–284.
Wahl/Graw 2001J. Wahl/M. Graw, Metric sex differentiation of the pars petrosa os-sis temporalis. Int. J. Legal. Med. 114, 2001, 215–223.
Wiechmann u. a. 2012I. Wiechmann/M. Harbeck/G. Grupe/J. Peters, Ancient DNA-Labor des ArchaeoBioCenters, LMU München. In: Grupe G., McGlynn G. & Peters J. (Hrsg.): Documenta Archaeobiologiae 10. Current dis-coveries from outside and within – Field explorations and critical comments from the lab (Rahden/Westf. 2012).
Yang u. a. 1998D. Y. Yang/B. Eng/J. S. Waye/J. C. Dudar/S. R. Saunders, Technical note: improved DNA extraction from ancient bones using silica-based spin columns. Am. J. Phys. Anthropol. 105, 1998, 539–543.
Abbildungsnachweis
Abb.1; 2; 4: Fotos: St. Friedrich, Archäolog. Staatsslg. München.Abb. 3: Dr. G. Sorge, Archäolog. Staatsslg. München.Abb. 5: Verändert nach Schild 1996.Abb. 6: F. Immler. Abb. 7: Geisler 1998 Taf. 153.Abb. 8: Menke/Menke 2013 Taf. 44; Taf. 74.Abb. 9: Geisler 1998 Taf. 5.
Tobias Gärtner, Brigitte Haas-Gebhard, Michaela Harbeck, Franziska Immler und Andreas Rott
BVBl_ 79_2014.indd 240 03.11.2014 10:44:21