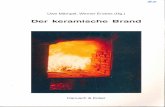Der Stralsunder Laufgraben von 1628- verschüttete Söldner und Waffen in situ. Festungsbau im...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Der Stralsunder Laufgraben von 1628- verschüttete Söldner und Waffen in situ. Festungsbau im...
Einleitung
Die Pommersche Ostseeküste nahm im Ver-lauf des Dreißigjährigen Krieges, in der Phase des Dänisch-Niedersächsischen Krieges (1625–1629) eine bedeutende Rolle ein, insbe-sondere die Insel Usedom und die Stadt Wol-gast.1 Der Hansestadt Stralsund wurde bisher vor allem wegen der erfolgreich abgewehrten Belagerung der kaiserlichen Truppen und ihrer Verhandlungspolitik mit dem Herzog von Friedland, Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, Wallenstein genannt (1583–1634), mit ihrem Landesherrn Bogislaw XIV., Herzog von Pommern-Stettin (1580–1637) als auch mit den nordischen Mächten Däne-mark und Schweden Aufmerksamkeit zuteil.Mit der Entdeckung des Stralsunder Laufgra-bens im Jahr 2010 rückte der Nordosten Deutschlands mehr in das Bewusstsein der Schlachtfeldarchäologie.2 Der während der
Belagerung Stralsunds 1628 ausgehobene Gra-ben, in dem zwei Männer starben und in situ verschüttet wurden, gehört im engeren Sinne nicht zum Thema dieses Tagungsbandes Schlachtfeld und Massengrab. Dennoch ist der Stralsunder Laufgraben einer „der spektaku-lärsten neuzeitlichen Funde Deutschlands der letzten Jahre“ aus dem Bereich kriegerischen Handelns (Brock/Ho mann 2011, 65).Der Stralsunder Laufgraben und weitere Er-gebnisse der Ausgrabung im Quartier Fran-kenhof (Fundplatz 333) werden im Folgen-den vorgestellt. Ein Exkurs fasst zudem
197
Der Stralsunder Laufgraben von 1628 – verschüttete Söldner und
Waffen in situ. Festungsbau im Süden der Hansestadt (Quartier Fran-
kenhof) im Spiegel archäologischer Befunde und historischer Quellen
Marlies Konze, Barth, Renate Samariter, Horst
In der Hansestadt Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) untersuchte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 2010 im südlich der Altstadt gelegenen Quartier Frankenhof eine etwa 5000 m2 große Fläche. Das Areal wurde vom 14.–19. Jh. intensiv genutzt und dabei durch Festungsbauten des 17.–19. Jhs. maßgeblich geprägt. Der wichtigste neuzeitli-che Befund war ein Laufgraben, in dem wäh-rend der Belagerung Stralsunds und bei Ge-fechten um das Frankenkronwerk im Sommer 1628 zwei Männer gestorben und mit etlichen Waffen sowie Schanzwerkzeugen verschüttet worden waren. Die sehr gute Erhaltung von Funden aus Metall, Holz, Leder und Stoff macht diesen Befund zu einer einzigartigen Momentaufnahme der Kämpfe des Dreißig-jährigen Krieges. Mithilfe zeitgenössischer Quellen konnten die Todesumstände konkre-tisiert werden.
In 2010, an area of approximately 5000 m2 in the Frankenhof quarter was excavated by the Heritage Services of Mecklenburg-Vorpom-mern. This area, to the south of the histor i-cal centre of the Hanseatic city of Stralsund, was used intensively from the 14th to the 19th
century and was subsequently shaped by for-tifications dating from the 17th to the 19th cen-tury. The most important post-medieval find was a communication trench, in which—dur-ing the siege of Stralsund and fighting around the Frankenkronwerk bastion in the summer of 1628 —two men were killed and entombed with a number of weapons and entrenching tools. The excellent preservation of metal, wood, leather and fabrics makes this con-text a singular snapshot of a battle from the Thirty Years War. The circumstances of the deaths were substantiated using contempo-rary sources.
Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg · Band 15 · 2014 · Seite 197–231
1 In der Schlacht bei Wolgast am 2. September 1628 wurde das dänische Heer unter Christian IV. (1577–1648) von den kaiserlichen Truppen geschlagen. Zwei Jahre später, am 6. Juli 1630 landete Gustav II. Adolf (1594–1632) mit seiner Armee an der Küste Usedoms und begann seinen Feldzug nach Süddeutschland.
2 Aus Mecklenburg-Vorpommern ist vor allem der Fundplatz Weltzin im Tollen-setal nördlich von Altentreptow bekannt. Die menschlichen Skelettreste, Tierkno-chen und Waffenfunde aus der Bronzezeit werden als Überreste eines Gruppen-konfliktes interpretiert (vgl. Lidke u. a. in diesem Band, 17–24).
198 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
erstmals die wichtigsten schlachtfeldarchäo-logischen Befunde und Funde aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Mecklenburg-Vorpommern zusammen.
Historische Quellen bis zum Beginn der
Belagerung Stralsunds 1628
Mit der Besetzung des Mecklenburg-Stargar-dischen Landes im Juli 1627 durch kaiserliche Truppen unter Hans Georg von Arnim-Boi-zenburg (1583–1641) war der Krieg bis an die Grenzen Pommerns gelangt (Abb. 1). Am 10. Oktober 1627 wurden in Mecklenburg die Stadt Wismar und die Insel Poel einge-nommen, Rostock kaufte sich mit Geld frei. Bogislaw XIV., Herzog von Pommern-Stet-tin, unterzeichnete am 10. November 1627 die Franzburger Kapitulation, die das Einrü-cken der kaiserlichen Truppen in Pommern
gestattete. Die fürstlichen Residenzorte Wol-gast, Stettin, Damm und Köslin (das heutige polnische Koszalin) sollten von einer Beset-zung ausgenommen werden. Unmittelbar nach der Unterzeichnung drangen kaiserliche Truppen in Pommern ein, insgesamt 31 500 Mann zu Fuß und 7540 Mann zu Ross unter dem Oberbefehl von Arnim-Boizenburgs (Kosegarten 1853, 103 ff.). Die Städte in un-mittelbarer Nachbarschaft Stralsunds wur-den schnell besetzt. Am 28. November3 rück-ten eine halbe Kompanie in Barth und am 30. November fünf Kompanien vom Reiter-regiment des Obersten Pernstein mit Stab in Greifswald ein (Fock 1872, 145). Von hier aus führte von Arnim-Boizenburg zunächst Ver-handlungen mit Stralsund. Die Stadt wider-setzte sich sowohl dem kaiserlichen Feld-herrn Wallenstein als auch ihrem Landesherrn Bogislaw XIV. mit ihrer Weigerung den Durchzug kaiserlicher Truppen zu gewähren und eine Besatzung aufzunehmen.Nachdem Verhandlungen zwischen den Kai-serlichen und Stralsund an den jeweiligen
3 O. Fock (1872) verwendete den alten julianischen Kalender, seine Datumsangaben sind im Text auf den neuen gregorianischen Kalender umgerechnet.
Abb. 1: Lage der Stadt Stralsund (roter Kreis) in einer Karte Pommerns von E. Lubino, S. Rogiers und I. Hondius, Amsterdam 1650
199Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Forderungen gescheitert waren, ließ von Ar-nim-Boizenburg am 14. Februar 1628 die südöstlich der Stadt gelegene Insel Dänholm von Rügen aus besetzen. Am 21. Februar ei-nigte man sich im Greifswalder Vergleich, dass die Stadt 30 000 Taler zahlen, den Aus-bau ihrer Verteidigungsanlagen einstellen und ihre Schiffe vom Dänholm zurückziehen sollte (ebd. 169). Im Gegenzug sagte von Ar-nim-Boizenburg den Stralsundern freien Handel zu und versprach, den Dänholm nicht weiter zu befestigen. Stralsund zahlte die ge-forderte Summe am nächsten Tag, von Arnim blockierte jedoch die Handelswege zu Land und ließ auf dem Dänholm weiterhin gegen die Stadt gerichtete Festungswerke aufbauen. Die Stadt beschloss daraufhin, mit dem Bau der Festungsanlagen fortzufahren und ließ wieder Schiffe vor dem Dänholm kreuzen. Zunächst wurden Proviantlieferungen noch zugelassen, im März blockierte man die Insel dann vollständig. Am 15. April musste die Besatzung des Dänholms kapitulieren; die kaiserlichen Truppen zogen von der Insel ab, die daraufhin von städtischen Einheiten be-setzt wurde (ebd. 178).Ende April wies Wallenstein von Arnim-Boi-zenburg an, wie er weiter mit Stralsund ver-fahren solle: „Bitt derowegen, der Herr sehe auf alle Weis eine Guarnizon hienein zu brin-gen, wollen sies nicht mitt gutem einnehmen, so hebe der Herr nur an, in Gottes Nahmen die Approchi [Annäherungsgräben; Verf.] zu machen, denn ich sehe, das nichts anders thun wird.“ (Langer 1985, 161).Von Arnim-Boizenburg begann Stralsund einzuschließen; am 23. Mai 1628 war der landseitige Belagerungsring vollständig ge-schlossen. Die kaiserlichen Truppen lagerten im Hainholz (nordwestlich der Stadt), von Arnim-Boizenburg selbst bezog sein Haupt-quartier in Kedingshagen, etwa 6 km nord-westlich der Stadt. Am 26. Mai begannen die Kampfhandlungen mit einem Sturm auf das Kniepertor im Norden und „In derselben Nacht umb 2. Uhren gegen den Morgen […] ist gleichsfalls für dem Franckenthore an der Stadt Wercken zu sturmen angefangen / und continuiret biß umb 6. Uhr des folgenden 17. Maji / woselbst auch den Sturmern derge-stalt begegnet / daß sie sich endtlich in die noch unabgebrante Katen und Fischerheuse-lein in suburbio retiriret" (Hasert 1631, 85).
Historische Quellen zum Festungsbau in
der Stralsunder Frankenvorstadt (17. Jh.)
Die Stadt Stralsund, 1234 mit Lübischem Stadtrecht bewidmet, ist im Osten durch den Strelasund natürlich geschützt, während es im Norden, Süden und Westen von bereits im Mittelalter aufgestauten Teichen umgeben und gesichert wird. Die Zuwegung erfolgte seitdem hauptsächlich über drei Dämme: im Westen über den Tribseer Damm, im Norden über den Knieper- und im Süden über den Frankendamm. Die insuläre Lage und die vor 1300 errichtete Stadtmauer aus Backsteinen mit ihren sechs Wasser- und vier Landtoren boten zunächst ausreichend Schutz gegen Angriffe. Mit der Entwicklung der Feuer-waffen wurden jedoch neue Verteidigungs-anlagen notwendig.Die südlich der Altstadt gelegene Franken-vorstadt entwickelte sich um den 1318 erst-mals genannten Frankendamm. Sie war im Mittelalter Standort von Ziegeleien, Werften und deren Zulieferbetrieben; hier befanden sich die Gertruden- und Heilig-Kreuz-Ka-pelle. Den schriftlichen Quellen nach began-nen erste Baumaßnahmen zur Befestigung der Frankenvorstadt mit dem Abbruch der Gertrudenkapelle im Jahr 1547 (Stralsund 1902, 378). Nach O. Fock (1872, 135) gab es hier 300 Wohnhäuser, in denen 500 Familien lebten. Im März und April 1628 wurde, ange-sichts der drohenden Besetzung, ein Großteil der Bebauung abgebrochen: „von dem niede-ren Volk der Stadt gegen den Willen und Wunsch des Rathes und der Patrizier" (ebd. 506).Bereits 1625 hatte Dietrich von Falkenberg (1580–1631) bei seinem Aufenthalt in der Stadt einen Plan „für die Anlage neuer Befes-tigungswerke und Vervollkommnung der alten" angefertigt (ebd. 135), doch fanden in-tensive Arbeiten an den Außenwerken erst 1627 statt. Neben der Vertiefung der Teiche ist vor allem an Gräben und Wällen in den Vorstädten gearbeitet worden. „Die Bürger-schaft wurde zum Schanzen aufgeboten, die Reicheren mußten Pferde und Wagen stellen, und so wurde vor dem Knieper- und dem Frankendamm allmälig eine Reihe von Au-ßenwerken hergestellt" (ebd. 134). Dennoch sind diese in zeitgenössischen Quellen als un-zureichend beschrieben worden.Major Robert Monro, der vom dänischen König für sechs Wochen zur Unterstützung in das seit dem 23. Mai belagerte Stralsund
199
200 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
ten, der am schwächsten war“ (zitiert nach: Mahr 1995, 70 f.).Die Festungswerke, die während der Belage-rung existierten, sowie die Stellungen der kaiserlichen Truppen kartierte 1628 der schwedische Ingenieur A. Fielittz (Abb. 2). Der niederländische ‚Special=Agent‘ Carl von Cracau, der sich im Auftrag seiner Regie-rung von Januar bis Mai 1629 in Stralsund aufhielt, legte eine leicht abgewandelte Vari-ante dieser Karte seinem „Bericht über […] die dortigen Zustände während und kurz nach der wallensteinischen Belagerung“ bei (zitiert nach: Fock 1872, 501 ff.). Der Histori-ker und Theologe Otto Heinrich Friedrich Fock (1819–1872), der 1872 eine Übersetzung dieses Berichts inklusive einer nochmals leicht abgewandelten und ergänzten Karte veröffentlichte, erkannte deren Bedeutung für die Stadtgeschichte: „Dieser Plan ist von großer Wichtigkeit; er ist nicht allein der äl-teste vorhandene Stadtplan von Stralsund, sondern er ist auch der einzige, welcher eine zuverlässige Kunde giebt von der Gestalt und
geschickt worden war, traf mit seinem schot-tischen Regiment am 7. Juni dort ein und schilderte die Befestigung im Süden der Stadt als „ein dürftiges, nur durch einen trockenen Graben oberflächlich geschütztes Außen-werk, mit nicht mehr als mannshohen Wäl-len. Vor uns lag der starke Feind und kam immer näher, so daß wir einen plötzlichen Sturm befürchteten. […] So hielten wir jede Nacht Wache und lösten einander ab, und das während eines Zeitraums von sechs Wochen. Die übrigen Stellungen oben auf den Mauern waren mit Deutschen besetzt, aber keiner von ihnen hatte auch nur die Hälfte dessen zu leisten, was wir leisteten, und zwar aus dem Grund, weil sich alle Annäherungsgräben des Feindes gegen unseren Abschnitt richte-
4 Stralsund hatte während der Belagerung „den Advocaten Laurentius […] nach den Niederlanden gesandt, um auf Grund des seit 1616 zwischen den Niederlanden und einer Anzahl deutscher Hansestädte, worunter auch Stralsund, bestehenden Bundesvertrages die Unterstützung der General=Staaten in Anspruch zu neh-men.“ Infolge des Berichtes von C. von Cracau erhielt Stralsund eine „Beihülfe von 30.000 Gulden“ (Fock 1872, 501 f.).
Abb. 2: Plan der Stral-sunder Festungswerke von A. Fielittz, 1628. Detailausschnitt mit rotem Kreis: Grabungsfläche Quartier Frankenhof, Fpl. 333; 1 Alte Landwehr; 2 Zingel; 3 Mühlenberg; 4 Ziegelhofschanze; 5 Gertrudenkirchhof
201Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Mittelalter
Ausgehend von einem natürlichen Gelän-desporn im Westen der Grabungsfläche, be-gann um 1300 die Besiedlung der Vorstadt. Ab Mitte bis kurz vor Ende des 14. Jhs. wurde hier Gewerbe angesiedelt. Ausschlaggebend dafür war die direkte Nähe zum Strelasund,
Art der Befestigungswerke Stralsunds und der Angriffspositionen der Kaiserlichen zur Zeit der Belagerung“ (ebd.).4
Der von Fielittz angefertigte „Abriss von der Belahgerung der Stadt Stralsundt wie diesel-bige von dem kaiserlichen Feldmarschalk Arnheim angestellet und continuiret worden. Anno 1628“ zeigt ein unregelmäßiges Kron-werk vor dem Frankentor, während die am rechten oberen Rand mit „31 Decemb 1628“ datierte Karte aus dem Schwedischen Kriegs-archiv (Abb. 3) bereits das ausgebaute Kron-werk abbildet, das entsprechend dem Bericht von Cracaus auf schwedische Weisung nach der Belagerung entstand.Anhand der von Fielittz gezeichneten Karte lässt sich das bei O. Fock (ebd. 211; 214) be-schriebene Vorrücken der kaiserlichen Trup-pen auf das Frankentor gut nachvollziehen. So wurde zunächst die alte Landwehr einge-nommen, die von den Stralsundern nicht neu befestigt und besetzt worden war. Die kaiser-lichen Truppen verschanzten sich auf dem Mühlenberg und legten von hier aus Laufgrä-ben an. Im Bereich des Ziegelhofs wurde eine Schanze aufgeworfen, von der aus das Fran-kentor mit seinen Außenwerken sowie das Fahrwasser in Richtung Rügen unter Be-schuss genommen wurden. Eine Redoute und kleinere Batterien errichtete man am Müh-lenberg. Eine weitere große Batterie, flan-kiert von kleineren Redouten befand sich etwa 500 Schritte vom Außenwerk entfernt, mitten in der Frankenvorstadt (ebd. 236 f.). Kleinere Verschanzungen wurden zudem auf dem ehemaligen Gertrudenkirchhof einge-richtet, dessen Begrenzungsmauer noch er-halten war und als rote Linie in Abbildung 2 eingezeichnet ist.
Das Grabungsgelände
Von April bis Dezember 2010 und im Febru-ar 2011 führte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) im Quartier Fran-kenhof, das sich südlich der Stralsunder Alt-stadt befindet (Abb. 4), umfangreiche Ber-gungs- und Dokumentationsarbeiten durch. Mit deren Leitung wurden die Verfasserin-nen betraut.5 Im Sommer 2012 machte die Sa-nierung der westlich an die Grabungsfläche grenzenden Straße Frankenhof eine weitere baubegleitende Untersuchung erforderlich.6
Das ca. 5000 m2 große Areal wurde bis 0,4 m HN (etwa 3,5 m u. GOK) bzw. bis 0,9 m HN ausgegraben.
5 Dem Grabungsteam vom Frankenhof sei herzlich gedankt.6 Die Leitung übernahm Renate Samariter.
Abb. 3: Plan der Stralsunder Festungs-werke vom 31. Dezember 1628
Abb. 4: Lage der Grabungsfläche Quartier Frankenhof, Fpl. 333
202 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Abb. 5: Grabungsgelände Quartier Frankenhof, Fpl. 333. Befunde der Zeit um 1600 –1630 sowie Ost- und Südfacen der Ostbastion des Frankenkronwerks aus der zweiten Hälfte des 17. Jhs.
203Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
dessen Ufer damals im westlichen Bereich der Grabungsfläche verlief. Um 1350/1360 ent-stand im Flachwasserbereich eine aus etwa 150 abgewrackten Boots- und Schiffsteilen gebaute, 15 m lange und 4–5 m breite Boots-werft.7 Unmittelbar am Ufer verlief eine wie-derholt angehobene Straße, die wohl zu den südöstlich gelegenen Ziegeleien führte. Diese Infrastruktur wurde um 1380/1390 aufgege-ben und das Gelände aufgeschüttet.8
Dreißigjähriger Krieg (Abb. 5)
Anfang des 17. Jhs. wurde erneut aufplaniert und ein etwa 74 m2 großes ebenerdiges oder leicht eingetieftes Gebäude errichtet (Abb. 6). Von diesem vermutlichen Wach-/Lagerhaus erhielten sich die Feldsteinunterzüge für die Schwellbalken und Teile des Fußbodens. Der mit Back- und Feldsteinen sowie Backstein-fliesen und Kalksteinplatten belegte Boden lag bei 2,1 m HN und war im Osten bis zu 0,4 m abgesackt. Um das Laufniveau auszu-gleichen, wurden Fragmente einer um 1590/1600 entstandenen Kachelserie mit der Darstellung eines ‚Haubtmanns‘ (Abb. 7,1) und eines Trabanten (Abb. 7,3) sowie das Bruchstück einer Bekrönungskachel mit stei-gendem Löwen (Abb. 7,2) verbaut. Auf dem jüngsten Fußboden lag eine Kupferklippe (halbe Öre) aus der Zeit Gustavs II. Adolf, die zwischen 1611 und 1632 datiert (Abb. 8). Wahrscheinlich war das Gebäude in zwei Räume unterteilt; die in einer Reihe verlegten Kalksteinplatten waren wohl Unterzüge für eine Trennwand.Etwa 20 m südlich des Wach-/Lagerhauses befand sich ein Wasser führender Kanal, der in den Strelasund mündete. 1625 (oder kurz danach) wurde eine abgedeckelte, aus Eiche gezimmerte Wasserleitung (Oberkante bei 2,1 m HN) installiert, die in diesen, seit dem ausgehenden 14. Jh. mit Holz ausgesteiften Kanal entwässerte. Vermutlich war das Lauf-niveau zu dieser Zeit teilweise befestigt; Reste eines Feldsteinpflasters (Oberkante bei 2,35 m HN) fanden sich südlich des Wach-/Lagerhauses. Spätestens mit den Kampf-handlungen um das Frankenkronwerk wurde das Gebäude abgebrochen, das Wasser füh-rende System funktionslos und verfüllt.Die zeitgenössischen Quellen berichten, dass es sich bei dem Frankenkronwerk um ein auf-geworfenes Erdwerk handelte. Dies scheinen die archäologischen Untersuchungen zu be-stätigen, da sich weder hölzerne noch steiner-
7 Für die dendrochronologischen Datierungen sei Dr. K.-U. Heußner, Deutsches Archäologisches Institut Berlin, herzlich gedankt. Die Bootswerft wurde im Rah-men einer unveröffentlichten Magisterarbeit an der Universität Kiel unter dem Ti-tel „Mittelalterliche Schiffsholzfunde aus einem Gebäudebefund des 14. Jh. vom Fundplatz Stralsund – Frankenhof“ von Phillip Grassel ausgewertet und vorge-stellt.
8 Aus den Aufschüttungsschichten wurde u. a. das umfangreichste Stralsunder Pil-gerzeicheninventar des Mittelalters geborgen (Samariter 2013).
Abb. 6: Wach-/Lagerhaus, Blick nach Westen
Abb. 7: Kachelfragmente einer um 1590/1600 datierenden Serie aus dem Wach-/Lagerhaus. 1 Hauptmann; 2 Bekrönungskachel mit steigendem Löwen; 3 Trabant
1
2
3
204 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
ne Konstruktionen nachweisen ließen. Be-grenzt bzw. geschnitten wurden die Schichten aus dem ersten Viertel des 17. Jhs. von den Baugruben der 1661 errichteten Süd- und der 1664 erbauten Ostface des jüngeren Kron-werks. Sowohl südlich als auch östlich dieses jüngeren Kronwerks fanden sich keine Befun-de aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
Spuren der Belagerung haben sich auf dem Grabungsgelände als eingetiefte Objekte er-halten, die während und nach den brutalen und verlustreichen Kämpfen um das Franken-kronwerk angelegt worden waren. An der Nordwestecke des Wach-/Lagerhauses ent-deckte man in einer flachen Grube, deren Sohle sich bei 1,8 m HN befand, Skelettreste von drei Männern (Massengrab 3). Sie starben im Alter von 21–25, 30–34 und 35–44 Jahren.9 Ihre Knochen lagen nur noch teilweise im anatomischen Verband. Aus dieser Grube barg man zwei Münzen (Abb. 9), zwei Messing spangen (Abb. 10,1.2), eine Gabel (Abb. 10,3), eine Eisenschnalle und mehrere Musketenkugeln. Die beiden Münzen, Taler, wurden unter Erzherzog Leopold (1623–1632) in der Münzstätte Hall (Tirol, Habs-burgische Erblande) im Jahr 1620 (Abb. 9,1) und 1622 in der Münzstätte Middelburg (Pro-vinz Zeeland, Vereinigte Provinzen der Nie-derlande) geprägt (Abb. 9,2).Weitere menschliche Knochen sowie u. a. zwei Musketenläufe stammen aus einer etwa 15 m südlich vom Wach-/Lagerhaus gelege-nen Grube (Sohle bei 0,14 m HN), die als Sprengtrichter interpretiert wird.In Massengrab 2, etwa 20 m südlich des Wach-/Lagerhauses, wurden zehn Männer bestattet (Abb. 11), die überwiegend im jun-gen Alter von durchschnittlich 28 Jahren ge-storben waren. Zwei Jugendliche hatten nicht das 20. Lebensjahr erreicht; nur ein Mann war bereits über 50. Sie wurden mit einer Ausnahme einlagig eingebracht, alle ge-
Abb. 8: Kupferklippe (halbe Öre) aus der Regierungszeit Gustavs II. Adolf (1611–1632)
Abb. 9: Silbertaler aus Massengrab 3. 1 Münzstätte Hall 1620; 2 Münzstätte Middel-burg 1622. M. 1: 1
Abb. 10: Funde aus Massengrab 3. 1; 2 Messingspangen; 3 Eisengabel mit Holz-griff. M. 1: 1
21
1
2
9 Die anthropologische Untersuchung dieser Skelette sowie der aus Massengrab 2 (s. u.) nahm Dr. B. Jungklaus, Anthropologisches Dienstleistungsbüro Berlin, vor, der herzlich gedankt sei.
3
205Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
kaiserlichen Truppen bestattet wurden, als „Bürger und Soldaten alsobald anfingen die feindlichen Batterien, Schanzen und Lauf-gräben zu schleifen, wobei sie dann im Lager viele Leute zerschmettert, todt und noch un-begraben fanden“ (Zober 1828, 217). Dass die Männer an der Pest starben, die im Sommer
streckt auf dem Rücken mit unterschiedli-chen Arm- und Beinhaltungen. Bei drei Toten wies der Schädel nach Osten oder Nordosten (Nr. 3; 6; 8), bei zwei nach Südos-ten (Nr. 9; 10) und bei fünf Männern war der Kopf nach Westen oder Südwesten ausgerich-tet (Nr. 1; 2; 4; 5; 7). Die Skelette 1–8 fanden sich auf einer 9 m2 großen Fläche von etwa 5 (O–W) x 1,8 m (N–S) unmittelbar südöstlich der gedeckelten Holzwasserleitung, die 1625 (oder kurz danach) eingerichtet worden war.10 Ein Toter (Nr. 1) lag auf der Kanalver-füllung, die anderen befanden sich östlich davon.Die Skelette waren in Gruppen unterschied-lich angeordnet: die Leichname 1 und 2 waren übereinander und 4–8 dicht neben- und nur teilweise aufeinander gelegt worden, sodass sie sich berührten. Die beiden Toten 9 und 10 begrub man dicht nebeneinander in einem Doppelgrab etwa 4 m südöstlich auf vergleichbarer Bestattungshöhe.Bei zwei Toten wurden halbkugelige Glas-knöpfe mit Metallösen gefunden (Dm. 8–13,8 mm), drei am rechten Arm von Ske-lett 3 (Abb. 12) und fünf im Halsbereich von Skelett 6.11 Aus der Graberde stammen neben Keramikscherben eine Tonmurmel, Reste einer mehrlagigen Lederschuhsohle, ein Teil eines knöchernen Griffes, ein eisernes Ort-band und ein doppelkonischer Pfeifenkopf, dessen Ferse abgebrochen ist (Dm. außen 18 mm, Höhe 26 mm).Die Knochen zweier Toter (Nr. 1; 4) weisen unverheilte Verletzungen von einem Nah-kampf auf.12 Wahrscheinlich waren die Män-ner Söldner, die 1628 während der Belage-rungskämpfe oder nach dem Abzug der
10 Die Toten wurden im Vergleich zu anderen Massengräbern auf einer relativ großen Fläche begraben. Im Massengrab von Wittstock (1636) waren 125 Männer auf etwa 33 m2 (Grothe 2012 a, 168 f.), im Massengrab 1 vom Frankenhof in Stralsund (1715) 25 Männer auf 6 m2 (Ansorge 2010, 129) bestattet worden.
11 Ihre Form ähnelt den Metallknöpfen aus dem Stralsunder Laufgraben (Konze/Samariter 2012, 275 ff.) und dem Massengrab von Wittstock (Grothe 2012 b, 175).
12 Mit 20 % ist der Anteil der Toten mit Knochenverletzungen sehr gering. Im Neu-brandenburger Massengrab von 1631 (Jungklaus/Prehn 2011, 22 ff.) und im Witt-stocker Massengrab von 1636 (Jungklaus u. a. 2012 a, 153 f.) umfasst er jeweils ein Drittel der Verstorbenen.
Abb. 11: Massengrab 2 mit acht dicht beieinan-der liegenden Toten und separater Doppelbe-stattung; links schemati-sche Darstellung der Lage und Numme-rierung der Toten
Abb. 12: Skelett 3 in Massengrab 2, Blick nach Westen. Detail: Knöpfe vom rechten Arm
206 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Zweite Hälfte des 17. Jhs.
Seit Sommer 1628 war Stralsund durch einen Allianzvertrag mit Schweden verbündet. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 kam Vorpommern formell unter die schwedische Krone, die Stralsund zu ihrer größten Fes-tung auf dem Kontinent ausbaute.Eine Konstruktion aus waagerechten Bohlen und Stützpfählen wurde 1661 (oder kurz da-nach), eine weitere 1664 (oder kurz danach) errichtet (vgl. Abb. 5). Beide waren Teil der Süd- bzw. Ostface der östlichen Halbbastion des Frankenkronwerks. Ein sehr hoher An-teil (ca. 70 bzw. 80 %) der Hölzer stammte aus Gotland bzw. Südschweden. Offensicht-lich unterstützte Schweden mit der Lieferung dieses Baumaterials den Ausbau der Fes-tungsanlagen.Bereits ab 1671 wurden weitere Holzkonst-ruktionen gesetzt. Die neue Südface bzw. deren hölzerne Aussteifung zum Bastions-graben versetzte man um etwa 1,5 m nach Süden. Kurze Zeit später, ab 1672, wurde eine neue hölzerne Befestigung der Ostface ge-baut (Abb. 13). Dies ging mit einer Änderung ihrer Flucht und einem Verschieben Rich-tung Strelasund einher; der Winkel zwischen den Facen vergrößerte sich von 70 ° auf etwa 85°.Das Gelände zwischen den alten und den neu errichteten Facen wurde aufgeschüttet und landfest gemacht. Dabei verwendete man bei der Ostface u. a. abgestochene Gras-soden, auch Wasen oder Plaggen genannt, die als Baumaterial vielfältig einsetzbar waren.14
Nach historischen Schriftquellen ist auch bei Stralsunder Festungsbauten dieses häufig vorkommende und leicht zu gewinnende Ma-terial verwendet worden. So berichtete E. H. Zober (1828, 148): "Am 28sten [Mai] liefen zehn Schotten, ohne ihre Musketen geladen zu haben, auf dem Kniepesdamme 20 Ar-nimschen Soldaten, welche aus dem Heinholz Wasen nach ihren Schanzen trugen, entge-gen, schlugen ihrer etliche nieder und nah-men ihnen die Wasen." O. Fock (1872, 178) vermerkte, dass die kaiserlichen Truppen Wasen beim Schanzenbau auf der rügenschen Halbinsel Drigge nutzten.15
Das Aufschüttungsmaterial dürfte größten-teils aus der näheren Umgebung stammen. Mit dem Bau der Ostface 1672 verloren die älteren Festungswerke ihre Funktion, wur-den spätestens zu diesem Zeitpunkt eingeeb-
1629 in Stralsund innerhalb von zwei Mona-ten 2 000 Opfer forderte, ist nicht ganz aus-zuschließen. Zwischen 1627 (Franzburger Kapitulation) und 1631 (Abzug der kaiserli-chen Truppen aus Greifswald) war Stralsund unmittelbar von Kämpfen bedroht. Brand-schatzung, Plünderung, Mord und Totschlag waren während des Dreißigjährigen Krieges an der Tagesordnung. Die Anlage des Grabes, das Bestattungsmuster der Toten und die ge-ringe Anzahl der am Skelett nachweisbaren Verletzungen können auch mit einem Kran-kenlager oder Ähnlichem in Verbindung ge-bracht werden.13
Der wichtigste Befundkomplex dieser ar-chäologischen Untersuchungen ist ein am Westrand der Grabungsfläche angeschnitte-ner Laufgraben, in dem zwei Skelette und et-liche Waffen lagen. Dieser Graben wurde während der Kämpfe um das Frankenkron-werk verschüttet – so blieb eine einzigartige Momentaufnahme von der Belagerung Stral-sunds im Sommer 1628 erhalten. Der Lauf-graben wird im nächsten Kapitel ausführlich vorgestellt.
13 Zum Massengrab 2 vgl. den ausführlichen Bericht in der Reihe StraleSunth – Stadt-Schreiber-Geschichte(n); Jungklaus u. a. 2012 b.
14 Die Auskleidung der seit der zweiten Hälfte des 14. Jhs. mit Holz ausgesteiften Wasserrinne im Quartier Frankenhof bestand ursprünglich ebenfalls aus Grasso-den.
15 Bei archäologischen Untersuchungen 2009 westlich der Schweriner Altstadt ist ein Ravelin untersucht worden, dessen Nordseite beidseitig einer Bohlenwand (1644 oder kurz danach) ebenfalls mit Grassoden eingefasst war (Konze u. a. 2010, 530).
Abb. 13: Holz-konstruktion der Ostface des Frankenkronwerks von 1672 (oder kurz danach), Blick nach Westen
207Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
net und ihr Baumaterial, darunter die Gras-soden, zur Aufhöhung des Geländes verwendet. Gestützt wird diese Annahme durch den hohen Anteil älterer Funde. So stammen u. a. 13 Münzen, neben mittelalter-lichen Geprägen fünf kleinere Nominale (Scherf, Witten) des 16. Jhs., aus den Auf-schüttungen. Der jüngste Fund, eine mit dem Stralsunder Pfeil und der Jahreszahl 1670 geprägte Bleimarke, komplementiert die dendrochronologische Datierung der neu errichteten Ostface um 1672 oder kurz da-nach.Die Festungswerke erwiesen sich im Verlauf des Schwedisch-Brandenburgischen Krieges jedoch als unzureichend. Im Oktober 1678 wurde Stralsund vom brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (1620–1688) belagert und nach heftigem Beschuss einge-nommen.
Erstes Viertel 18. Jh.
In der Frühphase des Nordischen Krieges (1700–1721) entstand 1705 (oder kurz da-nach) ein Hornwerk, von dem bei der Gra-bung ein etwa 80 m langer Abschnitt der Ost-face, die Südface auf etwa 50 m Länge und eine Staumauer (der so genannte Bär) erfasst wurden.Die aufwändige hölzerne Gründung bestand aus bis zu fünf parallelen Pfahlreihen, auf denen bis zu 13 m lange Quer- und Längsbal-ken lagerten (Abb. 14). Den nördlichen Ab-schnitt der Ostface errichtete man als 2 m breite Feldsteinmauer, während der 4 m breite südliche Abschnitt aus Backsteinen bestand (Abb. 15,1), die zur Strelasundseite mit Gra-nitquadern verblendet wurden (Abb. 15,2). Der südlich anschließende Bär, die Staumauer zwischen dem Strelasund und dem mindes-tens 25 m breiten Bastionsgraben, war 5,5 m breit und ebenfalls aus Backsteinen und Gra-
Abb. 14: Holz-substruktion der Südface des Frankenhornwerks von 1705 (oder kurz danach), Blick nach Westen
1 2
Abb. 15: Ostface des Frankenhornwerks von 1705 (oder kurz danach). 1 als Backstein- (im Vordergrund) und Feldsteinmauer ausge-führte Ostface, Blick nach Norden; 2 mit Granitquadern verkleidete Ostseite der Backsteinmauer, Blick nach Südwesten
Abb. 16: Staumauer von 1705 (oder kurz danach) zwischen dem Bastions-graben und dem Strela-sund, Blick nach Norden
208 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Hornwerk (ebd. 130 f.). Nach weiterem hefti-gen Beschuss durch die feindlichen Truppen musste Stralsund am 22.12.1715 kapitulieren. Die Verluste waren sowohl auf Seiten der Be-lagerer als auch der Belagerten sehr hoch. Für 25 Männer wurde die östliche Bastion des Frankenhornwerks zum Grab. Auf etwa 6 m2 waren die Toten teils mit den Köpfen im Wes-ten, teils im Osten und zum Teil auf dem Bauch liegend, in drei bis vier Lagen überein-ander bestattet worden (Ansorge 2010). An den Skeletten ließen sich Verletzungen durch Nahkampf und Artilleriebeschuss nachwei-sen (Jungklaus in diesem Band, 341–351).
19. Jh.
Während der Napoleonischen Kriege (1800–1814/15) wurde Stralsund erneut belagert, beschossen und eingenommen. Um eine feindliche Besetzung zu verhindern, erteilte Napoleon am 1. November 1808 den Befehl, die Festungsanlagen zu schleifen und das Wasser aus den Teichen zu lassen bzw. sie zuzuschütten. Letzteres konnten die Stral-sunder Bürger verhindern, der Großteil der Festungsanlagen wurde jedoch bis 1809 abge-tragen. Im Auftrag der Franzosen sprengte der Greifswalder Universitätsbaumeister Jo-hann Gottfried Quistorp das Frankenhorn-werk. Dieser brachte die Sprengladung im inneren Winkel zwischen Ost- und Südface an und ließ tief reichende Sprengtrichter (Un-terkante bei maximal 0,66 m u. HN) in das Mauerwerk des Bären einschlagen. Die Wucht der Explosion trennte die Südface von ihrer hölzernen Gründung ab und verschob sie etwa 3 m nach Osten in Richtung Strela-sund; das Mauerwerk des Bären wurde zer-rissen.Während des Baus der Frankenhofkaserne zwischen 1877 und 1881 schüttete man das Gelände auf und verfüllte die letzten Reste der Festungsgräben. Die Kaserne wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen.
Der Laufgraben von 1628
Der Laufgraben wurde in zwei etwa 5 m von-einander entfernten Abschnitten erfasst. Das etwa ost-westlich verlaufende, 7,5 m lange, ca. 2 m breite (Sohlenbreite 1,5 m) und 0,8 m tiefe östliche Ende des Grabens ist bei den archäo-logischen Untersuchungen 2010 entdeckt worden (Abb. 17). Während der Sanierung von Versorgungsleitungen in der westlich an
nitquadern ausgeführt worden (Abb. 16). Von der 3 m breiten Backsteinmauer der Südface, die während des 19. Jhs. zur Steingewinnung größtenteils abgebrochen worden war, hat sich ein etwa 10 m langer Abschnitt erhalten. Nach mehrfach erfolgreich abgewehrten Be-lagerungen in den Jahren 1711 und 1712 wurde Stralsund 1715 erneut von sächsischen, preußischen und dänischen Truppen einge-schlossen. Am 5. November begannen erste Angriffe gegen das Frankenhornwerk, dessen vorgelagertes Retranchement von den Bela-gerern durch den Strelasund umgangen und eingenommen wurde (Voges 1922, 64; 81 f.). Am 17. Dezember erstürmten die Angreifer über den zugefrorenen Bastionsgraben das
Abb. 17: Laufgraben von 1628, Blick nach Osten
209Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
bestehen aus mehreren ursprünglich verleim-ten und mit kleinen Nägeln fixierten Lederla-gen. In den Schuhabsätzen des jüngeren Mannes sind Holzkeile verarbeitet worden. Der ältere Soldat trug eine Jacke oder ein Wams,20 zu dem 28 halbkugelige Knöpfe ge-hören. Die Oberbekleidung wurde im Brust-bereich einreihig mit acht, darunter dreirei-hig mit zwei und an den Unterarmen mit jeweils sieben Knöpfen geschlossen (Abb. 21).
das Quartier Frankenhof angrenzenden Stra-ße wurde 2012 der zweite Abschnitt auf einer Länge von 1,5 m untersucht (Abb. 18). Der Graben war hier ebenfalls 2 m breit (Sohlen-breite 1,4 m), jedoch nur 0,6 m tief. Durch den Einbau eines Betonschachtes waren insbe-sondere die Holzfunde bzw. die hölzernen Teile der Funde beschädigt worden.16 Insge-samt erstreckte sich der Graben auf einer Länge von mindestens 13 m. Der zugehörige Wall lag auf der Nordseite in Richtung der Stadt. Der Laufgraben war demnach von kai-serlichen Truppen angelegt worden, um sich auf der Halbbastion zu verschanzen.Die Verfüllsedimente bargen zwei auf dem Bauch liegende Tote (Abb. 17), die sich mit den Köpfen und Schultern berührten und deren linker Arm jeweils unter dem Ober-körper des anderen lag. Sie waren im Nah-kampf schwer, wenn nicht gar tödlich verletzt worden und kampf- sowie handlungsunfä-hig. Der westlich liegende Mann (Individu-um 2) war etwa 1,82 m groß und 18 bis 22 Jahre alt.17 Er starb wahrscheinlich an einer Stichverletzung, verursacht von der Spitze einer Pike oder einer Waffe mit ver-gleichbarem Querschnitt, die seinen vierten Brustwirbel von hinten traf (Abb. 19). Der östlich liegende Mann (Individuum 1) war ca. 1,66 m groß und 45 bis 50 Jahre alt. Sein lin-ker Oberarm war gebrochen, der rechte von einer Klinge getroffen. Tödlich verletzt wurde der Mann wahrscheinlich durch einen Pistolenschuss in seine Brust, wo sich eine Bleikugel mit 13,6 mm Durchmesser fand (Abb. 20,4).18
In seinem Schädel blieben Überreste des Ge-hirns (60 g) in mineralisierter Form erhalten. Erste geochemische Untersuchungen belegen hohe Kohlenstoff-Gehalte und damit die or-ganische Herkunft der Probe. Die in allen Messungen stark vertretenen Elemente Eisen und Schwefel deuten auf anoxische Bildun-gen; weiterhin ist Pyrit nachweisbar. Zu-künftige Analysen sollen klären, ob die Lage des Schädels nahe der Blankwaffe 4 (vgl. Abb. 27) die Erhaltung der Substanz ermög-lichte und ob der erhöhte Schwefelgehalt durch das Schwarzpulver aus Schusswaffe 2 (s. u.) verursacht wurde.19
Von der Bekleidung der Toten haben sich Me-tallverschlüsse und organische Bestandteile erhalten. Beide trugen Halbschuhe aus Leder, von denen die des älteren Mannes mit Ober-leder, Fersenkappen, Laufsohlen und Absät-zen noch vollständig waren. Letztgenannte
16 In diesem Grabenabschnitt wurden eine Stangenwaffe (Nr. 7; s. u.), ein Beil, ein zugespitztes Holz, ein längs gespaltenes Holz, eine fragmentierte hölzerne Dose und neun Musketenkugeln geborgen.
17 Die anthropologische Untersuchung übernahm U. Brinker, M. A., LAKD, der herzlich gedankt sei. Vgl. Brinker u. a. in diesem Band, 233–238.
18 Unser Dank gilt A. Schürger, M. A., Lützen, der die Munition aus dem Laufgraben und einigen anderen Befunden bestimmte.
19 Zurzeit wird das Gehirn am Institut für Geographie und Geologie der Ernst-Mo-ritz-Arndt-Universität Greifswald untersucht. Für die ersten Hinweise sei Dr. S. Lorenz und Prof. L. Warr herzlich gedankt.
20 Für Hinweise zur Bekleidung sei A. Grothe, M. A., Berlin, herzlich gedankt.
1
2
3
Abb. 18: Zweiter Abschnitt des Laufgrabens von 1628. 1 Übersicht, Blick nach Südwesten; 2 bis auf die Sohle frei-gelegter Laufgraben, Blick nach Westen; 3 Detail der Funde auf der Sohle
Abb. 19: Unverheilte Stichverletzung im vier-ten Brustwirbel und Markierung des mögli-cherweise von einer Pike stammenden Stichkanals
210 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Ein Knopf war abgerissen und fand sich sepa-rat im Laufgraben. Alle wurden aus einer in-homogenen Bleischmelze mit Eisen, Kupfer und Nickel in verschiedenen Anteilen gegos-sen. Vermutlich war zur Herstellung der Knöpfe Altmetall eingeschmolzen worden.21
Auf dem rechten Oberschenkel des älteren Mannes lagen ein 11 x 4 cm großes Gewebe-fragment und auf seinem rechten Knie Woll-fäden ohne erkennbare Gewebestruktur.22 Im Nacken und auf der Brust von Individuum 2 fanden sich zugeschnittene, durchlochte Rin-denstücke, die in die Bekleidung eingenäht waren. Auf seinem Rücken wurde im Be-ckenbereich eine 2,4 cm große Messingöse (Abb. 20,2) dokumentiert, der zugehörige Haken lag in geringer Entfernung. Sechs eng benachbarte Musketenkugeln lassen auf einen Kugelbeutel aus Stoff an seiner rechten Hüfte schließen. Aus dem Graben stammen weiterhin ein Pommerscher Schilling, ge-prägt 1622 (Abb. 20,1), ein Messingknopf (Abb. 20,3) und eine Tonpfeife (Abb. 22). Die Pfeife mit doppelkonischem Kopf und Fer-senmarke in Form einer fünfblättrigen Rose ist niederländischen Ursprungs; wahrschein-lich wurde sie in Amsterdam gefertigt.23 Von einer hölzernen Dose haben sich nur Frag-mente erhalten (Abb. 23).Weiterhin barg man aus dem Graben sieben Blank-, sieben Stangen-, zwei Schusswaffen, einen Musketenkolben, zwei separate Piken-spitzen, Schanzwerkzeuge, drei Hölzer un-bestimmter Funktion, einen einzelnen Schuh, einen eichenen Fassdeckel/-boden sowie 46 Musketenkugeln.Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei den Schusswaffen um zwei Musketen. In ihre Kolben sind Buchstaben eingeritzt, die als Initialen der Besitzer gedeutet werden. Der aus Birke gearbeitete ist mit ON markiert (Abb. 24,2), der aus Rotbuche mit den Buch-staben WN (Abb. 24,3). Computertomografi-en dieser Waffe (Schusswaffe 2) zeigen eine Kugel im Lauf sowie den Ladestock.24 Deut-lich erkennbar sind die in die Kolben eingear-beiteten Daumenschlitze/-kerben (Abb. 25).25 Der einzelne, ebenfalls aus Rotbuche beste-hende Kolben ist mit einer Brandmarke mit einem bekrönten M versehen (Abb. 24,1; 26), möglicherweise eine Schäfter- oder die Eigen-tumsmarke eines Truppenteils.26
Nahe der rechten Hand des älteren Mannes lagen drei Blankwaffen (Abb. 27,4.5.7). Die Klinge von Waffe 4 ist 0,89 m lang und mehr-fach gebrochen; die Spitze fehlt. Aufgrund
21 Die Metallzusammensetzung einiger Knöpfe wurde mittels Rasterelektronen-mikroskop/Röntgenfluoreszens bestimmt. Dafür möchten wir T. Widmer, For-schungszentrum für Sensorik Greifswald e. V., herzlich danken.
22 Die Verwendung dieser Textilfragmente ist bislang unklar. Die Erfassung der Tex-tilfunde verdanken wir Dipl. Restauratorin I. Vogel, LAKD.
23 Freundliche Mitt. J. van Oostveen (www.xs4all.nl).24 Dipl. Restauratorin I. Vogel, LAKD erstellte das Restaurierungskonzept und er-
möglichte zahlreiche Untersuchungen; vgl. Vogel u. a. in diesem Band, 239–245.25 Für diesen Hinweis danken wir G. E. Bush, Jr. in Jonesboro, Georgia, USA.
Abb. 20: Metallische Kleinfunde aus dem Laufgraben von 1628. 1 Pommerscher Schilling, Münzstätte Franzburg 1622; 2 Messingöse, Teil der Bekleidung (jüngerer Mann); 3 unverzierter Messingknopf; 4 Pistolen kugel aus dem Brustkorb (älterer Mann). M. 1: 1
Abb. 22: Pfeife mit doppelkonischem Kopf und Fersenmarke in Form einer fünfblätt-rigen Rose
Abb. 21: Knöpfe aus dem Brust- und Armbereich des älteren Mannes; Bleilegierung
11
211Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Die beiden separaten Bewehrungen dürften wiederum von Piken stammen. Inklusive der Seitenlaschen/-federn messen sie 0,4 bzw. 0,6 m; die eigentlichen Spitzen sind mit 0,1 bzw. 0,2 m deutlich kürzer.Als Schanzwerkzeuge dienten vermutlich eine 0,24 m lange eiserne Hacke, deren Holz-schaft abgebrochen ist und eine Schaufel aus Erle (Abb. 31). Diese ist 1,04 m lang, der Stiel-durchmesser verjüngt sich von 6 auf 2 cm und das Schaufelblatt ist abgetrennt. Hinzu kommt ein 0,42 m langes Beil mit einem ein-geritzten Pfeilzeichen auf dem Griff (Abb. 32).Im Graben kamen auch drei Hölzer unbe-kannter Funktion zutage: ein 2 m langes Kant-holz aus Kiefer (Querschnitt 4 x 8 cm), ein längs gespaltenes (L. 0,98 m; Abb. 33,1) und ein zugespitztes Holz (L. 0,35 m; Abb. 33,2).28
Die Soldaten trugen keine persönlichen Ge-genstände bei sich, weder Schmuck noch Amulette. Sie waren ohne Rüstung (Helm,
ihrer Breite und der geraden Parierstange könnte es ein älterer Waffentyp sein. Die Klinge steckt in einer Holzscheide mit dün-ner Lederauflage. Die ca. 0,96 m lange Blank-waffe 5 befand sich in einer Lederscheide mit wellenförmiger Ziernaht. Die Spitze der etwa 0,6 m langen Waffe 7 ist nicht vorhanden. Ihr Griff ist mit organischem Material, mögli-cherweise Bast oder Leder umwickelt. Blank-waffe 6 lag neben dem linken Bein von Indi-viduum 2. Sie sitzt in einer durchgängigen Lederscheide und ist mit 1,17 m die längste Klingenwaffe aus dem Graben. Blankwaffe 1, mit 0,97 m deutlich kürzer, wurde am östli-chen Ende des Laufgrabens geborgen. Am Griff ließen sich Reste von Geweih- oder Beinapplikationen, im unteren Drittel der Klinge Hiebspuren nachweisen. Westlich davon fand sich die etwa 0,95 m lange Blank-waffe 2 mit S-förmiger Parierstange. Beson-ders prunkvoll gearbeitet ist schließlich Blankwaffe 3, die unter dem linken Unter-schenkel des älteren Mannes lag. Sie ist insge-samt etwa 1,13 m lang, die Klinge misst ca. 0,97 m.27
Wie die Hieb- und Stichwaffen wurden auch die Stangenwaffen nummeriert (Abb. 28). Stangenwaffe 1 ist mit 4,2 m Länge vollstän-dig erhalten (Abb. 29,1). Korrodierte Reste einer Eisenbewehrung am Ende des Eschen-schaftes (Dm. 2,5–3 cm) lassen eine Deutung als Pike zu. Stangenwaffe 2, ebenfalls mit korrdierten Eisenresten am Ende des 3 cm starken Kiefernschaftes, ist bei einer Länge von 3,36 m gebrochen (Abb. 29,2). Die ver-mutliche Pike 3 ist mit 2,6 m komplett (Abb. 29,3). Ihr Kiefernschaft verjüngt sich von 5 auf 4 cm am oberen schmaleren Schaf-tende, wo mit Seitenlaschen/-federn die spitz zulaufende Bewehrung befestigt ist. Am un-teren Ende wurde eine Marke, ein bekröntes Doppelkreuz oder ein X mit zwei Querstri-chen eingeritzt (vgl. Abb. 24,4). Die Schäfte der Stangenwaffen 4 (Abb. 29,4) und 5 (Abb. 29,5) sind aus Esche gefertigt, abgebro-chen, ohne Bewehrung und 2,35 m bzw. 2,37 m lang. Die ca. 10 cm messende eiserne Spitze der Stangenwaffe 7 (Abb. 30) ist im Vergleich zu den anderen Bewehrungen rela-tiv kurz, der Schaft unvollständig.Der Morgenstern (Nr. 6), die einzige Schlag-waffe, ist mit 2,4 m Länge unversehrt erhalten (Abb. 29,6). Der Schaft aus Kiefer hat einen Durchmesser von 4 cm. Auf dem tonnenför-migen, mit fünf Eisendornen bewehrten Kopf sitzt eine 0,25 m lange eiserne Spitze.
26 Für zahlreiche Hinweise und seine freundliche Unterstützung bedanken wir uns bei B. Bernatzki, Stralsund.
27 Auf der Klinge ist im Röntgenbild die zweifache Inschrift IOHANNI HOPPE zu erkennen. Johannes Hoppe war Solinger Schwertschmied, der 1640 die Zeichen Wilder Mann und Helmbardierer bei seiner Zunft eintragen ließ. In der ersten Hälfte des 17. Jhs. wanderten Solinger Schwertschmiede nach England aus, darun-ter auch ein Johannes Hoppe (Weyersberg 1926, 20 f.).
28 Die Holzartenbestimmung der Neufunde von der Grabung 2012 steht noch aus.
Abb. 23: Fragmentierte Holzdose
Abb. 24: Waffen mit Markierungen. 1 mit Brandmarke; 2; 3 mit Initialen; 4 Pikenschaft mit Einritzung
3 4
1
2
212 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Harnisch) in den Kampf gezogen. Ihre Be-kleidung war relativ einfach; es fanden sich keine Schnallen von Schuhen, Riemen oder Gürteln. Die beiden Männer dürften der In-fanterie angehört haben, Pikeniere oder Mus-ketiere gewesen sein. Nicht auszuschließen ist auch, dass zwei Schanzknechte während der Kämpfe verschüttet worden sind.Die große Anzahl an Waffen lässt darauf schließen, dass sich ursprünglich weitere Männer im Laufgraben befunden haben. Während der Kämpfe um das Frankenkron-werk flohen diese und ließen ihre Waffen zu-rück. Unmittelbar einsatzfähig davon waren fünf (Abb. 34), darunter eine geladene Mus-kete (Nr. 2), die aber nicht abgefeuert wurde oder werden konnte. Von den sieben Klin-genwaffen besitzen vier (Nr. 1–3; 7) keine Scheiden. Eine (Nr. 7) befand sich – einsatz-fähig – in der rechten Hand des älteren Man-nes, während die Waffen 4 und 5 unter ihm lagen und ebenso wie eine weitere (Nr. 6) noch in ihren Scheiden steckten.Die Toten müssen schnell verschüttet worden sein, da sie sonst geplündert worden wären. Bei den Ausgrabungen zeigte sich ein an der Grabensohle (1,5–1,6 m HN) 0,2 m und an
Abb. 25: Mit Initialen gemarkte Musketen-kolben. 1 mit ON; 2 mit WN
Abb. 26: Musketenkolben mit Brandmarke
1 2
213Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Der Bericht Robert Monros und das
Verhältnis zwischen Stralsund und den
schottischen Regimentern
Der einzige Chronist, der selber an den Kämpfen vor dem Frankentor teilnahm, war der Schotte Robert Monro, dessen Aufzeich-nungen29 1995 in der deutschen Übersetzung von Helmut Mahr mit dem Titel ‚Oberst Ro-bert Monro. Kriegserlebnisse eines schotti-schen Söldnerführers in Deutschland 1626–1633‘ erschienen (Mahr 1995). Major Robert Monro30 und sein Regiment gehörten zu den Kompanien, die der dänische König Christi-an IV. unter dem Kommando von Oberst-leutnant Alexander Seaton nach Stralsund geschickt hatte, um die belagerte Stadt zu un-terstützen. Die Soldaten trafen dort am 7. Juni31 ein und hielten sechs Wochen ihre Stellung vor dem hart umkämpften Franken-tor (Abb. 35).32 Monro wurde bei den ersten Sturmangriffen nach der Ankunft General Wallensteins in der Nacht vom 6. auf den
der Grabenschulter bis 0,5 m mächtiges Sand-gemisch, das die Männer und Waffen über-deckte. Eine festgetretene Oberfläche belegt jedoch, dass der Graben als Geländevertie-fung noch sichtbar war und eine Zeit lang be-gangen wurde. Später verfüllte man ihn voll-ständig mit Sand, Lehm, Feldsteinen und Ziegelbruch und schüttete das Gelände um etwa 0,2 m (2,3–2,4 m HN) auf. Bald nach der Rückeroberung des Frankenkronwerks durch die Belagerten begann man, wie nach der Wiedereinnahme der anderen Außenwerke, die feindlichen Verschanzungen zu schleifen (Zober 1828, 217). Die Aufhöhung des Gelän-des kann demnach kurz nach der Rückerobe-rung stattgefunden haben; spätestens erfolgte sie mit dem Umbau des Frankenkronwerks zu der regelmäßigen Befestigung, die die Karte vom 31. Dezember 1628 aus dem schwedi-schen Reichsarchiv (Abb. 3) zeigt.
Die Kämpfe vor dem Frankentor – unter
welchen Umständen starben die Männer
in dem Laufgraben?
Diese Frage wird nicht eindeutig beantwortet werden können. Aber man kann sich mithilfe von Zeitgenossen und späteren Chronisten, die die erfolgreich abgewehrte Belagerung Stralsunds im Sommer 1628 schilderten, einer Antwort nähern. Diese werden einleitend vorgestellt.
29 Monro 1637; an dieser Stelle danken wir herzlich Dr. H. B. Gardner McTaggart, Friedland bei Göttingen, der sich auf unsere Bitte ausführlich mit Robert Monro beschäftigte und viele Fragen zu seinen tapferen schottischen Landsleuten beant-wortete.
30 Während seines Aufenthalts in Stralsund war Robert Monro Major; er wurde am 28. August 1632 zum Oberst befördert (Mahr 1995, 10).
31 Alle Angaben zum Datum wurden auf den heutigen gregorianischen Kalender umgerechnet.
Abb. 27: Nummerierung der Hieb- und Stichwaffen
Abb. 28: Nummerierung der Stangenwaffen
214 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
er jeweils eine Betrachtung (Observations) als kritische Analyse folgen ließ. Aus dieser konnten seine Leser lernen, denn er schrieb hauptsächlich „for the younger officer his in-struction“ (ebd. 11 f.).Major Monros Darstellung der Belagerung Stralsunds widerlegt „die damalige, bis heute nachwirkende Propaganda, in der die Bürger von Stralsund zu alttestamentarischen Hel-den hochstilisiert wurden, was viele Histori-ker schon immer mit Skepsis betrachteten“ (ebd. 12).Zur Erläuterung: Das Verhältnis zwischen der Stadt Stralsund und den schottischen Truppen war problematisch. Die Stralsunder befanden sich in einer Zwickmühle. Einerseits
7. Juli durch einen Knieschuss verletzt. Von den etwa 900 Männern, mit denen der Schot-te nach Stralsund gekommen war, fielen an die 500 und nur etwa 100 blieben unverletzt.Major Monros Schilderungen kriegerischer Auseinandersetzungen gelten als objektiv; er berichtete in chronologischer Folge und be-gann seine Darstellung bemerkenswerter mi-litärischer Aktionen mit der Beschreibung einer Dienstleistung (A duty discharged), der
32 Nicht ohne Stolz erwähnte R. Monro mehrmals, dass sich die Angriffe der Kai-serlichen auf das Frankentor konzentrierten, weil die vorgelagerten Festungswer-ke der schwächste Abschnitt der Stadtbefestigung waren, z. B. „denn das war der schwächste Abschnitt der ganzen Stadtbefestigung und die einzige Stelle, die vom Feind angegriffen wurde. Unser Oberstleutnant hatte diese Stelle zur Ehre seines Landes ausgesucht, denn hier war der gefährlichste Abschnitt.“ (Mahr 1995, 69).
Abb. 29: Stangen- und Schlagwaffen. 1 Pike 1; 2 Pike 2; 3 Pike 3; 4; 5 Holz - schäfte 4 und 5; 6 Morgenstern 6
Abb. 30: Stangenwaffe 7
Abb. 31: Schaufel
215Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
wir kamen, ihnen beizustehen. Ihre Undank-barkeit wiegt umso schwerer, als sie sich an den einfachsten Geboten der Gastfreund-schaft versündigten.“ (ebd. 73).E. H. Zober beschreibt in seiner 1828 erschie-nenen Belagerungsgeschichte die völlig ande-re Sichtweise der Einheimischen: „Schon oben ward erwähnt, daß […] noch vier Com-
pagnien Schotten vor Stralsund angelangt waren; diese wurden zwar nach einer Verfü-gung des Raths nicht gleich in die Stadt auf-genommen, sondern blieben in Zelten und Hütten draußen vor derselben gelagert; je-doch wenige Tage nachher verlangten diese Truppen sämmtlich in der Stadt einquartiert zu werden, wodurch der Rath sich veranlaßt fand, den Obersten Holck nochmals zu bit-ten, nicht mehr Volk kommen zu lassen, weil die Stadt nur Beschwerden davon hätte: zu-gleich erinnerte man ihn, da die Friedensver-handlungen von Neuem eingeleitet waren, wieder an sein Versprechen: den Frieden
wurde ihnen im Verlauf der Belagerung immer mehr bewusst, dass sie ohne die Unter-stützung der Truppen, die zunächst der däni-sche und später auch der schwedische König schickten, keine Chancen gegen ihre Belage-rer hatten. Andererseits distanzierten sie sich von diesen Einheiten und deren Einquartie-rung, weil sie dadurch in Konflikt mit dem Kaiser, General Wallenstein und ihrem Lan-desherrn, Herzog Bogislaw XIV. gerieten.Die Einquartierungen belasteten die Stadt na-türlich auch, weil sie Kosten und Umstände verursachten. So schrieb der Chronist O. Fock (1872, 282) zur erneuten Unterbrin-gung dänischer und schwedischer Truppen gegen Ende Juli 1628: „Eine Truppenanzahl von der angegebenen Stärke einzuquartiren und zu unterhalten, mußte in der That für die ohnehin schon durch Lasten aller Art er-schöpfte Stadt eine reine Unmöglichkeit sein.“ In Bezug auf die schottischen Regimenter stellte er eine scharf formulierte Kosten-Nut-zen-Rechnung auf: „Namentlich die Schot-ten, die man militärisch als ziemlich un-brauchbar ansah, wünschte man los zu werden, und die Bürgerschaft verlangte, daß man sie wenigstens von den wichtigen Posten vor dem Franken=Thor entferne.“ (ebd.).Das Verhältnis zwischen der Stadt und Major Monro, der den Stralsundern an mehreren Stellen seines Berichtes Undankbarkeit vor-warf, war anscheinend von Anfang an schwie-rig. In seiner 16. Dienstleistung schilderte der Offizier einen Konflikt, der sich wenige Tage nach seiner Ankunft in Stralsund ereignete. Soldaten, denen man keine Unterkunft zuge-wiesen hatte, waren in die Stadt gezogen, um vom Bürgermeister Quartier zu verlangen. Dieser beschwerte sich bei dem Gouverneur Oberst Holck, der einen Kriegsrat einberief. Der Vorfall wurde als Meuterei bewertet, zwei Schotten und ein Däne wurden per Los zum Tode verurteilt. Wiederum per Los be-gnadigte man die beiden Schotten, hängte je-doch den dritten Mann; wie Monro bemerkte, ein Däne wie Holck, „so daß nun der eine Däne gerechterweise für die Schuld eines an-deren Dänen büßte.“ (Mahr 1995, 71).In seiner 16. Betrachtung spiegelt sich Mon-ros Verbitterung über diesen Vorfall wider: „die Undankbarkeit der Bürger kann einfach nicht entschuldigt werden, die ihr Geld zu-rückhielten und jene nicht versorgten, die sie, ihre Frauen und Kinder vor der Wut der Fein-de bewahrten in einer Zeit, in der sie sich sel-ber nicht um ihre Sicherheit kümmerten, bis
Abb. 32: Beil
Abb. 33: Holzfragmente
216 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
weder zu stören noch zu hindern, sondern, falls er zu Stande käme, mit seinen Hilfsvöl-kern wieder abzuziehen.“ (Zober 1828, 155).In seiner 18. Betrachtung zum Ende der Stral-sunder Zeit distanzierte sich Major Monro von der Stadt, die er mit seinen Männern, von denen mehr als die Hälfte gefallen war, vertei-digt hatte: „Hier konnte ich auch feststellen, daß keine Stadt, sei sie auch noch so stark und gut besetzt, und auch kein Panzer, wie kugel-fest er auch sei, in der Lage ist, einem verzag-ten Herzen Mut einzuflößen. So gab es zu dieser Zeit und in dieser Stadt Stralsund viele Bürger, viele Soldaten, Fremde, Offiziere, Frauen und Kinder, die von Todesangst gepei-nigt wurden und von der Angst, ihren Besitz
zu verlieren. Diese Angst war allgemein so groß, daß sie sie sowohl ihres Verstandes als auch ihres Mutes beraubte, wie bei Leuten, die sich aufgeben, so daß sie in gewisser Weise auch ihre gerechtfertigte Verteidigung beein-trächtigte. Etwas Ähnliches habe ich noch nicht gesehen, und ich möchte es auch nicht wieder sehen“ (Mahr 1995, 81).33
Von den Chronisten der Belagerung wurden die schottischen Regimenter kaum beachtet; so schrieb E. H. Zober über den 4. Juni 1628 lapidar: „An eben diesem Tage kam vom Kö-nige von Dänemark im Hafen eine bedeuten-de Hilfe an. Sie bestand aus drei Kompagnien Schotten und einer Kompagnie deutschen Volks unter dem Obersten Heinrich Holk; die Schotten hatten mehr als einen Anführer, der vornehmste hieß Hamilton.“ (Zober 1828, 141).
33 O. Fock (1872, 480 f.) kommentierte diese Observation: „Monroe übertreibt hier die Furcht der Bürger und Soldaten von anderer Nationalität, um den Muth und die Tapferkeit der seinigen, der Schotten, wieder in ein desto helleres Licht zu stellen.“
Abb. 34: Farbliche Markierung der unmit-telbar einsatzfähigen Waffen
Abb. 35: Kupferstich aus dem Jahr 1628 mit Detail einer Belagerungsszene
217Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Stettin sowie diversen anderen Archiven und Bibliotheken (Fock 1872, V ff.). „Monroes Expeditions“ hielt O. Fock für ein „Werk, welches für die Kriegsgeschichte der Jahre 1627 bis 1634 von nicht unerheblicher Wich-tigkeit ist“ (ebd. 466) und widmete ihnen ein eigenes Kapitel, in dem er über fast 20 Seiten aus dem englischen Original zitierte und den Bericht kommentierte (ebd. 465 ff.).36 G. P. Neuburs 1772 erschienene Belagerungsge-schichte kritisierte O. Fock in seinem Vor-
Einheimische Chronisten
Den ältesten Bericht eines einheimischen Zeitgenossen verfasste der Stralsunder Syndi-cus Dr. Jacob Hasert im Auftrag des Stadtra-tes (Hasert 1631). Hasert hatte General Wal-lenstein persönlich kennengelernt, da er einer der Stralsunder Abgeordneten war, die nach den harten Kämpfen vom 6. bis 9. Juli in das kaiserliche Lager im Hainholz fuhren, um dort mit Wallenstein zu verhandeln (Abb. 36). „Wallenstein empfing die städtischen Abge-ordneten sehr gnädig; er ließ ihnen Stühle an-bieten, und als die Anrede sie traf, schilderte Synd. Hasert mit lebhaften Farben das bishe-rige Elend der Stadt.“ (Zober 1828, 193). Nach der Interpretation eines späteren Chro-nisten versuchte J. Hasert mit seinem Bericht hauptsächlich „die Stralsunder gegen den Vorwurf zu rechtfertigen: als seyen sie Rebel-len gegen den Kaiser und die Landesobrig-keit, und hätten unerlaubter Weise ein Schutz- und Trutzbündnis mit Schweden ge-schlossen.“ (ebd. VI).1828 – zum 200. Jahrestag – erschien die „Ge-schichte der Belagerung Stralsund’s durch Wallenstein, im Jahr 1628“ von Dr. Ernst Heinrich Zober, der Lehrer und Stadtbiblio-thekar in Stralsund sowie Mitglied der Ge-sellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde war (ebd.). Zober zitierte bei den Ausführungen über die Kampfhand-lungen überwiegend ältere Quellen, die er oft mit der Formulierung wie „heißt es in gleich-zeitigen Tagebüchern“ einleitete und in sei-nem Vorwort summarisch aufführte.34 Die Schilderungen der Belagerung Stralsunds von Johann Philipp Abelinus in der 1662 bei Matthäus Merian in Frankfurt erschiene-nen Ausgabe des Theatrum Europaeum stim-men nahezu wörtlich mit den zeitgenössi-schen Zitaten überein, die E. H. Zober später in seiner Belagerungsgeschichte verwendete (Abb. 37).35
1872 veröffentlichte der Historiker und Theologe Otto Heinrich Friedrich Fock den sechsten Band seiner „Rügensch Pommer-sche [n; Verf.] Geschichten aus sieben Jahr-hunderten“. Er verwendete im Vergleich zu den älteren Chronisten, die sich überwiegend an lokalen oder regionalen Quellen orientiert hatten, zusätzlich Materialien aus dem däni-schen Geheimarchiv in Kopenhagen, dem schwedischen Kriegsarchiv in Stockholm, dem niederländischen Reichsarchiv, den Preußischen Staatsarchiven in Berlin und
34 E. H. Zobers Quellen waren der erwähnte Bericht des Syndicus Hasert (Hasert 1631) sowie ein ebenfalls 1631 gedruckter Text über „Drey Jährige Drancksal Des Herzogthumbs Pommern“, der nach Zober (1828, VII) auf Befehl von Herzog Bo-gislaw XIV. entstanden war und ebenfalls die Allianz mit den Schweden recht-fertigen sollte. Weiterhin nutzte Zober die fünfbändige Sammlung „Nachrichten die im Jahre 1627 geschene Einrückung der unter dem Oberbefehl des Herzogs von Friedland stehenden Kaiserlichen Truppen […] die der Stadt Stralsund an-gemuthete Einquartierung […] und die endlich im Jahre 1628 darauf erfolgte Be-lagerung […] betreffend“. Zober betonte die Zuverlässigkeit der unter Aufsicht von Landrat J. Dinnies 1772 angefertigten „vollständige [n; Verf.] authentische [n; Verf.]“ Sammlung (ebd. VIII). Die meisten Zitate entnahm er dem ersten Band „Beschreibung der Belagerung der Stadt Stralsund aus einem alten Manuscr.“ so-wie den beiden letzte Bänden „Urkunden und Aktenstücke, als Beilagen zu den Auszügen aus des Raths Protocollbüchern“ (ebd. IX). Als letzte Quelle führ-te Zober die ebenfalls 1772 erschienene „Geschichte der unter des Herzogs von Friedland Oberbefehl von der kayserlichen Armee unternommenen Belagerung der Stadt Stralsund“ von Georg Philipp Neubur auf, der nach Zobers Angaben ebenfalls aus der Sammlung von Dinnies zitierte (ebd. X). Weiterhin nutzte er eines von acht Liedern aus der Flugschrift „Allerhand lustige Kriegs Lieder, der sehr starcken Stralsundischen Belagerung betreffend, Geschehen im Jahr 1628“, die 1630 gedruckt worden war (ebd. VII; 229 ff.).
35 z. B. die Ereignisse vom 2. auf den 3. Juni, nach damaligem protestantischen Ka-lender vom 23. auf den 24. Mai (Abelinus 1662, 1068 linke Spalte; Zober 1828, 136).
36 O. Focks Einstellung den schottischen Truppen gegenüber war jedoch zumindest distanziert, so schrieb er in Zusammenhang mit dem Eintreffen des Regiments von Lord Spynie: „König Christian hatte abermals die Gelegenheit benutzt, Schotten aus seinem Lande los zu werden.“ (Fock 1872, 274).
Abb. 36: Verhandlungen im Hainholz, Gemälde von Gauß Matthes Nieny, um 1860
218 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Überlebenden keine Möglichkeit ließen, die Waffen zu erbeuten und die Toten zu bergen. Solche Kämpfe, schnelle Vorstöße und Rück-züge unter Artilleriebeschuss konzentrierten sich vor dem Frankentor37 bei zwei Gelegen-heiten: bei der Eroberung der so genannten großen oder äußeren Schanze durch die Bela-gerer am 9. Juli, als Resultat der Angriffe, die der Ankunft General Wallensteins folgten, und bei ihrer Rückeroberung durch die Bela-gerten während eines großen Ausfalls unter Führung des schottischen Kommandeurs Sir Alexander Leslie am 29. Juli.
Die Eroberung des Frankenkronwerks
durch die Kaiserlichen
General Wallenstein war von Böhmen über Sagan, Frankfurt/Oder, Neustadt, Anger-münde, Prenzlau, Ueckermünde, Anklam und Greifswald nach Stralsund gekommen, wo er am 6. Juli eintraf.38 Mehrfach hatte er sich in Schreiben an von Arnim-Boizenburg abfallend über die Stralsunder geäußert und sie als „lose Buben, denen nicht zu trauen, Schelme, Bösewichte, Kanaillen, Bestien“ be-zeichnet (Fock 1872, 250).Major Monro schilderte die Ankunft Gene-ral Wallensteins: „und als er sah, daß Feld-
wort als wissenschaftlich überholt. Damit be-urteilte er auch E. H. Zobers Chronik, die nach dessen Bekunden den Ausführungen Neuburs „an sehr vielen Stellen […] wörtlich“ folgte; sie sei vielleicht gar nicht entstanden, schrieb Zober, „wenn nicht die Exemplare des Neubur’schen Werkes längst gänzlich vergrif-fen gewesen wären.“ (Zober 1828, X; Fock 1872, VI f.).
Die Kampfhandlungen vor dem Franken-
tor
Zurück zu dem dokumentierten Laufgraben mit den Skeletten von zwei Männern, die im Nahkampf schwer oder tödlich verwundet worden waren. Die vielen Waffen in ihrer Nähe stammen vermutlich von weiteren dort eingesetzten Soldaten. Sie belegen, dass der Graben nicht lange offen geblieben war, weil er ansonsten ausgeräumt worden wäre. Die-ses Befundbild lässt vermuten, dass die Män-ner bei Kampfhandlungen starben, die den
37 Die Kämpfe um das Frankentor begannen in der Nacht vom 26. zum 27. Mai, nachdem die Kaiserlichen den Belagerungsring um Stralsund am 23. Mai geschlos-sen hatten.
38 E. H. Zober (1828, 190) datierte seine Ankunft auf den 7. Juli, nach julianischem Kalender der 27. Juni.
Abb. 37: Belagerung von Stralsund im Jahr 1628, Kupferstich aus dem Theatrum Europaeum
219Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Major Monro wurde beim zweiten Sturman-griff durch einen Knieschuss verwundet. Damit endeten seine detaillierten Schilde-rungen der Kämpfe, an denen er nicht mehr teilnehmen konnte. Er berichtete von seinem Krankenlager in Stralsund aus weiter, wo ihn sein Oberstleutnant und vermutlich auch an-dere Offiziere besuchten und über die weite-ren Entwicklungen informierten (ebd. 75 ff.).39
Im Gegensatz zu Monro datierte O. Fock die ersten schweren Angriffe auf das Frankentor und auch die Verletzung des Schotten einen Tag später in die Nacht vom 7. auf den 8. Juli (Fock 1872, 256; 475 f.).40 Am 6. Juli hätten zwar erste Kämpfe vor dem Frankentor statt-gefunden, aber keine schweren Sturmangrif-fe: „Wenn der erste Napoleon zu seiner Armee kam, so war es ein Zeichen, daß in nächster Zeit große Schläge zu erwarten waren. […] Arnim hatte seine Anstrengun-gen gegen zwei Zugänge zur Stadt, gegen das Franken= und Knieper=Thor zugleich ge-richtet; Wallenstein beschloß gegen die ande-ren Thore nur zu demonstriren, und den ent-scheidenden Hauptangriff gegen das
39 Major Monro reiste während des Waffenstillstandes, der den Sturmangriffen folg-te, nach Kopenhagen, um dort seine Knieverletzung behandeln zu lassen: „Ich sah nämlich, daß kein Arzt in Stralsund es auf sich nehmen wollte, mir die Kugel aus meinem Knie herauszuschneiden, weil das Risiko zu groß war, daß ich dabei lahm würde. Um das zu vermeiden, wählte ich lieber das kleinere Übel und ließ die Kugel 14 Tage im Knie“ (Mahr 1995, 80). O. Fock kommentierte, dass Monros Bericht nach seiner Verletzung „unklar und unzuverlässig“ wurde, weil er sich auf das „Hörensagen“ verlassen musste (Fock 1872, 256; 476).
40 Diese zeitliche Diskrepanz kann hier nicht geklärt werden. Auch O. Fock, der u. a. die entsprechende Passage aus dem Originalbericht Major Monros zitierte, ging nicht auf diesen zeitlichen Widerspruch ein.
marschall Arnim schon sechs Wochen vor dieser Stadt lag und nicht hineinkam ärgerte er sich. Bei seiner Ankunft erkundete er die ganze Stadt, und er fand heraus, daß unsere Stellung der schwächste Abschnitt der Stadt-befestigung war, sowohl aufgrund der Lage, aber auch wegen der Unzulänglichkeit der Befestigungswerke, denn der Wall ging über Mannshöhe nicht hinaus. Da beschloß er, hier mit einem Sturmangriff vorzugehen, und er schwor in seinem Zorn, er werde die Stadt in drei Nächten einnehmen, selbst wenn sie mit eisernen Ketten zwischen Himmel und Erde hinge.“ (Mahr 1995, 74; vgl. Abb. 38).Monro bereitete sich umgehend auf den An-griff der Kaiserlichen vor, ließ Vorposten auf-stellen, alle Abschnitte verstärken, die Wa-chen verdoppeln sowie eine Eingreifreserve im Ravelin und 80 Musketiere in Bereitschaft setzen (ebd. 74). In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli griffen die Kaiserlichen zwischen 10 und 11 Uhr in einer ersten Welle mit über 1 000 Mann an. „Jeder Mann wurde nun auf seinen Posten gerufen. Schlimm war, daß wir draußen eine Halbmondschanze hatten, die noch nicht fertig war. Dort befand sich Fähn-rich Johnston mit 50 Musketieren, die nun gezwungen waren, sich unter der Erde, einer hinter dem anderen, durch einen Fluchtgang zurückzuziehen. Dabei wurden einige, ehe sie hereinkommen konnten, getötet. Als sie bei uns waren, begannen unsere Leute mit dem Gefecht […] Dann ging der Kampf mit aller Heftigkeit auf der ganzen Linie los.“ (ebd. 74 f.).Noch in derselben Nacht folgten zwei weitere kaiserliche Angriffsstürme mit jeweils 1 000 Mann, und beim letzten, im Morgen-grauen des 7. Juli, konnte der Feind in die städtische Befestigung eindringen, „wurde aber unter großen Verlusten mit Säbeln, Piken und Musketenkolben wieder hinausge-worfen, so daß er bei Tagesanbruch gezwun-gen war, sich zurückzuziehen, nachdem er über 1 000 Mann verloren hatte. Wir aber hat-ten 200 Mann Verluste, ohne diejenigen, die verwundet waren. […] Der Feind war zu-rückgewichen, unsere Befestigungen waren nicht erobert worden, der Graben war bis zum Rand mit den Leichen der Feinde ge-füllt. Die zerstörten Werke konnten jedoch am Tage nicht wieder repariert werden, was zur Folge hatte, das die nächste Nachtwache umso gefährlicher war.“ (ebd. 75 f.).
Abb. 38: Lithografie zur 261-jährigen Wallensteinsfeier, 1889
220 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Franken=Thor auszuführen. Gleich am […] Abend seiner Ankunft ließ er eine vorberei-tende scharfe Recognoscirung vornehmen, die zugleich den Zweck hatte, die Belagerten überall aus den vorgeschobenen Stellungen, die sie noch innehatten, in ihre eigentlichen Verschanzungen zurückzuwerfen. Vor dem Frankenthor kamen die Belagerten den Fein-den um 8 Uhr Abends mit einem Ausfall zuvor; zwar gelang es ihnen, die Gegner aus den ersten Laufgräben zu vertreiben, als dann aber gegen 2000 Mann Kaiserliche aus der Ziegelhof= und Mühlenbergschanze zur Un-terstützung der ihrigen heranrückten, muß-ten die Stralsunder mit einigem Verlust wie-der zurück “ (ebd. 253 f.).41
O. Focks Wiedergabe für den zweiten Tag nach Wallensteins Ankunft und die darauf folgende Nacht (7./8. Juli) enthält wiederum Details, die Major Monro einen Tag früher datierte.42 Stralsund traf am 7. Juli „ein hefti-ges, von Morgen bis Abend anhaltendes Bombardement. […] Bei den Schotten war man überzeugt, daß es diesmal ihrer Stellung als dem schwächsten Punkt der Festungs-werke gelten werde. Während der Oberst-lieutenant Seaton von der Stadt aus die Ver-wendung der sämmtlichen dänischen Hilfstruppen leitete, commandirte Major Monroe draußen in der Schanze vor dem Franken=Thor; rechts nach dem Teich [Fran-kenteich; Verf.] zu und in der Mitte standen die Schotten, links, wo das Außenwerk sich auf das Ravelin zurückbog [die spätere Gra-bungsfläche; Verf.], eine Compagnie deut-scher Soldtruppen. Eine Reserve von 80 schottischen Musketieren wurde zur Un-terstützung der am meisten bedrohten Punk-te zurückgehalten; im Uebrigen wurden die Schildwachen verdoppelt und sonstige Vor-sichtsmaßnahmen getroffen. Sie waren nicht überflüssig. Wallenstein hatte eine Masse von 4 000 Musketieren, in drei Sturmcolonnen gesondert, hier in den nächsten Werken und Laufgräben zusammengezogen; mehrere hundert Reiter hielten in gedeckter Stellung seitwärts nach dem Außen=Strande zu, mit der Aufgabe, die Verschanzung […] durch das Wasser zu umgehen und so den Sturman-griff der Infanterie zu unterstützen. […] Dann, es mochte kurz vor 11 Uhr [nachts;
Verf.] sein, gab die am weitesten hinauspo-stirte schottische Schildwache Feuer und rief zu den Waffen; die erste Sturmcolonne der Kaiserlichen brach aus den Laufgräben her-vor und warf sich […] auf die gegenüberlie-gende Schanze. Ein kleines erst neuerlich an-gefangenes vor derselben gelegenes halb- mondförmiges Werk, welches von 50 Mann unter einem Fähnrich besetzt war, wurde so-fort geräumt, doch so plötzlich und stür-misch war der Angriff der Kaiserlichen ge-kommen, daß von der schottischen Besatzung, welche sich durch eine Ausfallpforte in die Hauptschanze zurückziehen mußte, die Letzten bereits in des Feindes Gewalt fielen. Monroe beorderte in aller Eile ein Detache-ment unter einem erprobten Offizier, die Pforte zu verteidigen, und dann begann auf der ganzen Front ein heftiger Kampf; […] Als die erste Sturmcolonne der Kaiserlichen in die Schanze nicht einzudringen vermochte, rückte bald die zweite […] vor, und stürmte noch wilder als die erste gegen die Schanze an. Jetzt wurden mehrere schottische Of-ficiere getötet und noch eine größere Anzahl verwundet, darunter Monroe selbst durch einen Schuß ins Knie. […] Aber der Feind ließ nicht nach; die dritte Sturmcolonne rückte zum Angriff vor, und drang […] in die Schanzen ein. Gleichzeitig wollte der Zufall, daß eine feindliche Granate in eine Pulver-tonne schlug; ein panischer Schrecken ent-stand unter den Vertheidigern, welche glaub-ten, daß in einer rückwärts gelegenen Schanze eine Mine aufgeflogen sei, und nun in wilder Hast zurück in das Ravelin und von dort, die Besatzung desselben mit fortreißend, gegen das Thor flohen, um in der Stadt Zuflucht zu suchen. Der Feind stürmte natürlich sofort nach, und es gelang ihm sogar, mit den flie-henden Vertheidigern auch in das Ravelin einzudringen. Es war ein gefährlicher Au-genblick. Da brach zur rechten Zeit der Oberst Rosladin mit seinen Schweden, von einer deutschen Abtheilung unterstützt, aus dem Thore hervor und trieb den Feind […] wieder aus dem Ravelin, und bald auch aus dem Außenwerk“ (Fock 1872, 255 ff.).Am folgenden Tag wurde das Frankentor er-neut bombardiert. Oberstleutnant Seaton und der verwundete Major Monro beschlos-sen, ihre bereits stark reduzierten Truppen bei neuen Sturmangriffen auf das Ravelin zu-rückzuziehen (Mahr 1995, 78 f.). Nach O. Fock hatten sie jedoch das städtische Ober-kommando nicht über diese Entscheidung
41 R. Monro erwähnte den Ausfall der Belagerten um 8 Uhr abends nicht.42 Dies betrifft besonders Schilderungen einzelner Kampfhandlungen mit Nennung
der beteiligten Offiziere (Mahr 1995, 75 f.; Fock 1872, 256), die hier wegen ihrer Ausführlichkeit nicht wieder gegeben werden können.
221Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
informiert, „sonst hätte dasselbe ohne Zwei-fel rechtzeitig für die nothwendige Verstär-kung gesorgt, da zu viel daran hing, das wichtige Außenwerk zu behaupten. Um Mit-ternacht begann nun der Feind abermals […] den Sturm. […] Die Schotten leisteten eine Weile Widerstand, dann räumten sie, dem von ihren Höchstcommandierenden gefaßten Beschluß gemäß, die Schanze und zogen sich auf das Ravelin zurück. […] Als das städti-sche Obercommando den unerwarteten Rückzug der Schotten gewahr wurde, ent-sandte es sofort eine Abtheilung deutscher Truppen zur Unterstützung“. Die Kaiserli-chen konnten jedoch nicht wieder aus der Schanze vertrieben werden. „So blieb das für die Deckung des Zuganges zur Stadt so wich-tige Außenwerk jetzt definitiv in den Händen der Kaiserlichen.“ (Fock 1872, 257 f.).Major Monro beschrieb den Rückzug der schottischen Truppen auf das Ravelin, den er in die zweite Nacht nach General Wallen-steins Ankunft datierte, wie folgt: „Die Leute erhielten vom Oberstleutnant die Anwei-sung, sie sollten sich, wenn der Feind sie hart bedränge, geordnet zum Ravelin zurückzie-hen, die Außenwerke aufgeben und versu-chen, von der Stadtmauer und vom Ravelin herab den Feind mit Musketen und Kanonen abzuwehren. Sie traten ihre Wache an, und als die Nacht herankam, brach der Feind wütend über sie herein. Sie verteidigten die Außen-werke eine Zeitlang, bis sie am Ende so hart bedrängt wurden, das sie sich entsprechend ihrem Befehl zum Ravelin zurückzogen. Der Feind setzte ihnen darauf mit Schreien und Rufen nach […] Trotz dieser plötzlichen Schreckenssekunde verteidigten unsere Sol-daten den Ravelin heldenmütig mit Piken und Handgranaten, nachdem der Feind schon voll Tapferkeit soweit vorgerückt war, das er die Palisaden einreißen und sich daranma-chen konnte, den Ravelin zu unterminieren, was unsere Leute durch Gegenminen verhin-derten." (Mahr 1995, 79).Nach diesen schweren und für beide Seiten verlustreichen Sturmangriffen begannen er-neut Waffenstillstandsverhandlungen zwi-schen Stralsund und General Wallenstein; gleichzeitig erwartete die Stadt weitere Hilfe aus Dänemark und bat den schwedischen König Gustav II. Adolf um Unterstützung.
Die Rückeroberung des Frankenkronwerks
Am 26. Juli waren die vom schwedischen König Gustav II. Adolf geschickten Obristen Graf Nils Brahe und Sir Alexander Leslie, nach Major Monros Worten „ein erfahrener und tapferer schottischer Kommandeur“ (ebd. 80) mit schwedischen Truppen und 500 Zent-nern Pulver in Stralsund angekommen.43
Die Rückeroberung der großen oder äußeren Schanze begann am 29. Juli. Sir Alexander Leslie „beschloß, zum Ruhm seiner Lands-leute einen Ausfall gegen den Feind zu ma-chen, denn er war begierig, den Ruhm seiner eigenen Nation allein zukommen zu lassen, zumal es die erste Aktion in dieser Stadt war“ berichtete Major Monro (ebd. 82). „Das neu angekommene schottische Regiment Spynie stand im Vordertreffen, die Ueberreste des Regiments Mac Key unter einem Capitän als Reserve hinter sich.“ (Fock 1872, 283).Den Verlauf des Ausfalls schilderte J. Hasert: „haben der Stadt Kriegsvolck fürm Fran-ckenthore einen Außfall gethan / und die Feinde alle auß der grossen Schantzen herauß gejaget und dergestalt geschrecket / daß sie in drey Hauffen / etliche beym Strande hinab nach den Ziegelhöfen / etliche nach dem Schlagbamme auff dem Damme / die ubrigen nach der Mühlenschantze geflogen / weil aber den flüchtigen Feinden schleunige Hülf-fe zukommen / so haben sie sich bald gewen-det / und die Schantze wieder eingenommen. Es seynd in der Schantze 12. Centner Pulwer gefunden / welche alsbald angezündet. diß Treffen hat uber 3 Stunde continue gewehret / und seynd von der Stadt seithe ohngefehr 30. Soldaten darin geblieben / von des Fein-des seithe uber 30. Gefangene herein gebracht / und haben folgenden Tages die Uberleuffer berichtet / daß ihrer bey 500. erschlagen / und viel beschediget / auch etliche vornehme Officirer geblieben werden / Der feind hat bey diesem Treffen von den Ziegelhöfen von Anfangs des Außfalls mit 4. Stücken unauf-fhörlich auff der Stadt Schantzen / und in die Stadt / auch nach S. Nicolai und S. Jacobi Kir-chen geschossen / und ob er wol durch etliche Heuser / auch in beyde benante Kirchen ge-troffen / so ist doch durch Göttliche abwen-
43 O. Fock (1872, 281) beschreibt Oberst Leslie als „einer jener fahrenden schottischen Ritter, welche wir fast überall in den festländischen Kriegen jener Zeit finden, ein tapferer Soldat, aber ohne Bildung, denn er konnte nicht schreiben und lesen.“ Ver-mutlich konnte Alexander Leslie tatsächlich nicht Deutsch lesen oder schreiben; Schottisch, Englisch und Französisch waren ihm jedoch geläufig (freundliche Aus-kunft von Dr. H. B. Gardner McTaggart, Friedland bei Göttingen).
222 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
dung kein sonderlicher Schade geschehen“ (Hasert 1631, 164). Mit diesem Ausfall kam die große Schanze des Frankenkronwerks wieder zurück in die Hand der Belagerten.
Das Ende der Belagerung
Am 30. Juli griffen die Kaiserlichen erneut das Frankentor an: „Unter der Nachmittags-predigt, nach zwei Uhr, machte der Feind Miene, als ob er vor dem Frankenthore Bre-sche schießen wollte: das Feuern dauerte bis in die Nacht, und die friedländischen Völker standen zum Sturm bereit; weil aber ein star-ker Regen einfiel, so wurden sie daran behin-dert“. Spätestens in der darauffolgenden Nacht bereitete Feldmarschall von Arnim-Boizenburg anscheinend einen Rückzug vor: „machten sie Abends um neun Uhr vor dem Franken-Thore abermals einen blinden Lärm, führten etliches Volk mit brennenden Lunten an, mit Geschrei und Getümmel, als wenn sie stark anfallen wollten: und als darü-ber die von der Stadt sich zur Gegenwehr ge-faßt gemacht, und etwas mit dem Feinde scharmuziret […] so hat unterdessen der Feind alles sein grobes Geschütz, sowol von den Ziegelhöfen, als von der Mühlenschanze […] ab- und weggeführet […] die Schanzen vor berührtem Franken Thore aber stark be-setzt gehalten“ (Zober 1828, 216).Am 31. Juli erteilte General Wallenstein den Befehl, seine Truppen umgehend von Stral-sund abzuziehen. Am 1. und 2. August ver-ließen die Kaiserlichen ihr Lager im Hain-holz sowie ihre Schanzen vor dem Knieper-, Hospitaler-, Küter- und Tribseer Tor. Am 3. August abends brach dann „der Feind […] vor dem Frankenthore vollends und gänzlich auf; steckte zuvor das Lager, die noch übrigen Häuser und die Windmühlen, bloß eine Mühle und zwei Häuser ausgenommen, in den Brand und blieb die folgende Nacht bei dem hohen Graben, ein halbviertel Weges von der Stadt, in voller Ordre de Bataille ste-hen.“ (ebd. 218).
Bereits am 22. Juli waren dänische Schiffe an der Küste vor Rügen angekommen und hat-ten die kaiserlichen Schanzen bei Brandsha-gen (südlich von Stralsund) beschossen. So mussten „die Kaiserlichen vor Stralsund jetzt in beständiger Furcht vor einer dänischen Landung sein, durch welche sie in der Flanke oder im Rücken bedroht wurden. Auch ging das Gerücht, daß der König von Schweden kommen werde: sie mußten also doppelt auf ihrer Hut sein. Wallenstein fürchtete na-mentlich für sein neues Herzogthum Meck-lenburg; vor Stralsund war kein Ruhm mehr zu holen.“ Am 25. Juli verließ General Wal-lenstein Stralsund und begab sich über Trib-sees nach Güstrow (Fock 1872, 280).Christian IV. landete am 21. August mit sei-nem Heer auf Usedom und eroberte die Städ-te Usedom und Wolgast. Wallenstein, der in-zwischen seine Truppen bei Greifswald zusammengezogen hatte, griff die Dänen an. Nach verlustreichen Kämpfen ließ der däni-sche König zur Sicherung seines Rückzugs die Stadt Wolgast, nachdem er sie geplündert hatte, anzünden und zog sich nach Dänemark zurück. Mit dem Ende der Belagerung wurde Stralsund zwar nicht mehr akut bedroht, doch hielten sich kaiserliche Truppen weiter-hin in der Nähe der Stadt auf. Die 35 km ent-fernte Hansestadt Greifswald war „schon längst im ganzen Pommernlande die einzige noch übrige kaiserliche Festung“, die erst am 16. Juni 1631 von den Schweden eingenom-men wurde (Kosegarten 1860, 122).
Zum Schluss: Was wäre wenn ... Stralsund
eingenommen worden wäre?
Die Belagerung Stralsunds ist zumindest in der lokalen Rezeption mit einem berühmten Zitat Wallensteins verbunden, das anlässlich seiner Ankunft in der Stadt entstanden sein soll.44 Major Monro gab es im englischen Ori- ginal wieder: „he resolved to pursue it by stor- me, swearing out of passion he would take it in, in three nights, though it were hanging with Iron chaines, betwixt the earth and the heavens.“ Bei H. Mahr (1995, 74) lautet dies: „Er schwor in seinem Zorn, er werde die Stadt in drei Nächten einnehmen, selbst wenn sie mit eisernen Ketten zwischen Himmel und Erde hinge.“ Bei J. P. Abelinus (1662, 1069 rechte Spalte) findet sich das Zitat leicht abge-wandelt: „Wann schon diese Vestung mit ey-sernen Ketten an Himmel gebunden were / so müste sie doch herunter.“
44 Der Chronist O. Fock war davon überzeugt, dass es sich bei dem Zitat „die Stadt müsse herunter und wäre sie auch mit Ketten an den Himmel gebunden.“ um eine wörtliche Wiedergabe handelt. Zweiflern hielt er entgegen: „allein es ist von zwei von einander unabhängigen gleichzeitigen Zeugen berichtet, und es ist zudem so ganz in dem Stil wallensteinischer Bravaden gehalten, daß man nicht wohl seine Authenticität bezweifeln kann.“ Seine beiden Zeitzeugen sind Major Monro und „der Verfasser des hansischen Weckers op. 9“ (Fock 1872, 253). In welcher Spra-che und unter welchen näheren Umständen das Zitat übertragen worden sein soll, bleibt unklar.
223Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Wären die kaiserlichen Truppen bis zum Frankentor vor- bzw. in die Toranlage einge-drungen, hätte sich hier mit großer Wahr-scheinlichkeit ein Nahkampf entwickelt wie beispielsweise 1631 im Friedländer Tor in Neubrandenburg. 13 von über 90 Männern, die dort in der engen Anlage gefallen waren, wurden 1991 bei Bauarbeiten ausgegraben. Besonders die mehrfach von stumpfen Ge-genständen und Klingenhieben getroffenen Schädel zeugen von der Gewalt und Ver-zweiflung dieses Kampfes (Jungklaus/Prehn 2011, bes. 22 ff.).Die Plünderung Stralsunds war nach einem von E. H. Zober zitierten Text von den im Tross mitreisenden Frauen der Soldaten vor-bereitet gewesen: „Daß der Obrister Arnim seiner Armee, die in wenigen Stunden die Stadt erobert haben sollte, die Plünderung versprochen hat, und daß die Soldatenweiber schon die großen Säcke fertig gehabt, worin sie, wie sie sich haben verlauten lassen, des Stralsundischen Frauenzimmers Hochmuth […] zu sacken gemeinet“ (Zober 1828, 220).General Wallenstein ließ wenig Zweifel an der Zerstörung Stralsunds nach der von ihm zuverlässig erwarteten Erstürmung. Im Mai 1628 kündigte er dem Stralsunder Protonotar Vahl, der ihn in Prag aufgesucht hatte, an „Es sei der Befehl ergangen, daß 15 Regimenter vor Stralsund rückten; diesen Befehl werde er – Wallenstein – nicht zurücknehmen, wolle vielmehr selbst hin, und dann von dort nicht eher abziehen, als bis Stralsund kaiserliche Garnison eingenommen, oder er wolle es so machen, daß nichts davon übrig bleibe“ – bei den letzten Worten strich er als Symbol für die Tilgung vom Erdboden mit der Hand über den Tisch – „und sollten auch 100,000 Mann davor bleiben, oder er selbst das Leben davor verlieren“ (Fock 1872, 184 f.).Von einer ähnlichen Drohung berichteten brandenburgische und herzogliche Vermitt-ler, die sich im Juli 1628 mit dem Stralsunder Rat im Triebseer Zingel trafen. Sie „betheuer-ten mit einem Eide, der Herzog von Friedland hätte gesagt, wofern man nicht ungesäumt die vorgeschlagenen Bedingungen annähme, un-tersiegelte und exequirte, so wolle er die Stadt mit noch größerem Ernste angreifen, und nicht nachlassen, ehe er ihrer mächtig sey, sollte er auch davor geschunden werden, und wenn er der Stadt mächtig würde, wollte er nicht eines Kindes in Mutterleibe verschonen, ja es sollte nicht eine lebendige Seele darin ver-bleiben.“ (Zober 1828, 198 f.).
Auch Major Monro ging davon aus, dass Stralsund von den kaiserlichen Truppen zer-stört worden wäre. In seiner 16. Betrachtung zieht er einen Vergleich zu Frankfurt an der Oder und Magdeburg, die am 3. April und 10. Mai 1631 erstürmt worden waren; diese Textpassage kann er also erst drei Jahre nach seiner Zeit in Stralsund geschrieben haben: „Obwohl wir es für hart hielten, daß uns nicht erlaubt wurde, unsere Stellungen zur gewöhnlichen Erholung verlassen und nicht einmal außerhalb unserer Stellungen schlafen zu dürfen, stellte sich heraus, daß uns am Ende die Wohltat dieser Ordnung zugute kam. Als uns der Feind nämlich mit seinen Angriffen hart zusetzte, waren wir zur Stelle und konnten uns verteidigen und unsere Ehre bewahren. Andernfalls wäre es uns so ergan-gen, wie es in den Schwedenkriegen Magde-burg an der Elbe und Frankfurt an der Oder ergangen ist.“ (Mahr 1995, 74).Stralsund überstand die Belagerung äußerst knapp und nur mithilfe der Truppen, die zu-nächst der dänische und später der schwedi-sche König geschickt hatten und die vor dem Hintergrund der strategischen Lage der Stadt eigene Interessen verfolgten.Der Abzug der kaiserlichen Truppen – nicht der Abzug General Wallensteins, der die Stadt früher verließ – wird heute noch mit den Wallensteintagen gefeiert, allerdings ent-sprechend dem alten Kalender am Wochen-ende um den 24. Juli.45
„Pommerland ist abgebrannt“ und „In
Mecklenburg ist […] alles bis auf den
Erdboden verheert“46 – ein Streifzug durch
die Archäologie des Dreißigjährigen Krie-
ges in Mecklenburg-Vorpommern
Der Dreißigjährige Krieg hat im heutigen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern auf-grund von dessen wechselnder Besetzung durch kaiserliche und schwedische Trup-
45 E. H. Zober (1828, XI Fußnote) erwähnt das so genannte Wallensteinsfest bereits für das Jahr 1821.
46 Das Lied „Maikäfer flieg“ mit der Verszeile „Pommerland ist abgebrannt“ wurde gemäß Wikipedia im Jahr 1800 von J. K. Ch. Nachtigal (1800, 46) veröffentlicht. Wenige Jahre später führte es die Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ auf, allerdings mit dem Vers: „Die Mutter ist im Pulverland, und Pulverland ist abgebrannt“ (von Arnim/Brentano 1806, 235). „In Mecklenburg ist nichts als Sand und Luft, alles bis auf den Erdboden verheert; Dörfer und Felder sind mit kre-piertem Vieh besäet, die Häuser voll toter Menschen, der Jammer ist nicht zu be-schreiben“, schrieb General Johan Banér im September 1638 an den schwedischen Reichskanzler Axel Oxenstierna (zitiert nach: Koch 1999, 16; ursprünglich aus Schnell 1907, 100).
224 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
pen47 auch im archäologischen Befundbild tiefe Spuren hinterlassen. Im Folgenden wer-den einige Funde und Befunde – hauptsäch-lich Münzschätze und Gräber – ohne An-spruch auf Vollständigkeit vorgestellt (Abb. 39). Nicht erwähnt werden Kellerver-füllungen und Brandhorizonte mit entspre-chenden Funden, die in den von Artilleriebe-schuss betroffenen Städten (z. B. Anklam; Fries 2009, 145; 162 f.) sowie insbesondere in gebrandschatzten Orten (z. B. Pasewalk; Hoffmann 2005, 182; Schäfer 2009, 203 f.; Fries/Zach-Obmann 2012) bei stadtarchäo-logischen Untersuchungen immer wieder an-getroffen wurden.48
‚Weggebrachte Schätze’ werden manchmal viele Jahre später wiedergefunden und spie-geln eindrucksvoll die Angst vor Plünderung wider, aber auch die Hoffnung auf eine Rück-kehr. Aus Pommern sind rund 90 Münz-schatzfunde bekannt, die während der Kriegsjahre versteckt wurden,49 aus Meck-lenburg kommen etwa 40 weitere hinzu (Krüger 2002, 299).In Neubrandenburg, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte (damals Mecklenburg),50 kamen zwei Münzschätze aus dem Dreißigjährigen Krieg zum Vorschein. Im März 1962 ent-deckten Bauarbeiter bei Tiefbauarbeiten in
der Treptower Straße ein kleines Bronzege-fäß mit 92 Münzen51 aus dem Zeitraum zwi-schen 1555 und 1625. Möglicherweise wur-den sie versteckt, als kaiserliche Truppen 1627 die Stadt besetzten. Unter den Münz-ständen sind die habsburgischen Lande mit 29 Prägungen am stärksten vertreten (Schu-dy 1978).52 Dieser ausschließlich aus Talern bestehende Münzschatz stellte ein kleines Vermögen dar und unterscheidet sich damit deutlich von dem zweiten Schatzfund aus Neubrandenburg, den man im März 2000 bei Restaurierungsarbeiten im ehemaligen Fran-ziskanerkloster entdeckte.Das 1260 gegründete Kloster wurde seit 1567 als Hospital und Armenhaus genutzt, wes-halb der ursprüngliche Saal im Obergeschoss durch Fachwerkwände in kleinere Räume unterteilt worden war. Ein Bewohner ver-steckte vermutlich im Frühjahr 1631 einen Stoffbeutel mit 103 Münzen unter dem Fuß-bodenpflaster. Damals war die kaiserliche Besatzung von den Schweden abgelöst wor-den, die die Stadt jedoch im März im Sturm zurückeroberten (s. u.). Die Münzen sind mit Ausnahme eines halben sächsischen Talers (Kurfürst Johann Friedrich und Herzog Mo-ritz) Kleinmünzen des täglichen Zahlungs-verkehrs, überwiegend Schillinge und Sechs-linge.53 Die älteste Münze datiert in das Jahr 1537 (Hamburger Sechsling), die jüngsten sind fünf Stralsunder Düttchen von 1631 (Virk 2001, 353 ff.; 2005, 474).Neubrandenburg war 1627 von den Kaiserli-chen besetzt worden. Am 1. Februar 1631 zog Gustav II. Adolf mit seinem Heer, darunter Schotten unter Major Monro, vor die Stadt. Nach anfänglicher Gegenwehr baten die Kai-serlichen um Verhandlungen und verließen Neubrandenburg schließlich in voller Be-waffnung. Etwa 2000 schwedische Soldaten wurden unter Generalmajor von Knyphau-sen in die Stadt gelegt. Am 3. März bezog Ge-neral Tilly mit 18 000 Mann die Burg Star-gard und ließ Neubrandenburg ab dem 19. März schwer beschießen, nachdem die Stadt die Übergabe verweigert hatte. Seine Truppen verschanzten sich unterhalb des Ge-richtsbergs und griffen vor allem die Fried-länder Toranlage im Nordosten des Stadt-mauerrings an. Nach dreitägiger Belagerung stürmten die Kaiserlichen durch das Tor in die Stadt. R. Monro berichtete, dass „der Feind […] in seiner Wut den größten Teil der Verteidiger über die Klinge springen ließ.“ (Mahr 1995, 105; vgl. Maubach 1995, 295 f.).
47 Eine zeitgenössische Schilderung des Pastors Christian Hartwig gibt das Hin und Her zwischen König Gustav II. Adolf, dem „Löwen aus Mitternacht“ und Gene-ralissimus Albrecht von Wallenstein, dem Feldherrn Kaiser Ferdinands II., dessen Wappentier der Adler war, einprägsam wieder; vgl. Koch 1999, 16; ursprünglich aus Hartwig o. J.
48 Jüngst publiziert wurden neue Funde aus Laage und Plau am See. Laage, südlich von Rostock, wurde Pfingsten 1638 auf Befehl von General Gallas niedergebrannt. In der Altstadt fanden sich großflächig die entsprechenden Brandschichten, so 2010 solche mit Resten des ehemaligen Rathauses (Konczak 2012, 165). In Plau am See, Lkr. Parchim, traten 2010/2011 in einer Brandschicht u. a. zwei schwedische Silbertaler von 1626 und 1633 zutage (Jänicke 2012, 180).
49 Freundliche Mitt. von Dr. J. Krüger, Greifswald.50 Das heutige Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gliederte sich zur Zeit des
Dreißigjährigen Krieges in mehrere Herzogtümer. Im vorliegenden Artikel wer-den Städte und Regionen vereinfacht den damaligen Landesgrenzen Mecklenburgs bzw. Pommerns zugeordnet.
51 Nach K. Schudy (1978, 47) 91 Taler „und ein Gepräge von 8 Realen“.52 Es folgen die Vereinigten Provinzen der Niederlande mit 23, das Herzogtum
Braunschweig-Lüneburg mit sechs sowie Kursachsen und die spanischen Nieder-lande mit jeweils fünf Prägungen. Je einmal vertreten sind Spanien, die ernestini-schen Herzogtümer, das Herzogtum Schleswig-Holstein, die Grafschaft Hohn-stein, Brandenburg/Franken, das Herzogtum Jägerndorf, Kurbayern, sowie die Erzbistümer Salzburg und Magdeburg. Von den 15 städtischen Münzständen sind Hamburg und Lübeck je dreimal, Lüneburg und Schaffhausen je zweimal vertre-ten. Aus Wismar, Rostock, Frankfurt am Main, Zug und Bern (St. Gallen) stammt je eine Münze.
53 Außer 23 Skillingen des Königreichs Dänemark (22,4 %) und einem Stuiver aus den Vereinigten Niederlanden handelt es sich um Münzen des Deutschen Reichs. Den größten Anteil bilden solche aus dem Herzogtum Mecklenburg mit 27,2 % und der Stadt Stralsund mit 13,6 %. Vertreten sind weiterhin die Städte Rostock, Wismar, Lübeck und Hamburg, die Herzogtümer Pommern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Lauenburg, sowie die Kurfürstentümer Brandenburg und Sachsen.
225Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Erasmus Pontanus, damals Leiter der Neu-brandenburger Gelehrtenschule, beschrieb die Zerstörung und das Blutbad, das der Er-stürmung folgte und das nur etwa 50 Bürger unbeschadet überstanden hätten. In der engen Anlage des Friedländer Tores habe man etwa 90 Gefallene „ober einander todt […] ligend gefunden“ und sie zwischen dem Tor und dem vorgelagerten Zingel bestattet „Leiche an Lei-che, abgehawene Feuste, Finger, Füße, Arme, Beine, Hirnschalen und andere Menschliche Gliedmaßen.“ (Pontanus 1631, o. S.).Im November 1991 fand man bei Bauarbeiten im eingeebneten mittleren Wallgraben vor dem Friedländer Tor Skelettreste von min-destens 13 Männern, die mit großer Wahr-scheinlichkeit zu diesen Toten gehören. Das Massengrab wurde nur angeschnitten, so dass weitere Gefallene an dieser Stelle zu ver-muten sind. Die Männer waren überwiegend im Alter zwischen 25 und 29 Jahren gestor-ben und lagen mit den Köpfen teils im Wes-ten, teils im Osten. Gut ein Drittel der Skelet-te (fünf von 13) weist unverheilte Verletzungen auf.54 Mit Ausnahme von zwei Schusswun-den stammen alle aus Nahkämpfen, die – so lassen die mehrfachen Verletzungen an den Schädeln vermuten – erbittert geführt wur-den (Jungklaus/Prehn 2011).55
Ähnlich wie Neubrandenburg erlebte auch Pasewalk, Lkr. Uecker-Randow (damals Pommern), Grenzstadt zur Mark Branden-burg, während des Dreißigjährigen Krieges schnell wechselnde und verheerende Beset-zungen durch schwedische und kaiserliche Truppen. 1627 hatten sich Kaiserliche in Pa-sewalk einquartiert. 1630 besetzten Schwe-den die Stadt, jedoch eroberte am 7. Septem-ber das 3000–4000 Mann starke kaiserliche Heer unter der Führung von Oberst Hans von Götze – von Zeitgenossen als Bluthund bezeichnet – sie zurück. Die Stadt wurde am 11. September angesteckt und brannte fast vollständig ab. 1692/93, mehr als 60 Jahre nach der Brandschatzung, verzeichnete ein Kataster immer noch 425 wüste und unbe-baute Hausstellen. Die Pasewalker und die schwedischen Besatzungstruppen wurden in einem auch für damalige Verhältnisse außer-gewöhnlichen Blutbad umgebracht, das nur 50 von 2000 Menschen überlebt haben sollen. Während archäologischer Untersuchungen im Jahr 2002 legte man einige in den Ruinen des Rathauses und der Markthalle beigesetzte Tote frei (Ewe 1996, 89 f.; Hoffmann 2005, 182; Brüggemann 2010, 434 f.).
Die Pasewalker Marienkirche wurde im gleichen Maße wie die Bürgerhäuser ge-brandschatzt.56 Die Plünderer übersahen je-doch einen Kasten mit etwa 100 Münzen, der wahrscheinlich in den Boden der Sakris-
tei eingelassen war. Die Zusammensetzung der Münzen spiegelt ihre Herkunft aus einer Kollekte wieder. Die älteste Münze ist ein nicht näher bestimmbarer Hohlpfennig ver-mutlich aus dem 14. Jh., dessen Fundzuge-hörigkeit nicht sicher ist; zwei Geldstücke stammen aus dem 15. Jh. und elf Schluss-
54 Dieser Anteil findet sich auch bei den Toten, die am 4. Oktober 1636 während der Schlacht von Wittstock am Scharfenberg gefallen und vermutlich von schwedi-schen Soldaten begraben worden waren (Eickhoff 2012, 141; Jungklaus u. a. 2012 a, 153 f.).
55 Die rechte Schädelseite eines Mannes wurde durch stumpfe Gewalt, etwa einen Schlag mit einem Hammer oder Ähnlichem eingeschlagen. Zusätzlich trafen Hie-be von einer Blankwaffe sein hinteres Stirnbein, seine rechte hintere Schädelseite und seinen Hinterkopf. Ein anderer Mann wurde dreifach am Unterkiefer verletzt; ein Hieb drang von vorne ein und trennte etliche Zähne unterhalb der Wurzeln ab, die beiden anderen kamen von schräg unten und schräg oben. Außerdem traf ein Schuss sein Stirnbein. Bei einem weiteren Schädel war die linke Schläfe zer-trümmert, an einem anderen der rechte Hinterkopf durch einen Berstungsbruch deformiert. Eine Musketenkugel hatte den rechten Hinterkopf eines weiteren Mannes durchschlagen; Jungklaus/Prehn 2011; B. Jungklaus, Ein Massengrab aus dem Dreißigjährigen Krieg am Friedländer Tor in Neubrandenburg – Ergebnisse der anthropologischen Untersuchung. Unveröff. Abschlussber. Stadtarchäologie Neubrandenburg (Berlin 2010).
56 „Als endlich in den Häusern nichts mehr zu finden gewesen, ist bald hier, bald dort Feuer angelegt worden, welches alsbald gewaltig um sich gefressen hat. Da-rauf geht die Marienkirche, ein sehr schönes Gebäude, köstlich ausgeziert, durch das Feuer an, nachdem sie erstlich von allen Kirchen Ornat, Silber und Golf, ge-plündert worden war, und alle schönen Werke darin werden zur Asche. In diesem Feuer sind viele Kinder verbrannt, die die Mütter auf der Flucht in den Wiegen oder Betten zurück lassen mussten. Und man hat diese neroischen Worte vielfältig gehört: Siehe, wie fein brennt Pasewalk.“ (Loper 1630, o. S.; zitiert nach Fries/Zach-Obmann 2012, 189; auszugsweise publiziert in Milger 1998).
Abb. 39: Fundplätze des Dreißigjährigen Krieges in Mecklenburg-Vorpommern. Kursiv: Orte auf dem Lande oder außerhalb des Bundeslandes
226 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
münzen datieren in das Jahr 1622 (Krüger 2005 a, 581 ff.).57
Der Brandschutt, der sich auf dem ehemali-gen Backsteinfußboden der Sakristei teilwei-se erhalten hatte, enthielt zudem mehr als 60 teils aufwändig verzierte Buchverschlüsse, Massivbuckel und Mittel- sowie Eckbeschlä-ge aus Buntmetall, letzte Reste der Kirchen-bibliothek, die möglicherweise vor der Brandschatzung geplündert worden war. Die meisten Funde datieren in die Zeit zwischen 1470 und 1540/50. Wahrscheinlich befanden sich einige Bücher der Bibliothek des Pase-walker Dominikanerklosters darunter, das 1532 im Zuge der Reformation aufgelöst wor-den war (Adler/Ansorge 2007, 154 ff.; Schäfer 2009, 203 f.).Auch die Hansestadt Greifswald (damals Pommern) war bereits 1627 von kaiserlichen Truppen besetzt worden. Im Jahr 1630, als etwa 2000 Männer einquartiert waren, brach die Pest aus. Im Juni 1631 näherten sich schwedische Truppen der Stadt. Komman-dant Oberst Ludovico Perusius, der die Lage bei einem Ritt erkunden wollte, wurde von schwedischen Reitern getötet. Daraufhin zogen die kaiserlichen Besatzer am 16. Juni ab und Gustav II. Adolf einen Tag später in Greifswald ein.Bei archäologischen Untersuchungen im Jahr 2001 wurden in der Gasse Am Jacobikirch-platz 299 Gräber freigelegt. In einem lag das Skelett eines ca. 1,7 m großen Mannes, der mit etwa 30 Jahren gestorben war. Besondere Grabbeigaben lassen vermuten, dass hier ein katholischer und somit vermutlich kaiserli-cher Soldat auf dem Friedhof der Jacobikir-che begraben worden war. Drei Tonpfeifen
datieren aufgrund ihrer Fersenmarken in die Zeit um 1630. An seinem linken Oberschen-kel fand sich ein Rosenkranz aus Knochen-perlen. Fünf Gruppen von Zehnerperlen, so genannten Ave-Perlen, werden unterbrochen von je einer großen Perle, die wiederum von zwei kleinen eingefasst ist. Eingehängt sind je zwei aus Knochen geschnitzte Hände und Füße als Symbole für die Wundmale Christi. Ein Amulett besteht aus zwei Glasplättchen, die den auf Papier gedruckten Anfang des Jo-hannesevangeliums einfassen: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott“ (Ansorge 2003).Aus Greifswald stammt auch ein großer Münzschatz, der 2001 bei Grabungen im südwestlichen Hofbereich des Grundstückes Rakower Straße 9 entdeckt wurde und 1251 in Stoff gewickelte Münzen umfasst.58 481 davon datieren in den Zeitraum zwischen 1551 und 1570, 147 in den Abschnitt von 1611–1623. Kleingeld, das nach 1618, wäh-rend der so genannten Kipper- und Wipper-zeit mit hoher Münzentwertung geprägt wurde, fehlt. Der Besitzer hat somit nur hochwertige Silbermünzen angespart. Die äl-teste ist ein unter Christopher III. (1440–1448) in Malmö geprägter dänischer Hvid, die Schlussmünze ein 1623 in Glückstadt ge-prägter Taler des dänischen Königs Christi-an IV. (1588–1648; Ansorge u. a. 2009, 191 ff.; Ansorge/Samariter 2012, 32).Zwei weitere große Münzschätze wurden 1995/1996 in Anklam, Lkr. Vorpommern-Greifswald (damals Pommern), und Güs-trow, Lkr. Rostock (damals Mecklenburg), geborgen. Bereits 1627 hatten sich kaiserliche Truppen in Anklam einquartiert. Am 21. Juli 1630 eroberten dann schwedische Truppen unter Gustav II. Adolf die Stadt und hielten sie elf Monate besetzt. 1637 wählten die Schweden Anklam erneut als Stützpunkt gegen die bei Stettin stehenden kaiserlichen Truppen und verteidigten es im August er-folgreich gegen General Gallas, der mit 60 Regimentern die Peene überqueren wollte und die Stadt beschießen ließ; dabei wurden der Marienkirchturm und die Bebauung am Pferdemarkt schwer in Mitleidenschaft gezo-gen. Die Schweden blieben bis zum Sommer 1638 in Anklam (Fries 2009, 145; 162 f. 167 f.).In einer später zugesetzten Mauernische im Keller des Hauses Wollweberstraße 42 bar-gen Archäologen einen Holzkasten mit über 2 600 Münzen,59 zwei Silberlöffeln, einem Federkielhalter, vier Wappenschilden von
57 Es handelt sich um 64 kupferne Scherfe, zehn kupferne Sechspfennigstücke so-wie 14 silberhaltige Scheidemünzen, darunter ein in Stralsund gegengestempel-ter brandenburgischer Doppelschilling sowie ein sundischer Schilling aus Stral-sund. Von den zehn Münzständen sind die Teilherzogtümer Pommern-Wolgast und Pommern-Stettin am häufigsten vertreten (41 bzw. 15 Münzen), es folgen die Stadt Stralsund (vier Münzen), sowie das Stift Kammin und die Städte Stettin und Garz an der Oder mit jeweils einer Münze. Weitere stammen aus dem Herzogtum Mecklenburg (vier), aus Brandenburg (zwei), dem Königreich Dänemark und aus Magdeburg (jeweils eine).
58 Es dominieren Doppelschillinge, Schillinge und Sechslinge (zusammen 89 %), hinzu kommen 14 Taler, zwei Halbtaler und fünf Vierteltaler. Insgesamt sind 57 Münzstände vertreten. Den größten Anteil bilden Münzen aus den Städten Rostock, Hamburg und Stralsund sowie aus den Herzogtümern Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Neben Münzständen aus dem Reich sind in kleinerer Zahl die Königreiche Polen, Dänemark, Schweden und die Niederländischen Provinzen vertreten.
59 Der überwiegende Teil des Hortes setzt sich aus Kleinmünzen wie Doppelschil-lingen, Düttchen und kleineren Nominalen zusammen. Bemerkenswert hoch ist der Anteil gegengestempelter Doppelschillinge norddeutscher Provenienz und dänischer Kleinmünzen. Die selteneren Taler sind meist niederländische oder
227Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
einem Willkommhumpen und Kleidungszu-behör (Gürtelteile, Buchstabenanhänger, Textilbesätze und Wamsverschlüsse). Einer der auf den Wappenschilden und Löffeln ein-gravierten Namen fand sich in einer lokalen Urkunde: Jasper Wulf war 1610 Mitglied der Anklamer Brauzunft und starb am 12. April 1631.Das älteste Geldstück ist ein Handheller, wohl aus dem zweiten Viertel des 13. Jhs. Die jüngsten Münzen wurden unter Bogis-law XIV. von Pommern 1629 geprägt. Da sie fast prägefrisch wirken, könnte der Schatz 1629 oder 1630, als schwedische Truppen die Stadt besetzten, verborgen worden sein (Virk 2005, 473 f.; Fries 2009, 167 ff.).Nach der Belagerung durch General Gallas brach im Sommer 1638 in Anklam die Pest aus, an der zwei Drittel der Bevölkerung star-ben: „der beste Kern der Bürger, bis auf den dritten Theil des ganzen, legte sich schlafen“ (zitiert nach: Fries 2009, 145). Auf dem Pfer-demarkt, der nach kaiserlichem Artilleriebe-schuss am 20. August 1637 ein Trümmerfeld geworden war, dokumentierten Archäologen einen Notfriedhof wahrscheinlich mit Pest-toten. Die 303 Gräber waren überwiegend einlagig in nahezu Nordost-Südwest orien-tierten Reihen angelegt und die verstorbenen Männer, Frauen und Kinder meist in Holz-särgen oder Tüchern beerdigt worden. In Grab 81 lag ein etwa 1,6 m großer Mann, des-sen Hände mit langen Eisennägeln fixiert worden waren. Ein weiterer Nagel fand sich oberhalb seiner rechten Hüfte und sein Kopf war mit einem Holzgefäß verdeckt worden. Anscheinend wurde hier jemand beigesetzt, den man als Wiedergänger angesehen hatte (Fries 1996, 80 ff.).Ein mit 2136 Münzen ähnlich großer Schatz wie in Anklam wurde in Güstrow auf dem Grundstück Baustraße 40 geborgen. Ein Wasserrohrbuch hatte etwa ein Drittel der Geldstücke in die Baugrube geschwemmt; beim Nachsuchen kamen etwa 1 400 weitere Objekte zutage. Das Geld war wahrschein-lich in einem Stoffbeutel an der Außenseite eines mittelalterlichen Gebäudes vergraben worden. Es sind ausschließlich Scheidemün-zen.60 Die älteste Münze, ein Stralsunder Witten um 1387, stammt möglicherweise aus einem anderen Fundzusammenhang; die nächst jüngeren Münzen datieren um 1500. Über 1 800 Geldstücke des Güstrower Schatzfundes waren 60 Jahre oder älter, als sie versteckt wurden. Zusammen mit den ver-
gleichsweise kleinen Nominalen spricht dies für eine Deutung als Sparstrumpf oder eiser-ne Reserve, die vermutlich von einem Acker-bürger oder einfachen Handwerker über lange Zeit angespart worden war. Das Präge-jahr der Schlussmünze, ein Düttchen aus Rostock, ist 1630 (Krüger 2002; 2005 b, 469 ff.). Von Juli 1628 bis August 1630 war Güstrow die Residenz des von Kaiser Ferdi-nand II. mit Mecklenburg belehnten Gene-rals Wallenstein. Dieser hatte sich jedoch nur kurzfristig im Sommer 1628 hier aufgehalten (Koch 1999, 6 ff.).Deutlich wertvoller war eine bei Abbruchar-beiten 1965 in Stralsund gefundene Samm-lung aus 233 Talern oder talerartigen Geprä-gen und einer dänischen Krone Christians IV. Sie war in einem mit einer Weintraube ge-markten Zinngefäß zusammengetragen und in die Giebelseite des Kellers Badenstraße 12 eingemauert worden. Die Münzen entstam-men der Zeit von 1541 bis 1626. Sie wurden – vermutlich von einem Mitglied des wohlha-benden Stralsunder Bürgertums – mutmaß-lich im Zeitraum zwischen der Franzburger Kapitulation im November 1627 und dem Ende der erfolgreich abgewehrten dreimona-tigen Belagerung Stralsunds Anfang August 1628 versteckt (Räbiger 1970).61
Habsburger Prägungen. Insgesamt sind etwa 100 Münzstände vertreten, die von Schweden und Dänemark im Norden, über Riga, das Herzogtum Kurland und Polen im Osten, weiter über Ungarn, Österreich und die Schweiz im Süden, sowie Flandern und die Niederlande im Nordwesten reichen. Am westlichsten liegen die Münzstände Sevilla (Spanien) und Mexiko als spanische Überseekolonie. Am häufigsten kommen das Bistum Kammin und die Stadt Stralsund vor.
60 Darunter am häufigsten lübische Sechslinge (etwa 75 %) und Schillinge (knapp 22 %) oder wertgleiche Münzen. Geringe Anteile haben Doppelschillinge und Düttchen, die jeweils jüngere Prägungen sind. Von den 20 Münzständen, die von Kopenhagen im Norden, Krakau im Osten, Württemberg im Süden und Ravens-berg im Westen reichen, sind die Hansestädte Rostock, Hamburg, Stralsund, Lü-beck, Wismar und Lüneburg mit knapp 80 % am häufigsten vertreten. Es folgen Prägungen der mecklenburgischen Herzöge und dänischen Könige mit knapp 19 %.
61 Die 37 Münzstände verteilen sich auf das gesamte Reich sowie auf Dänemark im Norden, Siebenbürgen und Tassarolo (Italien) im Süden und die niederländischen Provinzen und Städte im Nordwesten (Krüger 2005 b, 471 f.). In den Vereinig-ten Provinzen der Niederlande dienten 73 Taler als Zahlungsmittel (24 in West-friesland, 14 in Seeland, 12 in Utrecht, zehn in Geldern, je fünf in Overijssel und Holland und drei in Friesland). Aus den Städten Kampen, Deventer und Zwolle kommen drei weitere Taler hinzu. Damit ergibt sich für niederländische Taler ein Anteil von etwa einem Drittel. 60 Taler (etwa ein Viertel) stammen aus habsburgi-schen Münzständen, 13 aus dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, sechs aus Kursachsen und fünf aus dem Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorp. Je drei Taler kommen aus den Grafschaften Mansfeld und Hanau-Münzenberg und zwei aus dem Herzogtum Mecklenburg-Güstrow. Je ein Taler wurde geprägt in Kur-bayern, dem Herzogtum Sachsen-Weimar, der Grafschaft Holstein-Schauenburg-Pinneberg, dem Herzogtum Jülich-Kleve-Berg, der Markgrafschaft Bayreuth, der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, den Grafschaften Ostfriesland, Öttingen, Erbach, Solms-Laubach und Tassarolo, der Burg Friedland an der Wetterau, der
228 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Neben diesen bei stadtarchäologischen Un-tersuchungen geborgenen und dokumentier-ten Befunden und Funden sind in den letzten Jahren in Mecklenburg-Vorpommern auch außerhalb der Städte Funde aus dem Dreißig-jährigen Krieg aufgedeckt worden.62 ‚In der Benz’, einem Waldgebiet in der Nähe von Malchin, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte (damals Mecklenburg), lagerte 1639 ein Heer von 80 000 sächsischen und brandenburgi-schen Söldnern und erwartete die aus Pom-mern zurückkehrende schwedische Armee unter Feldmarschall Johan Banér. Nach sie-ben Wochen vergeblichen Wartens zwangen Pest und Hunger die Kaiserlichen zum Abzug aus ihrem Heerlager.Verschanzungen oder ähnliche Befunde wur-den bei den bisherigen Begehungen nicht ent-deckt. Im Boden blieben aber Funde zurück, die sich in fünf abgrenzbaren Bereichen kon-zentrieren und vermutlich einzelne Truppen-einheiten repräsentieren. Zur Ausrüstung von Ross und Reiter zählen einfache Räd-chensporen sowie verschiedene Steigbügel, darunter reich gestaltete und möglicherweise Offizieren vorbehaltene mit durchbrochenen Trittplatten und verzierten Seiten, aber auch einfache schlaufenförmige Bandsteigbügel. Weiterhin fanden sich etliche Hufeisen mit einfach umgeschlagenen Stollen, zwei Typen von Pferdestriegeln und Zaumzeugteile wie eine vollständige Kandare. Von der Bewaff-nung blieben Musketen- und Pistolenläufe, Steinschlösser, eine vermutliche Musketenga-bel sowie Fragmente von Hellebarden und Spießeisen erhalten. Eine weitere Fundgrup-pe umfasst Werkzeuge wie Äxte, Zangen und Hämmer, Eisenringe (Bestandteile von Holz-
rädern) sowie Bügel von Holzeimern. Dinge des täglichen Gebrauchs waren ein eisernes Truhenschloss mit komplizierter Mechanik, Scheren, Fingerhüte, Zapfhähne und verzier-te Löffel. Zum Kleidungszubehör zählen eine komplette Bronzekette mit Puttenköpfchen auf den Verschlüssen, ein einzelner Ver-schluss mit einem Löwenkopf sowie Schnal-lenrahmen. Eine arabische Goldmünze (Osman II., 1618–1622) war vermutlich in die Kleidung eingenäht (Schoknecht 2012).63
Bisher noch unpubliziert sind zwei 2011 ent-deckte Fundplätze.64 Durch die systemati-sche Aufnahme von Oberflächenfunden wurde eine Wüstung in der Gemarkung Jar-gelin, Lkr. Vorpommern-Greifswald (damals Pommern), wenige Kilometer nördlich von Anklam erfasst. Die räumliche Verteilung di-verser Fundkategorien deutet ebenso wie die schriftlichen Quellen auf die Existenz von vermutlich drei Gehöften hin. Neben priva-tem Besitz und gehobener bäuerlicher Sach-kultur gibt es eindeutige Hinweise auf die Anwesenheit von Soldaten: viele Bleigeschos-se, eine kleinkalibrige Kanonenkugel aus Eisen, ein Degenknauf, zwei Pikenspitzen, eine Musketengabel, ein Kugelzieher und mehrere Radsporen. Im umfangreichen Münzspektrum, mit einem Schwerpunkt im ersten Drittel des 17. Jhs., gibt die jüngste Münze von 1625 einen Datierungsanhalt auf die Zerstörung des Ortes.Im November 2011 kam an einem alten Über-gang über die Tollense bei Weltzin, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte (damals Pom-mern), im Rahmen systematischer ehrenamt-licher Detektorsuche ein ausgepflügter Schatz mit 240 Münzen zutage. Nach erster Sichtung65 umfasst er überwiegend Taler und Schillinge zumeist des 16./17. Jhs. Neben Münzen aus dem Deutschen Reich, Däne-mark und den niederländischen Provinzen ist ein Stralsunder Taler von 1635 vertreten.Zum Schluss soll ein bemerkenswertes Grab in Erinnerung gerufen werden, das etwa 8 km südlich der Grenze zu Mecklenburg in Bran-denburg entdeckt und 1977 publiziert wurde (Lüders 1977).66 Am östlichen Ortsausgang von Karstädt-Postlin, Lkr. Prignitz, wurde 1976 bei Bauarbeiten ein Grab angeschnit-ten.67 Die Fundstelle befindet sich am einst geschlossenen Ende des 1345 erstmals er-wähnten Sackgassendorfes Postlin, etwa 250 m von der Kirche entfernt. Der Tote lag in etwa 0,8 m Tiefe auf dem Rücken mit dem Kopf im Süden. Er war knapp 1,6 m groß und
Herrschaft Vianen und dem Fürstentum Siebenbürgen. Städtische Münzstände sind Hamburg (acht Taler), Lübeck und Nürnberg (je sieben), Stralsund (fünf), so-wie mit je einem Taler Rostock, Lüneburg, Hannover, Hildesheim, Emden, Köln, Ulm, Kempten, St. Gallen und Basel. Fünf Taler stammen aus dem Erzbistum Salzburg und je einer aus den Bistümern Halberstadt, Hildesheim und Regensburg sowie aus dem Benediktinerstift Stablo.
62 Dies ist hauptsächlich Feldbegehungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter des LAKD zu verdanken.
63 Dieses Fundinventar aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges unterscheidet sich deutlich von den Funden, die 2010 während der Ausgrabung der Ostbastion des Stralsunder Frankenkronwerks gemacht wurden (Konze/Samariter 2011, 459–465).
64 Herzlich gedankt sei Dr. M. Schirren, LAKD, der diese Fundplätze betreut und uns seine Informationen zur Verfügung stellte.
65 Die Restaurierung und Bestimmung der Münzen steht noch aus.66 Den Hinweis verdanken wir Dr. H. Schäfer, LAKD, dem wir auch für die Litera-
tur herzlich danken.67 Der Befund wurde von dem ortsansässigen ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger
Ekkehard Lüders in knapp drei Stunden bei 30 cm tief reichendem Frost dokumen-tiert und geborgen.
229Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gestor-ben. Der Mann hatte an einer verschleißbe-dingten Deformation der Wirbelsäule (Spon-dylose) gelitten. Ein Zahn war durch Karies weitgehend zerstört, an etlichen hatte sich Zahnstein gebildet. Zudem waren seine Kie-ferknochen aufgrund entzündlicher Erkran-kungen des Zahnhalteapparats rückgebildet (Parodontose).Neben seiner linken Hüfte lagen acht Be-schläge aus Eisen und Bronze, die Überreste eines Holzkästchens. An ihnen hafteten Fa-sern eines leinwandbindigen Gewebes. In dem Kästchen lagen – nach Angaben des Bau-arbeiters übereinander – sechs Bronzelöffel, ein kleiner (L. 12,4 cm) und fünf größere (L. 16,8–17,7 cm) mit einfachen, unterschiedlich gestalteten Stielenden. Außerdem fand sich ein etwa 5,1 cm hoher Bronzegriff von einem Zapfhahn, dessen Ende als Dreipass gestaltet war. An diesen Funden wies man Reste von Flachs nach. Das Kästchen enthielt zudem neun Silbermünzen, alles kleine Nominale.68
Eine verdorrte Eichel und mehrere Haselnüs-se aus seiner Nähe legen eine Bestattung im Herbst nahe. Neben dem linken Knie des Toten lag ein 7,2 cm langer Nagel, möglicher-weise vom Sarg. Neben seinem Schädel doku-mentierte der Ausgräber jeweils einen Zahn von einem Fohlen sowie einem ausgewachse-nen Pferd und etwas darunter einen Amphi-bienknochen, vermutlich von einem Frosch. Von der Kleidung des Mannes hatten sich im Hals- und Brustbereich vier vollständige, an-nähernd kugelförmige und mit einem fünf-strahligen Stern verzierte Bronzeknöpfe (Dm. 1,2 cm) erhalten sowie das Bruchstück eines fünften. An ihren Ösen klebten eben-falls Flachsreste. Die Todesursache sowie die Herkunft des Toten oder seine Zugehörigkeit zu „einer deutschen oder ausländischen Truppe“ konnte nicht festgestellt werden. Die „vielen Beigaben“ veranlassten den Ausgrä-ber zu dem Schluss, der Verstorbene könnte „ein Einheimischer gewesen sein, dem die persönliche Habe mit ins Grab gegeben wurde.“ (ebd. 64).
68 Das älteste Geldstück ist ein 1544 im Herzogtum Preußen geprägter Dreigröscher, das jüngste ein Dreier von 1625 aus dem Kurfürstentum Brandenburg. Von dort stammen auch zwei Kippermünzen, ein Sechs- (1622) und ein Dreigröscher (1623). Zwei Dreigröscher kommen aus dem Königreich Polen (1589 und 1600), je ein Dreier aus dem Kurfürstentum Sachsen (1557) und dem Fürstentum Bran-denburg-Ansbach (1579). Ein Groschen wurde 1599 im Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorp geprägt.
230 Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Ansorge/SamariterJ. Ansorge/R. Samariter, Archäologische Untersuchungen im ehe-maligen Greifswalder Franziskanerkloster. Greifswalder Beitr. 6, 2012, 26–33.
Archäologie unter dem Straßenpflaster 2005Archäologie unter dem Straßenpflaster – 15 Jahre Stadtarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern. Beitr. Ur- u. Frühgesch. Mecklen-burg-Vorpommern 39 (Schwerin 2005).
von Arnim/Brentano 1806A. von Arnim/C. Brentano (Hrsg.), Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder, Bd. 1 (Heidelberg 1806).
Brock/Homann 2011T. Brock/A. Homann, Schlachtfeldarchäologie – Auf den Spuren des Krieges (Stuttgart 2011).
Eickhoff 2012S. Eickhoff, Die Schlacht. In: Eickhoff/Schopper 2012, 136–141.
Eickhoff/Schopper 2012S. Eickhoff/F. Schopper (Hrsg.), 1636 – ihre letzte Schlacht. Leben im Dreißigjährigen Krieg (Stuttgart 2012).
Ewe 1996H. Ewe, Das alte Bild der pommerschen Städte (Weimar 1996).
Fock 1872O. Fock, Aus den letzten Zeiten Pommerscher Selbständigkeit. Wallenstein und der große Kurfürst vor Stralsund. Rügensch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten (Leipzig 1872.
Fries 1996H. Fries, Eine ungewöhnliche Bestattung auf dem Anklamer Pferdemarkt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Arch. Ber. Mecklenburg-Vorpommern 3, 1996, 80–83.
Fries 2009H. Fries, Katalog Fundplätze. In: Anklam – Siedlung am Fluss. Eine über 1 000-jährige Geschichte im Spiegel der Archäologie. Katalog zur Sonderausstellung „Verschüttet, vergessen, entdeckt” vom 17. Mai bis 21. September 2009 in Anklam (Anklam 2009) 99–194.
Fries/Zach-Obmann 2012H.Fries/B. Zach-Obmann, „Siehe, wie fein brennt Pasewalk“.Ein historisches Ereignis und seine Hinterlassenschaft. Arch. Ber. Mecklenburg-Vorpommern 19, 2012, 189–194.
Grothe 2012 aA. Grothe, Stratigrafische Abfolge und „Harris-Matrix”. In: Eick-hoff/Schopper 2012, 168–170.
Grothe 2012 bA. Grothe, Die Kleidungsfunde aus dem Grab und vom Schlacht-feld. In: Eickhoff/Schopper 2012, 172–177.
Hoffmann 2005V. Hoffmann, Vergessene Größe – Der Pasewalker Marktplatz. In: Archäologie unter dem Straßenpflaster 2005, 181–182.
Jänicke 2012R. Jänicke, Die Untersuchungen auf dem Westteil des Marktes in Plau am See, Lkr. Ludwigslust-Parchim. Arch. Ber. Mecklenburg-Vorpommern, 19, 2012, 174–181.
Jungklaus/Prehn 2011B. Jungklaus/B. Prehn, Ein Soldatenmassengrab vom Friedländer Tor in Neubrandenburg aus dem Jahre 1631 und dessen anthropolo-gische Untersuchung. Neubrandenburger Mosaik 35, 2011, 10–33.
Jungklaus u. a. 2012 aB. Jungklaus/H.-G. König/J. Wahl, Die toten Soldaten. In: Eick-hoff/Schopper 2012, 153–159.
Jungklaus u. a. 2012 bB. Jungklaus/M. Konze/R. Samariter, Die Stralsunder Stadtbefesti-gung. StraleSunth. Stadt-Schreiber-Geschichte(n) 2, 2012, 98–103.
Koch 1999I. Koch, Die Welt ist ein einziger Schatten. Begleitband zur Aus-stellung anläßlich der 350. Wiederkehr des Westfälischen Friedens im Museum der Stadt Güstrow, 9. Oktober 1998 bis 15. Januar 1999. Schriftenr. Mus. Stadt Güstrow 7 (Güstrow 1999).
Konczak 2012R. Konczak, Ergebnisse der Untersuchung auf dem Marktplatz von Laage, Lkr. Rostock. Arch. Ber. Mecklenburg-Vorpommern 19, 2012, 162–173.
Quellen
Abelinus 1662J. Ph. Abelinus, Theatrum Europaeum, oder außführliche und war-hafftige Beschreibung aller und jeder denckwürdiger Geschichten, so sich hin und wieder in der Welt fürnemblich aber in Europa und Teutschlanden, sowol im Religion- als Prophan-Wesen ... zugetra-gen. 1617 biß 1629 exkl. (Franckfurt am Mayn 1662).
Fielittz 1628A. Fielittz, Abriss von der Belahgerung der Stadt Stralsundt wie dieselbige von dem kaiserlichen Feldmarschalk Arnheim angestel-let und continuiret worden. Anno 1628 (Stadtarchiv Stralsund, Sig. MI–006).
Hartwig o. J.C. Hartwig, Admiranda u. vere divina liberatio meae, bina vica facta. (Die wunderbare und wahrhaft göttliche Befreiung meiner Person, die zweimal geschehen ist). In: Koch 1999, 15–16.
Hasert 1631J. Hasert, Gründlicher, warhaffter vnnd kurtzer Bericht, Von der Haense Stadt Stralsund, Der Heubtstadt in Pommern. Wie Anno 1627 Die Einquartierung daselbst begehret aber guetlich abge-handlet und gleichwol folgig Gewalt unterschiedlich wider sie ver-uebet Auch von dero Belagerung, Stuermung und was dabey und weiter biß zum Abzuge des Feindlichen Kriegsvolcks vorgangen; nebst den noethigsten Beylagen. Auf Befehl E. E. Rahts daselbst in Druck geben (Stralsund 1631; zitiert nach: Bayerische Staatsbiblio-thek Inv.-Nr. Eur. 1011 e).
Loper 1630Ch. Loper, Laniena Paswalcensis Das ist/Missive Von der zu Pa-sewalck in Pommern verübten unmenschlichen Tiranney und Verstörung. An einem guten Freund/nacher Penckun/von einem so auß Pasewalck ... entrunnen … Anno 1630. den 12. September abgesandt (Stralsund 1630).
Monro 1637R. Monro, Monro, his expedition with the worthy Scots Regiment (called Mac-Keys Regiment) levied in August 1626 … (London 1637; online: http://books.google.de/books/about/Monro_His_expe-dition_with_the_worthy_Sco.html?id=KMpFAAAAcAAJ&redir_esc=y).
Pontanus 1631E. Pontanus, Truculenta Expugnatio Sanguineolentumque Exci-dium Neobrandenburgicum; Das ist/Erschröckliche Eroberung unnd blutige Zerstörung Der Stadt NewBrandenburg/Wie dieselbe von dem Käyserlichen General H. Graffen von Tylli/belagert/ be-stürmet/erobert und despeuplerct (o. O. 1631; online: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/86621/).
Literatur
Adler/Ansorge 2007G. Adler/J. Ansorge, Buchverschlüsse und Buchbeschläge vom Marienkirchhof in Pasewalk – Zeugen der ehemaligen Bibliothek des Pasewalker Dominikanerklosters. Jahrb. Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 54, 2006 (2007) 151–176.
Ansorge 2003J. Ansorge, Ein Rosenkranz und andere Merkwürdigkeiten vom Friedhof der Jacobikirche in Greifswald. Arch. Ber. Mecklenburg-Vorpommern 10, 2003, 180–194.
Ansorge 2010J. Ansorge, Ein Massengrab aus der Zeit des Nordischen Krieges auf dem ehemaligen Frankenhornwerk in Stralsund. Arch. Ber. Mecklenburg-Vorpommern 17, 2010, 122–135.
Ansorge u. a. 2009J. Ansorge/R. Samariter/H. Schäfer, Vom Klostermarkt zur rei-chen Handelsstadt – Die Hansestadt Greifswald. Archäologische Entdeckungen in Mecklenburg-Vorpommern. Arch. Mecklenburg-Vorpommern 5 (Schwerin 2009) 187–192.
231Konze/Samariter, Der Stralsunder Laufgraben
Schäfer 2009H. Schäfer, Zankapfel der Mächtigen – Pasewalk, Lkr. Uecker-Randow. Archäologische Entdeckungen in Mecklenburg-Vor-pommern. Arch. Mecklenburg-Vorpommern 5 (Schwerin 2009) 201–204.
Schnell 1907H. Schnell, Mecklenburg zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges 1603–1658. Mecklenburg. Gesch. in Einzeldarst. 10 (Berlin 1907).
Schoknecht 2012U. Schoknecht, Das Heerlager „In der Benz“ bei Gielow (Mecklen-burg-Vorpommern). In: Eickhoff/Schopper 2012, 69–71.
Schudy 1978K. Schudy, Der Neubrandenburger Münzfund von 1962. Neubran-denburger Mosaik 47, 1978, 47–57.
Stralsund 1902Die Baudenkmäler des Regierungsbezirkes Stralsund. H. 5: Der Stadtkreis Stralsund (Stettin 1902) 378.
Virk 2001W. Virk, Zwei neue mecklenburgische Münzfunde des 17. Jahrhun-derts. Jahrb. Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 48, 2000 (2001) 353–377.
Virk 2005W. Virk, „Gold und Silber lieb ich sehr ...“ – Nobel, Taler und an-dere Münzsorten in Mecklenburg-Vorpommerschen Münzfunden. In: Archäologie unter dem Straßenpflaster 2005, 473–476.
Voges 1922H. Voges, Die Belagerung von Stralsund im Jahr 1715 (Stettin 1922).
Weyersberg 1925A. Weyersberg, Solinger Schwertschmiede des 16. und 17 Jahrhun-derts und ihre Erzeugnisse (Solingen 1926).
Zober 1828E. H. Zober, Geschichte der Belagerung Stralsund’s durch Wallen-stein, im Jahr 1628 (Stralsund 1828).
Abbildungsnachweis
1; 2; 35; 36; 38: Stadtarchiv Stralsund, Sig. EIIIa-018; Sig. MI-006; Sig. MI-19-54; Sig. Mic-067; Sig. Mic-020. – 3: Schwedisches Kriegsarchiv Stockholm, Sig. stralsund262-001b, 0406:25:262:001 b Stralsund Utan titel. – 4–7; 10–20,2–4; 21; 22; 24; 27; 28; 34: R. Samariter. – 8: J. Ansor-ge, Horst. – 9; 20,1: H. Schäfer, LAKD. – 23; 25; 26; 29; 31: I. Timpe, Stralsund. – 30; 32; 33: R. Samariter/I. Timpe, Stralsund. – 37: Univ-bibl. Augsburg, Sig. 02/IV.13.2.26-2, un:nb:de:brg:348-uba000237-1. – 39: LAKD/R. SamariterBearbeitungen: R. Opitz, P. Woidt, BLDAM
Anschriften
Marlies Konze, M. A., Teergang 9, 18356 [email protected]
Dipl. Geol. Renate Samariter, Dorfstr. 54, 18519 Sundhagen OT [email protected]
Konze u. a. 2010M. Konze/M. Kühlborn/R. Samariter, Kurze Fundberichte, Schwerin, Landeshauptstadt, Fpl. 166. Jahrb. Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 57, 2009 (2010) 526–537.
Konze/Samariter 2011M. Konze/R. Samariter, Kurze Fundberichte, Hansestadt Stral-sund, Fpl. 333. Jahrb. Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpom-mern 58, 2010 (2011) 454–475.
Konze/Samariter 2012M. Konze/R. Samariter, Der Stralsunder Laufgraben von 1628 – Eine Momentaufnahme aus dem Dreißigjährigen Krieg. In: I. Schuberth/M. Reichel (Hrsg.), Die blut´ge Affair´ bei Lützen. Wal-lensteins Wende (Wettin-Löbejün 2012) 266–281.
Kosegarten 1853J. G. L. Kosegarten, Das Friedländische Kriegsvolk zu Greifswald in den Jahren 1627–1631. Nach den Acten des Greifswaldischen Stadtarchives. Balt. Stud. 15/1, 1853, 1–136.
Kosegarten 1860J. G. L. Kosegarten, Das Friedländische Kriegsvolk zu Greifswald in den Jahren 1627–1631. Nach den Acten des Greifswaldischen Stadtarchives. Fünfte Fortsetzung. Balt. Stud. 18, 1860, 115–158.
Krüger 2002J. Krüger, Der Münzschatz von Güstrow, Lkr. Güstrow – ein Schatzfund aus dem Dreißigjährigen Krieg. Jahrb. Bodendenkmal-pfl. Mecklenburg-Vorpommern 49, 2001 (2002) 285–321.
Krüger 2005 aJ. Krüger, Der Münzfund Pasewalk-Marienkirche. Ein Beitrag zum Umlauf des Kupfergeldes in Pommern-Wolgast während des Dreißigjährigen Krieges. Jahrb. Bodendenkmalpfl. Mecklenburg-Vorpommern 52, 2004 (2005) 581–591.
Krüger 2005 bJ. Krüger, Was gilt der Taler? – Der Geldwert pommerscher und mecklenburgischer Schatzfunde. In: Archäologie unter dem Stra-ßenpflaster 2005, 469–472.
Langer 1985H. Langer, Innere Kämpfe und Bündnis mit Schweden. Ende des 16. Jahrhunderts bis 1630. In: H. Ewe (Hrsg.), Geschichte der Stadt Stralsund (Weimar 1985) 137–167.
Lüders 1977E. Lüders, Ein beigabenreiches Körpergrab aus der Zeit des 30jäh-rigen Krieges von Karstädt-Postlin, Kr. Perleberg. Inf. Bezirksar-beitskr. Ur- u. Frühgesch. Schwerin 17, 1977, 56–64.
Mahr 1995H. Mahr, Oberst Robert Monro. Kriegserlebnisse eines schotti-schen Söldnerführers in Deutschland 1626–1633 (Neustadt an der Aisch 1995).
Maubach 1995P. Maubach, Katalogtext Nr. 5. 35 (Die Erstürmung Neubran-denburgs durch die Kaiserlichen 1631 gehörte zu den blutigsten Kriegsereignissen in Mecklenburg und zerstörte die Stadt). In: J. Erichsen (Hrsg.), 1 000 Jahre Mecklenburg. Geschichte und Kunst einer europäischen Region. Landesausstellung Mecklenburg-Vorpommern 1995. Kat. zur Landesausstellung Schloss Güstrow, 23. Juni–15. Oktober 1995 (Rostock 1995) 295–296.
Milger 1998E. Milger, Gegen Land und Leute. Der Dreißigjährige Krieg (Mün-chen 1998).
Nachtigal 1800J. K. Ch. Nachtigal, Volcks-Sagen (Bremen 1800).
Räbiger 1970W. Räbiger, Der Stralsunder Talerfund. Greifswald-Stralsunder Jahrb. 9 (Weimar 1970) 103–129.
Samariter 2013R. Samariter, Neue Pilgerzeichen und religiöse Zeichen aus Stral-sund. In: H. Kühne/L. Lambacher/J. Hrdina (Hrsg.), Wallfahrer aus dem Osten. Mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine. Beiträge der Tagung Perspektiven der europäi-schen Pilgerzeichenforschung 21.–24. April 2010 in Prag (Frank-furt a. M. 2013) 145–178.