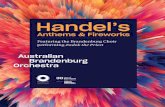Alexander Gramsch, Ritual und Kommunikation. Altersklassen und Geschlechterdifferenz im spätbronze-...
Transcript of Alexander Gramsch, Ritual und Kommunikation. Altersklassen und Geschlechterdifferenz im spätbronze-...
Universitätsforschungenzur prähistorischen Archäologie
Band 181
Professur für Ur- und Frühgeschichteder Universität Leipzig
2010
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
2010
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
Ritual und Kommunikation
früheisenzeitlichen Gräberfeld Cottbus Alvensleben-Kaserne
von
Alexander Gramsch
(Brandenburg)
Altersklassen und Geschlechterdifferenz im spätbronze- und
ISBN 978-3-7749-3682-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über <http: //dnb.d-nb.de> abrufbar.
Copyright 2010 by Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
Herausgeber sind derzeit:
Die Reihe „Universitätsforschungen zur prähistori-schen Archäologie“ soll einem in der jüngeren Vergan-genheit entstandenen Bedürfnis Rechnung tragen, näm-lich Examensarbeiten und andere Forschungsleistun-gen vornehmlich jüngerer Wissenschaftler in die Öf-fentlichkeit zu tragen. Die etablierten Reihen und Zeit-schriften des Faches reichen längst nicht mehr aus, dievorhandenen Manuskripte aufzunehmen. Die Uni-versitäten sind deshalb aufgerufen, Abhilfe zu schaf-fen. Einige von ihnen haben mit den ihnen zur Ver-fügung stehenden Mitteln unter zumeist tatkräftigemHandanlegen der Autoren die vorliegende Reihe be-gründet. Thematisch soll darin die ganze Breite desFaches vom Paläolithikum bis zur Archäologie derNeuzeit ihren Platz finden.
VORWORT DER HERAUSGEBER
Ursprünglich hatten sich fünf Universitätsinstitute inDeutschland zur Herausgabe der Reihe zusammenge-funden, der Kreis ist inzwischen größer geworden. Erlädt alle interessierten Professoren und Dozenten ein,als Mitherausgeber tätig zu werden und Arbeiten ausihrem Bereich der Reihe zukommen zu lassen. Fürdie einzelnen Bände zeichnen jeweils die Autoren undInstitute ihrer Herkunft, die im Titel deutlich gekenn-zeichnet sind, verantwortlich. Sie erstellen Satz, Um-bruch und einen Ausdruck. Bei gleicher Anordnungdes Umschlages haben die verschiedenen beteiligtenUniversitäten jeweils eine spezifische Farbe. Finan-zierung und Druck erfolgen entweder durch sie selbstoder durch den Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH,der in jedem Fall den Vertrieb der Bände sichert.
Kurt Alt (Mainz)Peter Breuning (Frankfurt am Main)
Philippe Della Casa (Zürich)Manfred K.H. Eggert (Tübingen)
Clemens Eibner (Heidelberg)Ralf Gleser (Münster)
Bernhard Hänsel (Berlin)Alfred Haffner (Kiel)
Svend Hansen (Berlin)Ole Harck (Kiel)
Joachim Henning (Frankfurt am Main)Christian Jeunesse (Strasbourg)Albrecht Jockenhövel (Münster)
Rüdiger Krause (Frankfurt am Main)Klára Kuzmová (Trnava)Amei Lang (München)Achim Leube (Berlin)
Andreas Lippert (Wien)Jens Lüning (Frankfurt am Main)
Joseph Maran (Heidelberg)Wilfried Menghin (Berlin)
Carola Metzner-Nebelsick (München)Johannes Müller (Kiel)
Ulrich Müller (Kiel)Michael Müller-Wille (Kiel)
Mária Novotná (Trnava)Bernd Päffgen (München)Christopher Pare (Mainz)
Hermann Parzinger (Berlin)Margarita Primas (Zürich)
Britta Ramminger (Hamburg)Sabine Rieckhoff (Leipzig)
Wolfram Schier (Berlin)Heiko Steuer (Freiburg im Breisgau)
Thomas Stöllner (Bochum)Biba Terzan (Berlin)
Andreas Zimmermann (Köln)
Vorwort
Um die Neugier der Leserschaft zu wecken und die Bereitschaft, dem Verfasser auf ungewohnten Wegen zufolgen, sollte man vielleicht vorweg ganz klar sagen, was die vorliegende Studie nicht sein will: weder eine tradi-tionelle Gräberfeldanalyse, noch ein Beitrag zur Typochronologie der Lausitzer Kultur.
Stattdessen bezweckt sie etwas eigentlich ganz Einfaches, das für Archäologinnen und Archäologen aber be-kanntlich zum Schwierigsten gehört: die Beschreibung der Regeln für den Umgang der Menschen miteinander.Jede historische Erzählung – auch eine wissenschaftliche Vergangenheitsdeutung ist eine Erzählung (Rieckhoff2007) – versucht zu zeigen, wie Anfang und Ende einer Geschichte von sozialen Regeln bestimmt und diesevon Liebe und Hass, Treue und Verrat, Trauer und Gewalt konterkariert werden. Aber nichts von alledem hatim Boden Spuren hinterlassen, so dass die Archäologie auf andere Mittel und Wege angewiesen ist.
Schwierig ist der Fall des Gräberfeldes Cottbus Alvensleben-Kaserne auch deshalb, weil es sich nicht umPrunkgräber handelt, sondern um eine „ärmliche“ Bestattungsgemeinschaft in der Niederlausitz zwischen dem12. und 8. Jahrhundert v. Chr., die nicht einmal über nennenswerte Fernkontakte verfügte – d.h. um einigewenige Familien, wie es viele gegeben haben muss, die in ihrem lokalen Milieu verwurzelt waren und überJahrhunderte an ihrem Friedhof festhielten, von dem aber nur unspektakuläre Brandgräber geblieben sind, indie selten mehr als anspruchslose Tongefäße beigegeben wurden. Da das Gräberfeld überdies im Zuge einerBaumaßnahme nicht vollständig untersucht werden konnte und die Altfunde verschollen sind, mussten vieleFragen erhaltungsbedingt offen bleiben. Kurzum, die Ausgangsbedingungen für eine „soziokulturelle Perspekti-ve“, aus der heraus der Verfasser die Geschichte dieser Bestattungsgemeinschaft schreiben wollte, waren allesandere als günstig. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis, das einen überraschend tiefen Einblick ermöglicht,weniger in das alltägliche Handeln als vielmehr in die Vorstellungen einer prähistorischen Gesellschaft – dieVorstellungen über die sozialen Rollen von Frauen und Männern, Jungen und Alten, über das Verhältnis zwi-schen Individuum und Gemeinschaft, also über all das, was Soziologen und Kulturwissenschaftler heutzutagebeschäftigt.
Insofern ist es nur konsequent gewesen, dass Alexander Gramsch seine Absicht, die sozialarchäologischeAnalyse nicht wie üblich aus der Beigaben-Qualität und -Kombination zu erschließen, sondern über das Be-stattungsritual zu rekonstruieren, mit Hilfe von Theorien und Modellen verwirklicht hat, die er den modernenSozial- und Kulturwissenschaften entlehnt hat. Damit hat er der Gräberfeldarchäologie völlig neue Interpretati-onswege eröffnet, denn Diskurse über Funktionalismus und Strukturalismus, poststrukturalistische Textualisie-rung des Rituals und Dekonstruktion der sozialen Identität, Handlungs- und Kommunikationstheorie reprä-sentieren hierzulande nicht gerade den methodologischen Mainstream. Gräberfeldanalysen gehen stattdessenüblicherweise primär vom Material aus, von der Grabarchitektur und den Beigaben, die als statusmarkierendeObjekte verstanden werden und Auskunft über vertikale Sozialstrukturen geben sollen, über Rangstufen undEliten – selbst wenn die Voraussetzungen, nämlich anthropologische Bestimmungen, für Studien zu Geschlechtund Alter, d.h. zu horizontalen Sozialstrukturen gegeben gewesen wären.
Der hohe Anteil der Anthropologie an den Ergebnissen dieser Arbeit ist evident – und kein Zufall. Die Dis-sertation von Alexander Gramsch ist hervorgegangen aus einem Projekt, das ich ursprünglich unter dem Titel"Herrschaft und Geschlechterdifferenz aus archäologischer und anthropologischer Sicht. Eine diachrone Studie amBeispiel Mitteldeutschlands im 1. Jahrtausend v. Chr." beantragt hatte und das von 2001 bis 2003 vom FreistaatSachsen gefördert worden ist. Im Laufe der Konturierung des Projektes hat es sich zwar als notwendig erwiesen,die Fragestellung geografisch zu beschränken und vor allem chronologisch einzuengen, doch die leitende Ideeist zu keinem Zeitpunkt aus dem Visier geraten: durch ein interdisziplinäres Forscherteam aus Archäologe undAnthropologe von Projektbeginn an der Frage nach Sozialstrukturen nachzugehen. Die daraus resultierendefruchtbare Zusammenarbeit zwischen Alexander Gramsch und der Anthropologin Birgit Großkopf (Großkopf2004) war nicht nur ein Glücksfall, sondern darf durchaus auch als methodischer Fortschritt gelten. Die eigent-liche wissenschaftliche Innovation der vorliegenden Studie scheint mir aber in der Tatsache zu liegen, dass für
Alexander Gramsch der oben erwähnte theoretische Hintergrund von Anfang an die entscheidende Sicht aufFunde und Befunde befördert hat – auf das Grab als Sequenz ritueller Handlungen, auf rituelle Handlungen alsMittel der Darstellung der sozialen Identität des bestatteten Individuums. Diese Sicht hat sich unmittelbar –von der peniblen Ausgrabungsmethode (einschließlich Werkstattuntersuchungen) bis hin zur komplexen Aus-wertung des Leichenbrandes als „kulturgeschichtlicher Quelle“ – in der Praxis niedergeschlagen.
Es mussten viele Knöchelchen herauspräpariert und viele Scherben geklebt werden, bis diese optimale Syn-these aus induktiver und deduktiver archäologischer Methodik zum Druck vorlag. Ich danke AlexanderGramsch, dass er nie die Geduld verloren hat bei der mühseligen Kleinarbeit in der Werkstatt und schlussend-lich eine anspruchsvolle Analyse vorgelegt hat, durch die auch ich viel gelernt habe. Es ist eine beglückendeErfahrung, wenn sich der universitäre gegenseitige Lehr- und Lernprozess eines Tages in einem so stattlichenWerk niederschlägt, dem ich eine nachhaltige Wirkung wünsche.
Regensburg, Mai 2010 Prof. Dr. Sabine Rieckhoff
Großkopf 2004: B. Großkopf, Leichenbrand: Biologisches und kulturhistorisches Quellenmaterial zur Rekon-struktion vor- und frühgeschichtlicher Populationen und ihrer Funeralpraktiken (Diss. Leipzig 2004:http://dol.dl.uni-Leipzig.de/receive/DOLDissHabil_disshab_00000356 [Stand: 1.12.09]).
Rieckhoff 2007: S. Rieckhoff, Keltische Vergangenheit: Erzählung, Metapher, Stereotyp. Überlegungen zu einerMethodologie der archäologischen Historiografie. In: S. Burmeister u.a. (Hrsg.), Zweiundvierzig. Fest-schrift M. Gebühr. Int. Arch. Stud. honoraria 25 (Rahden 2007) 15-34.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung ................................................................................................................................................ 7
1. Einleitung ........................................................................................................................................... 9
2. Fragestellungen und Ziele ................................................................................................................. 11
3. Forschungsgeschichte: Vom Lausitzischen Typus zur Lausitzer Kultur – und zur Genderarchäologie ............................................................................................................................ 15
3.1. Riekens Grabungen: Gräber mit Keramik vom „Lausitzischen Typus“ ......................................................153.2. Zur „Lausitzer Kultur“ .............................................................................................................................163.3. „Mittel-, Jung- und Jüngstbronzezeit“ ......................................................................................................173.4. Grünbergs Gliederung für Sachsen ...........................................................................................................173.5. Differenzierung der Stufengliederungen ...................................................................................................183.6. Neue Fragestellungen ...............................................................................................................................19
4. Das Gräberfeld Cottbus Alvensleben-Kaserne ................................................................................... 214.1. Grabungsgeschichte des Fundplatzes ........................................................................................................214.2. Untersuchungen nach Abschluss der Grabungen („Werkstattuntersuchungen“) .......................................25
4.2.1. Bergung und Dokumentation der Urnen- und Beigefäßinhalte .....................................................254.2.1.1. Untersuchung der Urneninhalte ........................................................................................254.2.1.2. Geschichtete Leichenbrände ...............................................................................................26
4.2.2. Passscherben..................................................................................................................................274.3. Topographie und Siedlungsraum ..............................................................................................................29
5. Die Befunde ...................................................................................................................................... 315.1. Grabformen .............................................................................................................................................31
5.1.1. Rechteckgräber..............................................................................................................................315.1.1.1. Größe und Architektur .....................................................................................................315.1.1.2. Obertägige Markierungen .................................................................................................335.1.1.3. Beigefäße .........................................................................................................................34
5.1.2. Kammergräber ..............................................................................................................................345.1.3. Grubengräber ................................................................................................................................35
5.1.3.1. Größe und Architektur .....................................................................................................355.1.3.2. Glockengrab .....................................................................................................................365.1.3.3. Brandschüttungsgräber .....................................................................................................36
5.1.4. Scheiterhaufenreste .......................................................................................................................375.1.5. Grabhügel .....................................................................................................................................37
5.2. Bestattungsformen ...................................................................................................................................385.3. Tierbestattung ..........................................................................................................................................385.4. Sonstige Befunde ......................................................................................................................................39
5.4.1. Keramikpackungen .......................................................................................................................395.4.2. Scherbenhaufen und -streuungen ..................................................................................................415.4.3. Gefäßdepots ..................................................................................................................................41
5.4.3.1. Gefäßdepots außerhalb von Gräbern ..................................................................................415.4.3.2. Gefäßdepots innerhalb von Gräbern und „Kenotaphe“ ........................................................42
5.4.4. Keramikreiche Gruben ..................................................................................................................42
5.4.5. Scherbenpflaster ............................................................................................................................435.4.5.1. Tier- und Menschenleichenbrand ......................................................................................445.4.5.2. Vergleichsbefunde .............................................................................................................44
5.4.6. Zusammenfassung.........................................................................................................................45
6. Die Funde ......................................................................................................................................... 476.1. Keramik ...................................................................................................................................................47
6.1.1. Typologie und Terminologie ..........................................................................................................476.1.2. Gefäßtypen ...................................................................................................................................47
6.1.2.1. Doppelkonus ....................................................................................................................476.1.2.2. Buckelgefäß ......................................................................................................................486.1.2.3. Kegelhalsgefäß ..................................................................................................................486.1.2.4. „Terrine“ .........................................................................................................................486.1.2.5. Gehenkelte Kegelhalsgefäße ...............................................................................................486.1.2.6. Amphore ..........................................................................................................................496.1.2.7. Topf, Zweihenkeltopf ........................................................................................................496.1.2.8. Eitopf ..............................................................................................................................506.1.2.9. Krug ................................................................................................................................506.1.2.10. Tassen ............................................................................................................................506.1.2.11. Schalen ..........................................................................................................................516.1.2.12. Doppelgefäß ...................................................................................................................526.1.2.13. Napf..............................................................................................................................52
6.1.3. Verzierungen .................................................................................................................................526.1.3.1. Plastische Verzierungen .....................................................................................................526.1.3.2. Rillen ..............................................................................................................................526.1.3.3. Riefen ..............................................................................................................................526.1.3.4. Flechtband .......................................................................................................................536.1.3.5. Ritzverzierung .................................................................................................................536.1.3.6. Bodenkreuze, Spiralböden .................................................................................................54
6.1.4. Fehlende Typen .............................................................................................................................546.1.5. Keramikgebrauch ..........................................................................................................................54
6.2. Metallfunde ..............................................................................................................................................556.2.1. Nadeln ..........................................................................................................................................55
6.2.1.1. Nadel mit profiliertem Kopf ..............................................................................................556.2.1.2. Rollenkopfnadel ...............................................................................................................576.2.1.3. Nagelkopfnadel ................................................................................................................576.2.1.4. Petschaftkopfnadel ............................................................................................................576.2.1.5. Schwanenhalsnadel mit Schälchenkopf ..............................................................................586.2.1.6. Kugelkopfnadel ................................................................................................................586.2.1.7. Weitere Nadeln und Schaftfragmente .................................................................................58
6.2.2. Sonstige Bronzefunde ....................................................................................................................596.2.2.1. Knöpfe .............................................................................................................................596.2.2.2. Spiralröllchen ...................................................................................................................596.2.2.3. Ringe und Perlen ..............................................................................................................606.2.2.4. Trageweise und Funktion ..................................................................................................616.2.2.5. Bronzedraht, -blech, weitere Fragmente .............................................................................61
6.3. Sonstige Kleinfunde .................................................................................................................................626.3.1. Tonperlen ......................................................................................................................................626.3.2. „Spinnwirtel“ ................................................................................................................................636.3.3. Steinanhänger ...............................................................................................................................646.3.4. Knochenschaftfragmente ...............................................................................................................646.3.5. Tierzähne ......................................................................................................................................65
7. Chronologie ...................................................................................................................................... 677.1. Relative Chronologie ................................................................................................................................67
7.1.1. Bisherige Stufengliederungen ........................................................................................................677.1.1.1. W. Grünberg ....................................................................................................................677.1.1.2. W. Coblenz ......................................................................................................................697.1.1.3. J. Schneider .....................................................................................................................697.1.1.4. D.-W. Buck .....................................................................................................................707.1.1.5. E. Bönisch .......................................................................................................................70
7.1.2. Frühe Urnenfelderzeit („Fremdgruppenzeit“ ) ...............................................................................717.1.3. Ältere bis mittlere Urnenfelderzeit (Jungbronzezeit) ......................................................................71
7.1.3.1. Frühe Jungbronzezeit .......................................................................................................717.1.3.2. Späte Jungbronzezeit ........................................................................................................73
7.1.4. Jüngere bis späte Urnenfelderzeit (Jüngstbronzezeit) .....................................................................737.1.4.1. Riefenbreite als chronologisches Merkmal ...........................................................................747.1.4.2. Übergang und frühe Jüngstbronzezeit ................................................................................757.1.4.3. Jüngstbronzezeit ...............................................................................................................787.1.4.4. Späte Jüngstbronzezeit ......................................................................................................81
7.1.5. Frühe Hallstattzeit (Billendorfer Gruppe) ......................................................................................827.1.6. Funde der Grabung Rieken ...........................................................................................................87
7.2. Absolute Chronologie ...............................................................................................................................877.2.1. Datierung von Leichenbrand ........................................................................................................877.2.2. δC13-Messungen ..........................................................................................................................897.2.3. Ergebnisse .....................................................................................................................................89
7.2.3.1. Rückersdorf ......................................................................................................................897.2.3.2. Haasow ...........................................................................................................................917.2.3.3. Diskussion .......................................................................................................................927.2.3.4. Cottbus Alvensleben-Kaserne .............................................................................................94
7.3. Zusammenfassung ....................................................................................................................................95
8. Belegungsabfolge des Gräberfelds ..................................................................................................... 978.1. Horizontalstratigraphie .............................................................................................................................978.2. Zusammengehörige Befunde ....................................................................................................................98
9. Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen ............................................................... 1019.1. Palynologie .............................................................................................................................................1019.2. Massenspektrometrische Gefäßinhaltsanalysen .......................................................................................1019.3. Chemische Untersuchung von Auflagerungen auf dem Leichenbrand ....................................................1039.4. Archäozoologie .......................................................................................................................................105
10. Anthropologie ............................................................................................................................... 10710.1. Methodische Bemerkungen ..................................................................................................................107
10.1.1. Altersdiagnose .........................................................................................................................10810.1.2. Geschlechtsdiagnose ................................................................................................................109
10.2. Ergebnisse ............................................................................................................................................11110.2.1. Alter und Geschlecht ..............................................................................................................11110.2.2. Sterblichkeit ............................................................................................................................11310.2.3. Anordnung und Beschaffenheit des Leichenbrands in den Urnen ............................................114
10.2.3.1. Schichtung und Anordnung der Leichenbrände ..........................................................11410.2.3.2. Repräsentanz ...........................................................................................................11510.2.3.3. Primäre Kohlenstoffverfärbungen (PKV)....................................................................11610.2.3.4. Fragmentgröße .........................................................................................................116
10.2.3.5. Verbrennungsgrad und Verbrennungstemperatur .........................................................11610.2.3.6. Taphonomische Prozesse in den Urnen .......................................................................117
10.2.3.7. Beimengungen und Leichenbrand aus Grabgruben ......................................................11810.2.4. Pathologien .............................................................................................................................11810.2.5. Rekonstruktion des Bestattungsvorgangs .................................................................................12010.2.6. Postfunerale Veränderungen des Leichenbrands ......................................................................121
10.3. Zusammenfassung ................................................................................................................................121
11. Ritual, Handlung und Identität .................................................................................................... 12311.1. Ritual: Handlung und Kommunikation ...............................................................................................123
11.1.1. Rituale als soziale Handlungen ................................................................................................12311.1.2. Rituale als Ausdruck von Weltanschauungen und Emotionen .................................................12511.1.3. Rituale als kommunikative und transformative Handlungen ...................................................12611.1.4. Die Gabe: Akt des Gebens und gegebenes Objekt ...................................................................12911.1.5. Übergangsrituale .....................................................................................................................13011.1.6. Ein Beispiel: Das Isoma-Ritual ................................................................................................13111.1.7. Die soziale Bedeutung von Übergangsritualen .........................................................................13311.1.8. Zusammenfassung ..................................................................................................................134
11.2. Soziale Identitäten: Individuum und Gemeinschaft ..............................................................................13511.2.1. Soziales Geschlecht .................................................................................................................136
11.2.1.1. Biologisches Geschlecht (Sex) und soziales Geschlecht (Gender) ....................................13711.2.1.2. Geschlechtertausch, Geschlechterwechsel, Zwischengeschlechter .....................................138
11.2.2. Alter und soziale Identität .......................................................................................................13911.2.3. Individuum und Gemeinschaft ...............................................................................................141
11.3. Zusammenfassung ................................................................................................................................141
12. Bestattungssitten und soziale Identität .......................................................................................... 14312.1. Rituelle Handlungen und Objekte als Merkmale sozialer Identität .......................................................14312.2. Präfunerale Handlungen .......................................................................................................................14512.3. Funerale Handlungen ...........................................................................................................................146
12.3.1. Körperbehandlung ..................................................................................................................14612.3.1.1. Schichtung ................................................................................................................14612.3.1.2. Repräsentanz ............................................................................................................14912.3.1.3. Leichenbrandgewicht .................................................................................................15012.3.1.4. Primäre Kohlenstoffverfärbungen (PKV) .....................................................................15112.3.1.5. Fragmentgrößen ........................................................................................................15212.3.1.6. Beimengungen ..........................................................................................................15212.3.1.7. Scheiterhaufenreste ....................................................................................................15412.3.1.8. Zusammenfassung .....................................................................................................156
12.3.2. Anlage der Grabgrube .............................................................................................................15912.3.3. Urnen und Deckgefäße ...........................................................................................................161
12.3.3.1. Urnentypen ..............................................................................................................16112.3.3.2. Deckgefäße ...............................................................................................................16512.3.3.3. Visibilität .................................................................................................................167
12.3.4. Einzelne Beigefäße ..................................................................................................................16812.3.5. Gefäßsätze ...............................................................................................................................169
12.3.5.1. „Urnenferne“ und „urnennahe“ Gruppen ...................................................................16912.3.5.2. Urnenfelderzeitliche Gefäßsätze in Cottbus Alvensleben-Kaserne ..................................17112.3.5.3. Hallstattzeitliche Gefäßsätze ......................................................................................17512.3.5.4. Zusammenfassung .....................................................................................................177
12.3.6. Scherbenpackungen ................................................................................................................178
12.3.7. Fakultative Handlungen ..........................................................................................................17912.3.7.1. „Kenotaphe“ .............................................................................................................17912.3.7.2. Gefäßdepots ..............................................................................................................18212.3.7.3. Besondere Gefäßpositionierungen im Grab ..................................................................18312.3.7.4. „Seelenlöcher“ ...........................................................................................................18512.3.7.5. Zusammenfassung .....................................................................................................187
12.3.8. Schmuck- und andere Beigaben ..............................................................................................18812.3.8.1. Die Anthropomorphisierung der Urne ........................................................................19212.3.8.2. „Amulette“ ................................................................................................................19312.3.8.3. Nahrungsbeigaben ....................................................................................................197
12.4. Postfunerale Handlungen .....................................................................................................................19712.4.1. Grabmarkierungen ..................................................................................................................19812.4.2. Graböffnungen........................................................................................................................199
12.4.2.1. Nachgaben ...............................................................................................................19912.4.2.2. Grabraub .................................................................................................................201
12.4.3. Totenmahl, Fest und Opfer .....................................................................................................20312.5. Zusammenfassung ................................................................................................................................205
12.5.1. Die kanonische Behandlung des Körpers im Bestattungsritual ................................................20512.5.2. Die Errichtung der Gräber ......................................................................................................20612.5.3. Die Auswahl der Grabkeramik ................................................................................................20712.5.4. Das Aufkommen kanonischer Gefäßensembles in der Urnenfelderzeit ....................................20712.5.5. Nicht-kanonische Gefäßhandhabungen ..................................................................................20812.5.6. Die Bedeutung von Schmuckbeigaben als „Anthropomorphisierung“ der Urne und als
„magische Objekte“ .................................................................................................................20912.5.7. Postfunerale Handlungen ........................................................................................................210
13. Vom Ritual zu Alter und Geschlecht .............................................................................................. 21113.1. Interpretation von Handlungen und Ausstattungen .............................................................................211
13.1.1. Doppel- und Mehrfachbestattungen .......................................................................................21313.1.2. Nachbestattungen ...................................................................................................................21613.1.3. Ursachen für Mehrfach- und Nachbestattungen ......................................................................21913.1.4. „Mutter-Kind“-Bestattungen? .................................................................................................22013.1.5. Kinderbestattungen .................................................................................................................222
13.1.5.1. Kindersterblichkeit ....................................................................................................22213.1.5.2. Soziale Identität von Kindern ....................................................................................224
13.1.6. Erwachsenenbestattungen .......................................................................................................22713.1.6.1. Soziale Identität von Frauen ......................................................................................22713.1.6.2. Soziale Identität von Männern ..................................................................................229
13.2. Geschlechterdifferenz im Bestattungsritual ...........................................................................................23113.3. Zusammenfassung ................................................................................................................................232
14. Rückblick und Ausblick ................................................................................................................ 235
15. Literaturverzeichnis ...................................................................................................................... 241
16. Anhang .......................................................................................................................................... 26316.1. Abbildungsverzeichnis ..........................................................................................................................26316.2. Tabellenverzeichnis ...............................................................................................................................26516.3. Alters- und Geschlechtsangaben ..........................................................................................................26616.4. Glossar .................................................................................................................................................26716.5. Tabellen zur Anthropologie .................................................................................................................26816.6. Gräberfeldpläne ....................................................................................................................................273
17. Katalog .......................................................................................................................................... 27517.1 Anmerkungen .......................................................................................................................................27517.2 Abkürzungen .........................................................................................................................................27517.3 Katalog der Grabung „Urban und Partner GbR“ ...................................................................................27617.4 Katalog der Grabung „Wurzel Archäologie GmbH“ ..............................................................................38217.5 Katalog der Streufunde ..........................................................................................................................39617.6 Katalog der Grabung K. Rieken ............................................................................................................400
18. Tafeln ............................................................................................................................................. 405
Danksagung
Die vorliegende Untersuchung ist eine für den Druck überarbeitete Fassung meiner Dissertation. Sie resul-tiert aus dem Projekt „Herrschaft und Geschlechterdifferenz im 1. Jahrtausend v. Chr. – Spätbronzezeitliche Gesellschaften in der Niederlausitz (Brandenburg) aus Sicht der Genderforschung“ an der Professur für Ur- und Frühgeschichte des Historischen Seminars der Universität Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Sabine Rieckhoff. Das Projekt wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst finanziell gefördert. Meine Dissertation wurde am 5. August 2004 an der Fakultät für Geschichte, Kunst und Orientwissenschaften der Universität Leipzig eingereicht, begutachtet von Prof. Dr. S. Rieckhoff (Leipzig), Prof. Dr. F. Bertemes (Halle) und Prof. Dr. Chr. Strahm (Freiburg) und am 9. Mai 2005 verteidigt. Ab 2005 erschienene Literatur wurde nur noch zum Teil eingearbeitet.
Eine große Zahl an Menschen und Institutionen hat mich im Verlauf meiner Arbeit am Gräberfeld Cottbus Alvensleben-Kaserne auf die eine oder andere Weise unterstützt, und es ist mir ein Vergnügen, sie alle hier würdi-gen und ihre Hilfe honorieren zu können. Mein Dank gilt insbesondere:
Sabine Rieckhoff für ihre immer verständnisvolle, aufmunternde und sanft lotsende Betreuung der Arbeit im •Rahmen des Leipziger Forschungsprojekts;den Leipziger MitarbeiterInnen und StudentInnen für vielfältige Hilfen, insbesondere Barbara Dammers, •Felix Fleischer, Doreen Mölders, Caroline von Nicolai, Josefine Puppe, Katja Skrobanowski, Wolf-Rüdiger Teegen;Holger Grönwald, Berlin, fürs unermüdliche Zeichnen aller Funde und viele freundschaftliche Gespräche;•dem Archäologiebüro „Strackenbrock & Urban“ (heute „Urban & Partner“), als deren Angestellter ich das •Gräberfeld ausgraben durfte, für Unterstützung über meine aktive Zeit hinaus;der Bremer Stiftung für Kultur- und Sozialanthropologie, für eine Anschubfinanzierung;•Felix Bittmann, der am Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischem •Landesmuseum (BLDAM) die Pollenanalysen durchgeführt hat; am BLDAM besonders auch Markus Agthe, Eberhard Bönisch, Jürgen Kunow, Günter Wetzel und Franz Schopper für Rat und Unterstützung;Inge Wetzel, Stadtmuseum Cottbus, für Unterlagen der Grabung von Käthe Rieken; •dem Institut für Anthropologie der HU Berlin und dort besonders Herbert Ullrich und den StudentInnen •seines Leichenbrand-Kurses, die die Werkstattuntersuchung von sechs Urnen übernahmen; Hartmut Wischmann, der am Institut für Zoologie und Anthropologie, Historische Anthropologie und •Humanökologie, Universität Göttingen, probeweise einige Scherben auf Inhaltsstoffe untersuchte; Andreas Kronz vom Electron-microprobe Laboratory des Geowissenschaftlichen Zentrums der Universität •Göttingen für Untersuchungen auf Aufschmelzungen auf Leichenbrand;dem Fachbereich Restaurierung/Grabungstechnik der HTW Berlin unter Matthias Knaut, den dortigen •StudentInnen für Werkstattuntersuchungen und besonders Iris Hertel für zusätzliches Kleben von Keramik; ebenso der AFG mbH Calau und den dortigen ABM-Kräften fürs Keramikkleben; •den MitarbeiterInnen und ehemaligen KommilitonInnen des Instituts für Prähistorische Archäologie der •FU Berlin sowie den MitarbeiterInnen und StudentInnen des Lehrstuhls für Ur- und Frühgeschichte der HU Berlin, besonders Michael Meyer, der das Problem der Lagerung unzähliger Kisten voller Gefäße und Scherben löste; Ralf-Jürgen Prilloff, Farsleben, für die Archäozoologie;•Stefanie Feldmann für Satz und Layout dieses Bandes;•außerdem einer großen Zahl an FreundInnen und KollegInnen, die mit Literaturhinweisen, schwer zugäng-•lichen oder unveröffentlichten Arbeiten, langen Diskussionen, Anregungen, Korrekturlesen usw. eine un-ermessliche Hilfe leisteten, insbesondere: Philine Bach, Jonas Beran, Peter Biehl, Ursula Brosseder, Stefan Burmeister, Michael Dietler, Uta Halle, Anne Homann, Nils Müller-Scheeßel, Sabine Reinhold, Wiebke Rohrer, Germo Schmalfuß, Ulrike Sommer, Petra Weihermann, Anke Weinert, Marco Weiß, Samuel und Silke van Willigen, Marco Zabel und Gabriele Zipf; und Louis Nebelsick für sein Interesse an der Arbeit;
8
schließlich Birgit Großkopf für eine mehrjährige Zusammenarbeit, wie sie angenehmer und fruchtbarer kaum •sein könnte;und • last but not least: meiner Familie, und ganz besonders meiner Frau Elke Eisert für ihre bedingungslose Unterstützung.
Alle eventuellen Schwächen und Mängel liegen trotzdem oder gerade darum in meiner Verantwortung.
Freiburg, im April 2010 Alexander Gramsch
1. Einleitung
„Es ist eine eigenartige Wissenschaft: Gerade ihre eindrucksvollsten Erklärungen stehen auf dem unsichersten Grund, und der Versuch, mit dem vorhandenen Material weiter zu gelan-gen, führt nur dazu, daß der – eigene und fremde – Verdacht, man habe es nicht recht im Griff, immer stärker wird.“ (Geertz 1987, 41)
Was Clifford Geertz hier über die Ethnologie schreibt, haben auch viele Archäologinnen und Archäologen für ihr Fach empfunden oder beklagt. Besonders gern werden dabei die Vertreter der jeweils „anderen“ theoreti-schen oder methodologischen Ausrichtung beschuldigt, dass das vorhandene Material die – mehr oder weniger – eindrucksvolle Erklärung nicht rechtfertigen würde. Auf welchen Wegen Erklärungen oder Interpretationen prähistorischer Strukturen und Prozesse möglich sind, ist letztlich das grundlegende Thema der hier vorgelegten Arbeit. Es soll nicht behauptet werden, dass sie keine Fragen offen lässt. Und dennoch: Es ist wichtig, nicht nur das archäologische Material gründlichst zu erfassen, sondern auch neue Fragestellungen, Modelle und Metho-den zu entwickeln, um zu neuen, weiterführenden Antworten zu gelangen. Beides will ich mit dieser Arbeit unternehmen und damit noch immer bestehende Grenzen zwischen materialorientierten und theorieorientier-ten archäologischen Ansätzen überwinden. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass die Fragen und Ziele, die angewandten Theorien und Methoden nicht allein auf das hier vorgelegte Lausitzer Gräberfeld anzuwenden sind. Sie lassen sich ebenso mit anderem, vielleicht sogar geeigneterem Material umsetzen. Auch deshalb werden die Fragestellungen, Methoden und theoretischen Grundlagen ausführlich dargelegt und explizit diskutiert und mit derselben Strenge befragt wie das archäologische Material selbst. Welches Material und welche Fragen ste-hen nun im Zentrum der hier vorgelegten Untersuchung?
Mit dieser Publikation werden zum einen die Funde und Befunde des auf dem Areal der ehemaligen Gene-ral-von-Alvensleben-Kaserne in Cottbus (Brandenburg) gelegenen Gräberfeldes erstmals vollständig vorgestellt. Der Fundort liegt in der Niederlausitz und damit im Bereich der westlichen Lausitzer Kultur; er liefert wertvolle Ergänzungen zum bisher bekannten Spektrum von Bestattungssitten und zur materiellen Kultur dieser bronze- und eisenzeitlichen archäologischen Kultur1. Die Gräber, Keramikpackungen, Gefäßdepots u.ä., die von einer Bestattungsgemeinschaft im 12.-8. Jahrhundert v.Chr. angelegt worden sind, wurden im Rahmen eines For-schungsprojektes der Universität Leipzig ausgewertet. Ziel des Leipziger Projekts war jedoch nicht die chorolo-gische und chronologische Gliederung der Lausitzer Kultur. Vielmehr haben wir in interdisziplinärer archäolo-gisch-anthropologischer Zusammenarbeit die Quellen speziell nach der horizontalen Sozialstruktur der Bestat-tungsgemeinschaft befragt. Zu diesem Zweck wurde zum ersten Mal eine derartige Kombination verschiedener feld- und laborarchäologischer, anthropologischer und weiterer naturwissenschaftlicher Daten zu Bestattungsri-tualen erhoben, die Auskunft darüber geben konnten, wie durch rituelle Handlungen die horizontale Sozial-struktur durch Alters- und Geschlechterverhältnisse dargestellt wurde. Damit schließt diese Arbeit eine For-schungslücke im Bereich der Interpretation von Ritual und Sozialstruktur in den europäischen Metallzeiten.
Deshalb gliedert sich die Arbeit folgendermaßen: Nach der Diskussion der Fragestellungen und Ziele und der Forschungsgeschichte zur Lausitzer Kultur, auf der diese Arbeit aufbaut, werden die Daten aus den archäologi-schen, anthropologischen und chemischen Untersuchungen vorgelegt. Im Anschluss werden die Wege diskutiert, die zu einer adäquaten Interpretation dieser Daten und des komplexen Geschehens des prähistorischen Bestat-tungsrituals, aus dem sie resultieren, führen können. Denn für eine Analyse von rituellen Handlungen und Al-ters- und Geschlechterverhältnissen ist ein detailliertes und grundsätzliches Verständnis der Bedeutung von mate-rieller Kultur, Ritual und Sozialstruktur notwendig. Diese Begriffe und die hinter ihnen stehenden Konzepte werden ausführlich und allgemein besprochen, so dass sie nicht allein auf die Lausitzer Kultur anzuwenden sind. Danach werden die archäologisch und naturwissenschaftlich gewonnenen Daten unseres Gräberfelds
1 Siehe z.B. Bönisch (1990, 1996); Breddin (1993); Buck (1986a, 1997); Bukowski (1988); Bukowski/Gediga (1987);
Coblenz (1952, 1997); Ender (2000); Gedl (1979, 1991); Grünberg (1943); Nebelsick (1995); Parzinger (1993).
1. Einleitung10
mit Hilfe dieser theoretischen Begriffe und Konzeptionen analysiert und interpretiert und eine Antwort auf die Frage nach der Darstellung sozialer Identitäten im Bestattungsritual gegeben. Zusammenfassung, Anhang und zitierte Literatur bilden den Abschluss der Arbeit.
Wenn ich mich dabei nacheinander, vielleicht auch gleichzeitig, auf Autoren wie Arnold van Gennep (1986 [orig. 1909]), Marcel Mauss (1990 [orig. 1925]), Victor Turner (1967, 1989), Walter Burkert (1972, 1990), Clifford Geertz (1973, 1987), Anthony Giddens (1979, 1984), Jan Assmann (1988, 1991), Jürgen Habermas (1968, 1981a, 1981b), Catherine Bell (1992) und andere berufe (s. besonders Kap. 11), deren theoretische Heimat oft eine ganz verschiedenartige ist, mag das eklektizistisch erscheinen. Dennoch halte ich dieses Vorgehen für gerechtfertigt, ja notwendig. Da die Prähistorie ihr Material nicht „aus sich heraus erklären“ kann, bedarf sie, wie auch die Historie, der Hilfe der Kultur- und Sozialwissenschaften – einschließlich Ethnologie, poli-tischer Ökonomie etc. Denn es gibt keine historischen, sondern nur soziologische Erklärungen, so wie es in der Astronomie nur physikalische und keine astronomischen Erklärungen gibt (Veyne 1988, 7f.; s.a. Gramsch 2000a, 157). Zum anderen gibt es auch keine Kultur- oder Sozialwissenschaftler, Ethnologen oder Philosophen, die ernsthaft von sich behaupten würden, die eine, umfassende, universelle „theory of everything“ entwickelt zu haben (vgl. Geertz 1987, 7f.).
Werden im Folgenden Beispiele aus anderen geographischen und zeitlichen Kontexten herangezogen, insbe-sondere um auf Basis ethnographischer Daten gewonnene Modelle nutzbar zu machen, ist dies keine Angleichung von prähistorischen „Mitteleuropäern“ an vorindustrielle „Außereuropäer“. Vielmehr geht es darum, zu abstrahie-ren und Strukturen zu erkennen, die als Modelle auch für prähistorische Gesellschaften Erklärungswert besitzen (s.a. Flaig 2003).
Vergleiche und Analogiebildungen sind eine notwendige archäologische Methode (Gramsch 1996; 2000b; in Vorb.) – auch wenn der Althistoriker Egon Flaig (2003, 39) besorgt fragt: „Aber woher den Mut nehmen, das Verhalten römischer Gruppen neben das von melanesischen Clans zu stellen?“. Er selbst bringt diesen Mut auf und zieht, Mauss und Bourdieu folgend, interkulturelle Vergleiche. Denn es ist nicht zum Schaden, sondern zum Nutzen der archäologischen Interpretation, verschiedene, sich ergänzende Positionen einnehmen und Modelle nutzen zu können, um nichts Geringeres zu erreichen als ein Verständnis für eine uns völlig fremde prähistorische Lebens- und Geisteswelt.
Fragestellungen und Ziele2.
„Jedermann weiß, daß die Bestattungsriten bei verschiedenen Völkern sehr unterschiedlich und so-wohl vom Alter als auch vom Geschlecht und der sozialen Position des Verstorbenen abhängig sind.“ (van Gennep 1986, 142)
Mit diesen Worten leitet Arnold van Gennep das Kapitel über Bestattung in seinem 1909 veröffentlichten Buch Übergangsriten ein und fährt fort: „Doch kann man in der außergewöhnlichen Vielfalt der Einzelheiten bestimm-te Grundzüge entdecken, von denen ich hier einige der Kategorie der Übergangsriten zuordnen werde“ (ebd., 142f.). Auch in der hier vorgelegten Arbeit werden Bestattungen als Übergangsrituale verstanden. Deshalb sollen über die vielfältigen Einzelheiten hinaus Grundzüge dieses Übergangsrituals rekonstruiert werden mit dem Ziel, seinen Zusammenhang mit Alter, Geschlecht und sozialer Position der Verstorbenen zu erschließen. Eine sol-che Interpretation zielt auf die soziale, nicht die religiöse Bedeutung des Bestattungsrituals. Religionshistorische Fragen nach dem Pantheon bronzezeitlicher Gesellschaften, nach der metaphysischen Weltsicht, mit der die Rituale motiviert worden sind, oder nach der Verehrung von Ahnen als Göttern oder Heroen stehen abseits der hier interessierenden Probleme.
Im Mittelpunkt steht das Gräberfeld der Lausitzer Kultur von Cottbus Alvensleben-Kaserne (Abb. 2.1.). Alle hier bestatteten Individuen wurden verbrannt und in der überwiegenden Mehrzahl in Urnen beigesetzt. Anhand der archäologischen und anthropologischen Analysen sollen soziologische und kulturgeschichtliche Fragen be-antwortet werden. Ausgangspunkt ist die These, dass das Ritual ein Medium der Kommunikation über soziale Identitäten in einer Gemeinschaft ist.
Sowohl in der traditionellen Gräberfeldarchäologie als auch in sozialhistorisch oder durch die Genderforschung inspirierten Forschungsansätzen sind Fragen nach der Sozialstruktur antiker Gesellschaften nicht neu. Untersuchungen zum Status bestimmter Personengruppen konzentrieren sich jedoch meist auf Hierarchien. Zudem steht in der Gräberfeldarchäologie die Analyse von Grabbeigaben im Vordergrund, die als Indikatoren sozialer Ränge (z.B. Burmeister 2000) oder von Geschlechterrollen oder -beziehungen verstanden werden (z.B. Strömberg 1993, 1998; Reinhold 2005; Arnold 1995; kritisch hierzu s. Owen 1997, Kleibscheidel 1997). Dementsprechend wünscht man sich einen Grabbefund „ungestört und beigabenführend“ (Ament 1992, 6). Vernachlässigt wird bei derartigen Ansätzen, dass Gräber weniger eine Kollektion von Objekten als viel mehr Resultat einer Reihe komplexer Handlungen sind. Darum unterscheiden sich die hier formulierten Ziele in zweierlei Hinsicht von den genannten Ansätzen: Zum einen wird nicht versucht, aus der Beigaben-Qualität und -Kombination auf Sozialstrukturen rückzuschließen, zum anderen steht nicht eine mögliche hierarchische Abfolge sozialer Schichten im Mittelpunkt, also die Rekonstruktion vertikaler Sozialstrukturen. Vielmehr soll die kontextuelle Analyse der rituellen Praxis zeigen, wie soziale Identitäten, also horizontale Sozialstrukturen, im Bestattungsritual durch Handlungen dargestellt werden (vgl. Hodder 1991). Diese rituellen Handlungen werden als eine Form der Kommunikation verstanden (vgl. Habermas 1981a, 1981b), die eine soziale Funktion erfüllt.
Diese Arbeit erweitert damit das überwiegend auf Macht und Status gerichtete Spektrum der Themen in der Gräberfeldarchäologie: Gefragt wird nach horizontalen sozialen Strukturen, nach Individualität und sozialer Identität, nach deren Konstruktion und Transformation durch soziale Handlungen.
Die soziale Identität der hier bestatteten Individuen wird vor allem durch ihre Zugehörigkeit zu Alters- und Geschlechtsgruppen bestimmt. Deshalb stehen Alter und Geschlecht als Identitätscharakteristika im Vordergrund. Dazu muss zwischen biologischem und sozialem Geschlecht unterschieden und die Diskussion zur Genderforschung aufgegriffen werden (s. z.B. Wesely 2000).
Archäologie sei stark androzentrisch geprägt, betrachte die Prähistorie aus männlicher Sicht und produziere dadurch nur verzerrte Rekonstruktionen vergangener Lebenswelten – dies jedenfalls ist die Position feministisch inspirierter Genderstudien in der Archäologie (Conkey/Spector 1984). Es ist jedoch nicht das Ziel dieser Arbeit, die Berechtigung feministische Kritik an der (traditionellen wie postmodernen) Archäologie zu überprüfen. Ihre Genderorientierung liegt vielmehr in ihrem Ziel, die Darstellung der sozialen Identität und damit auch des sozialen
2. Fragestellungen und Ziele12
Geschlechts eines Individuums im Ritual zu erfassen. Deshalb werden mögliche in der rituellen Kommunikation dargestellte Geschlechterdifferenzen untersucht wie auch mögliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
Notwendig erscheint mir also, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften seit den 1970er Jahren geführte und auch in der deutschsprachigen Archäologie bereits gelegentlich umgesetzte Diskussion um Gender (Brandt 1996, Derks 1997, Karlisch/Kästner/Mertens 1997, Bernbeck 2000) und soziale Identität in die stark mit so-zialen Fragen beschäftigte Metallzeitforschung einzuführen. Genderarchäologie wird demnach nicht allein als Sichtbarmachung von Frauen in der Prähistorie verstanden, sondern als „Frauen- und Männerarchäologie“ (s. Gramsch/Großkopf 2005), so wie heute Geschlechtergeschichte ebenso als Männer- wie Frauengeschichte ver-standen wird (z.B. Kühne 1996).
Die erste Aufgabe, die diese Arbeit erfüllen muss, um die rituelle Kommunikation über soziale Identitäten zu erfassen, ist die detaillierte Beschreibung des Bestattungsrituals, also des Handlungsablaufs vom Tod des Individuums bzw. der Individuen bis zum (letztmaligen) Verschluss des Grabes, soweit dieser Ablauf archäologisch und anthropologisch erfassbare Spuren hinterlassen hat. Wenn die daraus rekonstruierten rituellen Handlungen mit unterschiedlichen Alters- und Geschlechtergruppen korreliert werden können, sind Rückschlüsse auf so-ziale Identitäten möglich. Voraussetzungen dafür sind eine explizite Auseinandersetzung mit den angewandten Begriffen, Konzepten und theoretischen Grundlagen, die Einbeziehung aller vorliegenden Gräber und vor allem die anthropologische Alters- und Geschlechtsbestimmung.
Ein solches Vorgehen bedeutet, die archäologischen und anthropologischen Gräberfelddaten nicht als „Spiegel des Lebens“ (Haffner 1989) zu sehen (vgl. Burmeister 2000), sondern sie als Resultat von Handlungen zu begreifen, durch die soziale Strukturen und soziale Identitäten dargestellt und hergestellt werden. Diese ri-tuellen Handlungen differenziere ich mit Hilfe des van Gennep’schen Konzepts der Übergangsriten, so dass sie in eine Abfolge von präfuneralen, funeralen und postfuneralen Praktiken gebracht werden können. Präfunerale Handlungen umfassen jene, die vor der Leichenverbrennung durchgeführt wurden und der Abtrennung von Leichnam und Trauergemeinschaft von der profanen Lebenswelt dienen; funeral sind die Umwandlungsriten, also die Verbrennung selbst, die eigentliche Bestattung der menschlichen Überreste, die Beigabe von Gefäßen und Schmuck usw.; mit den postfuneralen Handlungen werden vom Verschluss der Grabgrube bis zu möglichen nachträglichen Graböffnungen stattfindende re-integrative Rituale erfasst.
Um Unterschiede in der Darstellung von sozialen Geschlechtern und Altersklassen zu erkennen, werden in dieser Arbeit nicht allein die rekonstruierten rituellen Handlungen genutzt, sondern auch die Beigaben. Sie wer-den nicht als statusmarkierende Objekte, sondern als Teil eines Handlungsablaufs verstanden und als solche in die Untersuchung zur horizontalen Sozialstruktur einbezogen. Im Mittelpunkt steht also die Funktion des Rituals und der involvierten Gegenstände als Mittel der Darstellung und Gestaltung sozialer Strukturen. Ritual und Religion werden damit im Sinne Emile Durkheims (1981) rationale Funktionen zuerkannt (vgl. Streck 1998, 51f.).
Abb. 2.1.: Die General-von-Alvensleben-Kaserne in Cottbus, Brandenburg, während der Ausgrabung 1997, Blick von Süden auf die Gebäude 15, 16 und 1 (v. li., s.a. Abb. 4.2.).
2. Fragestellungen und Ziele 13
Räumlich konzentriert sich die Arbeit auf die sächsisch-lausitzische Gruppe der Lausitzer Kultur und hier besonders auf die Niederlausitz (Abb. 2.2.), d.h. sie geht sozusagen induktiv vor; vom Einzelfall des Gräberfelds Cottbus Alvensleben-Kaserne ausgehend richtet sich der Blick auf den weiteren westoderischen Bereich. Gelegentlich werden auch Vergleiche mit Beispielen aus den östlichen Gruppen in Kleinpolen, Oberschlesien und Böhmen gezogen. Grundsätzlich wird jedoch nicht, wie so häufig in der traditionellen Archäologie, auf die gesamte „archäologische Kultur“ fokussiert (vgl. Wotzka 1993, Czerniak 1996; Brather/Wotzka 2006), sondern auf eine lokale Bestattungsgemeinschaft, eine kleinräumige Identitätsgruppe (vgl. Barth 1969; Sommer 2003) und deren Verständnis von Ritual und Gemeinschaft.
Durch diese Herangehensweise rücken andere Fragestellungen eher an den Rand. So ist es nicht das Ziel dieser Arbeit, ungeklärte Fragen zur Homogenität der Lausitzer Kultur an sich zu beantworten (z.B. Bukowski/Gediga 1987), deren äußere Grenzen oder innere Gliederung zu definieren, oder ihre unterschiedlichen regiona-len Chronologien zu vereinheitlichen. Zeitlich liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der späten Bronze- und frühen Eisenzeit, doch soll über den Beginn und das Ende der Lausitzer Kultur in dieser Arbeit nicht spekuliert werden, zumal die Belegung des Gräberfelds Cottbus Alvensleben-Kaserne erst im Verlauf der Lausitzer Kultur einsetzt und bereits vor deren Ausklang endet (s. Kaiser 2002).
Zudem will diese Arbeit zeigen, dass nicht nur vollständig ausgegrabene Gräberfelder Aussagen zu sozialge-schichtlichen Fragestellungen ermöglichen. Zwar sind die Möglichkeiten der Sozialanalyse eingeschränkter, wenn nicht die gesamte bestattete Population erfasst werden kann, aber dennoch lassen sich die rituelle Kommunikation
Abb. 2.2.: Spätbronzezeitliche Regionalgruppen der Lausitzer Kultur mit Lage des Fundplatzes Cottbus Alvensleben-Kaserne (Stern; nach Reichel 2000, 23).
2. Fragestellungen und Ziele14
und die unterschiedliche Darstellungen sozialer Rollen feststellen. Darüber hinaus wird deutlich werden, dass nicht nur mit Hilfe von beigabenführenden Gräbern soziale Beziehungen untersucht werden können. Auch ein „metallarmes“ Gräberfeld wie das von Cottbus Alvensleben-Kaserne enthält so viele Informationen, dass sich eine Sozialanalyse lohnt. Es gilt nur, diese Informationen zu erschließen. Dazu gehört neben einer Fülle archäologi-scher Beobachtungen, die die detaillierte Auswertung von Grabungsdaten liefern kann, auch der Leichenbrand als archäologisches Material. Weit über die Geschlechts- und Altersbestimmung hinaus ist er eine reiche kul-turhistorische Quelle (Großkopf/Gramsch 2004, 2007). Seiner Bergung, Bestimmung und Auswertung wurde deshalb besondere, interdisziplinäre Aufmerksamkeit gewidmet, die neue Erkenntnisse zur Kremation und zur anschließenden Behandlung der verbrannten Reste ermöglichte. Der Umgang mit dem verstorbenen Individuum im Bestattungsritual bildet den roten Faden dieser Arbeit.
Über die soziale Bedeutung von Bestattungsritualen hinaus werden Themen angesprochen, die gerade in den Metallzeiten häufig diskutiert werden, wie „Grabraub“, „Kenotaph“, Gefäßdepot und andere Befunde, die als Zeichen „kultischer Handlungen“ verstanden werden (vgl. Kossack 1996, Buck 1996). So hätte diese Arbeit auch unter den traditionelleren Titel „Beiträge zum Kultgeschehen in der Lausitzer Kultur“, gestellt werden können, doch steht weniger der Kult als die Kommunikation, weniger das Religiöse als das Soziale im Vordergrund.
In den letzten Jahren lässt sich in den Kulturwissenschaften ein neues Interesse am Rituellen als einer Ordnungskategorie des Wandels und zugleich des Beharrens, des kanonisierten Handelns und zugleich des Mittels zur oder Ausdrucks sozialer Veränderung beobachten (Bell 1992; Harth/Schenk 2004; Köpping/Rao 2000; Michaels 2007; Schäfer/Wimmer 1998). Rituale werden bei Rockern ebenso beobachtet wie im Alltagsleben (vgl. Zipf 2003). Und auch in der Archäologie sind sie ein wiederkehrendes Thema (jüngst z.B. Biehl/Bertemes 2001; Metzner-Nebelsick 2003; Kyriakidis 2007). So steht diese Arbeit in einem weitgespannten kulturwissenschaftli-chen Kontext und soll dementsprechend auch ein Beitrag sein zu einem breiteren Verständnis von Ritualen und deren gesellschaftlicher, kultureller und historischer Bedeutung.
Abschließend spreche ich in dieser Arbeit bisherige Interpretationen von Gräberfeldanalysen an, besonders im Hinblick auf die ihnen zugrunde liegenden, oft impliziten Gendermodelle. Über die auf die spätbronze- und früheisenzeitliche Lausitzer Kultur begrenzten Aussagen hinaus sollen damit Wege für eine sozialgeschichtliche Forschung der prähistorischen Archäologie aufgezeigt werden. Ziel jeder wissenschaftlichen Arbeit sollte sein, nicht der Vorlage des Materials, sondern der Interpretation der Daten Priorität zu geben. In diesem Sinne muss auch die prähistorische Archäologie – als eine besondere, überwiegend auf materieller Kultur beruhende Art der Geschichtsschreibung (s. Eggert 2006, 197ff.) – eine interpretierende Wissenschaft sein. Ergebnis archäologischer Forschung ist nicht das Aufstellen von Typologien, die Identifikation archäologischer „Kulturen“ oder deren chronologische Einordnung, sondern Geschichtsschreibung aus soziokultureller, ökonomischer, politischer, tech-nologischer etc. Perspektive. Die vorliegende Arbeit wurde aus einer soziokulturellen Perspektive geschrieben.
Rückblick und Ausblick14.
„Im Einzelgrabe ruht ein Moment, im Gräberfelde mit seiner lokalen Umgebung eine Summe von Momenten, die Geschichte von zusammengehörenden Generationen.“ (Rieken 1909, 224)
In der hier vorgelegten Arbeit geht es um zweierlei: einerseits um die Vorlage eines Gräberfeldes der späten Bronze- und frühen Eisenzeit, die Bestimmung der Befunde und Funde und deren chronologische Einordnung; andererseits um eine sozialgeschichtliche Interpretation prähistorischer Bestattungssitten – um „die Geschichte von zusammengehörenden Generationen“, wie sie sich aus rituellen Handlungen erschließen lässt. Durch die-se beiden Ziele ist die Arbeit zugleich Teil der Gräberfeldarchäologie und Teil der Anstrengungen, aus dem Forschungsmaterial, das der Prähistorischen Archäologie vorliegt – der materiellen Kultur vorgeschichtlicher Gesellschaften –, Kultur- und Sozialgeschichte zu schreiben. Es ist eine problemorientierte und materialbasierte Arbeit, da Geschichte nicht aus dem Material selbst heraus, sondern nur mit Hilfe von klaren Fragestellungen und dafür erarbeiteten Modellen und Konzepten geschrieben werden kann.
In der Gräberfeldarchäologie werden Gräber noch immer vor allem als Ansammlung von Objekten gese-hen, aus deren Kombination auf Hierarchien, d.h. auf vertikale Sozialstrukturen geschlossen wird. Stehen der Gräberfeldarchäologie Urnengräber zur Verfügung, wird Leichenbrand nur zur Alters- und Geschlechtsbestimmung, nicht jedoch als kulturhistorische Quelle genutzt (s. z.B. die Beiträge in Fasold et al. 1998). Ein anderer Weg wird hier beschritten. Ansätzen in Kulturanthropologie und Ethnologie folgend wird auch der Körper als sozio-kulturell und historisch konstruiert aufgefasst. In den Mittelpunkt der Auswertung rücken soziale Beziehungen zwischen Akteuren und die Transformation sozialer Identität durch rituelle Handlungen. Im folgenden sollen nun die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und ein kurzer Ausblick auf mögliche oder notwendige weitere Forschungsschritte, offene Fragen und weiterführende, in den voran gegangenen Abschnitten nur angeschnittene Probleme gegeben werden.
Die Toten des Gräberfelds Cottbus Alvensleben-Kaserne sind alle verbrannt und überwiegend in Urnen beige-setzt worden. Alle geborgenen Leichenbrände wurden anthropologisch untersucht. Jedoch wurden nicht nur Alter und Geschlecht der einzelnen Individuen bestimmt. Eine innovative Untersuchung der menschlichen Überreste eröffnet darüber hinaus neue Möglichkeiten, zu Aussagen über die Körperbehandlung im Bestattungsritual zu ge-langen: Der Leichenbrand wurde schichtweise aus den Urnen entnommen und nach Schichten getrennt untersucht. Daten zur Repräsentanz der überlieferten Knochen, ihrer Lage in der Urne usw. wurden erhoben, um die Praxis des Bestattungsrituals zu rekonstruieren. Diese kleinschrittige und interdisziplinär durchgeführte Untersuchung ergab zahlreiche Informationen zu verschiedenen Handlungen wie der Einbringung von Knochen und Beigaben in die Urnen. Die Rekonstruktion des prähistorischen Bestattungsrituals ist jedoch kein Selbstzweck. Die Analyse der sozialen Bedeutung dieser Handlungen ist das eigentliche Ziel dieser Arbeit. Die zentrale Frage lautet, wie die Gemeinschaft soziale Identitäten und Beziehungen im Ritual darstellt. Die „Ahnwerdung“ der Verstorbenen wird demnach als sozialer Prozess verstanden. Dieser Ansatz eröffnet der Gräberfeldarchäologie neue Forschungsfelder, die das Spektrum möglicher problemorientierter Arbeiten erweitern:
die Frage nach der sozialen Identität von Individuen, die durch das soziale Geschlecht (Gender) und das •soziale Alter geprägt werden; die Frage nach der Präsentation und Transformation dieser Identität durch kommunikative Handlungen;•die Frage nach den sozialen Wirkungen von Ritualen statt nach „dahinter“ vermutetem (irrationalen?) •prähistorischen Denken;die Rolle der materiellen Kultur – sowohl von Objekten als Gaben im Mauss‘schen Sinne als auch von •Grabarchitektur – bei der Manifestation und Manipulation von sozialen Identitäten und Beziehungen im Ritual;Grab und Leichnam oder Urne nicht als Ausdruck von Hierarchien, sondern als Resultat von •Körperinszenierungen; ein Verständnis des Körpers nicht als gegebene und unveränderbare natürliche Einheit, sondern als sozi-•ales Konstrukt und soziales Bild;
14. Rückblick und Ausblick236
eine Kulturgeschichte der Auseinandersetzung mit Körperlichkeit und der Versuche, die Kontrolle über •Prozesse der Körpertransformation (z.B. Kremation vs. Verwesung) zu gewinnen.
Diese Forschungsfelder können jedoch nur bearbeitet werden, wenn die zugrunde gelegten Begriffe und Konzepte explizit erläutert und kulturanthropologisch verankert werden. Gräber sind, so das Credo dieser Arbeit, kein statisches Bild, aus dem soziale Verhältnisse direkt abzulesen wären, vielmehr werden sie als Resultat kom-plexer Handlungen aufgefasst. Diese Handlungen sind symbolisch, da sie eine über ihre „eigentliche“ Funktion hinausgehende soziale Wirkung besitzen. Und sie sind kommunikativ im Sinne der Habermas’schen verstän-digungsorientierten Kommunikation. Kommuniziert wird im Ritual über richtiges soziales Verhalten ebenso wie über soziale Strukturen und Identitäten. Durch die Transformation der Toten in der Kremation, durch das Aushändigen von Gaben und durch wiederholte Praktiken bei der Bestattung und am Grab werden sowohl die Charakteristika der sozialen Identität der Toten als auch die Beziehungen zwischen Toten und verschiedenen an-deren sozialen Akteuren dargestellt und umgewandelt.
Da die Bestattung ein Übergangsritual nach van Gennep ist, lassen sich die rituellen Handlungen anhand der drei von ihm festgestellten Stufen gliedern in eine (ideale) Abfolge von präfuneralen, funeralen und post-funeralen Handlungen. Präfunerale Handlungen dienen der Separation, d.h. der Abtrennung von Leichnam und Trauergemeinschaft von ihrem sozialen Umfeld; die funeralen Handlungen kennzeichnen die Phase der Liminalität und somit der Umwandlung sowohl des Körpers der oder des Verstorbenen als auch ihrer oder seiner sozialen Identität; die abschließenden postfuneralen Handlungen charakterisieren die Reintegration, die das ver-storbene Individuum in den neuen Status als „Ahne“ einführt.
Die Analyse des Materials aus Cottbus Alvensleben-Kaserne wird, der Dreistuflgkeit der Übergangsriten entsprechend, getrennt für präfunerale, funerale und postfunerale Handlungen durchgeführt. Die präfunera-len Handlungen umfassen zum einen zahlreiche archäologisch nicht fassbare Rituale, die der Vorbereitung des Leichnams und des Verbrennungsplatzes gelten, zum anderen die Errichtung des Scheiterhaufens selbst. Zu Brandplätzen liegen keine archäologischen Befunde vor. Jedoch lässt sich aus der Untersuchung der Anordnung der Knochen in der Urne, ihres Verbrennungsgrades und ihrer Repräsentanz ermitteln, dass der Leichnam ausgestreckt auf den Scheiterhaufen gelegt und verbrannt worden ist. Zudem lässt sich erschließen, dass der Scheiterhaufen in der Regel in hinreichender Größe aufgeschichtet worden war, um den Körper ausgestreckt liegend aufzunehmen und vollständig zu verbrennen.
Mit Beginn der Kremation endet die Phase der Separation und der Übergang wird eingeleitet. Die nun einset-zende funerale Phase umfasst die meisten archäologisch und anthropologisch erfassbaren Handlungen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Handlungen im Zusammenhang mit der Leichenverbrennung und der Beisetzung des Leichenbrands, die den zentralen Teil der funeralen Handlungen darstellen. Als funerale Handlung wird auch die Auswahl und Zusammenstellung der Grabkeramik, also sowohl von Urnen und Deckschalen als auch von einzelnen oder zu Ensembles zusammengestellten Beigefäßen, verstanden. Auch die Art der Positionierung von Gefäßen oder Manipulationen an Gefäßen können hier einbezogen werden. Zu fragen ist, ob sich ein Kanon ritu-eller Handlungen erkennen lässt, welche Handlungen fakultativ sind, und in wieweit Abweichungen Rückschlüsse über die soziale Identität der oder des Bestatteten zulassen.
Die postfuneralen Handlungen setzen mit dem Verschließen der Grabgrube ein, die den Beginn der Reintegration der Verstorbenen in einen neuen sozialen Status darstellt. Postfuneral sind auch nachträgliche Graböffnungen oder andere Handlungen am Grab, insbesondere Gefäßniederlegungen oder öffentliche Feste, die wiederum als Handlungen mit sozialer Wirkung verstanden werden. Auch das Problem möglichen Grabraubs muss hier besprochen werden. Solche und ähnliche Spuren, die auf das wiederholte Aufsuchen des Grabes hin-weisen, ließen sich in Cottbus vor allem bei Mehrfachbestattungen beobachten.
Der Schwerpunkt der Analyse lag auf den funeralen Handlungen, die mit archäologischen und anthropologi-schen Mitteln am besten zu erfassen sind, die aber zudem den zentralen Teil der rituellen Kommunikation darstel-len. Wie erwähnt bildet hier die interdisziplinäre Untersuchung des Leichenbrands einen wesentlichen Bestandteil und lieferte zahlreiche neue Erkenntnisse. Kossack hatte bei der Frage nach Totenfolge und der Behandlung der Individuen besonders in Mehrfachbestattungen noch beanstandet, „ob jedes einzelne vollständig oder nur in Teilen [verbrannt und beigesetzt wurde,] blieb gewöhnlich offen“ (Kossack 1999b, 159). Durch die interdiszi-plinäre Arbeit des Leipziger „Gender-Projekts“ kann nun sowohl über die Totenfolge als auch die Behandlung der Individuen bei und nach der Kremation mehr gesagt werden. Durch die erstmals systematisch durchgeführte
14. Rückblick und Ausblick 237
schichtweise Entnahme und Untersuchung des Leichenbrands aus allen en bloc geborgenen Urnen stehen zahlreiche neue Erkenntnisse zur Verfügung:
In der Regel wurde jedes Individuum einzeln bestattet. •Der vollständige Körper wurde ausgestreckt liegend verbrannt. •Der Scheiterhaufen brannte herunter und konnte soweit auskühlen, dass die verbrannten Knochen bei der •Bergung nicht zersprangen. Ein Ablöschen des Scheiterhaufens kann ausgeschlossen werden, da zum einen die saubere Trennung von •Knochen und Asche nicht möglich gewesen wäre und zum anderen die Knochen dabei stärker fragmen-tiert worden wären.Aufgrund der überlieferten Fragmentgröße kann zudem ein alters- bzw. geschlechtsabhängiges Zerkleinern •der Brandreste vor Einfüllung in die Urne ausgeschlossen werden. Der Leichenbrand wurde sorgfältig in die Urne geschichtet, bei den unteren Extremitäten beginnend und •beim Schädel endend, wobei gelegentlich der anatomischen Verband imitiert oder Knochenpaare zuein-ander gelegt wurden.
Das Recht auf diese Art der Körperbehandlung stand jedem verstorbenen Individuum zu, unabhängig von Alter und Geschlecht, ebenso das Recht, einzeln verbrannt und in einer eigenen Urne bestattet zu werden. Nur vereinzelt wurde von dieser Regel Abstand genommen, um Kinder gemeinsam in einer Urne beizusetzen, seltener auch Frauen mit Kindern oder zwei Erwachsene. Damit kann die Urne bereits in der Urnenfelderzeit als anthro-pomorph aufgefasste Manifestation der bzw. des Verstorbenen interpretiert werden. Sie symbolisiert den wieder hergestellten menschlichen Körper, jedoch nicht in individueller Ausprägung, wie die standardisierte Auswahl von Urnen und Deckschalen zeigt.
Erwachsene wurden, unabhängig von Alter und Geschlecht, ganz überwiegend in Kegelhalsgefäßen bestattet. Abweichungen von dieser Regel flnden sich bei Männern etwas häuflger als bei Frauen. Kinder erhielten meist ein deutlich kleineres Gefäß als Urne, das zudem häuflg kein Kegelhalsgefäß, sondern ein gehenkeltes Gefäß ist – kleine zweihenkelige „Ösenhenkelterrinen“ und Tassen. Aber auch Gefäßunterteile flnden als Kinderurnen Verwendung, nie jedoch als Erwachsenenurnen. Die kleinen Gefäßformen wurden meist für Neugeborene und Kleinstkinder ausgewählt, während größere Kinder häuflger größere Formen, z.B. Eitöpfe, als Urnen erhielten. So konnten Urnen für verstorbene Kinder aus einem deutlich größeren Formenspektrum ausgewählt werden als solche für Erwachsene. Urnenabdeckungen wurden offensichtlich der Größe der Urnen gemäß ausgewählt. Eine deutliche Zuordnung von Schalentypen zu Geschlechtern oder Altersklassen ist nicht zu erkennen, doch scheinen die selten verwendeten Turbanrandschalen Männern und Kerbrandschalen Frauen zugeordnet zu sein. Insgesamt flnden sich verzierte Deckschalen deutlich häuflger als Verschlüsse von Frauen- als von Männerurnen. Kleine Kinderurnen wurden meist von Omphalosschalen, selten auch Gefäßunterteilen oder Scherben abgedeckt. In der Hallstattzeit wurden nahezu alle Urnen mit gleichartigen einfachen Schalen mit einbiegendem Rand verschlossen, so dass auch die Deckschalenformen deutlicher standardisiert wurden.
Diese Erkenntnis muss betont werden: Die für die Eisenzeit anhand von Gewandnadeln auf der Urnenschulter festgestellte Anthropomorphisierung der Urne hat ihren Ursprung in der urnenfelderzeitlichen Sitte der anato-misch geordneten Schichtung. Diese Einsicht ermöglicht uns auch, in den auf die eingeschichteten Leichenbrände gelegten Bronzeringen und -nadeln nicht nur die erhöhte Visibilität beigegebenen Schmucks, sondern auch hier die möglicherweise bereits bestehende Anthropomorphisierung durch Tuch und Halterung zu sehen. Nadeln können ebenso wie Ringe als Verschluss eines Tuches interpretiert werden, in den der Leichenbrand geschichtet und mit dem er in die Urne eingebracht wurde. Die hallstattzeitliche Sitte, ein Tuch um die Urne zu legen und auf der Gefäßschulter mit einer Nadel zu verschließen, ließ sich ebenfalls in Cottbus Alvensleben-Kaserne beobach-ten. Auch hier zeigt sich, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen „menschengestaltig“ beigesetzt werden.
Als wichtiges Ergebnis der Untersuchung muss demnach herausgestellt werden, dass die Art der Körperbehandlung unabhängig von Alter und Geschlecht der Verstorbenen ist. Sie wird im spätbronze- und wohl auch früheisenzeitlichen Bestattungsritual kanonisch durchgeführt.
Wenige Gräber enthielten mehrere Beigefäße, die auf mögliche Geschirrsätze hinweisen. Diese werden mit Gefäßzusammenstellungen verglichen, die bei den größeren Gräberfeldern der westlichen Lausitzer Kultur als regelhafte Ensembles herausgestellt wurden. Es lässt sich ein Set aus Schöpf- und Trinkgefäßen erkennen, d.h. ein Krug mit zwei oder mehr Omphalosschalen, gehenkelten Omphalosschalen oder Tassen, das häuflger in Gräbern mit mehreren Urnen niedergelegt wurde. Dieses Trinkgeschirr ist aus hallstattzeitlichem Kontext bekannt, wo es mit ritualisierten Trinkgelagen in Verbindung gebracht wird, tritt in Cottbus Alvensleben-Kaserne aber bereits in
14. Rückblick und Ausblick238
den urnenfelderzeitlichen Rechteckgräbern auf. Teilweise wurde es nachträglich auf oder in das Grab gelegt, so dass es sowohl während der funeralen als auch der postfuneralen Phase zum Einsatz kam. Es scheint deshalb auf Gemeinschaft stiftende und Spannungen abbauende öffentliche Feste zu verweisen und auf die Gabe als Mittel, soziale Beziehungen dar- oder herzustellen. Ein weiteres Set kombiniert eine „Ösenhenkelterrine“, z.T. auch einen Zweihenkeltopf oder ein henkelloses Kegelhalsgefäß, mit zwei Schöpf-/Trinkgefäßen. Hier stellt das größere, oft zweihenkelige Gefäß möglicherweise einen Behälter dar. Eine hallstattzeitliche „urnenferne“ Gefäßgruppe aus Großgefäßen, Ofenmodell und Tonscheibe etc. fehlt dagegen in Cottbus Alvensleben-Kaserne ganz.
Beachtung wird auch Handlungen geschenkt, die anhand der besonderen Positionierung von Keramik zu erkennen und nicht kanonisch sind. Diese als „fakultativ“ bezeichneten Handlungen führten zu Kegelhals- und anderen behälterartigen Gefäßen, die mit Schalen verschlossen wurden, aber keinen Leichenbrand enthielten. Sie können als „symbolisch Urne“ aufgefasst werden, durch die eine „Doppelung“ oder „Spiegelung“ der Bestattung erreicht wird. Fakultativ sind auch sogenannte Gefäßdepots, die als außerhalb der Gräber abgestellte Gruppen vollständiger Gefäße auffallen, aber auch innerhalb der Gräber niedergelegt wurden. Auf der Mündung und z.T. oberhalb der Grabgefäße abgestellte Gefäße werden diesen Gefäßdepots zugerechnet. „Symbolische Urnen“, Gefäßdepots und Gefäßsätze weisen einige kontextuelle Gemeinsamkeiten auf, die nahe legen, dass der Akt des Niederlegens, aus dem sie resultieren, von ähnlicher Bedeutung war. Sie stellen Beziehungen der Gebenden zu den Toten dar oder erst her und sind Teil der Transformation der Verstorbenen. Zugleich sind diese Gaben eine soziale Verp�ichtung, sie sind Teil der gesellschaftlich eingeforderten P�icht zur Sorge um Verstorbene bzw. Ahnen. Der Gemeinschaft signalisieren sie, dass man seinen sozialen Verp�ichtungen nachkommt, und gleichzeitig ermög-lichen sie die eigenen Beziehungen zum Toten zu manipulieren. Bestattungen von Kindern werden zu diesem Zweck ebenso aufgesucht wie jene von Erwachsenen.
Artefakte aus Metall, Knochen, Stein oder Ton wurden recht selten beigegeben. Geräte und Waffen, z.B. Pfeilspitzen und Messer, die von anderen Gräberfeldern der Lausitzer Kultur bekannt sind, fehlen ganz. Häuflg wurden große, einfache Bronzedrahtringe zuoberst auf den Leichenbrand gelegt oder als Tuchverschluss benutzt, seltener Gewandnadeln aus Bronze oder später Eisen. Außerdem liegen Tonperlen vor, die teilweise aufgrund ihrer großen Zahl und ihrer aufgereihten Lage wohl als Perlenkette zu rekonstruieren sind. Teilweise flnden sie sich aber auch in kleinen Gruppen zwischen die Schichten des Leichenbrands gestreut. In der Hallstattzeit wur-den kaum noch vollständige Objekte mitgegeben, statt dessen wurden aus den Urnen Bronzefragmente und ebenso geschmolzene Bronzestücke geborgen, die auf mitverbrannte, eventuell zum persönlichen Besitz gehörige Artefakte hinweisen. Schmuckobjekte scheinen ein eher weibliches Attribut zu sein, da sie häuflger Frauen mit-gegeben wurden als Männern. Einige Objekte können aufgrund ihrer besonderen Handhabung während des Einbringens des Leichenbrands in die Urne eine besondere, „magische“ Funktion besessen haben; dies fällt vor allem in Zusammenhang mit Kinderbestattungen auf.
Zusammengefasst lässt das derart rekonstruierte Bestattungsritual Aussagen über die rituelle Darstellung von Alters- bzw. Geschlechterunterschieden zu. Während sich bei der Schichtung des Leichenbrands keine Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen feststellen lassen, deutet sich an, dass Männer gelegentlich schlech-ter verbrannten als Frauen. Möglicherweise ist dies auf einen für diese Individuen zu kleinen Scheiterhaufen zurückzuführen. Dies wäre ein Hinweis, dass auch die Größe des Scheiterhaufens kanonisch festgelegt war, und zwar wiederum unabhängig vom Geschlecht. Die Auswahl von Urnen und Schmuck lässt vermuten, dass die soziale Identität bzw. deren Darstellung im Ritual bei Frauen stärker festgelegt war, die der Männer dagegen etwas �exibler. Deutlich ist jedoch der Versuch zu erkennen, Männer und Frauen im Ritual auf gleiche Weise zu transformieren. Auf der Idealebene werden demnach eventuell bestehende Geschlechterdifferenzen überspielt und mögliche Spannungen somit ausgeglichen. Anders ausgedrückt: In der rituellen Kommunikation werden keine Unterschiede in der Geschlechterzuweisung angezeigt, die in der alltäglichen Lebenswelt durchaus bestanden haben können.
Werden beide Geschlechter auf gleiche Weise im Ritual dargestellt, fallen die Unterschiede zwischen den Altersklassen um so deutlicher auf. Kinder sind durch eine Reihe von Sonderbehandlungen ebenso herausge-hoben wie durch die Tatsache, dass sie häuflger in Doppel- bzw. Mehrfachbestattungen beigesetzt wurden als andere Individuen. Bei erwachsenen Frauen zeichnet sich in der rituellen Darstellung eine Altersklassengrenze bei etwa 40 Jahren ab, die wohl mit dem Ende der biologisch reproduktiven Phase übereinstimmt. Größere Unsicherheit herrscht bei der Interpretation der Bestattungen männlicher Individuen, vor allem was die vermu-tete Altersstufengrenze zwischen „Jünglingen“ und „Männern“ betrifft, doch scheinen männliche Individuen bis
14. Rückblick und Ausblick 239
etwa 20 Jahren eher wie Kinder dargestellt worden zu sein. Eine Altersklasse bilden die über 20jährigen Männer, eine weitere Grenze bildet möglicherweise das Lebensalter über 40 Jahren.
Die aufwändig gebauten und mit vielen Gefäßen ausgestatteten Rechteckgräber wurden offensichtlich nicht für sozial Höherstehende angelegt, sondern um mehreren Verstorbenen eine gemeinsame Begräbnisstätte bereit-zustellen. Es wurden deutlich mehr Kinder als Erwachsene in diesen Gräbern beigesetzt. Ob der zeitnahe Tod mehrerer Kinder, z.B. durch Krankheit, oder eine im weitesten Sinne „familiäre“ Beziehung und damit eine Art von Totenfolge zur Anlage von Mehrfachbestattungen führte, kann nicht immer abschließend entschieden wer-den, doch liegen Indizien für beide Fälle vor. Rechteckgräber und Mehrfachbestattungen allein durch hierarchi-sche Sozialstrukturen erklären zu wollen greift dagegen auf jeden Fall zu kurz.
Das Bild einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft in Urnenfelder- und Hallstattzeit ist grundsätzlich kri-tisch zu hinterfragen (Bockisch-Bräuer 1999, 533). Oft werden Begriffe wie „Häuptling“, „Kriegeradel“ etc. aus anderen zeitlichen Kontexten entlehnt und formale Analogien zu antiken, mittelalterlichen oder neuzeitlichen sozialen Konzepten gebildet. Zudem werden Gräber und ihre Ausstattungen noch immer häuflg mit der sozi-alen Wirklichkeit der Lebenden gleichgesetzt, als „Spiegel des Lebens“ verstanden. Schließlich fehlen häuflg an-thropologische Bestimmungen bei gleichzeitiger unkritischer Anwendung archäologischer Bestimmungskriterien (Kleibscheidel 1997). Deshalb muss, was hier für die Untersuchung der horizontalen Sozialstruktur unternommen wurde, auch für Untersuchungen zur vertikalen Sozialstruktur gelten: Um diese interpretieren zu können ist eine explizite Diskussion der angewandten Begriffe und Konzepte und der zugrunde gelegten �eorien notwendig, ebenso wie die Einbeziehung aller handlungsbezogenen Daten aller Gräber und vor allem die anthropologische Alters- und Geschlechtsbestimmung.
Um Aussagen sowohl zur horizontalen wie zur vertikalen Sozialstruktur treffen zu können müssen wir wissen, wie viele Individuen in den Urnen tatsächlich bestattet sind – viele bislang als Erwachsenenurnen angespro-chene Leichenbrandgefäße dürften die gemeinsame Bestattung eines Erwachsenen mit einem Kind enthalten haben. Wir müssen erfragen, ob Leichenbrände auf verschiedene Urnen verteilt oder geringe Mengen davon in andere Grabgruben gestreut wurden und ob wir es mit zufälligen Beimengungen oder bewussten Bezügen zwi-schen verschiedenen Individuen zu tun haben. Wir müssen berücksichtigen wer wo nachbestattet wurde usw. Ausdrücklich hinweisen will ich darum erneut auf den Sinn und hohen Aussagewert einer interdisziplinären Untersuchung des Leichenbrands. Dieser darf nicht erst auf dem Tisch der Anthropologin oder des Anthropologen in das Sichtfeld der Forschung rücken, sondern er muss bereits während der Ausgrabung und bei der anschlie-ßenden Werkstattuntersuchung Teil der archäologischen Fragestellung sein. Es empflehlt sich, alle Inhalte von Grabgruben und anderen Befunden während der Grabung auszusieben, besonders aber, den Leichenbrand aus den Urnen, soweit möglich, in Schichten zu bergen und das Ausnehmen zu dokumentieren. Dadurch werden nicht nur Vergleiche zu dieser Arbeit möglich, sondern auch zahlreiche Aussagen, die über das hinausgehen, was die Fund- und Beigabensituation ermöglichen.
Erneut soll darauf hingewiesen werden, dass die hier erzielten Ergebnisse an anderem Material überprüft werden sollen und können. Zum einen blieben durch die Ausgrabungsart, die nicht über die Leitungstrassen und Fundamentgräben hinausgehen durfte, zahlreiche kleinere und größere Flächen stehen. Dies ist weder aus Sicht der akademischen noch der denkmalp�egerischen Archäologie sinnvoll, da, wie auch die hier vorgelegte Untersuchung zeigt, das ganze Gräberfeld das zu schützende Denkmal ist, nicht die einzelnen Gräber. Gern ver-weise ich hier erneut auf die vor einem Jahrhundert getroffene Feststellung Käthe Riekens, die ich eingangs dieses Kapitels zitiert habe (Rieken 1909, 224).
Zum anderen sind die vorgelegten Fragen und Modelle, da sie explizit diskutiert wurden, auf andere Gräberfelder übertragbar. Übergangsrituale und Feste, Gaben und Objektmanipulationen, Körperinszenierung und -transfor-mation lassen sich in allen Gesellschaften beobachten. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Untersuchung von Gräberfeldern größerer Bestattungsgemeinschaften zu anderen Ergebnissen führt. Hier gilt zu bedenken, dass die Gemeinschaft, die den Bestattungsplatz Cottbus Alvensleben-Kaserne anlegte und nutzte, keine überregionalen Kontakte gep�egt zu haben scheint. Importe von z.B. schlesisch-bemalter Keramik oder Graphit zur Herstellung der eisenzeitlichen graphitierten Keramik (Buck 1979, 72) fehlen, Bronzegegenstände von überregionaler Verbreitung fanden kaum Verwendung. Wir erfassen hier also eine eher lokal verwurzelte Gemeinschaft.
Die hier erzielten Ergebnisse betreffen nicht nur die westliche Lausitzer Kultur, sie können auch in die Untersuchung anderer archäologischer Kulturgruppen einbezogen werden. Vergleiche sind z.B. auch mit ikono-graphischen Beobachtungen möglich, wie sie aus der Pommerschen Kultur oder „Gesichtsurnenkultur“ vorliegen.
14. Rückblick und Ausblick240
Piktogramme von Schmuck- und anderen Gegenständen, die auf den Gesichtsurnen dargestellt sind, wurden mit den anthropologisch bestimmten Leichenbränden in Beziehung gesetzt (Kneisel 2002). In der Tendenz zeigt sich, dass das Geschlecht der bzw. des Bestatteten durchaus die Auswahl der Urne bzw. der auf dieser darge-stellten Piktogramme beein�usst hat233. Auch altersbezogene Unterschiede waren zu beobachten: „Weibliche“ Kombinationen von Piktogrammen („Ausstattungsmuster“) flnden sich bei allen Altersgruppen (infans I bis ma-tur), männliche dagegen fast nur bei adulten Männern, Kinder werden nie mit Waffen dargestellt (ebd., 94).
„Wie die Altertumswissenschaft hat auch die Ethnologie von Anfang an der Entlastung von der Moderne gedient, aber ihr Vorteil war stets das Lebendige ihrer Szenarien gegenüber den, wie schon Herder sagte, ‚Papierkulturen‘ der Philologen“, postuliert Streck (1993, 3). Zwar haben die Altertumswissenschaften, und mit ihnen die Prähistorische Archäologie heute weitgehend andere gesellschaftliche Aufgaben als die „Entlastung von der Moderne“ (vgl. Gramsch 2000c) – mit dieser dürften wir uns inzwischen weitgehend angefreundet haben, auch wenn Habermas sie für ein noch „unvollendetes Projekt“ (1994) hält – doch „Papierkulturen“ sind es noch immer, was wir als Prähistorikerinnen und Prähistoriker schaffen. Und mit diesen versuchen wir, die Moderne aus der Prähistorie zu erklären – z.B. das heutige Europa als Folge der Vorgeschichte zu verstehen – und uns diese anzueignen als „unsere“ Vorgeschichte. Ich habe jedoch oben betont, dass wir von der Fremdheit der zu untersu-chenden prähistorischen Gesellschaften ausgehen müssen. Dies wiegt schwerer, als es zunächst scheint. Zu leicht verfallen die Interpreten vorgeschichtlicher Kulturen Europas in explizite oder, häuflger, implizite Analogien zu sogenannten alteuropäischen Kulturen. Gern wird angenommen, religiöse, metaphysische oder philosophische Begriffe aus der antiken Überlieferung könnten zur Erklärung prähistorischer religiöser bzw. ritueller Phänomene herangezogen werden. Im Fall der Lausitzer Kultur sind dies z.B. ein vermuteter paneuropäischer Dualismus, der in Konzepten wie chthonisch vs. ätherisch (Elysion vs. Hades; Wallhall vs. Hel usw.) gesucht wird, oder antike Beschreibungen von Bestattungen, die zur Illustration archäologischer Befunde herangezogen werden. Einerseits wird in Kossinna’scher Tradition zurück verlängert, was nicht zurückzuverfolgen ist. Andererseits wer-den Konzepte, die von Philosophen und Wissenschaftlern der Antike entwickelt wurden, für das Denken älterer, prähistorischer Zivilisationen als Messlatte und pauschales Erklärungsmuster angelegt, um unverständlich gewor-dene Rituale verständlich zu machen, obwohl viele dieser Konzepte im klassischen Denken entwickelt wurden (Burkert 1990). Sie gehörten nicht uneingeschränkt zum gemeinsamen Denken, zum kulturellen Gedächtnis der gesamten antiken oder gar europäischen Gesellschaften – dies wurden sie erst durch den Hellenismus der neuzeit-lichen Klassik und Romantik (Fuhrmann 1995, Christ 1999). Deshalb ist es notwendig, von der Fremdheit der prähistorischen Kulturen auszugehen, wie Althistoriker dies für antike Kulturen einfordern (Veyne 1988, Flaig 2003). Scheinbar vertraut sind uns diese Kulturen erst durch die Aneignung des 18. und 19. Jahrhunderts. Zwar hilft es nicht, allein auf die mögliche Andersartigkeit einer (zeitlich oder räumlich) entfernten Kultur zu verweisen und ehrfürchtig vor der Fremdheit und Polymorphie ihrer Lebenswelt zu verharren. Doch ist es ebenso wenig hilf-reich, prähistorisches Denken als „alteuropäisch“ aufzufassen. Ebenso wenig ist es „prälogisch“ oder unterentwik-kelt. Das kulturevolutionistische Verständnis, das traditionellen, vorindustriellen Zivilisationen nicht die gleichen geistigen Fähigkeiten zugesteht, muss in Frage gestellt werden. Ein solches fragwürdiges Verständnis flndet sich z.B. in der Klassiflkation prähistorischen Denkens als Naturreligion (Kossack 1996, 38) oder in der Gleichsetzung prähistorischer Bildgestaltung und -auffassung mit kindlichen Entwicklungsstufen (Huth 2003).
Deshalb habe ich bewusst zwischen die Materialvorlage und die Auswertung eine grundlegende �eoriediskussion geschoben und die Modelle offen gelegt, auf denen die Interpretation beruht. „Wenn die �eorie auf die Erfahrung warten sollte, käme sie nie zustande,“ sagt Novalis. Wir müssen mehr fragen als uns die Erfahrung erwarten lässt, wir müssen vom Unerwarteten, vom Fremden und Exotischen ausgehen, sonst bestätigt die implizite Analogie nur sich selbst.
233 Kritischer stehe ich Kneisels Versuch gegenüber, aus bestimmten Kombinationen von Piktogrammen eine soziale Hier-archie abzulesen und z.B. Krieger und „außerhalb der kriegerischen Schicht“ stehende Männer zu erkennen (Kneisel 2002, 91f.).