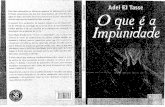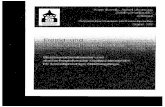Kulturelle Kommunität und Distanz. Zur adeligen Teilnahme an literarischer Kommunikation in der...
-
Upload
uni-rostock -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Kulturelle Kommunität und Distanz. Zur adeligen Teilnahme an literarischer Kommunikation in der...
Kulturelle Kommunität und Distanz 239
Claudius Sittig
Kulturelle Kommunität und DistanzZur adligen Teilnahme an literarischer Kommunikationin der Frühen Neuzeit
»Literarisch gesehen haben die Adligen wenig geleistet.«1 So hat man einmalin der Forschungsdiskussion der 1970er Jahre pointiert die Bedeutung desAdels für die Geschichte der deutschen Literatur in der Frühen Neuzeit bi-lanziert. Und noch bis in die jüngste Gegenwart findet man die Auffassung,dass schon eine »flüchtige Erhebung« schnell zu dem Ergebnis führenwürde, »dass die deutsche Literatur der Neuzeit eine bürgerliche ist. Die we-nigen Adeligen […] können kaum Akzente setzen […].«2 Solche pauschalenhistoriografischen Urteile über den geringen Anteil des Adels an der domi-nant bürgerlich geprägten deutschen Literaturgeschichte scheinen tatsäch-lich unmittelbar plausibel, umso mehr, wenn man vergleichend an andereeuropäische Literaturen denkt, mit prominenten adligen Autoren wie Casti-glione, Montaigne oder Sidney.
Aber bei einer gründlicheren Bestandsaufnahme würde man doch zu derEinschätzung kommen, dass die Zahl der Autoren von hohem Stand, die alsAkteure in der deutschen Literaturgeschichte der Frühen Neuzeit in Erschei-nung getreten sind, so gering gar nicht ist. Ein erster Anhaltspunkt ist eineAnthologie mit dem Titel Deutsche Fürsten als Dichter und Schriftsteller ausdem Jahr 1883, die auf über 300 Seiten eine Auswahl von Gedichten fürst-licher Autoren und Autorinnen vom Mittelalter bis in die Gegenwart prä-sentiert. Die Einleitung bietet einen knappen Abriss, der für das 16. und17. Jahrhundert allein immerhin zwölf Seiten umfasst, ohne auch nur allewichtigen Namen zu nennen.3 Die bloße Existenz einer solchen Zusammen-stellung mag als Indiz dafür gelten, dass auch alternative Perspektiven mög-lich sind und dass für den bemerkenswert bescheidenen Wissensstand über
1 Dann, »Soziologisches zu den Sprachgesellschaften«, 152.2 Costadura, Der Edelmann am Schreibpult, 1, Anm. 2, hervorgehoben im Original.3 Seidl, Deutsche Fürsten als Dichter und Schriftsteller, XV–XXVII; vgl. auch Zimmer-
mann, Fürstliche Schriftsteller des 19. Jahrhunderts; Idem, Krone und Lorbeer; Idem, Deut-sche Fürsten als Dichter; zu den genannten Anthologien vgl. die kurze Notiz bei Häntz-schel, Die deutschsprachigen Lyrikanthologien 1840 bis 1914, 243–245.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
240 Claudius Sittig
adlige Akteure in der deutschen Literaturgeschichte auch Prozesse der Ka-nonbildung verantwortlich sind. Falls die naheliegende Vermutung zuträfe,dass die herrschende Meinung eine Perspektive etabliert, die spezifischeSchnittstellen zwischen der sozialen Formation des Adels und der Institu-tion der Literatur aus dem Blick verliert, dann wäre das zitierte Schlagwortvon der »Bürgerlichkeit« der frühneuzeitlichen Literatur nicht nur ein Er-gebnis der Forschung, sondern auch eine zu diskutierende Voraussetzung.Diese Vermutung steht am Anfang der folgenden Überlegungen: Ihr Ziel istes, alternativ zur Rede von den »Leistungsdefiziten« mögliche Fragestellun-gen zu entwickeln, die geeignet sind, die Konturen eines »eigensinnigen« ad-ligen Umgangs mit Literatur freizulegen. Der Status dieser Überlegungenmuss vorläufig bleiben, solange die nötigen detaillierten Bestandsaufnah-men noch nicht geleistet sind. Und die Überlegungen wären vielfach nochzu differenzieren, etwa durch die Unterscheidung zwischen fürstlichen undadligen Lebenswelten oder durch die (oft vernachlässigten) Differenzen zwi-schen Adelskultur und Hofkultur. Dennoch lohnt sich – in diesem Wissen –der Versuch einer ersten generalisierenden Zusammenschau, mit exemplari-schen Blicken auf Anton Ulrich von Braunschweig-Lüneburg, den promi-nentesten schreibenden Fürsten im 17. Jahrhundert, sowie auf die soge-nannte Fruchtbringende Gesellschaft als einen möglichen paradigmatischenFall der Institutionalisierung einer spezifischen Praxis der »kulturellenKommunität«. Denn so lassen sich die Grundzüge eines adligen Habitus imUmgang mit Literatur sichtbar machen, der den skizzierten negativen Be-fund erklären kann und zugleich geeignet ist, Perspektiven für neue Unter-suchungen zu eröffnen.
1. Kopplung von Literatur und »Bürgerlichkeit«
Das angesprochene historiografische Problem wird mit aller wünschenswer-ten Deutlichkeit in einem jüngeren Beitrag zum Epochenband von HansersSozialgeschichte der deutschen Literatur ausformuliert. Über die soziale Stel-lung der Autoren im 17. Jahrhundert heißt es gleich in den ersten Sätzen:»Die Autoren der Barockliteratur gehörten in der überwiegenden Mehrheitdem bürgerlichen Gelehrtenstand an. […] Der Anteil der Autoren adeligerHerkunft war demgegenüber gering, darum freilich nicht zu vernachlässi-gen.«4 Aufschlussreich ist allerdings, was anschließend über diese Gruppeder adligen Autoren gesagt wird: »Bei den Autoren adeliger Herkunft«, soheißt es, »ist der Anteil derer, die ein Universitätsstudium, in der Regel ein
4 Lohmeier, »›Vir eruditus‹ und ›Homo politicus‹«, 156; außerdem Bonfatti, »Vir Auli-cus, Vir Eruditus«.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 241
Studium der Rechte absolvierten, sehr hoch. Das ist ein erwartungsgemäßerBefund insofern, als er dem zeitgenössischen Verständnis der Dichtkunst alseiner auf gelehrter Bildung, insbesondere auf dem Studium der antikenLiteratur und auf rhetorisch-poetischer Übung beruhenden Fertigkeit, undals eines Bestandteils gelehrter Tätigkeit entspricht […].«5 Das ist, kurz ge-sagt, in Anbetracht des ambivalenten Verhältnisses, das der frühneuzeitlicheAdel zum universitären Studium hatte,6 allerdings eher ein Ausschlusskrite-rium. Und diese Argumentation wird mit Blick auf das Selbstverständnis derDichter im 17. Jahrhundert noch weitergeführt: »Akademisch-lateinischeBildung und Gelehrsamkeit« – das heißt die »Grundlage barocker Dicht-kunst« – spielte »im standesethischen Repertoire des Adels noch um dieMitte des 16. Jahrhunderts kaum eine Rolle; ein über die Liebhabereihinausgehender Umgang mit gelehrten Sachen, also auch mit der Poesie,galt […] als eine eminent bürgerliche Angelegenheit und also unaristokrati-sche Betätigung. Daraus geht aber zugleich hervor, dass adelige Barockdich-ter als Exponenten einer Entwicklung betrachtet werden dürfen, die den ge-samten Stand betraf und in deren Verlauf diese standesethischen Normeninfrage gestellt wurden […].«7 Zugespitzt könnte man auch formulieren,dass sich dichtende Adlige in der Frühen Neuzeit nach diesem Verständnisauf das Feld der »bürgerlichen« Gelehrsamkeit begeben. Ihr Engagement istein Indiz für den historischen Wandel »von einer älteren und adelsgeprägtenRepräsentationskultur des Körpers zu einer bürgerlich geprägten Repräsen-tationskultur der Sprache […]«.8
Solche Deutungsversuche, die einen spezifisch adligen Umgang mit Lite-ratur kaum denkbar machen, sind historisch durchaus plausibel, denn dieenge Kopplung von Literatur und »Bürgerlichkeit« entspricht den zeitgenös-sischen Selbstbeschreibungen des Literatursystems. Sie ist das Resultat vonProzessen der Autokanonisierung einer Gelehrtenschicht, deren Konturenman mit dem Vokabular der »Bürgerlichkeit« erfassen kann.9 Und eineFunktionsgeschichte der frühneuzeitlichen Literatur zeigt, dass sie tatsäch-
5 Lohmeier, »›Vir eruditus‹ und ›Homo politicus‹«, 159. Die Grundlage für LohmeiersAussagen ist eine prosopografische Auswertung von 113 Biografien, 100 davon aus demBürgertum und 13 von Adel (leider ist weder die Liste der Namen aufgeführt, noch wer-den die Kriterien offengelegt, nach denen die Zugehörigkeit der Autoren zu den Ständenbestimmt worden ist, vgl. ebd., 157) – auch das ein Beleg für die Relevanz des bereits an-gesprochenen Kanonisierungsproblems.
6 Vgl. Müller, »Aristokratisierung des Studiums?«; zu differenzieren wäre auchzwischen einem Studium antiker Literatur und der Rhetorik und einem – von Adligenhäufiger absolvierten – Studium der Rechte, vgl. dazu Wieland, »Status und Studium«.
7 Lohmeier, »›Vir eruditus‹ und ›Homo politicus‹«, 171.8 Linke, Sprachkultur und Bürgertum, 64; vgl. auch Idem, »Das Unbeschreibliche«, bes.
251–253.9 Vgl. exemplarisch Garber, »Gelehrtenadel und feudalabsolutistischer Staat«.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
242 Claudius Sittig
lich zunehmend zum privilegierten Medium von Prozessen der bürgerlichenVergesellschaftung wird, für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hat manihr eine »so außerordentliche Bedeutung« zugeschrieben, dass man sie zuden allgemein verbindlichen »Lebensführungsmächten« zählen muss.10 ImLaufe der Frühen Neuzeit wird die Gruppe der Teilnehmer an der literari-schen Kommunikation kontinuierlich erweitert; neue Rationalitäten, Wert-vorstellungen und Weltmodelle werden formuliert, neue Erfahrungsräumeund Erwartungshorizonte entworfen. Anders als in den Ableitungsmodellender frühen Sozialgeschichte versteht man diese Veränderungen inzwischennicht mehr als Reflex einer bereits entstandenen Gruppenmentalität; statt-dessen betont man die Funktion der Literatur, neue Identitätsangebote füreine erst noch zu konstituierende große soziale Gruppe zu transportieren.Ganz im Einklang mit der antizipatorischen Struktur des Begriffs »Bürger-lichkeit« formuliert sie Möglichkeiten für eine neue »kulturelle Kommuni-tät«11 in einem großen historischen Entwicklungsprozess, an dessen Endedie »Zielutopie«12 einer sozial egalisierten Gesellschaft steht, die auf univer-sal gültigen Normen und Werten basieren soll.13 So lautet – kurzgefasst – die»Meistererzählung« von der »Verbürgerlichung« in der Literaturgeschichts-schreibung.14
Es leuchtet unmittelbar ein, dass diese Funktionsbestimmung von Litera-tur als Medium der »kulturellen Vergesellschaftung« für adlige Teilnehmeran der Kommunikation kaum einen Platz bietet: Sich mit unbekannten an-deren Kommunikationsteilnehmern gemeinzumachen, birgt die Gefahreines Distinktionsverlusts und damit einer Preisgabe der sozialen Existenz-grundlage. Und dennoch – trotz der kulturellen Hegemonie einer latent»bürgerlichen« Logik in der literarischen Kommunikation – ist eine signifi-kante Zahl von Adligen als Autoren von literarischen Texten namhaft zu ma-chen. Zu fragen ist darum, welche Positionen diesen adligen Akteuren alsTeilnehmern an der literarischen Kommunikation nach den Regeln des Dis-kurses zugewiesen wurden, ob sie eine eigene Haltung kultiviert haben, obsie sich den herrschenden Regeln des literarischen Feldes beugten, oder obsich Momente der Brechung oder Markierungen einer reservierten Distanzbeobachten lassen.
10 Tenbruck, Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft, 213.11 Ebd., 251.12 Zum Begriff vgl. Wehler, »Geschichte und Zielutopie«.13 Tenbruck, »Bürgerliche Kultur«, 263.14 Zur Rekonstruktion des Diskurses vgl. Sittig, »Zur Rede von ›Bürgerlichkeit‹ und
›Verbürgerlichung‹«.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 243
2. Ambivalenzen adliger Autorschaft
Paradigmatisch kann man diese Fragen am Beispiel der Dichtungen desWelfenherzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Lüneburg (1633–1714) dis-kutieren, des prominentesten dichtenden Fürsten im 17. Jahrhundert.15 Seinumfangreiches Werk bietet nicht nur eine überwältigende Fülle an Material;im Kontext seiner Schriften ist zugleich das ganze zeitgenössische Arsenalder diskursiven Formulierungsmöglichkeiten für eine adlige Autorschaftversammelt. Zu den Werken des Herzogs gehören ein Band mit geistlichenGedichten, den er seinem Vater handschriftlich im Jahr 1655 übereigneteund der 1665/1667 unter dem Titel Christ-Fürstliches Davids-Harpfen-Spielim Druck erschien;16 verschiedene Ballette und Singspiele, verfasst zu höfi-schen Anlässen, beginnend mit der eigenen Hochzeit im Jahr 1656;17 undschließlich zwei höfisch-historische Romane, Die Durchleuchtige SyrerinAramena (1669–1673) und die unvollendet gebliebene monumentale Römi-sche Octavia (1677–1707/1712). Es gibt gute Gründe dafür, dieses Werk alsadlige »Standeskunst« zu verstehen, die der eben skizzierten »bürgerlichen«Logik der literarischen Kommunikation diametral gegenübersteht. Die Ar-gumente lassen sich gattungsspezifisch ordnen: Die geistlichen Gedichtestellen ihren Autor explizit in die poetische Tradition des biblischen Sänger-königs David, der als Rollenvorbild erscheint. Das Schreiben von geistlicherLyrik lässt sich schon aus diesem Grund als standesgemäß deklarieren, es ge-hört als Ausweis der tugendhaften Frömmigkeit fest zum zeitgenössischenProgramm der Fürstenerziehung.18 Nach dem Amtsantritt kann es auchdazu dienen, den Anspruch des protestantischen Fürsten auf die höchstegeistliche Autorität seines Herrschaftsbereichs zu befestigen. Die Bühnen-dichtungen wiederum, die mehrheitlich einer repräsentativen Ästhetik ge-horchen, lassen sich bruchlos in die Anlässe des höfischen Zeremoniells in-tegrieren. Und schließlich ist insbesondere für die Prosadichtungen einexplizit ständisches Kalkül formuliert worden: in Sigmund von Birkens Vor-Ansprache zur Syrischen Aramena, der an ihrer Entstehung kontinuierlichbeteiligt war. Diese Vorrede wird in der Regel als frühes Dokument einerentstehenden Romantheorie in Deutschland gelesen; gleichzeitig finden sich
15 Zum Folgenden vgl. Berns, »›Princeps Poetarum et Poeta Principum‹«; Kraft,Geschlossenheit und Offenheit.
16 Vgl. Krummacher, Exercitia artis et pietatis.17 Anton Ulrich Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Werke, Bd. I 1/2: Bühnen-
dichtungen.18 Vgl. exemplarisch die lateinische Psalterparaphrase des Kasseler Landgrafen Moritz
des Gelehrten (Schmalkalden 1593) oder die deutsche Psalterübersetzung durch Lud-wig VI. von Hessen-Darmstadt (Gießen 1657). Die eigene Tradition der fürstlichen Psal-terdichtung, die sich hier andeutet, ist bisher nicht untersucht.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
244 Claudius Sittig
hier aber auch ausführliche legitimatorische Überlegungen, wie das otiumder Literatur mit dem negotium des politischen Amtes in Einklang zu brin-gen ist. Birken betont mit Blick auf das staatstheoretische Sujet des Romans,es seien »dieser art Historien/ vor allen anderen Schriften/ ein recht-ade-licher und darbei hochnützlicher zeitvertreib/ sowol für den/ der sie schrei-bet/ als für den/ der sie liset: wie dann auch die jenigen/ so dergleichengeschrieben/ meist entweder vorneme Stands= und sonsten adeliche perso-nen/ oder doch leute gewesen/ die mit solchen personen kundschaft gepflo-gen haben«.19 In dem Maß, in dem Geschichte zur magistra vitae wird, sollendie Inhalte des Romans pragmatisch als Adels- und Hofschule zu verstehensein. Seine Autorschaft weist den Fürsten darum implizit als ideale Verkör-perung des rex philosophus aus. Sein Schreiben wird außerdem eingebundenin das kulturpatriotische Projekt der Entwicklung einer eigenen deutschenLiteratursprache, die mit den Literaturen der benachbarten europäischenNationen konkurrieren kann.
Neben diesen Versuchen, den pragmatischen Nutzen der Literatur imRahmen der politischen Standeskultur des Adels auszuweisen und den fürst-lichen Autor damit vom Vorwurf des Müßiggangs zu entlasten, unternimmtBirken Anstrengungen, die Würde der Literatur so zu formulieren, dass siedem decorum des Fürsten angemessen ist. Zu diesem Zweck entwirft er einegenealogische Reihe von exemplarischen Dichtern der biblischen und römi-schen Antike, deutet einen höfischen Kanon europäischer Literatur in deut-scher Übersetzung an, verweist aber auch auf originale Werke in deutscherSprache von zeitgenössischen adligen Autoren wie Dietrich von dem Werderoder Wolfgang Helmhard von Hohberg. Er nennt außerdem, in ständischdifferenzierter Ordnung, ausgewählte Mitglieder der Fruchtbringenden Ge-sellschaft, in die auch der Welfenfürst Anton Ulrich unter seinem Gesell-schaftsnamen, der »Siegprangende«, stillschweigend eingereiht ist: In derFruchtbringenden Gesellschaft hätten »nun von 50 jahren her/ viele Fürst-liche und Gräfliche/ auch andere Stands/ und adeliche Personen sich befun-den/ die zu Teutscher Nation und ihrem eigenen unsterblichen ruhme/ dieKunstwelt und unsere Sprache mit vielen fürtrefflichen Schriften bereichert.Solche sind/ im Fürstenstande/ aus den häusern Anhalt/ Braunschweig/Hessen und Mekelnburg/ der Nehrende/ Unveränderliche/ Befreiende/ Sieg-prangende/ Kitzliche/ Wolgenannte/ Tüttrende und Gefällige; im Grafen-und Herrnstande/ der Unglückseelige/ Kunstliebende/ Kühne/ Sinnreiche/Grünende und Vollziehende; im Adelstande/ der Vielgekörnte/ Feste/ Un-verdrossene/ Friedfärtige/ Geheime/ Fördernde/ Gleichgefärbte/ Erwach-sende/ Gebrauchte/ Behütende/ Hülfreiche/ Entleibende/ Vollziehende undOrdentliche: welche alle/ als der hohe Raht des Teutschen Parnassus/ ihre
19 Birken, »Vor-Ansprache«, [5].
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 245
Verstands-haabe so rümlich bewäret/ daß andere/ die allein auf Eitelkeit undStaatisterey bedacht sind/ und den Kunstfleiß/ dessen sie nicht fähig/ verach-ten/ sich selbst mit einbildung mehrerer klugheit zu beschmeicheln nicht ur-sach haben.«20 Das alles hat den Zweck, die nobilitas mentis neben der nobi-litas corporis ins Recht zu setzen und die geistigen studia – darunter auch dieÜbung der Literatur – schließlich den körperlichen exercitia mindestensgleichwertig an die Seite zu stellen: »Soll die adeliche Belustigung allein imReiten/ Fechten/ Tanzen/ Jagen/ Trinken/ Spielen bestehen? Ist nicht das Ge-müte und die himmlische Seele edler/ als der irdische körper? So muß dannauch die Verstand-belustigung adelicher seyn als die leibes-ergetzung. Manmag zwar um diese sich annemen: aber jene soll man darbei nicht unter-lassen.«21
Neben diesen Strategien der Aufwertung der Literatur finden sich an an-derer Stelle auch panegyrische Argumentationsfiguren, die umgekehrt densozialen Vorzug des Adels – gleichsam eine poetologische »Strategie desObenbleibens«22 – in einen eigenen Habitus der Autorschaft im literarischenFeld übersetzbar machen sollen. Entsprechende Formulierungen betreffenetwa die dokumentierte Noblesse der artikulierten Gedanken, wenn Gott-fried Wilhelm Leibniz schreibt: »L’ouvrage est véritablement de ce Prince, etles pensées nobles qu’il y a le font assez connoistre«;23 oder die heroischeÜberbietung der Realität durch die Fiktion im Widmungsgedicht von Ca-tharina Regina von Greiffenberg, das dem dritten Band der Aramena voran-gestellt ist: »Allein ein Helden-held/ | kann schöner/ als sie ist/ uns bilden abdie Welt/ | nach seinem edlen Geist.«24 Fluchtpunkt dieser behaupteten Kon-gruenz zwischen der Gestalt des Textes und der edlen Gesinnung ihres Au-tors ist eine strukturelle Homologie zwischen künstlerischer creatio undpolitischer Souveränität.25 So formuliert Birken gleich zu Beginn seiner Vor-Ansprache in einer schöpfungstheologisch gewendeten Metapher vom thea-trum mundi eine Analogie von Roman und Welt;26 und Gottfried Wilhelm
20 Ebd., [8f.]21 Ebd., [7].22 Zum Begriff vgl. Braun, »Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben«.23 Bodemann, »Leibniz an Henri Basnage, 1696«, 128.24 Greiffenberg, Uber die Tugend-vollkommene, unpag. Vgl. ähnlich die mythologische
Formulierung, dass die Aramena »billiger Minerva […] heisen solte: weil es scheinet/ siehabe ein Jovis-hirn zum mutterleibe gehabt«. (Birken, »Vor-Ansprache«, [13f.])
25 Zur Argumentslinie vgl. Bredekamp, »Antipoden der Souveränität«.26 Unter der Voraussetzung der Sterblichkeit, schreibt von Birken, müssen »unter
allen Schriftarten/ die bästen seyn/ die uns zur Gottes erkentnis füren/ und zur Tugendanweisen«. Insbesondere die historischen Schriften würden »Gott/ aus seinen werken«sichtbar machen und exemplarisch die Folgen von Tugend und Laster vorstellen. »DieWelt/ ist eine Spielbüne/ da immer ein Traur= und Freud-gemischtes Schauspiel vorges-
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
246 Claudius Sittig
Leibniz zieht in einem Brief an Herzog Anton Ulrich die Linie mit Blick aufdie Person des fürstlichen Autors weiter: »Es ist […] eine von den Roman-Macher besten künsten, alles in verwirrung fallen zu lassen, und dann un-verhofft herauss zu wickeln. Und niemand ahmet unsern Herrn besser nachals ein Erfinder von einem schöhnen Roman.«27 Die Semantik einer adligenPraxis des literarischen Schreibens, so könnte man das bisher Gesagte zu-sammenfassen, ließe sich also dergestalt ausformulieren, dass sie vollständigin einem politischen Bedeutungshorizont aufgeht.
Gleichzeitig aber machen die Anstrengungen, die man exemplarischebenfalls an Sigmund von Birkens gewundener Vor-Ansprache beobachtenkann, auch deutlich, dass sich literarisches Schreiben nicht bruchlos in diepolitische Standeskultur des Adels fügen lässt.28 Am deutlichsten wird derVersuch in Birkens Argument, dass der didaktische Nutzen des Textes auchdem Autor selbst unmittelbar zugute kommen wird, indem das Schreiben alsForm der Selbst-Ermahnung deklariert wird: »er lernet solches im lehren,und schreibet ihm selber ins herze, was er auf das papier schreibet.«29 BirkensVor-Ansprache sollen den schreibenden Fürsten erkennbar in apologetischerAbsicht gegen einen Vorwurf immunisieren, der von anderer Seite aus demstaatstheoretischen Diskurs kommt. Exemplarisch ausformuliert findet ersich etwa in Giovanni Boteros Spiegel hoher Fürstlicher Personen (1602). DiePrämisse lautet hier, es gebe »kein schwerer vnd gefahrlicher Geschäffte […]/als ein gantzes Volck regieren/ vnd kein edler vnd vortrefflicher dinge/ alseines Fürsten Majestet vnd Hochhet«. Und der Fürst solle sich, um dieser an-spruchsvollen Aufgabe und seiner Rolle gerecht zu werden, »ja […] keinesandern dinges annemmen/ als was seiner Person gepühret vnd zustehet«:»Darumb steht es vbel an einer Fürstlichen person/ wenn er als die Kindermit Fabelwerck oder Grammaticalischen sachen vmbgeht/ wie der KeiserTiberius gethan: oder mit Seitenspielen/ wie der Keiser Nero: oder mit demBogenschießen/ wie Domitianus: oder mit Lanternen machen wie Eropus/der König von Macedonien: oder mit Waxbilder formieren/ wie der KeiserValentinianus: oder mit mahlen/ wie Graff Renatus in der Prouintz: oder mit
tellet wird: nur dass von zeit zu zeit/ andere Personen auftretten.« (Birken, »Vor-An-sprache«, [1]).
27 Bodemann, »Leibniz an Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel«, 26. April1713, 234.
28 Vgl. auch die exhortative Passage in Cyriacus Spangenbergs Adelsspiegel (1591/94),der wie Birken einen langen Katalog von fürstlichen Autoren und Gelehrten präsentiertund die Forderung anschließt: »Haben sich nu so viel grosser Herrn/ Keyser vnd Könige/nicht geschemet zu studieren/ viel weniger sollens jnen die vom Adel eine schand achten.«(II., 179)
29 Birken, »Vor-Ansprache«, [6]; vgl. auch die Vorstellung des fürstlichen Schreibensals Selbst-Exercierung im Umfeld der Schriften des Landgrafen Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt, dazu Meise, Das archivierte Ich, 201–207.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 247
Verß machen/ wie Chilperich/ der König inn Frankreich/ vnd TheobaldusKönig inn Navarren: oder mit jagen alle tag/ wie Carl der Neunte/ König inFrankreich/ oder mit der Astrologey vnndt des Himmels Lauff/ wie Alfonsusder Zehende/ König in Hispanien. Dann wenn solche Personen jre recht ob-ligende vnd angefohlne Geschäffte fallen vnnd ligen lassen/ vnd sich auff Ne-bensachen zu viel begeben/ so verlieren sie (wie den vorgemeldten Herrnauch geschehen) dadurch jren rechten Titul vnd Namen/ also daß sie nichtmehr Könige/ Fürsten oder Herren/ sonder Maahler/ Versmacher/ Rhats-herrn/ Sternenseher/ Philosophen/ oder sonst mit andern Namen genennetwerden.«30 Der »Princeps otiosus, in litteris delicians«,31 wie es an andererStelle bei Christoph Besold heißt, wird also als Zerrbild des idealen Herr-schers abgewertet, der sich mit weltfernen, »privaten« Dingen abgibt, die ihndaran hindern, seinen Amtspflichten Genüge zu tun.32
Lesarten, die literarische Texte von adligen Autoren vorrangig auf Logikender Repräsentation und Statusbehauptung verpflichten, erscheinen insofernproblematisch, als sie diese Ambivalenzen in den zeitgenössischen Be-wertungen vernachlässigen müssen. Angemessener scheint es darum, denBalanceakt bewusst zu halten, den adlige Autoren bewältigen müssen: Siekönnen nicht vorbehaltlos an einer latent »bürgerlichen« kulturellen Kom-munität teilnehmen, ohne Gefahr zu laufen, implizit den existenziellen An-spruch auf sozialen Vorzug aufzugeben; dieser Anspruch lässt sich zwar überverschiedene Argumentationsfiguren in eine herausgehobene Autorpositionübersetzen, aber adlige Autoren sind, wenn sie ihren sozialen Status zu er-kennen geben, umgehend dem Vorwurf ausgesetzt, die Pflichten zu vernach-lässigen, die ihnen dieser herausgehobene soziale Status auferlegt. Wenn esalso um die Bestimmung eines adligen Habitus bei der Teilnahme an litera-rischer Kommunikation geht, ist nicht in erster Linie nach Formen derostentativen Statusbehauptung zu fragen, sondern nach einem spezifischenModus der Teilnahme, der gleichzeitig ein Mindestmaß an »sozialer Dis-tanz« wahrt.
3. Adliger Habitus I: Verpflichtung zur Distanz
Tatsächlich lassen sich konkrete Strategien benennen, die einen solchen Mo-dus der distanzierten Teilnahme konstituieren: Dazu zählt ganz offensicht-lich die regelmäßige anonyme Veröffentlichung oder die Wahl von Pseudo-nymen. Wie in vielen anderen Fällen sind auch die publizierten Texte des
30 Botero, Von eines Fürsten vnd Herrn Reputation, 245–247.31 Besold, Operis Politici Editio Nova, 13.32 Vgl. Kühlmann, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat, bes. 344f.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
248 Claudius Sittig
Welfenherzogs Anton Ulrich alle anonym erschienen. Und obgleich dieIdentität des Autors – wie im strukturell verwandten Fall des incognito33 – fürviele sicher ein offenes Geheimnis war, bleibt damit doch immer noch einebedeutsame Distanz markiert. Ähnliches gilt für die versteckte Mitteilungdes Autorennamens in Akrosticha wie etwa bei Johann II. von Simmern(1492–1557) oder in den Dramen des Herzogs Heinrich Julius von Braun-schweig-Wolfenbüttel (1564–1613).34 Wenn in allen diesen Fällen der Autornicht explizit namhaft gemacht wird, dann liegt der Grund – allgemein for-muliert – darin, dass das symbolische Kapital des adligen Namens in keinerWeise zur Disposition stehen darf.35
Die Distanzierungsgeste, den Autorennamen nicht explizit bekannt zu ge-ben, erfährt noch eine Steigerung in der grundsätzlichen adligen Reserve, dieTexte überhaupt in den Druck zu geben und anschließend frei zirkulieren zulassen. Die Existenz einer ganzen Reihe von adligen Privat- oder fürstlichenHofdruckereien belegt das fundamentale Bedürfnis, die vollständige Kon-trolle über den Druck zu behalten und damit zugleich von der verbreitetenSorge befreit zu sein, dass handwerkliche Fehler – auch in Nachdrucken – dieIntegrität der Textgestalt beeinträchtigen und damit die Reputation des Au-tors beschädigen könnten.36 Falls Texte tatsächlich gedruckt wurden, folgt da-raus wiederum nicht notwendig, dass sie auch frei kursierten. Die Produkteaus der Druckerei Johanns II. von Simmern etwa tauchten nicht in den Mess-katalogen oder Verkaufslisten auf,37 sodass man davon ausgehen kann, dasssie – ähnlich wie die frühneuzeitlichen Festbeschreibungen38 – vor allem einerrelativ klar beschränkten Gruppe von Adressaten zugänglich waren. Für eineentsprechende Binnenadressierung spricht auch die Tatsache, dass mancheEpisoden aus Anton Ulrichs Römischer Octavia als Schlüsseltexte der höfi-schen Gesellschaft gelesen werden können, deren Bedeutung sich erst Lese-rinnen und Lesern erschließt, die über das nötige soziale Wissen verfügen.39
33 Vgl. Schnitzer, Höfische Maskeraden, 37–44.34 Vgl. Wunderlich, »Johann II. von Simmern«; Die Schauspiele des Herzogs Heinrich
Julius von Braunschweig.35 Die Beobachtung, dass die anonyme Publikation oder die Wahl von Pseudonymen
als »Separierungskonzept« zu verstehen ist, formuliert auch Scheffler, »Adel und Me-dienöffentlichkeit«, 252, Anm. 43.
36 Das gilt in ganz besonderem Maße für die Prachtausgaben der Bücher des Braun-schweigischen Stallmeisters und Berghauptmanns Georg Engelhard von Loehneysen, vgl.dazu Sittig, »Loehneysens Plagiate«; zu denken ist etwa auch an Johann Wilhelm von Stu-benberg oder Wolf Helmhard von Hohberg, die ebenfalls die Drucke ihrer Schriften ineigenen Werkstätten herstellen ließen.
37 Vgl. Wunderlich, »Johann II. von Simmern«, 22. Vgl. exemplarisch auch Klaus Co-nermanns Untersuchung zur Köthener Druckerei (»Die fürstliche Offizin zu Köthen«).
38 Vgl. Bauer, »Höfische Gesellschaft«, bes. 47–50 u. 52–56.39 Vgl. Kraft, Geschlossenheit und Offenheit, 87–115.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 249
Der weitaus häufigste Fall ist aber, dass die Texte gar nicht erst zum Druck ge-langten. Für diese grundsätzliche adlige Distanz zum Medium des Drucks istsicher eine Ablehnung des Buchs als einer technisch hergestellten, ökonomi-schen Ware verantwortlich zu machen, mehr noch aber der Gedanke einerunkontrollierbaren allgemeinen Publizität, die nicht der Logik der sozialenReziprozität gehorchen konnte, die für die soziale Grammatik der Adelskul-tur so fundamentale Bedeutung hatte.40 Darum existierte, über die Erfin-dung des Drucks mit beweglichen Lettern als einer mediengeschichtlichenZäsur hinaus, in der Frühen Neuzeit insbesondere im Adel eine ausgeprägteliterarische Manuskriptkultur:41 Die Beschränkung auf das exklusivere Me-dium der Handschrift war geeignet, die Grenzen eines »geschlossenen Kom-munikationsraums« aufrechtzuerhalten.42
Die genannten Strategien schöpften allesamt aus dem Repertoire der kon-ventionellen Distanzierungsgesten, die in der Frühen Neuzeit zur Verfügungstanden. Auch andere Teilnehmer an der literarischen Kommunikation derFrühen Neuzeit nutzten diese Distanzierungsgesten in bestimmten Kontex-ten. Dazu zählte etwa das Feld der frühneuzeitlichen Satire, bei der die Ano-nymität zu den konstant verwendeten Strategien gehörte, während über ihreNotwendigkeit und Legitimität zugleich kontrovers diskutiert wurde;43 zunennen ist exemplarisch auch der esoterische Diskurs, der besondere Gestender Verschwiegenheit kannte, die ein implizites Erkenntnisversprechen for-mulierten.44 Auffällig ist im Fall von adligen Autoren allerdings der kon-stante Gebrauch der Strategien, sodass man der Markierung von Distanzkonstitutive Bedeutung beimessen muss.
Der Modus der Teilnahme von adligen Autoren an der zeitgenössischenliterarischen Kommunikation lässt sich, so kann man aus der vorliegendenknappen Skizze schließen, nur angemessen beschreiben, wenn man nichtvorrangig auf publizierte Werke und auf Fragen der Autorschaft fokussiert.Mit Blick auf die gedruckten Texte wären die jeweiligen Kommunikations-räume auch in ihrer materialen Dimension mit spezifischen Distributions-
40 Saunders, »The Stigma of Print«; May, »Tudor Aristocrats«; Wall, The Imprint ofGender, 1–23. Vgl. auch Dewald: Aristocratic Experience, 174–205. Aufschlussreich istallerdings die Tatsache, dass Texte von fürstlichen Autoren in vielen Fällen posthum inFuneralpublikationen in hoher Auflage erscheinen. Vgl. exemplarisch das MonumentumSepulcrale (1632) für Moritz den Gelehrten von Hessen-Kassel.
41 Vgl. Schnell, »Handschrift und Druck«.42 Zur Semantik der ›Privatheit‹ von Handschriften vgl. z.B. Goldsmith, ›Exclusive
conversations‹, 78–80.43 Vgl. Deupmann, ›Furor satiricus‹; Anonymität als zentrale Kommunikationsstrate-
gie in der frühneuzeitlichen Literaturgeschichte ist noch kaum eigens in den Blick ge-nommen worden, vgl. Mulsow, »Practices of Unmasking«; für England vgl. North, TheAnonymous Renaissance; Griffin, »Anonymity and Authorship«.
44 Vgl. Mulsow, »Harpocratism«.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
250 Claudius Sittig
wegen zu rekonstruieren.45 Vor allem aber ließe sich vermutlich unterhalbder Wahrnehmungsschwelle der zeitgenössischen Öffentlichkeit in den Ar-chiven eine spezifisch adlige Form der »schriftvermittelten Kommunität«verfolgen, in der durch die Zirkulation von Manuskripten und die Kommu-nikation über Literatur eine spezifische Form der Gemeinschaft entstand.46
Dabei müsste man mit einem Begriff des »Textes« operieren, der auch diekomplexen Prozesse einer »Socialization of texts«47 mit einer Vielzahl vonbeteiligten Akteuren abseits des monopolisierenden Autor-Begriffs in denBlick nimmt.48
4. Adliger Habitus II: Distanz zur Verpflichtung
Wenn man diesen distanzierten Modus der Teilnahme von adligen Akteurenan der literarischen Kommunikation der Frühen Neuzeit als konstitutiv vo-raussetzt, ist auch die Frage nach einem spezifischen Habitus im adligenUmgang mit Literatur neu zu diskutieren. Man könnte pointiert formulie-ren, dass hier die »Verpflichtung zur Distanz« in einer Art »Reserve gegen-über der Verpflichtung« realisiert wird: Die Normierung durch eine gelehrteRegelpoetik, die der zeitgenössischen Dichtung zugrunde liegt,49 ist für ad-lige Teilnehmer an der literarischen Kommunikation nicht in vollem Um-fang bindend gewesen. Der adlige Umgang mit Literatur ist, im Gegenteil,von einer eigenen »Nachlässigkeit« geprägt,50 die sich im Umfeld der Frucht-
45 Ein Modell zur Beschreibung eines solchen umfassenden »communication ciruit«hat bereits vor einiger Zeit Robert Darnton vorgeschlagen, vgl. Darnton, The ForbiddenBest-Sellers, 181–189. Eine wichtige Quelle in dieser Hinsicht sind auch die Adelsbiblio-theken, vgl. dazu zuletzt Adam, »Bibliotheksgeschichte«.
46 Den Begriff der »scribal community« hat Harold Love geprägt (vgl. The Culture andCommerce of Texts, bes. 177–230). Für den Darmstädter Landgrafen Ludwig VI. ist vorKurzem erstmals das Korpus der Werke auch aus der archivalischen Überlieferung er-schlossen worden. Vgl. Meise, Das archivierte Ich, 208–345); ähnlich aufschlussreich ist dieAuswertung der Korrespondenzen der Fruchtbringenden Gesellschaft, vgl. dazu unten.
47 McGann, The Textual Condition, 69–87.48 An der Entstehung von Anton Ulrichs Syrischer Aramena arbeiteten – dies nur
exemplarisch – auf verschiedene Weise neben anderen seine Schwester Sibylla Ursula, Sig-mund von Birken, Aurora von Königsmarck sowie Catharina Regina von Greiffenberg mit(vgl. Laufhütte, »Ein frühneuzeitlicher Autor als Redakteur«, 65). Die Liste wäre, im In-teresse eines angemessen komplexen Textmodells, noch um eine ganze Reihe von Namenzu erweitern, die an der »Sozialisierung« beteiligt waren.
49 Berns, »›Princeps Poetarum et Poeta Principum‹«, 6f. u. 13f.50 In dieser Hinsicht ist der Vorschlag von Jörg Jochen Berns vermutlich irreführend,
die ›bürgerliche‹ Regelpoetik mit der sozialdisziplinierenden Policy-Ordnung und einespezifisch ›fürstliche‹ Poetik mit dem höfischem Zeremoniell zu korrelieren (»›PrincepsPoetarum et Poeta Principum‹«, 5–8).
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 251
bringenden Gesellschaft vorführen lässt, der bedeutendsten und größtenfrühneuzeitlichen Sprachgesellschaft in Deutschland, gegründet zu Beginndes 17. Jahrhunderts von Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen nach dem Vor-bild der italienischen Akademien.
Die gut 900 Mitglieder der Gesellschaft, die zwischen der Gründung imJahr 1617 und der allmählichen Auflösung ab dem Jahr 1680 in den Listenauftauchen, hatten sich mit ihrem Eintritt verpflichtet, in patriotischerAbsicht zu einer Aufwertung der Volkssprache und zur Kultivierung einereigenen deutschen Nationalliteratur beizutragen. Intern galt die »Idee derParität als Assoziationsgrundsatz«.51 Die unvermeidlichen sozialen Diffe-renzen wurden unter anderem dadurch überspielt, dass unterschiedslos alleMitglieder nach dem gleichen Muster einen Gesellschaftsnamen erhielten.Gleichzeitig zeigt ein Blick auf den sozialen Stand der Mitglieder, dass in denersten dreißig Jahren seit der Gründung der Gesellschaft 94 Prozent der Mit-glieder Angehörige des Adelsstandes waren; auf die gesamte Dauer ihres Be-stehens gesehen, rangierte der Anteil der Adligen unter den fast 900 Mitglie-dern immer noch bei rund 75 Prozent. Es handelte sich also um ein eminentadliges Unternehmen.
Korreliert man diese prosopografischen Daten allerdings mit dem Publi-kationsaufkommen der Mitglieder, um den Erfolg der Gesellschaft daran zumessen, steht die Rede von einem »Leistungsdefizit« des Adels wieder imRaum. Denn die adligen Mitglieder scheinen kaum ernsthaft am sprachkri-tischen und literarischen Diskurs teilgenommen zu haben; es waren viel-mehr die wenigen bürgerlichen Mitglieder, die durch Publikationen sichtbarauf die patriotischen Ziele der Gesellschaft hinarbeiteten.52 Eine kürzlich for-mulierte pointierte Neubewertung, die auf dieser Mangeldiagnose gründet,kommt darum auch zu dem Ergebnis, dass »Ursprung und Funktion dieserhöfischen Sozietät« nicht in erster Linie »im literarisch-sprachwissenschaft-lichen Milieu« zu suchen seien, sondern stärker noch in »politischen Ambi-tionen und militärischen Aktivitäten […]«.53 Und tatsächlich gibt es einigeIndizien dafür, dass es sich bei der Fruchtbringenden Gesellschaft auch umeine »politische Sammlungsbewegung« handelte, vornehmlich getragen vonprotestantischen Fürsten mit einer klaren Stoßrichtung gegen den Kaiser, beider literarisch verklausuliert über tagespolitische Themen diskutiert wurde.
Diese pointierte Deutung des empirischen Befundes ist wiederum symp-tomatisch für die Differenz zwischen den Prämissen der aktuellen For-schungsdiskussion und den oben bereits angedeuteten historischen Kommu-nikationsverhältnissen. Wahrscheinlich ist es auch hier wieder der Begriff der
51 Martus, Werkpolitik, 78.52 Vgl. exemplarisch Breuer, »Literarische Sozietäten«, 202–204.53 Schmidt, »Die Anfänge der Fruchtbringenden Gesellschaft«, 7 und 15.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
252 Claudius Sittig
»Gelehrsamkeit«, der den Zugang verstellt: Er steht für eine epistemischeKultur, die häufig professionell an den Universitäten institutionalisiert istund in der Wissen nach theoretischen Grundsätzen systematisiert wird. Voneinem so charakterisierten gelehrten »Bücherwissen« – gleichgültig, ob da-mit reale Verhältnisse treffend beschrieben sind – grenzt sich die grundsätz-liche adlige Präferenz für Praxistauglichkeit ab.54 Wenn Sigmund von Birkenin seiner bereits zitierten Vor-Ansprache explizit betont, die Syrische Aramenasei »nicht im Schulstaub/ sondern zu Hof erwachsen«,55 dann ist darin exem-plarisch die fundamentale Distanz markiert. Als Bewertungskriterium wirddie »Nützlichkeit«, wie oben bereits gesehen, auch auf die litterae ausge-dehnt,56 und die Dominanz der Bemühung um »Brauchbarkeit« erklärtschließlich auch die auffällige Beteiligung von adligen Autoren an der früh-neuzeitlichen pragmatischen Wissensliteratur der Bergwerks-, Schach- oderRosszaumbücher.
Markiert wird das distanzierte Verhältnis zum unbrauchbaren Bücherwis-sen im zeitgenössischen Wertbegriff des »Pedantismus«, und in Abgrenzungdavon ist ein spezifischer adliger Habitus im Umgang mit Literatur zu su-chen, der sich zusätzlich mithilfe der Begriffe des »Dilettantismus« und der»Konversation« beschreiben lässt.57 Der Begriff des »Dilettantismus« öffnetdie Perspektive auf eine adlige literarische Kultur, die Distanz hält zu Formender professionellen literarischen Produktion und den poetologischen Para-digmen der gelehrten Literatur. Sie kollidiert nicht mit den Amtspflichten,weil sie zeitlich in die »Nebenstunden« verwiesen ist. Die Lokalisierung in ei-nem solchen Freiraum hat eine eigene Form der »Ungebundenheit« zurFolge. Man kann mit Recht davon sprechen, dass diese Ungebundenheit wie-derum einen Autonomieeffekt produziert, der auf die moderne künstleri-sche Ästhetik vorausweist.58 Eng verwandt mit dieser Kultur des »Dilettan-tismus« ist ein zweites Gegenmodell zum Begriff des »Pedantismus«, das aufden Begriff der »Konversation« gebracht werden kann. Die Konversation alsModus der Vergemeinschaftung muss Distanz halten zu einem pedantischenDogmatismus, der rigoros zwischen »wahr« und »falsch« unterscheidet undkeine vermittelnde Position zulässt. Systematisches Bücherwissen muss in
54 Vgl. Moran, »German Prince-Practitioners«; Rankin, »Becoming an Expert Practi-tioner«; der gleiche Gedanke liegt auch dem Curriculum der zeitgenössischen Ritter-akademien zu Grunde; vgl. Conrads, Ritterakademien der Frühen Neuzeit.
55 Birken, »Vor-Ansprache«, XXIV.56 Zum »Praxisbezug als Bewertungskriterium« vgl. auch Kühlmann, Gelehrtenrepub-
lik und Fürstenstaat, 330–341.57 Das Folgende im Anschluss an die aufschlussreichen Überlegungen von Herz, »Der
edle Palmbaum«; vgl. zur Bedeutung der Differenz für Anton Ulrichs Römische Octaviaauch Kraft, »Höfischer Barockroman und gelehrter Traktat«.
58 Vgl. Costadura, Der Edelmann am Schreibpult; Neumeister, »Montaigne«, 164–176.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Kulturelle Kommunität und Distanz 253
kommunizierbares Konversationswissen übersetzt werden, das den Grund-zug der Viabilität besitzen muss.59 Und darum definiert sich diese Kulturüber die Distanz zu Argumentationen, die man als übertrieben subtil undweltfern empfindet. Im Zentrum steht nicht der Leitgedanke der Systema-tisierung, sondern es geht um »kasuistische Wissensordnungen«,60 um einweltzugewandtes situativ aktualisiertes Urteilsvermögen.61
Mithilfe der beiden Begriffe des »Dilettantismus« und der »Konversation«lässt sich die Tätigkeit der Fruchtbringenden Gesellschaft tatsächlich ange-messener beschreiben: Exemplarisch kann man zum einen auf das Ziel derGeselligkeit verweisen, das in der Gründungsurkunde der Gesellschaft nochvor der Spracharbeit und dem Literaturprogramm genannt wurde: Ein jeder»liebhaber aller Erbarkeit/Tugend und Höfligkeit/ vornemblich aber des Va-terlands« sollte sich hier freiwillig einfinden können und sich »nütz- und er-getzlich bezeigen/ und überall bei Zusammenkünften gütig, fröhlich, lustigund erträglich in worten und werken sein«.62 Wenn das sprach- und litera-turreformerische Programm in eine solche Kultur der Geselligkeit einge-bunden war, dann verliert die Diagnose, dass die Fruchtbringende Gesell-schaft an ihrem eigenen Anspruch gescheitert sei, schnell an Plausibilität.
Und die auffällige Logik der Parität – die auf den ersten Blick so neu er-scheint, dass man dahinter ein inklusives, latent »bürgerliches« Konzepteiner utopischen »kulturellen Kommunität« vermuten kann63 – lässt sich vordiesem Hintergrund als oft erprobtes, systeminternes Ordnungsprinzip derInteraktion in Oberschichten verstehen, das diese »Geselligkeit« ermög-licht:64 Da sichergestellt war, dass man sich in guter Gesellschaft befand,konnte man auf weitere Hierarchisierungen tendenziell verzichten.
Man kann zudem auch auf einen spezifischen Modus des Wissens und derKritik hinweisen, der in der Fruchtbringenden Gesellschaft gepflegt wurde.Der Streit mit Philipp von Zesen zeigt paradigmatisch, dass er unter denFruchtbringern gerade auch wegen seiner dogmatischen Haltung in Fragender Poetik und wegen seines extremen Sprachpurismus eine isolierte Posi-tion hatte. Man warf ihm übertriebenes Klügeln, Subtilität und Pedantereivor, was die Integration seiner Positionen in die Kultur der Gesellschaft er-schwerte.65
59 Vgl. auch die adlige Polemik gegen gelehrte Weitschweifigkeit und übertriebenenPrunk auf dem Feld der Rhetorik (Braungart, Hofberedsamkeit, 245–254).
60 Vgl. Neuber, »Systematische und kasuistische Wissensordnungen«; der Hinweis beiHerz, »Der edle Palmbaum«, 171, m. Anm. 76.
61 Herz, »Der edle Palmbaum«, 172.62 Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen, Werke, 1. Bd., [8].63 Vgl. Kühlmann, »Sprachgesellschaften«.64 Vgl. Luhmann, »Interaktion in Oberschichten«, 75.65 Vgl. Herz, »Philipp von Zesen«.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
254 Claudius Sittig
Ein adliger Habitus im Umgang mit Literatur wäre also in den Spielräu-men einer Kultur des »Dilettantismus« und der Konversation zu suchen. Inden Blick zu nehmen wäre darüber hinaus auch die europäische Dimensiondes adligen Kanons, das Schreiben in anderen europäischen Sprachen, dieÜbersetzung als genuine Form der literarischen Kommunikation. Dabeikönnte schließlich eine spezifische Form der adligen »kulturellen Kommu-nität« sichtbar werden.
5. Ausblick
Man könnte über die entworfenen Fragestellungen hinausgehen, indemman die genannten Strategien der Distanzierung als adlige Verweigerung derbedingungslosen Teilnahme konkretisiert und ihnen komplementär die Ver-weigerung einer positiven Bestimmung des adligen Habitus an die Seite stel-len, die externen Aspiranten umgekehrt die vollgültige Teilnahme an derAdelskultur verwehrt. Exemplarisch könnte dafür die Formel des »Je-ne-sais-quoi« stehen, die Behauptung der Existenz eines unbeschreiblichen We-senskerns, die zugleich eine grundsätzliche Unnachahmlichkeit garantiert.66
Entsprechende ethisch und ästhetisch zu konkretisierende Verhaltens- undStilideale wie grace, sprezzatura oder Zierlichkeit haben eigene Konjunkturenim Rahmen eines adligen »art de plaire«.67 Zukünftige Studien müsstenüberdies die anfangs erwähnten fundamentalen Differenzen auch innerhalbdes Adels in Betracht ziehen und zwischen fürstlichen Amtsträgern und nie-deren Landadligen68 ebenso unterscheiden wie zwischen einer allgemeinenAdelskultur und spezifischen höfischen Kontexten, und sie müssten zudemauch auf die Bedeutung von Geschlechterdifferenzen fokussieren.
Die skizzierten Aspekte lassen aber schon jetzt die Umrisse eines adligenHabitus im Umgang mit Literatur erkennen, der sich über eine Reihe vonbreit angelegten Detailstudien zu einer eigenen Ästhetik des Adels entwi-ckeln ließe. Erstmals würde die systematische und historische Ausformulie-rung einer solchen Ästhetik dem Adel eigene Praktiken einer »kulturellenKommunität« zugestehen. Damit wäre eine Alternative zur Rede von den»Leistungsdefiziten« des Adels auf dem Feld der frühneuzeitlichen Literatureröffnet.
66 Vgl. Linke, »Das Unbeschreibliche«, 257–261.67 Vgl. Sittig, Kulturelle Konkurrenzen.68 Dabei kann man auf den Ergebnissen einer Reihe von Studien aufbauen, vgl. etwa
Bircher, Johann Wilhelm von Stubenberg; zu Wolfgang Helmhard von Hohberg vgl.Rohmer, Das epische Projekt, 257–339; zur Landleben-Dichtung vgl. Voßkamp, »Landadelund Bürgertum«, 99–110 u. 158–166; Lohmeier, Beatus ille.
aus: Leonhard/Wieland (Eds.), What Makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century© 2011 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
Bibliographie Adam, Wolfgang: „Bibliotheksgeschichte und Frühneuzeit-Forschung. Bilanz
und Perspektiven am Beispiel des Nachlassverzeichnisses von Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen“, Euphorion 102 (2008), 1–38.
Bauer, Volker: „Höfische Gesellschaft und höfische Öffentlichkeit im Alten Reich. Überlegungen zur Mediengeschichte des Fürstenhofs im 17. und 18. Jahrhundert“, Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 5 (2003), 29–68.
Berns, Jörg J.: „‘Princeps Poetarum et Poeta Principum‘: Das Dichtertum Anton Ulrichs als Exempel absolutistischer Rollennorm und Rollenbrechung“, in: Valentin, Jean-Marie (Hg.), ‘Monarchus Poeta’. Studien zu Leben und Werk Anton Ulrichs von Braunschweig-Lüneburg, Amsterdam 1985 (Chloe, Bd. 4), 3–30.
Besold, Christoph: Operis Politici Editio Nova, Straßburg 1626. Bircher, Martin: Johann Wilhelm von Stubenberg (1619–1663) und sein
Freundeskreis. Studien zur österreichischen Barockliteratur protestantischer Edelleute, Berlin 1968.
Birken, Sigmund von: „Vor-Ansprache zum Edlen Leser“, in: Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Lüneburg: Die durchleuchtige Syrerinn Aramena. Der erste Teil. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1669, hg. v. Blake Lee Spahr, Bern - Frankfurt/Main 1975.
Bonfatti, Emilio: „Vir Aulicus, Vir Eruditus.“, in: Neumeister, Sebastian / Wiedemann, Conrad (Hg.), Res Publica Litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit. Bd. 1. Wiesbaden 1987, 175–191.
Botero, Giovanni: Von eines Fürsten vnd Herrn Reputation/ oder Groß: vnd Hochachtung, Straßburg 1602.
Braun, Rudolf: „Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben. Adel im 19. Jahrhundert“, in: Wehler, Hans-Ulrich (Hg.), Europäischer Adel 1750–1950, Göttingen 1990 (Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 13), 87–95.
Braungart, Georg: Hofberedsamkeit. Studien zur Praxis höfisch-politischer Rede im deutschen Territorialabsolutismus, Tübingen 1988 (Studien zur deutschen Literatur, Bd. 96).
Bredekamp, Horst: „Antipoden der Souveränität: Künstler und Herrscher“, in: Raulff, Ulrich (Hg.), Vom Künstlerstaat. Ästhetische und politische Utopien, München 2006, 31–41.
Breuer, Ingo: „Literarische Sozietäten“, in: Meier, Albert (Hg.), Die Literatur des 17. Jahrhunderts, München 1999 (Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur Bd. 2), 201–208.
Conermann, Klaus: „Die fürstliche Offizin zu Köthen. Druckerei, Verlagswesen und Buchhandel im Dienste des Ratichianismus und der
Fruchtbringenden Gesellschaft (1618–1644/50)“, Wolfenbütteler Barock- Nachrichten 24 (1997), 121–178.
Conrads, Norbert: Ritterakademien der Frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im 16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1982 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 21).
Costadura, Edoardo: Der Edelmann am Schreibpult. Zum Selbstverständnis aristokratischer Literaten zwischen Renaissance und Revolution (Castiglione, Montaigne und La Rochefoucauld, Retz, Chateaubriand, Alfieri), Tübingen 2006 (mimesis, Bd. 46).
Dann, Otto: „Soziologisches zu den Sprachgesellschaften. Die Deutschgesinnte Genossenschaft.“, in: Bircher, Martin / van Ingen, Ferdinand (Hg.), Sprachgesellschaften, Sozietäten, Dichtergruppen. Arbeitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 28. bis 30. Juni 1977, Hamburg 1978 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 7), 150–161.
Darnton, Robert: The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, New York 1996.
Deupmann, Christoph: ‘Furor satiricus’. Verhandlungen über literarische Aggression im 17. und 18. Jahrhundert, Tübingen 2002 (Studien zur deutschen Literatur, Bd. 166).
Dewald, Jonathan: Aristocratic Experience and the Origin of Modern Culture. France, 1570–1715, Berkeley u.a. 1993.
Garber, Klaus: „Gelehrtenadel und feudalabsolutistischer Staat.“, in: Held, Jutta (Hg.), Kultur zwischen Bürgertum und Volk, Berlin 1983, 31–43.
Gleixner, Ulrike: „Sprachreform durch Übersetzen. Die Fruchtbringende Gesellschaft und ihre ‘Verdeutschungsleistung’ in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts“, Werkstatt Geschichte 48 (2008), 7–23.
Goldsmith, Elizabeth C.: ‚Exclusive conversations‘. The Art of Interaction in Seventeenth-Century France, Philadelphia 1988, 78–80.
Griffin, Robert J.: „Anonymity and Authorship“, New Literary History 30 (1999), 877–895.
Häntzschel, Günter: Die deutschsprachigen Lyrikanthologien 1840 bis 1914. Sozialgeschichte der Lyrik des 19. Jahrhunderts, München 1997 (Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München, Bd. 58).
Herz, Andreas: „Der edle Palmbaum und die kritische Mühle. Die Fruchtbringende Gesellschaft als Netzwerk höfisch-adeliger Wissenskultur in der frühen Neuzeit“, Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 2 (2009), 152–191.
Herz, Andreas: „Philipp von Zesen und die Fruchtbringende Gesellschaft“, in: Bergengruen, Maximilian / Martin, Dieter (Hg.), Philipp von Zesen. Wissen – Sprache – Literatur, Tübingen 2008 (Frühe Neuzeit, Bd. 130), 181–208.
Holland, Wilhelm Ludwig (Hg.) Die Schauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, Stuttgart 1855 (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, Bd. 36).
Kraft, Stephan: Höfischer Barockroman und gelehrter Traktat. Gratwanderungen zwischen honnêteté und Pedanterie. In: Zeitsprünge 4 (2000), 211–229.
Kraft, Stephan: Geschlossenheit und Offenheit der ‚Römischen Octavia‘ von Herzog Anton Ulrich. „der roman macht ahn die ewigkeit gedencken, den er nimbt kein endt“,Würzburg 2004 (Epistemata, Bd. 483).
Krummacher, Hans-Henrik: Exercitia artis et pietatis. Die geistlichen Gedichte des Herzogs Anton Ulrich zu Braunschweig-Lüneburg,Wiesbaden 2005 (Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse, Bd. 715).
Kühlmann, Wilhelm: Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. Entwicklung und Kritik des deutschen Späthumanismus in der Literatur des Barockzeitalters, Tübingen 1982 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 3).
Kühlmann, Wilhelm: „Sprachgesellschaften und nationale Utopien“, in: Langewiesche, Dieter / Schmidt, Georg (Hg.), Föderative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum ersten Weltkrieg, München 2000, 245–264.
Laufhütte, Hartmut: „Ein frühneuzeitlicher Autor als Redakteur: Sigmund von Birken“, Editio 21(2007), 50–68.
Leibniz, Gottfried Wilhelm: Die philosophischen Schriften. 7 Bde., hg. v. Carl Immanuel Gerhardt, Berlin 1875–1890.
Bodemann, Eduard, „Leibnizens Briefwechsel mit dem Herzoge Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel“, Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen (1888), 73–244.
Linke, Angelika: Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1996.
Linke, Angelika: „Das Unbeschreibliche. Zur Sozialsemiotik adeligen Körperverhaltens im 18. und 19. Jahrhundert.“, in: Conze, Eckart / Wienfort, Monika (Hg.), Adel und Moderne. Deutschland im europäischen Vergleich im 19. und 20. Jahrhundert, Köln 2004, 247–268.
Lohmeier, Anke-Marie: Beatus ille. Studien zum ‘Lob des Landlebens’ in der Literatur des absolutistischen Zeitalters, Tübingen 1981(Hermaea N. F., Bd. 44).
Lohmeier, Anke-Marie: „‚Vir eruditus’ und ‚Homo politicus’. Soziale Stellung und Selbstverständnis der Autoren.“, in: Meier, Albert (Hg.), Die Literatur des 17. Jahrhunderts, München 1999 (Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur Bd. 2), 156–175.
Love, Harold: The Culture and Commerce of Texts. Scribal Publication in Seventeenth Century England, Oxford 1993.
Ludwig von Anhalt-Köthen: Werke, Bd. 1, hg. v. Klaus Conermann. Die ersten Gesellschaftsbücher der Fruchtbringenden Gesellschaft (1622, 1624 u.
1628). Johannis Baptistae Gelli Vornehmen Florentinischen Academici Anmutige Gespräch Capricci del Bottaio genandt (1619), Wolfenbüttel, Tübingen 1992 (Die deutsche Akademie des 17.Jahrhunderts. Fruchtbringende Gesellschaft Reihe II, Abt. A: Köthen, Bd. 1).
Luhmann, Niklas: „Interaktion in Oberschichten. Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert“, in: Luhmann, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 1, Frankfurt/Main 1998, 72–161.
Martus, Steffen: Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, Tieck, Goethe und George, Berlin - New York 2007.
May, Steven W.: „Tudor Aristocrats and the Mythical Stigma of Print“, Renaissance Papers 1980, 11–18.
McGann, Jerome J.: The Textual Condition, Princeton 1991. Meise, Helga: Das archivierte Ich. Die Schreibkalender der Landgrafen und
Landgräfinnen von Hessen-Darmstadt 1624-1790, Darmstadt 2002 (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F., Bd. 21).
Müller, Rainer A.: „Aristokratisierung des Studiums? Bemerkungen zur Adelsfrequenz an süddeutschen Universitäten im 17. Jahrhundert.“, Geschichte und Gesellschaft 10 (1984), 31–46.
Moran, Bruce T.: „German Prince-Practitioners: Aspects in the Development of Courtly Science, Technology and Procedures in the Renaissance“, Technology and Culture 22 (1981), 253–274.
Mulsow, Martin: „Harpocratism. Gestures of Retreat in Early Modern Germany“, Common Knowledge 16/1 (2010), 110–127.
Mulsow, Martin: „Practices of Unmasking: Polyhistors, Correspondence, and the Birth of Dictionaries of Pseudonymity in Seventeenth-Century Germany“, Journal of the History of Ideas 67 (2006), 219–250.
Neuber, Wolfgang: „Systematische und kasuistische Wissensordnungen. Mnemotechnische Prozesse im 17. Jahrhundert“, in: Detel, Wolfgang / Zittel, Claus (Hg.), Wissensideale und Wissenskulturen in der frühen Neuzeit, Berlin 2002, 185–196.
Neumeister, Sebastian: „Montaigne. Von der Adelsrolle zur schriftstellerischen Autonomie“, in: Haug, Walter / Wachinger, Burghhart (Hg.), Autorentypen, Tübingen 1991, 164–176.
North, Marcy L.: The Anonymous Renaissance: Cultures of Discretion in Tudor-Stuart England, Chicago - London 2003.
Rankin, Alisha: „Becoming an Expert Practitioner: Court Experimentalism and the Medical Skills of Anna of Saxony (1532–1585)“, Isis 98/1 (2007), 23–53.
Rohmer, Ernst: Das epische Projekt. Poetik und Funktion des ‘carmen heroicum’ in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts, Heidelberg 1998 (Beihefte zum Euphorion, Bd. 30).
Saunders, James W.: „The Stigma of Print“, Essays in Critcism 1 (1951), 139–164. Scheffler, Mandy: „Adel und Medienöffentlichkeit. Die Publikationstätigkeit des
sächsischen Adels 1763–1910“, in: Marburg, Silke / Matzerath, Josef (Hg.), Der Schritt in die Moderne. Sächsischer Adel zwischen 1763 und 1918, Köln – Weimar - Wien 2001, 243–259.
Schmidt, Georg: „Die Anfänge der Fruchtbringenden Gesellschaft als politisch motivierte Sammlungsbewegung und höfische Akademie“, in: Manger, Klaus (Hg.), Die Fruchtbringer – eine Teutschhertzige Gesellschaft, Heidelberg 2001, 5–37.
Schnell, Rüdiger: „Handschrift und Druck. Zur funktionalen Differenzierung im 15. und 16. Jahrhundert“, Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 32/1 (2007), 66–111.
Schnitzer, Claudia: Höfische Maskeraden. Funktion und Ausstattung von Verkleidungsdivertissements an deutschen Höfen der Frühen Neuzeit, Tübingen 1999 (Frühe Neuzeit, Bd. 53).
Seidl, Franz X.: Deutsche Fürsten als Dichter und Schriftsteller. Mit einer Auswahl ihrer Dichtungen. Von den Hohenstaufen bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte, Regensburg 1883.
Simmel, Georg: „Exkurs über den Adel“, in: Simmel, Georg, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Frankfurt/Main 1992, 820f.
Sittig, Claudius: Kulturelle Konkurrenzen. Studien zur Semiotik und Ästhetik adeligen Wetteifers um 1600, Berlin 2010 (Frühe Neuzeit, Bd. 151).
Sittig, Claudius: „Loehneysens Plagiate. Die Produktion von Reputation.“, in: Laude Corinna / Heß, Gilbert (Hg.), Konzepte von Produktivität im Wandel vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit, Berlin 2008, 347–372.
Sittig, Claudius: „Zur Rede von ‘Bürgerlichkeit’ und ‘Verbürgerlichung’ in der Literaturgeschichtsschreibung.“, in: Lepper, Marcel / Werle, Dirk (Hg.), Die Frühe Neuzeit in der deutschen Literaturgeschichtsschreibung, erscheint Stuttgart 2010.
Tenbruck, Friedrich H.: „Bürgerliche Kultur“, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 27: Kultur und Gesellschaft (1986), 263–285.
Tenbruck, Friedrich H.: Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall der Moderne. Opladen !1990.
Voßkamp, Wilhelm: „Landadel und Bürgertum im deutschen Schäferroman des 17. Jahrhunderts“, in: Schöne, Albrecht, (Hg.) Stadt – Schule – Universität – Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert, München 1976, 99–110.
Wall, Wendy: The Imprint of Gender. Authorship and Publication in the English Renaissance, Ithaca 1993, 1–23.
Walther, Gerrit: „Adel und An tike. Zur Bedeutung gelehrter Kultur für die Führungselite der Frühen Neuzeit“, Historische Zeitschrift 266 (1998), 359–385.
Warnke, Martin: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln 21996.
Wehler, Hans-Ulrich: „Geschichte und Zielutopie der deutschen ‚bürgerlichen Gesellschaft’“, in: Wehler, Hans-Ulrich (Hg.), Aus der Geschichte lernen. Essays. München 1988, 241–256.
Wieland, Christian: „Status und Studium. Breisgauischer Adel und Universität im 16. Jahrhundert“, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 148 (2000), 97–150.
Wunderlich, Werner: „Johann II. von Simmern. Autor und Gelehrter auf dem Fürstenthron“, Euphorion 85 (1991), 1–31.
Zimmermann, Georg: Deutsche Fürsten als Dichter. Eine Anthologie als Beitrag zur Literaturgeschichte, Dresden 1906.
Zimmermann, Georg: Fürstliche Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Berlin 1895. Zimmermann, Georg: Krone und Lorbeer. Fürstliche Dichter von der Zeit der
Minnesänger bis zur Gegenwart, Berlin 1897. !