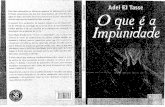Paulus und die Moderne. Anmerkungen zum Verhältnis von Universalismus und Gewalt
Baumburg und seine Gründer - Das Verhältnis des Stifts zum Adel und zur Ministerialität
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Baumburg und seine Gründer - Das Verhältnis des Stifts zum Adel und zur Ministerialität
Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
JÜRGEN DENDORFER Baumburg und seine Gründer Das Verhältnis des Stifts zum Adel und zur Ministerialität Originalbeitrag erschienen in: Walter Brugger/Anton Landersdorfer/Christian Soika (Hgg.), Baumburg an der Alz. Das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Geschichte, Kunst, Musik und Wirtschaft, Regensburg: Schnell und Steiner, 2007, S. 51-74.
Jürgen Dendorfer I Baumburg und seine Gründer
Das Verhältnis des Stifts zum Adel und zur Ministerialität
Das Urteil des Salzburger Erzbischofs von 1136 im Streit zwischen Baumburg und Berchtesgaden war in vielfacher Hinsicht ein wichtiger Einschnitt in der Geschichte des Stifts!. Nicht nur, dass Baumburg nun rechtlich von Berchtesgaden getrennt und auf sich selbst verwiesen war; nicht nur, dass der Salzburger Erzbischof, die Autorität in süddeutschen Kanonikerkreisen, den Standpunkt der Baumburger Kanoniker als "Meinung, die bei gewissen einfachen Brüdern aufkam" desavouierte2, auch das Abrücken der Gründerfamilie - der Grafen von Sulzbach - vom Stift manifestierte sich in ihm. Denn das gewichtigste Argument, das Erzbischof Konrad in seinem urkundlich fIxierten und nicht von ungefähr nur in Berchtesgaden überlieferten Urteil (iudicium)3 anführte, war der Wille des Stifters Graf Berengar I. von Sulzbach (t 1125). Noch zu Lebzeiten habe Graf Berengar beiden Konventen eigene Güter zugewiesen und sie getrennt, was auch Urkunden belegen würden4• Und in der Tat betrieb der Graf von Sulzbach von Anfang an die Gründung zweier Stiftes. Aus Baumburger Sicht stand dieser Stifterwille im Gegensatz zu den eigenen, im 12. Jahrhundert niemals aufgegebenen Ansprüchen auf eine Unterordnung Berchtesgadens. Graf Berengar selbst sowie seine Familie scheinen wiederum nach der erfolgten Gründungsausstattung, sicher aber nach 1136 kaum mehr etwas für Baumburg getan zu haben6•
Dieses spannungsreiche Verhältnis Baumburgs zu seiner Stifterfamilie ist bemerkenswert. Denn das Schicksal der zahlreichen klösterlichen Neugründungen des 12. Jahrhunderts hing eng vom Wohlwollen und der Förderung durch die Gründergeschlechter ab. Die Geschichte der Stiftungen des Adels entschied sich im Umfang der ersten Ausstattung mit Gütern und Menschen, in der erfolgreichen Ermunterung des adeligen Gefolges zu Schenkungen an das Stift, aber auch in der milden oder drückenden Ausübung der Vogtei sowie in der Intensität der Einbeziehung in die Krisen und Konflikte der jeweiligen Adelshäuser. Dass in Baurnburg der Gründer von Sulzbach und seine Familie so zurücktraten, musste gravierende Auswirkungen auf die Überlebensfähigkeit des Stifts haben und zu einer tiefsitzenden Verunsicherung führen. Denn über die anfängliche Bewidmung hinaus hatte eine Stifterfamilie für die Ergänzung und den weiteren Ausbau des Besitzes zu sorgen. Es war für das Stift an der Alz deshalb eine Schicksalsfrage, die Abwendung der Stifterfamilie zu kompensieren und den Adel und die Ministerialität des Chiemgaus für weitere Schenkungen zu gewinnen. Aufwelchem Weg gelang ihm das? Wer trat an die Stelle der Stifterfamilie, welche kleinen und großen Geschlechter wurden nun für Baumburg wichtig? Und wie erklärt sich das Abrücken der Grafen von Sulzbach von Baumburg aus der Perspektive des Adelsgeschlechts und die Zuwendung neuer Geschlechter aus deren Sicht? Was erwarteten sie vom Stift und welche Funktion übernahm es für deren adelige Herrschaft?
Die Baumburger Fundatio - ein veränderter Blick auf Gründung und Stifter?
Von den kargen urkundlichen Quellenbelegen für die ersten hundert Jahre des Chorherrenstifts hebt sich ein erzählfreudiger, poetisch stilisierter Prosatext, die Baumburger Gründungsgeschichte (fundatio), deutlich ab7• Sie ist nicht nur ein gut informierter Bericht über den Gründungsvorgang, sondern auch ein wichtiges, bisher kaum beachtetes Zeugnis für das historische Selbstverständnis des Stifts in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der Verfasser, wohl ein Baumburger Kanoniker, versuchte mit ihr das Zurücktreten des Gründergeschlechts nach 1125, dem Tod des Gründers, bzw. 1136 historiographisch zu bewältigen. Er schrieb dabei aus der Kenntnis der Vorgänge in der ersten Jahrhunderthälfte. Dieses
52 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
~ JI,ddJi~~uw 'l,
>.7i~·· ,\:.... :~' "'4 . ')
. "';.'4;;1' .. ~.~ o •• _ .. ~_· ,.~.",,------
Abb.17 Trennung Baumburg-Berchtesgaden (BayHStA, Baumburg Urk. 3, 1136)
Jürgen Dendorfer ßaumburg und seine Gründer I 53
Abb. 18 Fundatio Baumburgs. erste Seite (BayHStA, KL Baumburg 2, [al. 19)
54 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Wissen floss in seine Darstellung ein und veränderte seine Sicht auf die Gründung. Ist auch nicht eindeutig zu entscheiden, wo der Autor allein einen neuen Akzent im wirklichen historischen Geschehen setzte oder wo er Vorgänge bewusst falsch darstellte, in ihrer Gesamtheit bietet die Fundatio eine eindrückliche Schilderung des Verhältnisses Baumburgs zum Adel und zur Ministerialität des Chiemgaus aus der Perspektive des Stifts.
Dabei ist in der historischen Forschung diese Form der Darstellung der Klostergründung gut erforscht8. Nicht selten weitet sich die Schilderung der Gründungsumstände einer geistlichen Institution zur Geschichte der Stifterfamilie. Das hängt damit zusammen, dass es für das jeweilige Kloster sehr wichtig war, die Erinnerung an seine Anfänge aufrecht zu erhalten, sei es um den Nachfahren der Stifter zur Nachahmung empfohlene Beispiele der Wohltätigkeit vor Augen zu führen und sie in die Verantwortung für das Fortbestehen der Stiftung zu nehmen; sei es - je weiter die Gründung von der Gegenwart der Schreibenden entfernt war - durch die Erinnerung an die berühmten Gründer und die glanzvollen Anfänge auch die Zeitgenossen zu Schenkungen zu bewegen9• Nicht zuletzt erfüllte das Kloster damit seine Pflicht zum Gedenken (memoria) an die Gründerfamilie. Wie jede Geschichtsschreibung, so ist auch diese nur aus den Erfahrungen und Sehnsüchten der jeweiligen Gegenwart zu verstehen: Krisen der klösterlichen Gemeinschaft waren es zumeist, die zur Verschriftlichung einer Gründungsgeschichte führten, so wurde beobachtet lO• Wie ist nun die Baumburger Fundatio in diese Kategorie der "Stifterchronik" einzuordnen? Wann, mit welcher Absicht und für welches Publikum schrieb ihr Verfasser?
Zuerst ist festzustellen, dass die Gründungsgeschichte in deutlichem Abstand von den geschilderten Ereignissen, die bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts zurückreichen, entstand. Der Autor erwähnt, dass der Spanheimer Hartwig 11. Bischof von Regensburg seilI. Da dieser 1155 zum Bischof von Regensburg gewählt wurde, ist die Fundatio erst nach diesem Ereignis verfasst wordenl2. Nach oben ergibt sich dagegen keine sichere Datierungsgrenze. Wenn in der Gründungsgeschichte aber der Unmut über den Trennungsbeschluss Erzbischof Konrads I. von Salzburg von 1136 noch sehr stark ist13 und wenn in der knappen Spanheimer-Genealogie der Fundatio nur die Generation Markgraf Engelberts III. (t 1173) und Graf Rapotos I. von Ortenberg (t 1186) erwähnt wird 14, dann schrieb der Autor wahrscheinlich im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts, bald nach 1155.
Dieser Befund wird auch von der überlieferungssituation des Textes bestätigt. Er ist zuerst nach Papsturkunden Paschalis' 11. und Innozenz' 11. in einen Sammelcodex eingetragen, in dem die päpstlichen Privilegien aus den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts fehlenIs. Damit steht auch die Baumburger Gründungsgeschichte in einem überlieferungszusammenhang, der für "Stifterchroniken" schon wiederholt beobachtet wurdel6. Die Sicherung der urkundlichen überlieferung durch Abschriften (in Kopiaren) ließ immer wieder das Bedürfnis nach einer einleitenden Darstellung der Geschichte der Institution aufkommen. Ein Bedürfnis, das im Baumburger Fall besonders stark sein musste. Denn der in der urkundlichen Überlieferung, gerade in den Papsturkunden stark hervortretende GrafBerengarvon Sulzbach bzw. seine Nachfahren waren für das Stift an der Alz in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts weitgehend bedeutungslos. Es galt also, die Gründung des Stifts aufgrund der historischen Situation der Jahre nach 1155 zu aktualisieren.
Lässt sich diese Tendenz in der Baumburger Fundatio wirklich erkennen? Nehmen wir einmal an, es gäbe diesen Text aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts nicht und wir müssten uns mit den Nachrichten zur Gründung begnügen, die uns das Traditionsbuch und die Papsturkunden bieten. Wir wüssten dann nach den im Traditionsbuch verzeichneten Schenkungen, dass in Baumburg schon in den ersten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts eine ecclesia von einem Grafen Sizo gegründet worden ist - das von Heinz Dopsch identifizierte Burgstift der Sighardinger - und dass vor und um 1100 eine Gräfin Adelheid für das Seelenheil ihres Gatten Markwart und eine Gräfin Irmgard für das ihres verstorbenen Gatten Engelbert gabenl7. Etwas später folgte ihnen dann mit den umfangreichsten Schenkungen Graf Berengar von Sulzbachl8, dem sich verschiedene Edelfreie und Ministeriale anschlossenl9• Auffällig wäre
,
Engelbert I. 1057 Graf im Kraichgau, 1070-1091 Graf im Pustena] ca. 1077 Graf im Spanheim, 1085 Vogt von Salzburg
STIFTER VON ST. PAUL t 1.4.1096
Hadwig "von Massa" t 1.4. nach 1100
EngelbertII.
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 55
SiegfriedI. 1045 Markgraf der Ungarnmark
1048 Graf im Pustenal t 5.l
i1065
Hartwig
Richgard "von Lavant" Erhtochter Graf EngelberLs IV.
t 9.7.1072 (in Sponheim)
, Hermann
Burggraf und Vogt Propst in Erfurt 1079-1102 Erzbischof von
Magdehurg MITSTIFTER VON ST. PAUL
t 17.6.1102
Siegfried Graft 1070
bestattet in Sinsheim von Magdchurg 1091/98-1118
I Richgard
t 10.6. ca. 1125
I Hartwigl.
1105-1126 Bischof in Regensburg
I SiegfriedlI. Grafv.Areh
t6.5. ca. 1130
t 22.7.1118 ~Richgard
Mitstifterin v. Sponheim
t 11~GRAFEN VON STADE-1168
I Bernhard
Vogt v. St. Paul, Gf. v. Trixen Stifter v. Viktring
I Heinrich IV.
Herzog von Kärnten t 13.12.1123
1107 Markgf. Von Istrien 1124-1134 Herzog von Kärnten
Mönch in Seeon, t 13.4.1141 1. Berthold Gf. V. Schwarzenburg t 3.3.1126 1. Hildburg v. Tengling
t 16.11.1147
Ura, Erbtochter Graf, Ulrichs v. Passau t 16.4. nach 1142
2. Poppo III. Markgf. v. Istrien 3. Gebhard Graf v. Dießen
I I Engdbert III. Ulrich I 1124 Markgraf 1134-1144 Herzog
v. lsrrien von Kärnten 1135-1137 Markgf.
v. Tuszien t 7.4.1144
t 6.10.1173 Judith, Tochter d. Markgf. Hermann
Mathilde, von Baden
Tochter d. Gfn. I Bercngar I. v. Sulzhach
t 31.10.1165
Heinrich V. 1144-1161 Herzog
von Kärnten t 12.10.1161
Elisaheth von Steiermark
t 25.12.1144
Hcrmannll. 1161-1181 Herzog
von Kärnten t4.10.1181
m Agnes
von Österreich t 19.1. um 1181
I Heinrich
1133 Abt von
I Mathilde
t 13.12.1161 als Adeiheid
I RAPOTOI.
GRAF Weiler Betrnach Konv. in Fontevraulr Äbtissin V. ORTENBERG,
KRAIBURG U. 1145-1169 Q) von Göß Bischof TheobaJd IV. 1148-1178 MARQUARTSTEIN
t 26.8.1186 von Troyes Graf der Champagnc t 7.2.1178 t30.1.1169 t8.110.1.1152
Ulrich 1144 Graf
von Laibach tvor 1161
Adelheid m
Kg. Ludwig VII. von Frankreich
KIalh~r~ i
RapotolI. Gf. v. Ortcnhurg
und Kraiburg 1209 Pfalzgf. v. Bayern
t 19.3.1231
UdihUd von Dillingen
Adeiiheid
Chorfrau in
ELISABETH VON SULZBACH
t 23.1.l206
I I
Berchtesgaden 1188
Mathilde t ca. 1205
m Konrad 11.
Grafv. Valley tca.1200
Genrud 2. Adeiheid v. Dießen Kunigunde
von Steiermark
I Hartwig
1150 Domherr in Salzburg
1156--1164 Bischof von Regensburg
t 22.8.1164
I Elisabeth
GerolI. Graf v. Heunburg
Friedrich Graf v. Hohenhurg
ca. 1130
Ortebberg.MuC1.cb
Heinrich I. Graf v. Ortenburg
und Murach t 15.2.1241
1. Bozislawa, Tochter Kg. Premysl Otakars I.
,
Siegfried 111. Graf von Lebenau
1147 von Hohenburg t 23.8.1164
Mathilde von Valley tca.1195
(2. Heinrich v. Trixen)
c~,~ SiegfriedIV.
Graf v. Lebenau t 12.3.1190/91
m Kunigunde
Otto Graf v. Lebcnau
t 8.3.1205
1. Eufemia von Domberg
2. Sophie v. Plain
I Ulrichll.
I I I " ____ T'----,'------,'--2-.-Ri-·,h-i-,,-,v;Hohenhurg " ____ --,-, ___ ~I--"
Bernhard RapotoIII. Heinrieh 11. Elisabeth Gehhard Rapoto IV. DietpoJd Siegfried V. Bernhard NN (Tochter) 1181-1202 Herzog 1202-1256 Her:wg Pfalzgf. v. Bayern
Graf v. Kraiburg t 5.6.1248
Elisaheth t 1275 Graf v. Ortenberg t 1272 Graf von Graf von Graf von Graf von Graf von Q)
t 1256/57 Ortenberg Ortenberg Onenberg Lehcnau Lehcnau Ulrich I. von Kärnten t 10.8.1202
von Kärnten t4.1.1256
m Judith, Schwester
Kg. Premysl Orakars 11. t vor 1236
m Adelheid
von Nürnberg
I Elisaheth Erbwchter
m
Friedrich Landgraf von Leuchtenherg
1258 Hartmann Gf. v. Werdenberg
UlrichIII. 1251 Herrv.Krain
1256--1269 Herzog v. Kärnten t 27.10.1269
m 1. 1248 Agnes von AndechsMeranien, Erbin von Krain 2.1263 Agnes von Baden
t 2.1.1295
I Heinrich t 1257/63
Ph!lipp Propst v. Vysehrad Kanzler v. Böhmen
1246-1256 Erwählter Ehf. von Salzburg
1269-1272 Erwählter Patriarch v. Aquileia
1275 Herzog v. Kärnten und Herr von Krain
t22.7.1279
Erloschen
Marg1arethe
t 1249
Abb. 19 Stammtafel der Spanheim-Ortenberger
Bern~ard tvor 1249
~:d~~:1~:~ t nach 1275 t 19.11.1297 t 19.8.1285 t 17.12. ca. 1210 t 17.4.1229 72n3~~~: Leuchtenberg Kunigunde v. Pfannherg
von Bruckberg
I GRAFEN VON ORTENBURG -TAMBACH
(bis heute)
Erloschen
DIE SPANHEIMER ALS HERZOGE VON KÄRNTEN, GRAFEN VON LEBENAU UND GRAFEN VON ORTENBERG
noch, dass in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Grafen von Sulzbach nicht mehr erscheinen, während die Spanheim-Ortenberger häufiger auftreten. Die Papsturkunden wiederum sprechen nur davon, dass Graf Berengar das Stift gründete2o.
Die Schilderung der Baumburger Gründungsgeschichte steht nun dazu in keinem Widerspruch, sie ergänzt vielmehr die urkundlich bekannten Nachrichten. Dies spricht dafür, dass ihre Angaben über den Gründungsvorgang im Wesentlichen zuverlässig sind. Dennoch setzt sie andere Akzente, die sich aufgrund der urkundlichen Überlieferung so keineswegs aufdrängen würden: Sie übergeht die Gründung des Burgstifts am Beginn des 1l. Jahrhunderts, rückt Markwart von Marquartstein und Adelheid von Frontenhausen als eigentliche Gründerfiguren in den Mittelpunkt und stilisiert den Grafen Berengar von Sulzbach zum "Gründer wider Willen" - wie Heinz Dopsch herausgearbeitet hat2!.
56 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Gewichtet die Fundatio in diesen Punkten gegenüber der urkundlichen Überlieferung nur anders, so treten in ihr weitere Erzählstränge völlig neu hervor. Sie geben am ehesten Aufschlüsse über die Darstellungsabsicht des Autors. Die Gründungsgeschichte setzt im raunenden Imperfekt, im Märchenton, ein: "Einst gab es im Herzogtum Bayern einen Grafen aus bedeutendem Geschlecht, der Kuno genannt wurde. Er überragte alle Adeligen des Herzogtums so wie durch seine Abstammung auch an Macht und Reichtum ... Dieser Graf ... hatte eine allersüßeste Tochter, namens Adelheid, ein Mädchen von wundersamer Schönheit ... "22 Doch für diese Tochter einen ebenbürtigen Gemahl zu finden, sei Kuno nicht leicht gefallen, fast verzweifelt sei er dar an, dass er keinen gleich adeligen und vollendeten Mann finden konnte. Deshalb zögerte er lange, sie zu vermählen, bis sich gleichsam durch göttliche Fügung eine Lösung ergab23. Und nun führt der Baumburger Autor die Figur des Grafen Markwart von Marquartstein, den eigentlichen Helden seines Textes, ein, der mit zahlreichen Problemen kämpft, die zum Erfahrungshorizont der adeligen Kriegerelite der Zeit gehörten, und die auf diese oder ähnliche Weise auch in der volkssprachlichen Literatur der Zeit behandelt wurden. Von den Leuten des Grafen Kuno sei Markwart häufig angegriffen worden. Da er keine Möglichkeit sah, sich gegen Kuno und seine Gefolgschaft zu stellen, habe er weise auf Rache verzichtet und, nachdem durch eifrige Vermittler ein haltbarer Ausgleich (compositio) vermittelt worden sei, sich dem Grafen Kuno angeschlossen24• Nicht genug kann die Fundatio diese Einsicht loben25• Markwart diente seinem neuen Herrn treu und dankbar. Durch seinen Kriegsdienst (in exercitio militari) aber zeichnete er sich so aus, dass sich ihm Adelheid in Liebe zuneigte26• Konnten die bei den ihre Zuneigung anfangs noch geheim halten, so wussten sie doch, dass der Vater ihrer Verbindung nie zustimmen würde, und so blieb ihnen nur der "inszenierte", mit Einwilligung geschehene Frauenraub27• Doch widrige Umstände ließen das Glück der beiden Liebenden nicht von langer Dauer sein. Der Vater, Graf Kuno, enterbte seine Tochter Adelheid. Markwart aber fiel einem Mordanschlag zum Opfer, den Söhne seiner langjährigen Konkubine aus Verärgerung über die Zurücksetzung ihrer Mutter ausführten28 • Auf dem Sterbebett habe Markwart im Angesicht des Todes Adelheid seine Burg Marquartstein mit Ministerialen, Gütern und Hörigen übergeben, damit diese dort zuerst eine kleine Zelle, nach ihrem Tod aber mit allen Besitzungen ein Kloster gründen sollte29•
Die schillernde Figur Markwarts von Marquartstein steht in mehr als einem Drittel der Fundatio im Mittelpunkt. Diese Gewichtung zeigt, für wen der Autor schrieb: Durch Kriegsdienst gewonnene Liebe der Frauen; Liebende, die ihr Glück nur gegen den Willen des Vaters durch Flucht verwirklichen können; die wankelmütige fortuna, die das Geschick unerwartet jäh wendet, das sind Motive, die so oder ähnlich gerade in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts auch die volkssprachliche Dichtung thematisierte. Sie aber richtete sich an ein laienadeliges Publikum und hier mehr und mehr an das aus der Ministerialität erwachsende Rittertum. Zur Lebenswirklichkeit dieser Kreise gehörten auch die erwähnten Probleme adeliger Konfliktführung, die sinnvolle Beilegung solcher Konflikte durch eine compositio und der Anschluss an einen mächtigeren Herrn. Gerade dieses publikum sollte durch das Beispiel des auf dem Sterbebett bereuenden, wohltätigen Markwart zu Stiftungen an Baumburg animiert werden.
Im weiteren Fortschreiten der Erzählung ist dann noch deutlicher zu erkennen, für welche Adeligen der Verfasser diese Geschichte von Markwart von Marquartstein so ausschmückte. Denn durch die Ehen, die Adelheid von Frontenhausen nach dem Tode Markwarts schloss, legt der Autor ein Geflecht genealogischer Beziehungen um Adelheid offen, das die für die weitere Geschichte des Stifts, insbesondere in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, wichtigen Familien benennt. So hebt die Fundatio den Herkunftsort des Vaters der Adelheid, Frontenhausen, hervor3o, den Ursprungsort, nach dem sich seine Nachkommen noch bis heute (usque hodie) nennen. Ein Hinweis, der deshalb wichtig war, weil die Grafen von Lechsgmünd-Frontenhausen und ihre Ministerialen noch in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eifrig an das Stift schenkten3l . Diese Erwähnung sollte sie daran erinnern, dass sie in der Person Adelheids an der Gründung Baumburgs beteiligt waren.
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 57
DIE GRAFEN VON SULZBACH
I3crengar. m AJclhcid [007/1015
t 8.9.1043 (?)
Gcbhard 1. [IJ 1043/1071
Irmgard nm ROlt [2J Kunu d. Ältere von r-Iorburg [3] Graf Engdben
Bcrengar I. (ll (1) Adelhcid von Frontenhausen t ca. [ 105 (2) Kuno ..... Horburg [21 © Ade/heid v. Limburg (ll [IJ Cf. Friedrich .... Arnsbcrg t 3.12.1125 (2) Adclhcid von \'':Tolfratshauscn t 1l.l.1126 t 30.6.1139 t 1124/24
I I (2) Gcbhard II. m !vhthildc, (2) Genrud (J') Kg. Konrad II!. (2) Luirgard rn [11 Hzg. Goufried 11. t 28JO.1188 Toclucr Hzg. t 1146 t 1152 t nach 1163 v. Niederlothringen
I Bcrengar IL t 21.8.1167
Heinrichs des t 1142 Schwarzen @ [21 Hugo VIII. t flach 1178 Y. Dagsburg
I AJclheJd m GL Dietrich IL Y. Kleve
t 1171
t [[78
I Sophic (ll Graf Gcrhard Y. Grögling t 1228 t vor 1180
Abb. 20 Stammtafel der Grafen von Sulzbach
I I
(2) Malhildc (ll Mgf. Engelben 111. (2) I3ertha (ll Ks. Manud 1. (2) Adclhcid t vor 1165 '1.", lstrien t 1160 Komnenos Alnissin von
t 1173 t 11 HO Nicdcrnburg
I I Elisabcth (ll Rapolo L von Onenbcrg Bcrtha m Heinrich Ir. Y. AltenJorf t 1206 t 1186 t nach 1220 t 1194
Daneben fügt der Autor an unerwarteter Stelle, bei der Schilderung der Ehe Adelheids mit dem Grafen Ulrich von Passau, eine knappe Genealogie der Spanheimer ein. Uta, das einzige Kind aus dieser Verbindung, sei mit Herzog Engelbert "von Kraiburg" vermählt gewesen. Sie habe mit ihm vier Söhne gehabt, die alle namentlich erwähnt werden, über die aber, da sie sowieso bekannt seien, nichts Weiteres zu erzählen sei32• Auch dieses Geschlecht, die Spanheim-Ortenberger, spielte für Baumburg eine wichtige, ja in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts sogar entscheidende Rolle. Durch die Erwähnung im genealogischen Exkurs wurde es in das Gründungsgeschehen miteinbezogen.
Und selbstverständlich erwähnt der Autor auch die Rolle des eigentlichen Gründers, Graf Berengars von Sulzbach, des dritten Gatten der Adelheid. Während er die Mitwirkung der Frontenhausener und Spanheim-Ortenberger nicht wertete, ist dessen Bild eindeutig negativ besetzt. Berengar musste von Adelheid, die ihm und seiner Trägheit misstraute, zur Gründung gezwungen werden.
Der Autor der Baumburger Fundatio hebt also neben dem Gründer Graf Berengar von Sulzbach die Rolle der beiden weiteren wichtigsten Wohltäter des Stifts in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts hervor. Doch führt er diese Adelsgeschlechter merkwürdig farblos ein. An keiner Stelle wird die Baumburger Fundatio, wie das so häufig bei anderen Stifterchroniken zu beobachten ist, zur Geschichte eines
58 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Adelsgeschlechts. Wenn überhaupt, dann könnte man von der Geschichte einer Adelsgruppe, die sich um Adelheid von Frontenhausen greifen lässt, sprechen33•
Die eigentlichen Helden der Gründungsgeschichte aber sind weder die Frontenhausener noch die Spanheimer oder Sulzbacher; auch der Wille Markwarts von Marquartstein und seiner Witwe Adelheid von Frontenhausen reicht nicht aus, um das Stift erstehen zu lassen. Erst durch die ungebrochene Treue der Ministerialen gegenüber dem Vermächtnis Markwarts und Adelheids entstand das Stift an der Alz. Ohne ihre Mitwirkung wäre es nie gegründet worden, so suggeriert der Verfasser der Fundatio. Die eigenständige Rolle der Ministerialität schildert er schon vor ihrer Mitwirkung an der Klostergründung. Markwart von Marquartstein habe Adelheid zwar Ministeriale, Güter und Hörige übertragen34• An Baumburg sollte sie nur Güter und Hörige, aber keine Ministeriale (exceptis ministerialibus) tradieren35 •
Verständlich wird diese Einlassung nur, wenn der Verfasser den Eindruck einer Unterordnung der Ministerialen unter das Stift vermeiden wollte. Denn ein solcher hätte das Selbstbewusstsein dieser in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts mehr und mehr auf Eigenständigkeit pochenden Gruppe berührt. Auch wenn der Autor den für die Gründungsgeschichte seines Stifts eigentlich bedeutungslosen Widerstand der Ministerialität Graf Ulrichs des Vielreichen von Passau gegen den Übergang an Graf Berengar von Sulzbach erwähnt36, ist das derselben Absicht geschuldet: mit der Erwähnung der ministerialischen Selbständigkeit Vertretern dieser Gruppe zu schmeicheln.
Die Ministerialen trugen die Gründung Baumburgs von Anfang an. Als Adelheid von Frontenhausen sah, wie nachlässig Graf Berengar mit dem letzten Willen seiner Mutter Irmgard, der Gründung Berchtesgadens, umging, drängte sie ihn dazu, zusammen mit zwölf auserlesensten (electissimis) Ministerialen einen Eid zu schwören37• Einen Eid, mit dem er sich verpflichtete, Adelheid nicht eher zu bestatten, bis der letzte Wille des Grafen Markwart erfüllt sei. Und so ließ Berengar Adelheid nach ihrem Tod nur provisorisch neben seiner Kapelle in Sulzbach begraben. Noch nach zwölf Jahren sei ihr Grab nur notdürftig mit Erde bedeckt gewesen38• Während den Grafen von Sulzbach dies nicht störte, war auf die Ministerialen Verlass: " ... schwer erschüttert, begaben sie sich alle gemeinsam zu ihrem Herrn und baten ihn inständig, dass er ... das Testament erfülle ... "39 Erst auf ihre beständigen Interventionen und ihr häufiges und nachdrückliches Drängen hin rief der Graf eine Versammlung der Seinen in Rohrdorf zusammen40• Er selbst vertrat hier die Meinung, es seien zwei Stifte, Berchtesgaden und Baumburg, zu begründen. Die Ministerialenversammlung entschied sich aber anders, für ein einziges, gut ausgestattetes Stift41 •
Aus der Baumburger Rückschau der Zeit nach 1136 vertraten die Ministerialen also von Anfang an, schon vor der Gründung des Stiftes, die Interessen Baumburgs gegenüber dem Stifter. Diese Konfrontation des Stifterwillens mit der ministerialischen Entscheidung lässt sie zu den eigentlichen Trägern der Baumburger Ansprüche gegenüber Berchtesgaden werden. Und sie wirkten weiter, über diesen Beschluss hinaus, an der Gründung mit. Mit seinem Kaplan Arnold sandte Graf Berengar von Sulzbach zwölf Ministeriale aus, um den Platz für die Stiftsgründung auszumessen42 • Vom Eid gegenüber Adelheid bis zur reellen Bestimmung des Baugrundes für das Stift - bei der Gründung Baumburgs standen die Ministerialen an erster Stelle. Dabei hat die Zahl zwölf bei der Hervorhebung der ministerialischen Mitwirkung eine bisher nicht beachtete symbolische Dimension. Sie wird immer wieder bei der Schilderung von Klostergründungen verwendet und bezeichnet hier - in Analogie zu Christus und den zwölf Aposteln -die zwölf ersten Mönche, die eine Neugründung besiedelten. In Baumburg nun sind es zwölf Ministeriale, die an der Wiege des Stiftes stehen und durch deren Hartnäckigkeit allein der Gründungsvorgang abgeschlossen wurde. Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, für wie wichtig der Verfasser die Ministerialität für die Anfänge, aber auch die weitere Geschichte des Stifts hielt.
Wenn der Baumburger Chronist am Ende seiner Gründungsgeschichte auf die Trennung Baumburgs von Berchtesgaden eingeht, dann könnte das aufgrund der im Vorhergehenden geschilderten Zusammenhänge fast wie ein Nachtrag wirken. Doch erst aus dieser ganz offensichtlichen Wendung gegen die
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 59
Trennung Baumburgs von Berchtesgaden durch Erzbischof Konrad I. von Salzburg wird die eigentliche Causa scribendi der Baumburger Fundatio ersichtlich. An die Stelle der sich vom Stift abwendenden Stifterfamilie sollte die Ministerialität treten, die von Anfang an für die Gründung eines Stiftes, eben Baumburg, war. Ihre anhaltende Zuwendung wollte sich der Verfasser der Fundatio sichern. Die Darstellungsabsicht des Baumburger Kanonikers erhellt sich auf diese Weise. Neben der offenkundigen Absicht, die Trennung Baumburgs von Berchtesgaden als Rechtsbruch erscheinen zu lassen, will er vor allem die Ministerialität des Chiemgaus für sein Stift in die Pflicht nehmen. Auf Wirkung bei dieser Krieger- und Funktionselite, die im 12. Jahrhundert einen unaufhaltsamen Aufstieg erlebte43, war die Geschichte von Glück und Missgeschick des Kriegsmanns Markwart von Marquartstein berechnet. Sie war es auch, die den letzten Willen Markwarts umsetzten. Ob dieses Bild, das der Verfasser vom tatkräftigen Einsatz der Ministerialen für die Gründung Baumburgs gab, der Wirklichkeit entsprach, wird noch zu klären sein, ebenso wie die Frage, ob es ihm gelang, die Ministerialen gleichsam als "Ersatzstifter" an Stelle der eigentlichen Gründerfamilie zu setzen.
Wie aber nimmt sich aus der entgegengesetzten Perspektive der Gründerfamilie die Stiftsgründung aus? Wer waren diese Grafen von Sulzbach bzw. ihre Nachfolger in Baumburg, die sog. Spanheim-Ortenberger? Warum gründeten sie das Stift an der Alz und welche Motive hatten sie für die Abwendung von ihrer Stiftung?
Der Stifter Graf Berengar von Sulzbach und seine Familie
Graf Berengar I. von Sulzbach, der zuerst in den 80er Jahren des 11. Jahrhunderts in den Quellen erscheint und im Jahr 1125 starb, war einer der herausragendsten Adeligen Bayerns am Beginn des 12. Jahrhunderts44. Er führte seine Familie, die Grafen von Sulzbach, benannt nach dem heutigen Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz, auf einen Höhepunkt ihres Ansehens. Erste Vertreter dieses Grafengeschlechts fassen wir seit dem Anfang des 11. Jahrhunderts. Am Beginn des Aufstiegs dieser Adeligen stand die Ausübung der Vogtei über die reichen Besitzungen des von Kaiser Heinrich 11. (1002-1024) errichteten Bistums Bamberg in Bayern. Nicht nur in der Oberpfalz, auch an der Donau um Passau, im salzburgischen Lungau und in Oberbayern um Bad Aibling übten die Grafen von Sulzbach eine durch diese Bamberger Vogteigüter begründete und dann Schritt für Schritt erweiterte Herrschaft aus. In Oberbayern war der Besitzkomplex um Bad Aibling der erste Ansatzpunkt für weitere Akquisitionen, die eine geschickte Heiratspolitik in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ermöglichte. So erwarb Graf Berengar über seine Mutter Irmgard Besitz aus dem Erbe der Pfalzgrafen "von Rott", der Gründer des Klosters Rott am Inn45. Diese Irmgard war zudem mit einem Sighardinger vermählt, aus dessen Erbe ihr Sohn das Stift Berchtesgaden gründen sollte46. Hierdurch bekam Graf Berengar weitere Besitzrechte im Chiemgau und darüber hinaus im ganzen östlichen Oberbayern. Als der Sulzbacher Graf schließlich die reiche Witwe Adelheid nach 1099 ehelichte, gebot er über ausgedehnte Besitzungen vom Inntal über den Chiemgau bis ins Berchtesgadener Land. Mit gleichem Recht wie Graf "von Sulzbach" nannte ihn deshalb schon bei seinem ersten Auftreten eine Tegernseer Traditionsnotiz Graf "von Aibling"47. Der oberbayerische Besitz stand um 1100 den älteren Besitzungen in der Oberpfalz an Umfang kaum nach.
Doch nicht nur aufgrund seiner Besitzungen, die über das beim Grafenadel übliche Maß hinausragten, gehörte Graf Berengar von Sulzbach zu den führenden Adeligen Bayerns, ja sogar des hochmittelalterlichen Reiches um 1100. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von weiteren oberpfälzischen Adeligen veranlasste er den jungen König Heinrich v., sich 1104 gegen seinen Vater Heinrich IV. zu erheben und diesen abzusetzen48. Er war vielleicht der wichtigste Initiator dieses reichspolitisch folgenreichen Handelns. Dabei trieb den Grafen von Sulzbach nicht persönliches Machtstreben an, sondern das Ziel, den
60 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Idealen der Reformkirche im sog. "Investiturstreit" zum Durchbruch zu verhelfen. Graf Berengar gehörte um 1100 zu den eifrigsten Förderem der Kirchenreform in Bayern und im Reich; er stand mit den führenden Vertretern des "Reformadels" in Schwaben und Sachsen sowie mit den monastischen und kanonikalen Reformbewegungen in Kontakt. Dass er in Baumburg und Berchtesgaden Chorherrenstifte errichtete, entsprach neben dem Wunsch seiner Mutter Irmgard und seiner Frau Adelheid deshalb sicher auch seiner eigenen Begeisterung für die Ideale der Kanonikerreform. Als der Sulzbacher diese Stifte gründete, waren regulierte Chorherrenstifte im Südosten des Reiches noch keineswegs so verbreitet, wie sie es wenige Jahrzehnte später sein sollten. Nach den frühen Stiften St. Nikola vor Passau, Rottenbuch und Reichersberg unterblieben weitere GrÜndungen49• Erst die Sulzbacher griffen diese Reformbewegung wieder auf. Berengar war in seinen Reformbemühungen dabei nicht nur auf die Kanonikerreform festgelegt, wie die zeitgleich mit Berchtesgaden erfolgte Gründung des hirsauischen Benediktinerklosters Kastl in der Oberpfalz, das der Grafenfamilie als Hauskloster diente, zeigt50. Kastl war das erste hirsauische Kloster in Bayern überhaupt51 . Diese für Bayern zeitlich sehr frühen Reformgründungen in Kastl, Baumburg und Berchtesgaden zeigen, dass Graf Berengar zur führenden Schicht einer Reformelite im Reich gehörte, die nicht bereit war, halbherzige Kompromisse, wie sie Heinrich IV. mit seinen langjährigen Opponenten seit 1098 geschlossen hatte, zu akzeptieren.
Als der Kaiser im Winter 1104 mit einem Heer nach Sachsen zog, um bei einer strittigen Bischofswahl in Magdeburg wieder einem Gegner der Kirchenreform zum Durchbruch zu verhelfen und so aufs Neue Kämpfe mit den Sachsen drohten, gelang es der Gruppe um Graf Berengar, den jungen Heinrich V. auf ihre Seite zu ziehen52 . Gerade die ersten Jahre des jungen Königs bis 1111 prägte dann das Bemühen, eine ältere, längst vergangen geglaubte Zuordnung von Königtum und Reformidealen zu erneuern53•
Graf Berengar unterstützte den Salier hierin von Anfang an. Als sein Berater zog er an der Seite des Königs durch das gesamte Reich und folgte ihm 1110111 auch nach Italien. Kein anderer Graf ist häufiger am Hof des Salierkaisers nachzuweisen und nur der Neffe des Königs, Herzog Friedrich 11. von Schwaben, und der rheinische Pfalzgraf Gottfried von Calw übertreffen ihn unter den weltlichen Großen überhaupt in ihrer Präsenz54. Der Graf von Sulzbach beriet den Kaiser bei allen zentralen Ereignissen seiner so bewegten Regierungszeit. Und selbst nachdem Kaiser Heinrich V. im Jahr 1125 gestorben war, schienen das Ansehen und der Einfluss, den Graf Berengar erworben hatte, von Dauer zu sein. Als einziger Graf unterzeichnete der Sulzbacher das Wahlausschreiben für die Königswahl und nahm selbst an der Wahl teil. Kurz darauf allerdings starb am 3. Dezember 1125 auch er55•
Sein Sohn, Graf Gebhard 11. (t 1188), konnte die sulzbachische Erfolgsgeschichte nach anfänglichen Schwierigkeiten fortschreiben. Seine Schwestern, die Töchter Berengars, vermählten sich mit dem höchsten Adel des Reiches, was ein untrügliches Zeichen für das Prestige dieses Geschlechts ist. Klingende Namen wie die Staufer und Welfen gehörten zu den engsten Verwandten des Sulzbacher Grafen. Als die Großen des Reiches den ersten Stauferkönig, Konrad III. (1138-1152), erhoben, wurde mit diesem seine Gattin Gertrud, eine Schwester Graf Gebhards, Königin des Reiches. Eine andere Schwester, Bertha, wurde als Unterpfand diplomatischer Verhandlungen sogar mit einem künftigen byzantinischen Kaiser vermählt. Doch wie so oft bei hochmittelalterlichen Adelsfamilien lagen Glanz und Elend nahe zusammen. Als 1167 der einzige Sohn Graf Gebhards 11. auf einem Italienzug Friedrich Barbarossas starb, war das Ende dieses ruhmreichen Adelshauses besiegelt. 1188, nach dem Tod Graf Gebhards 11., zerfiel das sulzbachische Besitzkonglomerat in seine Einzelteile. Die Macht und der Ruhm der Sulzbacher um die Jahrhundertmitte blieben nur noch vage Erinnerung56. Die Bamberger Vogteilehen, die einst den Aufstieg des Geschlechts begründet hatten, gingen an Kaiser Friedrich Barbarossa selbst, der sie sich vom Bamberger Bischof vertraglich zusichern ließ. Die Eigengüter des Grafengeschlechts hingegen erbten mit den Töchtern des letzten Grafen vermählte Adelige. Von diesen übernahmen die Grafen von Ortenberg einen großen Teil der sulzbachischen Besitzungen in der Oberpfalz, aber auch im Chiemgau.
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 61
Die Enkel Adelheids - Die Spanheim-Ortenberger
Diese Grafen von Ortenberg, dem heutigen Ortenburg in Niederbayern, waren eine Linie des in Bayern und Kärnten weit verzweigten Geschlechts, das die Forschung als "Spanheim-Ortenberger" bezeichnet. Jene Familie stand den Grafen von Sulzbach bereits seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts besonders nahe. Mit keinem anderen wirkten die Sulzbacher enger zusammen als mit diesem in seiner Bedeutung für die bayerische, aber auch die Reichsgeschichte bei weitem noch nicht ausreichend gewürdigten GeschlechtS? Schon 1099, nach dem Tod Graf Ulrichs des Vielreichen von Passau, rückten beide Geschlechter gemein
sam in dessen Besitzungen ein. Heiratete Graf Berengar I. von Sulzbach Adelheid, die Witwe Ulrichs und Gründerin Baumburgs, so war Graf Engelbert 11. von Spanheim mit Uta, der Erbtochter des Grafen vermählts8• Über zwei weitere Generationen setzte sich diese Verklammerung der beiden Geschlechter durch Eheverbindungen fort. Zwei Söhne des Grafen Engelbert 11., der als erster nach Kraiburg genannt wurde, heirateten sulzbachische Töchter: so sein ältester Sohn, der im Baumburger Traditionsbuch dicht belegte
Engelbert III. (t 1173), Markgraf von Istrien, im Chiemgau nach seinen Burgen Marquartstein und Kraiburg genannt, so wie dessen jüngerer Bruder Graf Rapoto I. (t 1186), der in Niederbayern die Stammburg der Grafen von Ortenberg als eigenen Herrschaftsschwerpunkt begründete. Diese in den politisch intendierten Eheverbindungen (Konnubia) seit 1099/1100 greifbare, enge Verbindung zwischen beiden Geschlechtern schlug sich auch in einem politischen Wirkverbund auf regionaler und überregionaler Ebene nieder. Die besitzrechtlichen Überschneidungen beider Partnerfamilien im Chiemgau waren
zudem so groß, dass beide hier auf ein Zusammenwirken angewiesen waren. Schon bei der Ausstattung Baumburgs und Berchtesgadens dokumentieren die Urkundenbestände beider Stifte das gemeinsame Agieren der Familiens9• Darüber hinaus teilten Sulzbacher wie Spanheimer die Begeisterung für die Ziele der Kirchenreform. In der Reichspolitik distanzierten sie sich gemeinsam von Kaiser Heinrich IV. und stützten von Anfang an seinen Sohn Heinrich V.60 War der Sulzbacher auch der engere Vertraute des Sa
lierkaisers, so gelang es Graf Engelbert 11. im Südosten des Reiches innerhalb weniger Jahrzehnte, vom einfachen Grafen zum Markgrafen von Istrien und zum Herzog von Kärnten aufzusteigen. An Rang überragte der Spanheimer den Sulzbacher vollends, als er 1124 seinem früh verstorbenen Bruder Heinrich in
der Kärntner Herzogswürde folgte61 . Reiche Besitzungen in Kärnten, Istrien, in der bayerischen Ostmark sowie in Niederbayern - um Ortenberg (-burg) und im Rottal- und nicht zuletzt im Chiemgau, machten die Spanheimer auch in dieser Hinsicht mehr als ebenbürtig mit den Grafen aus der Oberpfalz.
In Oberbayern dürften die Spanheimer vielleicht schon im 11. Jahrhundert in sighardingische Besitzpositionen eingerückt sein, die sie um 1100 durch das Erbe der Uta, des einzigen Kindes Ulrichs von Passau und der reichen Witwe Adelheid, die das Erbe Markwarts v. Marquartstein verwaltete, ergänzten.
Auch diese gemeinsame Nachfolge in sighardingischen Positionen verband Sulzbacher und Spanheimer. Die Spanheimer übernahmen sogar schon im 11. Jahrhundert den sighardingischen Leitnamen Engelbert für ihr Geschlecht62. Sie waren die berufenen Nachfolger der Sighardinger im Chiemgau. Die Spanheim-Ortenberger beherrschten von der Kraiburg im Norden über zahlreiche Besitzungen um den
Chiemsee bis zur Burg Marquartstein im Süden sowie im Osten des Raums um Traunstein und den Waginger See die gesamte Region. Mitten in diesem von spanheimischen Ministerialensitzen überzogenen
Gebiet lag das Stift Baumburg. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Familie versuchte, ihren Einfluss auf das Stift zu verstärken, zudem, da dessen legendäre Gründerin Adelheid von Frontenhausen die Großmutter der prägenden Gestalten des 12. Jahrhunderts, Markgraf Engelberts III. von Istrien (t 1173) und Graf Rapotos I. von Ortenberg (t 1186), war. Dass Baumburg aber nicht nur die eine oder andere Schenkung von den Spanheimern und ihren Ministerialen erhielt, sondern zum zentralen kirchlichen Bezugspunkt des spanheimischen Herrschaftsverbandes im Chiemgau wurde, war auch allein
aufgrund dieser territorialen und verwandtschaftlichen Konstellation nicht zu erwarten.
62 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Die Grundlage für diese Entwicklung lag in dem erwähnten engen Zusammenwirken zwischen Sulz
bachern und Spanheimern. Im 12. Jahrhundert gewannen die Spanheim-Ortenberger mehr und mehr
sulzbachische Besitzpositionen im Chiemgau. Am deutlichsten lässt sich dieses Phänomen am Übertritt
Edelfreier bzw. Ministerialer aus dem sulzbachischen Gefolge in die spanheimische Ministerialität beob
achten63. Dadurch dass der Chiemgau für die Sulzbacher Fernbesitz mit nur gelegentlicher Möglichkeit
zur Präsenz war, scheint sich das Gefolge zunehmend neu auf die in der Region, in Kraiburg und Mar
quartstein, residierenden Spanheimer ausgerichtet zu haben. Verstärkt wurde diese Entwicklung sicher
durch die Eheverbindungen zwischen den Geschlechtern im 12. Jahrhundert, bei denen zwei Mal eine
Mitgift von den Sulzbachern an die Spanheimer überging. Diese Mitgift ist sicher in den sich im 12. Jahr
hundert verstärkenden Besitzrechten und in den Ministerialen der Spanheimer im Chiemgau, die vor
mals im sulzbachischen Besitz nachweisbar waren, zu suchen64. Möglicherweise ist in diesem Kontext
auch das Einrücken der Spanheimer in die Vogtei des Stiftes Baumburg vor 1136 zu sehen. Vielleicht im
Zug einer Mitgiftregelung, sicher aber im Einvernehmen mit den Grafen von Sulzbach übernahmen die
Spanheimer die Vogtei über das Stift an der Alz65. Während sich Berchtesgaden bis zum Ende der Grafen
von Sulzbach unter deren Vogtei an Schenkungen ihres ministerialischen und edelfreien Gefolges aus
allen Besitzschwerpunkten des Grafenhauses erfreuen konnte, überließen diese Baumburg nun ganz dem
verbündeten spanheimischen Geschlecht. Für deren Herrschaft in Oberbayern wiederum übernahm Baumburg Aufgaben, die es zu einer Art Hausstift der Spanheim-Ortenberger werden ließen.
Die rechtliche Grundlage für die Dominanz der Stifterfamilie in Baumburg
Die enge Bindung einer Stifterfamilie an ein Stift ist im Salzburger Reformverband der Augustiner
Chorherrenstifte eher außergewöhnlich. Sie hängt sicher mit der spezifischen Rechtsstellung Baumburgs
zusammen, die der Stifterfamilie, und zu ihr im weiteren Sinne gehörten die Spanheimer, über die Stif
tervogtei mehr Einfluss gewährte als das in anderen Chorherrenstiften des Reformkreises möglich war.
Anders als die benachbarten Stifte Au, Gars oder Herrenchiemsee gehörten Baumburg und Berchtesga
den nicht von Anfang an zu dem von Erzbischof Konrad I. begründeten Salzburger Reformverband66,
wenn sie sich auch ab den 40er Jahren des 12. Jahrhunderts diesem Kreis mehr und mehr annäherten67•
Vor der Gründung bzw. Reform der Salzburger Stifte von Rottenbuch aus besiedelt, unterschied sich das
Stift an der Alz in seiner Verfasstheit, seinem Verhältnis zur geistlichen und weltlichen Gewalt auch in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts noch deutlich von den anderen Salzburger Reformstiften. Zum
einen war der Bezug zum Papst, dem das Stift bei seiner Gründung zum Schutz übertragen wurde, stär
ker68• Der rechtliche Status als päpstliches Eigenstift blieb das ganze 12. Jahrhundert über bestehen. Die
Baumburger scheuten keine Mühe, regelmäßig eine Erneuerung ihres Schutzes und eine Bestätigung
ihres Besitzstandes beim Papst einzuholen69• Eine Privilegierung, ja auch nur einfache Schenkung durch
Konrad I. oder einen anderen Salzburger Erzbischof des 12. Jahrhunderts fehlt hingegen im Urkunden
bestand. Zum anderen unterschied sich Baumburg auch im Verhältnis zum Adel und zur Ministerialität
deutlich von anderen Salzburger Stiften. Ging dort rechtlich die Vogtei vom Erzbischof zu Lehen oder
war in anderen Formen von ihm abhängig70, so ist seine Mitwirkung an der Vergabe der Vogtei in Baum
burg zu keiner Zeit festzustellen. Vermutlich schon der Stifter Graf Berengar von Sulzbach, sicher aber
die mit ihm und seiner Familie aufs engste verbundene Familie der Spanheim-Ortenberger übten die
Vogtei in ihrer Gründung bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts aus7!. Grundlage des Rechtstitels war
die Gründervogtei, die von den Sulzbachern auf die Spanheim-Ortenberger wie ein Besitztitel überging.
Wenn in den ersten päpstlichen Privilegien für Baumburg die freie Vogtwahl nicht erwähnt wird, obwohl
diese Formulierung in anderen Papsturkunden für die Klöster und Stifte der Salzburger Kirchenprovinz
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 63
längst gebräuchlich war, so dürfte das auf einen Vorbehalt der Gründer zurückzuführen sein. Erst nach der rechtlichen Trennung von Berchtesgaden, als die Familie der Sulzbacher ihre Ansprüche auf Baumburg sicher aufgegeben hatte, wird die freie Vogtwahl des Stifts, zuerst in einem Privileg Innozenz' II. von 1139, zugestanden72• Das ist im bayerischen Vergleich eher spät und verweist auf den ungeklärten und langwierigen Gründungsprozess, der sich bis 1136 hinzog, sowie die Dominanz der Gründerfamilie in Baumburg. 1139 aber hatte Markgraf Engelbert III. die Nachfolge seines 1125 verstorbenen sulzbachischen Schwiegervaters Graf Berengars I. schon länger angetreten73. Wie so häufig änderte auch hier das von nun an immer wieder bestätigte und sogar immer mehr präzisierte Vogtwahlrecht nichts an dem Verbleib der Vogtei in den Händen der Spanheim-Ortenberger. Auf Markgraf Engelbert III. folgten sein Bruder Graf Rapoto I. (t 1186), dann dessen Sohn Rapoto 11. (t 1231). Mit dem Vogt Pfalzgraf Rapoto III. (t 1248) endete die oberbayerische Linie der Spanheim-Ortenberger. Die Vogtei ging nun an die wittelsbachischen Herzöge über74• Diese Stiftervogtei also, deren Ausübung von Seiten des Salzburger Erzbischofs keine Grenzen gesetzt waren, erlaubte es den Spanheim-Ortenbergern, eine besonders enge Bindung zum Stift zu entwickeln.
Baumburg als Hauskloster der Spanheim-Ortenberger
Nach der gesicherten übernahme der Vogtei durch die Spanheim-Ortenberger ab den 30er Jahren des 12. Jahrhunderts wuchs Baumburg für den oberbayerischen Teil der Herrschaft in die Rolle eines Hausklosters bzw. Hausstifts dieser Familie hinein. Vor allem im 11. und 12. Jahrhundert gründete der Adel diese Hausklöster, die zur Grablege ganzer Geschlechter wurden, in denen Mönche für die verstorbenen und lebenden Angehörigen einer Familie beteten und die herrschaftlich durch die Ausübung der Vogtei an die Stifterfamilie gebunden waren75• Für den grundlegenden Strukturwandel des Adels vom 9. bis zum 12. Jahrhundert kam diesen klösterlichen Erinnerungsorten an ein Adelsgeschlecht, an denen über
Abb.21 Schenkungsurkunde der Elisabeth von Ortenbergfür Baumburg (BayHStA, Baumburg Urk. 7, 1190)
64 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Generationen die Vogtei in der Familie weitergegeben wurde, eine herausragende Bedeutung ZU76. Auch Baumburg übernahm für die Spanheim-Ortenberger wichtige, wenn auch nicht alle Funktionen eines solchen Hausstifts.
Gegründet wurde das Stift zwar von Adelheid von Frontenhausen - der Schwiegermutter Graf Engelberts 11. und Großmutter Engelberts III. und Rapotos I. -, von einer genuin spanheimischen Gründung wird allerdings nicht zu sprechen sein. Andere Klöster, wie St. Paul im Lavanttal oder Sponheim im rheinfränkischen Herkunftsgebiet, wären hier mit größerer Berechtigung zu nennen77• Und doch, für die oberbayerische Herrschaft der Spanheimer wurde Baumburg mehr und mehr zum Hausstift. So ist etwa bemerkenswert, dass jede Generation der Spanheimer im 12. Jahrhundert seit Markgraf Engelbert III. (t 1173) an das Stift für ihr Seelenheil schenkte78• Lassen sich die Schenkungen Markgraf Engelberts III.79
zwar im Umfang nicht mit der sulzbachischen Gründungsausstattung sowie so mancher edelfreier bzw. ministerialischer Großzügigkeit vergleichen80, dann verdienen doch die zahlreichen Konsensschenkungen bzw. die rechtlich sicher ähnlich zu wertenden Schenkungen von Ministerialen in Gegenwart (in
presentia) der Spanheimer Beachtung81 . Auch auf diesem Weg, durch die Zustimmung zu Ministerialenschenkungen, konnte ein Kloster gefördert werden. Doch auch jeder Angehörige der bayerischen Linie der Adelsfamilie stiftete im 12. Jahrhundert für sein Seelenheil (pro remedia animae) an Baumburg. Markgraf Engelbert III., sein Bruder Graf Rapoto I. von Ortenberg und dessen Sohn Rapoto 11.: Hier sind sie alle in der Bitte um Gebetsgedenken vereint. Und noch im 13. Jahrhundert schenkten die Pfalzgrafen Rapoto 11. und Rapoto III. Patronatsrechte in Sieghartskirchen und Sitzendorf in Niederösterreich für ihr Seelenheil82. Vor allem aber gaben die Frauen, Herzogin Uta und ihre Schwiegertöchter Mathilde und Elisabeth, an das Stift. Ihre Freigebigkeit übertraf die der Männer deutlich. Bedachten Mathilde und Elisabeth auch in großen Schenkungsserien mehrere Klöster und Stifte, die im herrschaftlichen Einzugsbereich der Spanheim-Ortenberger lagen83, Baumburg lag ihnen besonders am Herzen84. Die Großzügigkeit der Elisabeth von Orten berg blieb im Stift unvergessen, wofür sie auch selbst gesorgt hatte. Einträge im Traditionsbuch, eine von der Gräfin selbst mit Zustimmung ihrer Söhne ausgestellte Urkunde und sogar eine päpstliche Bestätigung sollten ihre Schenkung unwiderruflich machen85. Das Baumburger Nekrolog überlieferte dann auch noch in seiner im 15. Jahrhundert kompilierten Form die Gedenktage aller oberbayerischen Familienmitglieder86. Kein anderes Kloster oder Stift Bayerns gedachte der Spanheim-Ortenberger des 12. Jahrhunderts in solchem Umfang.
Und noch in einer weiteren Hinsicht erwies sich Baumburg als Hausstift der Spanheim-Ortenberger. Sowohl Mathilde als auch Elisabeth förderten Baumburg deshalb so, weil sie an ihrem Lebensende selbst in das Stift eintraten. Auch auf diese Weise zeigt sich Baumburg in der Funktion eines Hausklosters. Denn diese Klöster waren nicht nur Rückzugsorte für kranke und schwache Angehörige eines Adelsgeschlechts, sondern ebenso für jene, die von Anfang an für den geistlichen Weg bestimmt waren oder sich am Ende des Lebens auf den Übergang in eine andere Welt vorbereiteten. Gerade die Kanonikerreform-bewegung bot dabei sowohl Männern als auch Frauen die Möglichkeit des gemeinschaftlichen Lebens. Die frühen Konvente bestanden häufig aus drei Gruppen: den eigentlichen Kanonikern, Konversen - Laien, die sich zum klösterlichen Leben bekehrt hatten - und einer Frauengemeinschaft87. In Baumburg ist dieser Frauenkonvent durch das Traditionsbuch gut greifbar. Er war offensichtlich auch für Frauen der Vogtfamilie attraktiv. Sowohl Mathilde als auch Elisabeth verbrachten ihre letzten Jahre im Stift88. Und ebenso konnten sich die männlichen Konversen um 1170 über den Eintritt eines berühmten Adeligen freuen. Markgraf Engelbert III.lebte, vielleicht nach dem Tod seiner Frau 1165, im Stift89. Der langjährige Vogt des Stiftes, selbst kinderlos, wählte so den gleichen Weg, den seine Frau wenige Jahre zuvor gegangen war.
Offensichtlich aber ließ sich der Spanheimer nicht in Baumburg, sondern beim Grab seiner Eltern in Seeon bestatten90. Sein Vater Herzog Engelbert 11. und seine Mutter Uta lagen in der alten Aribonenstiftung begraben91, die im 13. und wahrscheinlich auch schon im 12. Jahrhundert von einer spanheimi-
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 65
sehen Seitenlinie, den Grafen von Lebenau, bevogtet wurde92• Obwohl die Baumburger Traditionsüberlieferung im Spätmittelalter behauptet, die Gräber fast aller in der Gründungsüberlieferung erwähnten Personen lägen im Stift, war Baumburg gerade nicht Grablege der Spanheimer93 . Und damit fehlt in Baumburg ein wichtiges Definitionselement für ein Hauskloster: die Familiengrablege. Allerdings hatten die Spanheim-Ortenberger im 12. Jahrhundert auch kein Haus- und Grabkloster mehr, das das ganze Geschlecht umfasste. Den weitgestreuten Besitzschwerpunkten in Bayern und Kärnten entsprachen verschiedene Bestattungsorte der Spanheimer in den jeweiligen Herrschafts-bereichen. So war das 1092 gegründete Kloster St. Paul im Lavanttal Grablege für Kärntner Vertreter des Geschlechts, mit der bezeichnenden Ausnahme, dass Herzog Engelbert II. im Kloster Seeon, in dem er als Konverse seine letzten Lebensjahre verbracht hatte, lag94• Auch in Rosazzo, in Friaul, ließen sich im 12. Jahrhundert Vertreter der Familie, darunter die Herzöge Ulrich (t 1144) und Heinrich V. (t 1161) von Kärnten, bestatten95•
Die Linie der Grafen von Ortenberg, die im 12. und 13. Jahrhundert noch in Baumburg präsent war, wählte sich Orte in Niederbayern als Grablege, etwa St. Nikola vor Pass au bzw. am Passauer Dom, wo es zur Ausbildung eines Erbbegräbnisses kam96• Erst nach einer ortenbergischen Besitz- und Linientrennung zwischen Pfalzgraf Rapoto 11. Ct 1231) und seinem Bruder Heinrich 1. von Ortenberg Ct 1241), wodurch die pfalzgräfliche Linie auf die oberbayerischen Besitzungen beschränkt wurde, fand der letzte Vertreter des Geschlechts, Pfalzgraf Rapoto III., in Baumburg sein Grab97• Er ist nach der zeitgenössischen Überlieferung der einzige männliche Spanheim-Ortenberger, der in Baumburg bestattet wurde. Für die Konversin Mathilde bzw. ihre Nichte Elisabeth dagegen sind Beisetzungen in Baumburg durchaus wahrscheinlich98• Doch trotz des Fehlens einer Familiengrablege war das von spanheimischen Verwandten gegründete Stift an der Alz, das die Memoria dieses Geschlechts in außerordentlichem Umfang pflegte, von allen Familienangehörigen im 12. Jahrhundert bedacht wurde und als Rückzugsort für Frauen und Männer diente, die zentrale geistliche Institution der Familie in Oberbayern.
Das Ministerialenstift
Ebenso wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die großen Adelsgeschlechter, waren für das Stift an der Alz aber die Ministerialenfamilien. Aus Baumburger Sicht in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts drängten sie den säumigen Grafen Berengar I. von Sulzbach zum Abschluss des Gründungsprozesses. Sie sollten, so war an der Baumburger Fundatio zu zeigen, an Stelle der Stifterfamilie in die Pflicht für das Fortbestehen des Stifts genommen werden. Dabei schließen sich dieser Bezug zur Ministerialität und die Funktion Baumburgs als Hausstift der Spanheimer nicht aus. Vielmehr ist gerade die dominierende Präsenz der spanheimischen Ministerialität ein weiteres, wichtiges Indiz für die integrative Funktion des Stifts für diese Familie und ihre Herrschaft im Chi em gau.
Durch einen Vergleich der Schenkerkreise Baumburgs mit denen anderer oberbayerischer Stifte zeigt sich deutlich eine spezifische, von der span heimischen Ministerialität geprägte Struktur des Stiftes. So erhielten die viel näher an dem zentralen Burgort Kraiburg gelegenen Stifte Au und Gars kaum spanheimische Schenkungen, hierher stiftete das Gefolge der Herren von Mödling und die salzburgische Ministerialität99• An das Stift Herrenchiemsee gaben spanheimische und salzburgische Ministerialen gemeinsam, dominierend aber waren die salzburgischen Bezüge lOO• In Berchtesgaden wiederum, das durchaus Schenkungen der Spanheim-Ortenberger erhielt, zeigen sich ihre Ministerialen nur vereinzelt101 • Nirgends in Oberbayern lässt sich die umfangreiche, leider trotz einer exzellenten Quellenlage immer noch unbearbeitete spanheimische Ministerialität in solchem Umfang greifen wie in BaumburglO2•
Dabei ist die Konstanz der Schenkungen und das zunehmend exklusive Auftreten der spanheimischen Ministerialen in Baumburg trotz eines gestärkten Selbstbewusstseins der ministerialischen Eliten im
66 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
12. Jahrhundert, ohne die Zustimmung und Mitwirkung der Herrenfamilie nicht zu verstehen. Den Spanheim-Ortenbergern musste daran gelegen sein, dass die Stiftungen der Ministerialen zu ihrem Seelenheil an eine von ihnen bevogtete Institution gingen. Denn so blieben der Herrenfamilie die von den Ministerialen vergabten Besitzrechte über den Umweg der Vogtei herrschaftlich erhalten. Durch die Schaffung eines spirituellen Anziehungspunktes für andere, nicht dem eigenen Gefolge angehörende Schenker konnte auf diesem Wege sogar an eine Erweiterung der eigenen Herrschaft gedacht werden. Dazu kam nicht zuletzt, dass sich im gemeinsamen Gebetsgedenken von Herren und Ministerialen der Herrschaftsverband auch ideell konstitutierte.
Für die Ministerialen hingegen ging es wohl vor allem um das soziale Bedürfnis, an den Formen des religiösen Lebens teilzuhaben, die zuvor nur dem Hochadel vorbehalten waren. Durch eine Förderung der Memoria für die eigene Familie, die Anlage von Grablegen und das Eintreten von Töchtern und Söhnen in Stifte beanspruchte und imitierte diese aufsteigende Funktionselite nun das Memorialverhalten höher stehender Kreise. Dabei kamen die Ideale der Kanonikerreform den Ministerialen entgegen. Der "Kriegdienst für Gott" (militia Dei), den die Kanoniker anstrebten, musste dieser Kriegerelite besonders einleuchten103• Doch auch die Zusammensetzung der frühen Stifte, die sich bemühten, das sozial unterschiedslose Zusammenleben der Urkirche nachzuahmen, übte auf die unfreien Ministerialen einen starken Reiz aus. So ist das Phänomen zu beobachten, dass die Ministerialen generell eine gewisse Affinität zur Chorherrenreform entwickelten 104. Im Westen des Reiches gründeten sie sogar selbst Stifte 105. Im Südosten, im Salzburger Reformverband, kam es zwar nicht zu solchen ministerialischen Stiftungen, aber die grundsätzliche Tendenz ihrer Hinwendung zur Kanonikerreform lässt sich auch hier zeigen. Wenn die Traditionsbücher gerade der Chorherrenstifte des Chiemgaus voll sind von Ministerialenschenkungen, so ist das ein wichtiges Zeichen für die Attraktivität dieser Stifte für die Ministerialen.
Baumburg aber war noch weit stärker als andere Stifte von sehr engen und vielfältigen Beziehungen zur Ministerialität geprägt106• So gründet die Ministerialität zwar das Stift an der Alz nicht allein, sie war aber dennoch ausschlaggebend an der Gründung beteiligt, wie die Fundatio mitteilt. Das Traditionsbuch zeigt ferner, dass Ministeriale unmittelbar nach Graf Berengar von Sulzbach in beträchtlichem Umfang an Baumburg schenkten107• Noch zu Lebzeiten des Gründers stifteten die sulzbachischen bzw. spanheimischen Ministerialen Kuno von Hirnsberg, Eppo von Tettelham, Eticho und Eppo von Traun, Gerhard von Egerndach, Heinrich von Söllhuben und Gerhard von Wössenlo8.Auch der Edelfreie Gerhard von Truchtlaching, dessen Familie später in die spanheimische Ministerialität überging, gehört zu den ersten Wohltätern Baumburgs109• Zusammen mit dem Stifter Graf Berengar statteten also auch die Ministerialen, die sich so für die Errichtung des Stifts eingesetzt hatten, das Stift mit einem Grundstock an Gütern aus.
Und deren Besitztraditionen an das Stift verstärkten sich im 12. Jahrhundert noch. Der ganz überwiegende Teil der Schenkungen an Baumburg kam nicht etwa von der Gründerfamilie, von den SpanheimOrtenbergern oder den ebenfalls mitunter genannten Grafen von Frontenhausen, sondern von Ministerialen. Auch wenn immer wieder Schenkungen mit Konsens und in presentia des Herrn erwähnt werden, entscheidend war die ministerialische Initiative. Aus allen Teilen der spanheimischen Herrschaft in Oberbayern kamen Ministeriale nach Baumburg. Eine Ministerialengruppe saß in und um Kraiburg. Davon schenkten neben den Kraiburgern die Chraidorfer, Frauendorfer, Westernberger, Pietenberger, Haigerloher, und Kolbinger an das Stiftllo• Unweit des Stifts hatten die Truchtlachinger ihren Ansitzlll• Sie schenkten ebenso wie die im Osten des Sees bis zur Traun nachweisbaren Stötthamer, Harter, Narnberger, Trauner, Sondermoninger und Vachendorfer l12• Südlich, aus dem Gebiet, um die Burg Markwarts, Marquartstein, stifteten die Egerndach-Hohensteiner, Pettendorfer und Marquartsteiner1l3, Gaben aus dem Bereich westlich des Sees nur die Antworter 114 an das Stift, so konnte sich Baumburg über reiche Schenkungen der im Osten um den Waginger und Tachinger See beheimateten Lampertshamer, Törringer, Tettelhamer und Hag-Tittmoninger freuen 115. Aus allen Herrschaftsschwerpunkten der spanheimischen Fa-
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 67
Spanheim-ortenbergische Ministeriale in Baumburg
Inn
• Haigerloh
Legeng$<
• Stift
: Burg " • t>,[inisteriaknsitz
Tettelham.
j) .Anhvort
(/ Herrenchiemsee
Abb. 22 Die Spanheim-Ortenbergischen Ministerialen in Baumburg
milie in Oberbayern, zum Teil sogar aus dem niederbayerischen Rottal bedachten Ministeriale das Stift 11 6.
Wenn daneben vereinzelt noch sulzbachische ll7 oder salzburgische118 Ministeriale auftreten, dann fallen sie gegenüber der spanheimischen Dominanz kaum ins Gewicht. Auch die etwas häufiger belegten Besitztraditionen der Frontenhausener Ministerialen erreichen bei weitem nicht die Dichte und Häufigkeit der spanheimischen Schenkungen 119. Keine soziale Gruppe aber tat mehr für das Stift als die Ministerialität.
68 I ßaumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Manche Ministeriale entschlossen sich sogar, an der vita communis, dem Gemeinschaftsleben des Stifts, in vollem Umfang teilzunehmen und der Welt zu entsagen. Immer wieder gibt es Anzeichen für die conversio von Ministerialen und ihren Eintritt in das Stift. So nahm der Ministeriale Reginold von Frauendorf das Stiftsleben als Konverse auf sich120• Auch Angehörige der Marquartsteiner121 , Kraiburgerl22 und Tittmoninger123 lebten im Stift. Dass Töchter von Ministerialen in das Chorfrauenstift eintraten, ist bezeugt für die Truchtlachinger124, Pietenberger125 und Chraidorfer126• Gerade bei diesen Fällen ist oft nur schwer zu erkennen, ob es Damen im bereits fortgeschrittenen Alter waren oder ob noch unmündige Kinder an das Stift gegeben und für das geistliche Leben bestimmt wurden. Wenn Ministeriale Güter an Baumburg für die Erziehung ihrer Kinder unter der Regel des hl. Augustinus stifteten, so handelte es sich hier wohl um Oblationen, d.h. um die Übergabe von Kindern zur Erziehung an das Stift, mit dem Ziel, dass diese später zu Kanonikern bzw. Mitgliedern des Frauenkonvents wurden127• Diese Praxis war bei den Chorherrenstiften des 12. Jahrhunderts durchaus üblich. Die Springiersbacher Consuetudines, die in überarbeiteter Form auch im Salzburger Reformverband galten, kannten sie128 . In Baumburg wurden noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts Jungen und Mädchen zur Erziehung an das Stift tradiert129•
Alles zusammengenommen, durch die Konversion von Ministerialen, durch den Eintritt von Angehörigen der Schenkerfamilien und die Oblationen dürften die Baumburger Konvente in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stark von Angehörigen der Ministerialenfamilien geprägt gewesen sein. Sie verrichteten für ihre Brüder und Schwestern, die in der Welt verblieben waren, ebenso wie für die verstorbenen Eltern und Verwandten Gebete. Wenn Baumburg spätestens seit 1185 das Sepulturrecht hatte130, dann taten sie dies in einigen Fällen sogar am Grab ihrer Ahnen. Zumindest für die Truchtlachinger, eine der profiliertesten spanheimischen Ministerialenfamilien, ist eine Grablege im Stift auch urkundlich nachzuweisen131 •
Baumburg war also beides zugleich: Ministerialenstift und Hausstift der Spanheim-Ortenberger, in dem die konsensuale Gemeinschaft von Herrenfamilie und Ministerialität real erfahrbar wurde. Wenn Markgraf Engelbert II1. am Lebensende als Konverse in das Stift eintrat, so wird er manchem ministerialischem Mitstreiter als Bruder begegnet sein, ebenso wie Markgräfin Mathilde und Gräfin Elisabeth von Ortenberg gemeinsam mit zahlreichen Töchtern aus den Ministerialengeschlechtern dem Frauenkonvent angehörten.
Diese deutlich erkennbare Verschränkung von spanheimischem Herrschaftsverband und Stiftsgemeinschaft verhalf Baumburg auch nach der Trennung von Berchtesgaden und der Abwendung der Grafen von Sulzbach zur weiteren Blüte. Die baumburgische Stiftsgründung war vielleicht schon von Beginn an oder wurde zumindest sehr schnell zum Herzensanliegen der spanheimischen Ministerialität und ihrer Herren, wodurch die Grafen von Sulzbach als Stifter mehr als ersetzt wurden.
Konflikte zwischen Adel, Ministerialität und dem Stift
Und doch wäre es verfehlt, das Miteinander von Adel, Ministerialität und Stift nur harmonisch zu sehen, ohne auch auf die Gefährdungen, die in dieser engen Beziehung lagen, hinzuweisen. Schon um 1140 erwirkte der Baumburger Konvent von Papst 1nnozenz 11. ein Mandat, das den Bischöfen von Salzburg, Regensburg und Pass au auftrug, den Grafen Rapoto und seinen Ministerialen Friedrich zu ermahnen, ein von Rapotos Mutter Uta an das Stift gegebenes Gut wieder an Baumburg zu restituieren132. Schon zu diesem Zeitpunkt scheint es also in der Stifterfamilie verschiedene Auffassungen über den richtigen Umfang der Freigebigkeit an Baumburg gegeben zu haben. Doch bleibt dieses Zeugnis ein Einzelfall, auch das Traditionsbuch überliefert keine Zwistigkeiten zwischen der Vogtfamilie und Baumburg über
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 69
die Anfechtung von Schenkungen. Dagegen lässt sich die Schutzfunktion der Spanheimer als Vögte durchaus belegen 133.
Wenn die durch das Ende der Einträge in das Traditionsbuch dünner werdende Quellenlage nicht trügt, dann scheint es vor allem um 1200 und in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gehäuft zu Konflikten zwischen dem Stift und dem Adel bzw. der Ministerialität gekommen zu sein. Im Zuge der zunehmenden Herrschaftsverdichtung, die diese Zeit prägte, und die einherging mit der Definition und Abgrenzung früher nicht genau bestimmter Herrschaftsrechte, eskalierten territoriale Konflikte häufiger zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Auch Baumburg wurde hiervon in Mitleidenschaft gezogen. Als Herzog Leopold V. von Österreich die Grafen von Ortenberg um 1192 mit einer Fehde überzog, gingen Anhänger des Herzogs in der Region, Graf Eberhard von Dornberg und der unweit von Baumburg sitzende Rapoto vom Stein, ein Verwandter der Törringer, auch gegen Baumburg vor. Der Steiner habe das Stift durch Brand verwüstet, der Graf von Dornberg baumburgische Hörige gefangen genommenl34•
Noch Jahre später versuchte Baumburg durch päpstliches Mandat, Wiedergutmachung für die zugefügten Schäden zu bekommen. Bleiben die Motive dieses Kleinkriegs um Baumburg auch im Dunkeln 135,
so ist diese Auseinandersetzung doch ein wichtiger Hinweis darauf, wie stark noch in dieser Zeit Baumburg mit den Spanheim-Ortenbergern identifiziert wurde. Denn nur mit der Begründung, gegen die Ortenberger vorzugehen, konnte Rapoto vom Stein deren Stift Baumburg verwüsten.
Wenn Pfalzgraf Rapoto III. dann Jahrzehnte später, 1241, dem Stift Baumburg das Patronatsrecht in Sitzendorf als Kompensation für die von ihm und seinen Vorfahren zugefügten Schäden übergibt, so zeigt dies, dass es zwischen Stift und Spanheim-Ortenbergern immer wieder, vermutlich verstärkt nach 1200, zu Auseinandersetzungen um Besitzrechte kam136• Wie Gertrud Thoma im vorliegenden Band nachweisen konnte, legten bereits die Ortenberger und nicht erst die Wittelsbacher - wie bisher angenommen - den Markt Trostberg als Konkurrenzgründung zum baumburgischen Altenmarkt an137•
Damit errichtete die Vogtfamilie auf Baumburger Grund und Boden eine eigene Siedlung, wodurch Stift und Vogtfamilie in eine territoriale Konkurrenz traten. Auch als Wiedergutmachung für diese Schädigung könnte die Schenkung Rapotos zu verstehen sein. Wenn der letzte bayerische Pfalzgraf allerdings nach seinem Tod 1248 in Baumburg beigesetzt wurde, so zeigt sich auf diese Weise noch ein letztes Mal die Nähe der Spanheimer zu Baumburg, die die Geschichte des Stiftes im 12. und 13. Jahrhundert mehr zum Guten wie zum Schlechten geprägt hatte.
j Vgl. den Text in: SUB II Nr. 170,251-253. Zur Einordnung des
Trennungsbeschlusses aus Berchtesgadener Sicht: Stefan Weinfurter, Die Gründung des Augustiner-Chorherrenstiftes - Reformidee und Anfange der Regularkanoniker in Berchtesgaden, in: Geschichte von Berchtesgaden. Stift - Markt - Land, hg. v. Walter Brugger / Heinz Dopsch / Peter F. Kramml, I: Zwischen Salzburg und Bayern (bis 1594), Berchtesgaden 1991,229-264, hier 250-252, sowie den Beitrag von Heinz Dopsch in diesem Band.
2 SUB II Nr. 170, 252: " ... suborta est oppinio simplieibus quibusdam
fratribus ... " 3 BayHStA KU Berchtesgaden 3. 4 SUB I Nr. 170, 252: "Puit autem sententia iudiealis talis, ut quo
niam utrorumque locorum privilegia distinxerant alodia, in quibus
mine fundata sunt ambo monasteria fundatore amborum adhue
vivo separata et ab invieem disterminata ... "
Vgl. dazu den Beitrag v. Heinz Dopsch. 6 Das ergibt sich aus einer Analyse der Einträge im Traditionsbuch.
Nur Graf Berengar v. Sulzbach schenkte an das Stift selbst: Die Traditionen des Augustiner-Chorherrenstifts Baumburg an der Alz, bearb. v. Martin Johann Walko (= Quellen und Erörterungen
zur bayerischen Geschichte, NF 44,1), München 2004, Nr. 4, 7-10; Nr. 5a, 11-14; Nr. 29, 38. Seine Gemahlin gibt Hörige mit Zustimmung ihres Ehemannes in Nr. 249, 268-270. Der Sohn Berengars, Graf Gebhard 11. v. Sulzbach hingegen wird im Traditionsbuch nur indirekt, ohne selbst zu schenken, erwähnt.
7 Fundatio monasterii Baumburgensis, ed. Oswald Holder-Egger, in: MGH SS 15/2, Hannover 1888, 1061-1064.
8 Otto Meyer, Die Klostergründung in Bayern und ihre Quellen, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 51 (1931) 123-201; Hans Patze, Adel und Stifterchronik. Frühformen territorialer Geschichtsschreibung im hochmittelalterlichen Reich, in: ders., Ausgewählte Aufsätze, hg. v. Peter Johanek / Ernst Schubert / Matthias Wem er (= Vorträge und Forschungen 50), Stuttgart 2002,109-249, zuerst in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 100 (1964) 8-81 und 101 (1965) 67-128; ders., Klostergründung und Klosterchronik, in: ders., Ausgewählte Aufsätze (wie oben) 251-284, zuerst in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 113 (1977) 89-121; Jörg Kastner, Historiae fundationum monasteriorum. Frühformen monastischer Institutionengeschichtsschreibung im Mittelalter (= Münchener Beiträge zur
70 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Mediävistik und Renaissance-Forschung 18), München 1974; zu
sammenfassend Volker Honemann, Klostergründungsgeschich
ten, in: Verfasserlexikon, IV, Berlin 21983,1239-1247.
9 VgL dazu am Beispiel der eines anderen
auf die Grafen v. Sulzbach zurückgehenden Klosters: Jürgen Dendorfer, Zwischen adeliger und klösterlicher
Interessenswahrung: Die Kastler Reimchronik. Eine Quelle zur
Frühgeschichte Sulzbachs?, in: Sulzbach und das Land zwischen
Naab und Vils im frühen Mittelalter (= Schriftenreihe des Stadtmuseums und des Stadtarchivs Sulzbach-Rosenberg 19), Sulz
bach-Rosenberg 2003,43-60.
10 Gerd Althoff, Anlässe zur schriftlichen Fixierung adeligen Selbst
verständnisses, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 134 (1986) 34-46.
11 Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 31: " ... Hartwicus postea Ratisponensis episcopus ... "
12 Albert Brackmann, Die Kurie und die Salzburger Kirchenprovinz
(= Studien und Vorarbeiten zur Germania pontificia I), Berlin
1912,128.
13 Fundatio (wie Anm. 7) 1063f.
14 Fundatio (wie Anm. 7) 1062.
15 BayHSlA KL Baumburg 2, fol. 8r-lOv. In der Literatur zu klöster
lichen Fundationes fand die Baumburger Gründungsgeschichte
zwar wiederholt Beachtung, die Angaben zum Überlieferungszu
,al.'llll.CWllall'!! bei Meyer, Klostergründung (wie Anm. 8) 128, und Patze, Klostergründung (wie Anm. 8) 267f., sind aber falsch. Die
Fundatio steht nicht im Traditionsbuch (Patze, Meyer), sondern
in einem Codex der am Beginn des 13. Jahrhunderts verfaßt
wurde (BayHSlA KL Baumburg 2). Auf fol. lr-4r steht die älteste
Fassung des Baumburger Urbars. Vgl. Philippe Dollinger, Les
transformations du Regime domanial en Baviere au XIIIe siede d'apres deux censiers de l'abbaye de Baumburg, Strassbourg
1949,3; lohannes Wetze!, Die Urbare der bayerischen Klöster und
Hochstifte vom Anfang des 11. Jahrhunderts bis 1350, München
1995, 2lf. Darauf folgen Papsturkunden: Eine echte Urkunde Paschalls II. von 1110111, fol. 6r-6v. (Vgl. Germania Pontifida [wie
Anm.20] 76, Nr. 1), die Fälschung der Berchtesgadener Pascha
lisurkunde mit einem auf Baumburg bezüglichen Einschub, fol.
6v. (Brackmann, Kurie [wie Anm. 12]122-128) und zwei Urkunden Innozenz H. von 1139 (fol. 7r-8r) und 1141 (fol. 6v-7r)
(Germania Pontificia [wie Anm. 20] 76, Nr. 3+4). Die Fundatio ist erst nach diesen Papsturkunden eingetragen.
16 Meyer, Klostergründung (wie Anm. 8); Patze, Adel und Stifter
chronik (wie Anm. 8); ders., Klostergründung (wie Anm. 8). In
einem Codex des 15. Jahrhunderts findet sich die Baumburger
Fundatio dann auch am Beginn eines Kopialbuchs, also in dem
zu erwartenden Überlieferungszusammenhang: BayHStA KL Baumburg 9, wo am Anfang einer ersten Eintragsschicht, die bis
in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts reicht letzte Urkunde
von 1331 (fol. 43v-44r), erster Nachtrag von 1339 (fol. 44r) die Fundatio steht: fol. lr-3v.
17 Tr. Nr. 1~3, 3-7. Dabei handelt es sich um die erste Seite des
Traditionsbuchs: BayHSlA KL Baumburg 1, fol. 1, vgl. dazu Tr.
Tafel I. 18 Tr. Nr. 4f., 7-14.
19 Vgl. ab Tr. Nr. 6 die folgenden Einträge.
20 Baumburg verfügt über eine eindrucksvolle Serie von Papstur
kunden. Graf Berengar wird hier dabei in allen Bestä
tigungsurkunden des 12. Jahrhunderts als Gründer bzw. wich
tigster Stifter erwähnt. V gl. Germania Pontificia, I, hg. v. Albert
Brackmann, Berlin 1911,76, Nr. 1-3,6-8.
21 Vgl. den Beitrag von Heinz Dopsch in diesem Band.
Fundatio (wie Anm. 7) 1061, Z. 14-19: "Puitin Bawarie provincia comes illustris prosapie Cuno vacatus, omnibus eiusdem provincie nobilioribus sicut genere, sie etiam potestate seu diviciis excellens, cuius genuinus et cognitionis et cognationis posterorum elus postmodum communis locus usque hadie Vrantenhusen nuncupatur. Qui comes egregia liberorum procreatione fecundatus, habuit duZcissime indolis filiam Adilheit vocatam, pue/lam mire pulcritudinis, ita ut inter electissimas predicte terre mulieres, quantum genere prestantior, tantum forma decentior appareret ... "
23 Fundatio (wie Anm. 7) 1061, Z. 20-24: " .. , quam pater tenere diligens, dum, quia specie comparem filtam non reperit, et drum, CUt desponsaretur, eque nobtlem vel adeo perfectum tnvenire desperaret, et hac hesitatione, quid faceret, quid non, animus eius pro filia desponsanda multumque diuque vacil/ans versaretur in dubio, divina, ut creditur permissione factum est, lIt hee mentis ipsius nun satis approbanda elatio in se ipsam, quid esset reeognoseendum Te
traheretur hoc modo ... ': 24 Fundatio (wie Anm. 7) 1061, Z. 24-34.
25 Fundatio (wie Anm. 7) 1061, Z. 37-42.
26 Fundatio (wie Anm. 7) 1061, Z. 44; 1062) Z. 1-3: " ... precipue tamen in exercitio mititan; per quod etiam quia ignita pue1larum eorda, viri affeetantia cognitionem, maxime accenduntur, contigit prenominate puelle, ipso procante, ad eonsensum amoris sui animum inclinari .. ,':
27 Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 3-6: " ... sed nec quia fllrtivum amorem diu celari, nec patris permissione manifestum seu legittimum inter se coniugium fieri posse sciebant; sub strieta venere coerceri laboriosum estimantes, cupitis etiam amplexibus libere fru! iocundum reputantes, de raptu et fuga Invicem condixerunt. "
28 Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 6-13.
29 Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 20-26: "Ad eonsolandam ergo tarn sublte viduitatis desolationem predictum eastrum Marquarsten cum ministerialibus, prediis quoque et mancipiis omnibusque ditioni sue attinentibus in manus sepius diete coniugis sue, quia herede camit, libera traditione sub tali eomisso delegavit, vide/icet ut post mortem suam, quo cieius passet, ob communem utriusque memadam de ipso patrimonio eenobium in hanore beate Margarete construeret, personis aliquot inibi Deo servientibus prediis, quantum necessitas exigeret ad tempus, collocatis, ipsa quoque defuncta, idem patrimonium, exceptis ministerialibus, huic cenobio totaliter attineret.
30 Vgl. die Passage in der Fundatio (wie Anm. 7) 1061, Z. 15-17: " ...
cuius genuinus et eognitionis et cognationis posterorum eius postmodum communis lacus usque hodie Vrantenhusen nuncupatur."
31 'Ir. Nr. 120, 135-137; Nr. 168, 182f.; Nr. 218, 236f.; Nr. 224, 24lf.;
Nr. 291, 300; Zu den Frontenhausener Ministerialen, die an
Baumburg schenkten vgl. unten Anm. 119.
Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 27-32: " ... comes Udalricus de Pactavia, et prepotens ac predives, ita ut vulgo Vilrich appel/aretur, viduam ipsius duxit uxorem; per quam tarnen solam filiam generans nomine Utam, Einge/perto duci de Chraieburc eam desponsavit. Cui duci nati sunt per eam quatuor filii: Bernhardus dux Charintie, Einge/pertus marchio Ystrie, Hartwicus postea Ratispanensis episcopus et comes Rapoto de Chregeburc; de quibus propter notianis compendium mado tacebimus. "
33 Richard van Dü)men, Zur Frühgeschichte Baumburgs, in: Zeit
schrift für Bayerische Landesgeschichte 31 (l968) 3-48, hier 10,
spricht von "einer Stiftergemeinschaft" von Baumburg. 34 Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 20-26, vgl. das Zitat Anm. 29.
35 Fundatio (wie Anm. 7) 1062: » " personis aliquot inibi Deo ser-
Jürgen Dendorfer Baumburg und seine Gründer I 71
vientibus prediis, quantum necessitas exigeret ad tempus, collocatis, ipsa quoque defuncta, idem patrimonium, exceptis ministerialibus, huie cenobio totaliter attineret."
36 Fundatio (wie Anm. 7) 1062, Z. 36-40: "Milites autem comitis UIrici in manus aliene ditionis se transferri equanimiter non ferentes, usque ad retractionem huius facti repugnare non cessabant; et tamen consensu comitis hac donatione remissa, omni tempore quod domina eorum advixit, marito eius, quemadmodum iuris ratio exigebat, debitis obsequiis deferentes nichilominus adheserunt. "
37 Fundatio (wie Anm. 7) 1063, Z. 2-7:"At illa obidem testamentum matris sue comitisse Irmigardis simili de causa per desidiam suam adhuc in irritum remanere, ante non destitit, donec ipso comite cum 12 ministerialibus electissimis iureiurando se obligantibus cerrissime confirmatum est, non prius eam sepulture commendari., antequam cenobium sub patrocinio beate Margarete, secundum quod pie memorie Marquardus comes per eam fieri primitus insrituerat, fundaretur. "
38 Fundatio (wie Anm. 7) 1063, Z. 7-10: "Hiis erga dispositis, Alheidis comitissa post felicem vitam beato exitu defungitur in Domino; quam comes iuxta capellam suam in Sulzpach, ipsa terra propster iusiurandum, quo se cum suis obligaverat, sepulcri causa non effossa, sed humo aliunde asportata feeit operiri ... ':
39 Fundatio (wie Anm. 7) 1063, Z.IO-13: "Unde ministeriales graviter commoti, omnes in commune dominum sunt aggressi, attentissime supplicant, quatenus salutis sue causa et, ne simul cum eis ad ultimum periurus inveniatur, testamentum matris sue iam diu negleetum satageret adimpleri. "
40 Fundatio (wie Anm. 7) 1063, Z. 13-15: "Hiis ergo assidua interpellarione frequenter et acriter instantibus comes, omnibus suis in Iocum qui Rordorf dicitur convoeatis, tractare cepit de duarum eoniugum suarum testamentis ... '~
41 Fundatio (wie Anm. 7) 1063, Z. 15-19: " ... tractare (sc. comes Berengarius) cepit de duarum coniugum suarum testamentis, proponens eis, quod e duobus unum consilio inter se habito salubrius esse discernerent, aut duo cenobia, sicut ipse laudaverat, de prediis ad hec deputatis, /icet rerum et personarum penuriam habencia, aut unum sine utriusque defectu construi rebusque et mancipiis coadunatis honorifice dotari. Quibus unam ecclesiam cum copia quam duas eum inopia fundari sanius esse iudicantibus .. ::
42 Fundatio (wie Anm. 7) 1063, Z. 20-24: " ... comes capellanum suum Arnoltum saeerdotem cum illis 12, qui se una cum ipso iuramento astrinxerant, ad montem qui tune et nunc Boumburch appellatus est dirigens, eonsiderato hinc inde diligentissime Ioeo, fedt metin spaeia, primo ubi fabrica templi decentissime poneretur, deinde claustri ambitum et fratrum habitacula, postremo dispositionem officinarum congrue ordinari. "
43 Jan Ulrich Keupp, Dienst und Verdienst. Die Ministerialen Fried
rich Barbarossas und Heinrichs VI. ("" Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 48), Stuttgart 2002.
44 Vgl. zum }:olgenden: Heinrich Wanderwitz, Die Grafen von Sulz
bach, in; Eisenerz und Geschichte der Stadt Sulz
bach-Rosenberg (= Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadt
archivs Sulzbach-Rosenberg 12), I, Amberg 1999, 19-49; Jürgen
Dendorfer, Adelige Gruppenbildung und Königsherrschaft. Die
Grafen von Sulzbach und ihr Beziehungsgeflecht im 12. Jahrhun
dert (= Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialge
schichte 23), München 2004.
45 Elisabeth Noichl, Gründung und Frühgeschichte des Klosters
Rott bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, in: Willi Birkmaier (Hg.),
Rott am Inn. Beiträge zur Kunst und Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei, Weißenhorn 1983,7-17.
46 V gl. dazu den Beitrag von Heinz Dopsch in diesem Beitrag. Sowie
grundlegend Heinz Dopsch, Siedlung und Recht. Zur Vorge
schichte der Berchtesgadener Stifts gründung, in: Geschichte von
Berchtesgaden. Stift - Markt - Land, hg. von Walter Brugger I Heinz Dopsch I Peter F. Krammi, I: Zwischen Salzburg und Bayern (bis 1594), Berchtesgaden 1991, 175-228, hier 224-228.
47 Die Traditionen des Klosters Tegernsee 1003-1024, bearb. v. Peter
Acht (= Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte
NF 9,1), München 1952, Nr. 96a, 75. 48 Stefan Weinfurter, Reformidee und Königtum im spätsalischen
Reich. Überlegungen zu einer Neubewertung Kaiser Heinrichs V.,
in: ders. (Hg.), Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch
frühstaufischen Reich (= Quellen und Abhandlungen zur mittel
rheinischen Kirchengeschichte 68), Mainz 1992, 1-45, jetzt auch
in: ders., Gelebte Ordnung Gedachte Ordnung. Ausgewählte
Beiträge zu König, Kirche und Reich, hg. v. Helmuth Kluger I Hubertus Seibert I Werner Bomm, Sigmaringen 2005, 289-333.
49 Stefan Weinfurter, Die Kanonikerreform des 11. und 12. Jahr
hunderts, in: 900 Jahre Stift Reichersberg. Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg, Linz 1984,23-32, hier 25. Zur von
Rottenbuch ausgehenden Bewegung ist darüber hinaus immer noch hilfreich: Jakob Mois, Das Stift Rottenbuch in der Kirchen
reform des XL-XII. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Ordens-Ge
schichte der Augustiner-Chorherren (= Beiträge zur altbayeri
schen Kirchengeschichte 3,19), München 1953. Zum Salzburger
Reformverband: Stefan Weinfurter, Salzburger Bistumsreform und Bischofspolitik im 12. Jahrhundert. Der Erzbischof Konrad
I. von Salzburg 0106-1147) und die Regularkanoniker (= Köl
ner Historische Abhandlungen 24), Köln 1975. 50 Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 121-129.
51 Herrnann Jakobs, Die Hirsauer. Ihre Ausbreitung und Rechtsstellung
im Zeitalter des Investiturstreits Kölner Historische Abhandlun
gen 4}, Köln/Graz 1961. Früher bestand nur die ",ittelsbachische
Zelle Margaretenzell bzw. Fischbachau, ein Hirsauer Priorat, das erst
1102 zur Abtei erhoben wurde. Der Gründungsprozeß des schließ
lich nach Scheyern transferierten Klosters war aber auch damit noch
nicht abgeschlossen. Vgl. Jakobs, Hirsauer 37, 49. Zu Kast!: ebd.63(
52 Zu diesen Zusammenhängen Dendorfer, Gruppenbildung (wie
Anm. 44) 393-400.
53 Stefan Weinfurter, Papsttum, Reich und kaiserliche Autorität.
Von Rom 1111 bis Venedig 1177, in: Das Papsttum in der Welt
des 12. Jahrhunderts, hg. v. Ernst-Dieter Hehl f Ingrid Heike Rin
gell Hubertus Seibert (= Mittelalter-Forschungen 6), Stuttgart
2002,77-99, hier 82f.
54 /ürgen Dendorfer, Fidi milites? Die Staufer und Kaiser Heinrich
V., in: Grafen, Herzöge, Könige. Der Aufstieg der frühen Staufer
und das Reich, hg. v. Hubertus Seibert I Jürgen Dendorfer
(== Mittelalter-Forschungen 18), Stuttgart 2005, 213-265. 55 Zu Graf Berengar 1. unter Kaiser Heinrich V. zusammenfassend
Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 400-404. 56 Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 418-420.
57 Eine modernere Gesamtdarstellung der Geschichte dieser Fami
lie fehlt. V gl. aber zu den Anfangen des aus dem Rheinland stammenden Geschlechts im Osten des Reiches: Friedrich Hausmann,
Siegfried, Markgraf der "Ungarn mark" und die Anf.inge der
Spanheimer in Kärnten und im Rheinland, in: Jahrbuch für Lan
deskunde von Niederösterreich NF 43 (1977) 115-168; Heinz
Dopsch, Die Gründer kamen vom Rhein. Die Spanheimer als
Stifter von SI. Paul, in: Schatzhaus Kärntens. Landesausstellung
St. Paul 1991. 900 Jahre Benediktinerstift, II: Beiträge, Klagenfurt
1991,43-67. Zur Genealogie grundlegend: Friedrich Hausmann,
72 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
Die Grafen zu Ortenburg und ihre Vorfahren im Mannesstamm, die Spanheimer in Kärnten, Sachsen und Bayern, sowie deren Nebenlinien, in: Ostbairische Grenzmarken 36 (1994) 9-62. Für die Geschichte des Geschlechts im 12. und 13. Jahrhundert ist immer noch auf die ältere Darstellung von Eberhard Graf zu Ortenburg-Tambach, Geschichte des reichsständischen, herzoglichen und gräflichen Gesamthauses Ortenburg, 2 Bde., Vilshofen 1931132, zurückzugreifen.
58 Zu dieser Verbindung Sulzbacher - Spanheim-Ortenberger und den erwähnten Eheverbindungen vgl. Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 102-106.
59 Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 133-14l. 60 Zur bisher nicht beachteten Verwicklung der Spanheimer in die
Ereignisse um die Erhebung Heinrichs V. vgl. Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 394-400.
61 August Jaksch, Geschichte Kärntens bis 1335, I: Urzeit bis 1246, Klagenfurt 1924, 249-264 zu den ersten spanheimischen Herzögen Kärntens, zur Nachfolge: 25l.
62 Dopsch, Gründer (wie Anm. 57) 47. 63 Vgl. dazu Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 200-216. 64 Darauf, dass die Mitgift vor allem aus Gütern im Chiemgau be-
stand, verweist auch die Urkunde, mit der die Auseinandersetzung zwischen Mgf. Engelbert 111. v. Istrien und Graf Gebhard von Sulzbach um das Erbe der Mgf. Mathilde beigelegt wurde. Vgl. MB II 189f., Nr. 9.
65 Erster sicherer Beleg im iudicium Erzbischof Konrads I. von Salz-
burg: SUB 11 Nr. 170,251-253, hier 253: " ... Engilbertus marchio,
advocatus videlicet supradicti loci Poumburc ... ':
66 Zum Salzburger Reformverband vgl. Weinfurter, Salzburger Bisturnsreform (wie Anm. 49); ders., Neuere Forschung zu den Regularkanonikern im Deutschen Reich des 11. und 12. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift 224 (1977) 379-397; ders., Salzburg unter Erzbischof Konrad I. - Modell einer Bistumsreform, in: Salzburg in der europäischen Geschichte, hg. v. Eberhard Zwink (= Salzburg Dokumentation 19), Salzburg 1977,29-62.
67 Dazu Weinfurter, Salzburger Bistumsreform (wie Anm. 49) 69-74.
68 Die päpstliche Bestätigungsurkunde ist auf Il! 011111 zu datieren. Vgl. Germania Pontificia (wie Anm. 20) 76, Nr. I, zur späteren Datierung des dort noch auf 1105-1105 gesetzten Diploms vgl. Weinfurter, Gründung (wie Anm. I) 247.
69 Zu den Papsturkunden Baumburgs im 12. Jahrhundert vgl. Germania Pontificia (wie Anm. 20) 74-78.
70 Weinfurter, Salzburger Bistumsreform (wie Anm. 49) 143-15l. 71 Zur Baumburger Vogtei vgl. van Dülmen, Frühgeschichte (wie
Anm. 33) 21-25; Tr. Einleitung 70*f.; Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 298.
72 Germania Pontificia (wie Anm. 20) 76, Nr. 3; Druck: MB II 184, Nr.5.
73 Graf Berengar von Sulzbach ist allerdings nie als Vogt des Stifts belegt. Zuerst erscheint in dieser Funktion Graf Sigboto v. Weyarn, der diese Vogtei wahrscheinlich als Untervogtei im Auftrag der Grafen von Sulzbach ausübte (Tr. Nr. 31, 44f.). Er ist häufig im Gefolge Graf Berengars von Sulzbach nachweisbar, seine Nachfahren hatten umfangreiche Lehen von den Sulzbachern, vgl. Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 298, Anm. 1030. Er könnte für Graf Berengar bzw. dessen Sohn bis zu seinem Eintritt ins Stift Weyarn die Vogtei ausgeübt haben. Denkbar wäre allerdings auch, dass er erst nach dem Tode Berengars Vogt Baumburgs wurde. Da er nie zusammen mit Graf Gebhard 11. von Sulzbach erwähnt wird, er aber als Vogt gemeinsam mit Mgf. En-
gelbert 111. für das Stift handelte, ist auch eine Untervogtei für die Spanheim-Ortenberger bereits nach 1125 nicht auszuschließen. Zur Untervogtei: Martin Clauss, Die Untervogtei. Studien zur Stellvertretung in der Kirchenvogtei im Rahmen der deutschen Verfassungsgeschichte des Il. und 12. Jahrhunderts (= Bonner Historische Forschungen 61), Siegburg 2002; zu Graf Sigboto v. Weyarn: Sabine Buttinger, Das Kloster Tegernsee und sein Beziehungsgefüge im 12. Jahrhundert (= Studien zur altbayerischen Kirchengeschichte 12), München 2004,121-126.
74 Vgl. dazu die Ausführungen von Gertrud Thoma im vorliegenden Band.
75 Vgl. dazu die Kriterien für ein Hauskloster, die Wilhelm Störmer am Beispiel der wittelsbachischen Klöster herausgearbeitet hat: Wilhe1m Störmer, Die Hausklöster der Wittelsbacher, in: Wittelsbach und Bayern, III: Die Zeit der frühen Herzöge. Von OUo I. zu Ludwig dem Bayern. Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1180-1350, hg. v. Hubert Glaser, 139-150, hier bes. 148f.
76 Zusammenfassend Werner Hechberger, Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter (= Enzyklopädie deutscher Geschichte 72), München 2004, 21f.
n Vgl. dazu Dopsch, Gründer (wie Anm. 57) 43-45, 54-59 (zu Sponheim), sowie 49-54 (St. Paul).
78 Herzog Engelbert 11. von Kärnten selbst tradierte nie an das Stift, in dem immerhin die Mutter seiner Frau Uta begraben lag. Dafür stifteten seine Gattin Uta (Tr. Nr. 130, 148f.; Nr. 150, 167f.; Nr. 269, 282f.) sowie spanheimische Ministeriale, die als Ministeriale Herzog Engelberts bezeichnet werden (Tr. Nr. 54, 67f.; Nr. 60, 74f.; Nr. 93, 108f.; Nr. 106, 12lf.; Nr. 255, 273).
79 Tr. Nr. 48, 61; Nr. 101, 116f.; Nr. 204, 219f.; Nr. 236, 254f.; Nr. 297,
304f.; Nr. 308, 314f. Es handelt sich dabei um vereinzelte Güter sowie Hörige.
80 Vgl. etwa die große Schenkung Konrads v. Möglings an das Stift.
Er dürfte in den ersten Jahrzehnten überhaupt einen der größten Besitzkomplexe an Baumburg übergeben haben (Tr. Nr. 31, 40-44. Auch die Herren von Haberskirchen bedachten das Stift reich: Tr. Nr. 125, 141; Nr. 126, 142-144 sowie MB II 182, Nr. 182-183; Germania Pontificia (wie Anm. 20) 77, Nr. 4. Kontinuierlich gaben auch die Herren von Berg, Gern. Altenmarkt (Tr. Nr. 10, 20f.; Nr. 25, 34; Nr. 26, 34f.; Nr. 49, 62f.; Nr. 100, 115f.; Nr. 145, 162; Nr. 159-163, 176-179; sowie die Eulenschwang-Steiner (Tr. Nr. 65, 79f.; Nr. 67, 8If.; Nr. 77, 92; Nr. 144, 160f.; Nr. 201,
216f.; Nr. 244, 263f.; Nr. 263, 278; Nr. 288, 298f.). Der Umfang der Schenkungstätigkeit dieser Freien übertraf den der Spanheimer.
81 Zu den Schenkungen spanheimischer Ministeriale an das Stift, vgl. unten den Abschnitt "Das Ministerialenstift".
82 Vgl. hierzu ausführlich Gertrud Thoma im vorliegenden Band. 83 Dendorfer, Gruppenbildung (wie Anm. 44) 116-12l. 84 Vgl. die Schenkungen der Mathilde: Tr. Nr. 232, 249-251, sowie
MB II 189f., Nr. 9. 85 Einträge im Traditionsbuch: Tr. Nr. 34lf., 346-350; Nr. 344, 351-
353; damit in Zusammenhang stehen die Schenkungen ihres Sohnes, Graf Rapotos 11.: Nr. 343, 350f.; Nr. 345, 353f. Die eigene Urkunde Elisabeths findet sich gedruckt unter MB II 193f., Nr. Il. Zur päpstlichen Bestätigung vgl. Germania Pontificia (wie Anm. 20) 78, Nr. 10; Druck: MB II 194, Nr. 12.
86 BayHStA KL Baumburg 52; Necrologium Baumburgense, in: Necrologia Germaniae, 2: Dioecesis Salisburgensis, ed. Sigismund Herzberg-Fränkel, Berlin 1890-1894,236-255.
87 Stefan Weinfurter, Grundlinien der Kanonikerreform im Reich im 12. Jahrhundert, in: Franz Nikolasch (Hg.), Studien zur Geschichte von Millstatt und Kärnten. Vorträge der Millstätter Sym-
Jürgen Dendorfer ßaumburg und seine Gründer I 73
posien 1981-1995 (= Archiv für Vaterländische Geschichte und Topographie 78), Klagenfurt 1997,751-770, hier 754-756.
8B Einträge im Baumburger Nekrolog bezeichnen beide als Schwestern des Konvents. So Mathilde zum 31. Oktober: ,,Mathildis
marchionissa somr nostra" (Necrologium Baumburgense [wie Anm. 861 251), sowie Elisabeths zum 23. Januar: »Elizabeth comi
tissa conversa somr nostra de Orten berg» (Necrologium Baumburgense [wie Anm. 86] 237).
89 Necrologium Baumburgense (wie Anm. 86) zum 6. Oktober, 250: "Engelbertus marchio fr. n. el fundator".
90 Quelle dafür ist das in seinen Angaben zuverlässige, wohl auf Aufzeichnungen des 12. Jahrhunderts beruhende Seeoner Wohltäterverzeichnis, das in MB II 163f., im Anhang an das Seeoner Nekrolog des 12. Jahrhunderts gedruckt ist. Das Wohltäterverzeichnis findet sich allerdings nicht im Seeoner Kapitelsoffiziumsbuch, das dieser Nekrolog enthält. Vgl. BSB Clm 1048. Zur Beschreibung der Handschrift: Elisabeth Klemm, Die romanischen Handschriften der bayerischen Staatsbibliothek, T. 1: Die Bistümer Regensburg, Passau u. Salzburg (= Katalog der illuminierten Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek in München 3,1), Wiesbaden 1980, hier 166f., Kat. Nr. 276. Da die Angaben aber so detailliert und auch vor dem Hintergrund zeitgenössischer Quellen zuverlässig erscheinen, dem Druck in den Monumenta Boica wohl Aufzeichnungen aus dem 12. Jahrhundert zugrunde.
9! MB II 162. Heinz Dopsch, Die Grafen VOn Lebenau, in: Das Salzfass NF 4,2 (1970) 33-59, hier 46.
93 Für diese Tendenz spätmittelalterlicher klösterlicher L'berlieferung die Grablegen möglichst vieler und berühmter Adeliger für das eigene Kloster in Anspruch zu nehmen, ließen sich zahlreiche Beispiele anführen. In Baumburg, dessen Stiftsgeschichte im Spämittelalter keine historiographische Bearbeitung erfuhr, läßt sich das besonders an den Inschriften des 15. Jahrhunderts beobachten. Vgl. Siegrid Düll, Die Inschriftendenkmäler im CW;llldUlS,;ll
Augustiner-Chorherrenstift Baumburg, in: Jahrbuch des Vereins für Christliche Kunst 19 (1993) 7-260, inbesondere Nr. 55, 56, 59, 146-151. Mit Ausnahme Adelheids von Frontenhausen, Markwarts v. Marquartstein, Ulrichs von Passau und Elisabeths von Ortenberg sind für die hier genannten Personen andere Graborte belegt. Ob Ulrich von Passau, der seinen Herrschaftsschwerpunkt in Niederbayern hatte, in Baumburg begraben wurde, muss ebenfalls fraglich bleiben.
94 Zum Eintritt Engelberts ins Kloster: Necrologium Seonense, cd. Siegmund Herzberg-Fränkel, in: MGH Necrologia, Il, Berlin 1904, zum 13. April, 223: "Engilbertus ex duce m. n. c. predium
dedit"
Dopsch, Gründer (wie Anm. 57) 52. 96 Vgl. dazu Friedrich Hausmann (Hg.), Das Archiv der Grafen von
Ortenburg. Urkunden der Familie und Grafschaft Ortenburg (in Tambach und München), I: 1141-1400 (= Bayerische Archivinventare 42), Neustadt 1984, hier Kr. 70, 27.
97 Hausmann, Grafen zu Ortenburg (wie Anm. 57) 22, Nr. VI.3. 98 Hausmann, Grafen zu Ortenburg (wie Anm. 57) 17, Kr. IV.l u.
IV.3. Mathilde lebte als Konversin im Stift, in Frage käme für sie eine Bestattung an der Seite ihres Gatten '\1gf. Engelberts III. in Seeon (t 1173), der sich beim Grab seiner Eltern beisetzen ließ. Da das gutinformierte Seeoner Wohltäterverzeichnis Mathilde aber nicht erwähnt und sie zudem vor ihrem Gatten als Konversin starb, dürfte ihr Grab eher in Baumburg zu suchen sein. Für Elisabeth von Orten berg, behauptet eine Inschrift des 15. Jahr-
hunderts, die Beisetzung in Baumburg (Düll, Inschriften denkmäler [wie Anm. 93] NT. 56, 150f.)
99 Zu Au: Codex traditionum Augensium, hg. v. Johann Mayerhofer, in: Drei bayerische Traditionsbücher aus dem XII. Jahrhundert, hg. v. Hans Petz I Hermann Grauert I Johann Mayerhofer, München 1880,87-152; zu Gars: Die Traditionen, Urkunden und Urbare des Stiftes Gars, bearb. v. Heiner Hofmann Quellen und Forschungen NF 31), München 1983.
100 Codex traditionum Chiemseensium, in: MB II 271-371. lOI V gl. die Analyse der Schenkungen an Berchtesgaden durch Heim
Dopsch, Von der Existenzkrise zur Landesbildung, in: Geschichte von Berchtesgaden. Stift - Markt - Land, v. Walter Brugger I Heim Dopsch I Peter F. Kramml, I: Zwischen Salzburg und Bayern (bis 1594), Berchtesgaden 1991,371-386.
l02 Eine zusammenfassende Darstellung fehlt. Grundlegend für einzelne Familien im Osten des Chiemgaus Helga Reinde1-Schedl, Laufen an der Salzach. Die alt-salzburgischen Pfleggerichte l.aufen, Staufeneck, Teisendorf, Tittmoning und Waging (= HAB AIthayern 1 55), München 1989, hier 266-353 (Vor allem zu den Törringern, aber auch zu den Familien von Traun, Tettelham, Tittmoning-Hag, Törring, Lampertsham, Inzing, Panicher). Ansonsten ist auf die älteren Studien von Franz Tyroller, Der Chiemgau und seine Grafschaften, München 1954; ders., Die Grafschaften des Isengaus, in: Oberbayerisches Archiv 80 (J 955) 43-102, oder von Günther Flohrschütz, Die Vögte von Mödling und ihr Gefolge, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 38 (1975) 3-143, die methodische Schwächen aufweisen, zurückzugreifen. Am Rande berührt lohn B. Freed in seinen Studien zur salzburgischen Ministerialität immer wieder span heimische Familien: Diemut von Högl. Eine Salzburger Erbtochter und die erzbischöfliche Ministerialität im Hochmittelalter, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 1201121 (1980/81) 581-657; ders., Noble Bondsmen. Ministerial Marriages in the Archidiocese of Salzburg, 1100-1343, lthaca 1995.
103 Weinfurter, Grundlinien (wie Anm. 87) 753-755, 759f.; ders., Funktionalisierung und Gemeinschaftsmodell. Die Kanoniker in der Kirchenreform des 11. und 12. Jahrhunderts, in: Die Stiftskirche in Südwestdeutschland. Aufgaben und Perspektiven der Forschung, hg. v. Sönke Lorenz I Oliver Auge (= Schriften zur südwestdeutschen Landesgeschichte 35), Leinfelden-Echterdingen 2003, 107-121, hier 114f.
104 Vgl. Thomas Zotz, Milites Christi: Ministerialität als Träger der Kanonikerreform, in: Weinfurter, Reformidee (wie Anm. 48) 301-328.
105 Weinfurter, Funktionalisierung (wie Anm. 103) 118. 106 Zotz, Milites Christi (wie Anm. 104) 308f., hat vier Formen der Be
ziehungen zwischen Ministerialen und Chorherrenstiften herausgearbeitet, die sich alle auch im Verhältnis der spanheimischen Ministerialität zum Stift erkennen lassen: Die Gründung eines Stifts durch Ministeriale bzw. deren Beteiligung daran; ministerialische Besitzschenkungen; die Frage nach der conversio von '\1inisterialen und die Sepultur in Stiften. 1m Folgenden werden diese Punkte am Baumburger Quellenbestand zu überprüfen sein.
i07 Besonders anschaulich wird das an einer Traditionsnotiz VOn 1110, bei der sich der sulzbachische Ministeriale Kuno von
einer Schenkung seines Herren auf dem ersten Italien-zug unmittelbar anschloss. (Tr. Nr. 5, 11-14).
lOB Tr. Nr. 5, 6, 17, 18, 19,20,22,24. 109 Tr. Nr. 14f., 23-25. 110 Tr. Chraidorf. Kr. 317, 322; Frauendorf: Nr. 36, 50(.; Pietenberg: Nr.
90, 105f.; Nr. 191, 20M.; Nr. 199, 213f.; Kraiburg: Nr. 54, 67f.; Nr.
74 I Baumburg und seine Gründer Jürgen Dendorfer
59, 73f.;Nr.106, 12lf.; Nr.l07, 123; Nr. 255,273; Nr. 274, 28M.; Nr.
279, 289f.; Westcrberg: Nr. 157, 174; Nr. 170, 184f.; Nr. 200, 215f.;
Haigerloh: Nr. 212, 230f.; Nr. 332, 33M.; Kolbing: Nr. 350, 358.
III Tr. Nr. 14f., 23-25.
112 Tr. Stöttham: Nr. 134, 151f.; Hart: Nr. 194, 209f.; Nr. 290, 299f.;
Nr. 331, 334-336; Narnberg: Nr. 50f., 63-65; Traun: Nr. 251,
nOf.; Nr. 24, 32f.; Sondcrmoning: Nr. 83, 98f., Nr. 103, 118f.; Nr.
242, 26lf.; Nr. 32M., 330-332; Vachendorf: Nr. 52, 65f.
113 Tr. Egerndach: :,\Ir. 17,26-28; Nr. 37f., Slf.; Nr. 73, BBf.; Nr. 248,
268f.; Nr. 285, 294f.; Pettendorf. Nr. 34,48; Nr. 53, 66f.; Nr. 213,
23lf.; Marquartstein: Nr. ISS, 172.
114 Tr. Antwort: Nr. 86, lOlf.; Nr. 202, 217f.
fIS Tr. Lampertsham: Nr. 40, 54f.; NI. 192) 207f.; NI. 233, 2Slf.; Tör
ring: Nr. 56, 70f.; Nr. 143, 159f.; Nr. 207, 223f.; Nr. 266, 280f.; Nr.
314,319; Nr. 331, 334-336; Nr. 357, 364f.; Tettelham Nr. 6, 14f.;
Nr. 46, S9f.; Nr. 64, 78f.; Nr. 119, 134f.; Nr. 190, 20Sf.; Hag-Titt
moning: Nr. 39, 52f.; Nr. 84, 99f.; Nr. 206, 222f.; Nr. 210, 227-229;
Nr. 259, 275f.; Nr. 300, 307; Nr. 324f., 328-330; Nr. 365, 372.
116 Ministeriale Rapotos l.. Nr. 177, 192; Nr. 214, 232f. und Rapotos
Ir.: Nr. 356, 363.
117 Tr. Nr. 18f., 28f.; Nr. 19, 29f.; Nr. 198, 212f.; Nr. 230, 247f.; Nr. 55~
68-70.
us Tr. Nr. 23, 31f.; Nr.153, 170;Nr. 189,204; Nr. 305, 311f.; Nr. 322,326.
119 Tr. Nr. 109-112, 124-128: Nr. 120, 135-137: Nr. 124, 140; Nr.154,
171; Nr. 188, 203f., Nr. 216, 235; Nr. 225, 242f.; Nr. 227, 244; Nr.
242,262f.
Vgl. Tr. Nr. 36, 50f. (Vorbemerkung!) sowie Nr. 137, 154f. 121 Tr. Nr. 155, 172.
122 Tr. N r. 240, 259f.
123 Tr. Nr. 339,344.
124 Tr.NT. 174, 189.
125 Tr. Nr. 127; 144f.
126 Tr. Nr. 317, 322f.
127 Zur mittelalterlichen Oblationspraxis vgL mit reicher Literatur
Maria Lahaye-Geusen, Das Opfer der Kinder. Ein Beitrag zur Li
turgie- und Sozialgeschichte des Mönchtums im Hohen Mittelal
ter ('" Münsteraner Theologische Abhandlungen 13),Altenberge
1991, bes. 39f., wonach in den Consuetudines die Existenz der
pueri oblati "in den meisten Konventen nicht wegzuleugnen ist,
auch wenn versucht wird, ihre Position als zukünftige Mönche
bzw. Kanoniker mit wohlgemeinten Klauseln über die Einhal
tung von Altersvorschriften zu kaschieren".
128 Nach den Springiersbacher Consuetudines gab es die Oblation in
den Augustiner-Chorherrenstiften durchaus: Consnctudines C3-
nonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses, cd. Stepha
nus Weinfurter ('" Corpus Christianorum 48), Turnhoult 1978, § 233, 123f., sowie inbesondere § 248, 134f. Vgl. auch Consuetudi
nes Canonicorum regularium RodenseslDie Lebensordnung des
Regularkanonikerstifts Klosterrath ('" Fontes Christiani 11), Frei
burg 1993, Nr. 233, 431; Nr. 248, 4slf.
129 Die Formulierungen der einschlägigen Baumburger Traditionsno
tizen legen eine solche Interpretation und nicht etwa die Annahme,
es handle sich um eine bloße Schulerziehung im Stift nahe. So über
gab Liudgard, die Witwe des spanheimischen Ministerialen Fried
bert v. Sondermoning ein Gut an Baumburg, damit ihr Sohn "ab eiusdem loci fratribus reciperetur et secundum regulam sancti Augustini in communem vitam nutriretur" (Tr. Nr. 115, 130). Gerade die
Formulierung nach der Regel des hl. Augustinus, "in communem vitam" ist mit Sicherheit nur auf eine Erziehung für das Stiftsleben
zu beziehen. Der Zusammenhang zwischen nutritio und Eintritt in
das Stiftsleben (in communem vitam) zeigt sich ferner an der Schen
kung eines puer seolaris Gottschalk, der ein Gut für sein Studium
übergibt und wenn er eintritt für sein Seelenheil, "si iniret communem vitam, pro remedio anime sue". Die nutritio ist also eine Vor
stufe zum Klostereintritt, ganz wie es die Consuetudines, unter Be
rücksichtigung einer freien Entscheidung, vorsehen. VgL weitere
Fälle solcher Oblationen: Tr. NT. 199, 213f. (eine Pietenbergerinl;
Nr. 230, 247f. (Hohenaschauer, sulzbachische Minsiteriale); Nr.
151, 168f. (Schwaibacher, spanheimische Ministeriale [?]); Nr. 207,
223f. (Törring); Nr. 124, 140 ein Mädchen aus der Frontenhause
ner Ministerialenfamilie von Gindlkofen. Andere, nicht ministeria
lische Oblationen: Nr.140, 157f.; Nr.148, 165.
130 In diesem Jahr wird das Sepulturrecht zum ersten Mal in einer
päpstlichen Bestätigungsurkunde genannt: Germania Pontificia
(wie Anm. 20) 77, Nr. 7; Druck: Pflugk-Harttung, Acta inedita
(wie Anm. 134) Nr. 375, 327f.
13l Der Burggraf Konrad v. Salzburg, ein Truchtlachinger, stiftete
1217 für das Grab seiner Eltern in Baumburg: SUB m Nr. 699,
212. Zur familiären Einordnung Konrads als
Freed, Diemut von Högl (wie Anm. 102) 620-631; Heinz
Dopsch, Die soziale Entwicklung, in: Geschichte Salzburgs. Stadt
und Land, I: Vorgeschichte, Altertum, Mittelalter, Teil 2, hg. von
Heinz Dopsch, Salzburg 21983,361-418, hier 379f.
132 Germania Pontificia (wie Anm, 20) 77, Nr. 5; Druck: Julius v.
Pflugk-Harttung (Hg.), Acta pontificum Romanorum inedita, II:
Urkunden der Päpste vom lahre c. 97 bis zum Jahre 1197, Stutt
gart 1884, Nr. 358, 320f.
133 Vor allem die selbst an das Stift nie schenkenden Herren von
Nußdorf führten mit Baumburg Auseinandersetzungen um Be
sitz in Mögling vgl. Tr. Nr. 315, 320f.; Nr. 321, 325, Mgf. Engelbert
IIL sorgte offensichtlich immer wieder dafür, dass das Stift nicht
geschädigt wurde. Auch die spanheimischen Ministerialen v.
Haarbach leisten "in presentia" Mg{. IIl. Verzicht auf
ihre Ansprüche gegenüber dem Stift: Tr. Nr. 304, 31Of.
134 Quelle sind die päpstlichen Mandate, die Baumburg in dieser
Frage erwirkte: Germania Pontificia (wie Anm. 20) 78, NT. 9;
Druck in: MB II 194f., Nr. 13; vgl. auch Germania Pontificia 78,
Nr. 12; Druck: lulius v. Pflugk-Harttung (Hg.), Acta pontificum
Romanorum inedita, I: Urkunden der Päpste vom Jahre 748 bis
zum lahre 1198, Tübingen 1881, Nr. 440, 377.
135 Dieser Konflikt ist Teil einer größeren, eskalierenden Auseinander
setzung am Ende des 12. Jahrhunderts, in den führende bayerische
Adelsgeschlechter wie die Bogener und Ortenberger, aber auch die
Herzöge von Österreich, Bayern und Böhmen, sowie Kaiser Hein
rich VI. involviert waren. In den 90er Jahren zog dieser Krieg den
ganzen Osten Bayerns in Mitleidenschaft. Im Umfeld der spanhei
mischen Herrschaft im Chiemgau dürften territoriale Konkurren
ten die größere Fehde genutzt haben, um in der Region Vorteile zu
erringen. Vgl. den Versuch von Richard Loibl territoriale Umbrü
che im Donauraum als Ursache für diese Bogener Fehde festzuma
chen: Richard Loib!, Iubente Imperatore pax facta est. Die "Boge
ner Fehde" von 1192 und die Anfänge des bayerischen
Landesfürstentums, in: Bayern vom Stamm zum Staat. Festschrift
für Andreas Kraus zum 80. Geburtstag, hg. v. Konrad Ackermann
I Alois Schmid I Wilhelm Volkert ('" Schriftenreihe zur bayeri
sehen Landesgeschichte 140), München 2002,157-183.
136 MB II 199f., Nr. 19.
137 V gl. Gertrud Thoma in diesem Band.