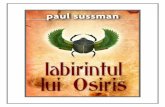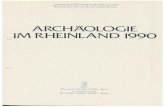"Möge dir Osiris frisches Wasser geben" Nilwasser und seine Bedeutung für den Isiskult, Antike...
Transcript of "Möge dir Osiris frisches Wasser geben" Nilwasser und seine Bedeutung für den Isiskult, Antike...
von Kathrin Kleibl
Ein in Herculaneum gefundenes Fresko zeigt folgende Szene: Ein weißgekleide-
ter, kahlgeschorener Priester steht im Ein-gang eines ägyptisch anmutenden Tempels. Er präsentiert mit verhüllten Händen einen Krug, in dem sich heiliges Wasser befindet. Nichts darf den Krug oder das Wasser verun-reinigen. Neben ihm stehen zwei Kultdiener mit Sistren (Klappern). Auf der Tempeltreppe und in dem davor liegenden Hof ist die Kult-gemeinde versammelt. In ihrer Mitte befindet sich ein weiterer Priester, der einen Hymnos vorträgt; die festlich gekleideten Gläubigen sind durch Singen und Musizieren in den Ri-tus mit eingebunden. Weiter vorne entzündet ein dritter Priester das Rauchopfer an einem geschmückten Altar. So in etwa kann man sich die morgendliche Öffnung des Tempels im gräco-ägyptischen Götterkult vorstellen (Abb. 1).
Authentisches NilwasserIn der altägyptischen Vorstellung war der Nil eine Verkörperung des Osiris und die jähr-lich stattfindende Nilflut sein Ejakulat, das sich über das Land Ägypten ausbreitete und dieses befruchtete; gleich wie Osiris seine Isis befruchtete und damit den Horus zeugte. Für die Anhänger des Isis-Kultes war es daher von großer Bedeutung, dass authentisches Nil-wasser für die Zeremonien genutzt wurde. Im
Iseum Campense, dem großen Isisheiligtum auf dem Marsfeld in Rom, bevorzugte man dieses echte Wasser vom Nil; eine Tatsache, die der römische Satirendichter Juvenal (58–138 n. Chr.) belustigt zur Kenntnis nahm. Er spottete über eine Pilgerin, dass «wenn die weiße Io (Isis) es befiehlt, sie bis ans Ende Ägyptens reisen wird und das Wasser heim-bringt das sie aus dem heißen Meroe geholt hat.» Es wurden scheinbar nicht nur in Rom große Anstrengungen unternommen das hei-lige Wasser aus Ägypten herbeizuschaffen. In Pompeji fand man bei Ausgrabungen zahlrei-che Amphoren mit der Aufschrift «Gabe des Sarapis» (der gräco-ägyptische Gott Sarapis wurde häufig mit Osiris gleichgesetzt). Es ist anzunehmen, dass sich in diesen Transport-gefäßen echtes Nilwasser befand, was – wie in dem von Juvenal berichteten Beispiel – von Ägypten nach Pompeji verschifft wurde.
Für die Rituale benötigten die Anhänger vermutlich mehr Wasser, als sie herbeibringen konnten. So erdachten sie sich «Umwege», über die das Nilwasser in die Heiligtümer ge-langte. Der Nil war nach griechischer Vorstel-lung unterirdisch mit den Quellen bestimmter Flüsse verbunden. Man stellte sich etwa eine Verbindung zum Flüsschen Inopus auf der Kykladeninsel Delos im Ägäischen Meer vor. Auf Delos wurden im 3. bzw. 2. Jh. v. Chr. – neben dem überregional berühmten und be-deutenden Apollon-Heiligtum – außerdem zwei kleine und ein großes Heiligtümer für
«Möge dir Osiris frisches Wasser geben»Nilwasser und seine Bedeutung für den Isis-Kult
Wasser war das wichtigste der vier Grundelemente im gräco-ägypti-schen Isis-Kult. Zahlreiche antike Textquellen beschreiben den Einsatz von Wasser in den Riten und bei festlichen Anlässen. Darstellungen von Wasserträgern, die Funde kostbarer Wassergefäße und aufwendig ge-staltete unterirdische Gebäudestrukturen, aus denen das heilige Wasser geschöpft wurde, legen Zeugnis über die Bedeutung des Wassers im Isis-Kult ab. Denn im Wasser manifestierte sich der ägyptische Gott Osi-ris, der Bruder und Gatte der Göttin Isis.
t
ite
lth
eM
A
ANTIKE WELT 6/1316
t
ite
lth
em
a
gräco-ägyptische Götter errichtet. Das Ino-pus-(Nil)Wasser wurde dann in einem gro-ßen Reservoir gesammelt und von dort direkt in die Heiligtümer geleitet oder getragen. So konnten die Priester für ihre Rituale stets auf «originales» Nilwasser zurückgreifen.
Fehlte ein «Nil-Ersatz» gänzlich, musste notgedrungen auch normales Wasser sym-bolisch in Nilwasser verwandelt werden. Plutarch schrieb hierzu: «Nicht allein den Nil, sondern alles Feuchte nennen sie (die Anhänger des gräco-ägyptischen Kults) ganz allgemein einen Ausfluss des Osiris und bei den Festzügen geht immer das Wassergefäß zu Ehren des Gottes voran.» Gleich wie es uns auf dem Fresko aus Herculaneum gezeigt
ist, und auch wie von Apuleius (***Stellenan-gabe***) in seinem 11. Buch der Metamor-phosen beschrieben wird.
Das wichtigste Fest des gräco-ägyptischen Isis-Kultes war das Navigium Isidis zu Ehren der Göttin Isis, die auch die Patronin der Seeleute war. Es wurde am 5. März gefeiert, wenn man die Seefahrt nach den Winter-stürmen wieder aufnahm. Anlässlich dieses Festes fand eine groß angelegte, festliche Pro zession von den Heiligtümern aus zum Meer hin statt. Apuleius beschreibt diesen Umzug ausführlich, sodass wir über deren Teilnehmer recht genau Bescheid wissen. Am Schluss der Prozession schreitet ein Priester mit einem «Bild des höchsten We-
Abb. 1 Fresko aus Herculaneum: morgendliche Öffnung des Tempels mit der Anbetung des heiligen Nilwasser, das den Gott Osiris verkörpert.
6/13 ANTIKE WELT 17
t
ite
lth
eM
A
sens», eine goldene Urne mit runden Bo-den, die außen Bildzeichen der Ägypter trug und «deren nicht besonders langer Hals in einem weit vorstehenden Schnabel endet, während auf der Gegenseite ein stark ausla-dender Henkel angebracht war, um welchen sich eine Schlange wand, die ihren gesträub-ten Schuppenhals blähend emporstreckte.» Neben den tief religiösen Elementen dieses Zuges hatte die Prozession aber auch einen volkstümlich komischen Charakter, der an
heutige Karnevalszüge erinnert. Gaukler und Verkleidete amüsierten mit Parodien die um-herstehende Menge an den Straßenrändern bevor die Priester aufliefen. Der Festzug re-präsentierte die Metamorphose vom schau-spielernden und orientierungslosen Clown zu einem Diener der erhabenen Götter Isis und Osiris. Dem Anhänger war genau diese Verwandlung im Kult gräco-ägyptischer Göt-ter möglich, so er sich in die Mysterien ein-weihen lassen wollte.
Abb. 2 Wasserkrypta im Iseum
in Pompeji.
ANTIKE WELT 6/1318
t
ite
lth
em
a«Möge dir Osiris frisches Wasser geben» – Nilwasser und seine Bedeutung für den Isis-Kult
Wasser zur errettung des Menschen – initiation in die Mysterien
Wollte man Mitglied in der Kultgemeinde gräco-ägyptischer Götter werden, musste man sich in die Mysterien der Isis einweihen lassen. Apuleius beschreibt am Beispiel des Lucius, wie eine solche Initiation stattgefun-den haben könnte.
Bei den Einweihungen ist Wasser gleich für mehrere Bereiche von Bedeutung gewe-sen. Zum einen wird es für die rituellen Rei-nigungen vor der eigentlichen Weihenacht verwendet. Noch wesentlich bedeutender ist aber das Wasser, dem der Myste in seiner nächtlichen Initiation begegnet. An altägyp-tische Traditionen angelehnt durchfährt der Initiant wie Osiris-Re nachts die Unterwelt und wird so eins mit dem Gott. Eine Wei-hung aus Thessaloniki aus dem 2. Jh. v. Chr. beschreibt diese Fahrt: Phylakides errichtete einen Naos für Osiris mit einer hohlen Lade, die im Inneren das Wasser trägt; in die-ser Lade fährt der Gott dann in der «durch Sterne beschienenen» Nacht umher und ver-setzt Isis in Festfreude. Am nächsten Morgen kommt es zu einer Auferstehung des wieder-belebten und neugeborenen Mysten, gleich wie Re (die Sonne) am Morgen kraftvoll am Horizont aufgeht.
Das Suchen und Finden des OsirisWie schon in der Weihung aus Thessaloniki angedeutet, treibt der tote Osiris in einem Sarg auf dem Nil umher. Isis sucht und fin-det schließlich ihren Brudergatten, um ihn mit Hilfe des Anubis zu neuem Leben zu erwecken. Plutarch berichtet, dass die Kult-gemeinden dies Isis gleichtun und nachts zu einem See aufbrechen. Dabei handelt es sich um sogenannte «Heilige Seen», wie sie auch in den ägyptischen Tempelanlagen zu finden sind: künstlich angelegte, viereckige Becken, die in ihrer Größe stark variieren können. Dort findet nun eine rituelle Insze-nierung des Mythos statt. Der Priester bringt zu diesem Anlass einen Korb mit, in dem sich – zunächst noch verhüllt – das goldene Wassergefäß befindet. Er füllt dieses schließ-lich mit (Nil)Wasser aus dem See. Die Ge-meinde ruft daraufhin: «Osiris ist gefunden» (Abb. 2).
WasserkryptenGab es in den meisten Heiligtümern gräco-ägyptischer Götter außerhalb Ägyptens nicht die Möglichkeit große Seen oder Bassins an-zulegen, musste man sich auf andere Art be-helfen. Die in einigen Heiligtümern entdeck-ten Wasserkrypten stellen eine nur für den gräco-ägyptischen Kult spezifische Gebäude-struktur dar, die klare Bezüge nach Ägypten aufzeigt. Wo sie innerhalb der Sakraltopo-graphie lagen spielte wohl keine Rolle; ent-scheidend war, dass sie nur eingeschränkt zu-gänglich waren und unterirdisch lagen. Eine weitgehend komplett erhaltene Wasserkrypta befindet sich im Iseum von Pompeji. In ei-nem kleinen tempelartigen Gebäude führt eine Treppe in einen unterirdischen Raum. Dort befinden sich ein Becken, das mit Re-genwasser gespeist wurde, sowie eine kleine Abstellfläche mit einem Krug. Im Giebel an der Frontseite des Gebäudes ist die Anbetung des Wassers verbildlicht (Abb. 3).
In ihrer Architektur und Funktion ahmten die Wasserkrypten die ägyptischen Nilome-ter bzw. Pseudo-Nilometer nach. Nilometer dienten in Ägypten zum Abmessen des Nil-standes, der besonders zu Zeiten der Nilflut von großer Bedeutung war. Brachte man in Ägypten den Gott Hapi mit den Nilfluten in Verbindung, wurde in der griechisch-rö-mischen Vorstellung besonders Osiris bzw. Sarapis mit dem Nil und dessen Fluten asso-ziiert. In den Wasserkrypten außerhalb Ägyp-tens konnte zwar der tatsächliche Nilstand nicht abgelesen werden, jedoch schwankte auch dort der Wasserstand je nach Jahreszeit und Intensität der Regenfälle; man war auch dort auf die Naturgesetze angewiesen. Wie in Ägypten konnte man so (Nil)Wasser für kul-tische Zwecke schöpfen.
Zu diesen kultischen Zwecken zählte die schon erwähnte morgendliche Öffnung des
Abb. 3 Detailansicht des Giebels der Wasserkrypta: Anbe-tung des Kruges, in dem sich Nilwasser befindet.
6/13 ANTIKE WELT 19
«Möge dir Osiris frisches Wasser geben» – Nilwasser und seine Bedeutung für den Isis-Kult
tit
elt
he
ma
Tempels, die tägliche Tempelreinigung wie auch mit großer Wahrscheinlichkeit Riten im Rahmen der Initiationen, bei denen den Mysten die Identifikation mit Osiris durch das Nil-wasser ermöglicht wurde.
Osiris ist das WasserFehlten im griechisch-römischen Kulturkreis zwar überwiegend die menschlichen Kultbil-der für Osiris, so wurde ihm trotzdem in sei-ner Erscheinungsform als Wasser gehuldigt.
Ab dem 1. Jh. v. Chr. stellten die An-hänger in einigen Heiligtümern sogenannte Osiris-Kanopen auf – Gefäße mit dem
Kopf des Gottes als Deckel, auch Osiris-Hydreios-Figuren genannt –, in denen sich heiliges Nilwasser befand. Die Behälter fan-den ursprünglich in Ägypten im Totenkult Verwendung und zwar zur Verwahrung der Eingeweide, die separat vom Körper bestat-tet wurden. Im gräco-ägyptischen Kult wur-den sie – auch als Scheinkanope ohne hoh-les Innere – zum Kultbild des toten Osiris (Abb. 4).
Außerordentliche Kräfte des NilwassersIm Nilwasser ertrunkene Menschen oder Tiere galten in Ägypten als besonders ge-
Abb. 4 Diese Priester-Statue, auf-gestellt an ihrem Fundort,
misst 1,22 m und hält eine Osiris-Kanope der Hand.
Die Skulptur wurde bei Aus-grabungen des Europäi-
schen Instituts für Unterwas-serarchäologie (IEASM) unter
Leitung von Franck Goddio im Osthafen von Alexandria auf der versunkenen Insel
Antirhodos entdeckt.
t
ite
lth
em
a«Möge dir Osiris frisches Wasser geben» – Nilwasser und seine Bedeutung für den Isis-Kult
segnet, da sie mit dem ertrunkenen Osiris gleichgesetzt wurden. Wie bei Osiris er-weckte der Nil bei allen Lebewesen neues Leben – wenn auch nur im Totenreich. An-tike Quellen berichten davon, dass an jenen Stellen wo im Nil Ertrunkene ans Ufer ge-spült wurden, Kultstätten für diese errichtet wurden. Die Toten wurden rituell verehrt und genossen quasi den Status eines Halb-gottes.
Auch im gräco-ägyptischen Kult wurden dem Nilwasser noch eben jene Kräfte zuge-sprochen. Dies zeigen etwa die hauptsäch-lich in der Umgebung von Rom gefundenen Grabinschriften, die die Worte «Möge dir Osiris frisches Wasser geben» wiedergeben. Der wohl prominenteste im Nil Ertrunkene römischer Zeit, war der Geliebte des Kaiser Hadrian Antinoos. Das Unglück fand im Jahr 130 n. Chr. statt, als sich Kaiser samt Gefolge auf einer Nilkreuzfahrt befanden. Unklar ist die genaue Ursache, die zum Ertrinken An-tinoos führte. Zeitgenossen vermuteten, dass Antinoos im Rahmen magischer Riten sein Leben für Hadrian geopfert habe. Moderne Forschungen gehen jedoch davon aus, dass Antinoos für Hadrian geopfert wurde, der sich damit ein längeres Leben erhoffte. Sicher ist jedoch, dass Antinoos nach seinem Tod vergöttlicht wurde – er erhielt eine Priester-schaft, Tempel und Agone. An seiner Todes-
stelle gründete Hadrian die Stadt Antinoopo-lis.
«Mit allen Wasser gewaschen»Das Wasser, – und nicht nur Nilwasser – dass in der Zeit um Christi Geburt von ei-nigen Religionen zur rituellen Reinigung verwendet wurde, legte wohl die Grundlage zum Ausspruch, man sei «mit allen Wassern gewaschen». War man in alle Mysterien ein-geweiht, konnte man sich so sicher sein, dass einem nichts auf dieser Welt und auch im Jenseits passieren konnte.
Adresse der Autorin
Dr. Kathrin Kleibl Am Fillerberg 9f D-27793 Wildeshausen
Bildnachweis
Abb. 1: akg-images / MPortfolio / Electa; 2: ***bitte liefern***; 3: Foto K. Kleibl; 4: © Franck Goddio/Hilti Foundation, Foto Christoph Gerigk.
literatur
L. BRICAULT, Les cultes isiaques dans le monde Gréco-Romain (2013).
K. KLEIBL, ISEION – Raumgestaltung und Kultpraxis in den Heiligtümern gräco-ägypti-scher Götter im Mittelmeerraum (2009).
R. A. WILD, Water in the cultic worship of Isis and Sarapis (1981).
«Möge dir Osiris frisches Wasser geben» – Nilwasser und seine Bedeutung für den Isis-Kult
tit
elt
he
ma
Anzeige
Anz. 1/3 S. quer – Greece Desing