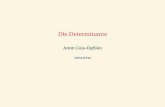M. Herdick, Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der...
Transcript of M. Herdick, Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der...
Stefan Albrecht · Falko Daim · Michael Herdick (Hrsg.)
DIE HÖHSIEENDLUNGEN IM BERGLANDDER KRIMUMWELT, KULTURAUSTAUSCH UND TRANSFORMATION AM NORDRAND DES BYZANTINISCHEN REICHES
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 2013
Römisch-Germanisches ZentralmuseumForschungsinstitut für Archäologie
Sonderdruckaus Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Band 113
Redaktion: Markus C. Blaich, Hildesheim; Stefan Albrecht,Reinhard Köster (RGZM)Satz: Hans Jung (RGZM)Bildbearbeitung: Hans Jung (RGZM); Franz Siegmeth, Illustra-tion · Graphik-Design · Malerei, Bad Vöslau / AUmschlaggestaltung: Reinhard Köster (RGZM) unter Verwen-dung einer Ansicht des Aufgangs zur Höhensiedlung Ėski Ker-men (Foto Stefan Albrecht, RGZM)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografi-sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abruf-bar.
ISBN 978-3-88467-220-4
ISSN 0171-1474
© 2013 Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begrün -deten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nach -drucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funk- undFernsehsen dung, der Wiedergabe auf photomechanischem(Photokopie, Mikrokopie) oder ähnlichem Wege und derSpeicherung in Datenverarbei tungs anlagen, Ton- und Bild -trägern bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vor be -halten. Die Vergü tungs ansprüche des § 54, Abs. 2, UrhG. werden durch die Verwer tungs gesellschaftWort wahrgenommen.
Druck: Strauss GmbH, MörelenbachPrinted in Germany.
IN GEDENKEN
AN UNSERE
VIEL ZU FRÜH VERSTORBENE KOLLEGIN
DR. AGNIESZKA URBANIAK
1974-2013
INHALTSVERZEICHNIS
Falko Daim
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Michael Herdick
Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM
auf der Krim (2006-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Stefan Albrecht · Michael Herdick
Ein Spielball der Mächte: Die Krim im Schwarzmeerraum (VI.-XV. Jahrhundert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Alexandr G. Gercen
Der Mangup in den Augen von Forschern und Reisenden vom 16. bis zum
beginnenden 20. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Stefan Albrecht
Die Krim der Byzantiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Alexandr G. Gercen · Magdalena Mączyńska · Sergej Černyš · Sergej Lukin · Agnieszka Urbaniak †
Jan Bemmann · Katharina Schneider · Ireneusz Jakubczyk
Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-dere am Fuss des Mangup-Plateaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Jan Bemmann · Katharina Schneider · Alexandr G. Gercen · Sergej Černyš · Magdalena Mączyńska
Agnieszka Urbaniak † · Uta von Freeden
Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Adym-Čokrak, Južnyj I und Južnyj II am Fuss
des Mangup – Ein Vorbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Aleksandr I. Ajbabin
Die mittelalterliche Siedlung auf dem Plateau Ėski Kermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Maja Aufschnaiter · Bendeguz Tobias
Untersuchungen zu den Höhlen der Siedlung Ėski Kermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Annegret Plontike-Lüning
Ein Herr vom Ėski Kermen?
Überlegungen zum »Dreireiter-Bild« in der Felskapelle am Südwesthang des Ėski Kermen . . . . . . . . . 251
Ėl’zara A. Chajredinova
Ausgrabungen in der Nekropole am Hang des Tafelberges Ėski Kermen
in den Jahren 2006-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
3
4
Frauke Jacobi · Marcus Stecher · Stephanie Zesch · Vladimir Radochin · Kurt W. Alt
Ėski Kermen, Almalyk und Lučistoe – Bioarchäologie auf der Krim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Guido Brandt · Wolfgang Haak · Christina Blechschmidt · Sarah Karimnia · Kurt W. Alt
Die Völker der Krim im Frühmittelalter – Anwendung und Potential der Paläogenetik
in Bezug auf archäologische Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Anja Cramer · Guido Heinz
Vermessungs- und Dokumentationsarbeiten im Bergland der Krim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Rainer Schreg
Forschungen zum Umland der Höhlenstädte Mangup und Ėski Kermen –
eine umwelthistorische Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Stefan Albrecht
Die Krim und Cherson: byzantinischer Vorposten im Norden des Schwarzen Meeres . . . . . . . . . . . . . 447
Stefan Albrecht · Michael Herdick · Rainer Schreg
Neue Forschungen auf der Krim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Publiktationen des Krim-Projekts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
MICHAEL HERDICK
ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM EUROPÄISCHEN PROJEKTDESIGN:
DIE FORSCHUNGEN DES RGZM AUF DER KRIM (2006-2008)
DIE ANFÄNGE
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das RGZM daran interessiert, die traditionell guten
Beziehungen in die Länder Osteuropas auszubauen und zu vertiefen. 2003/04 ergab sich die Gelegenheit,
die Möglichkeiten für ein Engagement des RGZM auf der Krim auszuloten, die Jahrzehntelang für west -
liche Forscher praktisch kaum zugänglich war. Vorausgegangen war dem eine Einladung von Prof. Dr.
Aleksandr I. Ajbabin (Ukrainische Akademie der Wissenschaften, Institut für Östliche Studien, Simferopol)
und Prof. Dr. Aleksandr G. Gercen (Universität Simferopol, Institut für Alte und Mittelalterliche Geschichte)
an den Generaldirektor des RGZM. Die beiden ukrainischen Archäologen führten seit Jahrzehnten intensi-
ve Ausgrabungen im Gebiet der Berge Ėski-Kermen und Mangup Kale im südwestlichen Bergland der Krim
durch.
Die geänderten politischen Rahmenbedingungen boten die Chance auf eine Neubewertung der spätanti-
ken bis frühneuzeitlichen Verhältnisse in der Bergkrim, ohne die ideologischen Zwänge und Verirrungen
vergangener Jahrzehnte. Ausgangspunkt der Planung war die bis heute gültige Beobachtung, dass in den
Schriftquellen über Jahrhunderte hinweg eine regionale (»gotische«) Identität greifbar ist 1. Fassbar er -
scheint sie in den politischen und vor allem kirchlichen Strukturen, in einem kulturellen Gedächtnis und in
der gotischen Sprache, die bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts hinein nachweisbar ist. Daraus ergibt sich
die Frage, welche Strukturen diese regionale Identität befördert haben und wie sich die Verhältnisse auf der
Krim über die Jahrhunderte in historischen Prozessen kultureller Transformation und Adaption verändert
haben.
Für die Planung des Forschungsdesigns wurden deshalb folgenden Themenbereiche in den Fokus gerückt:
1. Bevölkerung und soziale Strukturen
2. Gruppenidentität – Kulturbeziehungen – kulturelle Offenheit
3. Die Gotthoi 2 und Byzanz
4. Siedlungsstrukturen und Landschaft
Nach Sondierungen vor Ort bestand Klarheit darüber, dass ein internationales Kooperationsprojekt den
besonderen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der jungen Ukraine Rechnung tragen
muss. Die ukrainische Archäologie war schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion von der techni-
schen Entwicklung im Westen abgeschnitten gewesen. Darüber hinaus verhinderte der militärische Sonder -
status der Krim den Einsatz gängiger Vermessungstechnik. So stand etwa kein einheitliches Vermes -
1Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
1 Albrecht 2012, bes. 157-162. – Stiernon / Stiernon 1986. –Macdonalds jr. 1989.
2 Eine Gruppe von Bewohnern der Bergkrim. Gewöhnlich alsGoten nach einer direkten Übersetzung aus dem Griechischen
(Γότθοι) bezeichnet, soll hier der Quellenbegriff benutzt wer-den, um eine aprioristische Annahme ethnischer Identität zu ver-meiden.
sungsnetz zur Verfügung, da die Koordinaten als geheim eingestuft waren. Die schwierige wirtschaftliche
Lage hatte ferner zu etlichen Provisorien bei der Dokumentation und Archivierung von Grabungsunterlagen
und Funden geführt.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs waren die Barrieren für den internationalen Austausch zwar gefallen,
die unabhängig gewordene Ukraine hatte jedoch mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen3,
die bis heute wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen besonders hart treffen. Gleichzeitig rang man
in dem neu gegründeten Staat um eine politische Identität zwischen Ost und West. Die mehrheitlich von
sich als Russen verstehenden Einwohnern besiedelte Krim erwies und erweist sich noch als ein besonderer
Zankapfel zwischen der Ukraine und der Russländischen Föderation, die in Sewastopol den Hauptstütz -
punkt seiner Schwarzmeerflotte unterhält. Darüber hinaus gab es auch immer wieder Auseinander set -
zungen um den Autonomiestatus der Krim, in deren Verlauf u.a. versucht wurde, Russen und Krim tataren
gegeneinander auszuspielen. In den Diskursen und Konflikten um die Identität der Krim wie der Ukraine
sind regelhaft Versuche zu beobachten, die jeweilige Position auch durch archäologisch-historische Argu -
mente unterschiedlicher Qualität zu untermauern4. Damit eng verbunden ist vielfach die Vorstellung, dass
eine möglichst lang zurückreichende ethnische und kulturelle Tradition besondere politische Legi timation
verleiht.
Vor diesem Hintergrund bestand jedoch eine Wissenschaftskultur fort, deren Angehörige trotz mangelhaf-
ter Ausstattung und jahrzehntelanger Wissenschaftsentwicklung unter dem Diktat des marxistisch-lenini-
stischen historischen Materialismus an dem Anspruch festhielten, mit westlichen Partnern auf Augenhöhe
bestehen zu können. Bei der Planung und Durchführung eines Projektes auf der Krim konnte man daher
nicht unreflektiert auf vertraute Strukturen drittmittelfinanzierter Forschungsförderung in Deutschland
zurückgreifen. Es musste sowohl bei Geldgebern als auch bei den beteiligten wissenschaftlichen Institu -
tionen der Wille vorhanden sein, neue Formen der Zusammenarbeit zu erproben. Dazu gehörte insbeson-
dere eine besondere Sensibilität für die Grenzen und Möglichkeiten der Partner aus anderen Wissen -
schaftskulturen5 im Arbeitsalltag. Ferner war die Bereitschaft gefordert, Risiken einzugehen – die Möglich -
keit des Scheiterns eingeschlossen.
Bevor ich die Projektstrukturen und Finanzierung erläutere, möchte ich grundsätzliche Überlegungen über
die Planung und Durchführung eines Projekts anstellen, dessen Partner aus unterschiedlichen Wissen -
schafts kulturen kommen und unter denen die notwendigen Ressourcen ungleich verteilt sind.
FORSCHUNG ALS PROJEKT: EIN WIDERSPRUCH IN SICH?
Wenn Wissenschaftler über Drittmittelanträge sprechen, wird immer wieder gerne gespottet, dass ein
Projektantrag die besten Erfolgsaussichten hat, wenn man ihn erst nach Beendigung der eigentlichen For -
schungsarbeit stellt. Anderenfalls sollte man zumindest die Ergebnisse vorab zuverlässig vorhersagen kön-
nen.
Solche und vergleichbare Aussagen spiegeln zweifellos die Enttäuschung über abgelehnte Förderanträge
wider. Dahinter verbirgt sich jedoch auch ein Gespür für die Problematik und Widersprüchlichkeit der Wis -
2 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
3 Zur neueren Geschichte der Ukraine siehe Lüdemann 2006. –Kappeler 2009. – Timtschenko 2009. – Jobst 2010.
4 Kizilov 2009. – Hrycak 2002.
5 Wissenschaftskultur ist hier im Sinne von Wissenskulturen und inAnlehnung an Knorr Cetina 2002, bes. 12-22 zu verstehen.
sen schaftsorganisation in Form von Projekten. Gerade von wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtun -
gen wurde in den vergangenen beiden Jahrzehnten aber mehr und mehr verlangt, maßgebliche Anteile
ihres Budgets und ihrer Arbeit durch die Einwerbung von Drittmitteln zu gewährleisten, von denen ein gro-
ßer Teil für die Durchführung von Projekten vergeben werden6.
Diese Prozesse sind Bestandteil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in der in unterschiedlichsten
Lebensbereichen Projektstrukturen bei der Bewältigung von Aufgaben zum Einsatz kommen. Zur Beschrei -
bung dieser Verhältnisse hat sich der Begriff der »projectified society«7 etabliert. Der Projektstruktur als
Organisationsform wird offensichtlich eine besondere Leistungsfähigkeit zugeschrieben. Aufgrund der
Vielfalt ihrer Anwendungsfelder scheint die Bearbeitung von Aufgaben und Problemen im Rahmen von
Projekten unterschiedlichsten Anforderungen im Hinblick auf Kreativität und Flexibilität genügen zu kön-
nen. Beides sind Eigenschaften, die auch auf dem wissenschaftlichen Sektor positiv beleumundet sind. Die
Problematik, weshalb die Forschungsorganisation in Form von Projekten alles andere als selbstverständlich
und widerspruchsfrei ist, basiert auf dem Versprechen der Projekttheorie neben Kreativität und Flexibilität
auch verlässliche Rahmenbedingungen für die Sicherstellung von Planung, Controlling und Effizienz be -
grün den zu können8.
Genau in diesem Bereich tut sich jedoch der Widerspruch zwischen dem Charakter von Projekten und dem
Wesen wissenschaftlicher Forschung auf. Herausragende Forschungsergebnisse sind neuartig und oft uner-
wartet und stehen nicht selten auch im Widerspruch zu etablierten Forschungsmeinungen. Die Planung von
Projekten verlangt jedoch die detaillierte Darlegung eines Arbeitsprogramms zur Erreichung eines möglichst
präzise beschriebenen Forschungsziels 9.
Mit diesen Ausführungen ist die Unvereinbarkeit der Wissenschaftsorganisation in Projektform weder
behauptet noch bewiesen. Forschungsprojekte, die in der Vergangenheit erfolgreich realisiert wurden, spre-
chen vielmehr dafür, dass bedeutende wissenschaftliche Aufgabenbereiche tatsächlich als Projekte bear-
beitet werden können. Dazu muss man anerkennen, dass ein Großteil wissenschaftlicher Arbeit auf die ver-
besserte Fundierung bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie ihre kontinuierliche Weiterent -
wicklung und Vermehrung ausgerichtet ist. Ausgehend von einer solide aufgearbeiteten Datenbasis wer-
den die nächsten Forschungsziele definiert, deren Erreichen mit den vorhandenen Ressourcen und betei-
ligten Akteuren als realistisch planbar gelten kann. Anders ausgedrückt: Mit der Organisation wissenschaft -
licher Arbeit als Projekt setzt man auf relativ kleine wissenschaftliche Fortschritte, bei denen jedoch der
Aufwand, mit denen sie erzielt werden können, sicher und zuverlässig kalkulierbar scheint.
Diesem Forschungsmuster würde etwa die Freilegung eines merowingerzeitlichen Gräberfeldes entspre-
chen, mit dem Ziel Lücken in der frühmittelalterlichen Besiedlungsgeschichte einer Mikro-Region in Baden-
Württemberg schließen zu wollen. Der Aufarbeitungsstand vergleichbarer Bestattungsplätze kann als sehr
gut gelten10. Darüber hinaus verfügen die zuständigen Institutionen im Land über beträchtliche Erfah -
rungen mit der Durchführung entsprechender Ausgrabungen. Nicht wenige der Personen, die vergleichba-
re Studien durchgeführt haben, kennen sich z.T. schon seit Jahren persönlich. Obwohl jede Gräber feld -
untersuchung neue Überraschungen liefern kann11, ist bei diesem Fallbeispiel zunächst einmal von einem
3Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
6 Die wachsende Bedeutung der Forschungs- und Kulturorgani -sation in Projektform zeigt sich auch durch die steigende Anzahlvon Publikationen, die notwendiges Hintergrundwissen vermit-teln wollen. Siehe etwa Blanckenburg u. a. 2005. – Defila / Guilio / Scheuermann 2006. – Rogge 1993.
7 Lundin-Söderholm 1998.8 Besio 2009, 9.9 In der etablierten Projektmanagement-Lehre besteht Einigkeit
darüber, dass Projekte gerade nicht dazu geeignet sind, beson -
ders innovative Aufgaben zu erfüllen, für deren Bewältigungkeine Lösungsroutinen existieren: Besio 2009, 10. – Levene1996.
10 So gut, dass Ende des 20. Jhs. die Notwendigkeit gesehenwurde, weitere Gräberfelduntersuchungen zu rechtfertigen:Stork 1997.
11 Siehe etwa die Siedlungsbestattungen von Lauchheim oder denLeierfund von Trossingen: Stork /Wahl 2009. – Theune-Groß -kopf 2010. – Theune-Groß kopf 2006.
hohen Grad von Planbarkeit auszugehen. Die Voraussetzungen für die Projektierung eines solchen
Vorhabens sind also prinzipiell sehr gut. Es reichen jedoch wenige Veränderungen bei den Variablen aus,
um potenziellen Unsicherheitsfaktoren, welche die Planbarkeit reduzieren können, zusätzliches Gewicht zu
verleihen.
SCHWER KALKULIERBAR: MENSCHLICHE FAKTOREN IN FORSCHUNGSPROJEKTEN
Ein Forscherteam von einem anderen Kontinent dürfte vermutlich mit geringerer Selbstverständlichkeit und
größerer Skepsis an den vorhandenen Forschungsstand zu den merowingerzeitlichen Gräberfeldern
anknüpfen, als es deutschsprachige Archäologen tun würden. Das könnte durchaus einen Zugewinn an
wissenschaftlicher Erkenntnis zur Folge haben, wäre aber wohl mit einer Reduktion der zeitlichen Plan -
barkeit verbunden. Trotz aller Toleranz und Offenheit, die wir bei allen Beteiligten voraussetzen wollen,
müsste man ferner damit rechnen, dass sich bei der Durchführung einer Gräberfelduntersuchung unter
nicht-europäischer Leitung von der Beantragung der Grabungsgenehmigung bis zur Publikation der Ergeb -
nisse weitaus mehr Konfliktfelder auftun, als wenn eine süddeutsche Universität die Grabungen durchfüh-
ren wollte.
Die hier mit groben Strichen gezeichnete Fallskizze ist im Grunde genommen nichts anderes als die
Illustration einer Erkenntnis, die jeder Archäologe spätestens nach einigen Semestern Studium gewinnt:
Soziale, kulturelle und politische Faktoren haben ebenso Einfluss auf wissenschaftliche Forschungen wie die
Wahl der Fragestellung und der Methoden sowie die Auswahl der Untersuchungsgebiete oder der Theorien
und Modelle, die zur Erklärung archäologischer Quellen herangezogen werden. Analysen und Studien zur
praktischen Durchführung archäologischer Untersuchungen und konkret zur Subjektivität archäologischer
Bearbeiter spielen jedoch in der deutschsprachigen Archäologie in Forschung und Lehre kaum eine Rolle.
Demgegenüber findet die interpretatorische Tätigkeit der Wissenschaftler in der Post-Processual Archaeo -
logy vergleichsweise große Beachtung. Diese Schule hatte sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts vor
allem unter dem Einfluss von anglo-amerikanischen Archäologen wie Ian Hodder oder Bruce G. Trigger ent-
wickelt 12. Die grundsätzliche Offenheit der Post-Processual Archaeology für diese Problematik liegt u.a.
auch in der Auseinandersetzung mit konkreten gesellschaftspolitischen Entwicklungen begründet. Die
Aufarbeitung der Forschungsgeschichte der Archäologie, naturwissenschaftlichen Anthropologie, Ethno -
logie und verwandter Fächer in den Ländern des früheren Britischen Weltreichs verlangte eine kritische
Beschäftigung mit ihrer Rolle im Zeitalter des Imperialismus sowie ihrer Funktion bei der kolonialen Herr -
schaftslegitimation13. Eine entscheidende Rolle spielten dabei Intellektuelle in den jungen Nationalstaaten
wie Edward W. Said, die nicht mehr bereit waren, Wissenschaftlern aus den früheren Metropol gesell -
schaften mit ihrem anderen, imperialen kulturellen Hintergrund die alleinige Verfügungsgewalt über die
Erforschung und Interpretation der Vergangenheit ihrer Vorfahren zuzugestehen14. Als Folge davon hat es
umfangreiche Bemühungen gegeben, ethische Standards für die Erforschung sog. indigener Völker zu defi-
nieren und sie auch praktisch in die Forschungsarbeit zu integrieren 15. Darüber hinaus haben speziell in der
4 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
12 Shanks /Hodder 1998. – Kerig 1998. – Hodder 1982. – Trigger1991. – Trigger 1996. – Shanks / Tilley 1992. – Shanks / Tilley1996.
13 Hamilakis / Duke 2008. – Castañeda / Matthews 2008. –Smith /Wobst 2010. – Edgeworth 2006. – Wobst 1978.
14 Said 1981. – Vgl. Bachmann-Maedick 200915 Etwa Kerber 2006. – Smith /Wobst 2010. – Atalay 2006. –
Harrison /Williamson 2002.
Ethnologie Selbstreflektionen über die Rolle des Wissenschaftlers im Untersuchungsprozess beinahe den
Rang einer eigenen Literaturgattung erreicht16.
Die Instrumentalisierung und Instrumentalisierbarkeit der deutschen Archäologie im Dritten Reich, die
inzwi schen forschungsgeschichtlich hinlänglich aufbereitet wurde17, hätte durchaus Ausgangspunkt für
eine vergleichbare Entwicklung sein können. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Verstrickung in die gesell-
schaftspolitischen Verhältnisse des Nazi-Regimes mit den damit verbundenen Abhängigkeiten wird als tem-
porärer Sündenfall verstanden, dessen Wiederholung man durch die Verweigerung der Beschäftigung mit
kritikwürdigen sozialen, kulturellen und politischen Gegebenheiten im Kontext archäologischer Ausstel -
lungen und Forschungen zu vermeiden sucht18. Es wäre jedoch zu prüfen, ob in dieser Haltung nicht auch
die Irrelevanz archäologischer Erkenntnisse in den aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursen begründet
liegt.
ANNÄHERUNG AN EINEN GEMEINSAMEN FORSCHUNGSANSATZ
Mit dem Eingehen auf soziale, kulturelle und politische Faktoren, die archäologische Untersuchungen
beein flussen, ist weit mehr als nur ein ideeller Anspruch verbunden. Gerade bei der Planung und Organi -
sation von Projekten im Ausland ist die Beschäftigung mit diesen Faktoren eine unabdingbare Voraus -
setzung für die Formulierung realistischer Forschungsziele.
Der Blick auf die zeitgeschichtlichen Prozesse in der Ukraine, deren Augenzeugen die an dem Projekt teil-
nehmenden Wissenschaftler sind, gibt zunächst die Richtung der Forschung für ein »Wiederannähe -
rungsprojekt« ukrainischer und westlicher Partner vor: »Regionale Identität und kulturelle Transformations -
prozesse«. Damit kann man dem eingangs skizzierten Ansatz folgen, der am Beginn der Planungen stand.
Eine zeitliche Eingrenzung auf die Epoche von der Spätantike bis zum Spätmittelalter empfiehlt sich mit
Blick auf die Quellenüberlieferung, die es für diesen Zeitraum erlaubt, gleichermaßen auf archäologische
wie schriftliche Quellen zurückzugreifen.
Schwieriger gestaltete es sich, die konkreten Arbeitsschritte zu definieren mit denen die Partner gleichbe-
rechtigt und auf Augenhöhe Beiträge zur Diskussion des Forschungsthemas erbringen können und sollen.
Von einem deutsch-ukrainischen Forschungsprojekt sollte keine Gefahr für bestehende ukrainische Lang -
zeit vorhaben ausgehen, die ohnehin nur über begrenzte Ressourcen verfügten. Vielmehr strebte man mit
den vom RGZM initiierten Beiträgen eine Unterstützung und Erweiterung laufender Untersuchungen an.
Ein solches Verfahren hat grundsätzlich zunächst einmal die positive Konsequenz, dass die auswärtigen
Kooperationspartner nicht bei annähernd Null in einem fremden Arbeitsgebiet anfangen müssen. Sie kön-
nen stattdessen ein neues Projekt mit einheimischen Partnern auf dem im Arbeitsgebiet bereits erreichten
Forschungsstand aufsetzen.
5Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
16 Reikat 2005. – 9-10. Exemplarisch: Smith Bowen 1987. – Barley1989. – Barley 1990.
17 Halle 2002. – Fehr 2007. – Brather 2004. – Brather 2005. –Momm sen /Bollmus 2006. – Focke-Museum 2013.
18 Ein anschauliches Beispiel dafür ist die ausgebliebene Debatteum die 1994 im Landesmuseum Hannover gezeigte griechischeAusstellung »Makedonen: die Griechen des Nordens«, in derherausragende Exponate präsentiert wurden. Sie war aber auch
eine kulturpolitische Maßnahme, mit der die (griechische)Archäo logie für politische Zwecke im sogenannten Namens -streit zwischen Griechenland und Mazedonien politisch instru-mentalisiert wurde. Zu den historischen, politischen und natio-nalistischen Hintergründen der »makedonischen Frage« siehedie preisgekrönte Dissertation von Skordos 2012 und dieRezension von Axt 2012.
Die einheimischen Archäologen haben jedoch die vorhandene Datenbasis aus ganz anderen Betrach -
tungsperspektiven heraus erarbeitet, als sie auswärtige Wissenschaftler unter dem Einfluss ihrer nationalen
Forschungstraditionen eingenommen hätten.
So dürfte es z. B. für deutsche Wissenschaftler in Kenntnis der Debatte über ethnische Interpretationen in
der Archäologie19 sowie im Wissen um die deutsche Besatzungsgeschichte20 auf der Krim und der unrühm-
lichen Rolle der Archäologie in diesem Zusammenhang kaum plausibel sein, sich dem Thema kulturelle
Identität im Bergland der Krim vorrangig aus dieser Perspektive heraus zu nähern. Bei unseren ukrainischen
Partnern und dem wissenschaftlichen Nachwuchs auf der Krim war der Umgang mit diesem Thema
wesentlich unbefangener, obwohl man sich gleichzeitig der Brisanz archäologischer Interpretationen im
Hinblick auf politische Konflikte um historisch-kulturelle Identität und politische Zugehörigkeit der Krim
bewusst war. Diese gesellschaftspolitische Relevanz der Suche nach der historisch-kulturellen Identität der
Krim ist schließlich der Grund, weshalb man eine wissenschaftliche Positionierung nicht verweigern kann,
wenn man gesellschaftspolitische Relevanz für die Archäologie nicht aufgeben will. Für ein europäisches
Projekt ist es entscheidend, dem Thema mehr abzugewinnen als nur die ethnische Perspektive mit metho-
disch überholten Deutungsmustern.
Unterschiedliche Gewichtungen gibt es nicht nur im Hinblick auf inhaltliche Fragen, sondern auch bei der
Definition forschungspolitischer Ziele. So hat etwa der Technologietransfer zur Unterstützung der laufen-
den Projekte für die ukrainischen Archäologen einen hohen Stellenwert wegen der Stabilisierungsfunktion
für die Forschungsinfrastruktur. Die westlichen Partner sind mit einer solchen Herausforderung gar nicht
konfrontiert.
Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsvoraussetzungen muss man also schon vor Projektbeginn ganz
nüchtern damit rechnen, dass die Partner sehr verschiedene Ansprüche an das Projekt stellen und abwei-
chende Gewichtungen der einzelnen Aspekte vornehmen werden. Es stellt sich die Frage, wie man vor die-
sem Hintergrund den unterschiedlichen Interessen der Beteiligten gerecht werden und gleichzeitig die ver-
bindliche Bearbeitung einer anspruchsvollen kulturgeschichtlichen Fragestellung gewährleisten kann. Dabei
sollte es zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Rahmen eines Kooperationsprojekts europäischer Partner
undenkbar sein, die wirtschaftliche Überlegenheit einer Seite diskret auszuspielen, um eine verbale Ver -
pflichtung auf eine bestimmte Methodik und einen bestimmten Forschungsansatz zu erzwingen. Das hat
nichts mit naivem Idealismus zu tun, sondern vielmehr mit Realismus: Wer glaubt, finanziell geringer aus-
gestattete Partner mit unterschiedlichen Interessen und Sachzwängen allein mit wirtschaftlichen Mitteln
kontrollieren und lenken zu können, übersieht, dass er oder sie dazu gerade bei einem größerem Projekt,
dessen Partner aus verschiedenen Ländern Europas kommen, kaum jederzeit und an jedem Ort in der Lage
ist. Weitaus sinnvoller erscheint es deshalb, das Projekt so anzulegen, dass es allen Partnern die Möglichkeit
gibt, ihre primären Ziele innerhalb des vorgegebenen Rahmens zu realisieren. Gleichzeitig werden alle
Partner verpflichtet, die Ergebnisse der von ihnen übernommenen Forschungsaufgaben zur Bearbeitung
der Leitfrage des Gesamtprojekts zur Verfügung zu stellen. Der Antragsteller übernimmt gegenüber dem
Drittmittelgeber die Verantwortung dafür, dass eine angemessene Bearbeitung erfolgt, die der Weiter -
entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse erkennbar förderlich ist. Die Kooperationspartner werden
dabei nach Maßgabe der Möglichkeiten eingebunden.
6 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
19 Angeli 1991. – Bierbrauer 1999. – Bierbrauer 2004. –Bierbrauer 2008. – Brather 1996. – Brather. 2000. – Brather2004. – Fehr 2008. – Fehr 2010. – Rummel 2007. – Jones 1997.– Miller 1993. – Pohl 2010.
20 Kunz 2005.
DAS »NEUE« IN DER FORSCHUNG UND DER »FORTSCHRITT« IN DER WISSENSCHAFT
Obwohl die Assoziation zwischen »Forschung«, »Neu« und »Fortschritt« unmittelbar naheliegend sind,
wird darüber im praktischen Wissenschaftsmanagement relativ wenig reflektiert. Dabei bestimmen die
damit verbundenen Vorstellungen maßgeblich die Projektstrukturen. Einige kurze, grundsätzlichere Über-
legungen erscheinen daher angebracht.
»Mit dem Begriff der Forschung verbinden sich gemeinhin die Begriffe des Neuen und des (wissenschaft-
lichen) Fortschritts«21, so fasste der Konstanzer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß
das derzeit wohl gesellschaftlich und vor allem politisch dominierende Wissenschaftsverständnis zusam-
men. Jede Planerin, jeder Planer eines Forschungsvorhabens ist daher gut beraten, sich zunächst Klarheit
darüber zu verschaffen, was für sie, was für ihn und aus Sicht der Fachkollegen das Neue und Kreative sein
soll. Wenn man sich nicht auf die Bereitschaft der Gutachter verlassen möchte, grundsätzlich jede wissen-
schaftliche Aktivität als positiv zu bewerten, und wenn man nicht sein Vertrauen darein setzt, dass diese
nur Bedarf an mehr oder weniger hochwertigen Marketingslogans haben, um die Geldvergabe zu recht-
fertigen, sieht man sich mit einem äußerst anspruchsvollen wissenschaftstheoretischen Problem konfron-
tiert. Um die Herausforderung vor dem Hintergrund unseres Szenariums zumindest anzudeuten, soll der
Hinweis auf die Unterscheidung zwischen konvergentem und divergentem Denken in der Kreativitäts -
forschung genügen22. Konvergentes Denken bezeichnet die Fähigkeit, Antworten auf vorab klar definier-
te Fragestellungen zu finden, für die Lösungsschemata existieren. Divergentes Denken ist gefordert, wenn
es zunächst notwendig ist, die Probleme, die zur Erreichung von Projekt- und Forschungszielen gelöst wer-
den müssen, näher zu bestimmen. Die Lösungswege sind variabler. »Kreativität tritt hier (…) auf, die sich
darin ausdrückt, mit bestimmten Problemlagen produktiv umgehen zu können.«23
Eine divergente Denk- und Planungsstruktur ist ein prägnantes Merkmal von Forschungsvorhaben, bei
denen die Projektpartner erst gemeinsame Arbeitsroutinen entwickeln müssen, sich der wissenschaftlichen
Leitfrage aus unterschiedlichen Forschungskulturen heraus nähern und aus sehr unterschiedlichen Perspek -
tiven Erfahrungen im Umgang mit den archäologischen und historischen Quellen im Arbeitsgebiet erarbei-
tet haben.
Mit dieser Charakterisierung wird nicht die Legitimation des Controllings für derartige Projekte in Frage
gestellt oder außer Kraft gesetzt.
Zunächst einmal besteht bei der Planung eines Forschungsvorhabens mit den beschriebenen Merkmalen
im besonderen Maße die Verpflichtung zu einer frühzeitigen Sondierung der potenziellen Chancen und
Risiken mit allen Partnern vor Ort. Der wissenschaftliche Sinn solcher Vorstudien ist nicht dann erreicht,
wenn alle nahe liegenden Probleme und Herausforderungen für den Projektantrag wegargumentiert sind,
sondern wenn Klarheit darüber besteht, wie mit neuen Herausforderung während des Projektverlaufs
umgegangen werden soll. Die Kunst besteht darin, klar definierte Arbeitsfelder auszuwählen, deren
Bearbeitung die Grundlagen zur Diskussion der Forschungsleitfrage schafft, und die dazu notwendigen
Arbeitsaufgaben festzulegen. Gleichzeitig – und das ist das entscheidende – gilt es aber auch den Pla -
nungsrahmen so flexibel zu gestalten, dass auf vorab nicht absehbare Notwendigkeiten und Chancen kon-
struktiv und kreativ regiert werden kann. Das heißt konkret, dass das Wissenschaftsmanagement auch auf
7Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
21 Mittelstraß 2008, 75.22 Ebenda 76.
23 Ebenda.
die Integration neuer Arbeitsschritte und -aufgaben hin ausgelegt sein muss, die sich im Projektverlauf
ergeben.
Es erscheint reizvoll, vor diesem Hintergrund zunächst einmal exemplarisch einen Ansatz für ein internatio-
nales Kooperationsprojekt zu analysieren, der möglichst risikoarm ist.
EIN SICHERER ARBEITSANSATZ FÜR WISSENSCHAFTLICHE PROJEKTE? EINE FALLSTUDIE ZUR RISIKOKALKULATION IM WISSENSCHAFTSMANAGEMENT
Ein risikoarmer Ansatz könnte auf der Verständigung der Kooperationspartner auf die Vorlage möglichst
spektakulärer Fundkomplexe etwa aus Edelmetallen oder selten überlieferten organischen Materialien
basieren, deren Interpretation vorab wenig Konfliktstoff bieten würde. Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter
des Projektes hätten unter diesen Bedingungen durchaus die Möglichkeit, gezielt und ohne die Unsicher -
heit langjähriger Feldforschungen lohnende Quellenkomplexe auszuwählen und ausgehend von früheren
Untersuchungen im Rahmen einer Ausstellung mit zugehöriger Begleitpublikation wissenschaftlich neu und
öffentlichkeitswirksam zu verorten. Die Wissenschaft im Herkunftsland der archäologischen Objekte könn-
ten mit einem höheren Bekanntheitsgrad ihrer Forschungen über ihre gewohnte Scientific Community und
Landesgrenzen hinaus rechnen24. Der oben skizzierte Ansatz kommt mit unterschiedlichen Variationen
immer wieder im Vorfeld großer Ausstellungen zum tragen. Die in diesem Zusammenhang produzierten
Ausstellungskataloge bieten in der Regel ein weitgehend widerspruchsfreies Bild der Archäologie und der
Geschichte, weshalb sie sich als bequeme Einstiegs- und Übersichtswerke in der Wissenschaft wie in wei-
ten Teilen des Bildungsbürgertums großer Beliebtheit erfreuen25.
So spielerisch leicht sich ein solcher Ansatz aus einer methodenkritischen Perspektive heraus angreifen lässt,
so sollte man doch nicht übersehen, dass eine derartige Projektstruktur unter ökonomischen und wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten für alle Beteiligten ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Bei der Aufarbeitung
und Vorlage ausgewählter Materialkomplexe im Rahmen einer internationalen Kooperation kann das
anstehende Arbeitsvolumen vorab relativ zuverlässig bestimmt und die Aufgaben und Rechte der Partner
festgelegt werden. Damit ist auch die inhaltliche Struktur der Endprodukte – wissenschaftliche Publika -
tionen und/oder Ausstellungen – relativ gut absehbar. Es gibt also sehr plausible Gründe, diesen Ansatz zu
wählen, wenn klar ist, dass die Finanzierung des Vorhabens im Rahmen eines auf wenige Jahre beschränk-
ten Projektes erfolgen soll. Auf diese Weise bestehen gute Chancen sich Geldgebern auch auf lange Sicht
8 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
24 Selbstverständlich ist das freilich nicht: Bis heute spielen geradebei großen Ausstellungen zur »Weltkultur« Forscherinnen undForscher aus den Herkunftsländern der ausgestellten Objektenicht selten eine marginale Rolle. Und zwar ohne dass in derAusstellung und im Katalog angemessen über die Hintergründeinformiert wird. Exemplarisch sei dazu auf Ausstellungen zurKultur der Dogon im heutigen Mali verwiesen. Zwar fehlt esnicht an Versuchen, einen Rückbezug von den Artefakten die-ser Kultur als Kunstobjekte westlicher Museen zu ihrem Alltags -kontext im Herkunftsland herzustellen, aber diese können dasDilemma kultureller Enteignung nicht aufheben. Siehe hierzuexemplarisch Rauterberg 2011. – Leloup 2011.
25 Die Darstellungen weitgehend widerspruchsfreier Bilder derArchäologie und Geschichte fremder Kulturen stellen noch
keine Verletzungen wissenschaftlicher Standards dar. Sieerschweren bzw. verhindern aber den Vergleich mit der ver-trauten Kultur und die Auseinandersetzung mit dem Unbe -kannten. Als Folge des leichten Kulturkonsums bleibt meist nurein vager Eindruck kultureller Größe mit Blick auf das Aus -stellungsgut haften. Besonders anfällig scheinen diesbezüglichstark antiquarisch-kunstgeschichtlich ausgerichtete Aus stel -lungs projekte zu sein, bei denen die Alltagskultur vonHandwerkern und Bauern bestenfalls indirekt und am RandeErwähnung findet. Siehe etwa: Kulturstiftung Ruhr 1995. –Kulturstiftung Ruhr 2006. – Kunst- und Ausstellungshalle derBundesrepublik 2006. – Fol / Lichardus / Nikolov 2004. –Wieczorek / Périn 2001.
als starker Partner zu präsentieren, der wirklich zu liefern vermag. Damit steht die kontinuierliche Sicherung
der Forschungsförderung und ihrer etablierten Strukturen im Vordergrund. Ein Ansatz, den man schwerlich
verdammen kann26.
Wenn aus einem Forschungsgebiet, das nicht zu den traditionellen Arbeitsregionen der Fachinstitutionen im
Sprachraum der Projektträger zählt, einfach nur besonders eindrucksvolle Quellen präsentiert werden,
besteht allerdings nur wenig Aussicht auf nachhaltige Impulse über Sprachbarrieren hinweg. Es besteht die
Gefahr, dass bei einem solchen Szenarium allein der spektakuläre Charakter der publizierten bzw. ausge-
stellten archäologischen Artefakte im Sprachraum der Geldgeber zum Maßstab für wissenschaftliche Krea -
tivität wird. Ein solcher Ansatz würde Kooperationspartnern in ökonomisch schlechter gestellten Ländern
förmlich ein bestimmtes Bewirtschaftungsmodell ihrer Ausgrabungen aufdrängen. Sie wären gut beraten,
ausgehend von jeder Tagungseinladung oder Publikationsanfrage für einen Ausstellungskatalog häppchen -
weise einzelne Grabungskomplexe oder Siedlungsbefunde auf dem Markt zu werfen, um so ihre Stellung
als wissenschaftliche Lieferanten für die Geldgeber zu wahren. Angesichts ökonomischer Abhängigkeits -
verhältnisse wäre diese Haltung verständlich und sogar wissenschaftlich zu rechtfertigen – nämlich für die
wirtschaftlich schwächeren Forschungsinstitutionen, die versuchen müssen, ihren Betrieb aufrechtzuerhal-
ten. Die ethische und wissenschaftliche Kritik muss sich daher vielmehr an jene ökonomisch potenteren
Partner richten, die die Bereitschaft zur Beschäftigung, Einarbeitung und Auseinandersetzung mit den
Grundlagen und Ansätzen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der fremden Forschungsregion
verweigern und die Chancen der Zusammenarbeit nur dazu nutzen, bislang unbekannte Quellen einfach in
bestehende Deutungsmuster einzuordnen oder daran anzuhängen. Wenn man vermeiden will, dass aus-
schließlich Personen mit substantiellen Kenntnissen der (im Partnerland wenig gelehrten) Landessprache
sowie der Archäologie und Geschichte im Arbeitsgebiet an einem internationalen Wissenschaftsprojekt teil-
nehmen können, und wenn man wünscht, dass Forschungskulturen überschreitende Projekte nicht nur
Aufgabenfelder eines ziemlich exklusiven Kreises von Spezialisten seien und dass wissenschaftliche Frage -
stellungen für einen größeren Kreis von Bearbeiterinnen und Bearbeitern geöffnet werden, dann muss man
u.a. auch dazu bereit sein, die Grundlagen und Ansätze der Forschung im einen Land auch für die Scientific
Community im Sprachraum der Projektpartner des anderen Landes der Diskussion zugänglich zu machen.
Allgemeiner ausgedrückt wäre kritisch zu prüfen, ob der oben skizzierte antiquarische Forschungsansatz für
internationale Kooperationsprojekte in der Archäologie nicht als Phänomen einer Sicherheitskultur in der
Wissenschaftsförderung zu verstehen ist, die letztlich zu einer Forschungskultur führt, die mit der Chinoi -
serie der Frühen Neuzeit vergleichbar ist 27: Berichte von Missionaren, Forschungsreisenden, Gesandten und
Kaufleuten sowie die Importe asiatischer Luxusgüter lösten in Europa eine China-Euphorie aus. Dazu gehör-
ten nicht nur glorifizierende Vorstellungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse in China, sondern auch
die Entwicklung einer eigenen europäischen Kunst(handwerks)richtung nach chinesischem »Vorbild«. Das
Interesse an der fremden Kultur und an einer kreativen Beschäftigung mit ihr war also groß, aber im Grunde
genommen kam man ihr nie wirklich nahe, weil man sie immer aus der gewohnten »national-europäi-
schen« Perspektive betrachtete und in gewohnte Interpretationsmuster einzuordnen versuchte.
Natürlich lässt sich ein neuzeitliches Kulturphänomen nicht einfach mit heutiger Forschungspraxis verglei-
chen. Der distanzierte Rückblick auf die Formen und Strukturen von Kulturkontakten in der Vergangenheit
9Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
26 Dieser Satz ist nicht als diplomatisch-rhetorische Floskelgemeint. Man kann heute nicht mehr wie vielleicht noch imletzten Drittel des 20. Jhs. Ländern der 2. und 3. Welt Aus -stellungsinhalte vorschreiben. Insbesondere »neue« Mächtewie China, Indien oder auch die Türkei achten sehr darauf, dieKontrolle über die Darstellung ihrer Geschichte im Auslandnicht zu verlieren. Eine sture Protesthaltung würde hier oft nicht
weiterführen. Das Zustandekommen eines gemeinsamenAusstellungsprojekts ist nicht selten die Voraussetzung fürweitergehende wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen.Einfache Antworten und Political correctness liefern hier also inder Regel keine nachhaltigen Lösungen.
27 Siehe hierzu: Woesler 2006. – Abegg-Stiftung /Gruber 1984. –bes. Hallinger 1996.
kann jedoch sehr wohl Anregungen liefern, kritisch nach der Wirkung von Forschungsprojekten im Hinblick
auf das nachhaltige Eintauchen in fremde Forschungslandschaften und -kulturen heute zu fragen. Nach -
haltigkeit soll in unserem Zusammenhang nicht eine unrealistische Festlegung für Jahrzehnte bedeuten,
sondern die Bereitschaft ein Forschungsdesign zu entwickeln, dass
1. der Profilierung und Entwicklung bestehender bzw. in der Genese befindlicher Arbeitsfelder des RGZM
als Hauptprojektträger dient,
2. zum Fortbestand und möglichst zur Optimierung bestehender Forschungsanstrengungen einheimischer
Institutionen auf der Krim beiträgt,
3. Führungspersonal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studenten und Studentinnen aller beteiligten
Einrichtungen Möglichkeiten bietet, Erfahrungen mit den Ansätzen und Methoden der Partner zu sam-
meln und in die Bearbeitung der Leitfrage des Projekts einzubringen,
4. unterschiedliche Forschungstraditionen und -ansätze mit ihren Grundlagen gleichberechtigt abbildet,
aber die Ergebnisse in einer Auswertung zusammenführt und
5. in einer weiten Perspektive erlaubt, Arbeitsgebiete und Potenziale für zukünftige Kooperationen auszu-
loten.
DAS KRIM-PROJEKT: STRUKTUREN DER FORSCHUNG
Im Bereich der Forschung wurde ein Schwerpunkt in der Siedlungs- und Landschaftsarchäologie im Umfeld
der beiden Höhensiedlungen gesetzt 28, da hier bislang systematische Untersuchungen fehlten und es im
Hinblick auf die Ausgangsfrage zu klären galt, welchen Einfluss historisch-geografische Faktoren auf die
Verhältnisse in der südwestlichen Bergkrim ausübten. Diese Perspektive wurde nicht dazu gewählt, als poli-
tisch korrekte Alternative zur Frage nach ethnischen und anderen Gruppenidentitäten zur Verfügung zu
stehen29, sondern um Grundlagen für die Diskussion über Jahrhunderte hinweg nachweisbarer kultureller
Identität der Gesellschaftsverbände in der Bergkrim bereit zu stellen.
Ein weiteres Schwerpunktvorhaben war eine möglichst vollständige Vorlage der griechischen, lateinischen
und slavischen Schriftquellen über die Krim zwischen 300 und 1204 n.Chr30. Dabei wurde besonderer Wert
darauf gelegt, dass den Quellenpassagen neben einem Kommentar und einer Übersetzung auch Hinweise
auf unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten beigefügt sind. Neben dieser kommentierten Schrift -
quellen sammlung über die Krim ist darüber hinaus noch die deutsche Übersetzung des Gesandtschafts -
10 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
28 Siehe den Beitrag von R. Schreg in diesem Band. Vorberichte:Albrecht u. a. 2008. – Herdick / Schreg 2009. – Schreg 2008. –Schreg 2009. – Schreg 2009a. – Schreg 2010.
29 Nach den Erfahrungen der deutschsprachigen Archäologie mitden methodischen Verirrungen durch den dominantenGebrauch der ethnischen Perspektive, könnte es nahe liegenderscheinen, vordergründig weniger missbrauchsanfälligen,umweltgeschichtlichen oder historisch-geografischen Ansätzenden Vorzug zu geben. So ist etwa Jared Diamonds (2009) popu-läres Werk »Arm und Reich«, das einer komplexen Um welt -determinanz den Vorzug bei der Erklärung für den weltweitunterschiedlich verteilten Wohlstand gibt, erkennbar als Alter -native zu rassistischen Deutungsmodellen veröffentlicht wor-den. Darüber hinaus räumen heute auch die Wirtschafts -wissenschaftler geografischen Faktoren für die ökonomischeEntwicklung besondere Aufmerksamkeit ein: Collier 2008, 58-
88, bes. 77-78. Umweltgeschichtliche bzw. historisch-geografi-sche Ansätze sind jedoch alles andere als methodisch unan-fechtbar und ihre Ergebnisse eignen sich durchaus auch zurpolitischen Instrumentalisierung. Es ist an dieser Stelle nichtmöglich, alle Facetten umweltgeschichtlicher und historisch-geografischer Ansätze einer kritischen methodischen Analysezu unterziehen. Stattdessen soll exemplarisch auf grundlegen-de Studien hingewiesen werden, die sich mit dem Werk Fer -nand Braudels auseinandersetzen, dem die modernen Ge -schichtswissenschaften und die Archäologie der Gegenwartgrundlegende Impulse für die Beschäftigung mit dem Einflussgeografischer Faktoren auf historische Prozesse verdanken:Aguirre Rojas 1999. – Braudel 1977. – Kaser 2007. – Kinser1981. – Lutz 1982. – Shaw 2001. – Timpe 2004.
30 Albrecht 2012b.
berichts des polnischen Gesandten Marcin Broniewski (1579) zu erwähnen31. Es handelt sich um die älte-
ste überlieferte Beschreibung des Mangup. Beiträge ausgewiesener Fachwissenschaftler erschließen den
Wert der Quelle aus historischer wie archäologischer Sicht32.
Durch die ausgewählten Arbeitsschwerpunkte ergeben sich zwanglose Überschneidungen mit dem For -
schungs schwerpunkt Byzanz und der Umweltarchäologie, die annähernd zeitgleich mit dem Krim-Projekt
am RGZM etabliert bzw. weiter ausgebaut wurden. Weitere Berührungspunkte ergaben sich mit dem
Forschungsverbund »Raumbezogene Informationstechnik in den Geisteswissenschaften«33.
Das RGZM engagierte sich mit seinen Partnern, dem i3mainz, dem Vienna Institute of Archaeological
Science und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (beide Wien) in den Bereichen Prospek -
tion, Vermessung und Dokumentation. Ziel war die Erstellung eines einheitlichen Geoinformationssystems
(GIS) auch für den Bedarf der ukrainischen Archäologie auf der Krim 34. Der Einsatz geophysikalischer
Prospektionsmethoden sollte eine bessere Planbarkeit und einen ökonomischeren Einsatz der ukrainischen
Ressourcen ermöglichen. Im Bereich des Vermessungswesens galt eine besondere Aufmerksamkeit den
Höhlenkomplexen an der Peripherie des Ėski Kermen und des Mangup Kale35. Diese stellen in weiten
Bereichen der Siedlungsareale die letzten erhaltenen Siedlungsspuren dar, weil die Überreste der aufge-
henden Bauwerke in den letzten Jahrhunderten vielfach abgetragen wurden.
Besondere wissenschaftliche Beratung war bei der Untersuchung der Gräberfelder an den Hängen der bei-
den Höhensiedlungen gefragt. Wissenschaftler und Studenten des anthropologischen Instituts der Univer -
sität Mainz begleiteten die Ausgrabungen, um u.a. die notwendigen Voraussetzungen für paläogenetische
Untersuchungen zu schaffen36. Die ukrainischen Ausgräber erhielten darüber hinaus umfangreiche grafi-
sche und technische Unterstützung für die Vorlage der Gräberfelder. Als Resultat dieser Zusam narbeit ist
an erster Stelle die Veröffentlichung des ersten Bandes über das Gräberfeld von Lučistoe anzuführen37, das
von der Völkerwanderungszeit bis zur frühen Neuzeit belegt worden ist. Hinzu kommen Artikel über die
Ergebnisse der Gräberfelduntersuchungen am Ėski Kermen38. Weitere Gräberfelder am Man gup wurden
von Prof. Dr. Magdalena Mączyńska (Universität Łódź) und Prof. Dr. Jan Bemmann (Universität Bonn) in
Zusam men arbeit mit Prof. Dr. Aleksandr G. Gercen aufgearbeitet39.
Um eine bessere Rezeption der Grundlagen der ukrainischen bzw. russischen Krimarchäologie im Westen
(also überall dort, wo das Dictum gilt, slavica non leguntur) zu ermöglichen, wurde den Materialvorlagen
eine erweiterte und überarbeitete Ausgabe des Standardwerkes von Prof. Aleksandr I. Ajbabin über die
frühmittelalterliche Geschichte der Krim an die Seite gestellt 40. Hinzu kommt eine überarbeitete Fassung
der Dissertation von Prof. Dr. Aleksandr Gercen über das Befestigungssystem des Mangup Kale 41, dessen
Verständnis grundlegend für die Interpretation der Siedlungsgeschichte auf diesem Berg ist. Auch zukünf-
tige Forschungen werden sich intensiv und kritisch mit dieser Arbeit auseinandersetzen müssen.
In alle Arbeitsbereiche waren Studenten und Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland, Österreich, Polen
und der Ukraine in sogenannten Field Schools eingebunden. Für die ukrainischen Kollegen und Kolleginnen
wurden gezielt Weiterbildungsprogramme angeboten.
Das anvisierte Forschungsprogramm konnte im Projektverlauf prinzipiell unverändert durchgeführt werden.
Allerdings ergab sich eine Änderung bei der Untersuchung der Höhlenkomplexe an der Peripherie der
11Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
31 Albrecht /Herdick 2011. – Beachte ferner Albrecht 2012. –Albrecht 2012a.
32 Jobst 2011. – Schreg 2011. – Albrecht 2011.33 http://www.i3mainz.fh-mainz.de/Article182.html (20.12.2012).34 Vgl. den Beitrag von Heinz /Cramer in diesem Band. 35 Siehe den Beitrag von Aufschnaiter / Tobias in diesem Band.
Ferner Aufschnaiter u. a. 2008. – Aufschnaiter 2009. –Cramer /Heinz /Müller 2010.
36 Siehe die Beiträge von Jakobi und Brandt in diesem Band.37 Ajbabin / Chajredinova 2009. – russisch Ajbabin 1999.38 Siehe den Beitrag von Ė. Chajredinova in diesem Band. 39 Vorbericht: Gercen u. a. 2008. Im Druck: Bemmann 2013. –
Mączyńska u. a. 2013.40 Ajbabin 2011.41 Vgl. den Beitrag von A. Gercen in diesem Band.
Höhensiedlungen durch den Forschungsfortschritt. Durch intensive Prospektionen auf der dicht bewachse-
nen Innenfläche des Ėski Kermen hatte sich die Zahl der ursprünglich bekannten rund 300 Höhlenkomplexe
verdoppelt. Ersten Untersuchungen zufolge waren die Höhlen in der Innenfläche im Besiedlungsverlauf in
weit geringerem Ausmaße von Veränderungen betroffen gewesen als jene an der Peripherie. Ferner zeich-
neten sie sich dadurch aus, dass sie in der Mehrzahl noch nicht vollständig ausgeräumt worden waren. Im
Hinblick auf die angestrebte Nachhaltigkeit des Projektes wurde daraufhin der Schwerpunkt auf eine mög-
lichst vollständige Katalogisierung und Einmessung aller Höhlen gelegt und Abstand von relativchronologi-
schen Einzelstudien genommen. An der Detailvermessung exponierter Höhlenkomplexe wurde festgehal-
ten. In Zusammenarbeit mit dem IProD der Fachhochschule Mainz wurden dabei Standards für die Ausar -
bei tung von Plänen solcher polymorphen Raumkomplexe entwickelt, die in vielen Regionen des Mittelmeer -
raumes eine vernachlässigte Quellengattung darstellen42.
Einen Überblick über die vom RGZM und seinen Kooperationspartnern getragenen Forschungen geben die
Beiträge in diesem und einem noch folgenden Band, den Rainer Schreg herausgeben wird, sowie die Publi -
kationsübersicht im Anhang. Das wichtigste Ziel, das mit dieser Veröffentlichung verfolgt wird, ist die
Zusammenführung der von unterschiedlichen Forschungsträgern und aus verschiedenen methodischen
12 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
42 Schulze-Dörrlamm 2008.
Abb. 1 Aktuelle Ergebnisse der archäologischen Forschungen auf der Krim wurden auch im Rahmen der Ausstellung »Byzanz – dasRömerreich im Mittelalter« in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn präsentiert. Der Generaldirektordes RGZM Univ.-Prof. Dr. Falko Daim führte den griechischen Kulturminister Pavlos Geroulanos und S. Em. den Metropoliten von Deutsch-land und Exarch von Zentraleuropa Augustinos durch die Ausstellung. – (© Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutsch-land, Foto M. Brandenburgh).
Ansätzen heraus erarbeiteten Ergebnisse in einer Synthese43, einem hypothetischen Modell zur Sied -
lungsgeschichte und Kulturtransformation in der Bergkrim, durch Wissenschaftler des RGZM, die als letz-
ter Beitrag am Ende des Bandes zu finden ist. Das vorgeschlagene Modell soll dazu herausfordern, bei
der Untersuchung von Transformationsprozessen in anderen Kontaktzonen auf die Probe gestellt zu wer-
den. Neben den zu erwartenden Erkenntnissen für die Siedlungs- und Landschaftsarchäologie bietet sich
so insbesondere die Möglichkeit, Forschungsergebnisse der Krimarchäologie über einen Kreis regionaler
Experten hinaus in die Bearbeitung übergreifender historisch-kulturwissenschaftlicher Fragestellungen ein-
zubringen.
VERMITTLUNG
Ein Einblick in den Stand der laufenden Forschungen und eine Einführung in die byzantinisch-mittelalterli-
che Archäologie der Krim wurde der breiten Öffentlichkeit wie dem Fachpublikum im Rahmen der
Ausstellung »Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter« in der Bundeskunsthalle vermittelt 44 (Abb. 1). Neben
den Projektteilnehmern wurden dazu auch weitere Fachkollegen eingeladen.
Im Rahmen einer Lehrveranstaltung erhielten Studenten der Universität Mainz mit einer Exkursion eine
Einführung in die Archäologie der Krim und die Feldforschungen des RGZM (Abb. 2-4).
Eine Anerkennung der geleisteten kulturpolitischen Arbeit stellte die Einladung dar, das Krimprojekt im
Rahmen der deutsch-ukrainischen Kulturwochen in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Kiew
vorzustellen.
FINANZIERUNG
Die Realisierung dieses Projektes mit seinen Herausforderungen, Risiken und Chancen im Bereich der
Forschung und Entwicklungsförderung erfolgte mit Mitteln des Paktes für Forschung und Innovation. Mit
diesem Pakt verpflichteten sich Bund und Länder gegenüber den vier großen außeruniversitären
Forschungsorganisationen, zu denen auch die Leibniz-Gemeinschaft gehört, sowie gegenüber der
Deutschen Forschungsgemeinschaft zu einer jährlichen Steigerung der institutionellen Förderung um min-
destens drei Prozent zwischen 2006 und 201045.
In der Leibniz-Gemeinschaft entschied man sich dafür, ein Drittel der durch den Pakt zusätzlich erlangten
Mittel im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens zu verteilen, an dem sich alle Mitglieder-Institute beteili-
gen konnten46. Die einzelnen Anträge mussten Förderleitlinien zuzuordnen sein, die von der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung vorgegeben wurden. Zuständig für die Verfah -
rens durchführung war der mehrheitlich mit externen Wissenschaftlern besetzte Senatsausschuss Wett -
bewerb (SAW). Das Verfahren wurde als »Novum in der Geschichte der deutschen Forschungsförderung«
13Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
43 Siehe den Beitrag von Albrecht /Herdick / Schreg in diesemBand.
44 Daim /Drauschke 2010.
45 Aktuelle Informationen über die weitere Entwicklung desPaktes finden sich im Internet: www.pakt-fuer-forschung.de(19.7.2012).
46 Herbort-von Loeper / Steegers 2007.
14 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
Abb. 2 Deutsch-ukrainisch-polnische Surveymannschaft vor der Unterkunft am Fuße des Mangup. – (Foto R. Schreg, RGZM).
Abb. 3 Fester Bestandteil der Feldkampagnen auf der Krim waren regelmäßige Abendvorträge zur Weiterbildung der beteiligten Stu-dentinnen und Studenten und zur Diskussion vorläufiger Ergebnisse. – (Foto M. Herdick, RGZM).
15Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
Abb. 4 Eine Einführung in die Archäologie der Krim und die laufenden Forschungsarbeiten erhielten Studentinnen und Studenten desMainzer Instituts für Vor- und Frühgeschichte im Rahmen einer Exkursion. – (Foto R. Schreg, RGZM).
Abb. 5 Mit dem Krimprojekt sollte auch die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen auf der Krim und in Westeuropa ver-bessert werden. V. l. n. r.: Prof. Dr. Falko Daim (RGZM), Jean-Pierre Froehly (1. Sekretär der Abteilung für Kultur, Bildung und Minderhei-ten, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Kiev), Prof. Dr. Aleksandr I. Ajbabin (Ukrainische Akademie der Wissenschaften, Institutfür Östliche Studien, Simferopol) und Prof. Dr. Aleksandr G. Gercen (Universität Simferopol, Institut für Alte und MittelalterlicheGeschichte). – (Foto J. Drauschke, RGZM).
bezeichnet, weil erstmals »institutionelle Fördergelder im Zuge eines wettbewerblichen Verfahrens verge-
ben« wurden47.
AUSBLICK
Das Engagement des RGZM auf der Krim wurde nach Ende des Projektes auf die Unterstützung bei der
Publikation von Materialvorlagen und der technischen Beratung bei konkreten Anfragen reduziert. Es ist
aber nicht ausgeschlossen, dass die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Partnern nach einer grundle-
genden Änderung des derzeit problematischen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisses kurzfristig
wieder intensiviert wird. Das Potential dafür wäre im Übermaß vorhanden.
LITERATUR
16 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
47 Ebenda 7. Siehe auch Schavan 2007.
Abegg-Stiftung /Gruber 1984: Abegg-Stiftung / A. Gruber (Hrsg.),Chinoiserie: Der Einfluss Chinas auf die europäische Kunst 17.-19. Jahrhundert (Bern 1984).
Aguirre Rojas 1999: C. A. Aguirre Rojas, Fernand Braudel und diemodernen Sozialwissenschaften (Leipzig 1999).
Ajbabin 1987: A. Ajbabin, Ėtničeskaja prinadležnost’ mogil’nikovKryma IV – pervoj poloviny VII vv. n. ė. In: A. I. Ajbabin / T. N.Vysotskaja / V. M. Zubar’ (vyd.), Materialy k ėtničeskoj istoriiKryma (Kiev 1987) 164-198.
1999: A. Ajbabin, Ėtničeskaja istorija rannevizantijskogo Kryma(Simferopol 1999).
2011: A. I. Ajbabin, Archäologie und Geschichte der Krim inbyzantinischer Zeit. Monographien RGZM 98 (Mainz 2011).
Ajbabin / Chajredinova 2009: A. Ajbabin / E. Chajredinova, DasGräberfeld beim Dorf Lučistoe. Monographien RGZM 98 (Mainz2009).
Albrecht 2011: St. Albrecht, Die Tartariae descriptio des MartinusBroniovius. In: Albrecht / Herdick 2011, 1-10.
2012: St. Albrecht, Die Tartariae descriptio des Martinus Bronio-vius. Entstehung und Wirkung eines Gesandtenberichts aus demKrimkhanat. In: D. Klein /M. Arens (Hrsg.), Das frühneuzeitlicheKrimkhanat zwischen Orient und Okzident (Wiesbaden 2012)149-168.
2012a: St. Albrecht, Życie i dzieło Martinusa Bronioviusa aliasMarcina Broniewskiego. In: M. Maczynska (Hrsg.), Marcin Bro-niewski. Opis Tatarii. (Łódź 2012) IX-XXII.
2012b: St. Albrecht, Quellen zur Geschichte der byzantinischenKrim. Monographien RGZM 101 (Mainz 2012).
Albrecht u.a. 2008: St. Albrecht / A. Ajbabin / F. Daim / M. v. Auf-schnaiter / M. Herdick / R. Schreg, Die Höhlenstädte der SW-Krim – Siedlung und Umwelt an der Nordgrenze des Byzantini-schen Reiches. Archäologie in Deutschland 2008/1, 12-18.
Albrecht /Herdick 2011: S. Albrecht / M. Herdick (Hrsg.), Im Auf-trag des Königs. Ein Gesandtenbericht aus dem Land der Krim-tataren. Die Tartariae descriptio des Martinus Broniovius. Mono-graphien RGZM 89 (Mainz 2011).
Angeli 1991: W. Angeli, Der ethnologische Ethnosbegriff und seineAnwendung in der Prähistorie. Mitteilungen der Anthropologi-schen Gesellschaft in Wien 121, 1991, 189-202.
Atalay 2006: S. Atalay, Indigenous Archaeology as DecolonizingPractice. The American Indian Quarterly 30, 2006, 280-310.
Aufschnaiter 2009: M. Aufšnajter, Novye issledovanija peščer goro-dišča Ėski Kermen (Neue Untersuchungen zu den Höhlen deralten Siedlung Ėski-Kermen). Materialy po archeologii, istorii iėtnografii Tavrii 14, 2009, 316-332.
Aufschnaiter u.a. 2008: M. Aufschnaiter / A. Cramer / G. Heinz / -H. Müller, Documentation of Medieval Caves in Southern Cri-mea (Ukraine) Using Hybrid Data Sources. In: A. Posluschny /K. Lambers / I. Herzog (Hrsg.), Layers of Perception. Proceedingsof the 35th International Conference on Computer Applicationsand Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, April 2-6, 2007 (Bonn 2008) 72-77. – Online: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2010/533/ (20.12.2012).
Axt 2012: H.-J. Axt, Rezension zu: Skordos, Adamantios: Grie-chenlands Makedonische Frage. Bürgerkrieg und Geschichtspo-litik im Südosten Europas, 1945-1992. Göttingen 2012. H-Soz-u-Kult, 20.11.2012. Online: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2012-4-153 (20.12.2012).
Bachmann-Medick 2009: D. Bachmann-Medick, Cultural Turns.Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften (Reinbek beiHamburg 32009) 184-237.
Barley 1989: N. Barley, Die Raupenplage. Von einem, der auszog,Ethnologie zu betreiben (Stuttgart 1989).
1990: N. Barley, Traumatische Tropen. Notizen aus meiner Lehm-hütte (Stuttgart 1990).
Bemmann 2013: J. Bemmann, Die frühmittelalterlichen Gräberfel-der von Adym-Čokrak, Južnyj I und Južnyj II am Fuße des Man-gup. Monographien RGZM 108 (Mainz 2013).
Besio 2009: C. Besio, Forschungsprojekte: Zum Organisationswan-del in der Wissenschaft (Bielefeld 2009).
Bierbrauer 1999: V. Bierbrauer, Die ethnische Interpretation derSîntana de Mures-Cernjachov-Kultur. Akten des InternationalenKolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995. In: G.Gomolka-Fuchs (Hrsg.), Die Cernjachov-Sîntana de Mures-Kul-tur. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 2 (Bonn 1999) 211-238.
2004: V. Bierbrauer, Zur ethnischen Interpretation in der frühge-schichtlichen Archäologie. In: W. Pohl (Hrsg.), Die Suche nachden Ursprüngen. Von der Bedeutung des frühen Mittelalters.Denkschriften. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philoso-phisch-Historische Klasse 322 (Wien 2004) 45-84.
2008: V. Bierbrauer, Ethnos und Mobilität im 5. Jahrhundert ausarchäologischer Sicht: Vom Kaukasus bis nach Niederösterreich.Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,Philosophisch-historische Klasse, N.F. 131 (München 2008).
Blanckenburg u.a. 2005: C. v. Blanckenburg / B. Böhm / H.-L. Die-nel / H. Legewie, Leitfaden für interdisziplinäre Forschergruppen:Projekte initiieren – Zusammenarbeit gestalten (Stuttgart 2005).
Brather 1996: S. Brather, »Germanische«, »slawische« und »deut-sche« Sachkultur des Mittelalters – Probleme ethnischer Inter-pretation. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 37, 1996,177-216.
2000: S. Brather, Ethnische Identitäten als Konstrukte der früh-geschichtlichen Archäologie. Germania 78, 2000, 139-177.
2004: S. Brather, Ethnische Interpretationen in der frühge-schichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alterna-tiven. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Erg.-Bde.42 (Berlin, New York 2004).
2005: S. Brather, Germanen, Slawen, Deutsche. Themen,Methoden und Konzepte der frühgeschichtlichen Archäologieseit 1800. In: Ders. /C. Kratzke (Hrsg.), Auf dem Weg zum Ger-mania Slavica-Konzept. Perspektiven von Geschichtswissen-schaft, Archäologie, Onomastik und Kunstgeschichte seit dem19. Jahrhundert (Leipzig 2005) 27-59.
Braudel 1977: F. Braudel, Geschichte und Sozialwissenschaften.Die longue durée. In: C. Honegger (Hrsg.), Schrift und Materieder Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneignung histo-rischer Prozesse. Edition Suhrkamp 814 (Frankfurt am Main1977) 47-85.
Castañeda / Matthews 2008: Q. E. Castañeda / C. N. Matthews(Hrsg.). Ethnographic Archaeologies: Reflections on Stakehol-ders and Archaeological Practices (Lanham / MD 2008).
Collier 2008: P. Collier, Die unterste Milliarde. Warum die ärmstenLänder scheitern und was man dagegen tun kann, Lizenzaus-gabe. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung706 (Bonn 2008).
Cramer /Heinz /Müller 2010: A. Cramer / G. Heinz / H. Müller, Spa-tial Data for Large Size Archaeological Projects – An Example. In:CAA Conference 2010, Fusion of the Cultures XXXVIII AnnualConference on Computer Application and Quantitative Methodsin Archaeology Granada 2010. Online: http://www.i3mainz.fh-mainz.de/publicat/heinz10/CAA_2010_Extended_Abstract_Cramer_Heinz_Mueller.pdf (20.12.2012).
Daim /Drauschke 2010: F. Daim / J. Drauschke (Hrsg.), Byzanz – dasRömerreich im Mittelalter. Monographien RGZM 84, 1-4 (Mainz2010) .
Defila / Guilio / Scheuermann 2006: R. Defila / A. D. Giulio / M.Scheuermann, Forschungsverbundmanagement. Handbuch fürdie Gestaltung inter- und transdisziplinärer Projekte (Zürich2006).
Diamond 2009: J. Diamond, Arm und Reich. Die Schicksalemensch licher Gesellschaftenl. Fischer Taschenbücher 17214(Frankfurt am Main 52009).
Edgeworth 2006: M. Edgeworth, Ethnographies of ArchaeologicalPractice. Cultural Encounters, Material Transformations (Lanham/ MD 2006).
Fehr 2007: H. Fehr, The »Germanic Heritage« of Northern Gaul.Early Medieval Archaeology in Occupied France and Belgium. In:J.-P. Legendre / L. Olivier (Hrsg.), L’archéologie nationale-socialistedans les pays occupés a l’Ouest du Reich: actes de la table rondeinternationale »Blut und Boden« tenue à Lyon (Rhône) dans lecadre du Xe congrès de la European Association of Archaeo -logists (EAA), les 8 et 9 septembre 2004 (Gollion 2007) 325-335.
2008: H. Fehr, Germanische Einwanderung oder kulturelle Neu-orientierung? Zu den Anfängen des Reihengräberhorizontes. In: S. Brather (Hrsg.), Zwischen Spätantike und Frühmittelalter:Archäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im Westen. Reallexikonder germanischen Altertumskunde, Erg.-Bd. 57 (Berlin, NewYork 2008) 67-102.
2010: H. Fehr, Germanen und Romanen im Merowingerreich.Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Erg.-Bd. 68(Berlin, New York 2010).
Focke-Museum 2013: Focke-Museum (Hrsg.), Graben für Germa-nien: Archäologie unterm Hakenkreuz (Stuttgart 2013) (imDruck)
17Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
Fol / Lichardus / Nikolov 2004: A. Fol / J. Lichardus / V. Nikolov(Hrsg.), Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 23 Juli bis28. November 2004, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-republik Deutschland (Mainz 2004).
Gercen u.a. 2008: A. Gercen / S. Černyš / J. Bemmann / K. Schnei-der / U. v. Freeden / M. Mączyńska / A. Urbaniak, Die frühge-schichtlichen Gräberfelder am Fuß des Mangup-Plateaus. Archä-ologie in Deutschland 2008/1, 15-16.
Härke 2002: H. Härke, Archaeology, Ideology and Society. The Ger-man Experience (Frankfurt am Main 22002).
Halle 2002: U. Halle, Die Externsteine sind bis auf weiteres germa-nisch! Prähistorische Archäologie im Dritten Reich. Sonderveröf-fentlichungen des Naturwissenschaftlichen und HistorischenVereins für das Land Lippe 68 (Bielefeld 2002).
Hallinger 1996: J. F. Hallinger, Das Ende der Chinoiserie: Die Auflö-sung eines Phänomens der Kunst in der Zeit der Aufklärung(München 1996).
Hamilakis /Duke 2008: Y. Hamilakis / P. Duke, (Hrsg.), Archaeologyand Capitalism. From Ethics to Politics (Walnut Creek / CA 2008).
Harrison / Williamson 2002: R. Harrison / C. Williamson, After Cap-tain Cook: The Archaeology of the Recent Indigenous Past inAustralia (Walnut Creek / CA 2002).
Herbort-von Loeper / Steegers 2007: Ch. Herbort-von Loeper /R. Steegers, Forschung mit Strategie. Im Pakt für Forschung undInnovation garantiert die Politik mehr Geld für Forschung – dieWissenschaft verpflichtet sich auf Leistungssteigerung und Inno-vationsstrategien. Leibniz. Journal der Leibniz-Gemeinschaft2007/2, 6-7.
Herdick / Schreg 2009: M. Herdick / R. Schreg, Das Bergland derKrim im Frühmittelalter. Die »Höhlenstädte« Mangup, Eski Ker-men und ihr Umland. In: F. Biermann / Th. Kersting /A. Klammt(Hrsg.), Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischenRaum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes fürAltertumsforschung in Halle an der Saale, 19. bis 21. März 2007(Langenweissbach 2009) 295-315.
Hodder 1982: I. Hodder, Theoretical Archaeology. A ReactionaryView. In: Ders. (Hrsg.), Symbolic and Structural Archaeology(Cambridge 1982) 1-16.
Hrycak 2002: J. Hrycak, Ukrainian Historiography 1991-2001. TheDecade of Transformartion. In: A. Ivanišević /A. Kappeler /W.Lukan /A. Suppan (Hrsg.), Klio ohne Fesseln? Historiographie imöstlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus(Wien 2002) 107-126.
Jobst 2010: K. S. Jobst, Geschichte der Ukraine (Stuttgart 2010).
2011: K. S. Jobst, Das frühneuzeitliche Krim-Khanat. In: Al -brecht /Herdick 2011, 17-22.
Jones 1997: S. Jones, The Archaeology of Ethnicity. ConstructingIdentities in the Past and Present (London 1997).
Kappeler 2009: A. Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine. Beck’-sche Reihe 1059 (München 32009).
Kaser 2007: K. Kaser, Fernand Braudels Mittelmeerwelten. Einehistorisch-anthropologische Perspektive. In: F. B. Schenk (Hrsg.),Der Süden. Neue Perspektiven auf eine europäische Geschichts-region (Frankfurt am Main, New York 2007) 75-97.
Kerber 2006: J. E. Kerber, (Hrsg.), Cross-Cultural Collaboration:Native Peoples and Archaeology in the Northeastern United Sta-tes (Lincoln, London 2006).
Kerig 1998: T. Kerig, Ian Hodder und die britische Archäologie. In:M. K. H. Eggert /U. Veit (Hrsg.), Theorien in der Archäologie: Zurenglischsprachigen Diskussion (Münster 1998) 217-242.
Kinser 1981: S. Kinser, Annaliste Paradigme? The GeohistoricalStructuralism of Fernand Braudel. American Historical Review86, 1981, 63-105.
Kizilov 2009: M. Kizilov, »Autochthonous« Population, Ethnic Con-flicts and Abuse of the Middle Ages in Ukraine and the Autono-mous Republic of Crimea. In: J. M. Bak / J. Jarnut / P. Monnet /B. Schneidmüller (Hrsg.), Gebrauch und Missbrauch des Mittel-alters, 19.-21. Jahrhundert (München 2009) 297-311.
Knorr-Cetina 2002: K. Knorr-Cetina, Wissenskulturen: Ein Ver-gleich naturwissenschaftlicher Wissensformen (Frankfurt amMain 22002).
Kulturstiftung Ruhr 1995: Kulturstiftung Ruhr (Hrsg.), Das AlteChina. Menschen und Götter im Reich der Mitte 5000 v. Chr.-220 n. Chr. (Essen 1995).
2006: Kulturstiftung Ruhr (Hrsg.), Tibet: Klöster öffnen ihreSchatzkammern (Essen 2006).
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland2006: Kunst- und Ausstellungshalle der BundesrepublikDeutschland (Hrsg.), Angkor – Göttliches Erbe Kambodschas(Bonn 2006).
Kunz 2005: N. Kunz, Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941-1944). Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität (Darm-stadt 2005).
Leloup 2011: H. Leloup, (Hrsg.), Dogon: Weltkulturerbe Afrikas.Katalog zur Ausstellung in Bonn, Bundeskunsthalle der Bundes-republik Deutschland, 14.1.2011-22.1.2012 (München 2011).
Levene 1996: R. J. Levene, Project management. In: M. Warner(Hrsg.), International Encyclopedia of Business & Management 4(London, New York 1996) 4162-4181.
Lüdemann 2006: E. Lüdemann, Ukraine. Beck’ sche Reihe Länder(München 32006).
Lundin / Söderholm 1998: R. A. Lundin / A. Söderholm, Conceptu-alizing a Projectified Society. Discussion of an Eco-InstitutionalApproach to the Theory on Temporary Organizations. In: R. A.Lundin / Ch. Midler (Hrsg.), Projects as Arenas for Renewal andLearning Processes (Boston, Dordrecht, London 1998) 13-23.
Lutz 1982: H. Lutz, Braudels La Méditerranée. Zur Problematikeines Modellanspruchs. In: R. L. Koselleck / H. Lutz / J. Rüsen(Hrsg.), Formen der Geschichtsschreibung (München 1982) 320-352.
18 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
Macdonalds jr. 1989: S. Macdonalds jr., Das Krimgotische. In: H. Beck (Hrsg.), Germanische Rest- und Trümmersprachen. Real-lexikon der Germanischen Altertumskunde, Erg.-Bd. 3 (Berlin1989) 175-194.
Mączyńska u.a. 2013: M. Mączyńska / A. Gercen / O. Ivanova / S.Černyš / S. Lukin / A. Urbaniak / J. Bemmann / K. Schneider / I.Jakubczyk, Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-Dere amFuß des Mangup auf der Südwestkrim. Monographien RGZM115 (Mainz 2013) (im Druck)
Miller 1993: D. H. Miller, Ethnogenesis and Religious Revitalizationbeyond the Roman Frontier. The Frankish Origins. Journal ofWorld History 4, 1993, 277-285.
Mittelstraß 2008: J. Mittelstraß, Das Neue in der Forschung und dieForschungspolitik. In: H. Schmidinger / C. Sedmak (Hrsg.), DerMensch – ein kreatives Wesen? Topologien des Menschlichen 5(Darmstadt 2008) 75-85.
Mommsen /Bollmus 2006: H. Mommsen / R. Bollmus, Das AmtRosenberg und seine Gegner: Studien zum Machtkampf imnationalsozialistischen Herrschaftssystem (München 2006).
Pohl 2010: W. Pohl (Hrsg.), Archaeology of Identity: Archäologieder Identität. Denkschriften. Akademie der Wissenschaften inWien, Philosophisch-Historische Klasse 406=Forschungen zurGeschichte des Mittelalters 17 (Wien 2010).
Rauterberg 2011: H. Rauterberg, Mali-Ausstellung: Geformt vomgroßen Töpfergott. Lassen sich Tradition und Moderne versöh-nen? In Malis Lehmbauten schon. Und doch ist das afrikanischeWeltkulturerbe bedroht. Die Zeit 2011. Online: http://www.zeit. de/ 2011/43/Mali-Dogon-Kultur (21.12.2012).
Reikat 2005: A. Reikat, Wir und die Anderen. Zur Frage nach derFremdheit in der Ethnologie. Historische Zeitschrift 281, 2005,281-305.
Rogge 1993: K. I. Rogge, Kultur, Projekt, Management (Hagen1993).
Rummel 2007: Ph. v. Rummel, Habitus barbarus: Kleidung undRepräsentation spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert. Real-lexikon der Germanischen Altertumskunde, Erg.-Bd. 55 (Berlin,New York 2007).
Said 1981: E. W. Said, Orientalismus (Frankfurt am Main 1981).
Schavan 2007: A. Schavan, Wettbewerb durchbricht die »Versäu-lung«. Der Anteil wettbewerblich vergebener institutioneller För-dermittel muss steigen, um die Innovationsorientierung der Wis-senschaft weiter zu erhöhen. Leibniz. Journal der Leibniz-Gemeinschaft 2007/2, 3.
Schreg 2008: R. Schreg, Das Umfeld der Höhlenstädte Mangupund Eski Kermen auf der südwestlichen Krim – eine Siedlungs-landschaft in der Peripherie des byzantinischen Reiches. Sied-lungsforschung 26, 2008, 267-286.
2009: R. Schreg, Wasser im Karst: Mittelalterlicher Wasserbauund die Interaktion von Mensch und Umwelt. Mitteilungen derDeutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und derNeuzeit 21, 2009, 17-30.
2009a: R. Šreg, K voprosu izučenija osvoenija okrugi Mangupa iĖski-Kermena v ėpochu Velikogo pereselenija narodov i srednieveka s točki zrenija archeologii poselenija i okružajuščej sredy.Materialy po archeologii, istorii i ėtnografii Tavrii 15, 2009, 174-195.
2010: R. Schreg, Zentren in der Peripherie: Landschaftsarchäolo-gische Forschungen zu den Höhensiedlungen der südwestlichenKrim und ihrem Umland. In: Daim /Drauschke 2010/3, 95-109.
2011: R. Schreg, Der Reisebericht des Broniovius – Text undArchäologie. In: Albrecht /Herdick 2011, 23-44.
Schulze-Dörrlamm 2008: M. Schulze-Dörrlamm, Zur Nutzung vonHöhlen in der christlichen Welt des frühen Mittelalters (7.-10.Jahrhundert). Jahrbuch RGZM 55, 2008, 529-575.
Shanks /Hodder 1998: M. Shanks / I. Hodder, Processual, Postpro-cessual and Interpretive Archaeologies. In: D. S. Whitley (Hrsg.),Reader in Archaeological Theory: Post-Processual and CognitiveApproaches (London, New York 1998) 69-98.
Shanks / Tilley 1992: M. Shanks / C. Tilley, Reconstructing Archaeo-logy. Theory and Practice (Cambridge 1992).
1996: M. Shanks / C. Tilley, Social Theory and Archaeology(Cam bridge 1987, Nachdr. 1996).
Shaw 2001: B. D. Shaw, Challenging Braudel: A New Vision of theMediterranean. Journal of Roman Archaeology 14, 2001, 419-453.
Skordos 2012: A. Skordos, Griechenlands Makedonische Frage:Bürgerkrieg und Geschichtspolitik im Südosten Europas, 1945-1992 (Göttingen 2012).
Smith Bowen 1987: E. Smith Bowen, Rückkehr zum Lachen. Einethnologischer Roman. (Reinbek bei Hamburg 1987).
Smith /Wobst 2010: C. Smith / H. M. Wobst (Hrsg.), IndigenousArchaeologies. Decolonizing Theory and Practice (London, NewYork 2010).
Stiernon / Stiernon 1986: Dictionnaire d’histoire et de géographieecclésiastique 21 (Paris 1986) 862-918 s.v. Gotthia (R. Stier-non / L. Stiernon)
Stork 1997: I. Stork, Brauchen wir noch Alamannen? Zum Stellen-wert merowingerzeitlicher Grabfunde in der Landesarchäologie.Denkmalpflege in Baden-Württemberg 26, 1997, 39-43.
Stork /Wahl 2009: I. Stork / J. Wahl, Außergewöhnliche Gräberbeim Herrenhof: Merowingerzeitliche Siedlungsbestattungenaus Lauchheim »Mittelhofen«. In: J. Biel / J. Heiligmann / D. L.Krause (Hrsg.) Landesarchäologie: Festschrift für Dieter Planckzum 65. Geburtstag (Stuttgart 2009) 531-556.
Theune-Großkopf 2006: B. Theune-Großkopf, Die vollständigerhaltene Leier des 6. Jahrhunderts aus Grab 58 von Trossingen,Ldkr. Tuttlingen, Baden-Württemberg: Ein Vorbericht. Germania84, 2006, 93-142.
2010: B. Theune-Großkopf, Ein hervorragend erhaltenes Musik-instrument aus dem Frühmittelalter: die Leier aus Grab 58 vonTrossingen, Lkr. Tuttlingen. In: M. Zepf / C. Schaper (Hrsg.), VomMinnesang zur Popakademie: Musikkultur in Baden-Württem-berg. Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2010 im
19Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
Badischen Landesmuseum Schloss Karlsruhe, 16.4.-12.9.2010(Karlsruhe 2010) 129-134.
Timpe 2004: D. Timpe, Der Mythos vom Mittelmeerraum: Überdie Grenzen der alten Welt. Chiron 34, 2004, 3-23.
Timtschenko 2009: V. Timtschenko, Ukraine – Einblicke in denneuen Osten Europas (Berlin 2009).
Trigger 1991: B. G. Trigger, Post-Processual Developments inAnglo-American Archaeology. Norwegian ArchaeologicalReview 24/2, 1991, 65-76.
B. G. Trigger, Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist,Imperialist. In: R. Preucel / I. Hodder (Hrsg.), Contemporary Ar -chae ology in Theory (Oxford 1996) 615-631.
Vokotopoulou /Misdrachi-Kapon 1994: I. Vokotopoulou / R. Mis -drachi- Kapon (Hrsg.), Makedonen: die Griechen des Nordens.Sonderausstellung, 11.3.1994-19.6.1994, Forum des Landes-museums Hannover (Athen 1994).
Wieczorek / Périn 2001: A. Wieczorek / P. Périn (Hrsg.). Das Goldder Barbarenfürsten (Stuttgart 2001).
Wobst 1978: H. M. Wobst, The Archaeo-Ethnology of Hunter-Gatherers or the Tyranny of the Ethnographic Record in Archae-ology. American Antiquity 43, 1978, 303-309.
Woesler 2006: M. Woesler, Zwischen Exotismus, Sinozentrismusund Chinoiserie / Européerie (Bochum 32006).
20 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
Zusammenfassung / Abstract / Резюме
Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim (2006-2008)Das Krim-Projekt des RGZM ging auf eine Einladung von Prof. Dr. Aleksandr I. Ajbabin (Ukrainische Akademie der Wis-senschaften, Institut für Östliche Studien, Simferopol) und Prof. Dr. Aleksandr G. Gercen (Universität Simferopol, Insti-tut für Alte und Mittelalterliche Geschichte) an den Generaldirektor des RGZM zurück. Ausgangspunkt der Planungwar die bis heute gültige Beobachtung, dass in den Schriftquellen über Jahrhunderte hinweg eine regionale (»goti-sche«) Identität greifbar ist. Daraus ergibt sich die Frage, welche Strukturen diese kulturelle Identität befördert habenund wie sich die Verhältnisse auf der Krim über die Jahrhunderte in historischen Prozessen der kulturellen Transforma-tion und Adaption verändert haben.Nach Sondierungen vor Ort bestand Klarheit darüber, dass ein internationales Kooperationsprojekt den politischen undwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Ukraine mit ihren Auswirkungen auf die einheimischen archäologischenForschungseinrichtungen Rechnung tragen muss. Bei der Planung und Durchführung eines Projektes auf der Krimkonnte man daher nicht unreflektiert auf vertraute Strukturen drittmittelfinanzierter Forschungsförderung in Deutsch-land zurückgreifen. Es musste bei Geldgebern wie beteiligten wissenschaftlichen Institutionen der Wille vorhandensein, neue Formen der Zusammenarbeit zu erproben. Dazu gehörte insbesondere eine besondere Sensibilität für dieGrenzen und Möglichkeiten der Partner aus anderen Wissenschaftskulturen im Arbeitsalltag. Ferner war die Bereit-schaft gefordert, Risiken einzugehen. Nach der klassischen Managementlehre ist für ein solches Pioniervorhaben, dieProjektform eigentlich nicht die ideale Organisationsform. Nach eingehenden methodischen Überlegungen und vorallem auch unter Berücksichtigung grundlegender Aspekte des praktischen Wissenschaftsmanagements wurden fol-genden Anforderungen für ein Pionierprojekt auf der Krim definiert. den unterschiedlichen Voraussetzungen allerbeteiligten Partner Rechnung tragen und gleichzeitig die angemessene wissenschaftliche Bearbeitung der Fragestel-lung des Projekts erlauben (s. o.):1. Die Projektstruktur soll der Profilierung und Entwicklung bestehender bzw. in der Genese befindlicher Arbeitsfelderdes RGZM als Hauptprojektträger dienen,2. zum Fortbestand und möglichst zur Optimierung bestehender Forschungsanstrengungen einheimischer Institutio-nen auf der Krim beitragen,3. Führungspersonal, Mitarbeiter/Innen und Studenten/Innen aller beteiligten Einrichtungen Möglichkeiten bieten,Erfahrungen mit den Ansätzen und Methoden der Partner zu sammeln und in die Bearbeitung der Leitfrage des Pro-jekts einzubringen,4. unterschiedliche Forschungstraditionen und -ansätze mit ihren Grundlagen gleichberechtigt abbildet, aber dieErgebnisse in einer Auswertung zusammenführt und5. in einer weiten Perspektive erlaubt, Arbeitsgebiete und Potenziale für zukünftige Kooperationen auszuloten.Zur Stabilisierung der Projektgrundlagen wurde zunächst ein Maßnahmenbündel beschlossen, um einen umfangrei-chen Technologietransfer für die ukrainische Archäologie im Bereich der Geoinformatik zu gewährleisten. Dazu gehör-ten u.a. die Erstellung eines einheitlichen Vermessungssystems im Bereich des Mangup und des Eski Kermen sowie derAufbau eines GIS. Ukrainische Nachwuchswissenschaftler wurden im Rahmen eines Stipendienprogrammes für dessen
Betreuung und Ausbau geschult. Weitere umfangreiche Bemühungen in diesem Bereich galten der Katalogisierungund Vermessung der Höhlenkomplexe auf dem Eski Kermen und dem Mangup.Zur Erschließung von Quellengrundlagen für den internationalen Forschungsdialog wurden verschiedene Vorhabenrealisiert. Dazu gehört eine möglichst vollständige Vorlage der griechischen, lateinischen und slavischen schriftlichenÜberlieferung über die Krim zwischen 300 und 1204 n. Chr. Ferner eine mit einführenden Texten versehene Überset-zung des Gesandtschaftsberichts des Bronovius, der die älteste überlieferte Beschreibung des Mangup enthält. Darü-ber hinaus wurde eine Reihe von Gräberfeldpublikationen initiiert und begleitet: darunter der erste Band des Gräber-feldes von Lučistoe an der Südküste der Krim und Artikel über die laufenden Ausgrabungen auf dem Bestattungsplatzam Ėski Kermen (A. I. Ajbabin) sowie die Vorlage von Friedhöfen am Mangup (J. Bemmann, A. G. Gercen, M. Mączy-ńska u. a.). Während der Projektlaufzeit wurden die laufenden Ausgrabungen auf den Gräberfeldern von einemAnthropologenteam der Universität Mainz begleitet. Es sondierte unter der Leitung von Kurt Alt das Potenzial für palä-ogenetische Untersuchungen.Um eine bessere Rezeption der Grundlagen der ukrainisch-russischen Krimarchäologie im Westen zu ermöglichen,wurde den Materialvorlagen eine erweiterte und überarbeitete Ausgabe des Standardwerkes von Prof. Aleksandr I.Ajbabin über die frühmittelalterliche Geschichte der Krim an die Seite gestellt. Hinzu kommt eine überarbeitete Fas-sung der Dissertation von Prof. Aleksandr G. Gercen über das Befestigungssystem des Mangup Kale, dessen Ver-ständnis grundlegend für die Interpretation der Siedlungsgeschichte auf diesem Berg ist.In der Feldforschung wurde ein Schwerpunkt in der Siedlungs- und Landschaftsarchäologie im Umfeld der beidenHöhensiedlungen gesetzt, da hier bislang systematische Untersuchungen fehlten und es im Hinblick auf die Aus-gangsfrage zu klären galt, welchen Einfluss historisch-geografische Faktoren auf die Verhältnisse in der südwestlichenBergkrim ausübten. Zentrales Ergebnis des Gesamtprojekts ist schließlich die Zusammenführung der von unterschiedlichen Forschungsträ-gern und aus verschiedenen methodischen Ansätzen heraus erarbeiteten Ergebnisse in einer Synthese, einem hypo-thetischen Modell zur Siedlungsgeschichte und Kulturtransformation in der Bergkrim, die am Ende des Bandes zu fin-den ist. Das vorgeschlagene Modell soll dazu herausfordern, bei der Untersuchung von Transformationsprozessen inanderen Kontaktzonen auf die Probe gestellt zu werden. Neben den zu erwartenden Erkenntnissen für die Siedlungs-und Landschaftsarchäologie bietet sich so insbesondere die Möglichkeit, Forschungsergebnisse der Krimarchäologieüber einen Kreis regionaler Experten hinaus in die Bearbeitung übergreifender historisch-kulturwissenschaftlicher Fra-gestellungen einzubringen.
Considerations about an European project design: investigations from RGZM in Crimea (2006-2008)The RGZM’s Crimea project can trace its origins back to an invitation extended to the general director of the RGZM byProf. Dr. Aleksandr I. Ajbabin (Ukrainian Academy of Science, Institute of Eastern Studies, Simferopol) and Prof. Dr Alek-sandr G. Gercen (University of Simferopol, Department of Ancient and Medieval History). The progenitor of the projectwas the observation, which is still viable today, that for several centuries, there was a tangible regional («gothic») iden-tity in the written sources. Consequently the question arises which structures supported this cultural identity, and how didthe relations in Crimea change over the centuries due to historical processes of cultural transformation and adaption.After on-site preliminary studies, it became clear that an international cooperation project had to accommodate theUkrainian political and economic parameters and their impact on the local archaeological research institutes. Therefore,the planning and execution of a project in Crimea could not fall back blindly on familiar research grants funded by thirdparties in Germany. It was necessary that both the sponsors, as well as the involved academic institutions were willingto try a new form of collaboration. In particular this meant having a particular sensitivity for the limits and possibilitiesof the partners from other scientific traditions in day-to-day workplace activities. Additionally this also meant being willing to take risks. When following the classical managerial rules of thumb, this is not the ideal organizational formfor such a pioneer project. The following requirements for a pioneer project in Crimea were defined after takingmethodical considerations and more importantly fundamental aspects of practical scientific management into account.The different prerequisites of all of the involved partners needed to be accommodated in a way that also allowed asuitable scientific investigation of the project’s focus of study. 1. The project’s structure should shape and develop existing areas of investigation of the RGZM, according to its roleas the overall coordinator of the project;2. the project structure should contribute to the continuance and when possibly to the optimization of existing aca-demic efforts of the local institutes in Crimea;3. managerial staff, personnel and students from all of the partner institutions should be given the chance to gain ex -perience about the approaches and methods of the other partners and to partake in the development of the project’sgoals;
21Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
4. different academic traditions and approaches should be given equal precedence but the final results should be con-solidated into a single synthesis;5. further perspectives for future cooperation and potential areas of study should be explored. In order to form a firm basis for the project’s infrastructure, a course of action was then decided upon to ensure a com-prehensive technology transfer in the area of geoinformatics for the Ukranian archaeology. This entailed, amongst others,the creation of a unified survey system in the areas of Mangup and Eski Kermen, as well as the development of a GIS.As a part of a scholarship program, Ukrainian young scholars were trained to develop and maintain the system. Ad -ditional efforts were made in the area of cataloguing and surveying the cave systems at Eski Kermen and Mangup.Several projects that researched the primary resources of Crimean history and archaeology were initiated. These actedas the basis for an international research dialog. This included an exhaustive search of the Greek, Latin and Slavic written sources about Crimea between 300 and 1204 AD, and also a translation with introductory articles of theaccount of a diplomatic mission by Bronovius, which contains one of the oldest known descriptions of Mangup. Addi-tionally, a series of publications about cemeteries was initiated and supported, including the first volume of the ceme-tery at Lučistoe on the southern shore of Crimea and an article about the continuing excavations at the cemetery atEski Kermen (A. I. Ajbabin), as well as publications about the cemeteries located at Mangup (J. Bemmann, A. G. Ger-cen, M. Mączyńska, among others). During the duration of the project the continuing excavations of the cemeterieswere accompanied by a team of anthropologists from the University of Mainz. Under the direction of Kurt Alt, the teamexplored the possibilities of various palaeoanthropological studies.In order to obtain a better understanding in the West of previous research by the Ukranian-Russian archaeological in -vestigations in Crimea, an expanded and revised edition of the standard works about the early medieval history of Crimea from Prof Aleksandr I. Ajbabin was put into press. A revised version of the dissertation from Prof Aleksandr G.Gercen about the defensives at Mangup Kale was also included, which is fundamental for the interpretation of the hill-top settlement’s history. In the field, emphasis was placed on the settlement and landscape archaeology around both of the hilltop settlements,since there was no systematic study to date, and the area was critical for the original question of the project: whatinfluence did historical- geographic factors have on the relationship in the south-western Crimean mountains.The main goal from the entire project is to compile the results from the different research groups and methodicalapproaches into a synthesis, presented as a hypothetical model of the settlement history and cultural transformationin the Crimean mountains. This model, which can be found at the end of this volume, should also be tested in otherzones where transformation processes have taken place in order to evaluate its viability.
Размышления о европейском дизайне проекта: Исследования РГЦМ в Крыму (2006-2008)Крымский проект РГЦМ начался с приглашения профессора, д.и.н. Александра Айбабина (Крымскоеотделение Института востоковедения им. А. Ю. Крамского Национальной академии наук Украины) и про-фессора, д.и.н. Александра Герцена (кафедра истории древнего мира и средних веков Симферопольскогоуниверситета) генеральному директору РГЦМ. Исходным пунктом в планировании проекта было и по сейдень остается наблюдение, согласно которому в письменных источниках на протяжении столетий сохра-нялась региональная (“готическая”) идентичность. Отсюда возникает вопрос, какие структуры способство-вали формированию и функционированию этой культурной идентичности, и как изменялась ситуация вКрыму в течение столетий в контексте исторических процессов культурной трансформации и адаптации.В результате первых разведочных исследований на месте сложилось четкое представление о том, чтосовместный интернациональный проект должен учитывать политические и экономические условияУкраины, а также их влияние на местные археологические исследовательские институты. Поэтому припланировании и проведении проектных исследований мы не могли механически прибегнуть к знакомыми устоявшимся структурам и процедурам грантового финансирования науки в Германии. Как финанси-рующие организации, так и участвующие в проекте научные институции должны были проявить интереси волю к апробации новых форм сотрудничества. Это предполагало, в частности, проявление в рабочейповседневности особой чуткости к границам и возможностям партнеров, принадлежащих к отличнымнаучным культурам, а также готовность и способность пойти на риск. Согласно классическим учениям поменеджменту, такая архитектура проекта не является идеальной формой организации предприятия, нося-щего пилотный характер. По предварительным соображениям и, прежде всего, принимая во вниманиеосновополагающие аспекты практического научного менеджмента, были сформулированы критерии дляпилотного проекта в Крыму, а именно: соответствие отличным исходным предпосылкам всех участвующихв нем партнеров с одновременным обеспечением условий для надлежащей разработки поставленных в немисследовательских проблем (см. выше). Конкретно речь шла о том, что:
22 M. Herdick · Überlegungen zu einem europäischen Projektdesign: die Forschungen des RGZM auf der Krim
1. структура проекта призвана служить специализации и развитию действующих или формирующихсярабочих областей РГЦМ как ведущего инициатора исследовательского проекта;2. она должна способствовать сохранению и возможной оптимизации текущих исследований местныхнаучных институтов в Крыму;3. в ее задачи входит создание условий для руководства, сотрудников и студентов всех участвующих в про-екте партнерских организаций по взаимному обмену исследовательскими подходами и методами и ихиспользованию при разработке ключевых вопроса и проблем проекта;4. структура проекта должна включать на равных началах различные научно-исследовательские традициии подходы, их фундаментальные основы, но одновременно она должна обеспечивать возможность сведениярезультатов исследований в единое целое;5. структура проекта позволяет наметить перспективные области исследований и аккумулировать потен-циальную базу для последующей научной кооперации.Для стабилизации проектной базы был разработан сначала пакет мероприятий, призванный обеспечить
обширный трансферт технологий в украинскую археологию в области геоинформатики. К ним относи-лось, в частности, внедрение единой системы измерений в регионах Мангупа и Эски-Кермен, а также соз-дание геоинформационной системы. В рамках программы стипендий молодые украинские ученые обуча-лись техническому обслуживанию и развитию ГИС. Другие проектные мероприятия в этой сферевключали каталогизацию и измерения комплекса катакомбных поселений Эски-Кермен и Мангуп.
Для обеспечения поиска, разработки и освоения источниковой базы в рамках интернациональногонаучно-исследовательского диалога были реализованы различные комплексы мероприятий. К ним отно-сился сбор и анализ возможно максимально полного корпуса греческих, латинских и славянских письмен-ных источников по Крыму в период с 300 до 1204 н.э. Также был подготовлен и снабжен комментариямиперевод донесений посланника Мартина Броновия, содержащих первое из дошедших до нас на сегодняш-ний день описаний Мангупа. Кроме того была инициирована и подготовлена серия публикаций помолильникам, в том числе первый сборник публикаций по могильнику Лучистое на южном побережьеКрыма, статья о ведущихся раскопках на территории могильника Эски-Кермен (А. Айбабин), а также планмогильников Мангупа (Й. Бемманн, А. Герцен, М. Мачинская и. др.). Раскопки могильников на всем про-тяжении проекта сопровождала группа антропологов из университета им. Иоганна-Гутенберга г. Майнц.Под руководством Курта Альта антропологи зондировали возможности для проведения палеогенетиче-ских исследований.Помимо перечисленных публикаций, с целью обеспечения максимально широкой базы для рецепцииукраинско-германской археологии Крыма на Западе, нами был подготовлен немецкий перевод дополнен-ного и переработанного фундаментального труда проф. Александра Айбабина по раннесредневековойистории Крыма. С этой же целью был осуществлен перевод переработанной и дополненной монографиипроф. Александра Герцена, посвященной системе укреплений Мангуп-Кале. Работа Герцена является осно-вополагающей для интерпретации истории поселений на горе Мангуп.В рамках полевых исследований определяющим был фокус на археологии поселений и ландшафта в рай-онах обоих поселений, поскольку, во-первых, систематические исследования здесь до сих пор не проводи-лись и, во-вторых, в связи с ключевыми проблемами проекта нас интересовал вопрос влияния историко-географических факторов на ситуацию в юго-западном Крыму.Важнейшим результатом проекта в целом стал, в конечном итоге, синтез материалов, полученных различ-ными исследовательскими группами и учеными, применявших и опиравшихся на отличные методы и под-ходы, в рамках аккумулирующей гипотетической модели истории поселений и культурной трансформа-ции горного Крыма. Эта модель представлена в заключительной части настоящего сборника и может бытьопробована как основа при изучении трансформационных процессов в других контактных зонах. Помимоожидаемого приращения наших познаний в археологии поселений и ландшафтов мы надеемся, чторезультаты проведенных нами археологических исследований в Крыму могут быть использованы за рам-ками локальной и дисциплинарной научной экспертизы - в контексте изучения проблем, носящих меж-дисциплинарный, историко-культурологический характер.
23Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim
1. Auflage 2011, 356 S. mit 246 meist farb. Abb.,
21×28cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-186-3
€ 34,–
Benjamin Fourlas · Vasiliki Tsamakda
Wege nach ByzanzPublikation anlässlich der Ausstellung »Wege nach Byzanz« im Landesmuseum Mainz, vom 6. November 2011 bis zum 5. Februar 2012
Für das mittelalterliche Europa nahm Byzanz – das christianisierte und grä-zisierte oströmische Reich – in vielerlei Hinsicht den Status einer nach -ahmenswerten »Leitkultur« ein. Dennoch wird das byzantinische Erbe, dasin der orthodoxen Kirche und der griechischen Sprache bis heute lebendigist, in Westeuropa meist nicht als wesentlicher Teil der kulturellen IdentitätEuropas wahrgenommen. Der Titel »Wege nach Byzanz« ist mehrdeutig zuverstehen: Einerseits sind mit den »Wegen« tatsächliche Annäherungen andas Byzantinische Reich und seine Kultur gemeint (z. B. über Pilger- undHandelswege, diplomatische Kontakte, Kreuzzüge), andererseits geistes-und rezeptionsgeschichtliche Zugänge. Breiten Raum nehmen die »Wegeder Forschung« ein. Hier werden die Quellen, methodische Grundlagenund Erkenntnismöglichkeiten über die byzantinische Kultur thematisiert.Das Buch ist als Begleitband und Katalog zur gleichnamigen Ausstellung imLandesmuseum Mainz konzipiert. Die Einträge zu den über 100 Exponatenvermitteln Einblicke in zentrale Aspekte der byzantinischen Kultur jenseitsder geläufigen Klischees.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 92268 S. mit 270 meist farb. Abb.,
21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-172-6 (RGZM)
€ 76,–
Ljudmila Pekarska
Jewellery of Princely KievThe Kiev Hoards in the British Museum and The Metropolitan Museum of Art and Related Material
In the capital of Kievan Rus’, princely Kiev, almost 70 medieval hoards havebeen discovered to date. The hoards contained gold and silver jewellery ofthe ruling dynasty, nobility and the Christian Church. They were unique toKiev and their quantity and magnificence of style cannot be matched by anything found either in any other former city of Rus’, or in Byzantium. Mostof the objects never had been published outside the former Soviet Union.During the 17th-20th centuries, many medieval hoards were gradually un -earthed; some disappeared soon after they were found. This book providesa complete picture of the three largest medieval hoards discovered in Kiev:in 1906, 1842 and 1824, and traces the history and whereabouts of otherlost treasures. Other treasures took pride of place in some of the world’stop museums. This publication highlights the splendid heritage of medievalKievan jewellery. It illustrates not only the high level of art and jewellerycraftsmanship in the capital, but also the extraordinary religious, political,cultural and social development of Kievan Rus’, the largest and most power ful East Slavic state in medieval Europe.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · http://shop.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 106318 S., 168 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-202-0€ 75,–
Neslihan Asutay-Effenberger · Falko Daim (Hrsg.)
ΦΙΛΟΠΑΤΙΟΝSpaziergang im kaiserlichen GartenBeiträge zu Byzanz und seinen Nachbarn
Festschrift für Arne Effenberger zum 70. Geburtstag
Das Philopation war eine zum Vergnügen der Kaiser bestimmte Garten-und Jagdanlage außerhalb Konstantinopels. Ihm entsprach vor den Mauernvon Konya ein ähnlicher Ort mit Namen »Filubad«, an dem die Sultane Zer-streuung suchten. Unter dem Namen Philopation wurde Arne Effenberger,dem ehemaligen Direktor des Museums für Byzantinische Kunst (Bode-Museum), zu seinem 70. Geburtstag eine Festschrift gewidmet. Die hierinenthaltenen Beiträge erzählen von der großen Strahlkraft des oströmischenImperiums und spiegeln zugleich wenigstens einen Teil der lange gehegtenund weitläufigen Forschungsfelder des Jubilars wider, die sich von Byzanzbis Ägypten, von der Spätantike bis zur Neuzeit, von Venedig bis Konyaerstrecken, wobei ihm Konstantinopel/İstanbul stets besonders am Herzenliegt.
Monographien des RGZM, Band 101363 S.
ISBN 978-3-88467-197-9€ 48,–
Stefan Albrecht
Quellen zur Geschichte der byzantinischen Krim Die Erforschung der byzantinischen Krim wurde bisher dadurch erschwert,dass die vielen schriftlichen Quellen weit verstreut und auch aus sprach-lichen Gründen nicht immer gut zugänglich waren. Diese Sammlung solldem abhelfen. Sie umfasst die bekannten wie auch die selten benutztengriechischen, lateinischen und slawischen Quellen aus dem 4.-12. Jahrhun-dert. Die 90 Texte bzw. Textauszüge liegen teils erstmals in deutscher Über-setzung vor. Sie werden durch eine kurze Beschreibung und eine Einord-nung in den Kontext der bisherigen Forschung ergänzt.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · http://shop.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 108110 S. mit 12 Abb.,
61 meist farb. Taf.ISBN 978-3-88467-206-8
€ 42,–
Jan Bemmann · Katharina Schneider · Aleksandr Gercen Sergej Černyš · Magdalena Mączyńska · Agnieszka Urbaniak† Uta von Freeden
Die frühmittelalterlichen Gräberfeldervon Adym-Čokrak, Južnyj I und Južnyj IIam Fuße des MangupDie Gräberfelder gehören zu den sechs bisher bekannt gewordenen spät-antiken bis frühmittelalterlichen Nekropolen rund um den Tafelberg Man-gup in der südwestlichen Bergkrim. Sie wurden z. T. zur gleichen Zeit ge -nutzt und lassen sich zu den Siedlungs- und Befestigungsphasen auf demPlateau in Bezug setzen. Seit Beginn der 1990er Jahre konnten im Rahmenvon Rettungsgrabungen bisher nur Teilflächen der Bestattungsplätze unter-sucht werden, trotzdem sind anhand des geborgenen Fundmaterials ersteAussagen zum Nutzungszeitraum möglich.
Monographien des RGZM, Band 113511 S., 234 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-220-4€ 85,–
Stefan Albrecht · Falko Daim · Michael Herdick (Hrsg.)
Die Höhensiedlungen im Bergland der KrimUmwelt, Kulturaustausch und Transformation am Nordrand des Byzantinischen Reiches
Die Aufsatzsammlung markiert den Abschluss eines internationalen Pio-nierprojektes. Im Fokus stand die Frage, welche Faktoren in der Bergkrimeine regionale Identität entstehen ließen, die über Jahrhunderte hinweg inpolitischen und kirchlichen Strukturen, in einem besonderen kulturellenGedächtnis, in der noch lange verwendeten gotischen Sprache und nichtzuletzt in der materiellen Kultur erkennbar ist. Die Beiträge dokumentierendie ganze Bandbreite des Projektes, das archäologische, historische, kunst -historische, geodätische und anthropologische Untersuchungen um fasste.Sie gewähren Einblick in die Entwicklung einer Region, die den Byzantinernals zwar entlegener, aber doch integraler Bestandteil des Imperiums galt. Inden kolonialen Küstenstädten dieses Gebiets war dagegen die byzantini-sche Kultur Richtschnur und Orientierungspunkt der lokalen sozia len Grup-pen.