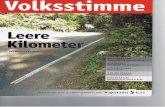Iusiurandum und vadimonium in der lex rivi Hiberiensis
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Iusiurandum und vadimonium in der lex rivi Hiberiensis
U N I V E R S I T À C A T T O L I C A D E L S A C R O C U O R E – M I L A N O I S T I T U T O G I U R I D I C O
A T T I D I C O N V E G N I
LEX RIVI HIBERIENSIS DIRITTO E TECNICA
IN UNA COMUNITÀ DI IRRIGAZIONE DELLA SPAGNA ROMANA
A CURA DI
LAURETTA MAGANZANI CHIARA BUZZACCHI
ESTRATTO
2
J O V E N E E D I T O R E 2 0 1 4
DIRITTI D’AUTORE RISERVATI
© Copyright 2014
ISBN 978-88-243-2312-3
JOVENE EDITORE Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
web site: www.jovene.it e-mail: [email protected]
I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall’art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.
Printed in Italy Stampato in Italia
JOHANNES PLATSCHEK
IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS*
I. iusiurandum, § 12b (III.18-22)
1. Stellung von § 12b im Regelungszusammenhang
In den §§ 8-15 (II.43-III.43) regelt die Satzung unserer Wasserge-meinschaft Details der Rechtsdurchsetzung. Dabei geht es in §§ 8-10(II.43-III.7) zunächst um die “Beitreibung” (persecutio) und die “Pfand-nahme” (pignoris capio) durch “die Dorfvorsteher oder den (damitbeliehenen) Unternehmer” (magistri pagi publicanusve). Die Maßnah-men müssen Forderungen der Wassergemeinschaft gegen ihre Mitglie-der wegen Verstößen gegen die Satzung betreffen. § 10 (III.3-7) regeltden Widerspruch des Vollstreckungsschuldners gegen eine erfolgtePfändung. § 11 (III.8-14) ordnet umgekehrt Bußen gegen die magistripagi wegen unterlassener Verfolgung von Verstößen an. § 13 (III.23-28) verhängt Bußen gegen die magistri pagi wegen originärer eigenerVerstöße gegen ihre satzungsmäßigen Pflichten; die Durchsetzungobliegt wie in § 11 (III.12) wiederum “allen Dorfangehörigen” omni-bus paganis, also dem “quivis ex paganis” (III.26). Wiederum darf sichder erfolgreiche Popularkläger mit der Gemeinschaft die Buße teilen(III.12-14; III.26-28). In §§ 14/15 (III.29-43) folgen Vorschriften, diedas Urteilsverfahren (actio petitio) über jegliche Buße aus der Satzungbetreffen: Geregelt werden Gestellungsversprechen (vadimonium),Richterbestellung, Verfahrensdauer, Klageformel.
* Nachtrag: Erst nach Abschluss des Manuskripts kam CRAWFORD M.H.,BELTRÁN F., The Lex riui Hiberiensis, in JRS 103 (2013), S. 233 zu meiner Kenntnis.Dort werden die Zeilen II.34 und III.18 im hier vertretenen Sinne ergänzt; CrawfordsVorschlag für III.19/20 von 2006 (ca-/[veri sibi ab eo …]) wird (m. E. zu Unrecht)verworfen.
122 JOHANNES PLATSCHEK
In § 12 (III.15-22) sieht die Literatur einen Störfaktor1; die Vor-schrift betrifft in § 12a (III.15-18) (Buß-)Forderungen zwischen Ka-nalnutzern (rivales) sowie in § 12b (III.18-22) das Eidesverfahren alseinen Weg von deren Abwicklung. Dies unterbreche einen engen Zu-sammenhang zwischen § 11 und § 13 (Bußen gegen magistri), wasdafür sprechen könne, dass es sich bei § 12 um einen nach Abschlussder Redaktion eingefügten Textbaustein handelt2. Dabei ist zu beach-ten, dass sich § 11 und § 13 trotz ähnlichen Inhalts durchaus auf ver-schiedenen Ebenen des Regelungszusammenhangs bewegen können.Der Text lässt sich nämlich folgendermaßen gliedern:
§§ 8-13 besondere Verfahrensarten und –vorschriften bei nen
verschiede-Bußforderungen
§§ 8-11 bei Bußforderungen der Gemeinschaft gegen ihre Mitglieder§§ 8-9 pignoris capio§ 10 Widerspruch gegen pignoris capio§ 11 Unterlassen der Verfolgung durch magistri pagi
§ 12 bei Bußforderungen der Mitglieder untereinander§ 13 bei Bußforderungen gegen magistri pagi
§§ 14-15 allgemeines Urteilsverfahren für alle Bußforderungen§ 14 vadimonium, Richterbestellung, Verfahrensdauer§ 15 Prozessformel
§ 11 ist also als Anhang der Verfolgung von Mitgliedern durch dieWassergemeinschaft zu verstehen, während § 13 originär die Verfol-gung der magistri pagi betrifft. Nicht § 12 stört den Zusammenhang;vielmehr wirkt es schwerfällig, dass in § 11 zunächst die besondereBuße der magistri pagi für unterlassene Rechtsverfolgung gegen Mit-glieder und sodann in § 13 die allgemeine Buße der magistri pagi, jeweilssamt Verfahren und in aller Breite Erwähnung finden, ohne dass sichauf der Rechtsfolgenseite Unterschiede ergäben. Die Alternative hättedarin bestanden, die Buße für unterlassene Rechtsverfolgung in § 13 zuerwähnen (“Dies gilt auch, wenn jemand in seinem Amt die Verfolgungvon Verstößen der Mitglieder gegen diese Satzung unterlässt …”; alsoeine Anordnung: § 12 - § 13 - § 11). Man mag dies als eleganter emp-finden; doch wäre dann die Regelung der Verfolgung von Satzungsver-stößen durch die magistri pagi (§§ 8-10) räumlich stärker vom Fall derunterlassenen Verfolgung getrennt. Die Doppelstellung der magistri
1 BELTRÁN F. 2006, S. 183: “anomalous paragraph”; S. 184: “entirely incon-gruous”; NÖRR 2008, S. 111 mit Anm. 12: “handwerkliche[r] M[a]ngel”; ibd. S. 187:“systematisch an falscher Stelle stehend”.
2 NÖRR 2008, S. 159 Anm. 250.
123IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
pagi als Bußenverfolger und Bußpflichtige bereitet bei jedem gewähltenAufbau Schwierigkeiten. Jedenfalls ist § 12 kein Einschub nach Been-digung der Redaktion. Aufgrund des Aufbaus deutet nichts darauf hin,dass die enthaltene Regelung einen “ephemeren Versuch”, eine “(eherwillkürliche) Kombination von juristischem Material” darstellen würde3.
2. Text von § 12b (III.18-22)4
III.18 Si·III.19 [quis (?) ad (?) iusiurandu(?)]m·adigere malu ≥e ≥rit dum·ipse·ca-III.20 [lumniae (?) causa (?)* no]n recuset, ·is cum quo agetur·iura-III.21 [re debeat(?) et si (?) non(?)] i ≥urauerit, ·eandem·poenam·quaeIII.22 [s(upra) (?) s(cripta) (?) est praestare (?) debeat(?)]·.
a) III.18-19: Si [quis ad iusiurandu]m adigere malueritDas Wort adigere “hin-/zutreiben” hat in der Rechtssprache
große Affinität zum Eid – iusiurandum5. In den Digesten begegnet adi-gere ausschließlich in diesem Zusammenhang6. Die Wendung libertumiureiurando adigere “den Freigelassenen dem Eid zutreiben / zum Eidzwingen” scheint im Wortlaut der lex Aelia Sentia enthalten zu sein: D.37.14.6 pr./2/3 (Paul. 2 ad leg. Ael. Sent.); es ist gleichbedeutend mitlibertum ad iurandum adigere “den Freigelassenen zum Schwören trei-ben/zwingen”: D. 37.14.15 pr. (Paul. 8 ad leg. Iul. Pap.); auch in D.2.4.8.2 (Ulp. 5 ad ed.) begegnet ad iusiurandum adigere “zum Eid trei-ben”. Die genannten Stellen zeigen außerdem, dass sich eine Personim Akkusativ, auch wenn sie nicht in der Konstruktion erscheint, stetsals Objekt von adigere hinzudenken lässt.
Das in III.19 vor adigere verbliebene -m zu [ad iusiurandu]m zuergänzen, den wenigen verbleibenden Raum mit dem Subjekt des Sat-zes auszufüllen und auf die Erwähnung einer Person im Akkusativ zuverzichten, hat daher eine hohe Wahrscheinlichkeit für sich. Das Wortmaluerit nach adigere ist gesichert. Es kennzeichnet das ad ius iuran-dum adigere als eine Verfahrensalternative. Es liegt nahe, dass die an-dere Möglichkeit in der Durchführung eines Beweis- und Urteilsver-fahrens besteht.
3 So aber NÖRR 2008, S. 187 f.4 Nach BELTRÁN F. 2006, S. 156.5 ThLL I, s. v. adigo II (col. 678 f.); NÖRR 2008, S. 160 mit Anm. 257.6 HEUMANN, SECKEL 1907, s. v. adigere (S. 14).
124 JOHANNES PLATSCHEK
b) III.19/20: dum ipse ca-[lumnia---no]n recuset(1) Kalumnieneid als Voraussetzung der Eideszuschiebung nach den
juristischen QuellenDie Ergänzung Francisco Beltráns zu ca[lumniae causa no]n r cu
e-set geht auf die Information Ulpians zurück7 , der Zuschiebung
des Eids müsse – bei einem entsprechenden Verlangen des
tender
Aufgefor-– die Leistung des Kalumnieneids vorangehen:
D. 12.2.34.4 (Ulp. 26 ad ed.)Qui iusiurandum defert, prior de calumnia debet iurare, si hoc
exigatur, deinde sic ei iurabitur.
Der zum Eid Aufgeforderte8 kann nach Ulpian darauf bestehen,dass der Auffordernde zunächst seinerseits schwört, nicht aus schi-kanösen Gründen gegen ihn vorzugehen9. Man wird darin einHemmnis erkennen dürfen. Denn ist die Zuschiebung des Eids erst er-folgt, sieht sich der Aufgeforderte in einer misslichen Lage: Leistet erden Eid “se non debere”, so schwört er sich damit zwar frei. EinerKlage seines Gegner wird er jedenfalls die exceptio iuris iurandi entge-genhalten können10.
Doch handelt es sich dabei um eine fragwürdige Befreiung. Denngegen die Behauptung der Schuld hat sich der Schwörende nichtdurch den erbrachten Beweis der Nichtschuld, sondern lediglichdurch seine ungeprüfte, aber beeidete Gegenbehauptung durchge-setzt. Den zugeschobenen Eid zu leisten, entspricht daher nicht gesell-schaftlichen Ussancen. “Einem ernsthaften Mann steht das Schwörenschlecht zu Gesicht”, heißt es bei Quintilian11.
Im Bereich des so genannten iusiurandum necessarium, des “not-wendigen”/“erzwingbaren” Eids, den der Prätor in seinem Edikt sank-tioniert, ist die Alternative zur Leistung des Eides die Bezahlung derSchuld. Sie wird vom Prätor “erzwungen”:
7 BELTRÁN F. 2006, S. 184; s. auch NÖRR 2008, S. 160 mit Anm. 259.8 Die Bezeichnungen “Beklagter” und “Kläger” werden im Folgenden vermie-
den, soweit die Quellen nicht unmittelbar zu ihrer Verwendung zwingen. Der is cumquo agetur unserer Inschrift (III.20) ist nicht zwangsläufig “derjenige, mit dem prozes-siert/gegen den geklagt wird”; agere cum aliquo kann auch Verhandlungen und Ver-fahren außerhalb der Klage bezeichnen, s. nur ThLL s. v. ago B 1 a a (vol. I, col. 1391f.); OLD s. v. ago, Nr. 37 ff. (S. 89 f.).
9 KASER, HACKL 1996, S. 268; 284 f.;10 KASER, HACKL 1996, S. 269 mit Quellen und Literatur in Anm. 24-25.11 Quint., Inst. 9.2.98: Iurare gravi viro parum convenit; s. PLATSCHEK 2013, S.
208 f.
125IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.):Ait praetor: ‘Eum, a quo iusiurandum petetur, solvere aut iurare
cogam’.
Die Literatur weist diese prätorische Sanktion des Eids – nichtohne Annahme von Interpolationen – in ihrem Ursprung dem Verfah-ren der actio certae creditae pecuniae zu12; von dort sei sie auf eine be-grenzte Anzahl anderer Klagen ausgeweitet worden, wohlgemerktauch auf solche, die nicht auf einen bestimmten Geldbetrag, sondernauf ein vom Richter zu schätzendes Interesse, also Schadensersatz, ge-richtet sind13.
Der Prätor verheißt Zwang, das eine oder das andere zu tun: sol-vere aut iurare cogam14. Diese Verheißung kommentiert Ulpian, D. 12.2.34.6 (26 ad ed.), mit den Worten: si non iurat, solvere cogendus erit apraetore. Der prätorische Zwang zum Schwören ist also jedenfalls ein
12 LENEL 1927, S. 235 mit Anm. 5; KASER/HACKL 1996, S. 268 mit Literatur inAnm. 19. In D. 12. 2. 34. 6 (Ulp. 26 ad ed.) emendiert GRADENWITZ 1887, S. 275 (über-nommen von LENEL 1889, S. 568 Anm. 7; LENEL 1927, S. 235; NÖRR 2008, S. 162 mitAnm. 269) zu: ‘Eum, a quo <certum> petetur, solvere aut iurare cogam’. Die Emenda-tion führt zu einer eigenartigen Verheißung des Prätors: Sobald eine condictio certi an-hängig wäre, würde er den Beklagten – ohne weiteres Zutun des Klägers! – zu Eides-leistung oder Bezahlung zwingen. Die Möglichkeit der Durchführung eines Beweis-verfahrens und eines Freispruchs des Beklagten durch Urteil geriete vollends aus demBlick. Nähme man den Prätor unter diesen Umständen beim Wort, wäre seine Ankün-digung geradezu monströs. Nach LENEL 1927, S. 235 f. ist das Ediktszitat “unvollstän-dig, wie schon aus der Stellung inmitten des Kommentars hervorgeht. Das Ediktdürfte vorher noch der Tatsache der Delation Erwähnung getan haben: denn mit denFragen [der Delation] … beschäftigt sich Ulpian eod. 34 pr.-§ 5 …”. Dann aber wäregerade ein Beginn des Zitats mit ‘eum, a quo <certum> petetur’ unverständlich. Dieediktale Regelung zur Eideszuschiebung müsste man dann vielmehr zwischen peteturund solvere vermuten; Ulpian hätte die ediktale Anordnung zum Zweck der Kom-mentierung in Teile zerlegt und neu zusammengefügt. Das Zitat zur Eideszuschiebunghätten die Kompilatoren vor D. 12. 2. 34 pr. gestrichen. Damit häufen sich aber dieZusatzhypothesen. Iusiurandum petere bezeichnet schlicht die “Delation”; warum de-ferre der “allein passende Ausdruck für die Eideszuschiebung” sein sollte (LENEL
1927, S. 235), erschließt sich nicht. Der überlieferte Text ist der Emendation daherüberlegen; sie darf Überlegungen zum Eid nicht zugrundegelegt werden. Ein Zusam-menhang der ediktalen Verheißung mit der condictio certi ergibt sich freilich aus derrekonstruierbaren Stellung im Edikt.
13 Insbesondere ist die prätorische Sanktion des Eids für die actio de pecuniaconstituta belegt; PLATSCHEK 2013, S. 21; NÖRR 2008, S. 162 Anm. 266.
14 S. oben Anm. 12 S. zum Zusammenspiel von Kalumnieneid, Eideszuschie-bung, Eideszurückschiebung und Eidesverweigerung noch C. 4.1.9 (Impp. Diocl. Ma-xim. AA. Marciano): Delata condicione iurisiurandi reus (si non per actorem, quominusde calumnia iuret, steterit) per iudicem solvere vel iurare, nisi referat iusiurandum, ne-cesse habet.
126 JOHANNES PLATSCHEK
indirekter: Es droht der Zahlungszwang. Hinter dem Zwang zur Zah-lung vermutet man wiederum die Androhung der sofortigen Voll-streckungdurch den Prätor, der Genehmigung der Vermögensbe-schlagnahme (missio in possessionem), die das prätorische Edikt regeltund die der Prätor aufgrund seiner Amtsgewalt verhängen kann15. Willder Beklagte nicht schwören, so befriedigt er den Kläger entwederfreiwillig durch Zahlung. Oder dem Kläger wird vom Prätor gestattet,sich Befriedigung im Wege der Vollstreckung zu verschaffen. Ersteresist zweifellos ehrenhafter.
Auch wenn die Bezeichnung iusiurandum in iure den Quellenfremd ist16, setzt der geschilderte Zwang doch voraus, dass das Eides-verfahren in diesen Fällen vor dem Prätor in iure durchgeführt wird.Darauf deutet auch die Zeitstufe hin: a quo iusiurandum petetur. Esgeht nicht um Fälle, in denen dem Prätor vorgetragen wird, ein Eides-verlangen sei erfolgt (petitum erit), sondern um die unmittelbaren Fol-gen eines Eidesverlangens: petetur bezeichnet dieselbe (zukünftige)Gegenwart wie cogam, mithin eine Situation vor dem Prätor17.
Zu unterstreichen ist, dass sich der prätorische “Zwang” nichtaus dem Gesetz ergibt, sondern aus einer bewährten und ediktal ver-festigten Handhabung einer Situation in iure bei bestimmten Klagen.Bei der Beeidung anderer Ansprüche und/oder außerhalb des Verfah-rens in iure gilt der prätorische Zwang nicht.
Neben den belegten ediktalen Alternativen solvere und iurare fin-det sich eine dritte Möglichkeit der Reaktion auf das Eidesverlangen18:der Aufgeforderte kann den Eid “zurückschieben” (referre)19. Nach D.13.5.25.1 (Pap. 8 quaest.) ist es modestius – “zurückhaltender”, den
15 LENEL 1927, S. 236; KASER,HACKL 1996, S. 269; WOLF 2009, S. 1460 mit Anm.9/10.
16 KASER,HACKL 1996, S. 268.17 Dagegen WOLF 2009, S. 1460 mit Anm. 10: “am Eidverfahren selbst war [der
Prätor] nicht beteiligt”. Gegen ein Verfahren in iure spreche “etwa auch D. 12.2.23”,wo ein Sklave schwört (der zweifellos nicht als Partei in iure stehen kann); die Stellesteht im Kommentar Ulpians (26 ad ed.) wohlgemerkt vor dem Zitat des prätorischenEideszwangs in D. 12.2.34. 6. Solvere aut iurare cogam setzt voraus, dass der Beklagtein iure (noch) Gelegenheit zum Eid hat.
18 NÖRR 2008, S. 162 Anm. 269. Nach LENEL 1927, S. 236 war “ohne Zweifel inForm einer Bedingung des auszuübenden Zwangs… auch der facultas referendi ge-dacht”; ich sehe dafür keinen Anhaltspunkt. S. außerdem sogleich Anm.19.
19 D. 12.2.34.7 (Ulp. 26 ad ed.). Leistet der Kläger den zurückgeschobenen Eidnicht, verweigert ihm der Prätor die Klage: iudicium ei praetor non dabit. Ulpian lobtdazu nicht das Edikt, sondern die prätorische Praxis: aequissime enim hoc facit (nicht:edixit o. Ä.).
127IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
Eid zurückzuschieben als ihn zu leisten. Wer den Eid zurückschiebt,zeige verecundia – “Ehrfurcht”, “Skrupel”20. Dann aber hat der Geg-ner Gelegenheit, das Bestehen seiner Forderung zu beschwören. Lei-det er unter denselben Skrupeln wie der Zurückschiebende, wird erauf die Eidesleistung verzichten und seiner Klage verlustig gehen (de-negatio actionis / exceptio)21. Leistet er den zurückgeschobenen Eid,muss dies dieselben Folgen haben wie die Verweigerung des zuge-schobenen Eids, im Geltungsbereich der prätorischen Verheißung“solvere aut iurare cogam” also den prätorischen Zahlungszwang22.
Der Herausforderer kann somit den Eidesmechanismus und dieSkrupel des zum Eid Aufgeforderten ausnutzen, um sich in eine bes-sere Position zu bringen. Der Kalumnieneid des Auffordernden vorIngangsetzung des Mechanismus wirkt dem entgegen. Jedenfalls vomZurückschieben des Eids und seinen Folgen ist in der lrH keine Rede;doch gilt dies, wie gesagt, offenbar auch für das prätorische Edikt.
Einer Projektion des Eidesverfahrens beim iusiurandum necessa-rium, wie es uns aus den juristischen Quellen bekannt ist, in das Rechtunserer Wassergemeinschaft, steht insofern nichts entgegen. Doch istzu betonen, dass die Satzung in § 12 keinen ausdrücklichen Bezug zurVerhandlung in iure herstellt. Dass die Tatbestände des § 12 (nur) iniure betätigt werden können, kann nicht ohne Weiteres unterstellt wer-den23; in diesem Fall wäre ein Verweis auf den ediktalen Eideszwangzu erwarten. Schließlich findet auch das in §§ 8-9 geregelte Verfahrender pignoris capio außerhalb des ius statt. Durch die Satzung kann eingesetzliches Eidesverfahren geschaffen werden, dass sich strukturellmit den bekannten ediktalen Regeln decken, aber auch davon abwei-chen kann.
(2) Ergänzung der Lücke mit dem KalumnieneidDie konkrete Ergänzung der Lücke bedarf der kritischen Über-
prüfung. Der von Francisco Beltrán rekonstruierte lateinische Textdum ipse calumniae causa non recuset bedeutet unbefangen übersetzt:“wenn er selbst nicht aus Gründen der Schikane zurückweist”. Dasscalumniae causa aber nicht als Adverb zu non recuset, sondern in ver-neinter Form zum Verhalten des Bußberechtigten (agere/postulare o.
20 Zur Stelle BABUSIAUX 2011, S. 219; PLATSCHEK 2013, S. 200 ff.21 S. oben Anm.19; LENEL 1927, S. 150; KASER, HACKL 1996, S. 269 mit Anm. 26.22 KASER, HACKL 1996, S. 269.23 So aber NÖRR 2008, S. 161; 163: “Der Bezug auf das Verfahren in iure ergibt
sich aus dem Kontext”.
128 JOHANNES PLATSCHEK
Ä.) gehört, müsste sich der Leser erst erschließen. Er müsste den Textgedanklich folgendermaßen ergänzen:
…dum ipse (scil. iurare/iusiurandum) calumniae causa (scil.se non facere/agere/petere/postulare o. Ä.) non recuset…
“…während er selbst sich nicht weigert (den Eid zu leisten,nicht) aus Schikane (zu handeln/klagen/fordern o. Ä.)…”
Dabei müssen entscheidende Elemente hinzugedacht werden, umden Text allein sprachlich schlüssig und eindeutig zu machen. DieSprache wäre eigenartig defektiv: anstatt auf die adverbiale Wendung(calumniae causa) zu verzichten, hätte man das Verb (non facere/agereo. Ä.) und die übergeordnete Wendung (iurare/iusiurandum) unter-schlagen. Soweit die adverbiale Wendung calumniae causa in denQuellen erscheint, ist das jeweilige Verhalten, das (nicht) calumniaecausa erfolgt, stets explizit genannt; aus dem Bereich normativer Texteseien erwähnt24:
Lex (Acilia?) repet. – CIL I. 22, n. 583 (= FIRA I,n. 7), v. 19: sideiuraverit calumniae causa non po[stulare]
Tab. Heracl. – CIL I. 22, n. 593 (= FIRA I, n. 13), v. 119 s.:quemve / k(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecissevequod iudicatum est erit.
Lex Rubria de Gallia cisalp.– CIL I. 22, n. 592 (= FIRA I, n. 19),cap. XX, v. 9: idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit:
Entsprechend wird die lex collegii aquae – CIL VI, n. 10298(=FIRA III, n. 32), v. 18/19 ergänzt25:
simulque iuranto / [se non calumniae causa fecisse facturumveesse]
Die Ergänzung Francisco Beltráns ist daher lich.
unwahrschein-Identifiziert man ca-[---] mit einer Form von calumnia, so
kommt für die Lücke allenfalls folgende Ergänzung in Frage:
24 Quellen und Literatur bei GIOMARO 2007, S. 493 f.25 BRUNS, MOMMSEN, GRADENWITZ 1909, S. 395; s. schon MOMMSEN 1850, S. 351
f.; HUSCHKE 1874, S. 533: iuranto [kalumniae causa non agere neque kalumniae causainfitias ire].
129IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
dum ipse ca-[lumniam se iurare no]n recuset
“Solange er selbst sich nicht weigert, den Kalumnieneid zu leisten”.
Da calumnia hier nicht in eine adverbiale Wendung integriert ist,ist eine Erwähnung des konkreten Verhaltens (facere/agere o. Ä.) inso-fern nicht erforderlich. Die calumnia als Objekt des “(Ab-)Schwörens”steht – im Zusammenhang eines Verfahrens – ohne Weiteres für dieschikanöse Verfahrenseinleitung. So sprechen die Juristen vom iusiu-randum de calumnia, von de calumnia iurare, pro calumnia iurare26.Dass der Eid eine Verneinung der calumnia beinhaltet, geht aus diesenAusdrücken nicht mehr unmittelbar hervor, wird aber aufgrund ihrerTechnizität subintellegiert27. Das ermöglicht den Ausdruck calumniamiurare28:
Cael., Cic. fam. 8.8.3: nam de divinatione Appius, cum ca-lumniam iurasset, contendere ausus non est.
Liv. 33.47.4: velut accusatores calumniam in eum iurarent acnomen deferrent.
Sen., contr. 2.1.34: in quem Syriacus Vallius, homo disertus,[ad] calumniam iuraverat.
Sen., contr. 7.4.7: si quam iniuriam Cato Pollioni Asinio ac-cusatori suo fecisset, se in eum iuraturum calumniam.
Ascon., Corn. 64 CLARK: in Curionem calumniam iuravit29.
Die prägnante Ausdrucksweise bezeichnet der Thesaurus LinguaeLatinae aufgrund dieser Belege als “sermo forensis”30. Die Sprache un-serer Satzung ist wohlgemerkt nicht “Gerichts-”, sondern Gesetzes-sprache, der jede Form von technischem Jargon fremd sein sollte. Inden weiter oben zitierten Gesetzesbelegen begegnet der Kalumnieneid
26 Etwa D. 2.8.8.5 (Paul. 14 ad ed.); D. 12.2.16 (Ulp. 10 ad ed.); D. 12.2.34. 4/7(Ulp. 26 ad ed.); D. 22.3.25.3 (Paul. 3 quaest.).
27 ThLL s. v. iuro cap. pr. II A 1 a a (vol. VII, 1/1, S. 672 vv. 31 f.): “calumniamsc. vitandam (in serm. forensi …)”.
28 ThLL s. v. calumnia I A (vol. III, S. 186 vv. 46 ff.).29 Unzutreffend die Übersetzung von LEWIS 2006, S. 129: “when he brought
false charges against Curio under oath” (entspräche Curionem iurato calumniae causaaccusavit o. Ä.).
30 S. oben Anm. 27.
130 JOHANNES PLATSCHEK
stets in einer “Langform”; calumniam iurare ist inschriftlich nicht be-legt.
(3) Cavere / cautio des Beklagten zur Abwendung der Eideszuschie-bung?
Die Ergänzung Crawfords: dum ipse ca/[veri sibi ab eo no]n recu-set bleibt – bei dieser Ausgangslage unvermeidbar – spekulativ. Allzuviele andere Wörter mit ca- kommen freilich nicht in Betracht (allenfallsnoch Formen von casus und capere31). Die Ergänzung führt zu einemansprechenden Modell: Der Anspruchsgegner hätte die Möglichkeit,durch cavere/cautio, also ein Versprechen in Stipulationsform zugun-sten des Bußprätendenten, die Zuschiebung des Eids abzuwenden; derBußprätendent könnte den Eid nur fordern, “solange er selbst nichtverweigert, dass ihm von diesem ein Schuldversprechen geleistet wird”.Wäre damit das Versprechen gemeint, den geforderte Geldbetrag zubezahlen, so läge die Regelung nahe beim prätorischen solvere autiurare cogam. Das Hemmnis des Kalumnieneids würde im Text ebensofehlen wie die Möglichkeit des Zurückschiebens. Wir müssen davonausgehen, dass beides auch im prätorischen Edikt nicht genannt ist32.
Im Verfahren vor dem Prätor entspräche es nicht der Effizienzund Prozessökonomie, könnte der Beklagte die Eidesleistung durchAbgabe einer cautio abwenden. Denn aus der cautio erwüchse demKläger nur eine weitere Klage (mit der Abgabe der cautio als einzigemBeweisthema). Warum sollten die Parteien zur Einsetzung dieser Klagenochmals in iure verhandeln? Warum sollte erst noch ein Richter überdas Vorliegen einer cautio Beweis erheben müssen, die doch vor demPrätor abgegeben wurde? Dass der Prätor zur Abwendung der Eides-pflicht daher nur sofortige Zahlung anerkennt, erscheint folgerichtig:solvere aut iurare cogam.
Der Eid der lrH kennt hingegen keine Beschränkung auf das Ver-fahren in iure. Prätorischen Zwang kann die Satzung außergerichtlichnicht generieren. Dass sich solvere aut iurare hier zu cavere aut iurareverschiebt, wäre konsequent. Die Funktionsweise wird jedoch erstganz verständlich, wenn die Folgen der Eidesverweigerung in denBlick genommen werden.
31 Gegen causa und cautio spricht tendenziell das Zeilenende ca-, da die Inschriftansonsten eine exakte Silbentrennung einhält. Für Formen von casus oder capere sind– mir, derzeit – inhaltlich keine Anknüpfungspunkte erkennbar.
32 Zum referre s. oben Anm. 18/19; auch zu prior de calumnia debet iurare, D.12.2.34.4 (Ulp. 26 ad ed.), s. oben bei Anm.7, zitiert Ulpian nicht das Edikt.
131IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
c) III.21/22: Folgen der EidesverweigerungSchwört der Aufgeforderte den zugeschobenen Eid nicht: [et si
non] iuraverit, so kommt eadem poena quae [s(upra) s(cripta) est---] –“dieselbe Buße, die oben genannt ist” ins Spiel. Insoweit haben die Er-gänzungen aufgrund ihrer Einfachheit und einer Parallele in der In-schrift33 die Wahrscheinlichkeit für sich. Auf der Suche nach der“oben genannten poena” stößt man auf die Nennung eines Betrags inDenaren unmittelbar vor der Regelung des Eidesverfahrens:
III.17 ·ei·cuius·aqua·fuerit, (denarios)III.18 [---]s i ≥ntererit·praestare·debeat.
Francisco Beltrán ergänzt III.18 zu (denarios)/[--- tum quotien]s in-tererit praestare debeat: Es gehe dort um eine feste Buße, die “jedesmal”bezahlt werden müsse, wenn das “Dazwischentreten” (interesse) einesAnrainers zur Unterbrechung des Wasserzuflusses eines anderenführten: “he should be obliged to pay [---] denarii to the person whosewater it is [for each time] that he blocks it”34. Daran verwundert be-reits, dass die Dauer der Unterbrechung nicht ausdrücklich zum Kri-terium erhoben wird. Für eine tage- und wochenlange Unterbrechung,die die Ernte gefährdet oder vernichtet, wäre eine Buße von wenigenDenaren (mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich 25 Denare;dazu sogleich) nicht angemessen. Impliziert [quotien]s – “each time”jeweils einen Tag der Unterbrechung?
Im Zusammenhang mit praestare debeat ist eine rechtstechnischeVerwendung von intererit zur Bezeichnung des Haftungsinhalts wahr-scheinlicher. Gemeint ist dann das Interesse, der Schaden des Berech-tigten: [--- quantum eiu]s intererit. Auch in II.34 muss diese Wendungergänzt werden: quantum eius in[tererit / -tersit o. Ä.]35. Man verglei-che außerdem etwa:
D. 19.1.13.1 (Ulp. 32 ad ed.)… praestare debebit, quanti emptoris interfuit non decipi
D. 21.2.8 (Iul. 15 dig.)Venditor hominis emptori praestare debet, quanti eius inte-
rest hominem emptoris fuisse.33 I. 20/21: [ean-]/dem poenam quae s(upra) s(cripta) est.34 Kritisch schon NÖRR 2008, S. 160: “m. E. wenig plausibel”. Intererit kann in
dieser Form übrigens nicht von interire kommen (interierit!).35 S. schon NÖRR 2008, S. 160 Anm. 255; zur Lesung in[---] s. aber auch BELTRÁN
F. 2006, S. 155 in app.: “TA++ cannot be completely discounted”.
132 JOHANNES PLATSCHEK
D. 17.1.27.2 (Gai. 9 ad ed. prov.)… quanti mandatoris intersit tenebitur …
D. 2.11.14 (Ner. 2 membr.)… ut quantum domini litis interfuit sisti, tantum ex ea stipu-
latione … debeatur.
In III.18 muss das Interesse des Geschädigten mit der in III.17vorangehenden Angabe (denarios) vereinbart werden. Denkbar ist,dass zunächst eine feste Buße genannt wird, anschließend als Alterna-tive voller konkreter Schadensersatz; dass der Schädiger dem Berech-tigten also haftet auf
(denarios) [--- quantumve/ vel quantum eiu]s intererit·praestare·debeat36.
Auch in II.33/34 geht der Wendung quantum eius in[tererit o. Ä.]und einer größeren Lücke (die mit dem Begünstigten der Buße, einemInfinitiv und einer Konjunktion aufgefüllt werden kann) ein fixer Be-trag in Denaren als Gegenstand der Schuld voraus:
II.33 *obl ≥i ≥g ≥auerit (denarios) XXV[---vel (?)]II.34 quantum eius in[tererit o. Ä.]
Eine Buße von 25 Denaren taucht in I.14, II.48 und III.24 auf. InII.17 dürfte die Zahl also nach XXV enden. Mangels anderer Anhalts-punkte gebietet die Wahrscheinlichkeit, einen Gleichlauf von II.33/34und III.17/18 zu vermuten und ein Modell “25 Denare oder vollerSchadensersatz” zugrundezulegen.
Dies wäre auch eadem poena, die bei der Verweigerung der Ei-desleistung nach III.21/22 ins Spiel kommt. Die Bezeichnung poenafür ein Alternativgebilde “feste Buße oder Interesse” ist jedenfallsdenkbar37.
Die Ergänzung zu eandem poenam [--- praestare debeat] über-nimmt Terminologie und Verbalform aus III.18; die Bezugnahme aufeandem poenam spricht für die Übernahme auch des Prädikats ausdem Zusammenhang der poena. Es entsteht eine Parallele zu:
36 S. schon bei NÖRR 2008, S. 159; BELTRÁN F. 2010, S. 33: “verosímil, aunque nosegura”.
37 S. schon bei NÖRR 2008, S. 163 mit Anm. 272.
133IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
I. 14 … (denarios) XXVI. 15 d(are) d(ebeto). ……I. 20/21 [ean-]/dem·poenam·quae·s(upra)·s(cripta)·est praestare·debeat.
Der mögliche Gleichlauf spricht für eine entsprechende Ergän-zung von III.21/22: Folge der Eidesverweigerung ist die Verhängungder Buße, also die Begründung einer (weiteren) Schuld. Die “These ei-ner sofortigen Vollstreckung” aus der Literatur zum prätorischenZwangseid findet in unserem Text in der Tat “keinen Anhaltspunkt”38.Der Grund ist schon darin zu vermuten, dass unser Text kein iusiu-randum in iure beschreibt.
Blicken wir nun auf die mögliche Abwendungsbefugnis des zumEid Aufgeforderten durch cavere (nach der Ergänzung Crawfords), sozeigt sich, dass die Folgen der Nichtleistung des Eids mit den Folgenseiner Abwendung im Ergebnis übereinstimmen: Will sich der Aufge-forderte nicht freischwören, so leistet er entweder die cautio mit demInhalt, das Geforderte (also die poena) zu zahlen; aus der cautio ent-steht dem Gläubiger eine Klage auf die poena (actio certae creditae pe-cuniae bzw. actio ex stipulatu); zu beweisen ist in diesem Prozess dasVersprechen der cautio und gegebenenfalls der konkrete Schaden.Oder der Schuldner bleibt auf das Eidesverlangen hin untätig, unddem Gläubiger erwächst aufgrund der Satzung eine Forderung samtKlage (condictio ex lege, III.39-43) auf eadem poena; zu beweisen istdann die Eidesverweigerung und gegebenenfalls der konkrete Scha-den. Dabei ist das Versprechen der cautio zweifellos ehrenhafter, ihreVerweigerung zwecklos.
Während vor dem Prätor aufgrund von dessen Machtvollkom-menheit solvere aut iurare durch die drohende Vollstreckung erzwun-gen werden, verbaut die lrH durch die Anordnung von eadem poenadem Bußpflichtigen die Flucht aus den Alternativen cavere aut iurare.Damit ist Parallelität auf zwei Ebenen der Rechtssetzung bzw. -durch-setzung gewonnen. Ob in der lrH die prätorische Struktur in die Mög-lichkeiten der Satzungsgebung übernommen wird39 oder sich umge-kehrt hinter der prätorischen Regelung eine Rezeption aus (uns bislangnicht erschlossenem, der lrH entsprechendem) ius civile verbirgt, muss
38 NÖRR 2008, S. 186.39 Vgl. nochmals NÖRR 2008, S. 187 f.: “Kombination von juristischem Material,
das [der Redaktor der lrH] in dem reichen Fundus römischer Rechtsfiguren fand”; s.aber schon o. bei Anm. 3.
134 JOHANNES PLATSCHEK
hier offenbleiben. Denkbar wäre etwa, dass dem prätorischen Zwangs-eid in seinem Ursprung einer des ius civile zugrundelag: Außergericht-lich war der Eid aufgrund einer der lrH entsprechenden Regelung(insbesondere im Bereich des Geldkredits) durch cavere abwendbarund seine Nichtleistung durch gesetzlich angeordnete Schuld oderKlage sanktioniert. Wurde der Eid in iure verlangt, modifizierte derPrätor dies aus Gründen der Effizienz: Abwendung nur durch solvere;Einleitung der Vollstreckung als Sanktion der Nichtleistung40.
Die lrH gibt also durchaus Anlass, “die gängigen Meinungen zumsog. iusiurandum in iure zu überprüfen”41; aber sie ist auch Ausgangs-punkt für die Erforschung von außergerichtlichem gesetzlichem Eides-zwang.
Die Ergänzung Crawfords führt zu einem schlüssigen Modell; esdürfte sich um die wahrscheinlichere (und damit vorerst um die wahr-scheinlichste) Lösung handeln.
II. vadimonium, § 14 (III.29-34)
Nach der editio princeps lautet der Text42:
III.29 [Si (?) quis (?) ab (?) aliquo (?) p]oenam·ex hac lege petet,·is·a quopoe-
III.30 [na petita (?) fuerit (?)43] uadimonium·ad eum·qui·proxumaeIII.31 [iurisdictio]n ≥i ≥ (?)·municipi·aut·coloniae praeeritIII.32 [promittat (?) ---pr]o ≥x ≥u ≥mae (?) rationis h ≥abita ex edicto·Mi-III.33 [nici / -nuci* (?) ---]a ≥n ≥i ≥ (?) l ≥e ≥g(ati) Aug(usti)·c ≥l ≥ar ≥i ≥ssimi ≥uiri ut ≥ inIII.34 [---*]+++* p ≥r ≥o ≥m≥i ≥t ≥t ≥i ≥·oportebit·iudicem
40 Nach BEHRENDS 1974, S. 98 Anm. 364 ist “das im Bereich der condictio gel-tende Zwangseidrecht (s. Lenel, Ed. perp. S. 232 ff. [also der ediktal verheißene präto-rische Eideszwang?]) … mit großer Wahrscheinlichkeit von den Kondiktionengeset-zen [gemeint sind die lex Silia und die lex Calpurnia, die Behrends in die zweite Hälftedes 3. Jh. v. Chr. datiert] eingeführt worden”. Dass das Edikt “solvere aut iurare co-gam” (unmittelbar) durch Gesetz eingeführt wurde, lässt sich wohl ausschließen; s.schon KASER 1949, S. 284 Anm. 1 mit Literatur.
41 NÖRR 2008, S. 186.42 Nach BELTRÁN F. 2006, S. 157.43 [na petita (?) fuerit(?)] ist nicht vertretbar; grammatikalisch möglich sind
poena petita erit, poena petetur und poenam petet, wobei petetur von Genus undZeitstufe her passender, für die Lücke allein aber zu kurz erscheint; freilich kommenauch Trennpunkte in Betracht (poena·petetur·vadimonium). Noch mehr Platz ließe is aquo poe-/[nam petet ---]; dann hätte jedenfalls ein weiteres Wort in der Lücke Platz (s.unten Anm. 60). Denkbar ist angesichts des Wechsels von petitio persecutiov[e] inIII.25 zu persecutor in III.26 aber auch is a quo poe-/[na persequetur].
135IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
III.35 [---* inter] quos·controuersia·erit·extra ordi-III.36 [nem ---*] qua ≥* secundum l ≥e ≥g ≥em·intra dies quin-III.37 [que proxumas quibus (?)] d ≥a ≥t ≥u ≥s ≥erit p ≥ronuntiet.
Wird aufgrund der Satzung eine Buße im Urteilsverfahren ver-folgt, so ist ein vadimonium des angehenden Beklagten zu einer be-stimmten Person erforderlich, die mit dem/einem municipium oderder/einer colonia in Verbindung gebracht wird. Das vadimonium als(regelmäßig strafbewehrtes) Gestellungsversprechen auf einen be-stimmten Ort (bzw. ein bestimmtes Gericht, bzw. einen bestimmtenJurisdiktionsbeamten) und einen nach Tag und Stunde bestimmtenTermin ist uns aus literarischen und dokumentarischen Quellen be-kannt44. Die lrH fügt sich dabei am ehesten in die Vorstellung eines sogenannten “Ladungsvadimoniums” ein: Gestellungsort ist der Ort desangestrebten Gerichtsverfahrens, ohne dass dem Gestellungsverspre-chen bereits eine Verhandlung vor einem Rechtsprechungsbeamtenvorausginge. Das vadimonium soll die erstmalige Prozesseinleitung inGegenwart des Beklagten ermöglichen.
1. III.30/31: ad eum qui proxumae [---]ni municipi aut coloniaepraeerit
Nach der Ergänzung[iurisdictio]ni muss der Beklagte verspre-chen, vor dem Beamten zu erscheinen, der “der nächsten Gerichtsbar-keit eines/des municipium oder einer/der colonia vorsteht”. Mit (dem)municipium könnte Cascantum gemeint sein, mit (der) colonia Caesar-augusta (Zaragoza)45. Versteht man dann proxuma iurisdictio im räum-lichen Sinne46, so fällt die Tatsache auf, dass “the town of Cascantumwas obviously much nearer the pagani territories than the distant Cae-saraugusta”47. Dass Randgebiete näher bei Caesaraugusta liegen, wirdman aber nicht ausschließen können, auch wenn “die Gerichtsbarkeitder colonia seltener zum Zuge [käme] als die des municipium”48. Nörrzieht in Betracht, dass der Beamte gemeint ist, in dessen Territoriumder “Tatort” des verwirklichten Bußtatbestands liegt49. Dass dafür die
44 S. jetzt nur DONADIO 2011, S. 1-17 mit Literatur.45 BELTRÁN F. 2006, S. 185; NÖRR 2008, S. 127 f.46 In räumlicher Bedeutung erscheint proxumus in I. 30/31: ad proxuma[m]/mo-
lem; I. 48/49: ad termi-/num proxumae villae Valeri Aviani.47 S. BELTRÁN F. 2006, S. 185 und die Karte S. 150.48 NÖRR 2008, S. 128.49 NÖRR 2008, S. 128.
136 JOHANNES PLATSCHEK
Bezeichnung proxuma iurisdictio gewählt würde, erscheint fraglich. Zuerwarten wäre eine Formulierung wie in III.5: qui eo loco iuri dicundopraeerit, quo contra legem factum esse dicitur … Mangels anderer An-haltspunkte wäre die iurisdictio gemeint, die dem Ort des Abschlussesdes vadimonium (in Gegenwart beider Parteien) am nächsten liegt.Dabei ist zu beachten, dass die Initiative beim Bußberechtigten liegt;um dem Verpflichteten ein vadimonium abzunehmen, wird er ihn regel-mäßig aufsuchen (lassen). Dann wird Ausgangspunkt der Bemessungder “nächstgelegenen iurisdictio” häufig der Sitz des Beklagten sein.Auch bei überwiegender Nähe von Cascantum und geringen Di-stanzunterschieden auch im Randbereich ließe sich die Regelung dochauf größtmögliche Beschleunigung des Verfahrens zurückführen.Wenn bereits in einer Vorlage der lrH zum Zweck der Beschleunigungohne Rücksicht auf konkrete geographische Gegebenheiten von muni-cipi aut coloniae die Rede war (also von “einem municipium oder einercolonia” – “a generic reference”)50, so mag dies am Ebro-Kanal aufbesonders ungleiche Verhältnisse treffen.
Die Verfahrensbeschleunigung kommt auch im Folgenden zumAusdruck: der Richter muss nach III.36/37 intra dies quin[que ---] –“innerhalb von fünf Tagen [(wahrscheinlich:) nach seiner Bestellungdurch den Beamten]” das Urteil sprechen. Die Worte extra ordi-/[---]51
in III.35/36 lassen sich außerdem so verstehen, dass der Rechtspre-chungsbeamte den Fall “außer der Reihe” zur Verhandlung annehmenmuss52, auch könnte der Verzicht auf bestimmte Fristen, auf besondereAnforderungen an den einzusetzenden Richter53 o. Ä. gemeint sein; alldies hätte ebenfalls beschleunigenden Effekt54.
Die Ergänzung zu [iurisdictio]ni und das räumliche Verständnisvon proxumae sind jedoch nicht zwingend. Für die Lücke in III.31erscheint [iurisdictio]ni eher als zu kurz55. Sicher ist ein Substantiv im
50 BELTRÁN F. 2006, S. 162.51 S. unten vor Anm.77.52 S. auch unten Anm.77.53 NÖRR 2008, S. 133; BELTRÁN F. 2010, S. 33.54 S. schon BELTRÁN F. 2006, S. 186; NÖRR 2008, S. 131 ff. mit Quellen und Li-
teratur.55 Iurisdictioni praeesse ist inschriftlich anderweitig nicht belegt (stets iuri di-
cundo praeesse); s. nur die Belege bei NÖRR 2008, S. 127 Anm. 92. Angesichts vonIII.5: qui eo loco iuri dicundo praeerit wäre insofern zu erwarten: qui in proxumo mu-nicipio aut colonia iuri dicundo praeerit. In D. 2.2.1.2 (Ulp. 3 ad ed.) erscheint ‘qui iu-risdictioni praeest’ allerdings als (freies?) Ediktszitat Ulpians; s. LENEL 1927, S. 59Anm. 2; RODGER 2001, S. 136; in D. 2.1.10 (Ulp. 3 ad ed.), D. 3.1.1.2 (Ulp. 6 ad ed.)
137IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
Dativ zu ergänzen (das erfordert praeerit); mit einiger Wahrscheinlich-keit ein Femininum (vgl. proxumae); also ein Substantiv auf ---io, -ionisoder ---nis, -is. Dabei ist III.32 zu berücksichtigen:
2. III.32: ---rationis habita
Den lückenhaften Text von III.32 liest und ergänzt Francisco Bel-trán folgendermaßen: [promittat ---pr]oxumae rationis habita ex edictoMi-. Er vermutet hierin eine Regelung der summa vadimonii, also derversprochenen Strafe für den Fall des Nichterscheinens56. Mit der Le-sung [pr]oxumae rationis habita scheint dies nicht vereinbar; außerdembleibt zwischen [promittat] und [pr]oxumae nur noch wenig Platz fürein weiteres Wort. Ein solches ist im Hinblick auf das folgende habitaerforderlich. Habita ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Abl. Sing.Summa/poena stipulationis habita ex edicto … – “unter Aufnahme/Einsetzung einer Stipulationsstrafe gemäß dem Edikt …” wäre sprach-lich denkbar. Die Inschrift liest aber recht eindeutig rationis. Ohnewirkliche Parallele wäre [---poena te]merationis – “Strafe für die Ver-letzung/Übertretung (des Gestellungsversprechens)”57 (zur Lesung ---merationis s. sogleich).
Mit promittat führt Francisco Beltrán ein notwendiges Prädikatzum Subjekt is (III.29), zum Objekt vadimonium (III.30) und zum ad-verbialen Ausdruck ad eum … (III.30/31) ein. Promittere hat starkeAffinität zu vadimonium58. Daneben kommt ein insoweit gleichbedeu-tendes vadimonium facere bzw. faciat in Betracht59. In der Lücke vonIII.32 wäre ein Prädikat entbehrlich, wenn es bereits in der Lücke vonIII.30 hinter petetur stünde: is a quo poe-/[na/-m petet/-ur, faciat] vadi-monium…60
und D. 5.1.81 (Ulp. 5 opin.) ist qui iurisdictioni praeest Sprache Ulpians; in D. 1.3.12(Iul. 15 dig.) Sprache Julians; in D. 2.5.2 pr. (Paul. 1 ad ed.) Sprache des Paulus. Iuridicundo praeesse begegnet in den überlieferten Juristenschriften nur bei Pomponiusund Scaevola: D. 1.2.2.13 (Pomp. sing. enchir.), D. 39.3.26 (Scaev. 4 resp.).
56 BELTRÁN F. 2006, S. 185; id. 2010, S. 32; NÖRR 2008, S. 129 will lediglich den“einschlägigen Ediktstitel auf das vadimonium promitti oportere” beziehen.
57 S. lediglich C. 11.8.2 = CTh. 1.32.1 (Imp. Constantinus A. ad Felicem); keinEintrag in OLD.
58 ThLL s. v. promitto cap. sec. I A 1 a b (vol. X. 2. 2, col. 1865, vv. 33-46);BEIKIRCHER 2001, S. 379 f.
59 ThLL loc. cit.60 Bei [nam petet faciat] stünde in der Lücke nicht mehr als bei der von Beltrán
vorgeschlagenen (sicher unzutreffenden, s. oben Anm.43) Ergänzung [na petita fuerit].
138 JOHANNES PLATSCHEK
a) [di-/nu]merationis: Bezugnahme auf die ediktale Fristberech-nung?
Die publizierte Abbildung der fraglichen Passage scheint mir vorrationis auch die Lesung -me- zu gestatten61, was eine Ergänzung zu [---nu]merationis oder [---dinu]merationis ermöglichen würde. Dinumera-tio bzw. dinumerare “abzählen”/“zahlenmäßig aufteilen” begegnet injuristischen Quellen mehrfach im Zusammenhang mit der Berechnungdes Termins für ein Gestellungsversprechen bei Zugrundelegung derWegstrecke zum Gestellungsort. Der Prätor sieht im Edikt vor, dassfür jeweils 20 Meilen ein Tag Reisezeit veranschlagt wird62. Am Ebro-kanal fände auf die Vadimoniumsfrist die Berechnungsweise aus demEdikt des Mi- (dazu sogleich) Anwendung: [--- ratione din]umerationishabita ex edicto Mi-. Für einen Ablativ vor di-/numerationis ist dannausreichend Platz vorhanden, wenn als Prädikat zu is vadimonium dasWort faciat gewählt wird, also etwa: [faciat ratione dinu]merationis ha-bita… Ergänzt man faciat bereits in III.30 (also: is a quo poe-/[nam pe-tet, faciat] vadimonium, so wird in III.32 etwa der Ausdruck mög-lich:[ratione itineris dinu]merationis habita, oder: [ratione summae etnu]merationis habita… Damit wäre im Text der (früheste) zulässigeTermin für die Gestellung63 angesprochen und durch Verweis geregelt,vielleicht auch die (höchste) zulässige Vertragsstrafe.
Doch begegnet die Voranstellung des Prädikats vor dem Objekt:faciat vadimonium nachhaltigen stilistischen Bedenken innerhalb des
61 BELTRÁN F. 2006, plate XXI.62 LENEL 1927, S. 56. D. 2.11.1 (Gai. 1 ad ed. prov.): Vicena milia passuum in sin-
gulos dies dinumerari praetor iubet praeter eum diem, quo cautum [Gaius: vadimo-nium?] promittitur, et in quem sistere in iudicium [Gaius: sistere vadimonium?] oportet.nam sane talis itineris dinumeratio neutri litigatorum onerosa est; D. 50. 16. 3 pr. (Ulp.2 ad ed.): ‘Itinere faciendo viginti milia passuum in dies singulos peragenda’ sic sunt ac-cipienda, ut, si post hanc dinumerationem minus quam viginti milia supersint, integrumdiem occupent. veluti viginti unum milia sunt passus: biduum eis adtribuetur. quae di-numeratio ita demum facienda erit, si de die non conveniat. Im Bereich von numeratioist insbesondere hinzuweisen auf D. 38. 15. 2. 3 (Ulp. 49 ad ed.): Si praeses provinciaein proxima fuit civitate, accedere debet ad utilitatem temporis ratio itineris, scilicet nu-meratione viginti milium passuum facta: nec enim exspectare debemus, ut praeses pro-vinciae veniat ad eum, qui bonorum possessionem petiturus est.Immerhin aus dem Zu-sammenhang prozessualer Fristen (bei der datio tutoris) stammen desweiteren FV. 162:per dinumerationem vicenum milium passuum; FV. 163: per dinumerationem similimodo reverti debebit; I. 1. 25. 16: dinumeratione facta viginti millium diurnorum et am-plius triginta dierum.
63 Von “the specified date” für das Erscheinen des Beklagten vor dem Beamtenspricht auch BELTRÁN F. 2006, S. 185. Nach seiner Rekonstruktion fehlt jedoch eineRegelung, nach der sich dieser Termin im Streit- oder Zweifelsfall bestimmt.
139IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
ansonsten gleichmäßigen Textes; gegen die Terminologie vadimonium… faciat statt vadimonium … promittat spricht (das schwer lesbare)promitti in III.34. Auch angesichts fehlender Autopsie der Inschriftmuss die Lösung daher zurücktreten, solange die Lesung der editioprinceps (unter veränderten Ergänzungen) ein schlüssiges Verständnisermöglicht.
b) [pr]oxumae (?) rationis = proxumae [---ratio(?)]ni: Bezugnahmeauf einen zeitlich nächsten Termin?
Legt man also für III.32 die Lesung [pr]oxumae rationis zu-grunde, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, hierin eine Wieder-aufnahme von proxumae [--io]ni aus III.30/31 zu sehen. In III.31 wäredann [---ratio]ni zu ergänzen. In III.32 verbliebe in der Lücke [pro-mittat --- pr]oxumae insbesondere Raum für die, worauf sich das fol-gende habita bezöge. Für proxumae käme ein zeitliches Verständnis inBetracht64. Mit proxumae [---ratio]ni in III.30/31 wäre ein Ereignis ge-meint: das nächste in einer Reihe wiederkehrender Ereignisse, die imEdikt eines legatus Augusti namens Mi- genannt sind; denn ex edictogehört mit einiger Wahrscheinlichkeit zu habita65. Bei ratio müsste essich um ein Ereignis handeln, das in “dem/einem municipium oderder/einer colonia” stattfindet und dem eine Person “vorsteht” (praee-rit), die Prozesse einsetzen kann. Dabei könnte es sich um Terminehandeln, zu denen sich der Statthalter oder ein anderer kaiserlicherBeamter zur Überprüfung der “Abrechnung”, “Rechnungslegung”(putanda ratio?)66 in die Munizipien und coloniae (des Konventsbe-zirks? Cascantum und Caesaraugusta?) begibt67; bei dieser Gelegenheit
64 Im zeitlichen Zusammenhang erscheint proxumus in der lrH ansonsten stetsmit dies – I. 40: diebus quinque proxumis; II. 15/16: [intra dies quinque pro-(?)]/xumas;II. 53: in diebus qui[nque proxumis]; III.3/4: in / diebus quinque proxumis; III.36/37:intra dies quin-/[que proxumas].
65 Anders NÖRR 2008, S. 129 f. Anm. 104: “ex edicto … promittere”. Gehörte exedicto … zu [promittat], so wäre die Ablativkonstruktion mit habita nach ex edicto …zu erwarten. § 14 ist kein “Beleg dafür, daß Vadimonien im statthalterlichen Ediktgeregelt waren” (so aber NÖRR 2008, S. 130).
66 Vgl. CIL VIII, n. 7039: proc(uratori) Aug(usti) … et ad pu/tandas rationes / Sy-riae civitatium; CIL VIII, nn. 7059 und 7060: legato / divi Hadriani ad rationes / civi-tatium Syriae putandas.
67 Zur Terminologie ratio vgl. die Ämter o. Anm. 66, sowie etwa AE 2003, n.1933 (Afr. proc.): proc(uratori) privatae rationis per Italiam proc(uratori) privat(ae) ra-tionis prov(inciae) Mauretaniae Caesariensis; sowie die Hinweise auf logistae beiMOMMSEN 1887, S. 858; 861 mit Anm. 2-4; s. auch NÖRR 1969, S. 20. Auffällig bleibteinerseits der Singular ratio (zu den rationes communes municipi vgl. leges Malac.
140 JOHANNES PLATSCHEK
stünde er auch zur Einsetzung von Prozessen zur Verfügung. Dafür,dass es sich um Termine vor Beamten der kaiserlichen Verwaltunghandelt, spricht die Tatsache, dass sie im Edikt eines legatus Augustifestgelegt sind und für verschiedene Städte (“municipi aut coloniae”)ungleichzeitig sind (proxumae). Das Verhältnis dieser Termine zu denGerichtstagen des conventus wäre zu untersuchen68. Die Beschleuni-gungstendenz spricht dafür, dass die rationes häufiger stattfinden alsdie Gerichtstage des conventus. Zu ergänzen ist also:
III.29 [Si quis ab aliquo p]oenam·ex hac lege petet,·is·a quo poe-III.30 [na persequetur (?)] vadimonium·ad eum·qui·proxumaeIII.31 [putandae (?) ratio]ni·municipi·aut·coloniae praeeritIII.32 [promittat die pr]oxumae rationis habita ex edicto·Mi-
Bei diesem Verständnis verschwinden die Probleme mit der örtli-chen Zuständigkeit zur Gänze. Vielmehr spricht dann alles dafür, dassman die Zuständigkeit für die Prozesseinsetzung der kaiserlichen Ver-waltung zuweist69.
3. III.32/33: ex edicto Mi-/[---]ani leg(ati) Aug(usti) clarissimi viri
Die Lücke zu Beginn von III.33 enthält den restlichen Namen desBeamten, dessen Edikt nach dem soeben entwickelten Verständnis dieTermine für die “rationes” der Städte festgelegt. Dafür, dass diese Per-son nicht mit [--- Fu(?)]ndanus Augustanus Alpinuslegatus [--- Tra]ianiHadriani Aug(usti)aus III.44/45 identisch ist, sprechen sich Nörr undFrancisco Beltrán unter Hinweis auf die divergierende Nomenklatur(jedenfalls Alpinus würde in III.33 fehlen) und den auf die Person inIII.32/33 beschränkten Titel clarissimus vir aus70. In III.44/45 sei derlegatus iuridicus genannt, in III.32/33 der amtierende Statthalter (lega-tus pro praetore). Tatsächlich scheint die Lücke in III.33: Mi-/[---]anifür Mi-/[nuci Fundani Augusta]ni zu wenig, für Mi-/[nuci Funda]ni zuviel Platz zu bieten. Ob in dem Edikt, das die ratio-Termine der Städte
LXVII und Irn. 67), andererseits (jedenfalls in III.32) die bloße Verwendung von ratiofür den Vorgang/Termin des rationem putare/reddere o. Ä. Doch bezeichnet umge-kehrt etwa conventus nicht nur den Termin des “Zusammenkommens”, sondern auchden Ort und die versammelten Personen.
68 Sitz des conventus ist CaesarAugusta, Plin., Nat. hist. 3.18; s. nur HAENSCH
1997, S. 172; 482 f.; ALFÖLDY 2007, S. 345.69 Zur Zuständigkeit des Statthalters oder Iuridicus s. auch NÖRR 2008, S. 125 f.70 NÖRR 2008, S. 110 s.; BELTRÁN F. 2010, S. 33 f.
141IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
festlegt, das (Provinzial-)Edikt des amtierenden Statthalters zu sehenist, lässt sich nicht sagen. Denkbar wäre auch, dass jährlich wiederkeh-rende Termine von einem anderen Legaten durch besonderes Ediktfestgelegt wurden und man seither auf dieses Edikt verweist.
4. III.33/34: ut in /[---]+++promitti oporte---
In III.33/34 enthält die Inschrift nach der Lesart Francisco Bel-tráns und der Ergänzung Crawfords eine adverbiale Wendung zur Ge-staltung des vadimonium: ut in / [edicto pr(aetoris) urb(ani)] promittioportebit. In edicto … promitti oportebit ist freilich unwahrscheinlich:“Im Edikt” muss nichts “versprochen werden”. Die Gestaltung desVersprechens ergäbe sich vielmehr “aus dem Edikt” (ex edicto) oder“durch das Edikt” (edicto); in / [edicto ---] lässt sich ausschließen.
Die publizierten Abbildungen scheinen auch eine Lesung oporte-ret zuzulassen71. Ut mit dem Irrealis ist durchaus typisch für Verwei-sungen auf eine eigentlich nicht einschlägige Regelung72: der Beklagtemüsste das vadimonium so gestalten, wie es unter bestimmten Um-ständen “versprochen werden müsste”. In der Lücke wären dann dieUmstände des promitti oporteret zu vermuten, also etwa ut in / [urbemRomam]73, ut in-/[ter civ(es) Rom(anos)], ut in /[pecuniaria re], ut in /[rebus creditis] promitti oporteret. Wiederum gilt aber: Auf die von mirnicht am Original überprüfte Lesung oporteret sollte solange nichtzurückgegriffen werden, wie die Lesung oportebit der editio princepssich sinnvoll integrieren lässt.
Bleibt man also bei oportebit, so eröffnet sich die Möglichkeit, inut … den Beginn eines Konsekutivsatzes zu sehen, in den ein unterge-ordneter Satz mit oportebit integriert ist, also etwa eine Bezugnahmeauf die Zeit: in [quam diem ---] promitti oportebit, den Ort: in [quem
71 BELTRÁN F. 2006, plate XX/XXII.72 Vgl. etwa lex agraria (111 v. Chr.) – CIL I. 22, n. 585, v. 30: [utei ei] et in eum
iudicium iudicem recuperatoresve ex h(ace) l(ege) dare oporteret sei quis de ea re iudi-ciu[m petisset quod civem Romanum contra h(anc) l(egem) fecisse diceret]; Lex Rubriade Gallia cisalp. (49-42 v. Chr.) – CIL I. 22, n. 592 (= FIRA I n. 19), cap. XXI, v. 8/cap.XXII, v. 40: utei esset esseve / oporteretsei …; Tab. Heracl. (80-43 v. Chr.) – CIL I. 22,n. 593 (= FIRA I n. 13):ita utei … profiterei oporteret; Tab. Hebana (20 n. Chr.) – AE1949, n. 215, v. 36: uti eum ex ea l(ege) [quam Cinna et Volesus] / [co(n)s(ules) tuler-unt X centuri]ar(um) agere facere oporteret; ibd., v. 40: [uti eum ex lege]… recitareoporteret.
73 Nach LENEL 1927, S. 56 ist die dinumeratio im Ediktsabschnitt über das vadi-monium Romam faciendum ausgeführt.
142 JOHANNES PLATSCHEK
locum ---] promitti oportebit74 oder die Person des Beamten in [cuius --- ---] promitti oportebit etc., zu ergänzen jeweils um [--- se sistere] pro-mitti, [--- vadimonium] promitti o. Ä.
5. III.34-37: iudicem… pronuntiet
Für den Rest des Paragraphen lässt sich über Alternativen zu denErgänzungsvorschlägen der editio princeps nachdenken:
Iudicem (III.34) kann Objekt zu einem zu ergänzenden [det] –“auf dass… er einen Richter gebe” oder [sortiatur] – “auf dass er… ei-nen Richter lose” sein75. Subjekt wäre jeweils der (ebenfalls zu ergän-zende oder aus qui… praeerit zu beziehende?) Rechtsprechungsbe-amte. Iudicem kann aber auch Objekt eines zu ergänzenden [accipiant]o. Ä. sein – “auf dass… sie einen Richter erhalten”; Subjekt wärendann die Streitparteien; also etwa:
III.34 iudicemIII.35 [accipiant ei inter] quos controversia erit76
Extra ordi- (III.35) lässt sich mit Francisco Beltrán zu extra ordi-/[nem ---] ergänzen. Denkbar ist aber auch extraordi-/[nari- ---], alsoiudicem … extraordi-/[narium---] oder extraordi-/[naria sorte ex]qua… pronuntiet77. Immerhin findet sich zwischen extra und ordi keinTrennungszeichen (wohl aber vor extra und den beiden Worten zu-vor).
Die Ergänzung von III.36/37 zu intra dies quin-/[que proxumasquibus] datus erit pronuntiet begegnet sprachlichen Bedenken bei qui-bus. Inhaltlich ist der Satz insoweit kaum zweifelhaft: es geht um die(mit fünf Tagen äußerst knapp bemessene) Urteilsfrist des eingesetztenRichters.
74 S. ThLL s. v. promitto, cap. sec. I A 1 a b (vol. X. 2. 2, col. 1865 vv. 43-46) mitlex Irn. 9 B 20/22; Gell. 6. 1. 9.
75 Zur Richterlosung s. nur KASER, HACKL 1996, S. 170.76 Die Ergänzung Crawfords [que is qui i. d. praeerit inter] (BELTRÁN F. 2006, S.
157) erscheint als zu lang für die Lücke in III.35. Zudem ist iuri dicundo auch in III.5nicht abgekürzt.
77 Zum grundsätzlich einzuhaltenden ordo postulationum in der Rechtsprechungdes proconsul s. D. 1.16.9.4 (Ulp. 1 de off. proc.). Ex qua sorte pronuntiare findet sichin der lex (Acilia?) repetundarum – CIL I. 22, n. 583 (= FIRA I n. 7), v. 54: ex qua sortipronontiarit, eam sortem proxumo iud[ici reddito. An der Ergänzung Crawfords extraordi-/[nem dato ea lege] qua secundum legem… (BELTRÁN F. 2006, S. 157) stört diezweifache Verwendung von lex in unterschiedlicher Bedeutung.
143IUSIURANDUM UND VADIMONIUM IN DER LEX RIVI HIBERIENSIS
Aus den Fragmenten der lrH zu vadimonium und Richterbestel-lung lässt sich wenig Sicheres beziehen. Die Qualifizierung als “La-dungsvadimonium” liegt nahe78; dass ein solches hier durch Satzungvorgeschrieben wird, wirft die Frage auf, ob und in welchem Umfangdas außergerichtliche vadimonium in anderen Fällen gesetzlich vorge-sehen ist. Die – wahrscheinliche – Bezugnahme auf den Beamten quiproxumae [--- ratio]ni municipi aut coloniae praeerit sollte in Überle-gungen zu jurisdiktionellen Zuständigkeiten in Hispania Tarraconensisund anderen kaiserlichen Provinzen einbezogen werden.
Abstract
The lex rivi Hiberiensis (lrH) mentions (among others) two importantinstitutions of Roman procedure: oath (iusiurandum) and promise to appear(vadimonium). Building up on the editio princeps, the oustanding new sourcecan cautiously and partially be restored by using epigraphic and literary evi-dence. It provides a new insight into the parties’ extrajudicial interaction andinto the initiation of a formal civil trial, but also raises new questions.
Die lex rivi Hiberiensis (lrH) erwähnt – in lückenhafter Form – zwei Re-chtsinstitute, die im uns bekannten römischen Prozessrecht eine entschei-dende Rolle spielen: den Eid (iusiurandum) und das Gestellungsversprechen(vadimonium). Die wertvolle Quelle lässt sich aufgrund der sonstigen epi-graphischen und literarischen Belege vorsichtig und teilweise ergänzen. Sieeröffnet dabei neue Einblicke in die außergerichtliche und prozesseinleitendeInteraktion der Parteien und wirft neue Fragen auf.
Bibliographie
ALFÖLDY G., Fasti und Verwaltung der hispanischen Provinzen: zum heutigenStand der Forschung, in HAENSCH R., HEINRICHS J. (Hgg.), Herrschen undVerwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kais-erzeit (Köln u.a. 2007), S. 325-356.
BABUSIAUX U., Papinians Quaestiones. Zur rhetorischen Methode eines spät-klassischen Juristen (München 2011).
BEHRENDS O., Der Zwölftafelprozess. Zur Geschichte des römischen Obligatio-nenrechts (Göttingen 1974).
BEIKIRCHER, H., Zur Bedeutungsentwicklung von promitto, in ZSS. 118 (2001),S. 378-380.
78 BELTRÁN LLORIS F. 2006, S. 185; NÖRR 2008, S. 130.
144 JOHANNES PLATSCHEK
BELTRÁN LLORIS F., An Irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hi-beriensis, in JRS 96 (2006), S. 147-197.
BELTRÁN LLORIS F., El agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraco-nense, in LAGÓSTENA BARRIOS L.G. et al. (Hgg.), Aquam perducendam cu-ravit. Captación, uso y administración del agua en las ciudades de la Béticay el occidente Romano (Cadiz 2010), S. 21-40.
BRUNS C.G., MOMMSEN TH., GRADENWITZ O., Fontes iuris Romani antiqui.Leges et negotia (19097).
DONADIO N., Vadimonium e contendere in iure. Tra “certezza di tutela” e “di-ritto alla difesa” (Milano 2011).
GIOMARO A.M., La diversa collocazione del De calumniatoribus: scuola o praticagiudiziale?, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XVI Con-vegno Internazionale (Napoli 2007), S. 491-549.
GRADENWITZ O., Rez. Demelius, Schiedseid und Beweiseid im römischen Civil-prozesse (1887), in ZSS 8 (1887), S. 269-277.
HAENSCH R., Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung inder römischen Kaiserzeit (Mainz 1997).
HEUMANN H.G., SECKEL E., Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts(19079).
HUSCHKE E., Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwen-dungen (1874).
KASER M., Das altrömische ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechts-geschichte der Römer (Göttingen 1949).
KASER M., HACKL K., Das Römische Zivilprozessrecht (München2 1996).LENEL O., Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung
(Leipzig 19273).LENEL O., Palingenesia iuris civilis II (Leipzig 1889).LEWIS, R. G. (ed.), Asconius. Commentaries on Speeches of Cicero (Oxford
2006).MOMMSEN TH., Römische Urkunden, in ZgR 15 (1850), S. 351 ss.MOMMSEN TH., Römisches Staatsrecht II.2 (Leipzig 18873).NÖRR D., Imperium und Polis in der Hohen Prinzipatszeit (München 19692).NÖRR D., Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis, in ZSS 125
(2008), S. 108-188.PLATSCHEK J., Das Edikt De pecunia constituta (München 2013).RODGER A., The Praetor Hoist with his Own Petard: the Palingenesia of Digest
2,1,10, in CAIRNS J.W., ROBINSON O.F. (Hgg.), Critical Studies in AncientLaw, Comparative Law and Legal History (Oxford 2001), S. 127-141.
WOLF J.G., Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund: eine Eidesdelationund eine Eidesleistung, in ALTMEPPEN H. et al. (Hgg.), Festschrift für RolfKnütel zum 70. Geburtstag (Heidelberg 2009), S. 1459-1468.