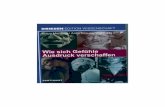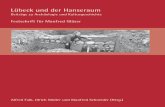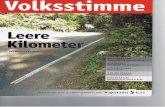Perge und seine Akropolis: Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit ......
Emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhunderts aus der Altstadt von Lübeck. In: A. Falk, U. Müller...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhunderts aus der Altstadt von Lübeck. In: A. Falk, U. Müller...
Alfred Falk, Ulrich Müller und Manfred Schneider (Hrsg.)
Lübeck und der HanseraumBeiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte
Festschrift für Manfred Gläser
Lübeck und der HanseraumBeiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte
Festschrift für Manfred Gläser
Verlag Schmidt-RömhildLübeck 2014
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-7950-5220-1© 2014 by the editors
Herstellung: Schmidt-Römhild, Lübeck
Gedruckt mit Unterstützung der Archäologischen Gesellschaft der Hansestadt Lübeck e.V.
Redaktion:Claudia Kimminus-Schneider und Dirk Rieger
Technische Redaktion, Satz und Layout:Holger Dieterich und Ines Reese
Umschlagentwurf:Holger Dieterich und Manfred Schneider
Bildredaktion:Holger Dieterich, Ines Reese und Dirk Simonsen
Umschlagbild: Lübeck, Ausgrabung Johanniskloster 1979 bis 1981.Der Ausgräber Manfred Gläser vor der Stadtmauer des 13. Jahrhunderts.
7
André Dubisch, Cathrin Hähn, Eric Müller,Hendrik Rohland und Katrin Siegfried
Alfred Falk
Günter P. Fehring
Mieczyslaw Grabowski
Antjekathrin Graßmann
Rolf Hammel-Kiesow
Jörg Harder
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .................................................................................................. 11
„Lübeck ist Archäologie” ....................................................................... 13
Manfred Gläser – Ein Leben für die Archäologie ................................. 17
Das Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum – Manfred Gläsers Werk ......................................................................... 23
Silexman ................................................................................................ 27
Innenansichten aus dem Leben eines Bereichsleiters ....................... 29
Schriftenverzeichnis Manfred Gläser .................................................. 41
Ein tiefer Blick in die Geschichte des Lübecker Burghügels.Neue Befunde zur Befestigung und Entwicklung eines wichtigenSiedlungskerns der Stadt Lübeck ........................................................ 51
Herrn Brehmers Spur ............................................................................ 69
Archäologie in Lübeck – Weltkulturerbe der UNESCOund Grabungsschutzgebiet ................................................................. 79
Kranenkonvent – Befunde und Ergebnisse der archäologischenUntersuchungen in der ehemaligen Beginenniederlassungan der Kleinen Burgstraße 22 zu Lübeck ............................................. 83
Ein mittelalterliches Kloster in Lübeck?Das St. Johannis-Jungfrauenkloster um 1800 ..................................... 95
Der Beitrag der Archäologie zur hansischen Geschichte ................. 107
Aparter Abort – ein erhaltenes Toilettenhausdes 13. Jahrhunderts..............................................................................115
Festschrift für Manfred Gläser
Alfred Falk, Ulrich Müller undManfred Schneider
Annette Borns
Friedhelm Anderl
Alfred Falk
Lara Mührenberg
Doris Mührenberg
Lübeck...
8
Torsten Kempke
Heiko Kräling
Ursula Radis
Dirk Rieger
Ingrid Schalies
Manfred Schneider
Ulf Stammwitz
Peter Steppuhn
Ingrid Sudhoff
Wo lag die Burg Alt Travemünde? ....................................................... 123
Digitale Dokumentation – Die Weiterentwicklung derLübecker Archäologie ......................................................................... 131
Der baugeschichtlich-historische Kontext ausgewählterBaubefunde der Großgrabung im Gründungsviertel Lübecks ......... 135
Exzeptionelle Hofgebäude des 12. Jahrhunderts aus demrezenten Großgrabungsprojekt im Lübecker Gründungsviertel ...... 149
Von Kaianlagen, Bohlwerken und Uferbefestigungen –archäologische Befunde zum Ausbau des stadtseitigenTrave-Ufers im 12.–20. Jahrhundert .....................................................161
„Die erste Kirche in Lübeck gebawet“Lübecks Kirchen – unbekannte Bodendenkmale ............................. 173
Neue archäologische Befunde zu frühen Backsteinbautenin der Lübecker Fischstraße ............................................................... 183
Emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhundertsaus der Altstadt von Lübeck ............................................................... 193
Forschung über Grenzen hinaus: deutsch-dänische Kulturprojekte .. 207
Ein Spielstein im Dorf .......................................................................... 215
Status, Power and Values: archaeological approaches tounderstanding the medieval urban community ............................... 223
Zier- oder Prunkglutstülpen aus Enkhuizen und West-Friesland(Niederlande) – Ein Spiegel der Gesellschaftim „Goldenen Jahrhundert” ............................................................... 235
Die Ausgrabungen im Bremer Stephaniviertel beim Neubauvon „Radio Bremen“ 2004 bis 2005 .................................................. 245
Domestic building in Alkmaar, the Netherlands .............................. 257
Der Lübecker Hof im mittelalterlichen Riga ..................................... 265
Grabmalerei im spätmittelalterlichen Brügge .................................. 273
Bring out your Dead! – burial rites and ritual in a medievalmonastic cemetery ............................................................................. 285
Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen und neuzeitlichenInfrastruktur in der Hamburger Altstadt ........................................... 301
...und der Hanseraum
Betty Arndt (Göttingen)
Brian Ayers (Norwich)
Michiel H. Bartels (Hoorn)
Dieter Bischop (Bremen)
Peter Bitter (Alkmaar)
Andris Caune (Riga)
Hubert de Witte (Brügge)
David H. Evans (Hull)
Elke Först (Hamburg)
9
Michael Geschwinde (Braunschweig)
Anna-Therese Grabkowsky (Münster)
Rita Gralow (Wismar)
Uta Halle (Bremen)
Palle Birk Hansen (Næstved)
Volker Herrmann (Bern)
Jesper Hjermind (Viborg)
Lene Høst-Madsen (Skanderborg)
Karl Bernhard Kruse (Hildesheim)
Leif Plith Lauritsen (Maribo)
Gabriele Legant (Allensbach)
Torsten Lüdecke (Hamburg)
Fred Mahler (Uelzen)
Gunnar Möller (Stralsund)
Joachim Müller (Brandenburg)
Ulrich Müller (Kiel)
Ralf Mulsow (Rostock)
Grażyna Nawrolska (Elbing)
Ieva Ose (Riga)
Ingvild Øye (Bergen)
Henryk Paner (Gdańsk)
Anton Pärn und Erki Russow (Tallinn)
Ac muris amplificavit – Archäologische Befunde zur Befestigungder Stadt Braunschweig im Mittelalter ............................................... 311
Die frühe Klosterlandschaft in Holstein ............................................. 319
Der Hof des Zisterzienserklosters Doberan in Wismar im Jahr 1656 ... 329
Archäologische Fragen und archivalische Antworten zumSchuster- und Töpferhandwerk in der Stadt am Beispiel Lemgos ... 339
Næstved Hafen – die Pforte zu Norddeutschland ........................... 345
Hafen, Markt und Pfalz Duisburg im frühen und hohen Mittelalter .... 349
With a hawk on the hand – the 11th-century life of the nobilityby Viborg Søndersø ............................................................................ 357
An Anchor Island and Five Ships under the Opera – a short reviewof the results of the archaeological excavation in Copenhagen ..... 367
Die Hildesheimer Stadtmauern vom 9. bis ins 12. Jahrhundert ....... 373
Lübeck, die Hanse und Lolland-Falster ............................................. 381
Zwischen Infobox und Elfenbeinturm. Reflektionen zur Öffentlich-keitsarbeit der Großgrabung Neue Straße in Ulm (2001–2004) .......... 389
Schreibgriffel der „Harzer Gruppe“ mit Glättspuren ....................... 399
Historische Archäologie bei einer Gebäudesanierung:Untersuchungen im historischen Rathaus der Stadt Uelzen .......... 409
„Viel Steine gab`s…“ Die einstigen spätmittelalterlich-neuzeit-lichen Grenz- und Flursteine in und bei Stralsund ........................... 413
Die Doppelstadt Brandenburg an der Havel. Überlegungen zuStadtplanung im 12. und 13. Jahrhundert und dem Phänomeneiner im Parzellennetz greifbaren sozialen Differenzierung ........... 423
„Archäologie“ + „Kultur“ = „Hansekultur“?Überlegungen zu einem Begriff ........................................................ 439
Die spätslawische Besiedlung des Rostocker Altstadthügels .......... 453
Waren Flaschen die Attribute der mittelalterlichen Pilger aus Elbing? ... 467
Einige Zeugnisse mittelalterlicher Wallfahrten undPilgerzeichen in Riga .......................................................................... 475
Bergen and the German Hansa in an archeological perspective ........ 481
Pilgrim badges with the image of Charlemagne in thecollection of the Gdańsk Archaeological Museum .......................... 491
Halbkeller in Westestland – Steinwerke aus der Städtegründungszeit ... 503
10
Slawische Handelszentren und frühdeutsche Siedlungen:Die Anfänge Lübecks und Rostocks im Vergleich ............................. 513
Zur Ostgrenze des Verbreitungsgebietes der Kugeltöpfe – Neue Betrachtung eines alten Problems .......................................... 519
Castles of the Scanian market – three examples .............................. 527
Helden- und Herrscherdarstellungen an Decken, Wänden undauf Ofenkacheln in Lüneburg ............................................................. 539
Form und Funktion. Einige theoretische Gedanken zur Entwick -lung der mittelalterlichen Burgen im Gebiet nördlich der Elbe .......... 549
Zur Inneren Sicherheit im frühen und hohen Mittelalter - eine archäo-logische Fallstudie zur Verwendung von Schloss und Schlüssel ............ 559
The Abodrites – the Vikings’ neighbours to the south.Relations between the Slavic Abodrites and the Vikingsalternating between conflict and peaceful alliance ........................ 573
Die Reliquie der heiligen Gertrud im Dom zu Turku ....................... 579
10 Jahre U-Bahn-Archäologie in Köln – ein Erfahrungsbericht ............ 587
Just to be on the safe side… Some notes on painted tombsin the Antwerp cathedral of Our Lady (Belgium) .............................. 597
Visby – Lübeck. Kontakte über sechs Jahrhunderte ....................... 609
Ortwin Pelc (Hamburg)
Marian Rębkowski (Stettin)
Anders Reisnert (Malmö)
Edgar Ring (Lüneburg)
Hans Gerhard Risch (Hamburg)
Ralph Röber (Konstanz)
Hans Skov (Aarhus)
Jussi-Pekka Taavitsainenund Markus Hiekkanen (Turku)
Marcus Trier (Köln)
Johan Veeckman (Antwerpen)
Gun Westholm (Visby)
11
Ein Buch mit Manfred Gläser zu erstellen ist in der Lübecker Archäologie eine zwar oft geübte aber stets auch jeweils neue Aufgabe, weiß er doch sehr genau, wie das Ergebnis aussehen soll und wie der Weg dahin führt.
Ein Buch für Manfred Gläser zu erstellen, ohne sein Zutun und Wissen, ist eine besondere Heraus-forderung, spürt man ihn doch stets mit seinen Vor-stellungen einer guten Publikation im Hintergrund. Als Herausgeber werden wir erleben, ob wir seinen Ansprüchen gerecht werden konnten. Publikatio-nen sind immer der Kern der Ergebnisse der wissen-schaftlichen Arbeit des mit diesem Buch zu ehrenden Kollegen und Bereichsleiters der Lübecker Archäolo-gie und Denkmalpflege.
Schon lange war es Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden von Manfred Gläser klar, ohne Festschrift können wir ihn nicht aus dem Amt entlassen. Sie wurde daher bereits ab 2010 ge-plant und vorbereitet, um sie ihm im Frühjahr 2014 mit dem Eintritt in den Ruhestand übergeben zu können. Aber wie so oft überraschte eine Entschei-dung von Manfred Gläser das schon fast fertige Projekt. Seinem Wunsch, seine Amtszeit um weite-re zwei Jahre fortzusetzen, wurde seitens der Hanse-stadt Lübeck entsprochen. Also stand die Festschrift ohne den ursprünglichen Anlass da. Die Herausgeber haben dann entschieden, das Projekt wie geplant ab-zuschließen und ihm die Festschrift noch vor Ende seiner Amtszeit zu übergeben.
Manfred Gläser ist 2014 in seinem 65. Lebensjahr 20 Jahre Amts- bzw. Bereichsleiter in Lübeck. 2014 kann er das größte Projekt der Lübecker Archäologie, die mehrjährigen Grabungen im Gründungsviertel, erfolgreich abschließen. Für uns sind das wesentli-che Punkte, sein bisheriges Wirken für Lübeck und die Archäologie im Hanseraum mit diesem Buch zu würdigen. Es spiegelt das breite Spektrum seiner For-schungsinteressen sowie eines Netzwerkes von Kol-leginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, mit denen er seit vielen Jahren verbunden ist.
Manfred Gläser kam als Amtsleiter 1994 nicht neu nach Lübeck, auch wenn damals sein Arbeitsort das
Kulturhistorische Museum der Hansestadt Rostock war. Das kurze Intermezzo als Direktor dieser ange-sehenen Institution in der schwierigen Nachwende-zeit trat er 1991 an, zuvor war er viele Jahre in ver-schiedenen Projekten der Lübecker Archäologie tätig, in denen er bereits den Grundstock für seine weitere wissenschaftliche Arbeit in Lübeck legte. Auch von Rostock aus lagen sein wissenschaftlicher Fokus und sein Lebensmittelpunkt stets in der Hansestadt an der Trave. So war es auch nur konsequent, die Nach-folge seines früheren Chefs Prof. Dr. Fehring, dem er noch von Rostock aus eine umfangreiche Festschrift widmete, anzutreten und die Lübecker Archäologie mit neuen Ideen, Konzepten und Projekten bis heute zu prägen. Konsequent öffnete er die archäologischen Forschungen und Aktivitäten in Lübeck einer brei-ten interessierten Öffentlichkeit. Veranstaltungen, Führungen, Vorträge und Ausstellungen sind durch ihn zu einem wesentlichen Standbein der Arbeit des Bereiches geworden. Hierdurch wurden die Archäo-logie und Bodendenkmalpflege sowohl in der Bevöl-kerung als auch in der Politik und Verwaltung der Hansestadt fest verankert. Der Aufbau eines wissen-schaftlichen Netzwerkes gelang ihm seit 1995 durch die Etablierung des Lübecker Kolloquiums zur Stadt-archäologie im Hanseraum, das bis zur Gegenwart kontinuierlich bereits neunmal stattfand. Natürlich haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser wissenschaftlichen Institution zu dem hier vorliegen-den Buch beigetragen.
Höhepunkte in der bisherigen Bereichsleitung Manfred Gläsers waren unzweifelhaft die Ausstel-lung zur Dänenzeit Lübecks mit dem Besuch der dänischen Königin und des Bundespräsidenten 2003 im Beichthaus und dessen Ausbau danach unter seiner Leitung zum Archäologischen Museum der Hansestadt Lübeck. Das im Sommer 2005 eröffnete Museum war sein eigentliches Lebenswerk, von dem er 2011, wenige Jahre später, erleben und mit anse-hen musste, wie es vollständig und radikal wieder auf den Ausgangspunkt zurück geführt wurde, um einer anderen musealen Institution Platz zu machen. Dies ist sicherlich die schmerzlichste Erfahrung der
Vorwort
12
Lübecker Archäologie der letzten Jahre. Kompensiert wurde dieser Verlust durch die Bewilligung und er-folgreiche Durchführung des bisher und wohl für eine lange Zeit auch größten archäologischen Projek-tes in Lübeck und Nordeuropa, der Grabungen im Gründungsviertel. Deren umfangreiche Funde und Ergebnisse werden Manfred Gläser auch lange nach dem Ende der Kampagne noch beschäftigen und eine Basis bilden für neue Ideen im Umgang mit dem überaus reichen archäologischen Kulturgut und sei-ner Präsentation in der Welterbestadt Lübeck.
Die Herausgeber dieser Festschrift und deren Au-torinnen und Autoren spiegeln sehr gut das amtliche, kollegiale, wissenschaftliche und freundschaftliche Umfeld Manfred Gläsers. Mit der Universität Kiel ver-bindet ihn ein langjähriger Lehrauftrag, aus der eine Honorarprofessur hervorging. In etlichen Übungen, Seminaren, Exkursionen haben mehrere Studieren-den-Generationen von Manfred Gläser Probleme der Mittelalterarchäologie, der Stadtarchäologie und na-türlich Lübecks kennengelernt, ebenso wie den prak-tischen Umgang mit archäologischen Ergebnissen in Ausstellungen und Publikationen. Die Archäologische Gesellschaft der Hansestadt Lübeck ist mit ihren 200 Mitgliedern Multiplikator der Archäologie in der inter-essierten Stadtöffentlichkeit und unterstützt die Arbeit des Bereiches und seines Leiters in vielfältiger Weise bei Veranstaltungen, Publikationen und Anschaffun-gen wissenschaftlicher Literatur und technischer Ge-räte. Besonders mit dem ehemaligen Archäologischen Museum und dem angeschlossenen Café identifizier-ten sich die Mitglieder der Gesellschaft und Manfred Gläser fehlte natürlich bei kaum einer Veranstaltung,
hielt Vorträge, leitete Führungen und Exkursionen. Manfred Gläser ist kein Freund zu langer Worte,
aber ein Freund voluminöser Publikationen, vor al-lem aus seinem Fachgebiet. So soll das Vorwort der Herausgeber hier enden und den Beiträgen in seiner Festschrift Platz machen, von denen wir hoffen, dass sie den hohen Ansprüchen des Geehrten ein wenig entgegenkommen.
Unser Dank gilt allen, die zum Zustandekommen dieses Buches beigetragen haben: zuerst den vielen Kolleginnen und Kollegen, die Beiträge beigesteuert haben, dem Redaktionsteam Dirk Rieger und Clau-dia Kimminus-Schneider, der Universität Kiel mit Ines Reese und Holger Dieterich für Satz und Lay-out und wichtige Unterstützung bei der Herstellung, der Archäologischen Gesellschaft der Hansestadt Lübeck für Beteiligung an den Druckkosten, eben-so der Hansestadt Lübeck für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und dem Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel für die Möglich-keit, das Buch dort technisch und graphisch bis zur Drucklegung fertig zu stellen. In bewährter und zu-verlässiger Weise übernahm Herstellung und Druck der Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck. Unser Dank gilt dort dem Geschäftsführer Herrn Sperling und dem Leiter der Technischen Redaktion/Herstellung Herrn Krakow für großzügiges Entgegenkommen bei den Herstellungskosten.
Viel Glück und Erfolg für alle weitere Unterneh-mungen wünschen Manfred Gläser die Herausgeber, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freun-de, Autorinnen und Autoren dieses Bandes!
Alfred Falkfür die Archäologische Gesellschaft
der Hansestadt Lübeck
Ulrich Müller für das Institut für Ur- und Frühgeschichte
der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Manfred Schneiderfür den Bereich Archäologie
und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck
Lübeck, im Februar 2014
193
Peter Steppuhn • Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck • S. 193–206
Die emailbemalten Glasgefäße an der Schwel-le vom Hoch- zum Spätmittelalter gehören zu den schönsten und zugleich geheimnisvollsten Gläsern in der europäischen Glasgeschichte. Lange Zeit als ab-solute Raritäten des späteren Mittelalters angesehen, erfuhren diese Gefäße vor allem seit den 1980er Jah-ren ein immer größeres Interesse1. Im Laufe der letz-ten Jahrzehnte ist die Zahl der emailbemalten Gläser stetig angewachsenen und europaweit mit einer Zahl von etwa 230 Individuen zu rechnen (davon allein gut 100 aus Deutschland)2. Das bereits vor 25 Jahren abgesteckte Verbreitungsgebiet, das „...von Akkon, Ägypten und Sizilien (sowie: Portugal3) im Südosten und Süden bis Schweden (und Südfinnland4) im Nor-den, von Russland (und Krim/Ukraine 5) im Osten bis England/Irland im Westen reicht“ (Baumgart-ner/Krueger 1988, 126) hat sich nur unwesentlich verändert, doch haben sich die Fundorte mittlerweile deutlich verdichtet 6. Insgesamt fällt bei der Verbrei-tung dieser Gläsergruppe auf, dass sich bis auf weni-ge Emporien, die durchaus mit den Handelsrouten der Hansezeit in Verbindung stehen, emailbemalte Gläser im binnenländischen Mitteleuropa deutlich
weniger nachweisen lassen als im übrigen Europa. Der bemerkenswert kleine Bestand dieser Spezies in Frankreich (Foy/Sennequier 1989, 193) mag damit zusammenhängen, dass hier andere Gläser nachge-fragt wurden (Baumgartner 2005, 244; Stephan 2012, 462).
Die große Anzahl der Becher gerade in Nordeuro-pa und deren Auffindungssituationen auch im bür-gerlichen Umfeld haben erkennen lassen, dass die emailbemalten Gläser als Serien – ja sogar als Mas-senprodukte – angesehen werden können. Sie waren damit einer relativ breiten – wenn auch eher wohl-habenden – Käuferschicht zugänglich. Ursprünglich war angenommen worden, Emailgläser seien in Syri-en für europäische, das heißt „fränkische“ Abnehmer hergestellt worden (Lamm 1930, 246, 278 ff.; 1941, 77 ff.), weshalb für diese Gruppe der Begriff „Syro-fränkische Becher“ üblich wurde (Baumgartner/Krueger 1988, 126 ff; Krueger 1996, 283 ff.; 2002, 113 ff). Mittlerweile hat sich der Begriff „Emailbemal-te Gläser“ durchgesetzt (Baumgartner/Krueger 1988, 126 ff.), der diese Gruppe neutral und wertfrei umschreibt. Gelegentlich ist auch die Bezeichnung
Emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhundertsaus der Altstadt von Lübeck
von Peter Steppuhn, Lübeck
Forschungsstand
1 Insbesondere widmet sich die Bonner Kunsthistorikerin Dr. In-geborg Krueger detailliert diesem Thema (Krueger 1984, 507 ff.; 1996, 283 ff.; 1998; 2002; 2003; 2005; 2008; Baumgartner/Krueger 1988, 126 ff.). Zusammen mit ihrem Baseler Kollegen Erwin Baumgartner initiierte Frau Krueger im Jahre 1988 die in Bonn und. Basel gezeigte Ausstellung „Phœnix aus Sand und Asche“ mit der die erste große Präsentation zum europäischen Glas des Mittelalters gelang (Baumgartner/Krueger 1988). Das große Interesse an der Glasgeschichte dieser Epoche zeigt sich weiterhin daran, das bereits 1989 eine zweite umfangreiche Ausstellung in Rouen stattfand, hier mit besonderer Berücksichtigung der mittel-alterlichen Glasproduktion (Foy/Sennequier 1989). Im Jahr 1994 war es schließlich das Museum Boijmans Van Beuningen, das seine großen Glas-Bestände zusammen mit denen von Harold E. Hen-kes (1994) präsentierte. Die letzte größere Ausstellung zum mit-telalterlichen Glas, eine erweiterte Präsentation der Bestände aus
der Sammlung des Krefelder Architekten Karl Amendt, war 2005 im Finnischen Glasmuseum Riihimäki und im museum kunst pa-last/Glasmuseum Hentrich in Düsseldorf zu sehen (Baumgartner 2005).
2 Diese Zahlen nannte mir freundlicherweise Frau Krueger im März 2012; ich bedanke mich bei Ingeborg Krueger für ihre vielfältigen Hinweise, Anmerkungen und Diskussionen zum Thema.
3 Medici 2008.4 Haggrén 1997, 354 f., Abb. 2; 1999, 65 f., Abb. 1; Haggrén/M�e-M�e-
salu 1999, 15; Matiskainen 1998, 229.5 Venegoni 2012.6 Größere Zusammenstellungen von Neufunden nach dem Kata-
log in Bonn/Basel finden sich bei Pause 1996 a, 27 ff.; Krueger 1996, 284 f.; 2002, 117 ff.; 2003; 2005; Steppuhn 2002 a, 25, Abb. 9.8 und 30, Farbtaf. 1.4; i. V.; Hoššo 2003, 95 ff., Abb. 1.15, 20; Bruckschen 2004, 62 ff., 272 ff., Taf. 12–13.
194 Peter Steppuhn
„Aldrevandin Becher“ – benannt nach einem voll-ständigen Becher aus dem British Museum London, der die Inschrift „Magister Aldrevandin(i) Me Fecit“ trägt – zu lesen (Tait 1991, 151 f., Abb. 192; Verità 1995; Krueger 2002, 111 ff.; 2008, 171).
Als emailbemalte Gläser werden Glasgefäße mit einer zumeist weiß konturierten Bemalung auf der Wandung bezeichnet, auf denen sich neben rein or-namentalen Motiven sakrale wie profane Menschen-darstellungen, Reiter, Tiere, Fabelwesen, Wappen und verschiedene Ornamente finden, die zum Teil zwi-schen stilisierte Pflanzen gestellt sind (Baumgartner/Krueger 1988, 126 ff.; Bruckschen 2004, 62 ff.; Stephan 2012, 459 ff). Eine nach oben das Bildfeld abschließende Bordüre enthält ornamentale Füllun-gen, magische Formeln/Zitate/Trinksprüche oder „Si-gnaturen“ mit Nennung der jeweiligen Bechermaler (Krueger 2003, 32). Die meisten Gefäße der Gruppe sind zylindrische Becher mit leicht konkav ausschwin-gendem Rand und glattem Stand ringfaden. Daneben gibt es aber auch Schalen, Flaschen und hochstielige Schalen mit Emailbemalung (Baumgartner/Krue-ger 1988, 156 f., Nr. 116; Krueger 2003, 30; Stad-ler/Reitmaier 2003, 200 f., Taf. 7.11; Bruckschen 2004, 63; Whitehouse 2010, 41 f.; Stephan 2012, 461). Die Glasmasse ist in der Regel farblos und weist gelegentlich einen Grau- oder Grünstich auf. Seit den 1990er Jahren sind jedoch ebenso blaue emailbemal-te Gläser bekannt geworden, die eine ebenfalls spo-radische wie weiträumige Verbreitung in Mittel- und Nordeuropa aufweisen. Rote Emailgläser sind noch seltener und im Fundkontext bisher auf den Balkan beschränkt (Andelić 1975, 171; Krueger 2002, 117).
Aus den von Luigi Zecchin (Zecchin 1987; 1990) ausgewerteten Dokumenten geht hervor, dass die spätmittelalterlichen Emailmaler (zur Bemaltech-nik spätmittelalterlicher Glasgefäße siehe: Krueger 2003, 34; 2005, 280 ff.; Bruckschen 2004, 64 ff.; Gudenrath 2006; Greiff 2012, 135 ff.) in der Re-gel selbst versierte Glasmacher waren, die die mit Emailfarben aufgetragenen Dekore in eigenen Werk-stätten/Öfen einbrannten. Die eigentliche Anforde-rung an die Glaskünstler bestand vor allem darin, die exakte Schmelztemperatur zu finden, die nur das Einbrennen der Farben in das Glas gestattete, gleich-
zeitig aber das Grundglas selbst nicht verformte. Bei der Mehrzahl der Becher sind die Emailfarben so-wohl innen als auch außen aufgetragen. Ein Grund für diese Maltechnik könnte sein, dass eine optisch größere Plastizität der Darstellungen erzielt werden sollte. Denkbar sind aber auch rein herstellungsbe-dingte Gründe: einerseits wurde das Verlaufen von Konturen und Farbflächen vermieden, andererseits konnte ein Einbrennvorgang ausgelassen werden, wenn sowohl die vordere als auch die hintere Glas-fläche gleichzeitig bemalt und anschließend gebrannt wurden. Die Verwendung sowohl bunter Emailfar-ben als auch Goldbemalung auf demselben Gefäß ist bislang nicht häufig nachzuweisen (Steppuhn 1996; Krueger 2003, 30), als bislang prächtigstes Exemp-lar mit einer solchen Kombination gilt der Becher aus Stralsund (Möller 1994; Krueger 1998).
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Palette der Glasformen, der Farbe der Grundgläser sowie der Dekore und Motive erheblich erweitert, so dass eine eigenständige Arbeit zu dieser Gläsergruppe längst überfällig ist. Neben stilkundlichen Betrachtungen werden naturwissenschaftliche Analysen, von denen bereits einige Reihen speziell zu den emailbemalten Glasgefäßen vorliegen, die Frage erhellen können, wo die Ursprungsgebiete der Emailgläser zu suchen sind (Freestone/Bimson 1995; Verità 1995; 1998; Pause 1996 a, 120 ff. Freestone/Stapleton 1998; Wedepohl 1998, 30 ff.; König u. a. 2002, 355 ff.; Freestone u. a. 2008, 165 ff.; Černá u. a. 2012, 404 ff.). Die überaus großen Fundmengen von email-bemalten Gläsern in Nordeuropa7 (und das ist sicher-lich erst ein kleiner Teil der Exemplare, die jemals in Umlauf waren) bei gleichzeitig nur sporadischen Vorkommen dieser Glasgefäße in Italien führen zu der Vermutung, dass solche gleichfalls in Glashütten nördlich der Alpen hergestellt worden sein könnten. Gleichwohl belegt eine Reihe chemischer Untersu-chungen an Emailgläsern aus Deutschland wie Italien – sowohl was die Grundgläser als auch die verwende-ten Dekorfarben betrifft – eine Produktion derartiger Gläser vor allem in oberitalienischen, insbesondere ve-nezianisch-muranesischen Werkstätten (Pause 1993, 235 ff.; 1996 a, 25 ff.; Freestone/Bimson 1995; Ve-rità 1995). Desgleichen verweist auch die Charakte-risierung dieser Spezies als Soda-Asche-Gläser mehr-
7 Nach einer überschlägigen Zählung im Mai 2012 durch Frau Dr. Krueger, Bonn, lassen sich aus den bislang bekannten Fragmenten mittlerweile etwa 260 emailbemalte Gläser rekonstruieren.
195Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck des 13./14. Jahrhunderts
heitlich in den mediterranen Raum (zuletzt: Greiff 2012, 136; Stephan 2012, 461). Eindeutige Belege für die Herstellung emailbemalter Gläser in Murano bereits seit dem 13. Jahrhundert finden sich zudem in schriftlichen Quellen (Baumgartner/Krueger 1988, 126 ff.; Zecchin 1990, 114 ff.; 373 f.; Krueger 2005, 280 ff.). In diesen Aufzeichnungen werden z. T. die Namen der Glasmaler genannt, die mit den „Her-stellerangaben“ auf den Bechern übereinstimmen. So kommen zu dem eingangs erwähnten Aldrevandinus weitere, wie Gregorius, Zannus Totolus, Petrus, Bar-tholomaeus und Donninus dazu, die zwischen 1280 und 1351 als Bechermaler erwähnt werden (Krue-ger 2005, 280 f.). Die verschiedenen Glasmaler übertrugen die ihnen bekannten Bildwelten auf die Glasgefäße (Baumgartner/Krueger 1988, 126 ff.; Zecchin 1990, 114 ff.; Pause 1996 a, 29 ff.; Krueger 2003, 31 f.; Bruckschen 2004, 62 f.; Stephan 2012, 460 ff.), und so korrespondieren dort genannte Bild-motive – z. B. drei Figuren, umgeben von Pflanzen-motiven – mit den Darstellungen auf entsprechenden Bechern8.
Sicherlich wird das Know-how der Glasrezeptu-ren und der Bemalung ihren Ursprung in venezia-nisch-muranesischen Glashütten9 haben, dennoch sollte die Möglichkeit einer Produktion emailbemal-ter Gläser nördlich der Alpen nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Die Glasforschung der letzten 30 Jahre hat zum Ergebnis geführt, dass farbloses, entfärbtes Glas durchaus ebenso in Frankreich, im Schwarzwald, im Spessart und in Niedersachsen so-wie in Böhmen hergestellt wurde (Baumgartner/Krueger 1988, 19 ff.). Einige der aufgemalten Mo-tive – vor allem Wappen (soweit bislang heraldisch bestimmt) – entsprechen oftmals nordeuropäischen Motiven und sind in einigen Fällen sicherlich nach individuellen Vorgaben der Besteller und späteren Eigentümer angefertigt worden (Pause 1996 a, 32; Carboni 1998, 102). Bislang konnte auch noch nicht abschließend geklärt werden, ob die emailbemalten Becher vor allem für nordeuropäische Käuferschich-ten hergestellt wurden, ob solche Gläser mittels im-portierter Glasmasse in Glashütten auch nördlich der Alpen entstanden, oder ob wandernde Glasmacher und Glasmaler im ausgehenden Mittelalter Hütten (z. B. im schweizerisch-süddeutschen Raum) gegrün-
det und betrieben haben, um hier solche Glasgefä-ße herzustellen. Seit dem 13. Jahrhundert war Ve-nedig außerordentlich bemüht, die einheimischen Glas arbeiter und auch Glasrezepturen an die eigene Stadt zu binden. Mit strikten Ausfuhrverboten für Rohmaterialien und Glasbruch sowie restriktiven Auswanderungsgesetzen versuchte man, den zuneh-menden Klagen von Glasmachern über Abwerbun-gen und Abwanderungen von Kollegen zu begegnen. Dadurch verschaffte sich Venedig eine europäische Spitzenstellung bei der Herstellung farblosen Glases. Doch schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts muss im Raum Schweiz/Süddeutschland/Elsass mit Glas-hütten gerechnet werden, die nach italienischem/ve-nezianischem Vorbild arbeiteten (König u. a. 2002, 351). Dazu kommt, dass vermutlich einige Gläser-formen speziell für deutsche Abnehmer produziert wurden (Pause 1996a, 124 ff.; 1996 b, 194 f.). Eine für das Jahr 1248 belegte steuerliche Sonderstellung für deutsche Glashändler in Venedig (Dreier 1989, 16) wirft hier ein besonderes Licht auf die intensive Nachfrage nach italienischen Produkten in Deutsch-land bereits seit der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Der archäologische Nachweis, der eine Produk-tion emailbemalter Becher in Oberitalien eindeutig belegt, steht dagegen weiterhin aus. Gleiche Ma-lernamen oder gleiche Motive auf Gläsern aus weit voneinander entfernten Fundorten lassen indes hof-fen, dass bestimmte Herstellungsgebiete, Werkstatt-Kreise oder sogar einzelne Werkstätten und damit zugleich private wie merkantile Verbindungen fass-bar werden. Der unterschiedliche Forschungsstand in den verschiedenen Regionen Europas, der immer von Notwendigkeit und Finanzierbarkeit archäologischer Untersuchungen abhängig ist, trägt ebenso dazu bei, dass die Frage nach den Herstellungsorten momentan nicht definitiv beantwortet werden kann. Das Man-ko der bis jetzt noch zu wenig bekannten und ergra-benen Glashütten wird auch in absehbarer Zeit nicht behoben sein, so dass weiterhin lediglich Überlegun-gen und Mutmaßungen zum Thema „Provenienz der Gläser“ angestellt werden können. Andrea Nöl-ke (Nölke 1997, 22) erwägt bei dem emailbemalten Becher aus einer Kloake der Stadtwüstung Münster in der Gemeinde Münstertal, Kr. Breisgau-Hoch-schwarzwald, dass es sich bei diesem Glas um eine
8 Zecchin 1990, 374 in Entsprechung zu Baumgartner/Krueger 1988, 129 ff., Nr. 72–73, 75–76 und 139 f., Nr. 89.
9 Für die höxterschen Soda-Asche-Gläser, darunter auch ein emailbe-
maltes Glas, nehmen König u. a. (König u. a. 2002, 351 ff., 358 f.) an, dass die Glasrezepturen für diese Gläser bis auf eine Ausnahme aus Italien, wenn nicht sogar direkt aus Venedig stammen.
196 Peter Steppuhn
nordalpine zeitgenössische Nachbildung eines aus Ve-nedig importierten Emailbechers handelt. Auch diese Theorie ist einer Überlegung wert, wenngleich man nicht pauschal dazu neigen sollte, Produkte in hand-werklich weniger geschickter Ausführung dem „bar-
barischen Norden“ zuzuschreiben. Denn sicherlich wird es ebenso in den mediterranen Produktionszen-tren Glasmanufakturen mit unterschiedlichem Qua-litätsniveau gegeben haben (Bruckschen 2004, 63; Krueger 2005, 282).
Abb. 1. Lübeck, Fleischhauerstraße 91–94 (ehem. Johannis-kloster, Brunnen 2). Sechs Fragmente (davon fünf geklebt) eines irisierten farblosen emailbemalten Bechers, 13./14. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck).
Farblose emailbemalte Gläser aus Lübeck
Aus dem „um 1211“ errichteten Brunnen 2 des ehemaligen Johannisklosters (Gl�ser 1989, 17 ff.; 2004, 182 ff.) in der Fleischhauerstraße 91– 94 ge-hören zwölf Scherben zu insgesamt zwei emailbe-malten Bechern10. Vom ersten Gefäß (Abb. 1)11 sind sechs konkav geschwungene Randscherben und fünf Fragmente der zylindrischen Wandung erhal-ten. Die Emailbemalung lässt sich durch die zum Teil abgeplatzten Reste auf den erhaltenen Gefäß-partien rekonstruieren: Von außen wurden auf den Glaskörper mit ehemals weißem (jetzt schwärzlich korrodiertem) Email die Konturen der Darstellung gezeichnet, die dann größtenteils vom Inneren des Glases her mit farbigem Email hinterlegt wurden. Unterhalb der Lippe befindet sich eine Kettenborte, ein horizontaler Fries aus hintereinander gereihten S-Motiven, der anstelle einer Inschrift bisweilen auch auf anderen emailbemalten Bechern erscheint (z. B.: Baumgartner/Krueger 1988, 127 ff., Nr. 72, 100, 106, 109; Henkes 1994, 23, Nr. 1.4). Unter dem Fries sind dreilappige Pflanzenblätter erkennbar so-wie die Reste eines mit einer Punktreihe eingefass-ten Wappenschildes. Zwei vor den Wappen zu einem Kringel zusammenlaufende Linien deuten mögli-cherweise ein nach links orientiertes Tier mit nach oben eingerolltem Schwanz an. Wappen kommen auf emailbemalten Gläsern des Öfteren vor (Baumgart-ner/Krueger 1988, 148 ff., Nr. 103–109; Krueger 2002, 111 ff.), wobei der Becher von der Foster Lane in London (Clark 1983, 154, Nr. 1, Taf. XII A; Baumgartner/Krueger 1988, 252 f., Nr. 109; Ty-son 2000, 89, Abb. 14g144 und 92, Nr. g144) aus der Zeit um 1300 mit der Kombination Kettenborte und Wappenschild dem Lübecker Stück besonders nahe kommt. Das zweite Fragment eines Emailglases aus demselben Fundkomplex trägt statt der S-Motive
eventuell Buchstaben einer Inschrift, jedoch sind die-se Reste zu klein, um sie zu identifizieren (Abb. 2a)12. Das gezackte Eichen(?)-Blatt ist von innen rot und blau ausgemalt. Überhaupt sind die Glasfunde vom Areal des Johannisklosters und insbesondere aus dem Brunnen als außerordentlich qualitätvoll einzustu-fen: Neben verschiedenen Varianten von Email- und Goldemailgläsern fanden sich außerdem farblose Rippen- wie Nuppenbecher, mehrere Bleigläser, ein Schaffhauser Nuppenbecher sowie ein Schlaufenfa-denbecher (Gl�ser 1989, 58 f.; Steppuhn 1996, 326; Pause/Steppuhn i. V.; Steppuhn i. V.).
Ebenfalls in einem ehemaligen Brunnen, hier in der Königstraße 32, der ein reichhaltiges und quali-tätvolles Keramik- wie Glasinventar barg, fanden sich insgesamt 23 Überreste von mindestens sechs email-bemalten Gläsern verschiedener Farben und Deko-re (Abb. 2b-2e, Abb. 3, Abb. 4a und Abb. 5) (Falk 1992, 37 f.; Steppuhn 1993; 1996, 322; Verità 1995, 87, Nr. 2). Drei Glasfragmente aus diesem Brunnen
10 Gl�ser 1989, 58 f. Bei den auf Tafel 7, Nr. 5–6 abgebildeten Scher-ben handelt es sich entgegen der Bildunterschrift „Syro-fränkisches Glas …“ nicht um Reste eines emailbemalten Bechers, sondern um Fragmente eines sog. Islamischen Goldemailglases (vgl. Steppuhn 1996, 325f., Abb. 8; Pause/Steppuhn i. V.).
11 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 31/552.
12 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 31/552.
197Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck des 13./14. Jahrhunderts
(Abb. 2b)13 weisen lediglich einen sehr schwachen Manganstich auf und könnten daher möglicherweise zu ein und demselben Glas gehören. Zwischen je zwei
rot-gelb-roten Linienbündeln sind hier auf dem obe-ren Stück die Reste von drei Buchstaben auszuma-chen, von denen nur der zweite und der dritte sicher
a b c d e
Abb. 2. a Lübeck, Fleischhauerstraße 91–94 (ehem. Johanniskloster, Brunnen 2). Fragment eines farblosen emailbemalten Be-chers, 13./14. Jahrhundert. b Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Drei Fragmente – davon eines mit Buchstaben – vermutlich eines einzigen farblosen emailbemalten Bechers, 13./14. Jahrhundert. c Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Zwei Fragmente vermut-lich eines einzigen farblosen emailbemalten Bechers, 13./14. Jahrhundert. d Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Fragment eines farblosen emailbemalten Bechers, Motiv: Vogelklaue, 13./14. Jahrhundert. e Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Fragment eines farblosen emailbemalten Bechers, 13./14. Jahrhundert (Fotos: Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck).
a
b
Abb. 3. Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Fragment eines farblosen (mit Manganstich) emailbemalten Bechers, Motiv: „Maria mit dem Kind“, 13./14. Jahrhundert (Foto: Bereich Ar-chäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck).
Abb. 4. a: Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Bodenpartie eines korrodierten farblosen emailbemalten Bechers, 13./14. Jahrhundert. b Lübeck, Alfstraße 7. Bodenpartie eines irisier-ten farblosen (mit Gelbstich) emailbemalten Bechers, 13./14. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck).
13 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/114, 126, 126.
198 Peter Steppuhn
als „I“ und „S“ bestimmt werden können14. Auf den beiden anderen Scherbchen lassen sich Reste von ei-ner Blume und von einem Kapitell erkennen, die auf eine Heiligen-Szene hindeuten. Zwei weitere Scher-ben aus dem Brunneninhalt weisen innen aufgetrage-ne rote und blaue Farbflächen auf, die außen mit wei-ßer Emailfarbe konturiert wurden (Abb. 2c)15. Eines der Fragmente trägt zudem dunkelrot-gelb-dunkelro-te Horizontalfäden, die eine Begrenzung des Bildfel-des andeuten. Aus völlig farbloser Glasmasse ist das nächste Stück aus dem Befund (Abb. 2d). Das Motiv ist hier ein Greifvogel (oder eine Harpyie?), von dem (der) nur noch eine Klaue und ein Teil des Gefie-ders(?) zu erkennen ist16. Greifvögel und Mischwesen (Harpyien, Phönix) sind, wenn auch nur vereinzelt, ebenso von anderen emailbemalten Bechern be-kannt. Zu diesen zählen zwei weitere Lübecker Glä-ser, zum einen aus Brunnen III in der Breiten Straße 97 (Baumgartner/Krueger 1988, 138 f., Nr. 87; Dumitrache 1990, 39, G 155, Abb. 81.2, Taf. 1.2) und zum anderen ein Streufund aus der Markttwiete (Baumgartner/Krueger 1988, 146, Nr. 98; Dumi-trache 1990, 39, G 154, Abb. 81.1, Taf. 1.1). Insbe-sondere die Fragmente aus der Markttwiete weisen
Ähnlichkeiten zu dem Stück aus dem Brunnen in der Königstraße auf. Andere Emailgläser mit Darstel-lungen von Vögeln oder Mischwesen sind aus Nürn-berg (Kahsnitz 1984, 28, Abb. 9; 107 ff.), Frankfurt (Bauer/Gabbert 1980, 59, Nr. 105, Taf. 3), Greifs-wald (Sch�fer/Sch�fer 1999), Höxter (König u. a. 2002, 353, Abb. 14.1), Mainz (Krueger 2005 mit weiteren Beispielen), Trier (Hupe 2012, 43 f.; 54 f.), und dreimal aus Tartu (M�esalu 1986, 401, Taf. XXXIX.1; 1990, 447, Taf. XXXII.2; 1999, 80, Abb. 6, Taf. VI.1, VII.2, VII.4; Haggrén/M�esalu 1999, 19 f.) bekannt geworden. Zu einem weiteren Becher mit Emailmalerei gehört das nächste Stück aus dem Brunnen (Abb. 2e)17. Das klare, aber leicht irisierte Fragment trägt eine schwungvolle Pflanzendarstel-lung; die nun schwärzlich korrodierten Konturen waren ehemals weiß.
Besonders eindrucksvoll innerhalb des Glaskom-plexes ist jedoch das große Fragment mit einer als „Maria mit dem Kind“ zu interpretierenden Darstel-lung (Abb. 3)18. Auf dem korrosionsfreien Glas mit
Abb. 5. Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Sieben Fragmente (geklebt) eines blauen emailbemalten Bechers, Motiv: Pfau, 13./14. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denk-malpflege der Hansestadt Lübeck). Abb. 6. Lübeck, Königstraße 57 (Kloake). Blauer emailbe-
malter Becher (geklebt und rekonstruiert), Motiv: Gitternetz, 13./14. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denk-malpflege der Hansestadt Lübeck).
14 Bei dem ersten Buchstaben könnte es sich, dem Schriftduktus nach zu urteilen, am ehesten um ein “V” handeln. Ein geschwungener Buchstabe, wie etwa das “G”, wodurch dann die Lesart “MAGIS-TER” möglich wäre, scheint ausgeschlossen.
15 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/124, 126.
16 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/126.
17 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/31.
18 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/124, 126.
199Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck des 13./14. Jahrhunderts
deutlicherem Manganstich sind Rot, Blau und Grün hinterlegt, die übrigen Farben auf der Außenseite auf-gebracht. Das Kind mit fein gezeichnetem Gesicht ist der Mutter Maria zugewendet und blickt beim Gruß mit der segnenden Hand die Gottesmutter an, deren Kopf nur vage an gepunkteten Umrisslinien zu erah-nen ist. Interessant an der Komposition der Darstel-lung ist die Sitzhaltung des Kindes: es scheint nicht auf dem Schoß der Mutter, sondern auf einer Art Mö-bel (Bett, Truhe, Wiege?) zu ruhen. Zu dem Lübecker Stück gibt es bisher nur eine Parallele in Form einer sehr kleinen emailbemalten Scherbe aus der Foster Lane in London, wobei die Köpfe von Maria und dem Christuskind jedoch nur sehr schemenhaft dargestellt sind (Clark 1983, 154, Nr. 3; Baumgartner/Krue-ger 1988, 131 f. Anm. 1, Nr. 76; Tyson 2000, 89, Abb. 14.g148 und 93, Nr. g148; Krueger 2002, 123, Anm. 69).
Ebenfalls emailbemalten Bechern zuzuordnen sind die Bodenpartien zweier Gläser, von denen ei-nes wiederum aus dem Brunnen in der Königstraße 32 stammt (Abb. 4a)19, das andere von der Alfstraße 7 (Abb. 4b)20. Das erste Stück hat einen kräftigen Gelbstich und ist stark irisiert, das zweite ist der Rest eines farblosen, verwitterten Exemplars mit einem Standringdurchmesser von 7,2 cm, womit er zu den größten Bechern seiner Art gehört. Was diese beiden Böden eindeutig zu den Emailgläsern des 13./14. Jahrhunderts zählen lässt, ist jeweils das noch deut-lich erkennbare rot-gelb-rote horizontale Linienbün-del, das sich nahezu an allen emailbemalten Gläsern dieser Zeit als Bildfeldabschluss nach oben wie nach unten nachweisen lässt. Zwar sind in beiden Fällen die Farben durch Korrosion und Lagerung zum Teil abgerieben und verändert, die Zuweisung der Stücke zu dieser Gruppe ist jedoch zweifelsfrei.
Blaue emailbemalte Gläser aus Lübeck
Eine erst in jüngerer Zeit bekanntgewordene Va-riante der soeben vorgestellten farblosen Gläser sind blaue Becher mit Emailbemalung. Bis jetzt wurden Scherben solcher Gläser nur aus Lübeck (Abb. 5 und Abb. 6) (Steppuhn 1998; 2002 b.; 2006, 32; Krue-ger 2002, 121 f., Abb. 7 und 8; 2003, 31, 35, Abb. 6; 2005, 276), Stralsund und Greifswald (Krueger 1998, 109; 2002, 119 ff; 2003, 31, 35, Abb. 6; Man-gelsdorf 1999), sowie Viljandi in Estland und Sig-tuna21 bekannt, dazu kommen drei Fragmente aus Tirol: Ruine Flaschberg und Schloss Tirol (Stadler/Reitmaier 2003, 200 f., Taf. 7.4–5, 10). Vom ersten Stück – wiederum aus dem Brunnen in der Königs-traße 32 – sind noch der Rand (Durchmesser 8,7 cm) und ein Teil des Inschriftenbandes “(M)RI(A)” – wohl “Maria” – in gelben, statt der sonst zumeist üblichen weißen Buchstaben, erhalten, sowie die üblichen hori-zontalen rot-gelb-roten Linienbündel, die das Inschrif-ten-Band begrenzen (Abb. 5)22. Auf dem Bildfeld selbst ist ein zungenförmiger Dekor mit hellbraunen (vormals roten) Flächen und weißen Strahlen als auch gelben Punkten zu erkennen, der als zusammengeleg-te Oberschwanzdecken eines Pfaus zu interpretieren
sein wird23. Mit der senkrechten Haltung des mehr geschlossenen als geöffneten Pfauenkleides wird ver-mutlich das geschlagene Rad symbolisiert. Eine ähnli-che Haltung der Schwanzfedern findet sich bei hoch-mittelalterlichen Wandmosaiken, wie in dem aus dem Palazzo dei Normanni in Palermo (Reimbold 1983, 96, Abb. 17). Vergleichbar ist ebenfalls die Darstellung Erschaffung der Tiere auf dem ehemaligen Hauptal-tar der St. Petri-Kirche in Hamburg, der 1379–1383 entstand und Meister Bertram von Minden zuge-schrieben wird (Hauschild 1999, 112, Abb. 1). Auch hier ist ein Pfau mit senkrecht stehenden Schwanzfe-dern zu sehen, die wie ein Bündel hochgestellt sind, ohne dass ein Rad geschlagen wird. Die gleiche Dar-stellungsweise findet sich ebenso in der islamischen Welt. So auf der Wandvertäfelung aus dem Haus des Buţrus-as-Samsār in Aleppo mit dem Bild „Schreiten-der Pfau unter Blütenzweigen“. Die bemalte Holzver-täfelung aus den Jahren1600/1601 befindet sich nun im so genannten „Aleppo-Zimmer“ im Museum für Islamische Kunst in Berlin (Gonnella 1997).
Darstellungen von Pfauen sind bereits für das Neolithikum (Harappa-Kultur in Pakistan) belegt;
19 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/118. Krueger 2002, 122f., Abb. 8.
20 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 70/9128.
21 Freundliche Mitteilung von Frau Dr. Ingeborg Krueger, Bonn.
22 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/180.
23 Ich danke Frau Ingeborg Krueger, Bonn, für diesen Hinweis. Zur Mythologie und Symbolik des Pfaus siehe allgemein Reimbold 1983 und Krueger 2005.
200 Peter Steppuhn
in Italien waren sie ein beliebtes Motiv der römi-schen Kunst, besonders auch der Kleinkunst (Reim-bold 1983, 18 ff.; 88 ff.) sowie in der frühchristlichen Kunst ein Symbol des Paradieses und wurden außer-dem als Sinnbild der Auferstehung oder auch einfach nur dekorativ verwendet (Reimbold 1983, 37 ff.).
Innerhalb christlicher Kirchen waren Darstellun-gen von Pfauen oftmals an zentralen Punkten des Kirchenraumes platziert, so als Schrankenplatten zum Beispiel für eine Schrankenanlage des Presby-teriums der 579 geweihten Kirche Santa Eufemia in Grado, Venetien (Dorigo 1997, 33 ff.). Etwa 150 Jahre später datieren die Schrankenplatte im ehema-ligen Kloster Santa Maria Teodote della Pusterla in Pavia und die Reliefplatte für die Treppenbrüstung eines Ambos im Seitenschiff der Kirche San Salvato-re in Brescia (Lomartire 1999; Tomezzoli 1999)24, ebenfalls mit Pfauenreliefs. In Mitteleuropa kennt man Pfauen seit Karl dem Großen. In der karolin-gischen Buchmalerei sind Pfauen vielfach belegt und noch in der Romanik steht der Pfau als Bild für die unsterbliche Seele. Im 1011 entstandenen Hildeshei-mer Guntbald-Evangeliar thronen zwei Pfauen über der Kanontafel des 1. Kanons (Knapp 1999, 53, Abb. 71). Auf dem Teppich von Bayeux (um 1080) beto-nen zwei Pfauen ihre Stellung als königliche Tiere, indem sie über dem Schloss von Herzog Wilhelm ab-gebildet werden (Wilson 1985, 21, 179, Taf. 17). In den römischen Kirchen des 12. und 13. Jahrhunderts in San Clemente und Santa Maria Maggiore gehö-ren Pfauen zum reichhaltigen Motivvorrat der Apsis-mosaiken (Oakeshott 1967, Nr. 73, 155, 199). Ein weiteres, besonders schönes Beispiel befindet sich in der Kirche Santi Maria e Donato in Murano, die im 7. Jahrhundert errichtet wurde. Das Mosaik im Mit-telgang des Hauptschiffs mit zwei aus einem Kantha-ros trinkenden Pfauen wurde vermutlich nach der Erneuerung der Kirche um 1140 angelegt (Dorigo 1997, 51 ff.). Im späten Mittelalter schließlich sind auf bildlichen Darstellungen innerhalb der Kirchenräu-me vielfach die Flügel von Engeln mit Pfauenaugen besetzt (Reimbold 1983, 45 f.; Schmidt/Schmidt 1984, 94 ff.). Auf den emailbemalten Bechern des 13./14. Jahrhunderts stehen die Inschriften in der Re-
gel nicht in Bezug zu den Motiven der Bildfelder. So sind „Magister ... Me Fecit“-Inschriften mit sakralen Motiven kombiniert oder der so genannte Englische Gruß „Ave Maria Gratia Plena“ steht über sehr profa-nen Darstellungen.
Bei dem Lübecker blauen Becher mit Pfauenfe-dern könnte es sich um ein Gefäß mit ausschließlich christlicher Symbolik handeln. Da der größte Teil des Glases jedoch nicht erhalten ist, kann über die Ge-samtkomposition und Aussage nichts Endgültiges ge-sagt werden. Weitere emailbemalte Gläser des Spät-mittelalters mit Pfauendarstellung sind überaus selten und liegen bislang lediglich aus Tallinn und Mainz vor (Krueger 2005, 276, Anm. 10). Im ausgehen-den Mittelalter schwindet die positive Bewertung des Pfaus immer mehr und kann sogar ins Negative umschlagen25. So wird er zum Sinnbild der super-bia, des Hochmuts, gar zum Attribut der Eitelkeit (Reimbold 1983, 51 ff.)26. Während der Renaissance bleibt der Pfau wegen seiner dekorativen Schönheit ein beliebtes Motiv der Malerei, findet aber auch Ver-wendung in Gemälden mit allegorisch-symbolischen Bezügen (Reimbold 1983, 57 ff.). Auf dem Tafelbild „Verkündigung an Maria“ von Carlo Crivelli27 wird der Pfau als Kontrastfigur zur Demut Mariens ein-gesetzt.
Ganz anders verziert und in dieser Ausführung bisher einzigartig ist das zweite blaue Glas mit Email-
a b
Abb. 7. Lübeck, Burgstraße 22 („Kranenkonvent“). Wan-dungsfragment, Aufsicht (a) und Schrägansicht (b) eines Islamischen Goldemailglases, Ende 13. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lü-beck).
24 Pavia: Musei Civici, Inv.Nr. B 57, Marmor, 1. Hälfte 8. Jahrhun-dert (Lomartire 1999); Brescia: Musei Civici d’Arte e Storia, MR 5829, Marmor, Mitte 8. Jahrhundert (Tomezzoli 1999).
25 „Der Pfau schleicht wie ein Dieb durchs Land / hat Teufels Stimm‘ und Engels G’wand“. Übertragen nach „Freidanks Bescheiden-heit“, 1229 (Schmidt/Schmidt 1984, 96, 270).
26 Auf dem um 1400 zu datierenden Teppich „Kampf der Tugen-den und Laster“ im Museum der Stadt Regensburg trägt die per-sonifizierte Hochmut als Helmzier über drei Kronen einen Pfau (Schmidt/Schmidt 1984, 270).
27 15. Jahrhundert; National Gallery, London (Schmidt/Schmidt 1984, 270).
201Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck des 13./14. Jahrhunderts
bemalung, ein 9,5 cm hoher Becher von der Königs-traße 57 (Abb. 6) (Steppuhn 1998; 2002 b; 2006, 32; Krueger 2002, 121 f., Abb. 7; 2003, 35, Abb. 6). Der in den Farben Rot/Gelb/Grün aufgetragene De-kor besteht hier aus einem nur außen aufgetragenen flächendeckenden Gitternetz mit vier Reihen zu je 15 Rauten sowie fünf Farbpunkten je Feld28. Bisher ist zu diesem Exemplar, das noch zu etwa 70 % erhalten ist29, keine Parallele aus Nord- und Mitteleuropa bekannt. Entfernt verwandt mit dem Lübecker Stück sind zwei
Becher aus Kraljeva Sutjeska in Bosnien mit „motifs géometriques“ auf gelblichem, beziehungsweise rot-bräunlichem Glas (Andelić 1975, 171, 180, Taf. IV, 16–17; Krueger 2002, 117). Die beiden Becher wei-sen die gleichen Grundformen auf, wie sie ebenso von anderen emailbemalten Bechern bekannt sind. Soweit sich auf den Rekonstruktionszeichnungen erkennen lässt, besteht der Dekor jeweils aus einem etwa 3 – 4 cm breiten Band mit Gitterlinien, ist also nicht so flächen-deckend wie bei dem Lübecker Exemplar30.
Weitere Gläser mit Emailbemalung
28 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 90/1988.
29 Der Becher wurde dankenswerterweise von Herrn Erik Ypey in den Restaurierungswerkstätten des Museums für Kunst u. Kulturge-schichte (St. Annen-Museum) in Lübeck zusammengesetzt und ergänzt.
30 In einer Mitteilung vom März 2012 machte mich Frau Krueger freundlicherweise darauf aufmerksam, dass sich unter den Fun-den von Konstanz ebenso Fragmente mit Gittermuster befänden. Inwieweit diese dem Lübecker Exemplar gleichen, wäre noch zu prüfen.
31 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 16/124. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Lübe-cker Kollegen Miesczysław Grabowski M. A. für alle Angaben zu
den Grabungs-, Befund- und Fundumständen, die zur Bergung des Glasfragmentes führten.
32 Siehe den Beitrag von Miesczysław Grabowski in dieser Publikation.33 z. B. Tait 1991, 134. Fragmente solcher Lampen finden sich ge-
legentlich auch in nordeuropäischen Fundzusammenhängen, u. a. in Ulm oder Warschau: Freundliche Hinweise von Dr. Uwe Gross (Juli 2011) bzw. Frau Sylwia Siemianowska (Juni 2012).
34 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 062/F39. Neugebauer 1964; 1976; Charleston 1976; Baumgartner/Krueger 1988, 121 f., Nr. 66; Steppuhn 1996, 323 ff.;
35 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 75/179, 190, 231. Steppuhn 1993; 1996, 323 ff.; 2003; 2006.
Neben den archäologischen Funden von bislang 14 emailbemalten Gläsern (Abb. 1– 6 hier im Text; Baumgartner/Krueger 1988, 138, Nr. 87 und 146, Nr. 98; Dumitrache 1990, 39, G 154 –156, Abb. 81.1–3; Steppuhn i. V.) gibt es ebenso Hinweise aus historischen lübeckischen Quellen auf weitere Gläser dieser Gruppe: Max Hasse zitiert aus dem 1341 ab-gefassten Testament des Lübecker Bischofs Heinrich Bocholt, in dem drei „vitra picta“ genannt werden (Hasse 1981, 62). Auch wenn es für diese Glasgefä-ße keine Abbildungen gibt, so ist doch davon auszu-gehen, dass es sich hier um (farblose?) emailbemalte Gläser der Zeit um 1300 handelt. Damit erhöht sich die Gesamtmenge der in Lübeck bislang bekanntge-wordenen Gläser dieser Art auf 17 Exemplare.
Ein anderes Glasfragment mit Emailfarben (Abb. 7a–b)31, das im Jahre 2010 auf dem Grundstück Kleine Burgstraße 22 („Kranenkonvent“) im Verlauf von bauhistorischen Untersuchungen geborgen wer-den konnte32, zählt zwar nicht zur Gruppe der oben vorgestellten emailbemalten Gläser, soll aber nicht unerwähnt bleiben. Das mit 2,2 – 2,9 mm recht dick-wandige Stück aus nahezu farblosem, leicht getrübt-irisiertem Glas gehört vielmehr zu den „Islamischen
Goldemailgläsern“. Der nur außen und relativ dick aufgetragene Emaildekor ist schwierig zu interpre-tieren: Unterhalb zweier dunkelroter horizontaler Linien befinden sich blaue Farbflächen mit dunkel-roten Konturen, die als umlaufender Fries oder rein dekoratives Rankenwerk anzusprechen sind. Die Scherbe wird Teil eines Trinkgefäßes gewesen sein, wenngleich aufgrund der Glasdicke und des gerin-gen Krümmungsradius’ nicht ausgeschlossen wer-den kann, dass das Fragment ursprünglich zu einer Moscheelampe gehörte33. Überreste Islamischer Goldemailgläser konnten in der Altstadt von Lü-beck bereits des Öfteren geborgen werden. Zu den schönsten und glücklicherweise weitgehend komplett erhaltenen Beispielen zählen die etwa gleich großen Becher aus ehemaligen Brunnen in der Dr. Julius-Leber-Straße 18 (Abb. 8) (Höhe 16,9 cm)34 bzw. in der Königstraße 32 (Abb. 9) (Höhe 17,3 cm)35. Beim zuletzt genannten Exemplar ist ein außergewöhn-lich qualitätvoller Fundreichtum innerhalb des Be-fundes bemerkenswert, denn hier fanden sich neben dem Goldemailglas ebenso die oben beschriebenen emailbemalten Glasfragmente (Abb. 2b – e, Abb. 3, Abb. 4 a und Abb. 5) (Steppuhn 1993; i. V.; Müh-
202 Peter Steppuhn
36 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 31/551, 552. Gl�ser 1989, 58f., Tafel 7, Nr. 5–6; Steppuhn 1996.
37 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck, Inv.-Nr. HL 89/97, 151. Müller 1992, 152 ff.; 157 f.; 166, Abb. 6,1–2; Steppuhn 1996, 325 f., Abb. 9–10.
38 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck,
Inv.-Nr. HL 151/825, 849. Für Auskünfte zu den Fundumständen der beiden Scherben danke ich meinem Kollegen Ulf Stammwitz M. A. sehr herzlich.
39 Siehe die ausführliche Diskussion zu dem Becher und dessen unter-schiedlichen Datierungsansätzen bei Krueger 2002, 113 ff.; 2008, 177 ff.; Freestone u. a. 2008, 168 ff.
Abb. 8. Lübeck, Dr. Julius-Leber-Straße 18 (Kloake). Isla-mischer Goldemailbecher (geklebt und restauriert), Motiv: Mann mit Glasbecher, 2. Hälfte 13. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck).
Abb. 9. Lübeck, Königstraße 32 (Brunnen). Islamischer Gold-emailbecher (geklebt und restauriert), Motiv: Musikantensze-ne, 3. Viertel 13. Jahrhundert (Foto: Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck).
renberg 2008, 331 ff.). Weitere fünf Scherben von mindestens drei Goldemailbechern liegen aus Fund-komplexen in der Fleischhauerstraße 91– 94 (ehem. Johanniskloster)36 sowie aus einem Findlingsbrunnen des frühen 13. Jahrhunderts in der Königstraße 7237
vor. Dazu kommen zwei zusammengehörende Frag-mente, die im Verlauf des Großgrabungs-Projektes „Ausgrabungen im Lübecker Gründungsviertel“ im August 2012 auf dem Grundstück Alfstraße 13 aus einer Planierschicht des mittleren 13. Jahrhunderts geborgen werden konnten38.
Auch wenn einerseits spätmittelalterliche emailbe-
malte Gläser und andererseits Islamische Goldemail-gläser mit einem Produktionszeitraum in der Zeit zwischen etwa 1250 und 1350 einem gewissen Mo-detrend unterlagen, so gibt es Hinweise darauf, dass solche Glasgefäße bisweilen in späteren Zeiten, insbe-sondere im späten 19. Jahrhundert nachgeahmt wur-den (Carboni/Henderson 2005). In dieser Hinsicht besonders interessant ist weiterhin der „Hope Beaker“ aus dem British Museum in London, denn bei diesem Einzelstück handelt es sich um eine vermutlich bereits um 1800 in England hergestellte Komposition mit ve-nezianischen und islamischen Stil-Elementen39.
203Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck des 13./14. Jahrhunderts
Während des Hoch- und Spätmittelalters zeigt sich in der Hansestadt Lübeck in vielerlei Hinsicht einv hoher Lebensstandard, dessen Definition aber insgesamt kritisch und differenziert betrachtet wer-den sollte, wie dies Doris Mührenberg eindringlich tut (Mührenberg 2008). So zeigen sich „Luxus und Lifestyle“ nicht nur an wertvollen Einzelobjekten, sondern ebenso an infrastrukturellen Verhältnissen und sozialen wie individuellen Lebensumständen. Sehr wohl ist also der „Reichtum“ auch innerhalb ei-nes bestimmten Befundes grundsätzlich zu hinterfra-gen und in Relation zu setzen zum archäologisch-his-torischen Gesamtbild einer Siedlung oder Stadt. Ein weiteres Kriterium für diesbezügliche Aussagen ist der jeweilige Untersuchungsstand, den eine Siedlung oder Stadt vorzuweisen hat. In dieser Hinsicht sind alle relevanten Grundlagen in der Hansestadt reich-lich vorhanden und zum großen Teil schon ausge-wertet. Zu recht spricht Manfred Gläser davon, dass „Lübeck inzwischen als eine der archäologisch am besten untersuchten mittelalterlichen Städte gelten kann“ (Gl�ser 1997, 207). Dank einer kontinuier-lichen Stadtarchäologie seit 1948 und vieler drittmit-telgeförderter Projekte sind Befund- wie Fundbasis so
groß, dass bereits vielfältige Erkenntnisse zur inner-städtischen Struktur und ihren Bewohnern gewon-nen werden konnten.
In Bezug auf die Fundkategorie Glas kann für Lü-beck festgestellt werden, dass „die Königin der Han-se“ im Vergleich zu weiteren europäischen Städten des 12. – 15. Jahrhunderts über eine außerordentlich große Vielfalt und Variabilität verfügt (Steppuhn i. V.). Dies zeigt sich nicht nur in einem sporadischen Einsetzen von Fensterverglasung im bürgerlichen Wohnbau bereits um 1200, sondern auch in der re-lativen Häufigkeit von Glasprodukten des 12./13. Jahrhunderts sowie an der sehr breiten Palette impor-tierter Glaswaren aus heimischer und mediterraner Produktion des 13. und 14. Jahrhunderts. Hier ist be-sonders interessant, dass sich sowohl im sakralen wie im profanen Bereich (z. B. Brunnen Johanniskloster vs. Brunnen Königstraße 32) ähnliche Handelswege und Vorlieben offenbaren. Die Gruppe der hier vor-gestellten sehr qualitätvollen Gläser mit absoluten Unikaten zeigt eindrucksvoll die wirtschaftliche Po-tenz der Stadt und lässt erahnen, welche Bedeutung Bürgertum und Kirche in Lübeck hatten.
Ausblick
204 Peter Steppuhn
Andelić 1975: P. Andelić, Un aperçu de la typologie du verre médiéval en Bosnie et en Herzegovine, in: Verre médiéval aux Balkans (Ve-XVe s.), Recueil des Travaux Conference Internationale Belgrade, 24–26 Avril 1974, Belgrad 1975, 167–182.
Bauer/Gabbert 1980: M. Bauer und G. Gabbert, Europäisches und außereuropäisches Glas, Museum für Kunsthandwerk Frankfurt am Main, Frankfurt² 1980.
Baumgartner 2005: E. Baumgartner, Glas des Mittelalters und der Renaissance. Die Sammlung Karl Amendt (= Ausstellungskatalog Finnisches Glasmuseum Riihimäki und museum kunst palast/ Glasmuseum Hentrich Düsseldorf), Düsseldorf 2005.
Baumgartner/Krueger 1988: E. Baumgartner und I. Krue ger, Phœ-nix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters (= Ausstellungskata-log Rheinisches Landesmuseum Bonn und Historisches Museum Basel), München 1988.
Bruckschen 2004: M. Bruckschen, Glasfunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Braunschweig. Bedeutung, Verwendung und Technologie von Hohlglas in Norddeutschland (= Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens 33), Rahden 2004.
Černá u. a. 2012: E. Černá, V. Hulínský, J. Macháček and J. Podliska, On the origin of enamel-painted glass of the 12–14th centuries in Bohemia, in: Annales du 18e congrès de l’Association Internati-onale pour l’Histoire du Verre (Thessaloniki 2009), Thessaloniki 2012, 401–408.
Carboni 1998: St. Carboni, Regorio’s Tale; or, of enamelled glass pro-duction in Venice, in: R. Ward (Hrsg.), Gilded and Enamelled Glass from the Middle East, London 1998, 101–106.
Carboni/Henderson 2005: S. Carboni und J. Henderson, Toward an Understanding of Nineteenth-Century Imitations of mam-lik Enamelled and Gilded Glass, in: Annales du 16e congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (London 2003), Nottingham 2005, 396 – 400.
Charleston 1976: R. J. Charleston, A 13th Century Syrian Glass Beaker Excavated in Lübeck – The Glass Beaker, in: O. Ahlers, A. Graßmann, W. Neugebauer und W. Schadendorf (Hrsg.), Lübeck 1226 – Reichsfreiheit und frühe Stadt, Lübeck 1976, 324–337.
Clark 1983: J. Clark, Medieval enamelled glasses from London, in: Medieval Archaeology 27, 1983, 152–156.
Dorigo 1997: W. Dorigo, Venedig vor Venedig: von Grado bis San Marco, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.), Venedig. Kunst & Architektur, Köln 1997, 33–79.
Dreier 1989: F. A. Dreier, Venezianische Gläser und ”Façon de Venise” (= Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin 12), Berlin 1989.
Dumitrache 1990: M. Dumitrache, Glasfunde des 13.–18. Jahrhun-derts aus der Lübecker Innenstadt, Grabungen 1948–1973, in: Lü-becker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 19, 1990, 7–161.
Falk 1992: A. Falk, Stadtarchäologie und Sachkulturforschung, in: Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte 2, 1992, 31– 47.
Foy/Sennequier 1989: D. Foy und G. Sennequier, A travers le verre du moyen age à la Renaissance (= Katalog zur Ausstellung in Rouen 1989), Nancy-Maxéville 1989.
Freestone/Bimson 1995: I. C. Freestone und M. Bimson, Early Vene-Early Vene-tian enemalling on glass: technology and origins, in: P. B. Vandiver u. a. (Hrsg.), Materials Research Society Symposium Proceedings 352, 1995, 415–431.
Freestone/Stapleton 1998: I. C. Freestone and C. P. Stapleton, Com-Com-position and technology of Islamic enamelled glass of the thirteenth and fourteenth centuries, in: Rachel Ward (Hrsg.), Gilded and Enamelled Glass from the Middle East, London 1998, 122–128.
Freestone u. a. 2008: I. C. Freestone, W. Gudenrath and C. Cart-Cart-
wright, Th e Hope Goblet Reconsidered. I. Technological Consid-, The Hope Goblet Reconsidered. I. Technological Consid-Technological Consid-erations, in: Journal of Glass Studies 50, 2008, 159–169.
Gl�ser 1989: M. Gläser, Archäologische und baugeschichtliche Un-tersuchungen im St. Johanniskloster zu Lübeck: Auswertung und Befunde, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturge-schichte 16, 1989, 9–120.
Gl�ser 1997: M. Gläser, Stand, Aufgaben und Perspektiven der Ar-chäologie in Lübeck, in: M. Gläser (Hrsg.), Die Infrastruktur (= Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IV), Lübeck 1997, 205–220.
Gl�ser 2004: M. Gläser, Die Infrastrukturen der Stadt Lübeck im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: M. Gläser (Hrsg.), Die Infrastruktur (= Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IV), Lübeck 2004, 173–196.
Freestone u. a. 2008: I. C. Freestone, W. Gudenrath and C. Cart-Cart-wright, Th e Hope Goblet Redonsidered I. Technological Consid-, The Hope Goblet Redonsidered I. Technological Consid-Consid-erations, in: Journal of Glass Studies 50, 2008, 159–178.
Gonnella 1997: J. Gonnella, Ein christlich-orientalisches Wohnhaus des 17. Jahrhunderts aus Aleppo (Syrien). Das „Aleppo-Zimmer“ im Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Mainz 1997.
Greiff 2012: S. Greiff, Von Glasmalern und Glasmachern. Herstellung römischer Emailgläser und ihre Weiterentwicklung bis zum Mittel-alter, in: L. Clemens und P. Steppuhn, Glasproduktion – Archäo-logie und Geschichte. Beiträge zum 4. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas, Trier 2012, 131–142.
Gudenrath 2006: W. Gudenrath, Enameled Glass Vessels, 1425 B.C.E–1800: The Decorating Process, in: Journal of Glass Studies 48, 2006, 23–70.
Haggrén 1997: G. Haggrén, Looking through Glass. Recent Glass Finds and Material Culture in Medieval Turku, Finland, in: Mate-rial Culture in medieval Europe (= Papers of the ”Medieval Brugge 1997” Conference 7), Zellik 1999, 353–360.
Haggrén 1999: G. Haggrén, Medieval glass fi nds from Turku, espe-Medieval glass finds from Turku, espe-cially from the Aboa Vetus excavations, in: R. Vissak und A. Mäe-salu (Hrsg.), The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology (= Proceedings of the first & second seminar, Tartu, Estonia, 6th–7th 1997 and 26th–27th June 1998), Tartu 1999, 65–73.
Haggrén/M�esalu 1999: G. Haggrén und A. Mäesalu, Cheers! Frag-ments from the Middle Ages. Glassvessels and Their Users in the Medieval North-Europe, Turku 1999.
Hasse 1981: M. Hasse, Neues Hausgerät, neue Häuser, neue Kleider – Eine Betrachtung der städtischen Kultur im 13. und 14. Jahrhun-dert sowie ein Katalog der metallenen Hausgeräte, in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 7, 1979 (1981), 7–83.
Hauschild 1999: S. Hauschild, Meister Bertrams Bestiarium, in: U. M. Schneede (Hrsg.), Goldgrund und Himmelslicht. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg. Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1999 112–117.
Henkes 1994: H. E. Henkes, Glas zonder glanz. Vijf eeuwen gebruiks-Vijf eeuwen gebruiks-glas uit de bodem van de Lage Landen 1300-1800, in: Rotterdam Papers 9, Den Haag 1994.
Hoššo 2003: J. Hoššo, Mittelalterliche und neuzeitliche Glasfunde aus der Slowakei – Stand der Forschung, in: S. Felgenhauer-Schmiedt, A. Eibner und H. Knittler, Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mit-teleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung (= Beiträ-ge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19/2003), Wien 2003, 91–106.
Hupe 2012: J. Hupe, Ausgewählte spätmittelalterliche und frühneuzeit-
Literatur
205Emailbemalte Gläser aus der Altstadt von Lübeck des 13./14. Jahrhunderts
liche Glasfundkomplexe aus dem Trierer Stadtgebiet, in: L. Cle-mens und P. Steppuhn (Hrsg.), Glasproduktion – Archäologie und Geschichte. Beiträge zum 4. Internationalen Symposium zur Er-forschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Eu-ropas, Trier 2012, 43–58.
Kahsnitz 1984: R. Kahsnitz, Formen mittelalterlicher Gläser, in: R. Kahsnitz und R. Brandl (Hrsg.), Aus dem Wirtshaus zum Wil-den Manne. Funde aus dem mittelalterlichen Nürnberg (= Ausstel-lungskatalog Nürnberg 1984), Nürnberg 1984, 38–55, 202–207.
Knapp 1999: U. Knapp, Guntbald-Evangeliar, in: U. Knapp und M. Stähli, Buch und Bild im Mittelalter. Dom-Museum, Hildesheim 1999.
König u. a. 2002: A. König, H.-G. Stephan und K. H. Wedepohl, Mittelalterliche Gläser aus Höxter (ca. 800 bis 1530). Archäologie, Chemie und Geschichte, in: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 23, 2002, 325–373.
Krueger 1984: I. Krueger, Mittelalterliches Glas aus dem Rheinland. Ein Glasfundkomplex mit emailbemaltem Becher der sog. syro-fränkischen Gruppe, in: Bonner Jahrbücher 184, 1984, 505–560.
Krueger 1996: I. Krueger, Research in medieval glass: Where are we standing now? In: Annales du 13e congrès de l’Association Interna-Interna-tionale pour l’Histoire du Verre (Niederlande 1995), Lochem 1996, 277–288.
Krueger 1998: I. Krueger, An enamelled beaker from Stralsund: a spectacular new find, in: R. Ward (Hrsg.), Gilded and Enamelled Glass from the Middle East, London 1998, 107–109.
Krueger 2002: I. Krueger, A Second Aldrevandin Beaker and an Up-date on a Group of Enameled Glasses, in: Journal of Glass Studies 44, 2002, 111–132.
Krueger 2003: I. Krueger, Emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhun-derts. Zum Stand der Forschung, in: S. Felgenhauer-Schmiedt, A. Eibner und H. Knittler, Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mittel-europas zur archäologisch-historischen Glasforschung (= Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19/2003), Wien 2003, 29–36.
Krueger 2005: I. Krueger, Magister Doninus und seine Vögel. Ein Glas-Neufund aus Mainz und was damit zusammenhängt, in: Mainzer Archäologische Zeitschrift 5/6, 1998/1999 (2005), 275–292.
Krueger 2008: I. Krueger, The Hope Goblet Reconsidered. II. An Art Historian’s View, in: Journal of Glass Studies 50, 2008, 171–178.
Lamm 1930: C. J. Lamm, Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbei-ten aus dem Nahen Osten (= Forschungen zur islamischen Kunst 5), Bd. I, Berlin 1930.
Lamm 1941: C. J. Lamm, Oriental glass of medieval date found in Swe-den and the early history of lustre-painting (= Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 50.1), Stock-holm 1941.
Lomartire 1999: S. Lomartire, Schrankenplatte mit Pfauen, in: C. Stiegemann und M. Wemhoff (Hrsg.), 799 – Kunst und Kultur der Karolingerzeit: Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn (Ausstellung der Stadt Paderborn, des Erzbistums Paderborn und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vom 23. Juli – 1. No-vember 1999), Band 1, Mainz 1999, 82–83.
M�esalu 1986: A. Mäesalu, Unikale Glasfunde aus Tartu, in: Proceed-Proceed-ings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR 35, 1986, 400–402.
M�esalu 1990: A. Mäesalu, Sechs Holzkonstruktionen in Tartu (Los-si-Straße), in: Eesti NSV teaduste akadeemia toimetised ükiskon-teaduste akadeemia toimetised ükiskon-nateadused 39, 1990, 446– 451.
M�esalu 1999: A. Mäesalu, Emailbemalte Glasbecher aus Tartu, in: R. Vissak und A. Mäesalu (Hrsg.), The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology (Proceedings of the first & se-
cond seminar, Tartu, Estonia, 6th–7th June 1997 and 26th–27th June 1998), Tartu 1999, 74–84.
Mangelsdorf 1999: G. Mangelsdorf, Glasbecher des späten 13. Jahr-hunderts mit Emailbemalung aus Greifswald, in: Archäologisches Korrespondenzblatt 29, 1999, 445–450.
Matiskainen 1998: H. Matiskainen, Rezension zu Carl Pause, Spät-mittelalterliche Glasfunde aus Venedig (Bonn 1996), in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 25/26, 1997/98 (1998), 228–229.
Medici 2008: T. Medici, A Medieval Enameled Beaker from Lisbon, in: Journal of Glass Studies 50, 2008, 316–318.
Möller 1994: G. Möller, Ein goldemailbemalter Glasbecher des frü-hen 14. Jahrhunderts aus der Altstadt von Stralsund, in: Jahrbuch Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 1993 (1994), 215–227.
Mührenberg 2008: D. Mührenberg, Luxus und Lifestyle im mittel-alterlichen Lübeck, in: M. Gläser (Hrsg.), Luxus und Lifestyle (= Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI), Lübeck 2008, 311–338.
Müller 1992: U. Müller, Ein Holzkeller aus dem späten 12. Jahrhun-dert: Erste Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen auf den Grundstücken Königstraße 70-74 in Lübeck. Mit einem Beitrag zu ausgewählten Glasfunden, in: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 22, Bonn 1992, 145–166.
Neugebauer 1964: W. Neugebauer, Ein syrisches Glas der Kreuzzugs-zeit in Lübeck, in: Lübeckische Blätter 12, 1964 (Sonderdruck ohne Seitenangaben).
Neugebauer 1976: W. Neugebauer, A 13th Century Syrian Glass Beak-Beak-er Excavated in Lübeck – Fundstelle und Funde, in: O. Ahlers, A. Graßmann, W. Neugebauer und W. Schadendorf (Hrsg.), Lübeck 1226 – Reichsfreiheit und frühe Stadt, Lübeck 1976, 321–323.
Nölke 1997: A. Nölke, Glasmalerei im Kleinformat: Ein emailbemal-ter Becher des Hochmittelalters aus Münstertal, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg 26, 1/1997, 17–22.
Oakeshott 1967: W. Oakeshott, Die Mosaiken von Rom vom 3. bis zum 14. Jahrhundert, Wien/München 1967.
Pause 1993: C. Pause, Mediterrane Importgläser im mittelalterlichen Göttingen, in: Göttinger Jahrbuch 41, 1993, 7–34.
Pause 1996 a: C. Pause, Spätmittelalterliche Glasfunde aus Venedig: Ein archäologischer Beitrag zur deutsch-venezianischen Handels-geschichte (= Universitätsschriften zur Prähisto rischen Archäologie 28), Bonn, 1996.
Pause 1996 b: C. Pause, Spätmittelalterliche Nuppenbecherdarstellun-gen – ein Interpretationsversuch, in: Archäologische Mitteilungen aus Norddeutschland, Beiheft 15 (= Realienforschung und Histori-sche Quellen), Oldenburg 1996, 189–199.
Pause/Steppuhn i. V.: C. Pause und P. Steppuhn, Ein spätmittelal-terlicher Fundkomplex mit qualitätvollen Importgläsern aus dem ehemaligen Johanniskloster in Lübeck (Manuskriptabgabe Juni 1998), in Vorbereitung für die Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte.
Reimbold 1983: E. T. Reimbold, Der Pfau. Mythologie und Symbolik, München 1983.
Schmidt/Schmidt 1984: H. Schmidt und M. Schmidt, Die vergessene Bildsprache christlicher Kunst, München³ 1984.
Stadler/Reitmaier 2003: H. Stadler und T. Reitmaier, Hohl- und Flachglasfunde aus mittelalterlichen Burgengrabungen in Tirol und Oberkärnten, in: S. Felgenhauer-Schmiedt, A. Eibner und H. Knittler, Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung (= Beiträge zur Mittelalt-erarchäologie in Österreich 19/2003), Wien 2003, 189–210.
Stephan 2012: H.-G. Stephan, Aspekte von Glasherstellung und Glas-gebrauch im 12./13. Jahrhundert in Mitteleuropa. Fächerübergrei-fende Forschungsperspektiven aus der Sicht der Archäologie, in:
206 Peter Steppuhn
H. Krohm und H. Kunde (Hrsg.), Der Naumburger Meister. Bild-hauer und Architekt im Europa der Kathedralen (= Schriftenreihe der vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatsstifts Zeitz 5), Bd. 3, 428–472.
Steppuhn 1993: P. Steppuhn, Ein islamisches Goldemailglas aus Lü-beck, Königstraße 32, in: M. Gläser, (Hrsg.), Archäologie im Han-seraum. Eine Festschrift für Günter P. Fehring (= Schriften des Kulturhistorischen Museums in Rostock 1), 1993, 479–484.
Steppuhn 1996: P. Steppuhn, Gold- und emailbemalte Gläser des 12. und 13. Jahrhunderts aus Norddeutschland, in: Annales du 13e congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Niederlande 1995), Lochem 1996, 319–331.
Steppuhn 1998: P. Steppuhn, Neues aus der Glasforschung, in: Ar-chäologie in Deutschland 1998, Heft 3, 51–52.
Steppuhn 2002 a: P. Steppuhn, Glasfunde des 11. bis 17. Jahrhunderts aus Schleswig, in: Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studi-en 16, Neumünster 2002.
Steppuhn 2002 b: P. Steppuhn, Ein außergewöhnlicher blauer Glasbe-cher, in: Fakten und Visionen. Die Lübecker Archäologie im letzten Jahrzehnt (= Archäologische Gesellschaft der Hansestadt Lübeck, Jahresschrift 4, 2000/2001), Lübeck 2002, 66–68.
Steppuhn 2003: P. Steppuhn, Ein wertvolles Glas aus dem Nahen Os-ten, in: M. Gläser und D. Mührenberg (Hrsg.), Weltkulturerbe Lü-beck. Ein Archäologischer Rundgang, Lübeck 2003, 86–87.
Steppuhn 2006: P. Steppuhn, Glas durch die Jahrtausende – Farben-froh und kreativ, in: Archäologie in Deutschland 6/2006, 32–36.
Steppuhn i. V.: P. Steppuhn, Mittelalterliche und frühneuzeitliche Glasfunde aus der Altstadt von Lübeck (Manuskriptabgabe März 1999), in Vorbereitung für die Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte.
Tait 1991: H. Tait (Hrsg.), Five Thousand Years of Glass, London 1991.Tomezzoli 1999: S. Tomezzoli, Trapezförmige Platte mit Pfau, in: C.
Stiegemann und M. Wemhoff (Hrsg.), 799 – Kunst und Kultur der Karolingerzeit: Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn (Ausstellung der Stadt Paderborn, des Erzbistums Paderborn und
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vom 23. Juli–1. No-vember 1999) Band 1, Mainz 1999, 82–83.
Tyson 2000: R. Tyson, Medieval glass vessels found in England c AD 1200–1500. (= Council for British Archaeology Research Report 121), York 2000.
Venegoni 2012: L. Venegoni, A Medieval Enameled Beaker from the Staryi Krym Area (Eastern Crimea, Ukraine), in: Journal of Glass Studies 54, 2012, 253–256.
Verità 1995: M. Verità, Analytical Investigation of European enam-Analytical Investigation of European enam-eled beakers of the 13th and 14th Centuries, in: Journal of Glass Studies 37, 1995, 83–98.
Verità 1998: M. Verità, Analyses of early enamelled Venetian glass: a comparison with Islamic glass, in: R. Ward (Hrsg.), Gilded and Enamelled Glass from the Middle East, London 1998, 129–134.
Wedepohl 1998: K. H. Wedepohl, Mittelalterliches Glas in Mitteleu-ropa: Zusammensetzung, Herstellung, Rohstoffe, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen II. Mathematisch-Physikalische Klasse, 1998, 3–56.
Whitehouse 2010: D. Whitehouse, Medieval Glass for Popes, Princes, and Peasants, with contributions by William Gudenrath and Karl Hans Wedepohl, Corning 2010.
Wilson 1985: D. M. Wilson, Der Teppich von Bayeux, Frankfurt Ber-lin 1985.
Zecchin 1987: L. Zecchin, Vetro e vetrai di Murano (= Studi sulla storia del vetro 1), Venezia 1987.
Zecchin 1990: L. Zecchin, Vetro e vetrai di Murano (= Studi sulla storia del vetro 3), Venezia 1990.
Peter SteppuhnGrabungsprojekt Gründungsviertel
c/o Bereich Archäologie und Denkmalpflegeder Hansestadt Lübeck
Meesenring 823566 Lübeck
Deutschland